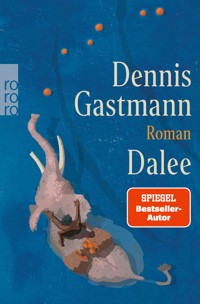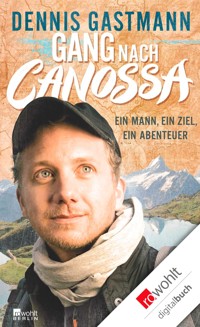9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rätsel, Regeln und Rituale – Dennis Gastmann macht sich auf, Japan zu erkunden, ein Land, das noch immer unvergleichlich fremd und geheimnisvoll wirkt. Dabei ist er nicht allein: Natsumi, seine Frau, die aus einer Samurai-Familie stammt, begleitet ihn. Die beiden bereisen den gesamten Inselstaat, von den grünen Gipfeln auf Hokkaidō bis zu den Vulkanen auf Kyūshū, sie pilgern in die Tempelstadt Nikkō und verlieren sich im Lichterrausch der Metropolen. Japan, wie es sich der Westen vorstellt, erlebt Gastmann im Neongewitter eines Tokyoter Roboterrestaurants. In einer Bar in Kagoshima wird er selbst als Fremder bestaunt: "Wir sitzen hier seit dreißig Jahren", erzählen ihm die Trinkenden, "und noch nie hat sich ein Gaijin hereingetraut." Schließlich, in den "sieben Höllen" von Beppu, das für seine heißen Quellen bekannt ist, sucht er nach Ruhe und begegnet einem ergrauten Herrn im Yukata, der plötzlich rauchend vor ihm sitzt. Ist er der Geist eines Samurai? Dennis Gastmanns Reiseerzählung ist das faszinierende Porträt eines Landes zwischen Anarchie und Ordnung, Besessenheit und Zen – und ein sehr persönliches Abenteuer: Kann ein "Gaijin", ein Fremder, eine Kultur verstehen, die ein Fremder gar nicht verstehen kann?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dennis Gastmann
Der vorletzte Samurai
Ein japanisches Abenteuer
Über dieses Buch
Dennis Gastmann entdeckt das Land der Rätsel, Regeln und Rituale: Japan. Die Jahrhunderte der Abschottung liegen weit zurück, und doch wirkt dieses Land bis heute unvergleichlich fremd und geheimnisvoll. Gastmann macht sich auf, es zu erkunden, und er ist nicht allein – seine Frau, die aus einer alten Samurai-Familie stammt, begleitet ihn. Die beiden bereisen den ganzen Inselstaat, von den Seen der Götter auf Hokkaido bis zu den Vulkanen auf Kyūshū, und verlieren sich im Lichterrausch von Tokyo, Kyoto und Osaka. Japan, wie es sich der Westen vorstellt, erlebt Gastmann im Neongewitter eines Roboterrestaurants. In den «Höllen» von Beppu dagegen, das für seine heißen Quellen bekannt ist, sehnt er sich nach Ruhe und begegnet dem Tod, der plötzlich rauchend vor ihm sitzt. Schließlich, auf dem Tempelberg Kōya-san, sucht er nach dem Sinn, um am Ende eines rastlosen Sommers doch noch in den Lotussitz zu finden.
Dennis Gastmanns Reiseerzählung ist das faszinierende Porträt eines Landes zwischen Ordnung und Anarchie, Besessenheit und Zen – und ein sehr persönliches Abenteuer: Kann ein «Gaijin», ein Fremder, eine Kultur verstehen, die ein Fremder gar nicht verstehen kann?
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Berlin Verlag GmbH, Berlin
Karte Peter Palm, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung Ira Block/Getty Images
ISBN 978-3-644-10030-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für das Kind des Sommers
Komm, lass uns gehen
Schnee schauen, Sake trinken
Taumeln wie Flocken
Matsuo Bashō (1644 bis 1694)
Das Haus der knienden Frauen
Tokyo
Langsam, ganz langsam wogten die Laternen im Abendwind, als sich ein zierliches Wesen vor uns verneigte. Es wartete auf dem Gehweg und wies nickend auf eine Stiege, die hinauf in einen Pagodenbau führte. Äußerlich, inmitten all der Wohntürme, die ihn überragten, war er mir klein vorgekommen wie ein Teehaus. In seinem Inneren aber wollte er nicht enden. Verwinkelt und verwunschen, schien er neunundneunzig Zimmer in sich zu bergen, eines wie das andere verschlossen, als hüteten sie Geheimnisse. Ihre Türen waren bloß aus Papier, und doch konnte ich dahinter nur Schatten erkennen.
In jedem Winkel, auf jedem Gang und an der Schwelle jeder Kammer knieten Frauen. Sie trugen Kimonos und waren in gleicher Weise gealtert wie ihr Lokal, das so mancher, trotz seiner wächsernen Aura und der Wasserflecken an den Decken, zu den edelsten des Landes zählte. Das Dekor beschränkte sich auf ein Gesteck im Entree und eine Tuschezeichnung an einem Nagel darüber, die nichts weiter zeigte als einen Apfel, rot wie ein Tropfen Blut auf einer Trauerkarte. Wie ausgesucht dieser Ort war, verrieten die Mienen der Bediensteten, die zwar den Blick vor uns senkten, es aber mit einer solchen Klasse taten, dass sie dabei nicht geringer wirkten.
Der einzige Herr unter ihnen, nahezu ein Greis, krümmte sich vor einer Kommode und legte unsere Schuhe hinein, als seien sie aus Kristall. So schritten wir auf Strümpfen durch das Reich der Kauernden, die mit jedem Meter, den wir gingen, und mit jeder Biegung, die sich zwischen Reisstroh, Holz und Sandputz bahnte, um weitere Jahre reiften. Es war, als würde das Haar der Frauen von Flur zu Flur an Schwärze verlieren. Ihre Brauen zogen sich zu Fäden zusammen, und über ihre Züge legte sich ein milchiger Schleier, blass und bleich wie eine Maske.
Die wohl Betagteste lugte aus dem Dunkel eines Spalts hervor. Sie saß buchstäblich in der Wand, ganz am Ende eines Korridors. Weil ihre Finger damit beschäftigt waren, Scheine zu zählen, und ihre Pupillen indes über eine Liste mit Zahlen und Schriftzeichen wanderten, senkte sich ihr Kinn eher beiläufig, als wir sie passierten. Unser Pfad bog nun nach rechts und abermals nach links, wo sich zwei Damen aus der Hocke erhoben. Sie legten die Aderhände an eine Schiebetür, fuhren sie sachte beiseite und ahnten wohl nicht, wie oft ich mir diesen Moment in Gedanken vorgestellt hatte.
Vier Sommer und vier Winter war ich nun mit Natsumi zusammen. Vier Jahre, in denen sie mir von ihren Verwandten in Japan erzählt hatte. Von Cousinen aus Kyoto, der Stadt der Kaiser, und Cousins aus Osaka, der Stadt der Lichter. Von einer wunderlichen Lieblingstante aus Kōbe, die seit Jahrzehnten unsere Sprache lerne und bisher kein einziges Wort herausgebracht habe – außer der Vokabel «Entenfamilie». Von dem einstigen Herrenhaus ihrer Vorfahren, das mit jeder Erwähnung größer wurde, und von all den Dienern, die dort einmal gearbeitet hätten, einige in den Gemächern, andere in den Gärten.
Natsumi stammt aus der Linie eines Samurai, und er scheint stets an ihrer Seite zu wandeln. Sie mag zerbrechlich wirken, aber ich habe sie nie weinen sehen. Eine Kriegerin verliert keine Tränen, und sollte es dennoch geschehen, dann nur im Stillen. Mir ist, als habe sie drei Gesichter: Eines zeigt sie der Welt, das zweite zeigt sie mir, und das dritte sieht nur sie selbst, im Wandspiegel, wenn die Tür hinter ihr verriegelt ist und keine Seele stört. Natsumis Mutter ist Japanerin, ihr Vater kommt vom Bodensee, und die ersten Takte ihres Lebens spielten hier, in Tokyo, umschwirrt von dreißig Millionen Stimmen. Ironisch aber, wie das Leben ist, lotste es ihre Eltern bald an den Deich. So war Natsumi zur Melodie des Alten Landes groß geworden, jenseits der Elbe. Dort, wo die Backsteinhöfe reetgedeckt sind und das Tageblatt hin und wieder neugierig um ein Foto bat, wenn ein Verwandter aus dem ach so fernen Osten zu Besuch war.
In Japan nennt man sie hāfu, eine Halbe, und auch ich hatte immer das Gefühl, sie nur zur Hälfte zu kennen. Morgens, wenn ich gebannt zusah, wie sie ein Rührei mit Stäbchen quirlte, und fragte, ob es nicht an der Zeit sei, in ihre zweite Heimat zu reisen, zögerte sie. Sicher, wir könnten fliegen, sagte sie dann. Aber vermutlich würden uns ihre Angehörigen nicht empfangen. Nicht gemeinsam. Nicht ohne Ring. Eine japanische Familie sei etwas Intimes, so verletzlich wie ein Herz, und wer lässt schon gern jemanden in sein Innerstes, der nicht bleibt?
Nun war es so weit. Wir hatten vor vierzehn Tagen geheiratet, an einem 4. Juni, und in den kommenden viereinhalb Wochen standen uns vier Zusammenkünfte mit vier Zweigen der Verwandtschaft bevor, um unsere Hochzeit nachzufeiern. Vier Jahre hatte mich Natsumi darauf vorbereitet, und doch war mir so, als wüsste ich gar nichts über dieses Land. Ich wusste aber, dass die Vier im japanischen Aberglauben für den Tod steht, und wenn er irgendwo auf dieser Welt zu Hause war, dann wohnte er hier, in diesem Lokal.
Als sich die Schiebetür öffnete, schnellten die Leute dahinter von ihren halbhohen Stühlen auf. Japanisches, gesittetes Chaos: Es ist laut und exzentrisch, doch so rasch es anschwillt, beruhigt es sich auch wieder. Es wirkt konfus, aber wer sich mitten hineinbegibt, stellt fest, dass es einer inneren Ordnung folgt. Unsichtbare Fäden zogen mich durch das papierene, gedämpft beleuchtete Separee wie eine Figur in einem sorgsam einstudierten Schattenspiel. Natsumi dirigierte mich von Person zu Person, sie fragte, antwortete, scherzte für mich, und hin und wieder streute ich ein Hajimemashite ein – «Schön, Sie kennenzulernen» –, womit mein Repertoire weitgehend erschöpft war. Ich hatte mir vor dem Abflug einige Floskeln parat gelegt, doch sie reichten leidlich, um das Essen zu loben und später nach dem Weg um die Ecke zu fragen, wenn es mir auch wenig half, weil ich die Antwort nicht verstand.
Natsumi war ohnehin dagegen, dass ich Japanisch lernte. Es sei ihre Geheimsprache, hatte sie mich einmal wissen lassen. Darin kläre sie die wirklich wichtigen Dinge mit ihrer Mutter, die sonst niemanden etwas angingen. Gelegentlich führte das zu Situationen, in denen ich merkwürdig apathisch neben den beiden saß und ein Schulterzucken mit ihrem Vater teilte, der nur reagierte, wenn sie ihn wieder Hage-san nannten, Herrn Glatzkopf – obwohl er doch noch einige Haare besaß, dichtere an den Seiten, dünnere oben auf dem Haupt. Es war keine Frage, dass sich die Frauen über uns lustig machten, und dennoch liebte ich es, wenn Natsumi Japanisch redete. Dann sprach sie plötzlich mit einer anderen, zarteren Stimme, in einem fremden, aber süßen Ton und einer ungewohnten, viel helleren Lage. In diesen Augenblicken erlebte ich sie neu, und hier, umringt von ihren Verwandten, war es noch mehr als das. Es fühlte sich an, als würde ich sie zurück in das Element geben, in dem sie atmen konnte. Mi bedeutet Schönheit, und natsu steht für den japanischen Sommer, der für uns in diesem engen, fensterlosen Zimmer begann.
Natsumi machte mich zunächst mit einer Dame bekannt, die sich so sehr darüber zu freuen schien, dass unter ihrer feinen, pergamentenen Haut ein bläuliches Äderchen hervortrat. Es zeichnete sich für Sekunden auf ihrer Schläfe ab, um dann, wie auf Kommando, wieder zu verschwinden. Sie war allein zu diesem Treffen erschienen, denn ihr Ehemann, Natsumis Onkel, war vor einiger Zeit verschieden, lange bevor die Psychologie den Begriff «Burnout» entdeckte. Er hatte sich so sehr der Arbeit hingegeben, dass sie ihn eines Tages mit Haut und Haaren verschlang. Der Onkel sei in seinem Unternehmen rasant aufgestiegen, hatte Natsumi erzählt, bis in die Dependance in New York. Seine Dienstreisen führten ihn sogar ab und an nach Europa, doch nie habe er Zeit gefunden, die Angehörigen dort zu treffen. Bis auf ein einziges Mal, wenige Wochen bevor er im Lift der Firmenzentrale einen Schlaganfall erlitt. Dieser erste und letzte Besuch sei wie ein Abschied gewesen, und vielleicht sah mancher darin ein Zeichen des Schicksals.
Der Verstorbene hatte einen Sohn hinterlassen, der sich mit Frau und Kind zu unserer Linken setzte. Natsumis Cousin legte sein Jackett nicht ab, obwohl die Sonne stundenlang auf dem Dach gebrannt haben musste und der gebrechliche Luftumwälzer, der müde in den Raum atmete, kaum Milderung brachte. Er arbeitete in einem Großkonzern, der weltweit mit Ramennudeln handelte und ihn heute nur entbehren konnte, weil Samstag war. Ansonsten gewähre man ihm vier freie Tage im Jahr, übersetzte Natsumi, und er schien diese wenigen Stunden ohne Klage hinzunehmen. In der Firma habe jeder seinen Platz, und wenn er fehle, wisse niemand, wie seine Tätigkeiten zu erledigen seien. «Es gibt keine Vertretung für mich», sagte er und tippte sich mit einem Finger auf die Nase, ganz leicht, als sei es ihm unangenehm, so viel über sich selbst zu reden. «Letztes Jahr sind wir aber verreist», deutete er auf seine Gattin, die vor dem Lokal auf uns gewartet hatte, und seinen Sohn, der gerade am Kopfende des Tisches ein liebevoll verschnürtes Päckchen öffnete. Drei Tage Bali an einem verlängerten Wochenende.
Bei grünem Tee und einer Auswahl an Wachskürbis, Ziermais und gesalzenen, unreifen Sojabohnen begannen wir ein Gespräch unter Männern. Es brauchte jedoch weibliche Fürsorge, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass ich der Einzige von uns beiden war, der redete. Was Natsumi meinte, dämmerte mir, als ich den Augenkontakt zu ihrem Cousin für ein Nippen an der Tasse löste und mich seiner Schwester zuwandte, die uns gegenübersaß. Der Cousin nutzte die Chance, das Separee unauffällig zu verlassen, um das Bad aufzusuchen oder zu rauchen. Wer sollte denn ahnen, dass er zwar Jahre in Manhattan verbracht hatte, aber dennoch kaum Englisch verstand? Die Schwester hingegen, Natsumis Cousine, zeigte sich redefreudiger. Sie hatte in London studiert und war in der Niederlassung eines amerikanischen Pharmakonzerns angestellt, der ihr immerhin einen fünften Urlaubstag gönnte. «Unsere Arbeitsverhältnisse passen sich immer mehr dem Westen an», sagte sie, beinahe entschuldigend. Es tue sich etwas in Japan. «Man darf auch nicht vergessen, dass es hier wesentlich mehr Feiertage gibt als im Westen.»
Während eine der beiden Bedienungen links von mir unter den Tisch kroch, wo sie versuchte, den Schlauch eines Gaskochers mit einem Anschluss über der Fußleiste zu verbinden, rang ich mit mir selbst. Ob es wohl auch angebracht war zu erwähnen, womit ich mein Geld verdiente? Das Reisen? Das Abenteuer? «Flieg um die Welt», hatte Natsumi immer gesagt, «verschwinde, solange wir keine Kinder haben!», und wie oft war ich allein in eine Maschine gestiegen, um ohne Kopf wieder herauszufallen, die Gangway hinab, in einen Bus, eine Bahn, ein Taxi, ein Hotel und bloß in ein Bett. Hundertmal hatte ich danach wach gelegen, hundert Vorhänge beiseitegeschoben und in das erste Kapitel einer ungeschriebenen Geschichte geblickt. Die tausend Vögel über den Dächern von Taschkent. Der Bananenmond über dem Berg, der in der Südsee trieb. Die Dschinn, die über das Grüne Meer kamen und durch die Wüste Arabiens irrlichterten, auf der Jagd nach einem Beduinenkind. Doch seit ich Natsumi kannte, tat es plötzlich weh, unterwegs zu sein. Keines der Erlebnisse konnte das ersetzen, was mir fehlte.
Nun reisten wir endlich vereint. Natsumi hatte Japan viel zu lange vermisst. Sie freute sich auf den Lichterrausch der Metropolen, doch es zog sie auch an Orte, die nicht vom Neon beschienen werden. Zum ersten Mal hatte sie Gelegenheit, das Land ihrer Mutter ausgiebig zu erkunden, von Hokkaidō im Norden bis zur Vulkaninsel Kyūshū ganz im Süden. Ich selbst kannte das Nachtleben von Tokyo, aber nicht viel mehr. Eine ganze Weile bevor ich Natsumi begegnet war, hatte man mich für eine Story hierhergeschickt, und diese Tage ließen mich damals genauso verstört wie verzaubert zurück. Auf der einhundertundersten Reise erwartete mich ein Land wie ein Rätsel, so fremd und doch, auf eine Weise, anziehend wie kein zweites.
«Nein, nein», das mit der Schriftstellerei sei nicht wichtig, solange sich keiner der Angehörigen danach erkundige, gab mir Natsumi zu verstehen, und um es vorwegzunehmen: Niemand schien mehr darüber wissen zu wollen, denn in der Neugier liegt auch etwas Obszönes. Nur das Söhnchen am Tischende quälte sich mit einer Frage, die man mir schließlich übersetzte. Der Junge hatte einen kleinen Globus geschenkt bekommen und erfahren, dass ich auf der Rückseite der Erdkugel wohne. Dort, wo die Sonne, die in Japan geboren wird, untergeht.
«Was macht ihr denn so in eurem Land?», wunderte er sich, und als das Kichern nachließ, das er mit diesem weitreichenden Interesse ausgelöst hatte, sagte ich mir: Wir arbeiten, wir essen, wir warten auf den Sommer, der niemals kommt. Ich sprach es nicht aus, weil es genauso obszön wäre, die eigene Heimat schlechtzureden. «Was machst dudenn so in deinem Land?», gab ich zurück, und der Fünfjährige zögerte nicht lange. Er hob seine Händchen hoch über den Kopf, bis seine Arme einen Kreis bildeten. «Ballett», erklärte die Mutter, «Daichi tanzt Ballett.» Der Junge sei noch etwas zu zart für Fuß- oder Baseball, sagte sie, und bald darauf hielt ich ein Foto in Händen, das den grinsenden, Strumpfhosen tragenden Daichi tatsächlich im Grand Plié zeigte.
Während das Bild durch die Reihen wanderte, überlegte ich, ob sich unsere Sitzordnung ergeben hatte oder von langer Hand geplant worden war. Was wurde auf dieser Seite der Welt überhaupt dem Zufall überlassen? In Natsumis Familie zumindest nichts, und so waren wir in einem diplomatischen Corps angereist. Ihre Eltern begleiteten unsere Flitterwochen wie Delegierte. Die zwei waren am selben Junitag in die Lüfte gestiegen wie wir, im selben Wind, der über dieselbe Rollbahn strich, aber in einem anderen Flugzeug, und so hatten sie Tokyo wenige Stunden nach uns erreicht. Unter keinen Umständen mochte Natsumis Mutter Seite an Seite mit uns abheben, um dann Hand in Hand abzustürzen. Murphys Gesetz wäre keines, wenn es nicht hin und wieder richtigläge, und im misslichsten Falle hätte das Schicksal eine ganze Sippenlinie ausgelöscht.
Das mag eigenartig klingen, und so ging es weiter. Obwohl wir in Tokyo unter einem Dach wohnten, waren wir den Eltern bis vor diesem Abend noch nicht begegnet. Kein einziges Mal, seit wir Fuß auf japanischen Boden gesetzt hatten. Es war gespenstisch. Wir wussten zwar, dass sie ihr Zimmer nur wenige Stockwerke unter uns bezogen hatten, aber wir hörten und sahen nichts von ihnen. Wollten sie sich höflich in Zurückhaltung üben? Eher hatte ihnen Natsumi die Grenzen aufgezeigt, als sie herausfinden musste, dass die beiden ein und dasselbe Hotel gebucht hatten. Aus «logistischen Gründen», wie die Mutter sagte.
Meine japanische Schwiegermutter heißt Katsumi, die Schönheit des Sieges. Ein Attribut, das man ihr vermutlich aus Trotz gegeben hat, Jahre nach der Kapitulation des Kaiserreichs. Es scheint sie zu verfolgen. Als sie nach Deutschland kam, um die Sprache zu studieren, begegnete sie bald einem älteren Herrn, der sie wie eine Verbündete aus Achsenzeiten begrüßte. «Und nächstes Mal ziehen wir ohne die Italiener in den Krieg!», rief er. Vermutlich hat Katsumi-san in jener Minute höflich gelächelt und innerlich den Lockenkopf geschüttelt. Was auch geschah, ich habe sie immer freundlich erlebt. Liebenswert freundlich. Freundlich verlegen. Überschwänglich freundlich. Katsumi-san kann summend und tanzend auf ihren Pantoffeln zwischen Küche und Esszimmer hin- und hersausen und den Tisch über und über mit Wundern bedecken. «Tabe, tabe!», ruft sie dann, «iss, iss!», um danach freundlich süffisant zu erklären, dass der, der zu viel isst und trinkt, früher stirbt. Sie kann aber genauso in freundlicher Zurückhaltung lauern und, wenn es nötig ist, freundliche Worte wie giftige Pfeile verschießen. Ihr deutscher Ehemann hingegen wirkt, als habe er sich ganz dem Zen-Buddhismus verschrieben. Er lässt die Dinge geschehen und zieht sich dann und wann in sein Zauberzimmer zurück, einen heimeligen Raum voller Bücher, die ihn in die Ferne reisen lassen. Manchmal sehe ich in den beiden eine ältere Version von Natsumi und mir.
Unserem Abend war so mancher Brief und so manches Telefonat zwischen den Kontinenten vorausgegangen. Meine Schwiegermutter hatte das Hotel kontaktiert und um ein Zimmer gebeten, das so weit wie möglich von unserem entfernt lag. Vor allem aber tauschte sie sich mit den Verwandten über Essgewohnheiten, Intoleranzen und Allergien aus. Die Wahl fiel letztlich auf dieses Restaurant, weil es für sein Sukiyaki bekannt ist, eine so einfache wie traditionelle Delikatesse der japanischen Küche. Den Westlern zuliebe entschied man sich gegen ein klassisches Tatamizimmer, in dem wir uns auf gebundene Matten aus Stroh gekniet und irgendwann unsere Gelenke verflucht hätten. So kam ich zu dem Schluss, dass auch die Sitzordnung wohlüberlegt sein musste. Sicher doch, nickte Katsumi-san, ohne preiszugeben, ob sie es ernst meinte oder nicht. Unsere Tafel sei nach Rang, Alter und Zunge geordnet: die Silberlocken am Kopfende, die Jüngeren und Jüngsten ganz außen und wir, das Brautpaar, in der Mitte, umgeben von Personen, mit denen wir mindestens eine Sprache teilten.
Sukiyaki allerdings ist ein heimtückisches Gericht für einen Abend, der unter einer gewissen Spannung steht. Zwar war das magere, hauchdünn filetierte Rind durchaus zart, doch konnte es fordernd sein, eines der dreißig Zentimeter langen Stücke aus einer Schale an den Mund zu führen, flink und sauber abzubeißen, es gleichzeitig mit den Stäbchen festzuhalten und elegant zurück in das rohe, verrührte Ei zu legen, in dem das Fleisch lediglich mit drei Zwiebeln badete. Ich sorgte mich, mein Hemd oder die papierenen Wände zu ruinieren, dachte dabei aber weniger an die Familie, sondern vor allem an die beiden Frauen, die stoisch an unserer Tafel knieten. Waren es Kellnerinnen? Waren es Köchinnen? Das hohe Zeremoniell, mit dem sie das Fleisch für Sekunden in siedendem Wasser brühten, um es wiegend abtropfen zu lassen und in derselben Bewegung zu servieren, erhob das Kochen zu einer Performance und sie selbst zu Künstlerinnen. «Wünschen Sie, dass ich im nächsten Gang etwas ändere?», ließ eine von ihnen fragen. Meine Reaktion nahm sie mit einer hochgezogenen Braue zur Kenntnis, und ich überlegte, ob ich sie mit meiner Bitte nach etwas Schärfe beleidigt hatte.
Katsumi-san, die Schönheit des Sieges, gab sich weit weniger schüchtern. Angesichts der Preise in diesem Laden sei das Essen doch eher mā-mā desu, urteilte sie, durchschnittlich. Man bezahle wohl in erster Linie für die steinalten Weiber im Kimono, kommentierte sie, als die beiden das Separee verlassen hatten, um die Nachspeise vorzubereiten. Niemand wollte widersprechen.
«Weißt du, wir haben eine sehr ungewöhnliche Tante», lachte die Cousine, «weil sie sagt, was sie denkt. Ist sie in Deutschland auch so witzig?»
«Katsumi-san, warum tragt ihr eigentlich keinen Ehering?», warf der Cousin ein, und sie höhnte, dass sie sich mit so einem Ding wie ein Hund am Halsband fühlen würde. Zu unser aller Erstaunen fiel auch ihrem Mann eine Erklärung ein, obwohl er doch angeblich genauso wenig von der Landessprache verstand wie ich. Er verlor nur drei kleine Worte, okane ga nai, doch die genügten anscheinend, um eine Pointe zu landen.
«Was hat er gesagt?», fragte ich Natsumi.
«Kein Geld», übersetzte sie.
«Also dafür, dass du kein Japanisch sprichst», flachste der Cousin, «hast du deine Antwort erstklassig auf den Punkt gebracht.»
Wie könnte ich die Runde vergessen, die sich nach dem Dessert um unsere Hochzeitsfotos scharte. Die Blicke der Verwandten schwirrten über die Abzüge wie Lichter über die Tanzfläche. Unsere Bilder wirkten auf sie so fremd, dass nun unversehens hundert Fragen aufkamen: Wer ist deine Mutter, wer ist dein Vater, was hat deine Großmutter so jung gehalten, und weißt du eigentlich, dass alles an eurem Fest so sehr an Downton Abbey erinnert? Währenddessen achtete Katsumi-san darauf, dass die Angehörigen keine der Aufnahmen zu sehen bekamen, auf denen ich ihre Tochter küsste. In einer Kultur, die sich körperlos begegnet, kann schon eine gehaltene Hand zu viel sein, selbst in der Intimität eines Trauzimmers.
Vier Stunden waren verflogen, und wenn ich mich recht erinnere, hatten die Dienerinnen vier Gänge in vier verschiedenen Schalen und Schälchen serviert. Ich war in dieses Land gekommen, um ein wenig mehr von ihm zu verstehen, und die erste Lektion besagte, dass die Vier nicht immer nur Tod und Verderben bringen muss. Sie kann auch großes Glück bedeuten. In einem Zimmer ohne Tageslicht, ohne jedes Gefühl für die Zeit, hatten wir die äußere Welt verlassen und eine zweite, innigere betreten. Während Katsumi-san und die Witwe das Separee verließen und gleich hinter der Papiertür nach alter Sitte lautstark darum stritten, wer die Rechnung begleichen würde, besiegelten wir das Treffen mit guten Gaben. Wir reichten Kaffeebohnen aus Hamburg, Marzipan aus Lübeck, gedörrte Apfelscheiben aus Hollern-Twielenfleth im Alten Land und einiges mehr, um dann viel zu viel von der anderen Seite zu empfangen.
Der Cousin legte auf diese Tradition besonderen Wert. Obwohl er mich kaum kannte, beugte er sich weit über die Tafel, um mir eines seiner Geschenke persönlich zu übergeben. Er fixierte mich durch seine Brille, schloss die Lider und verließ sich ganz auf den Eindruck der Schachtel, deren Äußeres so kostbar erschien, dass ich sie kaum berühren mochte. Manche Aufmerksamkeiten sind stärker als jedes Wort. Man nimmt sie mit beiden Händen entgegen, bedankt sich für die Geste, gern dankt man ein zweites oder drittes Mal, um sie dann einfach wirken zu lassen. Verpackt, verhüllt und kunstvoll umwickelt, versinken die Präsente in den Taschen, um jegliche Irritation zu vermeiden, einen Wertevergleich, eine ungebührliche Freude oder ein geheucheltes Lächeln. Wie hätte der Cousin dagestanden, hätte mir sein Geschenk nicht gefallen?
Auf dem Straßenpflaster wetteiferten wir um die tiefste Verbeugung, der Abend leuchtete orangerot, und ich wollte all die Leute umarmen – doch zu viel westliche Nähe hätte das Treffen wohl ruiniert. Sie blieben so lange vor dem Eingang des Lokals stehen, bis wir um die Häuserecke gebogen waren, und immer wenn ich mich nach ihnen umsah, verneigten sie sich erneut in der Ferne.
Die Päckchen öffneten wir noch in derselben Nacht, und jedes von ihnen hütete einen Schatz. Im ersten fand sich ein Rahmen mit goldenen Beschlägen. Das zweite enthielt lackierte Essstäbchen und dreieckige, perlmuttbesetzte Stäbchenhalter mit porzellanweißen Spitzen, die an die schneebedeckte Kuppe des Fuji-san erinnerten. Das Dritte brachte ein Schmuckkästchen zum Vorschein, und als ich den Deckel hob, ließ es dasselbe Lied erklingen, das gerade in meinem Inneren spielte.
«Ist gut», sagte Natsumi, «jetzt kannst du das Ding auch langsam wieder zuklappen.»
Roboto, Roboto
Im Taumel der Millionenstadt
Ich würde nicht sagen, dass ich neben mir stand, als ich tags darauf nicht mehr wollte. Neben mir war gar kein Platz. Es fühlte sich eher so an, als würde ich in einer düsteren Wolke über mir schweben, und nun blickte ich auf mich selbst, wie ich mitten im belebtesten Bahnhof der Welt stehen blieb und dem Leben seinen Lauf ließ – möge es doch bitte ohne mich weiterrennen. Die Vernunft setzte aus, und ein Trotz, der lange überwunden schien, setzte wieder ein. Ich war es leid, durch fiebrige Metrostationen zu hetzen, die bei jedem Umsteigen enger wirkten, brütend wie Heizungsschächte. Immer stur den Kolonnen nach, links, rechts, den Pfeilen auf den Treppenstufen folgen, auf, ab, den Wegweisern an den Decken gehorchen, rechts, links, Tempo, Tempo, bis zum Tilt.
Das Leben zeigte sich davon wenig beeindruckt. War ich eben noch mitgeschwommen, so teilten sich die Ströme jetzt und flossen um mich herum. Wobei ich mir nicht sicher war, ob sie sich von allein bewegten oder von etwas anderem gelenkt wurden – die Gesichter, die vorbeiwischten, die Mundschutzmasken, die Halbarmhemden, die Bügelfalten, die knielangen Röcke, die klackernden schwarzen Lederabsätze. Zehntausend Zehen wechseln im Bahnhof Shinjuku den Zug, pro Sekunde, hunderttausend Herzen schlagen in ihm, jede Stunde, und bei all den Seelen, die ihn an diesem Tag durchgeisterten, und all den Lungen, die seine Luft atmeten, war Shinjuku längst selbst zum Leben erwacht. Wie ein Muskel pumpte er die Körper und Körperchen in Adern und Kapillaren, hinein in seine Kammern, hinaus in einen endlosen Kreislauf, Runde für Runde dasselbe Spiel.
Das Tokyoter Schienennetz ist verwickelt und verschlungen und von einem wie mir, der an seinem Jetlag litt, schwer zu entwirren. Die moosgrüne Chiyoda-Linie sollte nicht mit der blattgrünen Shinjuku-Linie oder der maigrünen Namboku-Linie verwechselt werden. Schon gar nicht mit der pfefferminzgrünen Rinkai-Linie eines zweiten, konkurrierenden Bahnunternehmens. Manche Züge halten nicht an jeder Station, andere schon vor dem Ende der Strecke, wieder andere gehorchen einem dritten Anbieter, das heißt: Raus aus der Ticketzone, durch die Schranke, rüber in ein weiteres Labyrinth, durch eine zweite Schranke und hinein in die nächste feuchtwarme Halle der fliegenden Füße.
Sich da ziellos treiben zu lassen ist eine genauso schlechte Idee, wie einfach stillzustehen, durchzuatmen und zu meinen, man sei ein Individuum. «Du merkst schon, dass du den Leuten im Weg bist?» Natsumi griff nach meinem Arm und zog mich beherzt zurück in den Fluss. Sie verfügt über eine Gelassenheit, die mir ganz und gar fehlt, und mit dieser stoischen Ruhe bewegte sie sich durch die Massen, als würde sie durch die verdammte Matrix gleiten. Was blieb mir da anderes übrig, als am Zipfel ihres Sommerkleids zu hängen, auch wenn ich mir unser japanisches Abenteuer anders vorgestellt hatte. Man könnte es demütigend nennen, doch sagen wir besser, es war eine erdende Erfahrung für jemanden, der jahrelang um die Welt gereist ist. Ich war zu Fuß über die Alpen marschiert, hatte mit Haien getaucht und den entsetzlichsten Taifun erlebt, der je über die Insel Taiwan hinweggefegt war. Nun aber nützte mir das alles nichts. Ich musste mir eingestehen, dass es nur Zeit kostete, wenn ich versuchte, unseren Weg wie ein Desperado zu finden, und Zeit hatten wir nicht.
Zwar stand uns ein ganzer Monat in Japan bevor, doch Natsumi hatte uns um acht in der Frühe wecken lassen. «Wir sind nicht hierhergekommen, um zu schlafen, Honeymoon hin oder her», sagte sie und zog mir die Bettdecke weg. Obendrein hätten wir in Tokyo noch nichts erlebt, nichts außer einer erschöpfenden Sitzung mit ihren Verwandten. Da mochte sie recht haben, aber acht war bedauerlicherweise exakt die Stunde, zu der ich überhaupt erst in den Schlaf fand. Davor hatte ich auf der Bettkante gesessen und durch unser Hotelfenster auf eine Stadt geblickt, die vor keinem Horizont haltmachte und im Takt roter und silberner Nachtlichter funkelte.
Um den Jetlag zu besiegen, soll man möglichst breit in die Sonne grinsen. Mein Medizinmann hat mir dazu geraten. Wenn es um Endorphine gehe, sagte er einmal, sei keine andere Hautpartie so spendabel wie das Zahnfleisch. Die Glückshormone würden in Windeseile ausgeschüttet und aus der Mundhöhle direkt ins Hirn geschossen. Tokyo zu entdecken bedeutet jedoch, kreuz und quer durch ein Reich aus Schatten zu kriechen und den Himmel zu vermissen. Dabei verging mir allmählich das Lachen. Weil ich unsere Ehe aber nicht schon in den ersten Tagen riskieren wollte, folgte ich meiner Reiseleiterin artig durch die Unterwelt. Und wenn sie mal wieder irgendwen in der Geheimsprache dieses Landes um Auskunft bat – einen Polizisten, eine Krapfenverkäuferin, einen Prospektverteiler im Pandakostüm –, war ich derjenige, der einen halben Meter hinter ihr blieb und wenigstens versuchte, ein gefälliges Gesicht zu ziehen.
Natsumi war sich für diese Art der Navigation nicht zu schade. Unsere wenigen Tage in dieser Stadt erschienen ihr viel zu wertvoll, um sie mit Eitelkeiten zu verschwenden. So ist sie, und so verliebte ich mich in sie. Wir waren gerade ein Paar geworden, da lief ich einem Handleser über den Weg, der ein leichtes Opfer in mir fand. «Sieh an, du hast ein Mädchen kennengelernt», sagte der Alte vergnügt, ohne dass er irgendetwas darüber wissen konnte. Doch kaum hatte er mir einen Schein abgeknöpft und meine Herzlinie genauer betrachtet, ließ er Hand und Lachen fallen. Nur den Schein hielt er fest umschlossen. «Herr im Himmel, ist das Weib rational!», knurrte er, und dieses «rational» klang wie eine Warnung, beinahe wie ein Fluch. Kann «rational» lieben, dachte ich mir, würde «rational» an einem Strand unter Sternen übernachten?
Meine Frau wird niemals an Seher und Wünschelruten glauben. Die Propheten ihrer Religion heißen Logik und Pragmatismus. Natsumi vertraut allein in die Macht der Zahlen. Sie arbeitet mit ihnen, sie lebt mit ihnen, sie hat sie domestiziert, und dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass uns höhere Kräfte zusammengebracht haben. Ich war von einer Reise entlang der kalifornischen Küste zurückgekehrt und wollte einen Schulfreund zum Lunch abholen, der immer etwas Kreatives im Sinn gehabt hatte, nun aber sehr viel Geld verdiente. Als ich die Empfangshalle der Hamburger Privatbank betrat, in der er auf mich wartete, begann es so stark zu regnen, dass uns der Schauer in der gläsernen Lobby einschloss. Und plötzlich stand ich ihr gegenüber, einer Controllerin im nachtschwarzen Businesskleid, die untertags Risiken, Renditen und Cashflows berechnete wie ein Orakel, das sich auf statistische Erhebungen stützt. Ihre linke, fliehende Pupille hatte es mir angetan. Dieser minimale Silberblick, der bei manchen Asiatinnen süß wirkt und anderen ein so erotisches Charisma verleiht. Natsumi vereinte beides, was mich besorgte, denn zu allem Unglück schien sie auch noch klug zu sein.
Dass sie pragmatischer ist, als ich es mir jemals vorstellen konnte, dämmerte mir wenige Wochen später. Unser erstes gemeinsames Weihnachtsfest nahte, und als ich sie in der Adventszeit fragte, worüber sie sich freuen würde, entdeckte ich bald eine elektronisch erstellte Tabelle in meinem Postfach. Sie war offenbar vor einiger Zeit angelegt, regelmäßig aufgefrischt und gewissenhaft gepflegt worden. Natsumi hatte darin jede Geschenkidee verzeichnet, die ihr in den Sinn gekommen war. Sauber alphabetisch geordnet und farblich markiert nach Preiskategorien: null bis zehn Euro, zehn bis fünfundzwanzig Euro, fünfundzwanzig bis fünfzig Euro. Weil das mit uns zwar ernst, aber noch so frisch sei, empfahl sie mir Preiskategorie zwei, Misoschälchen oder eine Zitronenpresse. Es war der ungewöhnlichste, zweckmäßigste, aber rührendste Wunschzettel, den ich je gesehen hatte. Ich schenkte ihr einen knallbunten Sonnenschirm, den kitschigsten, den ich auftreiben konnte, und warf die Liste weg. Bis heute gefällt es mir, Brausepulver über ihre Zahlenwelten zu streuen, was wohl der Grund sein mag, warum sie sich irgendwann für mich entschieden hat. Rational betrachtet, hätte sie einen Investmentbanker heiraten sollen.
Wir hatten uns lange genug durch den Bahnhof Shinjuku bewegt und letztlich unseren Anschlusszug gefunden, da bemerkte Natsumi, dass es der falsche war. Präziser gesagt: Wir befanden uns auf der falschen Seite der Gleise und waren kurz davor, in die falsche Richtung zu fahren. Hin und wieder ist es beruhigend, dass auch meiner rationalen Hälfte Fehler unterlaufen, und so konnte ich endlich wieder lächeln. Natsumi aber fühlte sich herausgefordert. Ihr Ehrgeiz war erwacht und rüttelte auch das Controllerherz aus dem Schlaf. Weil wir unser Ticket bereits entwertet hatten und Natsumi nicht daran dachte, doppelt zu bezahlen, schickte sie sich an, mit einem Bahnangestellten zu verhandeln. Noch bevor sie ihn ansprechen konnte, schien der sich vielmals zu entschuldigen, als habe er den Irrweg selbst verursacht, und überreichte ihr zwei rote Karten. Je nach Sichtweise hätte man sie «Wildcards» oder «Idiotenscheine» nennen können, aber sie waren ohne jeden Zweifel nützlich. Wir wechselten auf die andere Seite der Gleise, übergaben sie dem dortigen Uniformträger an der Ticketkontrolle, und voilà: Natsumi hatte ihr kleines Versehen souverän und ohne wirtschaftlichen Schaden korrigiert. «Siehst du», sagte sie und stieß mir zufrieden den Ellenbogen in die Seite, «deine Ehefrau hat immer recht.»
Müsste Natsumi die Minute beschreiben, in der wir endlich wieder frische Luft atmeten, würde sie sagen: Wir gingen raus, es regnete, und es war nichts los. Ich selbst fühlte mich, als sei ich ein zweites Mal auf die Welt gekommen. Die Metro war einen Kilometer gefahren, nicht viel weiter, aber auf dieser Strecke hatte das Setting von «Bladerunner» zu «Mord im Orient-Express» gewechselt. Wir verließen einen verträumten kaiserlichen Bahnhof mit Giebeldach, Fachwerkelementen und einem Türmchen obendrauf, der vor hundert Jahren eröffnet worden war und immer noch rege genutzt wurde, als habe man einfach vergessen, ihn zu schließen. Er lag halb im Grünen und halb im Grauen. Auf der einen Seite schmiegte er sich an dreißig Meter hohe Ginkgobäume, von der anderen näherte sich unaufhaltsam die Stadt, deren Planer gerade darüber diskutierten, ob man Harajuku Station, diesen schönsten und ältesten Bahnhof Tokyos, vor den kommenden Olympischen Spielen modernisieren oder abreißen sollte.