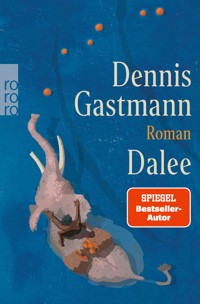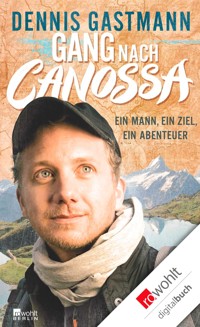19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Welt ist groß, rund und leuchtend blau – und Dennis Gastmann hat sie erlebt. Mal in Streiflichtern, mal in aller Farbenpracht, mal wie im Fiebertraum von Andalusien bis Allahabad, von Sydney bis Swakopmund, von den tausend Lichtern Manhattans bis Mumbai, der Stadt der Träume und Albträume. In diesem Buch erzählt der erfahrene Reporter von seinen abenteuerlichen Reisen. Er zieht mit einem Goldsucher durch die australische Wüste, tanzt mit Finnlands bekanntestem Tangolehrer, philosophiert in Taiwan mit einem chinesischen Dissidenten über den Preis der Freiheit. In Indien kniet er vor dem Oberhaupt der Hijra, des dritten Geschlechts, in Kalifornien rollt er durch ein «Drive-thru-Funeral», in Südspanien begleitet er die Kutten tragenden Geldeintreiber des «Klosters der Kassierer» auf wenig gottesfürchtiger Mission. Gastmann besucht den «patriotischen Unterricht» an Putins früherer Grundschule, wo Kinder lernen, Kalaschnikows zu bedienen – und gerät in die Fänge des russischen Geheimdiensts. Leuchtende, berührende, bisweilen wahnwitzige Geschichten und Erlebnisse – rund um jene Kugel, die der liebe Gott für uns Menschen an den Nachthimmel gehängt hat: den blauen Lampion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Dennis Gastmann
Der blaue Lampion
Stories von unterwegs
Über dieses Buch
Die Welt ist groß, rund und leuchtend blau – und Dennis Gastmann hat sie erlebt. Mal in Streiflichtern, mal in aller Farbenpracht, mal wie im Fiebertraum von Andalusien bis Allahabad, von Sydney bis Swakopmund, von den tausend Lichtern Manhattans bis Mumbai, der Stadt der Träume und Albträume.
In diesem Buch erzählt der erfahrene Reporter von seinen abenteuerlichen Reisen. Er zieht mit einem Goldsucher durch die australische Wüste, tanzt mit Finnlands bekanntestem Tangolehrer, philosophiert in Taiwan mit einem chinesischen Dissidenten über den Preis der Freiheit. In Indien kniet er vor dem Oberhaupt der Hijra, des dritten Geschlechts, in Kalifornien rollt er durch ein «Drive-thru-Funeral», in Südspanien begleitet er die Kutten tragenden Geldeintreiber des «Klosters der Kassierer» auf wenig gottesfürchtiger Mission. Gastmann besucht den «patriotischen Unterricht» an Putins früherer Grundschule, wo Kinder lernen, Kalaschnikows zu bedienen – und gerät in die Fänge des russischen Geheimdiensts. Leuchtende, berührende, bisweilen wahnwitzige Geschichten und Erlebnisse – rund um jene Kugel, die der liebe Gott für uns Menschen an den Nachthimmel gehängt hat: den blauen Lampion.
Vita
Dennis Gastmann, geboren 1978 in Osnabrück, hat alle Kontinente bereist – als Schriftsteller, Filmemacher und «Guerilla-Korrespondent» der ARD-Auslandsmagazine. Er reiste «Mit 80000 Fragen um die Welt» (2011), begegnete Heiligen und Hexern, Asketen und Oligarchen und wanderte zu Fuß über die Alpen, um seine Sünden zu büßen («Gang nach Canossa», 2012). Seine Reportagen wurden mehrfach preisgekrönt und dreimal für den Grimme-Preis nominiert. Für den «Atlas der unentdeckten Länder» (2016) besuchte er die letzten unbekannten Orte der Erde, für «Der vorletzte Samurai» (2018) erkundete er Japan. Zuletzt erschien «Dalee», sein erster Roman. Dennis Gastmann lebt in Hamburg und arbeitet in der ganzen Welt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann, unter Verwendung eines Motivs von Microsoft Bing Image Creator
Coverabbildung Seeschlange: iStock/Getty Images
ISBN 978-3-644-02138-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Die Göttin im Sari
Wir sehen uns unter dem Tisch
Die erste Reise
Der einsame Flucher in der Wüste
Die Metro der Entehrten
Das Tor zur Welt
Das Ding mit dem Ring
Souvenirs
Schweinerei
Ein Geschenk und sein Preis
Der Fluch der Giraffe
Das schießende Klassenzimmer
Wo Gott versagt, ist Gift gefragt
Das Kloster der Kassierer
Frech
Abschied auf Rädern
Mauern und Mandolinen
Mei pen rai
Jäger und Gejagte
Diese Ruhe, diese herrliche Ruhe
Die andere Hälfte
Dank
Für Marianne
Die Göttin im Sari
An den Ufern des Ganges
Sie hatte die Anmut einer Tänzerin, das Kreuz einer Athletin und die Aura eines Tigers. Ihre Hände waren Klauen, schwer von Juwelenringen, ihre Finger dabei so feingliedrig und zart, dass sie beinahe fleischlos wirkten. «Ich habe sie als Kind in die Zuckerrohrmaschine gesteckt, um den Saft herauszupressen», sagte sie mit einem Lächeln, das im Nu auf ihren bemalten Lippen erstarb. Laxmi Narayan Tripathi lehnte auf einer Thronbank, rührte lasziv in einer Schale voll Münzen und ließ sich die Zehen von den Männern küssen, die auf Teppichen zu ihren Füßen knieten. Sie galt als göttliches Wesen, geweiht von Rama, dem Quell aller Freude. Wohlgelaunt war sie jedoch nicht.
«Wer wagt es?», rief die Göttin und bäumte sich urplötzlich über den Köpfen der Kauernden auf. Sie musste sich nicht in voller Gestalt erheben, um größer zu erscheinen als die Gläubigen in ihrem goldenen Zelt. Laxmi reckte lediglich den Hals, an dem Gebetsketten schwangen, und straffte den majestätischen Bauch, der sanft unter ihren Gewändern wogte. Schon verstummte jedes Wort, und nur mehr die Nacht war zu hören, die Tempelglocken, die mantrischen Gesänge und das Hundegebell, während ihr suchender Blick durch die Reihen schweifte. So weich ihre Züge waren, wenn sie göttliche Antworten auf irdische Fragen gab, so scharf konnte ihre Zunge sein, wenn sich ein Sterblicher in ihrer Gegenwart ruchlos benahm. Und dieser Jemand war dummerweise ich.
«Wer hat dir erlaubt, meine Seele zu rauben?», sagte Laxmi und richtete ihren Zorn auf mich. Während sie aus der Höhe ihres Throns auf mich herabsah, schien das dritte Auge auf ihrer Stirn zu leuchten, das Zeichen Shivas aus verstrichener Asche und Sandelholzpaste. Die Göttin trug so viel Farbe auf den Wangen, als wollte sie ihr Antlitz hinter Purpur, Safran und flammendem Orange verbergen. Perlen zierten ihre Nasenflügel, wilde Locken wallten ihre Schultern hinab bis zu den Hüften, und es war ein Wunder, dass sie nicht unter dem Gewicht ihrer Goldarmreife zusammenbrach. Mit all dem Schmuck, der Ring an Ring von den Handgelenken bis zu den Ellenbogen reichte, kaschierte sie die Male ihres früheren Lebens, Tätowierungen, kräftige blaue Adern unter der Haut und so manches störrische Haar. Welcher Reporter aus dem Abendland wäre da nicht in Versuchung geraten? Wer hätte nicht in dieser Nacht am Ganges zur Spiegelreflex gegriffen und ausgelöst, nur ein einziges Mal, so laut der Apparat auch schnappte?
«Wenn ich wollte, könnte ich dich ins Gefängnis werfen», raunte die Göttliche mit einer Stimme, die unheilvoll zwischen hell und dunkel schwankte, während ich die Fotokamera unter meinem Arm verschwinden ließ. «Ich kann ein gutes Mädchen sein, hörst du? Aber auch ein sehr, sehr böses Mädchen. All das dient meinem Zweck.»
Ranjit war schuld. Wer sonst? Ranjit Kumar Pandey, der neben mir kniete und zu den geweihten Füßen der Furie demütig die Augen niederschlug. Ich liebte den Kerl. Ranjit war der beste Kundschafter, dem ich je in Indien begegnet bin. Gleichzeitig wünschte ich ihn zum Mond, weil er mich immer wieder, höflich gesagt, in Misslichkeiten verstrickte. Und diesmal hatte mich mein Freund so tief in die Scheiße geritten wie noch nie.
Ranjit war Ranjit, mit all seinen Vorzügen und Fehlern. «Go on, take pictures!», hatte er mir geraten und freundlich den Kopf hin und her gewiegt. «No problem, Mister Denish.» Er sei der Göttin im Sari schon häufiger begegnet und wisse, mit welchem Genuss sie vor der Linse eines Fotografen posiere. Nun aber hieß es aus seinem Mund, er habe Laxmi im Leben noch nicht gesehen. «Nur im Fernsehen», flüsterte er mir zu und schaute mich dabei mit so großen, runden, kindlichen Augen an, dass ich ihm ebenso gerne einen Kuss auf die Wange gegeben hätte, wie ihm links und rechts eine zu verpassen. Ranjit, der Gauner, hatte mich in das goldene Zelt gelockt. Und wie um Himmels willen brachte er uns wieder heraus?
Beginnen wir die Story mit Philosophie. Und mit ein wenig Zynismus. Zwei Dinge, die in diesem Teil der Welt denkbar eng miteinander verflochten sind. «Ich lebe nicht in Indien», sinnierte Ranjit, wenn wir durch die Gassen seines Landes streiften, von guten und bösen Gerüchen umgeben. «Meine wahre Heimat ist der Kosmos.» Und so unbegreiflich das Universum für uns Menschen schien, die auf dem blauen Lampion wandelten, so verschlungen konnten auch die Wege an seiner Seite sein.
Ich lernte Ranjit in Varanasi kennen, der «City of Learning and Burning», wie er den Ort seines kurzen irdischen Daseins nannte. Die wichtigste Lehre der heiligen Stadt schien das Loslassen zu sein. Jeden Morgen sahen wir Familien aus den Dörfern kommen, die ihre Toten auf den Schultern trugen. Sie brachten den Leichnam, in weißes Tuch gehüllt, zu den ascheschwarzen Treppen des Ganges und übergaben ihn dort den Flammen. War das Feuer heruntergebrannt, schlugen sie dem Verstorbenen den Schädel ein, um seine Seele zu befreien. Danach verlor sich ihr Blick in der Glut, während den Betrachtern ein seltsamer Barbecue-Geruch in die Nase stieg. Das Leben ist eine Brücke, heißt es in Indien. Überquere sie, aber baue keine Häuser darauf.
Varanasi war die Stadt von Licht und Schatten, und Ranjit war ihr Prophet. Als ich ihn einmal traf, um die Ghats und Tempeltürme in der schwindenden Sonne über Mutter Ganga zu fotografieren, entführte er mich lieber in ein Museum. «Denish, stell dir vor», sagte er und deutete auf verstaubte Steintafeln im Neonlicht, «Krishna hat uns dieses Wissen vor fünftausend Jahren geschenkt, ist das zu glauben?» Danach zitierte er aus den Inschriften der alten Veden, bis es finster war. Ein andermal, als mich Varanasi und seine ländlichen Gefilde so inspirierten, die Senffelder, die Neembäume, die Wasserbüffel, der aufgestapelte Kuhdung am Straßenrand, die halsbrecherischen Milchmänner mit ihren Kannen und Krügen am Fahrradlenker, gähnte er bloß und murrte: «Come, we go.» An solchen Tagen landeten wir früher oder später im Souvenirladen eines Freundes, in einem Haus für ayurvedische Heilessenzen oder im, wörtlich zitiert, «Cum Inside Show Room» eines umtriebigen Kaschmirhändlers, der auf seiner Visitenkarte mit dem Slogan warb: «God made men. I make gentlemen.»
Immerzu erklärte ich meinem Gefährten, ich sei auf der Suche nach Geschichten, nicht nach Geschenken für zu Hause. Und Ranjit? Er gab sich regelmäßig enttäuscht. Ich sei anscheinend noch nicht bereit für die wahre Magie seines Landes, machte er mir weis. «Deinem Schicksal kannst du nicht entfliehen», orakelte er und legte die Hände wie zum Gebet zusammen. «Alles im Sein ist vorbestimmt, jeder Gewinn, jeder Verlust auf Erden. Du wirst deine Geschichte nicht finden, mein Freund. Sie findet dich.»
Und so führte uns das Schicksal in ein goldenes Zelt. Zunächst jedoch in den Stau meines Lebens. Die Reise von Varanasi nach Prayagraj, vormals Allahabad, der Stadt, wo die Götter wohnen, werde uns zwei Stunden kosten, hatte Ranjit geschätzt. Vielleicht auch drei, je nach Wetterlage, Verkehr und Karma, er wolle sich lieber nicht auf die Minute festlegen, sagte mein Freund. Ein weiser Entschluss, denn aus zwei Stunden wurden letztlich zwölf. Ein sattes Dutzend quälender Autostunden auf Schotter und Asphalt, weil sich Ranjit aus spirituellen Gründen dazu entschloss, an einem Sonnabend aufzubrechen. Wie sich zeigte, gehörten die Wochenenden auf den Straßen jedoch den indischen Hochzeiten und ihren grell beleuchteten Festwagen, die mit Tanz, Musik und Scharen von Gästen wie selbstverständlich die Fahrspur blockierten. Nach den ersten drei Stunden am Steuer summte Ranjit besänftigende Lieder, die er aus Filmen kannte. Nach sechs Stunden stiegen wir gemeinsam aus und schlossen uns kurzerhand einer ekstatisch feiernden Hochzeitsgesellschaft zum Hüftschütteln an. Nach neun Stunden hielt Ranjit bei einem fliegenden Händler an und kaufte mir einen Maharajahut mit falschen Edelsteinen und Perlen, den ich samt Schleppe auf dem Kopf balancierte, bis es schien, als wären wir nach elf geschlagenen Stunden endlich an unser Ziel gelangt. Dann jedoch fuhr sich der Wagen zu allem Unglück fest. Er steckte so tief im Sand, dass wir zu Fuß weiterzogen.
Wir besuchten die Kumbh Mela, das größte Fest der Menschheit. Es erstreckte sich über Monate und viele Meilen hinweg am Gangesufer. Hundert Millionen Menschen pilgerten nach Prayagraj, um ein Bad in der Unsterblichkeit zu nehmen. Dort, wo sich Mutter Ganga mit den heiligen Wassern des Yamuna vereint und die Kraft des Göttlichen allgegenwärtig ist, wie es heißt. Einhundert Millionen Gläubige, angeführt von Mönchen und Asketenorden. Diese Zahl nannte mir Ranjit, während wir von einer Brücke aus über die Zwillingsflüsse und die glimmenden Lichter der Zeltstadt blickten, die nicht zu enden schien. Nur der Himmel weiß, wie viele Männer, Frauen und Kinder es wirklich waren. Bei Tage wuschen sie sich von ihren Sünden rein, um den Kreislauf des Lebens zu durchbrechen – in der Hoffnung, die Strafe einer weiteren Geburt möge an ihnen vorübergehen, denn wer lebt, der kämpft. Nachts, wenn die Kälte über das Ufer kroch, kauerten sie sich unter Tüchern, Wolldecken, Teppichen und Planen zusammen, Leib an Leib gepresst bis zur erlösenden Morgensonne, so der Allmächtige ihnen gnädig war.
Ich wollte nur noch die Augen schließen, als wir unser Quartier erreichten. Ein hoch umzäuntes, rund um die Uhr bewachtes Camp für Journalisten, Fotografen, Yogafreunde, Maharishijünger, Meditationsgruppen im spirituellen Wachstum und andere Sinnsuchende aus dem verwöhnten Westen. Die Zelte waren in die Preiskategorien «Luxury», «Super Luxury» und «Luxury Luxury» aufgegliedert, doch in jeder Unterkunft fand sich im Grunde dasselbe: ein Schlafplatz erhöht auf Stelzen, der vor Flut und kriechendem Ungeziefer schützte, saubere Laken, ein Kissen und ein Reiseklo, was sich angesichts der desolaten hygienischen Zustände als geradezu «Super Luxury Deluxe» erwies. Leider hing auch der Dieselgestank in den Zelten – verursacht von einem archaischen Stromgenerator, den es brauchte, um das Camp zu beleuchten und in der Dämmerung gründlich einzuräuchern, wenn die Mückenschwärme kamen.
Wer hätte sich nach all den Stunden der Reise nicht etwas Schlaf gegönnt? Die Gurus, Yogis, Sadhus und angeblich menschenfressenden Aghoris auf dem hinduistischen Jahrmarkt des Glaubens konnten warten und mit ihnen auch die Story, die ich mir erhoffte. Wieso in Hektik verfallen, wenn der Fluss des Lebens ohnehin strömt, wohin er will? Wer weiß, vielleicht würden wir ja sogar eine ganze Woche auf der Kumbh Mela verbringen, überlegte ich. Die Aussicht auf eine stundenlange Rückfahrt weckte jedenfalls wenig Enthusiasmus in mir.
Ranjit hingegen fand keine Ruhe. Er fühlte sich einsam in seinem Luxuszelt, das auf meine Rechnung ging. Wie ein Junge auf der Suche nach Mutter und Vater streifte er im Halbdunkel umher. Nach einer rastlosen Weile kam Ranjit zu mir, um ein Geständnis abzulegen. Mein Fremdenführer fühlte sich fremd. Wie ich hörte, hatte er sein weltliches Zuhause, die Stadt des Erkennens und Verbrennens, noch nie zuvor verlassen. Ranjit bewegte sich auf unentdecktem Terrain. Er hatte die hundert Kilometer lange Reise über den Rand der eigenen Welt nur für mich und meine Reportage auf sich genommen. Vor allem wohl wegen der Dollars, die er mit mir verdiente, um seine Familie zu versorgen: eine Ehefrau, zwei Töchter und die Bettler, die vor dem kleinen gelben Haus der Pandeys auf Almosen hofften. Jeden Sonntag schenkte er ihnen eine Rupie und erfreute so Saraswati, die Göttin des Wohlstands und des Glücks.
Allerdings gab es noch etwas, das Ranjit im Herzen bewegte. Ein Gerücht hatte ihn erreicht und ließ ihn nicht mehr los. Die Wächter des Camps erzählten davon, ebenso wie das Küchenpersonal, das noch die letzten Teller wusch, ehe es schon bald das Frühstück für die Reisenden vorbereiten musste. Auch der Händler, der die üblichen Saris und Schals für das übliche kleine Vermögen verkaufte, hatte bereits davon erfahren. Zwischen den Zelten tuschelten sie von einer hohen indischen Persönlichkeit, die der Kumbh Mela einen unvergleichlichen Glanz verlieh. Solch einen Gast hatte das heilige Fest in seiner zweitausend Jahre langen Geschichte noch nicht erlebt.
«Sir», flüsterte Ranjit, obwohl ich ihn inständig darum bat, mich erstens schlafen zu lassen und zweitens nicht Sir zu nennen. Ja, ich bezahlte ihn für seine Dienste. Aber nur weil er für einige Tage auf meiner Payroll stand, war ich keineswegs sein Herr und Gebieter, versuchte ich ihm zu erklären, sondern vielmehr so etwas wie ein Freund, dem er half, sich zurechtzufinden.
«Sir, come, Sir!», gab er nicht nach. «Come, come, Mister Denish, we must go!»
Ranjit bekniete mich nahezu, nahm mich abwechselnd in den Arm und zerrte an mir. Er umschmeichelte mich mit den blumigsten Worten, verglich mein blondes Haar mit dem von Goldie Hawn, versprach mir ein unvergessliches Erlebnis, ein wahres Spektakel, ja sogar ein Wunder!
«Von wem redest du?», fragte ich meinen Reisegefährten und betrachtete ihn mit halb offenen Augen. «Worum geht es überhaupt?»
Nun, darüber schwieg er sich aus. Ranjit erwischte meinen wunden Punkt – und das wusste er. Die Neugier ist der Stachel im Fleisch eines Reporters, seine Flamme, seine treibende Kraft, die verhängnisvolle Droge, die ihn zuerst um die Nächte und später um die Familie bringt, und eine gute Geschichte ist sein größter Triumph. Darum gab ich schließlich nach und folgte Ranjit ins Ungewisse, hinaus aus dem umzäunten Camp, hinein ins Dunkel des Gangesufers. Vorbei an Schattengestalten, die uns durch den wandernden Moloch aus Mensch und Tier geleiteten oder uns mit Lust in die Irre führten, wie es schien. Doch keiner vermochte es, uns zu verwirren, wir wandelten auf Gottes Pfaden.
Vor dem goldenen Zelt herrschte Tumult. Es war hell erleuchtet und funkelte wie der Morgenstern, so kitschig es klingen mag. Hunderte von Menschen drängten sich vor dem Eingang, der mit Lichterketten und Lampions geschmückt war. Ganz vorne in der Menge stand ein Mann in Anzug und Krawatte. Er fuchtelte mit den Armen herum und trug den Bauch, der sich unter seinem Seidenhemd wölbte, wie einen Schild vor sich her. «Ich bin Journalist!», empörte er sich und deutete mit den Fingern auf sein Mobiltelefon. Er fuhr wortreich durch Adresslisten, zählte namhafte Kontakte auf, über die er angeblich verfügte, und verteilte Visitenkarten an die Wächter, die den Eingang mit Rohrstöcken und ihrer schieren Muskelkraft schützten. «Rule is rule!», brüllte einer, Vorschrift bleibt Vorschrift, und jagte den Fluchenden davon.
«Was ist in dem Zelt?», fragte ich Ranjit, der mich an meinem Jeanshemd packte und wie einen Ochsen quer durch das Gewimmel zog. Er tauschte sich auf Hindi mit den Leuten aus, die er einen nach dem anderen beiseitestieß, manchmal höflicher, mal weniger galant. Welche Märchengeschichten er ihnen erzählte, war jedoch einfach zu verstehen: «Lasst ihn durch! Seht doch, ein Ausländer, ein VIP, ein Schriftsteller, Firangi-Filmemacher, Superhit-Regisseur, ein berühmter Künstler aus Jermani! Dieser Mann hier ist fünfzigtausend Meilen weit bis an den Ganges gereist, nur um die heilige Kumbh Mela zu erleben, seinen größten Traum, und jetzt macht Platz für unseren Ehrengast aus der großen, weiten Welt! Husch, husch!»
Ich war seine Carte Blanche. Die weiße Eintrittskarte, die er nutzte, um jede beliebige Tür in Indien zu öffnen, das dämmerte mir mit der Zeit. Nur um noch einmal daran zu erinnern: Nicht ich wollte in das Zelt hinein, er wollte es. Und so erstaunlich es war, wie gut sein Plan glückte, so erschütternd wirkte das Schauspiel auf mich. Allein meine Hautfarbe, die helle Pigmentierung meiner sterblichen Hülle, ließ die Menschen in nahezu biblischer Weise weichen und eine Gasse bilden. Es war hinduistischer Fatalismus in reinster Form: hier Seine Majestät, der König, dort der Bettelmann. So ist es, und so wird es bleiben. Wir sehen uns nach der Wiederfleischwerdung im nächsten Leben, neues Spiel, neues Glück.
«Ranjit», sagte ich, nun mit ernstem Unterton. Er hatte uns inzwischen durch die gesamte Schar der Wartenden und Hoffenden geboxt – bis vor einen Gitterzaun, den letzten Wellenbrecher vor dem Weg hinein. «Komm schon, gehen wir. Ich bitte dich, mein Freund. Wir müssen nicht in dieses Zelt.»
«Aber wieso denn nicht?»
Ranjit legte die Hand auf meine Schulter.
«Denish! Mister Denish, Sir! Jetzt sind wir doch schon so weit gekommen. Da drinnen wirst du eine einmalige Sache erleben, ein großes Fest mit Trommeln, Musik und Tanz. Du schwingst doch gerne die Hüften, oder nicht, Maharaja?»
«Tanzen?», sagte ich, halb zu mir selbst, und ließ die weiteren Gedanken unausgesprochen. Da belästigten wir all die Leute, die womöglich seit Stunden in Nacht und Wind vor dem Zelteingang aushielten, verärgerten die Götter und ruinierten im Rekordtempo die Bilanz unseres Karmakontos, nur wegen einer Tanzrevue?
«Tanzende Transen», sagte Ranjit und lachte mit spitzer Stimme auf. «Hijras! Transgender! Das dritte Geschlecht, verstehst du? Sie sind nicht nur göttliche Wesen wie aus den alten Schriften, sondern auch äußerst amüsant. Warte nur ab, mein Freund, ich stelle sie dir vor, du wirst sie lieben.»
Was mir als Nächstes zu Ohren kam, waren die Worte «one minute». Ein Wächter sprach sie aus, während er den Finger an seine Lippen hob. Er schien mich in der Tat für eine wichtige Größe auf der Welt zu halten, so respektvoll und vorsichtig behandelte er mich. Oder war es eine Wächterin? Ehe ich genauer hinsehen konnte, fuhr das Gitter auf, und wir fanden uns bereits im Allerheiligsten wieder. Ich verrate wohl kein Geheimnis, wenn ich sage, wie unbehaglich ich mich damals fühlte. Hätte wirklich eine Musikkapelle gespielt, begleitet von Trommeln, sie wäre auf der Stelle verstummt.
Niemand tanzte im goldenen Zelt. Keiner schwang ausgelassen die Hüften wie auf einer ländlichen Hochzeitsfeier und sang «balle, balle!», hurra, hurra, als wir das Innere betraten. Weder Laxmi, deren hypnotischer Blick mich nun traf, noch die zahlreichen Bewunderer, die zu ihren Füßen knieten und vor Ergriffenheit schwiegen. Wir hatten uns nicht nur auf schändliche Weise in den Pavillon einer Göttin gemogelt – ich voran, weil Ranjit mich schubste, und er, der Kleinere von uns beiden, versteckt in meinem Rücken –, wir platzten auch noch mitten in ihren Darshan hinein. Jene Stunde der spirituellen Erfahrung, in der sie mit ernster Miene auf ihrem Thron saß und wichtige Worte sprach, während die anderen sie still bewunderten und hofften, ihr Glanz möge sie treffen.
Diesmal dauerte es weniger als eine Minute, bis uns einer der Gläubigen mit unheiligen Worten hinaus in die Nacht verwies. Da jedoch hatte uns Laxmi längst im Auge. Oder war es das Schicksal selbst, das uns am Kragen packte? Mit einem Wink ließ sie uns fassen und zurück unter die Kuppel des Zelts befördern, meinen indischen Freund und mich. Und so, verehrtes Publikum, landeten wir also auf Knien vor Laxmi Narayan Tripathi, der berühmten goldgeschmückten Unbekannten, die mir mit Gefängnis drohte.
End of Story? Ich wünschte, es wäre so. Doch die Geschichte nahm gerade erst ihren Lauf.
«Was hast du da?», fuhr mich die Göttin an, während ich meine Spiegelreflexkamera unter dem Arm versteckt hielt. Der Fotofauxpas war eben erst geschehen.
«Nicht deine Canon», rief Laxmi, die Schreckliche. «Von diesen Dingern habe ich mehr als genug. Ich meine das, was da aus deiner Hose ragt.»
Nun sah ich an mir herab. Und was soll ich sagen? Schon wieder war Ranjit schuld, niemand anders als er. Vor der versprochenen Tanzrevue hatte er mir geraten, Geld bereitzuhalten. Es klang, als würden wir einen texanischen Stripteaseclub besuchen. «Dem Gesindel am Gangesufer musst du nichts geben», lauteten seine Worte, die bisweilen drastisch klangen. «Aber den Hijras schon, damit sie dich nicht verfluchen.»
Jenes Geld schaute nun aus meiner Hosentasche hervor. Papiergeld. Große bunte Scheine von fünfhundert und tausend Rupien. Umgerechnet hätte der Betrag in meiner europäischen Heimat bestenfalls für ein Frühstück gereicht, hier jedoch konnte er eine Familie über Tage und vielleicht sogar Wochen ernähren. Bei drohenden Verwünschungen wollte ich besser nicht kleinlich sein. Erst recht nicht, wenn es um das dritte Geschlecht ging, denn mit den Hijras hatte ich so meine Erfahrungen gemacht. Keine guten, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Auf meiner ersten Indienreise vor vielen Jahren hielt ich sie für Prostituierte. Damals drehte ich eine Reportage über die Kinoindustrie und den süßen Traum vom Aufstieg aus den Slums. Ich stand auf einer Verkehrsinsel in Mumbai, umgeben von vorbeirauschenden Tatas, Mahindras und Tuk-Tuks, und filmte das überlebensgroße Konterfei von Shah Rukh Khan. Der reichste Schauspieler des Landes blickte von einem Bollywoodplakat herunter, das über die gesamte Länge eines Häuserblocks gespannt war, als ich plötzlich Hände spürte. Große Hände mit Schmuck an den Fingern, Henna auf der Haut und abblätterndem roten Nagellack. Sie fuhren suchend durch meine Taschen. Dass es Ausgestoßene waren, die weder Ehen schließen konnten noch eine Chance auf legalen Broterwerb hatten, wusste ich nicht. Und so ließ ich etwas von meinem Geld fallen, einen Schein oder zwei, und lief davon.
Auf der zweiten Reise konnte ich nicht mehr fliehen. Diesmal waren es eindeutig Professionelle, und sie pirschten sich keineswegs still und leise heran. Vielmehr brausten sie mit dem infernalischen Grollen einer Boeing 747 über die Straße, während ich eigentlich die Stille der Großen Indischen Wüste von Rajasthan genoss. Ich schrieb meinen ersten Roman, eine Abenteuergeschichte, und erkundete das umstrittene Grenzland zu Pakistan, wo sich Sanddünen wie in der Sahara erheben. Da dröhnte etwas die Schotterpiste entlang, die zu meinem Zelt am Rande der Tharwüste führte. Ich lag auf einer Matratze, erschöpft von dem schaukelnden Ritt auf einem Dromedar, blickte an die bebende Decke meines provisorischen Lagers und fragte mich, was sich da wohl näherte. Ein Düsenjäger der pakistanischen Armee? Eine Panzerdivision auf Ketten? Wie sich zeigte, war es bloß ein Traktor. Jedoch einer mit Lautsprechern auf dem Heuanhänger und fünf Gestalten in wehenden Gewändern, die kreischend und zungeschnalzend zur Musik auf der Ladefläche tanzten.
Kaum hatte ich meine Hose übergestreift, hielt eine der Hijras auch schon meine Hoden in der Hand. Karma, könnte man aus heutiger Sicht sagen, irgendwann im Leben gleicht sich eben alles aus. Die Gruppe der fünf stürmte ungefragt in das Wüstenzelt hinein, das ich bewohnte. Eine spielte mit meinen blonden Locken, eine andere schlang von hinten die Arme um meine Taille und sagte immerzu: «Friend, friend», während mir die dritte von vorn so zielsicher wie beherzt zwischen die Beine griff. Sie – oder sollte ich besser they sagen? – ließ nicht locker und sah mich aus dunklen, kholumrandeten Augen an. Zu einem tieferen Gespräch, das nötig gewesen wäre, um solcherlei sensible Fragen der Genderidentität zu klären, kam es nicht mehr. Ebenso wenig zum Geschlechtsverkehr, auch wenn die Transperson, die meinen Hodensack in ihrer Faust umklammert hielt, mit einem «Please, Sir, please» eindringlich darum bat.
Nun, ich will mich nicht lustig machen. Natürlich hatte ich es mit Menschen zu tun. Mit Kindern der Erde wie du und ich, die von Samsara, dem kreisenden Rad des Lebens, nicht gerade begünstigt worden waren. Ob Transfrau, intergeschlechtlich, bigender oder trigender, geschlechtslos oder genderfluid, sie durchquerten die Wüste und tauschten Sex gegen Geld, weil sie es mussten. Und so ließ sich auch diese schmutzige Situation mit sauberen Scheinen bereinigen. Einige Hundert Rupien sollten es jedoch sein, vorher erhielt ich meine Familienjuwelen nicht zurück.
Richten wir den Blick wieder auf Ranjit, die erzürnte Göttin und die Rupienscheine, die so auffällig aus meiner Hosentasche ragten. Es waren verjährte Banknoten. Naiv, wie ich bin, hatte ich die Fünfhunderter und Tausender von einer früheren Indienreise mitgebracht und ahnte nicht, dass sie inzwischen außer Kurs gesetzt worden waren. Mein Geld war nicht nur wertlos, der Besitz war sogar verboten und konnte mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Die indische Regierung hatte die Tausender bereits vor Jahren einziehen lassen und die alten, längst ungültigen Fünfhunderter durch neue ersetzt, um Fälschungen, Korruption und Geldwäsche zu bekämpfen.
«Bei Shiva!», flüsterte Ranjit, als er die Scheine bemerkte, und riss die Augen auf. «Weg damit, los! Steck das ein, sonst wirft sie dich wirklich noch in den Knast! Laxmi sitzt im Parlament!»
Im Parlament? Davon hatte Ranjit nichts erzählt. Na gut, wie wir wissen, hatte er mir gar nichts über Laxmi Narayan Tripathi verraten, ehe wir unangekündigt zu ihrem Darshan erschienen. Bis auf zwei Dinge: dass er sie kannte, was mindestens geflunkert war, und dass sie Teil eines fahrenden Tanztheaters sei, was selbst mit gutem Willen als Lüge zu werten ist. Obwohl Hijras seit Jahrhunderten auf Hochzeiten und Geburtszeremonien tanzen, weil sie nicht nur für Angst und Schrecken stehen, sondern auch für Glück und Fruchtbarkeit. So entpuppte sich auch seine dritte Information als vage. Die Göttin auf Erden, zu deren Füßen wir knieten, war keineswegs ein gewähltes Mitglied des Parlaments in Neu-Delhi. Sie war noch weitaus mehr.
Laxmi war zur Inderin des Jahres gekürt worden. Laxmi hatte ihr Land vor den Vereinten Nationen repräsentiert, als erste Transperson aus Asien. Laxmi war Salman Rushdie begegnet und hatte ihn in Grund und Boden geredet, wie es hieß, worüber sich wohl niemand so verwundert zeigte wie Rushdie selbst. Nach dem leidenschaftlichen Zwiegespräch über die Rolle des dritten Geschlechts nannte er sie «force of nature», eine Naturgewalt. Laxmi hatte vor dem Obersten Gerichtshof geklagt und Gerechtigkeit für die drei Millionen Menschen in der Republik verlangt, die sich weder als Mann noch als Frau betrachteten. Sie stritt für gleiche Bildungschancen, dieselben Perspektiven auf Jobs, angemessene ärztliche Versorgung, getrennte Bäder, das Recht auf die Adoption von Kindern und legale Wege, sich unter dem Skalpell für ein bestimmtes Merkmal zwischen den Beinen zu entscheiden. Und was war geschehen? Laxmi hatte auf ganzer Linie gewonnen. Dank ihr und anderen Aktivistinnen wurde das dritte Geschlecht in Indien schließlich offiziell anerkannt.
Laxmi war eine Heldin, im Himmel wie auf Erden. Und obwohl ich von alldem erst später erfuhr, sah ich Ranjit an, wie sehr er sie liebte. Jeder liebte sie. Die Junggesellen in ihrem erlauchten Kreis, die verheirateten Männer, deren Frauen gerade die Kinder hüteten. Und besonders jene, die nahe bei ihrer Göttin saßen, geschminkt, gepudert und in Saris gehüllt. Laxmi war ihre Stimme und ihr Schwert. Eine Kriegerin wie aus der heiligen Mahabharata, die auf Hindi, Marathi und Oxford-Englisch für sie kämpfte. Nicht bloß selbstbewusst, oh nein, betrunken von sich selbst, und genau das verlieh ihren Worten den Reiz.
«Wisst ihr, ich bin unter vielerlei Namen bekannt», erzählte sie, während sich zahllose Augenpaare auf sie richteten. Einige aus dem Zelt heraus, andere durch jeden Spalt und jede Ritze, die sich zwischen den Planen für sie bot. «Hijra, Hijra-Guru, Homo, Transe, Eunuch. Ich selbst nenne mich einfach perfect diva, die vollkommene Frau der Träume.»
Wer sie trotz allem «Hijra» nannte, den wollte Laxmi nicht belehren. Das Wort bedeute «Göttin im Sari», wenn ihre Bewunderer es im Munde führten. Viele andere in Indien verknüpften es noch immer mit Begriffen wie verstoßen, gebrochen, verraten und verkauft. «Me Hijra, me Laxmi», betitelte sie ihre Lebensgeschichte, die landesweit als Buch mit rosarotem Cover erschienen war. Sie bevorzugte jedoch das gehobene «Kinnar», halb Mann, halb Frau, um sich selbst zu beschreiben. Laxmi war die Stimme der Kinnar Akhara, eines so mächtigen wie gefürchteten Ordens des dritten Geschlechts. Niemand konnte übersehen, welchen Gefallen sie an dieser Rolle fand. Nun hob sie einen der schweren, goldbereiften Arme und streckte den Zeigefinger in die Luft.
«Einmal wurde ich in einem Interview gefragt: Laxmi, wann hast du gemerkt, dass du anders bist? Da antwortete ich: Nie! Nie im Leben. Ich bin nicht anders, ich bin haargenau wie du. – Aber Laxmi, sei ehrlich, in welchem Alter ist dir denn aufgefallen, dass du ein wenig speziell bist? – Ich bin nicht speziell, gab ich zurück, die Welt hat mich dazu gemacht. – Und wann war dein Coming-out? – Allmächtiger!, sagte ich. Ich musste nirgendwo herauskommen, hörst du? Nur aus meiner Mutter!»
Das war eine große Show. Und während die Nacht verstrich, wurde mir klar, dass mein lieber Freund Ranjit keineswegs zu viel versprochen hatte. Die strafende, Blitze schleudernde Rachegöttin auf ihrem Thron konnte unterhaltsam wie eine Bühnenkomikerin sein. Wer brauchte Dave Chappelle und Ricky Gervais? Laxmi gehörte längst zur indischen Popkultur, sie war berühmt aus dem Reality-TV und Bollywoodfilmen. Und ja, sie tanzte. So soll ihre steile Karriere einst begonnen haben, als Schleiertänzerin in einer Bar in Mumbai. Der Erzählung nach erlangte sie dabei eine solche Bekanntheit, dass ihre Verehrer aus allen Vierteln der Millionenstadt zu ihr strömten, nur um einen Blick auf sie zu erhaschen. Eines Tages versuchte der Staat, die anrüchigen Tanzlokale zu schließen. Dagegen lehnte sie sich auf – wagemutig wie Bahuchara Mata, die heilige Kriegertochter, die ihren Vergewaltiger einst mit Impotenz strafte. Sie vergab ihm erst, als er schwor, sich fortan wie eine Frau zu kleiden und wie eine Dame zu benehmen.
«Ich war niemals ein Mann», sagte Laxmi. «Meine Seele war schon immer weiblicher Natur. Bei allen Göttern, was muss meine Mutter darunter gelitten haben. Ein Hijrakind galt als Schande! Aber Mütter sind Mütter, darum hielt sie zu mir.»
Wie eine liebende Mutter behandelte Laxmi auch die Kinder, die sie gerne zu sich rief. Wenn ein Söhnchen oder Töchterchen auf schwankenden Beinen in ihre Arme tapste, tätschelte sie seine Wangen, säuselte «I love you», verschenkte Süßes, füllte seine Windel mit Münzen und sprach einen schützenden Segen. Musste sie jedoch Geflüster, Gemurmel oder gar ein klingelndes Handy währenddessen hören, wurde sie laut: «Wer bist du, mich so zu beleidigen?», schimpfte sie den Störenden an, als hätte er es gewagt, an ihrem goldenen Sari zu zupfen. Dann strafte sie ihn und die anderen Gläubigen in ihrem Zelt mit Schweigen. Wortlos ließ sich Laxmi auf dem Teppich nieder, missachtete die Normalsterblichen um sie herum und wendete sich lieber den Gefäßen mit gespendetem Essen zu, das ihr unablässig zu Füßen gelegt wurde. Die Göttin fraß, gefüllte Teigtaschen, frittierten Paneerkäse und Küchlein aus Kichererbsen, während wir die Ehre hatten, ihr dabei zuzuschauen. Jawohl, sie fraß, leckte sich die juwelenbeladenen Finger, warf uns bisweilen die Krümel zu oder gönnte uns ein Fingerhütchen voll Chai. Aber keinen Tropfen mehr.
Laxmi hielt Hof. Und hatte ihre Majestät, die strahlende Herrscherin der Kinnar Akhara, nicht alles Recht, sich so zu benehmen? Sie musste schließlich zweitausend Jahre auf diese Genugtuung warten. Nie zuvor in der Geschichte war ein Orden aus dem dritten Geschlecht zur Kumbh Mela eingeladen worden. Nie zuvor hatten die Transpersonen offiziell an den heiligen Prozessionen und rituellen Bädern teilnehmen dürfen. Nun aber, nach zwanzig Jahrhunderten, brach die Ära von Laxmi Narayan Tripathi an, und das ließ sie uns spüren. Auch mich, denn meine Kamera und die verbotenen Geldscheine in meiner Tasche hatte sie nicht vergessen.
«Und nun zu dir», sagte Laxmi nach dem Essen und sah mich an. Während sie sich aufrichtete und schwerfällig zurück auf ihren Thron begab, beobachtete ich das Spiel ihrer Muskeln unter den wallenden Gewändern. «Dein Name?»
«Denish!», antwortete Ranjit an meiner Stelle und lächelte mich entschuldigend an.
«Woher?»
«Deutschland», gab ich zurück, ehe mein indischer Freund etwas anderes behaupten konnte.
«Kenne ich.»
Laxmi gähnte. Sie dachte nicht daran, dabei ihren Mund zu verdecken.
«Ich war in München und überall. Single?»
«Nein», sagte ich.
«Kinder?»
«Einen Sohn.»
«Gut.»
Laxmi hob den Zeigefinger und deutete auf mich, genauso wie sie die Kleinsten zu sich rief.
«Wer, ich?», fragte ich.