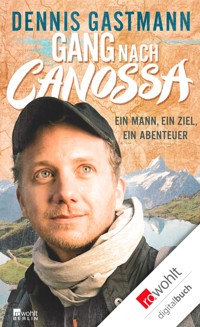
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 2012: Die Wirtschaft ist am Ende, das Klima kaputt, bald soll auch noch die Welt untergehen, und in einem kleinen Apartment im Herzen Hamburgs schnürt ein blonder Reisereporter seinen Rucksack. Sein Ziel: die eigenen Sünden büßen und Mutter Erde ein wenig besser machen. Sein Problem: Dafür muss er über die Alpen. Zu Fuß. Fast eintausend Jahre nach Heinrich IV. tritt wieder ein Deutscher den legendären Weg nach Canossa an. Natürlich auch, weil es dort so tolle Tortellini geben soll. Dennis Gastmann führt uns auf seiner ungewöhnlichen Pilgerreise von einer Grenzerfahrung in die nächste: An einem geheimen Ort in Ostwestfalen lässt er sich von einem Orakel die Zukunft vorhersagen, in Frankfurt wagt er sich aufs Börsenparkett, und in der pfälzischen Provinz stattet er den Zeugen Jehovas einen Hausbesuch ab. Im Dom zu Speyer beichtet er zum ersten Mal in seinem Leben, im französischen Pontarlier trifft er die «grüne Fee», bevor ihn der Weg auf die schmutzigen Spuren Uwe Barschels im Genfer Luxushotel «Beau Rivage» führt – und nach tausend Kilometern über die schwindelerregenden Höhen des Mont Cenis. Ein mitreißendes Abenteuerbuch und ein großartiges Lesevergnügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Dennis Gastmann
Gang nach Canossa
Ein Mann, ein Ziel, ein Abenteuer
Über dieses Buch
Wir schreiben das Jahr 2012: Die Wirtschaft ist am Ende, das Klima kaputt, bald soll auch noch die Welt untergehen, und in einem kleinen Apartment im Herzen Hamburgs schnürt ein blonder Reisereporter seinen Rucksack. Sein Ziel: die eigenen Sünden büßen und Mutter Erde ein wenig besser machen. Sein Problem: Dafür muss er über die Alpen. Zu Fuß. Fast eintausend Jahre nach Heinrich IV. tritt wieder ein Deutscher den legendären Weg nach Canossa an. Natürlich auch, weil es dort so tolle Tortellini geben soll. Dennis Gastmann führt uns auf seiner ungewöhnlichen Pilgerreise von einer Grenzerfahrung in die nächste: An einem geheimen Ort in Ostwestfalen lässt er sich von einem Orakel die Zukunft vorhersagen, in Frankfurt wagt er sich aufs Börsenparkett, und in der pfälzischen Provinz stattet er den Zeugen Jehovas einen Hausbesuch ab. Im Dom zu Speyer beichtet er zum ersten Mal in seinem Leben, im französischen Pontarlier trifft er die «grüne Fee», bevor ihn der Weg auf die schmutzigen Spuren Uwe Barschels im Genfer Luxushotel «Beau Rivage» führt – und nach tausend Kilometern über die schwindelerregenden Höhen des Mont Cenis. Ein mitreißendes Abenteuerbuch und ein großartiges Lesevergnügen.
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
(Abbildung: Frank Zauritz)
Abbildungen im Text © Dennis Gastmann
Karte Peter Palm, Berlin
ISBN Buchausgabe 978-3-87134-744-3 (1. Auflage 2012)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-11281-0
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Karte «Von Hamburg nach Canossa»
Widmung
«Riechst du es? Das ist der Duft Italiens!»
Kapitel 1 Wo die Hunde mit dem Schwanz bellen
Kapitel 2 Into the Wild
Kapitel 3 Der alte Heinrich und das Meer
Kapitel 4 Die Prophezeiung
Kapitel 5 Seelen in der Fleischauslage
Kapitel 6 Rien ne va plus
Kapitel 7 Rotkäppchen und der böse Rolf
Kapitel 8 Bibel-Bingo
Kapitel 9 Sex Seltz
Kapitel 10 Allein bei Kerzenschein
Kapitel 11 Run nach Canossa
Kapitel 12 Böser die Glocken nie klingen
Kapitel 13 Die große Überquerung des Jura-Gebirges zu Fuß
Kapitel 14 Premium Lifestyle
Kapitel 15 Kraftwürfel
Kapitel 16 Der Weg des kleinen Glücks
Kapitel 17 Und täglich grüßt das Murmeltier
Kapitel 18 Mangia, mangia!
Kapitel 19 Tod im Reisfeld
Kapitel 20 Gang nach Cabanossi
Dank
Für die letzte Samurai
«Riechst du es? Das ist der Duft Italiens!»
Alberto Bolognesi, Bergpirat, Mai 2012
Kapitel 1 Wo die Hunde mit dem Schwanz bellen
(Hamburg–Buxtehude)
Daruma ist keine Schönheit. Nicht nur, weil ihm Arme und Beine fehlen. Er hat buschige Augenbrauen, trägt einen gezwirbelten Schnurrbart, und seinen kugelrunden Leib bedeckt ein Rotkäppchengewand mit goldenen japanischen Schriftzeichen. Und wo sind seine Pupillen? Er hat keine. Der kleine Kobold hockt auf meinem Küchensims und starrt aus toten, schneeweißen Höhlen ins Leere. «Wären die Dinger nicht so furchtbar hässlich, hätte ich dir einen größeren geschenkt!», lächelte meine Liebe. Das war Heiligabend.
Heute ist der 6. März. Der Tag kam schnell. Viel zu schnell. Und nun schultere ich den Rucksack und ziehe einen schwarzen Filzstift aus der Schublade meines Schreibtisches. Die Japaner glauben, Daruma besitze magische Kräfte. Er soll Glück, Erfolg und gutes Karma bringen. Wer einen Wunsch hat, malt der Figur ein Auge aus. Hat sich der Wunsch erfüllt, pinselt man ein zweites hinzu und verbrennt den seltsamen Wicht in einem Tempel. Meine Hand ist zittrig. Daruma schielt mir einäugig hinterher, als ich die Mitgliedskarte des Alpenvereins Hamburg einstecke, die Wohnungstür schließe und für lange Zeit verschwinde. Ich weiß nicht, wann ich zurückkehre. Ich weiß nicht, ob ich zurückkehre. Ich gehe nach Italien. Zu Fuß. Was für ein absurdes Gefühl.
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, im Morgengrauen aufzubrechen. Das hätte so schön konspirativ und geheimnisvoll gewirkt. Doch es ist fast elf, als ich den ersten Wanderfuß ins Treppenhaus setze, und natürlich treffe ich meinen Nachbarn. Herr Römer ist einfach immer da, wenn ich meine Wohnung verlasse. Manchmal denke ich, er arbeitet für irgendeinen Geheimdienst und beschattet mich. Sein Nachname spricht sich übrigens hanseatisch «Rööööömä» aus, mit fünf Ö, einem Ä und einem verschluckten R. «Junge, mit Sack und Pack!», staunt er. «Du willst diesmal wohl länger ausbüxen, wat? Wohin geht denn die Reise?» – «Nach Canossa», antworte ich, und Herr Römer verzieht keine Miene. «Na denn, viel Spaß», sagt er trocken, und ich frage mich, ob der Gute mir überhaupt zugehört hat.
Meine Stadt kennt nur drei verschiedene Wetterlagen: Nieselregen, Sprühregen und Platzregen. Zwölf Jahre mache ich das schon mit. Aber zum Abschied hat der liebe Gott das ewige Grau beiseitegeschoben. Der wolkenlose Himmel spiegelt sich in den Pfützen auf dem Kopfsteinpflaster von St. Pauli, die S-Bahn rattert, und eine schwer überlackierte Frau mit rasierten Brauen ruft «Ey, Digger, ich schwöre!» in ihr Handy. Vor einem Gemüseladen steht ein kleiner Junge und zielt mit seinem verpackten goldglänzenden Magnum-Eis auf meine Brust. Ich hebe die Hände, er drückt ab, und ich tue so, als hätte Mandel-Nuss gerade mein Herz durchschlagen. Sonst nimmt niemand von mir Notiz. Trotz der olivgrünen Militärhose, trotz der schweren Wanderschuhe, trotz der zwölf Kilo auf meinem Rücken falle ich nicht auf, als ich die Reeperbahn überquere und Richtung Elbe stiefle. Verrückte gibt es hier genug.
«Zurückbleiben, bitte, Gangway wird bewegt!», knarzt ein Lautsprecher, die Hafenfähre legt blubbernd von den Landungsbrücken ab, und ich sitze als einziger Passagier an Deck. Es ist warm, der Wind schmeckt nach Sehnsucht, und im Morgenlicht glänzen die Wellen silbern. Wie eiserne Riesen stehen hundert Kräne Spalier, ein griechisches Containerschiff zieht vorbei, auch meine Freunde sagen Lebwohl: Michel, Peter und Wilhelmine, die Schlepper. In meinem Herzen mischen sich Schmerz und Euphorie. Hamburg ist das Tor zur Welt. Aber eben nur das Tor. Und manchmal muss ich raus.
Was habe ich mir da eigentlich vorgenommen? Nach Canossa gehen. Andare a Canossa. Aller à Canossa. «Canossavandring» heißt es im Schwedischen und «kanosszajárás» in Ungarn. Es bedeutet, zurück auf den Teppich zu kommen. Zu büßen. Zu bereuen.
Ich folge den Spuren eines zweifelhaften Vorbilds. Es heißt, er habe Mägde geschändet, seine eigene Schwester vergewaltigen lassen und die Sachsen abgeschlachtet wie Vieh: König Heinrich IV., Herrscher über Deutschland, Burgund und Italien. Ein Hurenbock, ein Dämon, vielleicht der Berlusconi seiner Zeit. Doch im Jahre 1076 machte der Lüstling einen folgenschweren Fehler: Er legte sich mit der Kirche an. Heinrich nannte Papst Gregor VII. einen «falschen Mönch», und dummerweise verstand der damalige Pontifex noch weniger Spaß als der heutige. Er setzte den König ab und bannte ihn aus der Kirche. Heinrichs Feinde, die Fürsten, rieben sich die Hände. Sie wollten den Tyrannen schon lange loswerden und stellten ihm ein Ultimatum: Wenn sich Seine Majestät nicht binnen eines Jahres vom Bann befreie, würden sie einen neuen König wählen. Und so zog Heinrich im tiefsten Winter über die Alpen auf die Burg Canossa, um sich mit dem Papst zu versöhnen. Allerdings startete der Adlige in Speyer, meine Reise beginnt schon im hohen Norden. Warum ich nach Canossa gehe? Das weiß ich noch nicht genau. Aber angeblich soll es dort fabelhafte Tortellini geben.
Die Sonne steht senkrecht am Himmel, und meine Hafenfähre landet auf dem Mond. Ich war schon in New York, aber noch niemals am südlichen Ufer der Elbe. Jemand hat ein Herzchen in den Rasen gemäht, an der Ecke verkaufen sie Kaminholz, und in den Fenstern der rot verklinkerten Giebelhäuschen sitzen hübsch angezogene, sonnengebleichte Puppen. «Moin!», sagt die Omi auf der Straße, norddeutsch kurz und bündig. Auf einem kleinen, künstlich aufgeschütteten Hügel am Ende der Siedlung stehen acht Rentner und warten, die Spiegelreflexkameras im Anschlag. Sie haben Glück. Ein Beluga landet auf dem Airbus-Gelände, dreht eine Ehrenrunde übers Rollfeld und posiert wie Germany’s Next Topmoppel von allen Seiten. Wie schnell könnte ich auf diesem gigantischen Moby Dick nach Canossa reiten? Und wie lange brauche ich zu Fuß? Es ist verrückt, aber von meiner Wohnung aus sind es exakt 999,9 Kilometer Luftlinie bis ans Ziel, und Google Maps macht Mut: Für einen Wanderer sei die Strecke in lächerlichen zehn Tagen und acht Stunden zu schaffen. Allerdings weist die allwissende Suchmaschine darauf hin, dass der Routenplaner für Fußgänger erst im Beta-Stadium sei. Und noch etwas macht mich skeptisch. Google meint, der kürzeste Weg führe über Helgoland.
Ich lasse die Insel aus und stapfe den Rest den Tages durch unendliche Weiten aus Wiesen, Moor und Moorwiesen. Meine Oma Anneliese würde sagen: Ganz schön viel Gegend hier. Manchmal schrecke ich Gänse auf oder bleibe stehen und esse einen Müsliriegel, der Rest ist Zen. Ich lasse die Gedanken kommen und wieder gehen, stundenlang, und mit jedem Schritt fühle ich mich langsam besser. So vergehen die Stunden.
Im ersten Sonnenuntergang des Jahres laufe ich auf eine sagenumwobene Stadt zu. Jeder kennt ihren sonderbaren Namen, doch kein Mensch hat sie je zuvor gesehen. «In Buxtehude, da bellen die Hunde mit dem Schwanz!», heißt es im Norden, und wenn man ärgerlich ist, sagt man im Süden: «Geh doch gleich nach Buxtehude!», weil dieser Ort so unvorstellbar weit weg scheint. Angeblich wächst hier der Pfeffer, und irgendwo am Stadtrand sollen sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Wie wunderbar. Ich fuhr mit der Rikscha durch Bangalore, tauchte meine Hand in den pechschwarzen Ölboden von Baku und tanzte Tango in Buenos Aires. Doch das größte Abenteuer meines Lebens beginnt ausgerechnet in Buxtehude.
Kapitel 2 Into the Wild
(Buxtehude–Wildeshausen)
Es war einmal ein Kollege von mir, der war klein, dünn und trug eine Brille. Auch sonst wirkte er ganz und gar unscheinbar, dennoch blickten die Leute voller Ehrfurcht auf den Knirps und nannten ihn die «Legende von Buxtehude». Sein wahrer Name klang nicht weniger bedeutend und mysteriös, er hieß Volker Pickenpack. In den achtziger Jahren, als die Menschen noch Nackenspoiler und Schenkelbürsten trugen, sorgte er für Angst und Schrecken in den Strafräumen der Landesliga. Seine Pässe schienen von Geistern gelenkt zu werden, und seine Schüsse waren so kraftvoll, dass es hieß, er könne sogar eine Kuh umschießen. Und so begab es sich zu dieser Zeit, dass der SV Buxtehude in jeder Saison die meisten Treffer im Lande erzielte.
Doch auf Zwerg Pickenpack lastete ein Fluch. Je mehr Tore er schoss, desto mehr kassierte auch sein Verein. Und sosehr er sich auch reckte, sosehr er fluchte und vollstreckte, niemals wollte der Aufstieg in die Verbandsliga gelingen. Es war zum Haareraufen.
Zehn Jahre gingen ins Land, das Männlein war ein Greis geworden, und endlich, in seinem allerletzten Fußballspiel, war der Aufstieg plötzlich zum Greifen nah. Die Uhr stand schon auf neunzig, Buxtehude lag gegen die Wandsbeker knapp in Führung, da sollte das Männlein einen Eckstoß ausführen. Grimm regte sich auf den Rängen, nun schieß doch, rief die Meute, schieß doch endlich! Doch Zwerg Pickenpack zögerte. Eine Ecke für Buxtehude bedeutete Gefahr fürs eigene Tor: Wie schnell hätten die Wandsbeker einen Konter fahren können, und dann, ja dann wäre es mit dem süßen Traum vom Aufstieg vielleicht vorbei gewesen.
Was machte das Männlein also? Es drehte sich nach rechts und schoss den Ball auf den Grill einer Bratwurstbude. Der Schiedsrichter pfiff, ließ den Zwerg zu sich holen und sagte: «Pickenpack, dafür hätten Sie Rot verdient. Aber ich kenne Sie einfach schon zu lange: Gratulation.» Und so feierten die Buxtehuder die ganze Nacht und blieben glücklich bis an ihr Lebensende.
Dieser Pickenpack ist übrigens bis heute mein großes journalistisches Vorbild. Zu Studentenzeiten jobbte ich beim Sat.1-Videotext, tippte die Sportnachrichten der Seiten 210 bis 219, und mein Redakteur, die Legende von Buxtehude, erfand die lustigsten Überschriften dazu. Als der Tunesier Adel Sellimi zum SC Freiburg wechselte, titelte das Männlein: «Adel verpflichtet».
Offenbar werden die großen Geschichten des Sports in Buxtehude geschrieben. An meinem zweiten Wandermorgen entdecke ich ein Straßenschild, das mich wirklich überrascht: «Wettloopsweg – Dat Wettlopen twischen den Hasen un den Swinegel up de lütje Heide bi Buxtehude». Auf einem Acker in der Nähe soll sich also die Rallye zwischen Hase und Igel ereignet haben. Können die Buxtehuder darauf wirklich stolz sein? Der Rammler macht sich über die krummen Beine des Igels lustig, und der Igel fordert ihn zu einem Wettrennen heraus. Es geht um ein Goldstück und eine Flasche Branntwein. Der Igel wetzt nur ein paar Schritte und lässt den Hasen dann davonlaufen, denn am Ende der Furche hat er seine Frau postiert, die ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Kein Wunder, der Genpool auf dem Land ist arg begrenzt. «Ick bün al dor!», ruft sie, als der Hase das Ziel erreicht. Natürlich kann das Langohr seine Niederlage nicht fassen und fordert immer wieder Revanche. Geschlagene vierundsiebzig Mal sprintet der Hoppelhase hin und her, bis er tot zusammenbricht.
Was sollen uns diese Provinzgeschichten sagen? Negativ formuliert: Wer bescheißt, gewinnt. Positiv formuliert: Was man im Kopf hat, braucht man nicht in den Beinen. Allerdings helfen mir beide Weisheiten auf meinem Weg nach Canossa wenig. Ich möchte nicht mogeln, und ich habe es satt, mein Gehirn anzustrengen, in meinem Kopf ist ständig Disco, das macht mich verrückt. Ich will mich auspowern, ich will mich plagen, ich will so lange marschieren, bis alle Fragen, alle Sorgen und alle Zweifel zwischen mir und dem Universum geklärt sind.
Gestern Abend schien ein riesiger Vollmond über den Fachwerkhäusern von Buxtehude. Ich fand ein Hotel am Stadtrand und bekam ein kleines Zimmer im Keller des Hauses. Es roch etwas modrig, nach feuchter Wäsche und verstaubten Gardinen, doch zum Frühstück gab es Zwiebelmett. Wie sehr ich diesen fabelhaften Brotaufstrich doch liebe. Die gute alte Maurermarmelade. Meine ersten zwanzig Kilometer zu Fuß habe ich gut überstanden, mal abgesehen von zwei Blutergüssen an den Hüften – der Bauchspeck hatte sich zwischen Gürtel und Rucksack eingeklemmt. Gut, dass ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben regelmäßig Sport treiben werde. Ansonsten keine Blasen, wenig Muskelkater und viel Motivation: Heute möchte ich die doppelte Distanz schaffen.
Meine zweite Etappe führt über siebenunddreißig Kilometer quer durchs wilde Niedersachsen bis nach Zeven im Kreis Rotenburg/Wümme. Der dopende Ex-Tour-de-France-Fahrer Udo Bölts würde sagen: Quäl dich, du Sau! Allerdings komme ich nicht so recht in die Gänge, die Buxtehuder Straßen sind wie ein verwunschener Irrgarten, ich finde einfach nicht heraus. Mein gesunder Menschenverstand versagt, und das Navigationssystem auf meinem Handy führt mich nicht ans Ziel, sondern nur zum «Bestattungsinstitut & Trauerhaus Holger Ringel» im Brillenburgsweg. Feuerbestattung ab 1622 Euro, Erdbestattung ab 2055 Euro, Seebestattung ab 1690 Euro und Friedwaldbestattung ab 1955 Euro, keine versteckten Kosten. Es ist mir etwas peinlich, aber immer wieder stiefle ich im Kreis und lande aufs Neue beim «Bestatter mit Herz». Ein schlechtes Omen? Vielleicht.
Als ich nach einer Stunde endlich den Ortsausgang erreiche, begrüßt mich ein armes, plattgefahrenes Eichhörnchen. Ein blitzsauberer Roadkill. Auch sonst erinnert alles an texanische Tristesse. Die Welt besteht nur noch aus zwei Farben: Der Himmel ist so grau wie die Landstraße, und das Gras, das neben dem Gehsteig wächst, ist genauso braun wie die gefrorenen Äcker links und rechts. Krähen schreien in den Gerippen der Birken, es riecht nach Tod und feuchter Erde, die Luft ist eiskalt.
Das Dorf Apensen ist der letzte Außenposten der Zivilisation. Ich kaufe noch zwei Mettbrötchen, eine Flasche Wasser und einen schwarzen Kaffee. Es gibt hier sogar eine Sparkasse. Vor dem Friseursalon «Haarmonie» auf der anderen Straßenseite steigt gerade eine Frau in ihren roten Kombi. «Das sieht sportlich aus!», ruft sie. «Wo soll’s denn hingehen?» – «Nach Canossa!», antworte ich. «Oha, das ist aber die falsche Richtung», sagt sie, und für einen kurzen Moment muss ich die Dame wohl so angesehen haben, als hätte sie gerade mein Urvertrauen zerstört. «Ist nur ein Scherz, junger Mann, immer geradeaus. Bewundernswert, was Sie da machen. Sie sollten den Wulff gleich mitnehmen. Viel Glück!»
Ob sie ahnt, wie goldrichtig sie liegt? Auf gewisse Weise trage ich die Sünden von Christian Wulff tatsächlich nach Canossa, ich bin nämlich über viele Ecken mit unserem Rabatt-Präsidenten verwandt. Wir sind beide Osnabrücker, und sein Urgroßvater und meine Urgroßmutter, eine geborene Wulff, sollen Cousin und Cousine gewesen sein. Ich kann nicht behaupten, dass ich darauf stolz wäre. Ob ich Christian schon persönlich begegnet bin? Oh ja. Ich habe ihn mal an der Käsetheke bei Allfrisch getroffen, ich durfte ihn sogar mal interviewen, aber nie war der richtige Zeitpunkt, ihm von unseren zarten familiären Banden zu erzählen.
Bei einer späteren Gelegenheit machte ich ihn wütend. Als Wulff noch Ministerpräsident von Niedersachsen war, erpresste er den Norddeutschen Rundfunk. Sein wunderschönes Bundesland, tönte er, sei im Programm völlig unterrepräsentiert. Und wenn sich das nicht bald ändere, wolle er dem NDR den Gebührenhahn zudrehen. Meine damalige Redaktion nahm ihn beim Wort und schickte mich quer durch Osnabrück, um die hässlichsten Ecken der Stadt zu dokumentieren. Ich filmte ein verwahrlostes Industriegebiet und eine heruntergekommene Mehrzweckhalle und machte episch lange Aufnahmen von trostlosen Bushaltestellen. Aus dem Material entstand eine wunderbare Serie: «Mehr Sendezeit für Niedersachsen». Dummerweise hat man sie nie gesendet. Warum? Das darf ich nicht verraten.
Hinter Apensen beginnt das Flachland, in dem der Bauer bereits morgens weiß, wer abends zu Besuch kommt. Mir ist, als könnte ich Zeven schon jetzt am Horizont erkennen. Der Fußweg ist verschwunden, die Felder sind nass und lehmig, also laufe ich dem Verkehr auf dem Grünstreifen entgegen. So sehe ich wenigstens, wer mich überfährt. Manchmal kann ich parallel zur Straße durch ein Waldstück gehen, doch meistens bin ich den Traktoren, den Pick-ups und den VW-Kombis der Landjugend (silbermetallic, Sportsitze, Heckfenster getönt) schutzlos ausgeliefert.
Wenn du etwas über die Bewohner eines Hauses erfahren willst, dann wühle in ihrem Abfall. Es ist wirklich bemerkenswert, was die Nordlichter so alles aus dem Autofenster werfen. Im schlammfarbenen Landstraßengras liegen Radkappen und zersplitterte Außenspiegel, Warnwesten und Bauarbeiterhelme, Thermoskannen und MC-Kassetten, benutzte Kondome, Analstöpsel (ich lüge nicht) und die Kauf-DVDs «Transi-Spektakel» und «Fuck-Girls: Chasing Pussy». Alle zwanzig Meter stolpere ich über blecherne Zigarilloschachteln, Dannemann Sweets. Noch viel häufiger entdecke ich leere Schnapsflaschen: Doppelkorn, Jägermeister, Kleiner Feigling, Chantré, Wodka Borisov und den mir bis dato unbekannten Kräuterlikör «Fläminger Jagd». Manchmal schimmern sogar Patronenhülsen im Boden. In Niedersachsen pflegt man alte Traditionen, hier schießt man noch auf Straßenschilder.
An den dicksten Bäumen der Alleen stehen Holzkreuze. Manche sollen wohl nur Raser abschrecken, einige aber sind bunt bemalt und tragen Namen: Anna, Alisa, Sascha, Vivien. Der Wind hat die rostigen Laternen unter den Kreuzen umgeweht, modriges Laub bedeckt ein Engelchen aus Stein. Dieser Unfall war vor vier Jahren in allen norddeutschen Zeitungen: Anna, Alisa und Sascha fuhren nachts vom «Mic Mac» in Moisburg nach Hause und stießen frontal mit dem BMW einer Selbstmörderin zusammen. Die Motorblöcke beider Wagen sollen sich tief in die Fahrerkabinen gebohrt haben. Drei Tage später entzündete Vivien für ihre drei Freunde eine Trauerkerze an der Unfallstelle. Auf dem Rückweg nach Buxtehude erfasste sie ein Mitsubishi. Ich weiß nicht, wie oft wir so einen Scheiß in meiner Heimat erleben mussten. Auch ich verlor einen Kumpel auf der Landstraße. Dominik, der mir zu meinem achtzehnten Geburtstag einen Joint schenkte, saß bekifft am Steuer und meinte, er müsste mit seinem Mini-Cooper einen Sattelschlepper überholen.
Der Tod gehört zu Norddeutschland wie die Krabbenkutter, die Shantychöre und der andere Küstenkitsch. Doch so morbide wie heute habe ich das Land selten erlebt. Wer geht zu dieser Jahreszeit auch wandern? Und vor allem: Wie masochistisch und lebensmüde muss man veranlagt sein, um ausgerechnet durch diese Gegend zu flanieren? Die Bauern scheinen das Gleiche zu denken. Sie sehen mich an, als käme ich vom Mars.
Es ist mittlerweile früher Nachmittag, und ich habe zwanzig Kilometer geschafft, fünf pro Stunde, mehr ist nicht drin. Noch immer quetsche ich mich den Seitenstreifen entlang und bete, dass mich niemand übersieht. Jedes Mal, wenn ein Auto nur knapp an mir vorbeirast, streiche ich mit der Hand über zwei Glücksbringer in meiner linken Brusttasche: einen marineblauen Lapislazuli, den ich seit meiner Kindheit bei mir trage (nach dem chinesischen Horoskop soll er mein persönlicher Glücksstein sein), und ein kleines, japanisches Amulett, das ich zusammen mit Daruma, meinem Kobold, geschenkt bekommen habe. Es sorgt angeblich für Sicherheit im Straßenverkehr und seltsamerweise auch für Erfolg in der Schule.
Meine Fußsohlen machen mir Sorgen. So langsam fühlen sie sich an, als hätte ich Kieselsteine im Schuh. Aber ich will nicht jammern, schließlich habe ich es so gewollt. Na ja, ein bisschen jammern möchte ich doch, denn leider habe ich noch dazu meine Mettbrötchen und die letzten Müsliriegel von gestern schon verputzt. Wahnsinn, was mein Körper so verfeuert. Ich bin eine Dampflok, wenn ich keine Briketts nachwerfe, ist der Ofen aus. Eigentlich dachte ich, man könnte auf dem Dorf gut essen, doch bisher waren alle Gaststätten auf dem Weg geschlossen. Vor dem «Kiek mol in – der Treff für nette Leute» stehen Autowracks, und das Lokal «Zur Post» in Wangersen hat Ruhetag.
Vielleicht ist das in diesem Fall auch besser so. Angeblich soll der Gasthof ein beliebter Neonazi-Treffpunkt sein. Dem braunen Gesocks gefällt es in der Einöde offenbar ganz gut. Wangersen wird deshalb vom niedersächsischen Verfassungsschutz beobachtet, und so geistert der Ort immer mal wieder durch die Presse. Ein Grabstein auf dem Dorffriedhof ist sogar bundesweit berühmt geworden, denn seine spiegelblank polierte Oberfläche ziert ein blitzsauberes Hakenkreuz – seit 1941 und völlig unbehelligt bis heute. Niemand in Wangersen scheint sich daran zu stören. Vor vier Jahren entdeckte ein Spaziergänger das verbotene Zeichen und erstattete Anzeige, genützt hat es nichts. Die Rechtslage ist schwierig. Eigentlich müssen Nazisymbole im öffentlichen Raum entfernt werden, doch dieses Grab ist in privaten Händen. Nicht ganz zufällig gehört es einem NPD-Politiker. Der Mann sitzt im Gemeinderat, ist hochangesehen und denkt nicht im Leben daran, das Hakenkreuz zu beseitigen. Die Ruhestätte seines Vaters sei schließlich eine der schönsten und gepflegtesten.
Immerhin ist in Wangersen mal was los, wenn die Medien einfallen, denn ansonsten ernüchtert der Blick auf den Veranstaltungskalender eher:
März
13. 03. Jahreshauptversammlung Heimatverein
20. 03. Blutspenden
24. 03. Müllsammeln
26. 03. Seniorennachmittag
Weitere Highlights des Jahres: das Feuerwehrfest am vierten und fünften Mai, Schulfaustball am siebten Juni und Kniffeln am zweiten Oktober. Man muss ja nicht gleich Nazi werden, aber was soll man in dieser Gegend auch machen – außer saufen, schießen oder vögeln?
Essen ist der Sex des Wanderers, und ich schleppe mich hungrig von Dorf zu Dorf. Nach fünfundzwanzig Kilometern brennen die Fußsohlen, nach dreißig Kilometern verziehe ich bei jedem Schritt das Gesicht, und nach fünfunddreißig Kilometern setze ich mich hin. Zum ersten Mal an diesem Tag. Irgendwie war ich der Meinung, ich könnte sieben, acht Stunden nonstop durchlaufen. Als ich mich wieder aufrichten will, blockieren meine Oberschenkel. Es ist, als würde Blitzeis in meine Muskeln fahren. Auch die Waden verkrampfen, versteifen und verhärten sich so sehr, dass ich sie nur unter großen Schmerzen bewegen kann. Gehören diese Beine überhaupt noch mir? Sie fühlen sich an wie Baumstämme. Voilà – ich wollte Canossa, jetzt habe ich Canossa. Ich hebe den Daumen, doch ich bin nicht Uma Thurman und auch nicht Hape Kerkeling. Völlig unbeeindruckt rauscht die Landbevölkerung an mir vorbei, und so wackle ich in Super-Slow-Motion weiter, wie ein Taucher mit bleischweren Gewichten auf dem Meeresboden. Es muss großartig aussehen, vermutlich würde ich hervorragend in Monty Python’s «Ministry of Silly Walks» passen.
«Meine Güte, laufen Sie etwa den Jakobsweg?», fragt die besorgte Dame an der Rezeption in Zeven.
«So ähnlich. Ich eröffne gerade einen neuen Pilgerpfad.»
«Verstehe. Herr Gastmann, Sie wohnen im zweiten Stock. Schaffen Sie die Treppen? Wir hätten auch einen Lift …»
Ich muss nach dieser Nummer wohl nicht erklären, warum ich auf meiner Reise in Gasthöfen und Hotels übernachte. Wenigstens abends möchte ich ein bisschen Komfort. Zelten wäre in dieser Jahreszeit keine gute Idee, und ich bin auch nicht scharf darauf, von Kloster zu Kloster zu ziehen. Mit Religion habe ich nicht viel am Hut, da geht es mir wie meinem historischen Vorbild. Was den Reisekomfort betrifft: Heinrich IV. zog nicht allein nach Canossa. Seine Frau, sein kleiner Sohn und seine Diener begleiteten ihn. Am Tagesende wusch man den Tyrannen und wickelte ihn in warmes Fell, damit sich Hochwohlgeboren bloß keinen Schnupfen einfing.
Leider bin ich mein eigener Diener und mein eigener Arzt. Ich massiere die Oberschenkel mit Sportsalbe, werfe eine Schmerztablette ein und spüle sie mit einem kräftigen Schluck Bier runter. Doch was zur Hölle mache ich mit meinem rechten kleinen Zeh? Der Junge ist fast doppelt so groß wie sonst, er sieht aus wie eine Nacktschnecke. Für solche Fälle habe ich ein Schweizer Taschenmesser eingesteckt, das Einzige, was mir von meinem Großvater geblieben ist. Otto kannte keine Schmerzen. Als er mal vom Schützenfest nach Hause kam, legte er sich flach auf die beheizten Kacheln in der Stube und bat meine Oma, sich auf seinen Brustkorb zu stellen – er wollte ihr demonstrieren, wie rüstig er im hohen Alten noch sei. Sie brach ihm dabei zwei Rippen. Zum Thema Schmerzen sagte er mir immer: «Heul nicht, mein Junge, denn wenn du heiratest, ist alles vorbei.» Das Messer hat an der Seite eine winzige Schere zum Ausklappen. Ganz in Ottos Sinne schneide ich beherzt in die Blase, lasse das Wundwasser herauslaufen und desinfiziere mein Werk mit Nordhäuser Doppelkorn aus der Minibar.
Jetzt haben Zeh und Zeven die gleiche Farbe: Orangerot. Ganz Downtown Zeven ist rot geklinkert, das Rathaus, die Fußgängerzone, die Geschäfte in der Innenstadt, und auf die roten Ziegeldächer prasselt kalter Regen. Der Ort ist für zwei große Unternehmen berüchtigt, die vermutlich eine Symbiose eingegangen sind. Das eine ist die Großraumdisco «Meyer’s Tanzpalast», das andere ist die Firma Mapa. Sie produziert Blausiegel, Fromms und Billy Boy. In den Gaststätten der Gegend gibt es noch Clubräume und verrauchte Herrenzimmer, in denen die Senioren Skat kloppen.
Heute Abend findet ein besonderes gesellschaftliches Ereignis statt: Der «Fachverband Schießsport im Kreissportbund Rotenburg/Wümme» trifft sich zur jährlichen Delegiertenversammlung im Landhaus Roose. Die Tagesordnung:
Begrüßung
Grußworte
Bericht des Vorsitzenden
Bericht des Kassenwartes
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung der Kassenführung und des Vorstandes
Referat des Schießsachverständigen
Bedauerlicherweise darf ich mir den Vortrag des Sachverständigen nicht anhören. Es geht um die Installation, den Betrieb und die Sicherheit von Schießsportanlagen, ein heikles Thema, da bleiben die Delegierten gerne unter sich. Im Saal bereitet der Referent in Sakko und Krawatte seine Powerpoint-Präsentation vor, und ich lasse den Tag stilecht mit einem Jägerschnitzel ausklingen. Zwei Schützenbrüder essen am Nebentisch.
«Ker, Ker, Ker, ist das traurich.»
«Nich wahr?»
«Keiner macht mehr Vereinsarbeit. Heute ist ja alles Individualismus.»
«Wat willste machen?»
«Da kannste nix machen.»
«Und unser Bundespräsident?»
«Traurich.»
«Eine Blamage.»
«Der hatte nicht das Format.»
«Man mag sich gar nicht mehr vorstellen, dass das mal unser Ministerpräsident war.»
«Und der Gottschalk?»
«Traurich. Ganz traurich.»
«Da hat die ARD ja so viel Zuschauerverlust.»
«Was will der Kerl denn auch? Der soll zurück nach Amerika gehen und fertich!»
«Nee, da guck ich mir lieber ZDF-Küstenwache an.»
«Zahlen bitte!»
«Das macht dann 8,20.»
«Dann machen Sie mal 9,20.»
«Danke.»
«Da nich für.»
In der Nacht bekomme ich die Quittung für meinen Gewaltmarsch. Alle halbe Stunde wache ich auf. Mal ist die Bettdecke schweißnass, mal zittere ich wie ein Aal im Steinhuder Meer. Auch mein Zeh erholt sich nicht. Im Gegenteil: Am Morgen ist die Nacktschnecke wieder genauso prall wie am Abend zuvor. Ich wiederhole meine fragwürdige medizinische Notversorgung, umwickle den kleinen Onkel mit mehreren Pflastern und schnüre den rechten Schuh etwas lockerer als sonst. Dies ist die erste längere Wanderung meines Lebens, und natürlich rebelliert mein Schwabbelkörper. Von nun an halte ich die Etappen kürzer, maximal fünfundzwanzig Kilometer, und zwinge mich dazu, mindestens einmal pro Stunde zehn Minuten Pause zu machen. Dann hocke ich auf einem Stein an der Landstraße 133 oder auf einer Bank in Kirchtimke, Westertimke oder Tarmstedt und labe mich an Käsebroten, die ich am Frühstücksbuffet geklaut habe.
Die Dörfer sind alle gleich hübsch und gleich tot. Aufgeräumte Gärten, akribisch geschnittener Rasen, Buchsbäume, Jägerzäune, Klinker, keine Menschenseele, keine Läden, null Infrastruktur. Das «Café und Bistro Muckefuck» macht Winterpause, auch «Wolfgangs Bierstube» und «… nach Fred» sind dicht. Es bleiben nur die Friseure, ein krisenfestes Gewerbe. In den Schaufenstern der Salons hängen die üblichen Modelfotos aus Hamburg und Berlin. Atemberaubende Frisuren, die Tante Trude aus Buxtehude niemals tragen würde. Die schönen, jungen Leute auf den Fotos sind in die Stadt gezogen, der Rest juckelt in auberginefarbenen VW Golf in den nächsten Lidl-Markt.
Ich versuche, meine Schmerzen rauszulaufen. Das klappt ganz gut. Mit der Zeit habe ich meinen kleinen Zeh so platt getrampelt, dass ich ihn nicht mehr spüre. Doch an jedem Wandertag tauchen neue Zipperlein auf. Mal sind es die Knie, mal die Schienbeine, und als ich die Bremer Innenstadt erreiche, sticht es auf einmal in meiner linken Achillessehne. Bei jedem zehnten Schritt fühlt es sich an, als würde mir ein Dackel in die Ferse beißen. Ich probiere es noch eine Weile, aber dieser eklige Schmerz will ums Verrecken nicht verschwinden.
Was nun? Ich suche etwas Liebe an einem vertrauten Ort und bestelle das Hamburger-Royal-TS-Sparmenü mit Cola und Kartoffelwedges bei McDonald’s in der Bahnhofstraße. Doch ein betrunkener Russe stört meinen Frieden. Er randaliert mit einer Halbliterdose Astra in der Hand vor dem Tresen, und zwei Angestellte versuchen vergeblich, ihn zu beruhigen. Witzigerweise kann ich jedes zweite Schimpfwort verstehen, dafür reicht eine Woche auf den Straßen Moskaus. «Bled!» heißt Nutte, und «Idi Nachuy!» bedeutet wörtlich übersetzt «Geh zum Schwanz!».
Mir bleibt nur übrig, zum Zug zu gehen. Oder besser: zu humpeln. Sosehr ich es auch will, ich komme zu Fuß einfach nicht mehr weiter. Delmenhorst, mein Tagesziel, ist noch dreizehn Kilometer entfernt, und ich muss es noch heute erreichen – morgen bin ich in der Gegend verabredet. Schweren Herzens nehme ich den Regionalexpress 4414 Norddeich Mole, er soll für die Strecke nur neun Minuten brauchen, und die Fahrkarte kostet mich vier Euro.
Allerdings können neun Minuten extrem lang sein. Es ist Freitagmittag, und das Großraumabteil ist voll belegt. Die üblichen Verdächtigen: Omis, Opis, Schulklassen, schreiende Kinder, überforderte Eltern. Auf den Klappstühlen vor den Toiletten starrt ein bärtiger Alki ins Leere und redet mit sich selbst. Um ihn herum liegen Netto-Tüten voller Leergut, seine alte Lederjacke ist speckig, und er hat sich augenscheinlich vollgepisst. Offenbar löst der Alkohol bei ihm eine Art Tourette-Syndrom aus. Immer wieder brüllt er «So ist das!» und «Du Scheißtyp!» und «Du Idiot!». Vier «Mädels» im gesetzten Alter stimmen in den Chor mit ein. Sie haben Prosecco dabei und Pappbecher und Würstchen und einen Ghettoblaster, und sie tanzen zu Shakataks «Down on the Street», 1984. Die Nervensägen wollen auf Norderney Junggesellinnenabschied feiern. «So ist das!», ruft der Alki.
Mir gegenüber sitzen Zwillinge, identische Ringelpullis, identische Brillen, identischer Vollbart. Sie rollen sogar synchron mit den Augen. «Besoffene Idioten», tuschelt ein Mann links hinter mir, «Scheißweiber!», ruft ein Familienvater, der mich ein wenig an Johannes B. Kerner erinnert. Er hat einen rosafarbenen Pulli über die Schultern geworfen, und seine beiden Töchter haben weißblonde Zöpfe. «Du Scheißtyp!», brüllt der Alki, und plötzlich betritt ein Polizist den Wagen. «Herr Wachtmeister!», ruft Johannes B. Kerner, die Staatsgewalt schreitet ein, und die Lage beruhigt sich. Diese Bahn scheint in neun Minuten direkt nach Canossa zu fahren.
«Mahlzeit, die Fahrscheine bitte!», trällert der Zugbegleiter, und ich drücke ihm mein Ticket in die Hand.
«So ist das!», meint der Alki.
Die Mädels spielen «Broken Wings», Mr. Mister, 1985.
«Da fehlt noch was!», sagt der Schaffner, und ich blicke ihn fragend an. «Was fehlt denn?»
«Die hättest du entwerten müssen!», sagt der linke Zwilling.
«Das stimmt!», sagt der rechte.
«So ist das!», ruft der Alki.
«Die Fahrt wird teuer für Sie», sagt der Schaffner.
«Vierzig Euro», sagt der linke Zwilling.
«Das stimmt!», sagt der rechte.
«So ist das!», ruft der Alki, und ich will nur noch raus.
Das kann nicht wahr sein. Vierzig Euro für neun Minuten Terror, willkommen in Deutschland. «Du Idiot! Du Scheißtyp!», brüllt der Alki zum Abschied, die Mädels singen «Never Gonna Give You Up», Rick Astley, 1987. Entnervt stiefle ich in einen Delmenhorster Gasthof und tröste mich mit Schmerztabletten und einer Grünkohlpfanne. Über diese Stadt gibt es nichts zu erzählen. Sarah Connor hat hier lange gelebt, schlimm genug. Gute Nacht.
Nein, es macht mich nicht gerade stolz, gleich in der ersten Wanderwoche zu mogeln. Vielleicht bin ich deshalb so frustriert. Doch Zwerg Pickenpack und der Igel aus Buxtehude hätten wohl das Gleiche getan, und mein Bußgeld sollte Strafe genug sein.
Irgendwie steckt Niedersachen, die Heimat der Pferderipper und Hühnerwürger, voller krimineller Energie. Gerade die Weserregion verführt mich immer wieder zu Gesetzesverstößen. In Wildeshausen stand ich sogar mal vor Gericht, allerdings nur als Zeuge. Mein Kumpel Delle meinte, er müsste einen Kombi auf der A1 rechts überholen. Ich saß auf dem Beifahrersitz und las den Kicker. Als sich der Fahrer vehement mit Lichthupe beschwerte, streckte Delle seinen Mittelfinger in den Rückspiegel. Das hätte er besser gelassen, denn dummerweise entpuppte sich der Überholte als Zivilpolizist, und wir drei sahen uns vor dem Amtsgericht Wildeshausen wieder.
Delle war ein ambitionierter Jurastudent und hielt es für eine gute Idee, sich selbst zu vertreten. Der Richter begrüßte ihn mit den Worten: «Mein lieber Herr Dellbrügge, Sie sind ein kleiner Wicht, und Ihrem Zeugen werde ich sowieso kein Wort glauben.» Trotzdem hatte ich bei meiner Aussage ein richtig gutes Gefühl. Ich war fabelhaft gebrieft und erzählte in rührenden Worten, wie besonnen, rücksichtsvoll und defensiv sich Delle durch den internationalen Straßenverkehr bewegen würde. Gandhi wäre stolz auf mich gewesen.
«Herr Gastmann, würden Sie denn sagen, Ihr Freund fährt flott oder vielleicht zügig?»
«Gott bewahre, Herr Richter. Herr Dellbrügge fährt ganz normal.»
«Und warum fährt er dann GTI?»
«Den hat ihm seine Mutter geschenkt. Das ist ein besonders sicheres Auto», sagte ich und fand meine Antworten wirklich schlüssig. Ich glaube, Delle wäre sogar freigesprochen worden, wenn nicht mitten in der Vernehmung mein Handy geklingelt hätte. Ein Kardinalfehler. Natürlich war der Richter not amused, er brach meine Aussage ab, man einigte sich auf einen Vergleich, und Delle musste eintausendzweihundert Euro an die ostdeutschen Flutopfer spenden. Irgendjemand in Grimma hat mir seine neue Couchgarnitur zu verdanken.
Ich laufe durch die Wildeshauser Geest, und würde es nicht nieseln, dann wäre es hier richtig schön. Heute ist mein fünfter Wandertag, das Wochenende bricht an, und mein Weg führt kreuz und quer durch Weidelandschaften. Auf manchen Feldern wächst sogar Rollrasen für Fußballstadien, Betreten verboten. Im Schritttempo kommt mir ein Traktor mit Anhänger entgegen, hinter ihm laufen zwei Bauern und sammeln die Wodkaflaschen, Zigarilloschachteln und Hardcore-Pornos aus dem Graben. Ein gutes Zeichen.
Die Geest ist ein Naturschutzgebiet im Dreieck zwischen Bremen, Oldenburg und Vechta. Ein riesiger Abenteuerspielplatz aus Mooren, Urwäldern und Hünengräbern. Passenderweise habe ich hier in der Gegend eine Art Outdoor- und Survivaltraining gebucht. Wer nach Canossa geht, dachte ich mir, sollte ein paar Dinge beherrschen: Feuer machen, Würmer fressen, Fische mit Speeren fangen, sich tarnen, Bärenfallen bauen, Hirsche ausnehmen, das ganze Programm. So zumindest stelle ich mir den Kurs vor. Er trägt den etwas kryptischen Namen «Coyote Mentoring», Gastgeber ist die Wildnisschule Wildeshausen, und wie der Name schon vermuten lässt, liegt sie irgendwo mitten in der Pampa.
Eine halbe Ewigkeit irre ich durch einen lichten Birken- und Kiefernwald, dann entdecke ich ein Haus, das mich an ein Schullandheim erinnert. Die Wände im Foyer sind in Pastellfarben getupft, an der Garderobe hängen bunte Gore-Tex-Jacken, gefütterte Westen und ein großer asiatischer Gong, und auf dem Boden liegt ein Haufen aus Trekkingstiefeln und Sandalen. Leider komme ich viel zu spät. Der Lehrgang hat schon begonnen, und Myriam, die Seminarleiterin, bittet mich, erst einmal einen Tee im Wintergarten zu trinken. Mit ihrem grünen Pulli und der braunen Mähne erinnert sie etwas an Ronja Räubertochter, doch dafür ist sie eigentlich viel zu schön. Sie sagt, ich solle mich bis zum Mittagessen gedulden. Danach müsse die Gruppe entscheiden, ob ich noch zu ihr stoßen darf.
Ich kann aus fünf Sorten Tee auswählen: Schwarz, Grün, Weiß, Rot und Yogi Tee. Auch die Kannen haben unterschiedliche Farben. Der schwarze Tee ist in der weißen Kanne, der rote in der blauen Kanne, der grüne in der schwarzen Kanne und so weiter und so fort. Mich überfordert das alles, ich gieße mir einen Getreidekaffee ein, lasse mich auf einem türkisfarbenen Holzstuhl nieder und sehe mich um. Der Wintergarten befindet sich unter einer langgezogenen, verglasten Dachschräge, ich sitze quasi direkt im Wald. Ein friedlicher Ort, wäre da nicht dieser Lärm. Es hört sich an, als würde die Küchenchefin nebenan mit Töpfen um sich werfen. Kocht sie, oder spielt sie Schlagzeug? Auf der hellblauen Fensterbank liegt ein Stapel Flyer, und ich vertreibe mir damit die Zeit. Das Moor- und Bauernmuseum Benthullen-Harbern lädt ein:
Wie war es noch, das Leben auf dem Land in der Mitte des letzten Jahrhunderts? Besichtigen Sie eine liebevoll nachgebaute Moorlandschaft, historische Trecker und Ackergeräte, zahlreiche komplett eingerichtete Handwerksbetriebe vom Schuster bis zum Schmied oder eine Zahnarztpraxis und einen Friseursalon mit zig Föhnen. Werfen Sie auch einen Blick in die ‹gute Stube› und lassen Sie sich im Cocktailsessel von Rudi Schurickes Caprifischern berieseln.
Klingt nett. In Wardenburg gibt es ein Schreibmaschinenmuseum, zwischen Delmenhorst und Harpstedt pendelt im Sommer eine historische Dampfeisenbahn, und das Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg kündigt die Sonderausstellung «Außerirdische Steine» an. Das Prunkstück der Sammlung: ein Chevrolet Malibu, dessen Heck 1992 in New York von einem Meteoriten durchschlagen wurde.
Ich finde auch eine Broschüre des Hauses. Jetzt weiß ich endlich, wo genau ich hier gelandet bin: Der Ort heißt Prinzhöfte-Horstedt, und bei dem vermeintlichen Schullandheim handelt es sich um ein «Kultur- und Tagungshaus für ganzheitliches Lernen». Das Gebäude sei «nach permakulturellen Gesichtspunkten gestaltet» und befördere «eine Atmosphäre der Kreativität und Ruhe». Ich ahne Böses. Manchmal dringt kindliches Gelächter aus den Seminarräumen, manchmal auch sphärische Flöten- und Gitarrenklänge. Es ist kurz vor eins, und nun höre ich die Teilnehmer singen: «Ich mag die Bäume, ich mag das bunte Laub, ich mag die Gräser, ich mag hier jeden Strauch, ich mag das Eichhörnchen, die Vögel hier im Wald, du-pi, du-pi, du-pi, du-pi, du-pi, du-pi, du-pi, du-pi, du.»
Es scheint das Pausenlied zu sein, denn jetzt jagen die Wildnisfreunde ans kalte Buffet. Meine Klischees erfüllen sich sofort: Norwegerpullis, Latzhosen, Batiktücher, Birkenstock. Allerdings füge ich mich mit meinen braunen Wollsocken, dem schwarzen Fleece und der Fidel-Castro-Kappe ganz wunderbar ein. Die Köchin hat sich wirklich ins Zeug gelegt, es gibt Kichererbsensalat, Mozzarella und Tomaten, Auberginenpolenta, Grießbrei und «vegetarische Fleischgerichte auf Anfrage». Dazu fällt mir ein, dass ich schon vor Jahren ein unschlagbares Geschäftsmodell entwickelt habe, das mich eines Tages sehr reich machen wird – ich möchte vegetarisches Angeln anbieten. Wie genau das funktionieren könnte, muss ich mir allerdings noch überlegen.





























