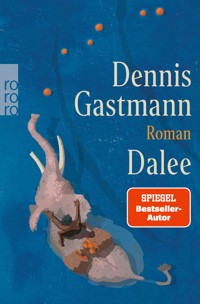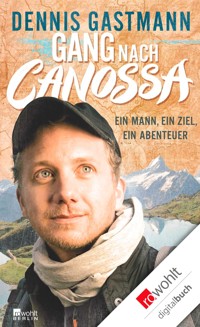9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seit zwei Jahren umrundet Weltreporter Dennis Gastmann den Erdball, um Fragen zu beantworten, die ihm die Zuschauer des Auslandsmagazins «Weltbilder» mit auf den Weg geben. Manche behandeln die großen Themen der Menschheit («Kommen Adam und Eva aus Afrika?», «Wo endet Europa?», «Was ist der amerikanische Traum?») oder die knallharten Realitäten des Lebens («Sind alle Latinos Machos?», «Gibt es noch Nazis in Argentinien?», «Wie stirbt es sich in Texas?»), andere geben große Rätsel auf: «Wer liegt vor Madagaskar?», «Warum wird man Torero?» oder «Wo steht das längste Ortsschild der Welt?». In diesem Buch beschreibt Dennis Gastmann seine skurrilsten Begegnungen auf allen fünf Kontinenten. Hartnäckig wie Michael Moore und furchtlos wie Borat, nur viel charmanter, unternimmt er seine Recherchen vor Ort. Das Ergebnis ist mal verblüffend, mal schockierend, aber immer schonungslos ehrlich und ziemlich lustig: In Sevilla lässt er sich von einem Torero in die Kunst des Stierkampfs einführen – und landet auf den Hörnern einer Kuh. In Pigalle erkundigt er sich bei einem Swingerclubbesitzer, ob Paris noch die Stadt der Liebe ist, und bei einem türkischen Meisterbeschneider, wo sich die Enden Europas befinden. Er zählt Schafe in Neuseeland, macht den Elefantenführerschein, trifft kettenrauchende Prinzessinnen in Thailand und diskutiert mit dem Generalsekretär des bolivianischen Präsidenten Evo Morales über den Sieg des Sozialismus und schwule Hähnchen. Ein pralles Abenteuerbuch – drastisch, bitter, komisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Dennis Gastmann
Mit 80 000 Fragen um die Welt
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Zitat
Prolog: «Warum ist der Neger schwarz?»
Kapitel 1: «Ist Holland in Not?»
Kapitel 2: «Ist Paris noch die Stadt der Liebe?»
Kapitel 3: «Warum wird man Torero?»
Kapitel 4: «Wo endet Europa?»
Kapitel 5: «Where are you guys from?»
Kapitel 6: «Was ist der amerikanische Traum?»
Kapitel 7: «Wie stirbt es sich in Texas?»
Kapitel 8: «Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?»
Kapitel 9: «Ist Amerika noch eine Supermacht?»
Kapitel 10: «Wo liegt eigentlich Absurdistan?»
Kapitel 11: «Wie macht man einen Elefantenführerschein?»
Kapitel 12: «Wo ist Nordkorea?»
Kapitel 13: «Kommen Adam und Eva aus Afrika?»
Kapitel 14: «Wo ist der schwarze Kontinent am schwärzesten?»
Kapitel 15: «Wer liegt vor Madagaskar?»
Kapitel 16: «Wie viele Schafe gibt es in Neuseeland?»
Kapitel 17: «Wo ist das längste Ortsschild der Welt?»
Kapitel 18: «Sind alle Australier Verbrecher?»
Kapitel 19: «Wie schön ist Panama?»
Kapitel 20: «Lebt Che Guevara noch?»
Kapitel 21: «Gibt es noch Nazis in Argentinien?»
Kapitel 22: «Sind alle Latinos Machos?»
Epilog: «Wo bist du gewesen?»
Danksagung
Für meine Familie
«So, wir fahren jetzt nach Nordkorea. Muss vorher noch jemand aufs Klo?»
Sergeant Meisenheimer, im August 2009
PROLOG
«WARUM IST DER NEGER SCHWARZ?»
REPORTERSCHICKSAL
Ich hatte nie eine Schwäche für Marmeladenbrötchen. Schon gar nicht mit Butter. Butter und Marmelade – ein ähnliches Gemisch hat BP im Golf von Mexiko angerührt. Unten: ein Schmierteppich. Oben: leblose Klumpen. Aber leider gibt es Menschen, die meine kleine Extravaganz nicht tolerieren.
Hallo, ich bin Dennis.
«Du musst da doch Butter unter nehmen!»
Wilma Brunkhorst sieht mich an, als hätte ich gerade ihr Weltbild zerstört.
«Frau Brunkhorst, ich mag das nicht mit Butter.»
«Bitte was? Keine Butter unter? Du bist doch ’ne schlanke Natur!»
Frau Brunkhorst ist schwerhörig. Sie redet nicht, sie kreischt. Dabei sollte man in Deckung gehen, denn wenn es schlecht läuft, fliegen dir scharfe Brötchensplitter und Marmeladenreste um die Ohren. Die kraushaarige Dame schnackt gern mit vollem Mund, sie ist eben vom Lande. Und wenn sie ausnahmsweise nicht spricht, stemmt sie ihre dritten Zähne in die dick bestrichenen Stullen– Gebäck und Gebiss erzeugen dann ein Geräusch, das du nicht mehr vergisst. Ähnlich muss es klingen, wenn man in einen Frosch beißt.
Natürlich ist die Erdbeermarmelade selbstgemacht, Wilma ist ein herzlicher Mensch. So herzlich, dass sie mich gerne abwechselnd tätschelt, knuddelt und fest umarmt. Wegen ihres Rheumas übrigens nur mit dem rechten Arm. Sie formt daraus einen Haken, legt ihn um meinen Hals und zieht mich immer wieder zu sich nach unten. Frau Brunkhorst ist sehr klein.
«Oh, mein lieber Dennis!», ruft das Ungeheuer aus der Tiefe. «Mensch, was ist das schön, dass du da bist. So ’n hübschen Bengel hab ich nicht oft inner Küche! So, und jetzt mach mal Butter unter. Sonst schmeckt das doch nicht.»
Das Fernsehen ist schuld. Ein großer Sender aus dem Norden hat mich an diesen Frühstückstisch gesetzt. Reporterschicksal: Wenn du ein Thema hast, dann musst du es «herunterbrechen». Also eine Nachricht, einen Anlass, ein Weltereignis mit der Heimat verknüpfen. Mit zu Hause. Manchmal bricht man sich dabei einen ab.
Michael Jackson ist tot! Was bedeutet das für Wilma Brunkhorst oder den Krabbenfischer aus Büsum? Krieg in Afghanistan! Wie schätzt Wilma Brunkhorst die Lage ein, und was sagen die Menschen aus Hahnenklee-Bockswiese dazu? Ein Reporter reist mit Zuschauerfragen um die ganze Welt! Welche bedeutende Frage stellt sich dann wohl Wilma Brunkhorst, die 87Jahre alte Röhrkohlbäuerin aus Wremen bei Bremerhaven? Dort, wo das Leben noch so norddeutsch ist wie vor fünfhunderttausend Jahren.
Das ist mein Auftrag: der Bilderbuch-Zuschauerin (Deich, Bauernhof, trockener Humor) ein paar geschmackvolle, bevorzugt norddeutsche Fragen entlocken und dann endlich abhauen in die große weite Welt. So weit weg wie möglich.
Das Brunkhorst’sche Anwesen hätten selbst die Bühnenbauer des Senders nicht authentischer dekorieren können. Ein schicker kleiner Giebelhof aus roten Backsteinen mit frisch gestrichenem grünem Tor und einer Diele, auf der Sensen, Milchkannen und ein hundert Jahre altes Fahrrad ihr verrostetes Dasein fristen. Über einen schmalen Gang geht es erst in die grün tapezierte Waschküche und dann in die hellbraun gekachelte Kochküche. Auch hier sieht es aus wie in den Kulissen des Ohnsorg-Theaters. Ein Teekessel pfeift auf dem Herd, darüber hängt ein Regal samt Kaffeemühle und Keramikdöschen, in denen Frau Brunkhorst vermutlich schwarzen Tee, Kandiszucker und Karamellbonbons hütet. Den Küchentisch bedeckt ein Tuch in Zartrosa, darüber liegt eine durchsichtige Kunststoffdecke.
Zur Feier des Tages hat Frau Brunkhorst ihr Sonntagsgeschirr aus dem Schrank geholt und Eier gekocht, die in norddeutsch blauen Bechern auf uns warten. Natürlich gibt es auch eine gute Stube – vollgestopft mit bestickten Kissen, Fotoalben und Oma-Möbeln: Eiche brutal.
Und Wilma? Sie ist die Frau, die Heidi Kabel immer zu spielen versucht hat. Wenn Frau Brunkhorst schnackt, dann fliegen ihre Händchen wie Schmetterlinge durch die Heizungsluft. Sie schimpft, tratscht, quietscht und setzt Pointen mit der Gewalt eines Jagdgewehrs in der Norddeutschen Tiefebene. Wilma Brunkhorst ist Norddeutschland.
«Wissen Sie, ich darf jetzt um die Welt bummeln!»
Wilma sieht mich völlig unbeeindruckt an. «Ja und? Dann bummel mal», sagt sie und schiebt sich kichernd ihre Brötchenhälfte ins Gebiss. Aber so leicht gebe ich nicht auf.
«Nein wirklich, Frau Brunkhorst. Ich darf mit den Fragen der Zuschauer um den ganzen Globus reisen!»
«So? Dann stell mir mal ’ne Frage.»
«Nein, Sie müssen mir eine Frage stellen!»
Es hilft nichts. Ich will ihr den Sinn meiner Sendung noch einmal erklären. Mit 80000Fragen um die Welt: Jeder Mensch hat eine Frage, die ihn von klein auf beschäftigt. In den letzten Wochen sind Hunderte davon bei mir eingegangen, über Facebook, Twitter, als E-Mail, Brief, Fax oder auf selbstgepinselten Postkarten: «Wie voll sind tausend Russen?», «Kann man im Vatikan Kondome kaufen?», «Warum verschwindet alles im Bermudadreieck?», «Wie schmeckt der Zuckerhut?» und «Wie riecht der Titicacasee?». Einer wollte wissen: «Woran starb das Tote Meer?»
Viele Zuschauer beschäftigen sich mit den großen Themen der Menschheit: «Was ist Freiheit?», «Wo endet Europa?» oder «Kommen Adam und Eva aus Afrika?». Andere fragen knallhart: «Wie stirbt es sich in Texas?», «Gibt es noch Nazis in Argentinien?» oder «Wo ist der schwarze Kontinent am schwärzesten?». Manche geben mir hintersinnige Rätsel auf: «Ist Cuba libre?», «Wer liegt vor Madagaskar?», «Ist Holland in Not?», «Wo liegt eigentlich Absurdistan?», «Wie schön ist Panama?» oder «Gibt es eine Sprache, die kein Futur bilden kann, und wenn ja: Können die Menschen dann an eine Zukunft denken?». All diese Fragen haben etwas gemeinsam: Sie schreien nach einer Antwort.
Ich verspreche Frau Brunkhorst, dass ich nicht ruhen werde, bis jede dieser 80000Missionen erfüllt ist. Und ich mache ihr klar, dass auch sie jetzt die einmalige Chance hat, mir eine Frage zu stellen. Eine weltbewegende Frage. Ich bin die gute Fee, und Frau Brunkhorst hat einen Wunsch frei.
Wilma legt ihr Marmeladenbrötchen aus der Hand. Sie wirkt plötzlich nervös. Für einen kurzen Moment ist die Naturgewalt sprachlos. Dann murmelt sie etwas und schleicht aus der Küche hinüber in die gute Stube. Was hat sie vor? Eine Schublade geht auf und wieder zu, und Frau Brunkhorst kehrt mit einem gefalteten Blatt Papier in der Hand zurück. Sie flüstert: «Weißt du, ich hatte mir da schon Gedanken gemacht.» Dabei presst sie das Zettelchen mit ihrer linken Hand auf den Küchentisch. Mit der rechten hält sie meine. In ihrem Blick mischen sich Zweifel und Mitleid: Sie will mir helfen, aber irgendetwas lässt sie zögern.
«Komm, ich will es dir mal vorlesen», brummelt sie und entfaltet das Papier, auf dem jetzt Bleistiftnotizen zum Vorschein kommen. Nun weiß ich, woran mich diese Szene erinnert: ein großer Moment in der Geschichte, ein Zettel, Wilma Brunkhorst meets Günter Schabowski.
«Also, mein Junge. Was ich immer schon mal wissen wollte: Warum ist der Neger schwarz?»
Ich blicke etwas ratlos, doch Wilma lässt sich, wo ihre Frage endlich raus ist, nicht beirren. Im Gegenteil, sie kommt erst richtig in Fahrt.
«Bengel, du hast doch gesagt, du willst jede Frage beantworten! Dann bitte erklär mir das mal: Wir sind weiß, der Chinese ist gelb, der Indianer ist rot, und der Neger ist eben schwarz. Ja, warum ist das so?»
Und dabei schaut sie so treuherzig und unschuldig wie ein zwei Wochen altes Robbenbaby in der Seehundstation Friedrichskoog.
«Frau Brunkhorst, ich möchte nicht unhöflich sein, aber haben Sie vielleicht noch eine andere Frage?»
«Ja, hier: Warum lieben sich immer mehr Männer?»
Wieder blickt sie mich so lieb an, sie will mir doch nur helfen.
«Mensch, das ist ’ne ganz normale Frage! Früher, da gab’s so was nicht, aber jetzt siehst du die Männer überall Hand in Hand. Und diese Knutscherei – das wird doch immer schlimmer.»
An diesem Morgen verliest Frau Brunkhorst noch viele andere gutgemeinte Fragen. Etwa ob Franzosen wirklich so schmutzig seien, wie manche Leute im Dorf behaupten. Oder warum das Spanferkel eigentlich Spanferkel heißt: «Weiß man nicht, oder? So ein kleines Schwein. Aber schmeckt gut.»
Es wird Zeit zu gehen. Ich bedanke mich höflich, wir stehen vor Wilmas grasgrünem Dielentor, sie zieht mich ein letztes Mal zu sich hinab, kneift mir in die Wange und bittet mich, ihr von unterwegs zu schreiben. Frau Brunkhorst bekommt nicht oft Besuch. «Tschüs, mein lieber Dennis, ich wünsch dir ’ne schöne Weltreise und sieh zu, dass du mich nicht vergisst!»
Ein paar Tage später stelle ich meinen Film in der Redaktion vor. Ich habe die besten Szenen aus dem Hause Brunkhorst geschmackvoll kombiniert und eine Swingmusik à la James Last unterlegt, das kommt gut an. Kein Quatschen mit vollem Mund, kein krachendes Gebiss– Wilma ist witzig und charmant, alles läuft bestens. Bis kurz vor Schluss. Bis zu dem Moment, in dem sie ihre Frage an die Welt verkünden soll. Die Masterfrage. Der Höhepunkt des Films. Die gefährliche Mission, die ich für Frau Brunkhorst eines Tages irgendwo auf diesem Planeten bestehen soll. Ich habe lange darüber nachgedacht und lasse sie nun die Frage aller Fragen vorlesen:
«Wie schmeckt Kängurufleisch?»
«Das ist alles?», fragt jemand aus der Redaktion. «Hat sie nicht noch was anderes gefragt?»
«Das ist alles», antworte ich, nehme meinen Koffer und schlurfe ein wenig heruntergebrochen in die große weite Welt. Für Wilma Brunkhorst, für meine Zuschauer und für Sie, liebe Leser. Oder um es mit den Worten eines ehemaligen Bundespräsidenten zu sagen: «Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger.»
KAPITEL 1
«IST HOLLAND IN NOT?»
DIE KÄSEMÄDCHEN
Meine Weltreise beginnt in einem gemieteten Opel Corsa auf der A1Richtung Amsterdam. Und irgendwo zwischen Oldenzaal und Apeldoorn ist sie schon fast wieder zu Ende. Rushhour. Ich bin in Eile und fahre links, zu schnell, Regen klatscht auf die Scheibe, und plötzlich steigt mein Vordermann beherzt in die Eisen. Blind reiße ich das Steuer nach rechts, mein Kotflügel fliegt haarscharf am Heck des anderen vorbei, und wie durch ein Wunder stoße ich in eine Autolücke, die wohl der liebe Gott gerade für mich geöffnet hat. Ich lasse den Wagen ausrollen und blicke den Produzenten an. Ich glaube, er ist tot.
Er heißt eigentlich Matthias, aber ich nenne ihn «den Produzenten», weil das so schön kalt und gefühllos klingt. Manche nennen ihn auch verrückt, weil er meine sonderbare Weltreise finanziert und mich mit seiner Kamera begleitet. Vor allem aber ist er ein guter Freund. Und so langsam kehrt gottlob wieder Farbe in sein Gesicht zurück.
«Hast du mal ein Sicherheitstraining gemacht?»
«Nein, ich habe Computer gespielt.»
Das erklärt meine guten Reaktionen auf holländischen Autobahnen. Und es erklärt mein Fernweh. Denn in den letzten Jahren habe ich viel zu viel Zeit am Bildschirm verbracht und viel zu wenig von der Welt gesehen. Kein Urlaub, kein Privatleben, Arbeit wie ein Besessener. Und in den Nächten, in denen ich vor Besessenheit nicht schlafen konnte, habe ich wie besessen gezockt. Pixelarmeen flimmerten durch meine Wohnung – ich habe sie alle niedergemacht. Autorennen – ich habe sie alle gewonnen. Und vielleicht hat uns das gerade den Hintern gerettet.
Reisen kenne ich eigentlich nur aus meiner Kindheit. Meine Mutter war mit mir auf Rhodos, an der Costa Brava und ein paarmal auf den Kanarischen Inseln. Und einmal im Jahr bin ich mit meinen Großeltern in ihrem weißen VW Passat Baujahr 77 nach Holland gefahren. Weil die beiden grundsätzlich zu viel Gepäck mitnahmen – ich erinnere mich an Kühltaschen, Federbetten und das hellgrüne Plastikbidet meiner Großmutter–, reisten wir immer mit einem offenen Anhänger, in dem auch unsere Fahrräder Platz fanden. Von meiner Heimatstadt Osnabrück dauerte es etwa eine Stunde bis zur Grenze, dann fing ich auf dem Rücksitz an zu quengeln: «Wann sind wir endlich daha?»
Das brachte meinen Großvater eines Tages so auf die Palme, dass er mir vor der nächsten Reise einen Auftrag gab: «Pass auf, mein Junge, diesmal musst du mir helfen: Weil du hinten sitzt, hast du den besten Blick auf unseren Hänger. Lass ihn auf der Fahrt nicht aus den Augen und sag mir sofort Bescheid, wenn er sich löst!» Von nun an konnten meine Großeltern die dreistündige Fahrt an die holländische Westküste völlig ungestört verbringen. Nur ab und zu meldete ich mich von der Rückbank und rief: «Alles klar, Opa! Der Hänger ist immer noch da!» Dass das ein fieser Trick war, ist mir erst kürzlich klar geworden.
Nun sitze ich am Steuer, und die holländische Grenze liegt etwa anderthalb Stunden hinter uns. Der Produzent und ich sind auf dem Weg nach Abcoude, einem Städtchen bei Amsterdam, und schon wieder jagen wir Kindheitserinnerungen.
Denn die Zuschauer wollen nicht nur wissen, ob Holland in Not sei. Sie gaben mir noch eine andere, ebenso berechtigte Frage mit auf den Weg: «Was macht eigentlich Frau Antje?» Und warum sollte man diese beiden Anliegen nicht kombinieren?
Ich musste nicht lange recherchieren, bis ich sie aufgespürt hatte: Frau Antje, die blonde Dame aus der Werbung, die immer so nett lächelte, wenn sie «echten Käse aus Holland» gebracht hat. Den Jingle von damals werde ich nie vergessen. Wer Frau Antje leibhaftig gegenüberstehen möchte, muss nicht ins ferne Käsewunderland reisen. Ihr Haus liegt auch nicht hinter einem gigantischen Gouda, durch den man sich hindurchfrisst. Es ist viel simpler: Du meldest dich bei der Pressestelle des holländischen Verbands für Milcherzeugnisse und lässt dir einen Termin geben. Dann stehst du vor einem modernen Quader aus hellbraunen Klinkern, mit Panoramafenstern und einem Flachdach. Davor parkt ein käsegelber Smart.
«Das wird es sein!», ruft der Produzent, und ich klingele. Klock, klock, klock macht es hinter der Tür. Das Geräusch wird immer lauter. Was geht hier vor? Plötzlich verstummt das Klocken, die Tür öffnet sich, und ich blicke auf zwei Holzschuhe. Darin steckt eine auffällig geschminkte Frau, Mitte dreißig, in holländischer Tracht, mit weißer Flügelhaube und blonden Zöpfen.
«Sind Sie Frau Antje?»
«Türlik! Welkom in Nederland!»
«Darf ich reinkommen?»
«Türlik!»
Auch ich schlüpfe in Holzschuhe, ein orange lackiertes Paar, und klockend begehen wir den Luxus-Käsetempel. Das Objekt ist maisonetteartig geschnitten. Über den modernen Wohnbereich – puristisch, dafür aber umso exklusiver eingerichtet – erreichen wir die offene Designerküche aus gebürstetem Aluminium. Frau Antje zeigt mir ihre Edelstahl-Käsemesser, und dreimal dürfen Sie raten, welches Milchprodukt ihre freistehende Kühl-Gefrier-Kombination dominiert. Neben einem Pop-Art-Porträt von Johann Wolfgang von Goethe hängt eine Frau Antje in Andy-Warhol-Optik. Wir setzen uns auf die alabasterweiße Couch, Frau Antjes Holzschuhe schieben sich in den cremefarbenen Flokatiteppich, und aus der iPod-Station fließt dezentes Easy Listening. Herr Antje ist ein wohlhabender TV-Produzent.
«Sind Sie wirklich Frau Antje?»
«Türlik!»
«Aber Sie müssten doch eigentlich viel älter sein.»
Ich bemerke die drei großen Goudas, die der blonde Sonnenschein ins Bild gerückt hat. Sie sind aus Plastik. «Ich bin die neue Frau Antje», quietscht Frau Antje und gibt mir etwas Nachhilfe in holländischer Geschichte.
Die allererste Frau Antje sei eine gewisse Kitty Janssen gewesen. Eine seriöse Schauspielerin, die das Werbegeld aber gut gebrauchen konnte. Das war 1961.Im deutschen Schwarzweißfernsehen grillte sie «Käsetoast Hawaii» und verkaufte der deutschen Hausfrau Rezeptbücher für eine Schutzgebühr von fünfzig Pfennig pro Exemplar. Übrigens nur der deutschen Hausfrau. Außerhalb der Bundesrepublik ist Frau Antje wenig bekannt, das gilt auch für Holland.
Nach zwei Jahren zog es die «Großmutter aller Frau Antjes», so nennt sie sich heute, wieder auf die Bühne. Statt Käse zu verkaufen, spielte sie nun Brecht. Die zweite Frau Antje war ein blondes Mannequin und wurde, wie das nun mal so ist, nach zehn Jahren durch eine jüngere Frau Antje ersetzt – aber nach weiteren zehn Jahren überraschend wieder eingestellt. Denn die jüngere Frau Antje hatte neben holländischem Käse noch andere, ausgefallene Hobbys: Sie zog sich für den «Playboy» aus und soll in eine Drogenaffäre verwickelt gewesen sein. Ende der Achtziger, die «ältere» Frau Antje war inzwischen Mitte vierzig, hatte das Büro für Milcherzeugnisse genug von der Frohnatur mit Flügelhaube. Es hieß, sie verkörpere ein altbackenes Bild von Holland. Frau Antje landete auf dem Werbefriedhof, irgendwo zwischen Clementine und Hustinettenbär.
Die Jahre vergingen, ein neues Jahrtausend brach an, und den Deutschen fehlte ihre Frau Antje immer mehr. So bekam die junge Physikerin Madeleen Driessen die Chance ihres Lebens:
«Es gab ein Casting, und jetzt bin ich das Käsemädchen!»
Madeleen setzt ihr schönstes Lächeln auf. Jedes Jahr besucht sie die Grüne Woche in Berlin, trifft Staatsbeamte und Minister, und allen bringt sie echten Käse aus Holland.
«Essen Sie eigentlich viel Käse?»
Schwups, da ist das Werbelächeln.
«Türlik! Morgens auf Brot, mittags im Salat und abends überbacken.»
«Wird Ihnen davon nicht schlecht?»
«Nein! Pikantje von Gouda kannst du immer essen.»
«Und ist Holland in Not?»
«Nö.»
«Nö?»
«Nö. Ganz sicher nicht.»
Türlik, das muss Frau Antje ja auch sagen. Aber man soll der Werbung eben nicht alles glauben.
Vermutlich verrät die Redewendung einfach, dass unsere Nachbarn immer schon befürchten mussten, bei Sonnenaufgang neben ihren Holzschuhen auf See zu treiben. Kennen Sie den höchsten Punkt der Nieder-Lande? Es ist der Vaalserberg im Dreiländereck bei Aachen mit lächerlichen 322,7Metern. Der tiefste Punkt Hollands liegt im Zuidplaspolder bei Gouda. Eingerahmt von der A20, einem Autohaus und ein paar Buchsbüschen steht eine meterhohe Aluminiumsäule. Davor sprüht eine Fontäne Wasser in den Regen. Auf der Säule ist eine dunkelblaue Skala, die den Meeresspiegel anzeigt: Der Zuidplaspolder liegt 6,74Meter unter Normalnull. Er ist übrigens auch der Tiefpunkt Europas.
Elf Millionen Holländer leben unter dem Meeresspiegel – und der steigt immer weiter an. Damit das Käseland eben nicht in Not gerät, investiert es Milliarden in Sperrwerke an den Küsten und Flussmündungen. Rotterdam zum Beispiel hat sich ein gigantisches Tor in den Hafen gesetzt. Zwei tonnenschwere Flügel, die sich bei einer Sturmflut zusammenschieben und über eine Million Menschen vor dem Wasser schützen sollen.
Noch eine Nummer größer ist das Oosterscheldewehr, ein kilometerlanger Damm, der im Ernstfall die gesamte Region Zeeland abriegelt und allmählich zu einer sonderbaren Touristenattraktion mit Spaßbad und Seelöwenshow mutiert. Es gibt viele solcher Wehre. Das hat mit jener Nacht im Winter des Jahres 1953 zu tun, die sie in Holland «de Ramp» nennen, die Katastrophe: Eine Springflut und ein schwerer Sturm erfassten den Süden des Landes, schnell stieg das Wasser um drei, vier Meter an. Es überraschte die Menschen im Schlaf, und zweitausend von ihnen starben. Auch wenn die Küsten heute bis über sieben Meter Wasserhöhe sicher sein sollen, fürchten sich viele Holländer noch immer. Nachts, wenn der Wind über die Brandung heult und man nicht weiß, ob man das Meer lieben oder hassen soll.
In solchen Nächten haben einige Küstenbewohner Albträume. Andere haben Visionen.
Und manche haben gleich beides. Es ist keine fünf Jahre her, da träumte Johan Huibers von einer verheerenden Sturmflut. Sie kam plötzlich, und niemand hatte sie vorhergesagt. Schnell war klar, dass der Wind stärker blies und die Wellen höher schlugen als bei der Katastrophe in den Fünfzigern. Holland schloss die teuren Tore und Barrieren, doch es half nichts. Das Wasser stieg und stieg, überwand die Wehre, und alle Dämme brachen. Wie eine Walze überrollte das Meer die Küste und riss jedes Haus, jeden Menschen und jedes Tier mit sich. Doch sein Hunger war noch nicht gestillt. Ohne Erbarmen fraß sich die Flut nun auch ins Inland, bis sie ganz Holland verschlungen hatte.
Am nächsten Morgen konnte sich Johan an jedes Detail seines Traums erinnern. Und weil er ein gläubiger Mensch ist, hielt er es für ein göttliches Zeichen. Er las die Heilige Schrift und erschrak, als er erkannte, dass Noah zu seiner Zeit denselben Traum hatte. Johan begriff, welches Schicksal der Herr ihm in dieser Nacht zuteilwerden ließ. Er nahm einen Hammer und eine Axt, fällte eintausend Bäume und tat es dem Mann gleich, der die Menschheit einst vor der Sintflut gerettet hatte. Johan Huibers zimmerte eine Arche.
Es bleiben Zweifel, als ich an der Seite von Deborah Huibers durch eine siebzig Meter lange, zehn Meter breite und zwölf Meter hohe Holzarche laufe. Sie ist die Tochter von Johan, der absagen musste, weil er gerade an einer neuen, doppelt so großen Arche baut. Allein.
Deborah hätte eine wunderbare Frau Antje abgegeben. Auch sie ist ein wenig zu stark geschminkt, mit langem, goudafarbenem Haar und freundlichen Kuhaugen. Wie zwei Holzschuhe hängen der Produzent und ich an ihr, als sie uns über das Schiff führt. Die Arche schwimmt auf einem Ponton und tourt als Attraktion durch ganz Holland. Sie gleicht ihrem biblischen Vorbild bis ins Detail: Über einem gigantischen, geschwungenen Rumpf thront eine Konstruktion aus vier Holzwänden und einem Giebeldach. Der Innenraum hat vier Stockwerke, Platz für eintausend Menschen. An den Seiten sind Ställe, in denen geschnitzte Giraffen, Elefanten, Büffel und andere Holzviecher aller erdenklichen Rassen stehen. Von jeder Art genau ein Paar.
«Sie haben hier sicher viele Besucher!»
«Ja, bis heute schon eine halbe Million.»
Deborah strahlt. Sie hat allen Grund zur Freude. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt, Kinder bis zwölf Jahre immerhin drei Euro. Die Arche akzeptiert auch Visa und Mastercard. Auf der untersten Ebene des Schiffes ist ein Kinoraum, in dem gerade ein Zeichentrickfilm über die Sintflut läuft. Nebenan kann jeder selbst mal Gott spielen. Du ziehst an einem Seil, das löst eine Mini-Sintflut aus, und schon schießt eine Plastikarche über eine Wasserrutsche und knallt gegen die Wand. Manchmal kippt das Schiff dabei um.
«Erkennst du das hier?»
Deborah deutet auf eine Holzkiste mit Tragegriffen, die jemand mit goldener Farbe besprüht hat. Darauf stehen zwei Plastikengel. Die Bundeslade.
«Das habe ich schon mal bei Indiana Jones gesehen», antworte ich, und sie blickt mich fragend an.
Eigentlich ist Deborah gelernte Stewardess, dann aber folgte sie den Visionen ihres Vaters, des Archetypen. Nun führt sie Schulklassen, Rentner und Presseleute durch das Schiff – ein anständiger Job. Andere in ihrem Alter besuchen Castings und enden als Käsemädchen.
«Geht es hier auch ein wenig um Mission?»
«Türlik, wir wollen den Leuten zeigen, dass die Bibel echt gut ist und dass man viel aus ihr lernen kann. Das ist unser großes Ziel. Wollt ihr noch die oberste Etage des Schiffes sehen?»
Wir folgen Deborah auf das Oberdeck. Dort präsentiert sie uns einen ausgestopften Noah aus Textil. Er sieht angeschlagen aus. Mit gekrümmtem Rücken und Schreibfeder in der Hand beugt sich der Meister über eine Papyrusrolle. Sein grauer Haarkranz ist ihm über die Schultern gewachsen und fließt in einen langen grauen Rauschebart. Das karge Leben auf der Arche hat dunkle Schatten in sein Gesicht gezeichnet.
«Das zeigt ihn, als er schon 600Jahre alt war!»
«600Jahre?»
«Ja, das ist unglaublich, oder?»
Ein biblisches Alter, das stimmt. In den Geschichten der Heiligen Schrift überdauern manche Protagonisten eben Jahrhunderte. Noah starb übrigens erst mit 950Jahren. Im zarten Alter von 500 zeugte er seine drei Söhne.
Weiter hinten im Schiff stehen Plakatwände mit Fotos und Textwüsten. «Wat zegt de Bijbel?» steht darüber. Deborah erklärt, es handele sich um wichtige Informationen zur Schöpfungsgeschichte.
«Seid ihr daran auch interessiert?»
«Nur so ganz grob: Schöpfung oder Evolution?»
«Schöpfung natürlich. Also, wir stammen sicher nicht vom Affen ab», lächelt Deborah, und so langsam zweifele ich an ihr.
«Das sind Kreationisten, Dennis», flüstert mir der Produzent zu.
«Was?»
«Die glauben noch an Adam und Eva!»
Und plötzlich fällt mir ein, was ich über Johan Huibers, den Nachwuchsnoah, gelesen hatte. Nach seinem Albtraum soll er verkündet haben, von nun an glaube er jeden Buchstaben in der Bibel. Was das bedeutet, kann ich jetzt live und in Farbe sehen. Wir schlendern an einer Wandmalerei vorbei. Zarte braune Pinselstriche auf weißer Fläche. Im Vordergrund ist Noah zu sehen, im Hintergrund ein zotteliger Elefant mit erstaunlich langen, geschwungenen Stoßzähnen. Hat der Bibelkapitän auch Mammuts gerettet? Deborah führt uns zu einer Schautafel mit den Kontinenten und einer Zeitleiste. Überschrift: «Creation versus Evolution».
«Wir glauben, dass die Erde erst 6000Jahre alt ist.»
«6000? Das habe ich noch nie gehört.»
«Doch, es ist wahr!»
«Seltsam, meine Biolehrerin hat uns immer von der Evolution erzählt. Darwin. Survival of the Fittest und der ganze Kram. Das soll viel länger gedauert haben.»
Deborah schüttelt den Kopf und deutet auf das Bild eines Einzellers.
«Soll das dein Ur-Opa sein? Das glauben wir nicht. Gott hat den Menschen und alle Tiere in sechs Tagen erschaffen. 4000Jahre vor Christus.»
«Aber gibt es nicht wissenschaftliche Funde, Fossilien, die viel älter sind?»
«Ich bin kein Wissenschaftler. Und unser Glaube ist keine Wissenschaft. Wir glauben, was die Bibel sagt, und überhaupt: In der Zeitung steht, diese Fossilien sind Millionen Jahre alt. Aber nicht alles, was in der Zeitung steht, ist richtig. Vielleicht ist die Bibel richtig?»
Deborah drückt mir ein orangefarbenes Büchlein in die Hand. Auf dem Cover ist eine Arche Noah und noch etwas anderes. Grün, groß und gefräßig: ein Tyrannosaurus Rex. Titel: «Dinosaurier und die Bibel».
«Noah hatte Dinosaurier auf seiner Arche?»
«Türlik!»
«Wie sollen die denn auf das Schiff gepasst haben?»
«Noah hat nur Dinosaurierbabys mitgenommen. Die waren noch ganz klein und harmlos. Außerdem: Alle Dinosaurier waren ursprünglich Vegetarier, Fleischesser sind erst nach der Flut entstanden.»
Ich sehe in Deborahs blaue Kulleraugen und suche darin nach Zweifeln. Nichts. «Das sind alles völlig neue Erkenntnisse für mich. Darüber muss ich erst nachdenken.»
«Ja, die Medien wollten nicht, dass das bekannt wird. Aber jetzt weißt du es.»
«Und sagen Sie, ist Holland eigentlich in Not?»
«Nö.»
«Nö?»
«Nö. Wer dem Herrn folgt, der ist niemals in Not.»
KAPITEL 2
«IST PARIS NOCH DIE STADT DER LIEBE?»
PROBELIEGEN BEI MONSIEUR ROGER
Kennen Sie Alfons, den französischen Straßenreporter mit dem Puschelmikrophon? Er hatte mich gewarnt. «Versuch das nicht!», sagte er. «Der Wickert hat das in den Achtzigern getan, aber heute ist es wirklich gefährlich!» Vielleicht hätte ich auf ihn hören sollen, nun ist es zu spät.
Ich stehe unter dem Obelisken im Zentrum der Place de la Concorde und zähle die Fahrspuren der monströsen Straße, die um mich herumführt. Es gibt keine. Ohne jede Markierung brettern Motorräder, Autos und Lastwagen in Zehner- oder Zwölferreihen vorbei. Manchmal kann ich dazwischen den Produzenten erkennen. Er steht mit seiner Kamera auf der anderen Straßenseite und wartet. Er wartet schon lange.
Ich könnte die Fußgängerampel benutzen. Normale Menschen tun das – sogar die Franzosen. Aber ich finde das feige. Ich will es exakt so machen wie Ulrich Wickert. Ich will die Mutprobe bestehen, die den gewöhnlichen Auslandskorrespondenten von der Reporterlegende unterscheidet.
Wickert wirkte völlig gelassen, als er dem deutschen Fernsehpublikum präsentierte, wie man die Place de la Concorde am einfachsten überquert. «Es sieht unmöglich aus, aber es geht», sagte er und marschierte, ohne nach links oder rechts zu blicken, quer über die Fahrbahn. Genau so muss Jesus übers Wasser gelaufen sein. Wickert plauderte dabei sogar fröhlich ins Mikrophon: «Wenn man nicht hinschaut», erklärte er, «dann denken die Fahrer, sie müssen aufpassen.»
Doch ich habe Angst. Denn seit Wickerts Zeiten hat sich an der Place de la Concorde etwas Entscheidendes verändert: Es gibt Ampeln. Früher blieb den Fußgängern nichts anderes übrig, als blind über die Fahrbahn zu hechten, und die Pariser Autofahrer hatten sich daran gewöhnt. Heute haben sie sich an die Fußgängerampeln gewöhnt.
Soll ich es wirklich wagen?
Ich fasse mir ein Herz und setze den rechten Fuß auf die Fahrbahn. Dann den linken. Dann gehe ich weiter. Einen Schritt nach dem anderen. Zen. Nur nicht zur Seite gucken. Nur nicht… o verdammt, ich hab’s getan! Schreiend renne ich zurück zum Obelisken, atme tief durch und versuche es noch einmal. Langsam. Schritt für Schritt. Nicht gucken, nur gehen. Einfach weitergehen. Wagen rauschen an mir vorbei, ich blicke ihnen nicht nach. Ein Bulli hupt in meinem Rücken, ich reagiere nicht. Ein Mofa streift meinen Koffer, ich gehe weiter, einfach weiter, und irgendwann stehe ich zitternd neben dem Produzenten. Er ist der erste Mensch, den ich um eine Zigarette bitte. Ich bin überzeugter Nichtraucher.
Kurz darauf biete ich selbst eine an. Ich stehe neben einem Kiosk im Stadtviertel Bastille, und die Abendsonne fällt auf ein französisches Wörterbuch in meiner linken Hand. «Voulez vous une cigarette?», frage ich ein Mädchen mit kurzen blonden Haaren. Sie lächelt. «Je regrette», sage ich, «es tut mir leid. Ich habe gar keine Zigaretten. Aber würdest du vielleicht mit mir ausgehen?» Jetzt lächelt das Mädchen nicht mehr und dreht sich um. Ich versuche es bei zwei Studentinnen: «Avez vous envie de prendre un café chez moi? – Habt ihr Lust, einen Kaffee bei mir zu trinken?» Sie lachen mich aus. Die Mädchen lachen noch lauter, als sie den Produzenten bemerken, der uns aus der Ferne filmt. Ja, das hier ist eine Straßenumfrage mit versteckter Kamera. Ich spiele weiter den Filou und frage Damen, die eindeutig zu alt für mich sind, was sie am Abend vorhaben: «Je cherche l’amour!» Sie prusten vor Lachen und wünschen mir «Bonne chance!».
Im Fernsehen wirkt es charmant, aber für mich ist es eine Tortur. Ich fühle mich wie mein Kollege Alfons, der mit naiven Fragen und französischem Akzent Rentner auf dem Wochenmarkt in Hamburg-Niendorf interviewt: «Isch möschtö Sie etwas fraggen. Was wärren Sie liebär: schwul odär ein Politikär?»
Nur umgekehrt: Ich bin ein deutscher Alfons in Paris. «Ich kann euch Deutsche nicht verstehen», hatte er mir vor der Reise gesagt. «Ihr fahrt nach Paris, redet von ‹Stadt der Liebe› und findet alles, aber auch wirklich alles toll. Für uns Franzosen ist diese Stadt einfach nur ein dreckiges Loch. Wir hassen Paris.»
Es beginnt zu regnen. Wir beenden den Drehtag, und der Produzent begleitet mich ins Hotel, ein moderner Bau in der Rue de Bagnolet. Unverputzte Betonwände, Stühle und Tische aus Plexiglas. Die Bäder sind gelb gestrichen, und über den rechteckigen Waschbecken baumeln schwarze Lampenschirme. Auch mein Zimmer ist schwarz. Zwei Wände sind schwarz gestrichen, an den übrigen hängen Spiegel, die das Schwarz aufsaugen. Auf meinem Nachttisch steht eine schwarze Statue. Jemand hat ihr eine Glühbirne in den Kopf geschraubt. Ihr schummriges Licht fällt auf den schwarzen Teppich und den schwarzen Vorhang hinter meinem Bett, der das kleine Fenster zur Straße verdeckt. Es ist ein cooles Hotel, aber es macht depressiv. Der Produzent übernachtet anderswo. Er bleibt bei seiner Freundin Babette, die in der Nähe ein kleines Apartment bewohnt. Für ihn ist Paris heute ganz sicher die Stadt der Liebe.
Und für mich? Mir geht es wie allen Deutschen, die nach Paris kommen. Egal, wo ich in dieser Stadt auch hinsehe, ich finde sie zum Niederknien schön. Und genau das ist mein Problem. Setz dich mal einen Nachmittag lang auf die Stufen des Sacré-Cœur und blicke vom Montmartre aus über die Dächer der alten Gebäude. Du siehst die kleinen Schornsteine, die verzierten Fenster, im Vordergrund beginnt eine altmodische Laterne zu glimmen, und irgendwo spielt jemand Chansons von Gilbert Bécaud. Du magst diesen Touristenscheiß noch so sehr hassen, dennoch wächst etwas in dir, das du nicht aufhalten kannst. Es beginnt im Bauch, kriecht langsam durch alle Organe bis in dein Herz, und wenn du allein bist, dann tut es weh. Ich bin allein. Und Paris macht alles noch schlimmer.
Das war schon früher so. Ich war dreizehn und unsterblich verliebt in Verena, ein Mädchen aus meiner Klasse mit Pagenkopf und Zahnspange. Als ich hörte, dass sie mit einer Gruppe des Gemeinschaftszentrums Ziegenbrink für ein Wochenende nach Paris fahren wollte, entdeckte ich meinen Gemeinschaftssinn und schloss mich an. Wir saßen im Bus nebeneinander, und im Euro Disney habe ich zum ersten Mal versucht, sie zu küssen. Es war auch das letzte Mal.
Auch die zweite Paris-Geschichte aus meiner Kindheit hat mit einer Busreise zu tun. Vielleicht hatte meine Mutter tatsächlich romantische Gedanken, als sie die fünftägige Tour inklusive Hotel und einer Bootsfahrt auf der Seine buchte. Der Trip endete in einem billigen Hotel im Rotlichtbezirk Pigalle. Ich kann mich noch an den finsteren Typ in Unterhemd und Hosenträgern erinnern, der am Empfang hinter Panzerglas saß und meiner Mutter die Zimmerschlüssel in die Hand drückte. Direkt unter unserem Bett fuhr die Metro, im Nebenzimmer verprügelte jemand eine Frau, und Mutti weinte. Am nächsten Morgen wanderten wir durch Pigalle. Vorbei am Moulin Rouge, an den Sexshops und an Frauen in roter Reizwäsche, die in den Hauseingängen auf Freier warteten. Es waren meine ersten Eindrücke von Paris bei Tageslicht: «Mama, sind eigentlich alle Franzosen versaut?»
«Franzosen machen immer Liebe. Jedes Jahr, jeden Monat und jeden Tag», sagt Alain Plumet, ein altes Männlein im Trenchcoat mit grauem Kinnbart und Knopfaugen. Ich folge ihm durch das Musée de l’érotisme, das Erotikmuseum im Herzen von Pigalle, vorbei an riesigen Porzellanpenissen und kopulierenden Statuen. Eine Figur steckt der anderen einen Eiffelturm in den Hintern, in der Ecke läuft ein Hardcore-Porno, und im Treppenhaus hängt ein Spiel mit einem heißen Draht. Wenn man sich geschickt anstellt, dann stöhnt eine großbusige Frau. Das gefällt Plumet: «Öhö, öhö», stöhnt er mit ein. Alain Plumet ist der Kurator dieser bedeutenden Vernissage.
«Ich war auch mal beim Film.»
«Ach wirklich? In welchem Bereich?»
«Erotik.»
«Wollen Sie darüber reden?»
«Non.»