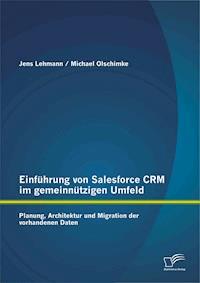9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Klartext: Jens Lehmann zieht Bilanz Jens Lehmann schreibt über seine Karriere in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft und im internationalen Spitzenfußball. Über seine Erfahrungen, Desaster, Siege und Triumphe. Über seine Clubs, Mitspieler und Trainer, über Erfolgsstrategien im Spitzensport. Zweimal wird er zum besten Torwart Europas gewählt. Er ist deutscher und englischer Meister, Vize-Europameister und hat den UEFA-Pokal gewonnen. In einer Champions-League-Saison bleibt er sagenhafte 852 Minuten ohne Gegentor. Jens Lehmann ist einer der erfolgreichsten Torhüter der letzten Jahrzehnte – und einer der eigenwilligsten. Nie ist er den einfachsten oder naheliegendsten Weg gegangen, immer hat er Herausforderungen gesucht, die nicht nur den Fußballer, sondern den Menschen Jens Lehmann fordern und weiterbringen, weit über den Fußballplatz hinaus. Nun zieht dieser außergewöhnliche Sportler Bilanz und schreibt über seine Karriere in der Bundesliga, der Nationalmannschaft, in der italienischen Seria A und der englischen Premier League. Offen, vorbehaltlos und mit dem ihm eigenen trockenen Humor erzählt Jens Lehmann nicht nur von seinen großen Erfolgen, sondern auch von prägenden Niederlagen und den Sackgassen, in die ihn bisweilen seine Risikofreude und das Festhalten an seinen Überzeugungen geführt haben. Er lässt die Stationen einer Karriere Revue passieren, die ihn von Schalke über Dortmund nach Mailand, London und schließlich nach Stuttgart führt. Er schreibt über das Innenleben europäischer Großklubs, über seine Mitspieler, Trainer und Rivalen wie Oliver Kahn, den er mit tollen Leistungen und Beharrlichkeit aus dem Tor der Nationalmannschaft verdrängt. Bei der WM 2006 wird Jens Lehmann zu einem der Helden des Sommermärchens; in seinem Buch erläutert er das Geheimnis dieser Mannschaft ebenso wie seine legendäre Zettelwirtschaft aus dem historischen Elfmeterschießen gegen Argentinien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
» Buch lesen
» Das Buch
» Die Autoren
» Impressum
Inhalt
Das wichtigste Spiel meines Lebens
Sich nach der Decke strecken – wie ich Profi wurde
Die Angst besiegen, oder: Was es heißt, Torwart zu sein
Blau und Weiß, wie lieb ich dich – meine Jahre bei Schalke 04
Meine (kurze) italienische Reise
Von Königsblau zu Schwarzgelb – riskanter Wechsel nach Dortmund
Spielregel im Fußball: Stärke zeigen!
Eine andere Welt – im Mutterland des Fußballs
Alltag mit Stars – wie eine Weltklassemannschaft funktioniert
Von harten Hunden, großen Schweigern und scharfen Denkern: meine Trainer
Wie ich die deutsche Nummer 1 wurde
Ein Rekord für die Ewigkeit – 852 Minuten Champions League ohne Gegentor
Da simmer dabei! Dat is prima! Die Weltmeisterschaft 2006
Geliebt, gehasst – mein Verhältnis zum Publikum
Alles für eine Zeile – die Macht der Medien
Von der Bank ins Finale – die Europameisterschaft 2008
Wenn es am schönsten ist – internationale Abschiede und schwäbischer Neuanfang
Und jetzt?
[Inhalt]
Das wichtigste Spiel meines Lebens
Der Zettel. Schon vor dem Spiel habe ich ihn mir genau angeschaut und versucht, mir ein paar der Namen zu merken, zusammen mit den Informationen über den Schützen. Langer Anlauf, linke Ecke, so was. Eigentlich ist es wie Vokabeln lernen, jedenfalls habe ich versucht, es so zu machen. Klingt einfach: eine Handvoll Namen, ein paar Begriffe dazu, fertig. Aber es ist wie früher in der Schule: Fallen einem die Wörter, die Bedeutungen auch ein, wenn man alleine vorne an der Tafel steht? Meine Tafel ist riesig, 7,32 mal 2,44 Meter – das Tor. Und die Schulstunde dauert bereits 120 Minuten, es ist drückend heiß an diesem Frühsommerabend, drei Kilo Gewicht habe ich seit dem Anpfiff vor gut zwei Stunden verloren. Außerdem sitzen in meinem Klassenraum nicht mucksmäuschenstill 30, 40 Mitschüler, die froh sind, dass nicht sie dran sind, sondern ich vorne stehe. Nein, in meinem Klassenraum drängen sich 83434 Menschen, Verrückte, Fußballfans. Schon während des Spiels haben sie so laut gepfiffen, dass ich mir auf dem Platz die Ohren zuhalten musste. So einen Lärm habe ich weder davor noch danach je erlebt. Und jetzt, als Ivan Zamorano den Ball nimmt, wird alles noch schlimmer. 1:1 steht es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung, als der chilenische Nationalspieler als Erster zum Elfmeterpunkt …
Moment mal, werden Sie jetzt vielleicht sagen, Chile? Aber das Spiel mit dem Zettel war doch gegen Argentinien! Wissen wir doch längst alles, das Sommermärchen, tausend Mal erzählt: Weltmeisterschaft 2006, Viertelfinale in Berlin, 1:1 nach Verlängerung, Tore von Ayala und Klose. Und der erste Elfmeterschütze der Argentinier hieß doch Cruz, Julio Ricardo Cruz!
Ja, schon. Aber es gibt da noch ein Stück Papier in meinem Leben. Und das ist für mich noch wichtiger als jener Zettel aus dem Schlosshotel Grunewald, der nach der WM für eine Million Euro versteigert wurde. Offenbar gehören solche Zettel zu meinen Erfolgen wie Gebetbücher in die Kirche. Das Exemplar, das mir half, das wichtigste Spiel meines Lebens zu gewinnen, hat Huub Stevens geschrieben, am 21. Mai 1997. In Mailand.
Oder war es doch in Erba, am Comer See? Mitunter gehen auch die Details der ganz großen Momente verloren, so gewaltig ist die Konzentration auf das Eigentliche, das Spiel. Legenden ranken sich um das, was vor einem Spiel oder während der Halbzeitpause in der Kabine gesagt, getan wird. Ich muss gestehen: Für mich sind die Minuten in der Kabine eine erinnerungslose Zeit. Ich habe auch keine besonderen Rituale; den Socken, auf dem ein kleines R steht, ziehe ich brav rechts an, selbst die Reihenfolge von rechts und links ist mir egal. Sonst wird man zu einem Gefangenen der eigenen Riten. Einzige Ausnahme: Wenn ich ein Spiel nicht verliere, trage ich die Handschuhe weiter. In meiner Zeit in England habe ich ein Paar mal 49 Partien hintereinander angehabt – das musste ich gut pflegen, damit es nicht auseinanderfiel. Ansonsten kümmere ich mich um meine Schuhe und überlege, welche Stollen ich nehmen soll – die langen? Oder doch lieber die kurzen, weil der Platz heute trockener ist? Dann kreisen die Gedanken nur noch ums Warmmachen und das Spiel. Der Rest liegt im Dunkel jenseits des Tunnelblicks.
Ich weiß noch, dass ich den Mailänder Zettel schon vor dem Spiel hatte. Aber wurde er erst in der Kabine des Giuseppe-Meazza-Stadions geschrieben oder nicht doch schon im Hotel Castello di Casiglio in Erba? Hier hatte bereits die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 1990 gewohnt, und das sollte auch ein gutes Omen für uns sein, für die Mannschaft von Schalke 04. Nur dieses eine Spiel trennte uns noch vom größten Erfolg der Vereinsgeschichte – dem Gewinn des UEFA-Pokals. Das war damals alles andere als der »Pokal der Verlierer«, wie ihn Franz Beckenbauer später mal abschätzig genannt hat. Vor der Einführung der Champions League spielten da – bis auf die Landesmeister – die besten Mannschaften Europas. Arsenal, Valencia, Glasgow, Istanbul, AS und Lazio Rom, Bayern München – sie alle waren zusammen mit uns im Herbst 1996 in der ersten von sechs Runden angetreten. Wir waren ein absoluter Außenseiter: Zum ersten Mal seit fast zwanzig Jahren konnte sich überhaupt eine Schalker Mannschaft für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren, und in der Bundesliga lief es auch nur mittelmäßig (Zwölfter wurden wir am Ende der Saison). Außer Olaf Thon und Marc Wilmots hatte kaum jemand von uns internationale Erfahrung, Namen wie Yves Eigenrauch, Michael Büskens oder Jens Lehmann kannte in Europa noch niemand. Gleich zu Beginn der Saison hatten wir Spieler auch noch dafür gesorgt, dass unser Trainer Jörg Berger entlassen wurde – die gesamte Mannschaft hatte das Gefühl, mit ihm nicht mehr weiterkommen zu können. Nicht eben geordnete Verhältnisse also, und wenig deutete darauf hin, dass aus dieser Mannschaft der Namenlosen innerhalb weniger Wochen die legendären »Eurofighter« werden sollten.
Unseren neuen Trainer bekamen wir ausgerechnet von unserem ersten Gegner im UEFA-Pokal, von Roda Kerkrade. Zwei Wochen, nachdem wir die Holländer ausgeschaltet hatten, fing Huub Stevens bei uns an. Unser Manager Rudi Assauer hatte ihn für gut befunden – und damit einen Glücksgriff getan. Stevens’ Programm kann man schon an seiner Frisur erkennen – der kämmt sich mit dem Zirkel. Uns hat er von allem das entscheidende bisschen Mehr mitgegeben, mehr Disziplin, mehr Technik, mehr Organisation. Dazu kam unser unbändiger Wille, der wahrscheinlich aus Minderwertigkeitsgefühlen und Trotz geboren war: Für viele von uns war es die letzte Chance zu beweisen, dass der Fußballgott oder auch nur die Manager der großen Vereine sie zu Unrecht übersehen hatten. Wir wollten beweisen, dass wir Durchschnittskicker mit Kameradschaft und einer besseren Spiel-Organisation als die anderen konkurrenzfähig waren. Mit Stevens begannen wir eine Serie, wie es sie im UEFA-Pokal noch nie gegeben hatte: Wir haben in allen Heimspielen kein einziges Gegentor kassiert. »Die Null muss stehen«, Stevens’ Beitrag zum Schatzkästlein der unsterblichen Fußballweisheiten, wurde in jener Saison geformt. 3:0 gegen Kerkrade, 1:0 gegen Trabzonspor, 2:0 gegen Brügge, 2:0 gegen Valencia, 2:0 gegen Teneriffa – das hatte auch keines der Starensembles jemals geschafft (von mancher blau-weißen Zitterpartie auswärts jetzt kein Wort). Zuletzt waren nur noch zwei Mannschaften übrig – Inter Mailand und wir.
Es war das letzte Mal, dass der Pokalgewinner in zwei Finals ausgespielt wurde. Wir traten zuerst im Parkstadion an, wo die Null stehen musste, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollten. Und sie stand. Freundlich gesagt, war es ein ereignisarmes Spiel. »Der mit dem Zirkel kämmt« blieb seinem Ruf treu und wechselte erst 23 Minuten vor Schluss einen zweiten Stürmer ein, Martin Max. Aber in dieser Saison machte Huub Stevens einfach alles richtig – nur drei Minuten später war der Platz da, den Marc Wilmots für seinen 25-Meter-Schuss zum 1:0 brauchte. »S 04 – eine Hand am Cup!« stand nach dem Schlusspfiff an der Anzeigentafel.
Das zweite Finale, das zum wichtigsten Spiel meines Lebens werden sollte, begann für mich Stunden vor dem Anpfiff – in einem Gotteshaus. Zum Hotel in Erba gehört auch eine kleine Kapelle. Da bin ich hin am Morgen des 21. Mai 1997. Der Glaube ist etwas so Persönliches, dass ich darüber nicht viele Worte machen möchte. Aber eins ist klar: Man betet nicht zu Gott, wenn man denkt, der guckt eh nicht. Vielleicht hatte ich also auch nach höherem Beistand gesucht, in die Kapelle kam aber Charly Neumann, unser Mannschaftsbetreuer, das Schalker Sozialkraftwerk seit jenen Tagen in den Fünfzigern, als Charly, der gelernte Bäcker, Ernst Kuzorra die frischen Brötchen brachte. Und weil man in einem Gotteshaus still sein soll, saß Charly, der nie um ein Wort (und selten um eine Träne) verlegen war, schweigend neben mir. Erst auf dem Rückweg zum Hotel brach es aus ihm heraus: »Mensch, Junge, hättest du gedacht, dass wir mal hier spielen?« – Ich: »Nein, Charly, wirklich nicht. Aber jetzt müssen wir auch gewinnen!« Er: »Keine Sorge, der liebe Herrgott wird ein Auge auf uns richten.«
Mein Mittagsschläfchen hatte ER an dem Tag aber noch nicht im Blick. Es gehört ja zur Routine vor einem Abendspiel, sich vor der Abfahrt ins Stadion noch mal hinzulegen. Normalerweise kann ich einschlafen wie auf Knopfdruck. Wenn ich heute, mit vierzig Jahren, um 20.45 Uhr zu einem wichtigen internationalen Spiel auflaufe, fange ich frühestens um 19 Uhr an, mir darüber ernsthaft Gedanken zu machen, manchmal noch später (und mitunter bin ich selbst beim Anpfiff noch nicht aufgeregt). Doch an diesem Tag war das alles noch ganz anders. Ich war zwar auch schon 27 Jahre alt, nach heutigen Maßstäben fast schon ein Alter. Aber in jenen Tagen unmittelbar nach dem Bosman-Urteil war die Umwälzgeschwindigkeit im Profi-Fußball ungleich langsamer, man blieb länger bei einem Verein, und Karrieren schossen seltener wie Raketen in den Himmel. Mein erstes Länderspiel sollte ich erst ein knappes Jahr später machen, und auch nach fast zehn Jahren bei Schalke konnte ich mir meiner Position als Nummer 1 keineswegs sicher sein. Ich lag also auf dem Bett in meinem kleinen Zimmer in Erba und starrte die Holzbalkendecke an, bis ich jedes Astloch mit Vornamen kannte. Was, wenn ich heute nicht gut halte? Sägt dich der Trainer ab? Und was dann?
Eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff waren wir dann endlich im Stadion. Ich hatte noch kurz mit meiner Familie und meiner Freundin telefoniert, die alle in Mailand waren und erzählten, dass der riesige Platz vor dem Mailänder Dom voll war mit Schalker Fans, die ununterbrochen sangen, den ganzen Nachmittag lang. Am Ende klatschten selbst die Italiener dieser friedlichen Ausdauerleistung Beifall. Wir wussten also von der Treue unserer Fans, aber als wir dann erstmals den Rasen betraten, waren wir doch überwältigt: Die blau-weiße Wand aus 20 000 Leibern war offenbar von der Innenstadt ins Stadion verlegt worden. Und diese Wand sang. Noch heute bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich an diesen Mailänder Moment denke. Ein Heimspiel, 1500 Kilometer von zu Hause entfernt. Auf dem Weg mit dem Bus durch die Stadt hatten wir natürlich auch italienische Fans gesehen, die uns siegesgewiss die Hand mit ausgestreckten Fingern hinhielten: Fünf Stück kriegt ihr! Aber so was hat mich in all den Jahren nur zusätzlich in Wallung gebracht. Wartet nur ab, ihr kleinen Italiener, euch werd ich’s zeigen! In den Minuten vor dem Spiel aber muss man dieser Anspannung Herr werden und aufpassen, dass man nicht zittert.
Die erste Halbzeit spielten wir auf unsere Fans zu. Vielleicht hatte der blau-weiße Sirenen-Gesang den Italienern den Kopf verdreht, vielleicht waren wir einfach besser – jedenfalls stand auch auswärts die Null, insgesamt 85 Minuten lang, bis zu jenem Einwurf kurz vor Schluss auf der von mir aus gesehen rechten Seite. Irgendwie mogelte sich der Ball durch unsere Abwehr, Ivan Zamorano, von dem noch die Rede sein wird, schaltete am schnellsten und traf den Ball fünf, sechs Meter vor meinem Tor. Das ist doch gar kein richtiger Schuss, dachte ich, eher ein seitliches Drücken! Aber der Ball fliegt oben rechts in den Winkel.
Verlängerung. »Komm, das schaffen wir!« – »Das halten wir durch!« – »Zur Not gehen wir ins Elfmeterschießen!« Einen Preis für sprachliche Originalität gewinnt in so einer Situation keine Mannschaft der Welt. Der Körper steckt so voller Adrenalin, dass man gar nichts mehr spürt, keinen Schmerz, keine Erschöpfung, aber auch brillante Gedanken kommen keine mehr vorbei. Dabei konnten wir die gut gebrauchen, denn inzwischen spielten wir elf gegen zehn, der Mailänder Salvatore Fresi war vom Platz geflogen. Was nun? Auf Sieg spielen? Aber wir wollten auch nicht volles Risiko gehen. Und so kam es, wie es wahrscheinlich auf allen Bolzplätzen der Welt kommt: Wir machten das Spiel, die Chancen aber hatte Inter. Es waren noch elf Minuten zu spielen, als eine Bogenlampe in meinen Strafraum flog, ich ging raus, der Ball sprang auf und Maurizio Ganz lupfte ihn über mich. Ich guckte und dachte nur eins: Scheiße.
Es gibt einige Szenen, die sich in meinem Gehirn festgebrannt haben wie das finale Duell auf der »High Noon«-DVD, und diese gehört dazu. Der Ball flog, ich schätzte seine Höhe und dachte: Ist nicht sicher, dass der drin ist. Wenn doch, ist alles verloren. Mike Büskens lief hinterher, alle, Spieler, Schiedsrichter, Zuschauer starrten wie vom elektrischen Schlag getroffen dem Ball nach – bis er auf die Latte fiel und Mike Büskens ihn wegdrosch. Der Rest war Mauern, bis der Schlusspfiff kommt.
Elfmeterschießen. Torwartstunde. Sagt man so. Weil der Torwart angeblich nichts zu verlieren hat. Aber das ist Quatsch. Der Druck auf den Torwart ist immens. Jede Mannschaft erwartet insgeheim, dass der eigene Keeper mindestens einen hält. Da soll man nichts zu verlieren haben? Außerdem: Bei meinem letzten Elfmeterschießen hieß mein Verein noch Schwarz-Weiß Essen, das war in der B-Jugend. Im DFB-Pokal war ich immer unspektakulär ausgeschieden, und in der Bundesliga gibt es kein Elfmeterschießen. Also war das hier meine Profi-Premiere als Elfmetertöter, im Finale des UEFA-Pokals. Ich tat instinktiv das, was ich in späteren Jahren immer wieder getan habe: Ich setzte mich alleine an die Mittellinie, trank einen Schluck, konzentrierte mich. Es gibt Kollegen, die machen dann Scherze oder provozieren den Gegner, aber das ist dumm. Man braucht in dieser Situation Intuition und gute Nerven, jede Ablenkung ist Gift. Anders als beim Duell mit Pistolen geht es nicht darum, wer schneller ist, sondern im Gegenteil darum, wer die Entscheidung vor dem Schuss am längsten herauszögern kann. Es gibt den Bruchteil einer Sekunde zwischen dem Moment, in dem der Schütze sich bereits für eine Ecke entschieden hat, und dem Treffen des Balles. Jetzt kann er nicht mehr zurück. Das ist der Augenblick, in dem ich reagieren muss. Nur dann habe ich eine Chance, den Ball zu halten.
Natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Man erlebt einen Spieler über 90 oder 120 Minuten, sieht seinen Bewegungsablauf, registriert, wie und wohin er insbesondere in Drucksituationen schießt. Und der Druck beim finalen Shootout ist mit nichts in unsrem Sport vergleichbar.
Der Zettel. Huub Stevens’ Assistent Hubert Neu zeigt ihn mir noch einmal. »Zamorano, langer Anlauf, linke Ecke« steht da. Inzwischen hat Ingo Anderbrügge unseren ersten Elfer in den Winkel geknallt. Der Schiedsrichter pfeift, und tatsächlich ist es der chilenische Nationalspieler, der sich als erster Mailänder den Ball schnappt. Lang läuft er an, zügig, gleichmäßig. Das bedeutet, dass er auch in seiner Entscheidung keinen abrupten Wechsel mehr vornehmen wird. Er wird sich treu bleiben. Oder doch nicht? Er holt aus, das Bein geht zum Ball, ich springe. Nach links. Und halte.
Jetzt gehe ich nach links aus dem Tor weg. Bloß kein Abklatschen mit dem gegnerischen Torwart! Das ist ein Spiel auf Leben und Tod, da kann ich dem Gegner unmöglich alles Gute wünschen, das geht leider nicht. Aber ich schaue ihm zu – und unseren Schützen. Auch Olaf Thon trifft. Ich merke schon: Gianluca Pagliuca ist ein typisch italienischer Torwart, der sich immer sehr früh bewegt. Ich habe da meine kleine Privatpsychologie. Die Italiener sind mit den Nerven nicht so stark, wenn es eng wird. Ich habe da später nur einmal eine Ausnahme erlebt, leider.
Aber jetzt schießt erstmal ein Franzose in italienischen Diensten, Youri Djorkaeff. Und der trifft. Wie nach ihm unser Martin Max. Nun nimmt sich Mailands Aron Winter den Ball. Jetzt gilt es, denke ich und erlaube mir ausnahmsweise den Griff in die Trickkiste, wo die fiesen Spielchen lagern. Ich gehe zu ihm, baue mich vor ihm auf, da sieht er noch mal, dass ich nicht der Kleinste bin und er eine Menge Quadratzentimeter zu überwinden haben wird. Ich sage: »I keep standing in the middle.« Ist das fair? Egal, hinterher wird keiner mehr danach fragen. Winter schweigt, guckt nur auf den Ball, der Druck liegt jetzt allein bei ihm. Wie angedroht stehe ich unbeweglich, stehe und stehe, im letzten Moment gehe ich nach rechts. Er aber hat mich ausgeguckt und schießt nach links. Normalerweise bin ich jetzt machtlos, schon vor dem Aufkommen auf dem Rasen weiß ich in so einem Moment, dass ich übertölpelt wurde. Aber Winter hat seine Innenseite einen Tick zu stark geöffnet – der Ball geht links am Tor vorbei. Anschließend trifft Marc Wilmots, aber erst als der jubelnd wegläuft, kapiere ich überhaupt, dass wir gewonnen haben.
Die Fernsehreporter fragen dann immer: Wie fühlen Sie sich jetzt? Was soll man da sagen? Zunächst mal rennen alle los und schreien sich scheinbar sinnlos an, die ganzen Emotionen müssen raus, vor allem, weil mit diesem Sieg keiner rechnen konnte. Selbst Rudi Assauer, der als Manager so gern den toughen Macho gibt, steht weinend auf dem Platz. Unsere Mannschaft war eigentlich nur Durchschnitt. Und jetzt gehört uns der Pokal. Der erste Eindruck, als ich die schönste aller Blumenvasen in den Händen halte: schwer, sehr schwer. Später kommen auch die Frauen und Freundinnen der Spieler auf den Platz, noch eine Stunde nach dem Abpiff drehen wir eine Ehrenrunde für die Schalker Fans, die immer noch im Stadion sind und singen; die Italiener sind da schon lange zu Hause. Die Bilder der Fans, die vor Glück weinen, werde ich so wenig vergessen wie Maurizio Ganz’ Lattenleger. Aber die blau-weißen Tränen nehmen auf der DVD Gott sei Dank mehr Platz ein.
Die Stimmung in der Kabine nach so einem Sieg ist schwer zu beschreiben. Die Umkleideräume in San Siro sind ziemlich hässlich, eigentlich kein guter Ort für große Jubelarien. Aber dieser Sieg ist für uns, für den Verein so bedeutend, dass uns die Umgebung völlig egal ist. Für einen Außenstehenden erinnert das Durcheinander vielleicht an einen Kindergeburtstag, aber seit ich selbst Kinder habe, weiß ich, dass das nicht stimmt. Kindergeburtstage sind fröhlich, über den nackten Männerleibern aber liegt ein Hauch von Erlösung, ja etwas wie – Gnade. Der ganze Druck, der Ehrgeiz, auch die Verzweiflung, alles fällt ab, immer wieder liegen wir uns in den Armen, manche weinen, schließlich fängt einer an, eines der Vereinslieder zu singen: »Blau und Weiß, wie lieb ich dich« oder »Steht auf, wenn ihr Schalker seid«. Das hat ein betrunkener Fan im Viertelfinale gegen Valencia erfunden: Ist einfach aufgestanden und hat den einen Satz gesungen, nach der Melodie von »Go west« von den Pet Shop Boys. Um ihn herum haben sich dann wirklich zehn Leute bequemt aufzustehen, am Ende stand das ganze Parkstadion. Inzwischen singen das Fans in ganz Deutschland für ihren Verein.
Irgendwann kristallisiert sich aus dem Tohuwabohu der Gefühle in meinem Inneren eine Frage heraus: Okay, was bedeutet das Spiel jetzt für mich? Es ist mein erster ganz großer Sieg, und der bleibt an einem haften. Von jetzt an wissen alle anderen: »Oh, das ist ein Gewinner.« Das ist viel wert. Was nun kommt, die Titel mit Dortmund, mit Arsenal, die WM und die EM – das alles gründet auf diesen Moment einst im Mai. Und auf einem Zettel, von dem ich nicht mal mehr weiß, wo er geblieben ist. Aber eins ist gewiss: Auch er hätte einen Platz im Museum verdient.
[Inhalt]
Sich nach der Decke strecken – wie ich Profi wurde
Am Abend des 8. Juli 1982, kurz vor elf, steht mein Entschluss fest: Ich werde Fußballprofi. Soeben hat Alain Giresse getroffen, hoffnungslos liegt die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale der WM in Spanien zurück. 3 : 1 für Frankreich in der Verlängerung, was soll da noch gehen? Ich sitze auf dem Sofa im Wohnzimmer meiner Eltern in Essen-Heisingen; obwohl es schon so spät ist und ich erst 13 Jahre alt bin, darf ich, muss ich dieses Spiel bis zum bitteren Ende sehen. Mein Gott, denke ich, das gibt es doch gar nicht, dass wir jetzt hier rausfliegen! Die müssen doch besser sein! Aber Rummenigge trifft nicht, Schumacher hält nicht, die Partie scheint verloren. Und plötzlich bildet sich in meinem Kopf dieser Gedanke: Das muss ich selbst irgendwie, irgendwann besser machen. Das will ich. Und das werde ich.
Fußball spielte ich zu dieser Zeit bereits seit fast zehn Jahren. Angefangen habe ich mit vier, auf der Straße. Mit sechs bekam ich meine erste Torwartausrüstung, zum Namenstag am 24. Juni. Noch heute habe ich diesen Geruch von frischem Gras und Matsch in der Nase, der fortan zu den Spielen in unserem kleinen Garten gehörte wie der Duft von Spaghetti Bolognese zum Samstagmittag bei den Lehmanns. Meine ersten Mitspieler waren mein Vater, mein zwei Jahre älterer Bruder Jörg und mein Cousin Jochen, vier Jahre älter als ich. Heute muss ich sagen: Super spielen konnte keiner von denen, aber das habe ich damals natürlich nicht bemerkt. Ich wollte einfach immer nur spielen, egal wo, egal wie gut, egal mit wem. Ein paar Jahre später, mit zehn, bin ich dann in meinen ersten Verein eingetreten, DJK Heisingen, E-Jugend. Wir wohnten nur 50 Meter von deren Sportplatz entfernt, mein Bruder und mein Cousin spielten auch dort, da war kein großer Familienbeschluss nötig, damit auch ich dabei sein konnte. Eine andere Sportart ist eigentlich nie in Frage gekommen. Ich hätte auch Rudern können, auf dem Baldeney-See, oder Tennis spielen. Aber das war einfach zu teuer, Aufnahmegebühr, Schläger, die ganzen Klamotten für draußen, für drinnen …
Wir wohnten zwar in einem ziemlich vornehmen Stadtteil – Heisingen, die von der Ruhr umschlungene Halbinsel im Essener Süden, liegt gleich neben Werden und Bredeney. Dort wohnten damals die meisten Millionäre Deutschlands, lauter Leute, die in den Konzernzentralen von Krupp, Thyssen, RWE oder Ruhrkohle wichtige Posten innehatten. Wir sind allerdings eine ganz normale Mittelstandsfamilie. Mein Vater hat im Vertrieb von Henkel gearbeitet. Meine Mutter hat ihren Job aufgegeben, als mein Bruder Jörg geboren wurde. Wir wuchsen in einer heilen Welt auf. Aber wie viele kleine Brüder musste auch ich die alten Klamotten meines Bruders oder meines Cousins auftragen. Es war auch nicht so, dass ich jede Menge Trikots von meinem Lieblingsverein im Schrank hängen hatte; damals existierte das Wort »Fanartikel« noch gar nicht. Ich hatte mal ein Teil von Borussia Mönchengladbach, das man wohl am ehesten als »Baumwollding« bezeichnen kann, dazu ein Trikot von Wolfgang Kleff – grün mit schwarzen Streifen. Aber dass man damit den ganzen Tag rumgelaufen oder gar in die Schule gegangen wäre, wie das heute üblich ist – undenkbar. Ich hätte mich auch gar nicht richtig entscheiden können, für welchen Verein ich Reklame laufen sollte. Ich war zugleich Fan von Mönchengladbach und vom 1. FC Köln, was eigentlich gar nicht geht. Heute muss man ja dankbar sein, dass zwischen den beiden Städten diese gewaltigen Braunkohlelöcher als natürliche Barriere liegen, sonst würden sich die Fans ständig auf die Köpfe hauen. Aber von Essen aus besehen waren die beiden gleich bewundernswert und spielten Mitte der siebziger Jahre auch den schönsten, erfolgreichsten Fußball. In meiner Heimatstadt selbst konnte ich mich nie recht zwischen Rot-Weiss und Schwarz-Weiß entscheiden. Rot-Weiss war ein bisschen besser, aber auch nie in der Bundesliga, bei Schwarz-Weiß habe ich später sogar in der Jugend gespielt – mein Sprungbrett in den »großen« Fußball. Zu guter Letzt bin ich ein Schalker Junge geworden, davon später.
Als junger Mensch war ich in manchen Überzeugungen so flatterhaft wie eine Fahne in der Fankurve; zunächst konnte ich mich ja nicht mal entscheiden, was ich nun sein wollte – Stürmer oder Torwart. Wenn wir nachmittags rumbolzten und in unseren Kindsköpfen die großen Spiele und ihre Stars parallel mitliefen, war ich meist Klaus Allofs, Pierre Littbarski oder Karl-Heinz Rummenigge. Und auch im allerersten Vereinsspiel, an das ich mich noch erinnere, war ich Stürmer. Wir spielten mit unserer E-Jugend gegen den SV Kupferdreh, auf dem Hügel jenseits der Ruhr. Die da oben waren gut, und irgendwann stand es 6:0. Gegen uns. Das ging mir derart auf die Nerven, dass ich mir den Ball vor dem eigenen Tor schnappte, quer über den Platz marschierte, alle Gegner umdribbelte und das 6:1 schoss. Die Niederlage habe ich damit natürlich nicht mehr verhindern können, wohl aber mein Selbstwertgefühl gerettet. Eigentlich bin ich doch besser als ihr, habe ich mir hinterher eingeredet. Und so ist es bis heute geblieben: Demütigungen sind für mich wie Kraftwerke – hässliche Dinger eigentlich, aus denen man aber eine gewaltige Energie bezieht. Gleich nach dem Spiel bekam ich mein allererstes Angebot – von Schwarz-Weiß Essen. Als Stürmer.
Über ein Probetraining kam ich aber zunächst nicht hinaus. Die ruhmreichen Schwarz-Weißen trainierten auf einem schmalen Aschenplatz, der von einer hüfthohen Mauer begrenzt wurde, aus der zur Krönung auch noch ein ehrfurchtgebietender Stahlzaun herausragte. Gleich beim ersten Spielchen grätschte mich einer in diese verirrte Knastarchitektur; mit der Schulter hinterließ ich eine Bremsspur darauf. Ich war total kaputt und völlig perplex, wie mit mir unschuldigem Probespieler umgesprungen wurde, so dass meine Entscheidung sofort feststand. »Nein, ich komme nicht«, sagte ich zum Jugendleiter Georg von Wick, der im ganzen Essener Fußballverband gefürchtet war als Personifizierung von Druck, Leistung und Kälte. Da konnte ich nicht ahnen, dass ich unter seiner Ägide meinen ersten Titel gewinnen würde.
Denn nach nur einem weiteren Jahr in Heisingen landete ich schließlich doch bei Schwarz-Weiß Essen, im Tor der D-Jugend. Ich besuchte inzwischen das Stadtwald-Gymnasium, und mein zukünftiger Trainer Martin Annen war mein Schulkamerad, wenn auch ein paar Klassen über mir. Der bearbeitete mich, ob ich nicht doch wechseln wolle. Ich wollte – wenn ich bloß weit genug weg wäre von der verdammten Mauer. Und da gab es nur eine sichere Position: im Tor. Also stellte ich mich da rein und machte das, was ich seit der Grundschule gut konnte: Bälle fangen. Schon beim Völkerball blieb ich auch dann an der Mittellinie stehen, wenn die gegnerische Mannschaft am Spiel war und versuchte, mich abzuwerfen. Wenn ich einen Ball fing, waren die Gegner schlagartig leichte Beute. Mit diesem Talent lief es auch im Tor gleich so gut, dass ich Kapitän meiner D-Jugend wurde und wir am Ende des Jahres den Essener Stadtpokal gewannen. Sicher fangen, schnell werfen – diesem Prinzip bin ich noch heute, als gestandener Profi, treu.
Dass man mit Bällefangen allein kein guter Torwart wird, war mir allerdings schnell klar. Ich musste mir ja nur Toni Schumacher ansehen in diesem Halbfinale: Wie eingesperrt steckte er in seinem Trikot, das seltsamerweise die französischen Farben hatte: rot der Rumpf, blaue Ärmel und darauf die drei weißen Streifen. Ein knallbuntes Kraftpaket, nur mühsam zu bändigen. Als er in der 60. Minute den armen Patrick Battiston umrammte, hatte ich weniger Mitleid mit dem schwer verletzten Stürmer gehabt als vielmehr den Mut bewundert, mit dem Toni aus dem Tor gekommen war. Das traut sich keiner, der nicht absolutes Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit seines Körpers hat, dachte ich. Und dann schlug ja doch noch seine Stunde, als das Spiel seine dramatische Wende nahm, Karl-Heinz Rummenigge den Anschlusstreffer erzielte und Klaus Fischer per Fallrückzieher in der letzten Minute den Ausgleich schaffte. Elfmeterschießen in einem der besten WM-Spiele der Fußballgeschichte! Und Toni Schumacher, mein Held und Vorbild, hielt den Elfmeter von Maxim Bossis – »wir« waren im Finale. Weil wir einen starken Torwart hatten, in jeder Hinsicht.
Ich war so überdreht wie wahrscheinlich alle deutschen Fußballfans an jenem Abend; jedenfalls konnte ich nicht sofort zu Bett gehen und fasste den zweiten wegweisenden Entschluss an diesem Tag: Ich musste stärker werden. Ich machte drei mal zehn Sprünge aus der Hocke an die Decke meines Kinderzimmers und dazu noch vier mal zwanzig Liegestütze. In den nächsten vier Jahren machte ich das jeden zweiten Tag – das Geräusch der Sprünge hat meine Eltern beinahe in den Wahnsinn getrieben. Aber wie an alles, so gewöhnten sie sich auch daran. Später bekam ich sogar Hanteln zum Geburtstag geschenkt, um meine Oberarme noch weiter zu trainieren. Nur mein Bruder konnte bis zuletzt meinen Versuchen, mich nach der Decke zu strecken, nichts abgewinnen und war einfach nur genervt.
Von meinem Entschluss, Profi zu werden, erzählte ich erstmal niemandem. Meine Eltern wussten zwar, dass ich ganz ordentlich Fußball spielen konnte, aber keiner in meiner Familie hatte eine ernst zu nehmende sportliche Vergangenheit und hätte sich auch nur im Entferntesten vorstellen können, dass ich mal mein Geld damit verdienen sollte, mich im hohen Bogen in den Matsch zu werfen. Damals war ein Profi-Fußballer kaum angesehener als ein Preisboxer; die Bundesliga hatte nach dem großen Skandal um Bielefeld und Schalke einen Ruf wie ein verqualmtes Wettbüro, und Prügeleien zwischen den Fans gehörten zum Alltag. Sogar mit Silvesterraketen wurde bei den einschlägigen Ruhrgebietsduellen aufeinander geschossen – manche Stadien galten am Samstagnachmittag als Kriegsschauplatz. Und da wollte ich mal arbeiten? »Nach dem Abitur sollst du eine Lehre machen«, sagte mein Vater immer, »bei der Bank oder als Kaufmann. Dann kannst du studieren, wenn du Lust hast. Musst aber nicht. Ist deine Entscheidung.« Bis zu jenem Abend im Juli hatte ich mir aber noch gar keine richtigen Gedanken gemacht, was ich eigentlich werden wollte. Ich hatte mal an Busfahrer gedacht, aber nur aus Bequemlichkeit: Wenn ich im Winter auf dem Weg zur Schule den Bus verpasst hatte, fror ich mir an der Haltestelle einen ab. Als dann endlich der nächste kam und die Tür öffnete, beneidete ich den Fahrer immer glühend um seinen warmen Arbeitsplatz. Da wollte ich auch mal hin! Aber dann begann ich lieber damit, an die Decke zu gehen.
Parallel zu meinem selbstgestrickten Krafttraining stellte ich mir einen Zeitplan auf: Mit 14, also in einem Jahr, spielst du bei Schwarz-Weiß Essen. Mit 18 wirst du dort zweiter Torwart in der Amateurmannschaft, mit 21 bist du die Nummer eins, und mit 23, 24 Jahren schaffst du es in die Bundesliga. Nur an die Nationalmannschaft verschwendete ich keinen Gedanken. So sah mein Masterplan aus, dem ich nach der Begegnung mit der Essener Mauer zunächst etwas hinterherhinkte, den ich dann aber auf einer permanenten Überholspur weit hinter mir gelassen habe. Was mich in all diesen Jahren eigentlich angetrieben hat, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Wahrscheinlich war es die Sehnsucht nach Anerkennung und der Ehrgeiz, selbst mal in der Sendung zu sehen zu sein, die wir jeden Samstagabend um 18 Uhr anschauten. Ein wenig hat auch das Geld eine Rolle gespielt. Vielleicht hatte ich als 13-, 14-Jähriger noch keine genaue Vorstellung davon, wie viel man in welchem Beruf verdient, eins war mir aber immer klar: Die meisten meiner Freunde und der Kinder um mich herum hatten mehr Geld als ich. In meiner Gegend bekam man als Junge aus normalen Verhältnissen schnell mit, dass man hart arbeiten muss, um mit den Kindern aus »bestem Hause« auch nur annähernd mithalten zu können. Wir hatten das Glück, auch in einem eigenen Haus zu wohnen. Aber die angesagten Leute in der Schule liefen in Poloshirts von Lacoste oder Benetton rum, ich nicht. Das höchste der Gefühle war ein Marc O’Polo-Sweatshirt, das mir mein Vater gekauft hatte, in Gelb. Und während die anderen zum 16. Geburtstag eine 80er bekamen, reichte es bei mir nur zu einem Mofa, einer Hercules Prima 5 S. Die fuhr zwar auch 50 Sachen, vor allem, nachdem ich sie ein bisschen frisiert hatte. Aber es blieb halt nur ein Mofa, wie viel ich auch dran rumschraubte. Die anderen waren, egal wohin wir gemeinsam aufbrachen, immer 10 Minuten vorher da. Und einen Rücksitz hatte ich auch nicht, was bedeutete: keine Mädchen hinten drauf. Viele der Teenager in meiner Umgebung würden in ihrem Leben nie selbst Geld verdienen müssen. Wer aus normalen Verhältnissen bei denen mithalten wollte, hatte meistens das Nachsehen, gerade beim Werben um die hübschesten Mädchen. Die Sechzehnjährigen aus meiner Klasse wurden von 18-Jährigen im Golf GTI abgeholt – da wurde ich als Mofafuzzi gar nicht beachtet.
So abgehoben wollte ich niemals werden, das schwor ich mir. Wahrscheinlich haben mich aber gerade diese Erfahrungen geprägt. »Euch werde ich es zeigen«, lautete der Refrain zu dem Wut-Song in meinem Inneren, mit dem ich die Ungerechtigkeiten dieser kleinen pubertären Welt bekämpfen wollte. Ein Vierteljahrhundert später zeigt mir meine Aggressivität und Verbissenheit auf dem Platz, dass ich diese Mentalität offenbar immer noch nicht abgelegt habe. »Euch werde ich es zeigen« – dieser eine Satz erklärt fast alles, bis heute. Dafür werden meine Kritiker mir nun vorhalten, dass ich offenbar über mein pubertäres Stadium nicht hinausgekommen bin. Das mag auf dem Platz sogar so sein, aber in diesen entscheidenden Jahren, in denen eine Persönlichkeit geformt wird, habe ich noch etwas gelernt: Respekt und Toleranz. Abends, in der Kneipe, habe ich erfahren, dass nicht alle Wohlstandsjünglinge Idioten sein müssen. Und beim Fußball, wo ich ja selbst einer aus »besserem Hause« war, habe ich viele kennen und schätzen gelernt, die aus einfachsten Verhältnissen kamen. Im Spiel ist man auf alle angewiesen, egal woher sie kommen. Mein Erfolg ist ihr Erfolg – und umgekehrt. Der Fußball ist eine richtige Schule fürs Leben, er hat eine unglaublich integrative Wirkung, das ist nicht nur einer der Leitfäden des DFB, das war und ist für mich die Wahrheit auf dem Platz, Tag für Tag.
Irgendwann konnte ich meinen verbissen verfolgten Berufswunsch zu Hause nicht mehr geheim halten. Schließlich gab ich mir einen Ruck, als wollte ich in einer brenzligen Situation aus dem Tor herauslaufen. Meine Eltern erklärten mich kurzerhand für weltfremd. Jahre zuvor hatten sie schon einmal eine meiner Entscheidungen nicht akzeptiert – damals zu meinem Glück. Ich wollte unbedingt auf die Realschule gehen, einfach, weil alle meine Freunde dorthin gingen. Natürlich hatte ich keine Ahnung, wie anders es dort sein würde. Meine Eltern aber waren weitsichtiger – und unnachgiebig: »Du gehst aufs Gymnasium«, entschieden sie, egal, wie viel Stress ich machte und wie viel ich heulte. Irgendwann habe ich dann eingesehen, wie wichtig eine gute Schulausbildung ist, und inzwischen weiß ich, dass auch Profifußballer davon nur profitieren können. Während meiner Zeit bei Arsenal habe ich Nachwuchsspieler gesehen, die schon mit 15, 16 Jahren Verträge hatten und nur noch zwei, drei Stunden am Tag unterrichtet wurden von einer Lehrerin, die der Verein besorgt hatte. Neue Dinge auf- und annehmen, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren – das lernen diese Burschen überhaupt nicht mehr. Aber als Topspieler muss man genau das haben: Sinn für Neues, seien es taktische Dinge, Ernährungsgewohnheiten oder Fitnessübungen. Und die Fähigkeit, sich zu konzentrieren: Nur wer auch in der 120. Minute noch hellwach ist, kann gute Klausuren schreiben – und große Spiele gewinnen. Die meisten erfolgreichen Fußballer, mit denen ich im Laufe meiner Karriere spielen durfte, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Cesc Fabregas, Oliver Bierhoff oder Christoph Metzelder – um nur einige zu nennen –, sind intelligente Leute. Sie können für ihre Mannschaftskollegen mitdenken, das macht sie groß. Einen strohdummen Superstar gibt es im modernen Hochgeschwindigkeitsfußball kaum noch.
»Gesundheit, Schule, Sport – in dieser Reihenfolge, Jens, verläuft dein Leben.« Das war die ewig wiederkehrende Litanei meines Vaters. Oft, wenn er sie angestimmt hat, hätte ich ihn dafür würgen können. Heute erzähle ich meinen Kindern auch nichts anderes. Eigentlich hatte meine Fußball-Besessenheit für meine Eltern einen angenehmen Nebeneffekt: Ich war unglaublich diszipliniert. Als ich endlich das Mofa hatte, fuhr ich damit natürlich nicht nur die 10 Minuten zur Schule und die Viertelstunde zum Training am Uhlenkrug, wo Schwarz-Weiß Essen heute noch spielt. Mit der größeren Beweglichkeit erschloss sich mir auch ein ganz neuer Freundeskreis. Wir fuhren nach Bredeney, wo die Mädchen hübscher waren als in Heisingen (vielleicht waren sie aber einfach nur unbekannter). Dort gingen wir immer ins »Johnny’s«, eine Kneipe, die eigentlich ganz spießig »Putzbachtal« hieß, zu jener Zeit aber der coolste aller Läden war – mit einem Wirt namens Johnny. Zu den wirklich Coolen gehörte ich allerdings nie. Die Joints, die dort regelmäßig die Runde machten, ließ ich immer aus, nicht mal geraucht habe ich und trank nur Cola. Davon allerdings so viel, dass ich von dem ganzen Koffein regelrecht in einen Cola-Rausch geriet. Natürlich empfand ich meine Abstinenz manchmal auch als ein ziemliches Opfer, aber die Verpflichtung gegenüber den Trainern und den Mannschaftskameraden war einfach größer. Ich hatte ein Ziel: Fußballprofi. Und die rauchen und trinken nicht – dachte ich jedenfalls damals (im Laufe meiner Karriere bin ich eines Besseren belehrt worden). Um kurz vor halb elf verabschiedete ich mich jedes Mal. Meine Eltern führten ein strenges Regiment, 22.30 Uhr war Zapfenstreich für mich, »der Schlaf vor Mitternacht ist der wichtigste«, sagte mein Vater; außerdem musste ich ja auch noch mein kleines Trainingsprogramm absolvieren. Der Weg mit dem Mofa nach Hause war manchmal lang und im Winter so kalt, dass ich meinen Kindern noch heute Räubergeschichten davon erzähle: Wie im Tunnel unter dem Bahnhof das Mofa den Geist aufgab und ich nach Hause schieben musste, zum Beispiel. Das klingt vielleicht banal, aber es waren mehr als zehn Kilometer, Geld für den Bus hatte ich nicht, geschweige denn für ein Taxi, und das Handy, mit dem man jemanden um Hilfe bittet oder wenigstens mitteilt, dass es später wird, war noch nicht erfunden. Schwitzend und total kaputt schiebe ich dann durch den stockdunklen Stadtwald, als plötzlich ein Mann von hinten … Aber nein, das ist nur die Variante der Geschichte für meine Kinder, um Spannung zu erzeugen. In Wahrheit waren die Heimfahrten einfach lang, kalt, nervtötend. Anfangs guckten meine Freunde noch dumm, wenn ich mich jedes Mal so pünktlich verabschiedete, als hätte ich einen Wecker verschluckt: »Was machst du denn da für einen Scheiß? Wieso immer dieser blöde Fußball?«, fragten sie. Ich konnte nicht mehr sagen als: »Macht Spaß.« Mit der Zeit gewöhnten sich die anderen daran, dass sie mir mit Hasch, Zigaretten oder Alkohol gar nicht zu kommen brauchten. Fortan wurde ich als »merkwürdig« akzeptiert – das war zwar nicht cool, aber besser, als ausgelacht oder geschnitten zu werden.
Nur die Mädchen wollten mit einem Merkwürdigen wie mir nicht wirklich was zu tun haben. Zwar hatte ich mit 14 schon eine Freundin, Katrin, aber außer ein bisschen Knutschen lief nicht viel, ich war einfach noch nicht so weit. Nicht mal ein Jahr später war schon wieder Schluss, immer nur Knutschen war ihr offenbar zu wenig. Jedenfalls wollte sie nichts mehr von mir wissen, auch nicht auf der Abschlussfahrt mit unserem Sport-Leistungskurs an den Gardasee. Dafür hatte Ines schon auf der Hinfahrt gesagt: »Den Jens nehm ich mir diese Woche mal vor.« Sie nahm dann aber doch einen anderen, ich hatte Schiss und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Mit den coolen Kiffern aus meiner Stufe saß ich abends am Strand, wenigstens in dieser einen Woche gehörte ich dazu. Gebracht hat es mir freilich nicht viel, ich merkte: Das ist eine andere Welt – verwöhnte, nette Kerle, die sich langweilen, Hasch rauchen, trinken. Einmal konnte ich dann auch nicht widerstehen, bei einem Ausflug zu einem Restaurant hoch oben über dem Gardasee bei Limone. Es war der erste Vollrausch meines Lebens. Viele sind dann nicht mehr dazugekommen, sonst wäre das nichts geworden mit dem Fußball.
Keine Chance bei den Mädchen, bei den Coolen nur geduldet – natürlich sind das Enttäuschungen, wie sie jeder Teenager erleiden muss. Doch für mich wurde daraus eine zusätzliche Motivation. Ich merkte, dass man im Leben ohne Zielstrebigkeit nicht viel erreichen kann. Diese Zielstrebigkeit hat sich fortan wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Ich hatte bei allen Tiefschlägen, die ich in meiner Fußballzeit erlebt habe, immer das Vertrauen, dass alles wieder in die richtigen Bahnen laufen wird. Dieses »Urvertrauen« verdanke ich sicher zum größten Teil meinen Eltern. Natürlich waren sie streng, aber eben auch sehr liebevoll und verlässlich. Ich empfinde es als ganz großes Glück, dass ich so wohlbehütet in normalen Umständen aufgewachsen bin. Ich bin sicher, dass diese geordneten Verhältnisse mich zu einem erfolgreicheren Sportler haben werden lassen. Nicht, dass meine Eltern bei jedem Spiel an der Seitenlinie gestanden und gebrüllt hätten: »Jetzt lauf! Gib ab! Geh ran!« Die Schreierei ist ohnehin kontraproduktiv; viele meiner frühen Mitspieler verloren die Lust, wenn ihre Eltern zu viel Druck machten. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern überhaupt mitgekommen sind – meine Mutter behauptet, sie hätte sich oft genug schweigend die Beine an irgendeinem Bolzplatz in den Bauch gestanden, ich kann mich daran gar nicht erinnern. Profitiert habe ich auf eine andere Weise. Ich habe Mitspieler erlebt, die in absoluten Drucksituationen, in Endspielen, im Abstiegskampf, im Elfmeterschießen, plötzlich total einbrachen, völlig unerwartet ihre Leistung nicht mehr brachten. Häufig waren das Leute, die aus ungeordneteren Verhältnissen kamen – die Eltern geschieden, der Vater verschwunden, so etwas. Denen fehlt das, was ich Urvertrauen nenne. Wenn es Spitz auf Knopf steht, denken die: Das geht bestimmt wieder schief. Bei mir ist immer das genaue Gegenteil im Kopf: Ach, das wird schon gutgehen! Denn wann immer ich gestürzt bin, haben mich meine Eltern wieder aufgehoben. Wann immer mein Bruder oder ich unsere Eltern brauchten, waren sie für uns da. Wenn wir aus der Schule kamen, stand das Essen auf dem Tisch, meistens irgendwas mit Kartoffeln. Im Nachhinein habe ich den Eindruck, jahrelang nur Kartoffeln gegessen zu haben – vielleicht liegt es ja daran, dass ich überhaupt eine Torhüterstatur bekommen habe, denn meine Eltern sind eher durchschnittlich groß, 1,76 Meter mein Vater, meine Mutter 1,70 Meter. Sonntags Kirchgang, anschließend ein Braten – das waren zwei weitere Fixpunkte in diesem »Rundum-sicher-Paket«. Natürlich bin ich nicht immer freiwillig in die Kirche gegangen, aber eine Zeit lang war ich sogar Messdiener. Und weil ich beinahe alles, was ich anfange, unglaublich intensiv mache, habe ich mitunter sogar drei-, viermal in der Woche Kerzen getragen, den Kelch an den Altar gebracht, bei der Wandlung mit den Glöckchen geklingelt. Ich weiß nicht, ob ich in der Kirche wirklich den Glauben an eine höhere Gerechtigkeit gelernt habe, die dann vielleicht auch auf dem Fußballplatz waltet. Eins habe ich aber dort bestimmt gelernt, was mir auch als Profi immer noch zugutekommt: Disziplin und Willensstärke. Als 14-Jähriger fuhr ich mit den Pfadfindern für drei Tage ins Elsass. Es regnete, als ginge die Welt unter, und ich schleppte einen Seesack, der statt vernünftiger Trageriemen nur ein paar Kordeln hatte. Nach drei Stunden hatte ich blutige Striemen auf der Schulter, vor lauter Schlamm konnte ich kaum noch laufen. Aber irgendwie ging es immer weiter, zuletzt nahm mein Bruder mich huckepack und sein Freund trug mir den Seesack.
Mein Bruder und ich waren die Kinder, die Florian Illies in seinem Buch »Generation Golf« beschrieben hat. Samstagmorgens wurde das Familien-Auto gewaschen, anfangs ein K70, später mal ein Opel oder ein Passat – ganz klassische deutsche Autos. Einer von uns Brüdern musste derweil die Einfahrt und die Bürgersteigrinne fegen. Danach Spaghetti Bolognese – weil ich in einem Fußballmagazin gelesen hatte, dass die Profis vor den Spielen Nudeln essen, und in der Tat mache ich das noch heute so. Am Nachmittag dann meistens ein Spiel. Wieder daheim, stand meine Mutter in Erwartung ihrer Recken bereits mit dem Wäschekorb vor dem Keller. Bei schlechtem Wetter spritzte sie mit dem Gartenschlauch die Asche vom Dress, oder sie packte alles direkt in die Waschmaschine. Die Badewanne war schon befüllt, bei »Sportschau« und »Wetten, dass …?« ging langsam die Sonne über unserem Idyll unter.
Heute würden vielleicht andere Frauen meine Mutter als nicht zeitgemäß abqualifizieren, als eine Frau, die ihre Talente und Fähigkeiten zu Hause vergeudet hat. Aber können sie auch beurteilen, inwieweit sich ihr Drang nach Selbstverwirklichung, ihr Egoismus mit der Erziehung von Kindern, mit der Fürsorge um eine Familie vereinbaren lässt? Ich glaube, dass die »Führung eines Familienunternehmens«, wie es in einer TV-Werbung mal treffend genannt wurde, anspruchsvoller und befriedigender sein kann als die meisten anderen Karrieren. Viele dieser studierten, berufstätigen, ehrgeizigen Frauen erkennen mit Ende dreißig, wie verdammt hart sie arbeiten mussten, um etwas zu erreichen, oft noch härter als Männer in vergleichbaren Positionen. Da sieht die Alternative, Kinder zu bekommen und die Vorzüge einer Familie zu genießen, plötzlich ziemlich verlockend aus, wenn man es sich leisten kann. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass meine Frau Conny sich ganz der Erziehung unserer Kinder Lasse, Mats und Liselotta widmet. Wir hoffen, ihnen damit eine ähnliche Sicherheit, Geborgenheit, ein ähnliches »Urvertrauen« für ihr Leben mitgeben zu können, wie ich es in meinem Elternhaus erlebt habe.
»Gesundheit, Schule, Sport« – Vaters Litanei war für die nächsten Jahre mein Gesetz. Ich war der Einzige in meiner Mannschaft bei Schwarz-Weiß Essen, der nur einmal in der Woche an einem Spiel teilnehmen durfte, auch wenn zwei angesetzt waren – da blieb mein Vater standhaft, sehr zum Ärger meiner Trainer. Auf dem Aschenplatz bei uns in der Nähe durfte ich so oft spielen wie ich wollte – aber nur, wenn ich mit den Hausaufgaben fertig war und meine Noten stimmten. Zum Glück war ich immer ein Zwei-minus-Drei-plus-Schüler, ohne allzu viel nebenher tun zu müssen. Meine Lieblingsfächer waren Mathematik und Sport, aber letztlich ist mir nicht viel in Erinnerung geblieben aus meiner Schulzeit, für mich gab es nur eins: Fußball. Ich war besessen davon. Nicht mal Urlaub wollte ich machen, weil ich dann ja nicht spielen konnte. Zwischen meinem 13. und 18. Lebensjahr bin ich nur einmal weggefahren: nach Italien. Mit der A-Jugend zu einem Fußballturnier.
Bis zu meinem sechzehnten Lebensjahr war ich allerdings bestenfalls Durchschnitt. Als Torwart der C1-Jugend von Schwarz-Weiß Essen spielte ich zwar in der Niederrheinliga, aber das taten viele, und auch viele Bessere. Doch schon beim Schritt in die nächsthöhere Altersklasse kam ich ins Straucheln; statt mit der B1 in der höchsten Spielklasse Nordrhein-Westfalens anzutreten, krebste ich mit der B2-Jugend in der Essener Leistungsklasse herum. Erst kurz vor dem Ende der Saison wurde das Unglück eines Kollegen zu meinem Glück: Klaus Bagh, der gute Torwart aus der B1, sprang unmittelbar vor meinen Augen so unglücklich bei einer Parade gegen den Pfosten, dass der arme Kerl sich den Unterkiefer brach. Also wurde ich zwangsläufig »befördert«; überdurchschnittlich war ich aber nun weder durch meine Leistungen noch durch meine Körpergröße. Ich gehörte eher zu den kleineren Torleuten; da ich aber weiter mein heimisches Spezialtraining absolvierte und eisern – wahrscheinlich als einziger Mensch überhaupt – daran glaubte, Profi werden zu können, ging es Schritt für Schritt bergauf.
Das Torwarttraining damals verdiente diesen Namen gar nicht, es war in Wahrheit eine Tortur. Wie die meisten Klubs im Ruhrpott hatte auch Schwarz-Weiß Essen nur einen harten Aschenplatz. Ob bei minus 3° oder plus 30° Grad – ich trug immer die gleichen Klamotten: zwei schwarze gepolsterte Torwarthosen und zwei Torwarttrikots, beides jeweils übereinander. Im Sommer schwitzte man sich schon beim bloßen Rumstehen zwei Kilo runter, im Winter sogen sich die Klamotten voll bis zum Anschlag und wogen wenigstens 5 Kilo. Mit Bleiwesten musste ich nie trainieren, so etwas besorgte der Regen über Essen kostenlos. Als ich 18 war, prophezeite mir ein Orthopäde, dass ich wegen all der unsanften Landungen auf den Aschenplätzen des Ruhrgebiets spätestens mit dreißig massive Hüftprobleme bekommen würde. Gott sei Dank war er kein so guter Diagnostiker, den aufrechten Gang habe ich auch heute noch nicht aufgeben müssen.
Das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir Kinder der Asche ab Mai Zutritt zu einem Paradies bekamen: der Schillerwiese. Eine wunderbare öffentliche Grünfläche in Essen, frisch gemäht, das Wembley meiner Jugendzeit. Zusammen mit meinem ersten Trainer, Martin Annen, und dem nagelneuen, rasend schnellen »Tango«-Ball pilgerte ich regelrecht dahin. Martin schoss drauf, und ich hatte endlich mal Spaß an meinem Job. Von da an wusste ich: Wenn ich nur einmal die Chance erhalten würde, regelmäßig auf Rasen zu spielen, würde ich sofort 30, 40 Prozent besser sein.
Martin Annen hat mir aber neben den Glücksgefühlen auf der Wiese noch etwas anderes mitgegeben, von dem ich noch heute immens profitiere. Nach dem Abitur fing er an, Philosophie zu studieren. Anfangs verstand ich gar nicht, wie das zusammengehen sollte: Dieser Fußballbesessene als Feingeist?! Den Jungs auf dem Platz zurufen, dass der Rasen jetzt brennen muss, zu Hause aber Kant studieren? Aber es ging. Die Regale in seinem Zimmer füllten sich nach und nach mit den Hauptwerken der großen deutschen und ausländischen Philosophen. Wann immer ich ihn besuchte, sah ich Martin lesen. In den ein oder anderen Band schaute ich auch mal rein, ließ es aber gleich wieder – zu schwierig. Und doch hat er mich mit seinem Vorbild weitergebracht. Weil ich andere Bücher las und nicht nur bereichert war, sondern zu der festen Überzeugung gelangte, dass Lesen die Konzentrationsfähigkeit steigert. Der allabendliche Blick auf meinen Vater hat mich darin noch bestärkt: Er im Sessel, lesend, historische Bücher, den »Spiegel«, was immer. Aber immer ganz bei sich. Wer liest, ist schwer abzulenken. Und für einen Torwart ist Konzentrationsfähigkeit der wichtigste Parameter, um konstante Leistungen über lange Zeiträume abrufen zu können. Der Keeper, der ich heute bin, konnte ich nur als Leser werden.
Dass mein Entschluss, Profi zu werden, keine größenwahnsinnige Schnapsidee war, merkte ich zum ersten Mal in dem Moment, als ich endlich im Tor der B1 von Schwarz-Weiß Essen stand. Das war kein organisch, über Jahre gewachsenes Team mehr, sondern ein strategisch zusammengestelltes Sammelsurium der besten Spieler aus ganz Essen, die der Verein systematisch abgeworben hatte. Aber anders hätte man gegen Mannschaften wie MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf oder Borussia Mönchengladbach kaum bestehen können. In einem Ausscheidungsspiel gegen Bayer 05 Uerdingen konnten wir uns sogar für die deutsche B-Jugend-Meisterschaft qualifizieren, galten aber als totale Außenseiter. Uerdingen steckte damals viel von seinem Bayer-Geld in die Jugendmannschaften – und doch gewannen wir das Hinspiel 1:0. Vor dem Rückspiel hieß es immer nur über uns: Passt auf, jetzt nehmen die euch ernst, da kriegt ihr fünf Stück! Aber wir hielten ein 0:0 – und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl: Mensch, das kann ja wirklich was werden mit dir und dem Fußball! In der nächsten Runde lernte ich aber auch gleich, welche Schattenseiten mein Sport haben kann, wenn zu viel Ehrgeiz im Spiel ist. Im Rückspiel des Achtelfinales gegen Hannover 96 trat mir einer der gegnerischen Stürmer das halbe Ohr ab – es war noch keine Viertelstunde gespielt, da war ich schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Aber wir kamen weiter, und nachdem wir im Viertelfinale gegen Hertha Zehlendorf eine 1:4-Heimpleite mit einem 5 :0-Sieg in Berlin gedreht hatten, ging es im Halbfinale gegen Paderborn-Neuhaus ins Elfmeterschießen. An das Spiel in Berlin erinnerte mich kürzlich noch einmal Martin Annen. Ich war zum Rückspiel nach dieser Verletzung mit meinem verbundenen Ohr eigentlich nur zur Unterstützung der Mannschaft mit nach Berlin gefahren. Beim Abschlusstraining am Nachmittag sagte ich dann aber zu unserem Trainer Friedhelm Slomke und dem Jugendleiter Georg von Wick: »Ich will unbedingt spielen.« Allerdings durfte der ebenfalls mitgereiste Reporter der NRZ auf keinen Fall berichten, dass ich aufgelaufen sei, da meine Eltern die Zeitung lasen. So hieß es dann nach unserem 5:0-Triumph dort nur: »Der Torwart (ohne Namen!) gab der Abwehr Stabilität. Man erkennt bei ihm einen starken Willen …«
Das Elfmeter-Schießen in Paderborn-Neuhaus sollte bis zum UEFA-Pokal-Endspiel in Mailand auch mein letztes bleiben. Zwei Strafstöße konnte ich halten: Finale! Dort verloren wir allerdings gegen den VfB Stuttgart 0:5 – vielleicht hat es ja einen höheren Sinn, dass ich zum Ende meiner Karriere ausgerechnet zu dem Verein gekommen bin, dem ich meine erste große Niederlage verdanke.
Für einen kleinen Verein wie Schwarz-Weiß Essen war aber allein die Finalteilnahme ein historischer Triumph, und ich wurde auch noch mit einer Einladung zur Jugend-Nationalmannschaft belohnt. Holger Osieck, damals der Assistent vom zuständigen DFB-Trainer Berti Vogts, hatte mich spielen sehen. Doch meine Premiere im Trikot mit dem Adler war ein Desaster: Ich hatte zu dünne Stollen untergeschraubt und rutschte bei den Abschlägen und beim entscheidenden Gegentor weg. Danach wurde ich nicht mal mehr zur Niederrheinauswahl eingeladen …
Bei meinem Ruf denkt jetzt vielleicht mancher, ich hätte Berti Vogts danach an den Haaren gepackt oder vor lauter Wut im nächsten Spiel einen Platzverweis kassiert. Aber mein Ärger hielt sich in Grenzen – unter anderem deshalb, weil ich eine andere Einladung bekam: zu einem Probetraining bei Schalke 04. Das war inzwischen mein Lieblingsverein geworden, und mein Mofa war schuld. Denn damit konnte ich immer zu den Bundesligaspielen fahren, direkt bis vor die Tore des Parkstadions, wenn ich nicht gerade im Auto meines Cousins mitfuhr. Und weil bei den Einlasskontrollen damals noch nicht diese Hochsicherheitstrakt-Atmosphäre herrschte, mogelten wir uns immer kostenlos ins Stadion und bis unten auf die Tartanbahn, wo hinter dem Tor diese alten Turnbänke für die Fotografen standen. Das wurde mein Stammplatz, von dem aus ich beim Bayern-Gastspiel Jean-Marie Pfaff bestaunte, fünf Meter vor mir. Gelernt habe ich auf meinem Logenplatz vor allem eins: Wie viel schneller und härter das Spiel bei den Profis doch ist. Und diese harten Jungs luden mich zum Probetraining ein! Okay, es war nur die A-Jugend, aber immerhin.
Kurz vor den Sommerferien bin ich hin – und traute meinen Augen nicht. Dass wir bei Schwarz-Weiß Essen immer noch auf dem Aschenplatz spielten, war ich ja gewohnt. Aber unser Platz war wenigstens aus roter Asche – die Schalker trainierten auf einem harten, grauen Aschenplatz, das ist der Trabbi unter den Fußballplätzen. Und rechteckige Holzpfosten hatten die noch! Als wenn das Wunder von Bern nachgespielt werden sollte. Ich gab dennoch mein Bestes und beeindruckte den Schalker Jugendtrainer immerhin so, dass er kurz darauf bei uns zu Hause anrief: »Michael Skibbe hier. Wir würden Ihren Sohn gerne für die A-Jugend verpflichten und ihn zum Vertragsamateur machen. Damit hat er auch die Möglichkeit, später mal Profi zu werden.« Nur vier Jahre nach meinem einsamen Sofa-Beschluss war ich also fast am Ziel, und jeder andere wäre vielleicht nackt in blau-weißen Badelatschen nach Schalke gepilgert, um den Vertrag zu unterschreiben. Ich aber sagte – nein. Das mache ich nicht. Aschenplatz und Vertragsamateur – nein danke. Ich hatte zwar auch ein anderes Angebot, von Wattenscheid 09, aber da wollte ich auch nicht hin. Lieber noch ein tolles Jahr Schwarz-Weiß Essen als eine schlechte Zeit auf Schalke.
Offenbar fühlten sich die Königsblauen von meiner Absage bei der Ehre gepackt. Inzwischen hatte ich bei einem Jugendturnier im Halbfinale den Schalkern mit ein paar guten Aktionen den letzten Nerv geraubt, so dass sie mich mehr denn je haben wollten. Dafür fuhren sie nun die schweren Geschütze auf: den Präsidenten persönlich, Günter Siebert. »Herr Lehmann«, sagte er zu meinem Vater am Telefon, »kommen Sie doch mal vorbei mit Ihrem Sohn. Wir wollen uns mal unterhalten.« Wie sich im weiteren Verlauf des Gesprächs herausstellte, war Siebert wie mein Vater in Kassel aufgewachsen, die beiden verstanden sich gleich so prächtig, dass mein Vater seine Litanei »Gesundheit, Schule, Sport« für einen Moment vergaß und versprach, mit mir nach Schalke zu fahren. »Dieter«, sagte meine Mutter, »du gehst dahin, du hörst dir das an, aber unser Sohn wird in diesem Verein nicht spielen!« Als meine Oma von dem Termin erfuhr, legte sie noch einen drauf: »Der Dieter wird doch den Jens nicht an so einen Proletenverein verkaufen!«
Hat er dann aber doch gemacht. Und ich habe dem »Proletenverein« 11 Jahre die Treue gehalten.
[Inhalt]
Die Angst besiegen, oder: Was es heißt, Torwart zu sein
Als der Ball geflogen kommt, denke ich noch: Wird schon werden, Emmanuel Eboué ist ja da, mein Verteidiger, der lässt nichts anbrennen. Schon springt er der Flanke entgegen – aber was macht er jetzt? Er zieht den Kopf ein! Das kann doch nicht wahr sein!! Manchester United greift an, der Ball rauscht in meinen Strafraum wie ein Artilleriegeschoss, Cristiano Ronaldo wartet nur auf ihn, und Eboué, der Einzige, der jetzt noch helfen kann, duckt sich weg. Der Ball springt auf, sieben Meter vor dem Tor, ich renne raus, breite die Arme aus, stehe einfach nur da in Erwartung eines gewaltigen Hammerschlags. Ronaldo zögert keine Sekunde, volley zieht er ab. Immer noch starre ich auf den Ball, der mit über 100 Stundenkilometern auf mich zuschießt, dann der Einschlag in meinem Gesicht, das Gehirn fliegt nach hinten – Ecke. Ich gehe zu Boden. Bei so einem Treffer kann man nicht mehr schreien, da stöhnt man nur. Ronaldo steht konsterniert vor mir. Er kann es selbst nicht fassen, dass er nur meinen Kopf getroffen hat. Wenigstens zwei Minuten liege ich benommen am Boden, dann rappel ich mich langsam hoch. Bei der anschließenden Ecke steht O’Shea vor mir, als der Ball reinkommt, um mich zu behindern. Ich schlage den Ball und seinen Kopf auf einmal mit meiner Faust. Der Ball ist weg, dann ist Halbzeit. Mein erstes Ziel ist Freund Eboué. »You fucking girl!«, schreie ich. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man einem Profi-Fußballer in der englischen Premier League sagen kann. Aber hat er nicht den Kopf im entscheidenden Moment eingezogen wie ein Mädchen? Ich schimpfe weiter, andere Mannschaftskameraden reden auf mich ein: Jetzt beruhig dich! Aber ich will nicht. Mein Gehirn tut weh, alles tut weh. »Komm, ist doch nicht so schlimm«, sagt jetzt auch Eboué. Spinnt der?! Was soll daran nicht schlimm sein, wenn mir einer aus fünf Metern beinahe den Kopf abschießt? Mein Trainer fragt mich, ob ich weitermachen kann. Ich gehe wieder raus.
Diese Szene aus dem Spiel Manchester United gegen Arsenal im Herbst 2006 erzählt etwas von der Besessenheit, die man braucht, um ein guter Torwart zu sein. Es war eines meiner besten Spiele überhaupt, nach der Weltmeisterschaft in Deutschland war ich in der Form meines Lebens. Kurz vor Schluss fischte ich noch einen Schuss von Solskjaer aus der langen Ecke und sicherte damit unseren wertvollen 1:0-Auswärtssieg.
In England nannten sie mich manchmal »Mad Jens«. Das war vor allem auf meine sehr offensive Spielweise bezogen. Aber meine Art zu spielen ist alles andere als wahnsinnig, im Gegenteil, sie ist das Ergebnis kühler Analyse von Wahrscheinlichkeiten.