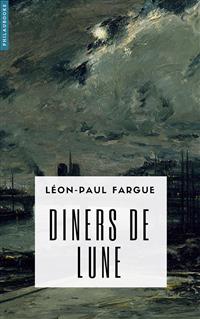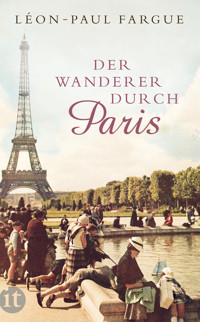
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker der Paris-Literatur – die Bibel der Flaneure! Léon-Paul Fargue, der »Dichter von Paris«, streifte stundenlang durch die Gassen von Paris, von Montmartre zu den Cafés der Champs-Élysées, durch das Marais und den Jardin des Plantes nach Montparnasse. Die Liebe zu seiner Heimatstadt spiegelt sich in den Aufzeichnungen seiner Wanderungen wider, in denen er die Stadt in all ihren Winkeln und Eigentümlichkeiten, ihre Menschen und ihre Kultur mit leichter Hand und fast impressionistischer Genauigkeit schildert. Dieser Band ist eine Einladung, Léon-Paul Fargue bei seinen schönsten Spaziergängen durch Paris zu begleiten. Und wenn alle anderen Zeugnisse verlorengingen, allein aus seinen Skizzen könnte man rekonstruieren, was die Welt um den Montmartre einmal gewesen ist. Das beste Paris-Buch.« Walter Benjamin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Der Klassiker der Paris-Literatur – die Bibel der Flaneure!
Léon-Paul Fargue, der »Dichter von Paris«, streifte stundenlang durch die Gassen von Paris, von Montmartre zu den Cafés der Champs-Élysées, durch das Marais und den Jardin des Plantes nach Montparnasse. Die Liebe zu seiner Heimatstadt spiegelt sich in den Aufzeichnungen seiner Wanderungen wider, in denen er die Stadt in all ihren Winkeln und Eigentümlichkeiten, ihre Menschen und ihre Kultur mit leichter Hand und fast impressionistischer Genauigkeit schildert. Dieser Band ist eine Einladung, Léon-Paul Fargue bei seinen schönsten Spaziergängen durch Paris zu begleiten. Und wenn alle anderen Zeugnisse verlorengingen, allein aus seinen Skizzen könnte man rekonstruieren, was die Welt um den Montmartre einmal gewesen ist.
»Das beste Paris-Buch.« Walter Benjamin
Léon-Paul Fargue, 1876 in Paris geboren, war Schüler von Stéphane Mallarmé und Paul Verlaine und verkehrte in den literarischen und intellektuellen Kreisen der Stadt. Er zählt zu den Symbolisten und gilt als einer der ersten, die sich der modernen französischen Dichtung zuwandten. Er veröffentlichte mehrere Gedichtbände und zwei Bücher über Paris, u.a. Der Wanderer durch Paris
Léon-Paul Fargue
Der Wanderer durch
Paris
Aus dem Französischen von Katharina Spann
eBook Insel Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1967
Die französische Originalausgabe erschien 1939 unter dem Titel
Le Piéton de Paris. © Éditions Gallimard 1939.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des
öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch
Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: hißmann, heilmann, hamburg
Satz: Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
eISBN 978-3-458-78120-2
www.insel-verlag.de
Der Wanderer durch Paris
Von woanders
Oft, und gerade erst gestern, sehe ich in mein Zimmer, das noch dazu von diesen gespenstischen Lichtern und diesem Donnergetöse erfüllt ist, mit dem die Lastautos der Hallen in Paris wild durcheinanderrasen, irgendeinen Kameraden oder Kollegen, Journalisten oder Dichter eintreten, der mich fragt, der mich manchmal auffordert, ihm einige Einblicke in meine Arbeitsweise zu gewähren. Sonderbare Frage. Wenigstens für mich. Für diesen Menschen, der ich am Morgen bin, der noch in seinen Bettüchern, in seinen Träumen umherirrt, gestützt auf Phantome, der mit früheren Leben Bockspringen veranstaltet. Meine Arbeitsmethode? Welche würde es sein? Und zunächst, würde ich eine haben? Würde ich der Sklave einer regelrechten Disziplin sein? Wäre es wirklich so, daß ich, um aus dem Wald herauszukommen, immer den gleichen Pfad wiederfinden würde, daß mich meine Schritte immer wieder über die gleichen Blätter führten?
Die Frage bringt mich wieder zum Träumen. Ich verstehe, daß sie für gewisse Menschen ein gewisses Quentchen von Interesse hat. Sind wir, wir anderen Menschen der Meditationen, die Tinte wiederkäuen, nicht den Zauberkünstlern ähnlich, von denen man gern wissen würde, wie sie es machen, daß sie Forellen aus ihrer Kreissäge hervorholen?
»Sehen Sie, Monsieur«, sagte eines Tages eine schöne Frau zu mir, die wißbegierig war. »Wir befinden uns hier vor dem Kanal Saint-Martin, für den Sie eine krankhafte Vorliebe hegen. Wir beugen uns gemeinsam über dies reglose, dunkle Wasser. Aus diesem Schauspiel, das Ihnen so viele Dinge sagt, dringt keine Stimme zu mir. Morgen jedoch werde ich in irgendeiner Zeitschrift mit Ihrer Namensunterschrift Beobachtungen finden, die mich durch ihre Genauigkeit oder ihre Poesie verblüffen. Wie machen Sie das?« Dieses »wie machen Sie das?«, man weiß, daß es wie ein Engerling die Ohren von Racine, Baudelaire, von Père Hugo, von Mallarmé, Rimbaud, Cézanne und Debussy aufgewühlt hat; daß es die von Valéry, Picasso, Pierre Benoit, James Williams und Joe Louis strapazierte, die von Di Lorto, dem Mann, der das Roulette besiegt hat, ebenso wie die noch viel dehnbareren der Greta Garbo. Es gibt in der Kunst und im Sport Fragen der Dunkelkammer und der Retorte, für die sich die Massen begeistern. Und ich versetze mich in ihre Lage. Als ich jung war, träumte ich ganze Minuten über einem Bild, das einen Seeadler darstellte, der im Begriff ist unterzutauchen, den Kopf unter Wasser, seine Fänge im Nacken eines großen Hechtes. Ich stellte mir den Raubvogel vor, wie er in beträchtlicher Höhe über dem Fluß kreiste und sich plötzlich, sobald er den schlafenden, schwarzglänzenden Fisch bemerkt hatte, auf ihn stürzte wie ein Fallschirm, der sich nicht geöffnet hatte. Aber er mußte seine Beute noch ans Ufer bringen, das heißt schwimmen, aus dem Wasser klettern, von Flügeln, Krallen, Schuppen und Flüssigem behindert. Es gab da für mich eine Reihe von bewunderungswürdigen Geheimnissen, Verkettungen und Gesetzen, in denen ich oft irgendeinen Schlüssel zur Welt erblickte.
Aber was sollte ich heute meinem Kollegen antworten, der zu wissen wünscht, wie ich in einer anderen Umwelt diesen Krallenhieb versetze, oder vielmehr diesen Ruck mit dem Netz vollbringe, wie mein alter Thibaudet sagte? Ich weiß nicht. Oder vielmehr ich weiß, daß ich keine Methode habe. Es ist nur eine dunkle und boshafte Gewalt, die mich plötzlich mondsüchtig macht und mich zwingt, die beiden Ellbogen auf den Tisch zu legen. Ich halte mich kaum an die Inspiration.
Man möge mir verzeihen, wenn ich einige Scheinparadoxe wage, die ich hüte wie meinen Augapfel. Ich verlasse mich nicht zu sehr auf die Inspiration. Ich sehe mich nicht zwischen den Schränken und den Fledermäusen meines Zimmers umhertasten auf der Suche nach diesem lauwarmen Dunst, der, wie es scheint, plötzlich in einem verborgene Quellen öffnet, aus denen der neue Wein hervorsprudelt. Die Inspiration ist vielleicht im dunklen Reich des Gedankens so etwas wie ein großer Markttag im Landkreis. Es entsteht an irgendeiner Stelle der grauen Hirnrinde freudige Bewegung, Willensanwandlungen rumpeln und poltern wie Gemüsekarren, man hört die schweren Ideenkanten scheppern: die Bogenschützen und Husaren der Phantasie stürmen das unbeschriebene Papier. Und zwar würde sich dieses Papier wie durch magische Truppenverschiebungen bedecken, so, als verspürten wir zu gewissen Stunden an dieser Küste, die von einer Schläfe zur anderen reicht, das Knattern eines Schreibgeschosses? In der Kunst macht mir die Inspiration den Eindruck eines Paroxysmus der Leichtfertigkeit. Und ich würde ihr die Absicht vorziehen, eine andere Mikrobe, die noch merkwürdiger ist.
Zweiter Punkt: Die Literatur interessiert mich nur in dem Maße, wie sie plastisch ist. Und ebenso wie Thibaudet bei einigen Autoren eine Romantik der subtileren Psychologie als derjenigen der Schicksalswende erkannt hatte, liebe ich meinerseits eine gewisse Plastik der seelischen Zustände. Verwechseln Sie mich bitte nicht mit den Parnassiens[1], die ich übrigens bewundere, weil ich eine Schwäche für die Goldschmiede im Gegensatz zu den Eisenwarenhändlern habe. Die Parnassiens hatten die Halluzination des Basrelief. Ich, ich ließ mich von den geheimen Geographien, den besonderen Materien anrufen, auch von den Schatten, dem Kummer, den Ahnungen, den gedämpften Schritten, den Schmerzen, die unter den Türen lauern, den wachsamen Gerüchen, die auf einer Pfote das Vorbeikommen der Phantome abwarten; von den Erinnerungen an alte Fenster, an Dünste, Gleitflüge, Spiegelungen und von den sterblichen Überresten des Gedächtnisses.
Wie oft haben wir von der Sache mit Charles-Louis Philippe oder Michel Yell gesprochen! Es ist notwendig, sagte ich, daß einer von uns sich entschließt, das zu schreiben, was man nicht schreibt. Denn, im ganzen gesehen, außer einigen Meisterwerken, die ebenso notwendig für den Rhythmus des Universums sind wie die sieben Weltwunder und die schließlich vollkommen mit der Natur verschmelzen, mit den Bäumen, mit den Gesichtern, mit den Häusern, schreibt man nichts. Niemand macht wirklich ähnliches. Etwas anderes auch beschwor unsere Todesangst. Das war das immer konstante, immer gegenwärtige Gewicht und auf einem einzigen Abdruck der ganzen Welt, Materien, Geräusche, Windhauch, seltsame Überschneidungen, Erinnerungen. Wir waren da, angeregte Spaziergänger des Boulevard de la Chapelle, gebannt auf einen einzigen Punkt des ewigen Lebens, auf ein einziges Furunkel des Wirbels. Und indessen starben Könige, ein Verbrechen wurde aufgedeckt, eine Brille glitt von einer Nase, die Aale zogen wie Messerschnitte den wärmeren Wasserparadiesen entgegen, der Kellner aus dem Café nebenan weinte in das Halbliterglas des teilnahmsvollen Gastes, eine Straßenbahn röchelte von der Gare de l'Est herauf, bei Madame de Jayme-Larjean spielte man Bridge, hier war winterliche Nacht und da unten käferfarbener Frühling … Die wirre, verschiedengestaltige Menge lebte in ihrem Gewimmel. Alles lebte gleichzeitig. Der Gedanke, für den Millionen und Millionen von Jahren notwendig waren, um den millionsten Teil dieses Augenblicks zu beschreiben, verwirrte uns, mißhandelte uns, ließ uns an Ort und Stelle erstarren. Und ich wiederholte, daß niemand sich entschied, das zu schreiben, was man niemals schreiben wird. Nun sagte Philippe mit seiner guten rauhen, ein wenig gepreßten Stimme, die unvergessen bleibt:»Entscheide dich.« Dann brachen wir wieder auf, den unendlichen Nächten unserer unbekannten Schicksale entgegen, ebenso schwer vorauszuahnen und zu deuten wie die bestürzende Unermeßlichkeit der gesamten und gleichzeitigen Schicksale dessen, was uns umgab.
Immer hat meine »Arbeitsmethode« Rechenschaft abgelegt von diesen fernen Schrecknissen. Es erschien mir natürlich, daß es alle Arten von Schriftstellern gab und daß Unterschiede zwischen uns ebenso formaler Art sind wie jene, die Kirchenvorsteher und Tennislehrer trennen. Schon früh habe ich mich für alle interessiert, die, wenn ich so sagen darf, sich in den Bereichen des Köstlichen betätigen und Werkzeuge verwenden, die immer schwerer zu finden sind und mühevoll gebrauchsfähig zu erhalten. Der Schriftsteller reizt mich nur, wenn er mir ein physisches Prinzip enthüllt, wenn er mich sehen läßt, was er mit seinen Händen arbeiten könnte, als Maler, Bildhauer, Handwerker, wenn er mir den Eindruck des »Individuell-Konkreten« vermittelt. Wenn er seiner Arbeit nicht den Charakter eines Objekts gibt, und zwar eines seltenen, so interessiert er mich nur hinter den Kulissen.
Wenn ich manchmal sage, daß alles in Balzac, Stendhal, Dostojewski oder Tolstoi vorkommt, so bemerke ich, daß es wohl bei Rimbaud, Flaubert oder Valéry andere Dinge gibt. Es handelt sich für mich nicht mehr darum, zu beschreiben, zu deuten oder Schlüsse zu ziehen. Ich habe eine Abneigung gegen die »Auslegung«, wie gegen das »Erzählte«, wie gegen das »Romantische«. Auch habe ich keine Arbeitsmethode. Ich habe vielmehr meine Art, den Berg zu erklimmen, der das Tal des weißen Papiers von der Hochebene der geschwärzten Blätter trennt. Aber diese Fährten bleiben geheim, selbst für mich. Alles, was ich enthüllen kann, ist, daß ich auf meine Weise einige Worte sagen möchte über das, was sich zwischen unserer Seele und den Dingen abspielt, deshalb möchte ich meinerseits vor dem höchsten Gericht erscheinen und den Zustand meines Herzens offenbaren. Zweifellos gibt es einerseits Kontaktaufnahme. Materien, zuverlässige Bilder, unabweisliche Gerüche, bestürzende Klarheiten kommen mir entgegen. Ich schreibe darüber, sei es. Es ist ein erster Wurf. Ich bringe diese Farben des Vorwortes auf einer breiten Filmleinwand unter. Ich webe einen Stoff. Das zweite Stadium besteht darin, mehr wahrzunehmen, vor dem gleichen Schauspiel zu verweilen, zeitiger zu schweigen, tiefer zu atmen, vor der gleichen Bewegung. Wenn ich irgendeinen jungen Schüler auszubilden hätte, so beschränkte ich mich wahrscheinlich darauf, ihm nur diese Worte zuzuflüstern: Sensibel … sich heftig bemühen, sensibel zu sein, unendlich sensibel, unendlich empfänglich. Immer im Zustand der Osmose. Dahin gelangen, das Betrachten nicht mehr nötig zu haben, um zu sehen. Das Raunen der Erinnerungen zu unterscheiden, das Raunen des Grases, das Raunen der Türangeln, das Raunen der Toten. Es handelt sich darum, schweigsam zu werden, damit uns das Schweigen seine Melodien überläßt, Schmerz, damit die Schmerzen bis zu uns gelangen können, Erwartung, damit die Erwartung schließlich ihre Möglichkeiten spielen lassen kann. Schreiben, das heißt Geheimnisse zu enthüllen verstehen, die man noch in Diamanten zu verwandeln wissen muß. Verfolge lange die Spur des treffendsten Ausdrucks und hole ihn von sehr weit her, wenn es sein muß. Einer meiner ältesten Vorfahren hatte irgend etwas für das Palais du Louvre ersonnen und für die Fontaine des Innocents. Sein Urenkel (er sah gut aus) hatte ein Wörterbuch verfaßt. Mein Großvater hatte seine Instrumententasche aufs neue erfunden; mein Vater erfand sein Glas, seine Emaillen, seine Schiene[2], seine Werkzeuge, sein Brennverfahren. Und ich, ich versuche, so gut es geht, weiterzumachen, indem ich meine poetisch-chemische Formel der Steinschleiferei meiner Vorväter hinzufüge …
[1] frz. Dichterschule 1866, Leconte de Lisle (Anm. des Übers.)
[2] zum Ausrunden von Keramiken (Anm. des Übers.)
Mein Quartier
Schon seit Jahren träume ich davon, einen »Plan von Paris« zu schreiben für sehr geruhsame Leute, das heißt für Spaziergänger, die Zeit zu verlieren haben und die Paris lieben. Und seit Jahren nehme ich mir vor, diese Reise mit einer Untersuchung meines eigenen Quartier zu beginnen, von der Gare du Nord und der Gare de l'Est nach La Chapelle, und nicht nur weil wir uns seit ungefähr fünfunddreißig Jahren nicht verlassen, sondern weil es eine besondere Physiognomie hat und weil es verdient, gekannt zu werden.
Vor fünfunddreißig Jahren heizte man hier noch Wärmehallen, die nach Männerhosen und ausgedienter Lokomotive rochen, Wärmehallen, die kaum lauwarm waren, doch gepriesen in der Welt der Armen, um die sich die Gauner von der Zunft der Vogelfreien versammelten wie Fliegen um ein Stück Münsterkäse. Es war die Zeit, in der Bruant sang und singen ließ:
Mais l' quartier d'venait trop rupin.
Tous les sans l' sou, tous les sans-pain
Radinaient tous, mêm' ceux d' Grenelle,
A la Chapelle.
Et v'là pourquoi qu' l'hiver suivant
On n' nous a pas foutu qu' du vent,
Et l' vent n'est pas chaud, quand i' gèle,
A la Chapelle …
Diese Art Sprache ist verschwunden. Heute singen die Burschen von La Chapelle und die Mädchen aus der Rue de Flandre oder aus diesen sonderbaren Quartiers, die von der Verwaltung Amérique und Combat genannt wurden, wie Grammophone. Durch das Radio und die Schallplatte gleicht das neunzehnte Arrondissement 1938 allen anderen. Die Kaldaunenhändler, die Advokaten, die bei Scheidungsangelegenheiten mit einem Kreditsystem arbeiten, die Kuppler, die durch kleine Gewinne in der »Nationale« langsam reich werden, die Statisten der Bouffes du Nord[1], die Angestellten der Binnenschiffahrt, die Weinhändler vom Quai de l'Oise und die Garagenbesitzer von der Place de Joinville sind für den Komfort und verschmähen es nicht, Faust oder die Neunte zu hören, wenn ihr schmalziger, abgehackter Lautsprecher gute Musik von sich gibt.
Entgegen einer Legende, die von hinter dem Ofen hockenden Vätern im Hirnkasten junger Abiturienten wachgehalten wird, ist La Chapelle weder ein Verbrecherviertel noch ein Quartier mit Wanzen. Es ist ein charmanter und zugleich solider Ort. Aber solide in dem Sinne, wie man das Wort auf einen Burgunder anwendet, auf ein Cassoulet oder einen Briekäse aus Melun. Das ist ein solides Essen.
Einen Beweis dieser Ehrbarkeit liefern uns die spießbürgerlichen Mätressen, mit denen sich Industrielle oder Bewohner des Pariser Zentrums in La Chapelle oder weiter unten in der Gegend der Gare du Nord und de l'Est treffen, in Restaurants für gute Esser, in verschwiegenen und geräumigen Brasserien, wo geliebt wird, um gleichzeitig Bourget, Steinlen und Kurt Weil zu inspirieren. Mit protzigen Ringen und Kreuzchen am Band geschmückte Mätressen, die Trauer anlegen, wenn ihr Geliebter irgendeinen Großvater verloren hat, und deren üppiger Busen eine Reihe von unechter Mütterlichkeit geweihten Meditationen heraufbeschwört. Solide Mätressen.
Gewiß, das Quartier ist auch dasjenige der Frauen für »Sidis«[2], für Randalierer, die den Gegner nur mit halbgeschlossenen Lidern wahrnehmen können, Individuen auf der Suche nach »Corridas«[3], die sich von einem Laden zum anderen an den Hauswänden entlang aufstellen, Rue de Tanger oder am Kanal de l'Ourcq, die die Kohlenlieferanten für den Wintersport kolonisiert, getauft, adoptiert haben, indem sie den Gäßchen ihre von den Kohlensäcken bekannten Namen gaben. Aber diese Fauna bilden Schmarotzer.
Sie hat sich in La Chapelle oder in La Villette eingenistet. Sie kehrt in der feuchten und verräucherten Atmosphäre des Kanals Saint-Martin wieder, in dem Saft der Schlachtbänke, aus Gründen, welche die Bürger dazu veranlassen, das Malerische des ›neunzehnten‹ zu meiden.
Wenn ich diese Ecke von Paris besonders zärtlich liebe, so deshalb, weil ich ungefähr dort geboren bin. Ich war vier Jahre alt, als mein Vater sich in La Chapelle niederließ, dort, wo sich heute das Kino »Le Capitole« befindet und wo er beinahe reich wurde mit dem Verkauf von »Wunderfedern, die ohne Tinte schreiben«, die den Füllfederhalter vorausahnen ließen. Außerdem brachte er ein neues chemisches Verfahren für farbige Perlen auf den Markt. Ich kehrte in das zehnte Arrondissement zurück, nachdem ich die Rue Colisée kennengelernt hatte, um in das Collège Rollin einzutreten, wo ich Barbusse fand, der ein guter Schüler war. Wir wohnten in der Rue de Dunkerque.
Bevor wir in dieses weiträumige, imposante Quartier, das sich auf zwei Bahnhöfe stützt, zurückkehrten, wohnten wir vorübergehend in Passy. Aber das zweite Mal zogen wir für immer in das ›zehnte‹. Eine Art Begeisterung führte uns dahin zurück, zum Boulevard Magenta, danach zum Faubourg Saint-Martin, und da wäre ich immer noch, wenn uns nicht die Compagnie de l'Est enteignet hätte, ehe sie uns wieder nach der Rue Château-Landon hinaufziehen ließ, nach La Chapelle, in diesen wimmelnden, dröhnenden Zirkus, wo sich das Eisen mit dem Menschen mischt, der Zug mit dem Taxi, das Vieh mit dem Soldaten. Mehr ein Land als ein Arrondissement, gebildet aus Kanälen, Fabriken, den Buttes-Chaumont, dem Port de la Villette, der den alten Aquarellisten teuer war …
Dieses Reich, eines der am meisten mit öffentlichen Bädern gesegneten von Paris, wo man wartet wie beim Zahnarzt und das von der Hochbahn beherrscht wird, die es krönt wie ein Stirnreif. Nach Norden beginnt die Rue d'Aubervilliers wie ein endloser Jahrmarkt, zum Bersten voll von Läden. Händler, die Schweinsfüße verkaufen, Spitzen nach Gewicht, Mützen, Käse, Salat, Stoffreste, gekochten Spinat, Gelegenheitsfahrradreifen, die übereinanderliegen, ineinandergehen, einander einschließen, ähnlich wie die Bauteile eines Stabilbaukastens in einem Alptraum. Man findet hier das Ei für sechs Sous, die »vorteilhafte« Hammelkeule, das Stück Briekäse, das irgendeine Stepperin in Zahlung gegeben hat, weil sie zu einer Hochzeit nach Charonne gerufen wurde, und gelegentlich einen Silberfuchs, der nicht viel mehr als ein Flederwisch ist und der für sechzehn Francs im Monat eine Existenz beendet, die auf Schultern angefangen hat, die sehr »Avenue du Bois« waren.
Das Geräusch der Linie Dauphine-Nation, dem Wehklagen eines Zeppelins ähnlich, begleitet den Fahrgast bis zu den von Fabrikschornsteinen eingekreisten Quartiers, Zinkseen, in die sich die Rue d'Aubervilliers wie ein Lackbach ergießt. Schreie umgeleiteter Züge übernehmen den Baßpart in dieser Landschaft. Zu jeder Stunde des Tages kommen und gehen Gruppen von Arbeitern an den Cafés mit niedriger Fassade vorbei, wo man »sein Essen mitbringen kann«, seine Gören »für eine Stunde« abgeben kann und manchmal schlafen, ohne etwas zu verzehren.
Die Kosten für den Lebensunterhalt sind hier sicherlich weniger hoch als sonst überall, aber die Händler verabscheuen das Anschreiben. Damit hängt zweifellos das Geheimnis ihrer opulenten Fleischereien und der braven Renaults zusammen, die man nur am Sonntag spazierenfährt, sowohl um sie zu zeigen als auch um sich fortzubewegen. Man könnte noch über die Eitelkeit der Leute von La Chapelle diskutieren. Es ist ein ursprüngliches Quartier, reich und geizig zugleich, ein Feind Gottes und des Snobismus. Die Touristen vor der reizvollen Kirche von Joinville, so florentinisch in den Farben, ebenso die Feinschmecker, die mit langen Schritten durch die Straßen gehen, um ein kleines Restaurant aufzuspüren, lassen das gleiche geringschätzige Lächeln auf dem Gesicht der Einheimischen erscheinen …
Die Restaurants findet man in La Villette. Sie sind übrigens in guten Reiseführern verzeichnet. Was die »Sehenswürdigkeiten für Touristen« betrifft, wie den Kanal de l'Ourcq, der gleich einem Schwimmbad zwischen den Quais der Marne und der Oise schlummert, stimmt den Reisenden nicht poetisch, weil es zu schwierig ist, sich in einer halb holländischen, halb rheinischen Landschaft wohl zu fühlen. Der Kanal ist für mich das Versailles und das Marseille dieser stolzen und kraftvollen Gegend. Die Kunst wagt sich kaum hierher, und doch sollten alle Schüler von Marquet und Utrillo hier ihr Domizil gewählt haben.
Es gibt hier ein Sammelsurium kleiner Häuser, windschief und sympathisch, Schaufenster mit Seesäcken, Ausrüstungen verstorbener Matrosen, Reklameschilder von Bauunternehmen und Wäschereien, eine Genossenschaft von Burschen aus Rotterdam, aus Turin, aus Toulouse, aus Dijon, aus Strasbourg, eine Schiffsehrentafel mit entzückenden Namen, deren Nachbarschaft und deren Vielfalt, deren Umrisse in jedem Haus hätten einen Dichter zur Welt kommen lassen können. Aber man meldete mir keinen einzigen »Intellektuellen« in der Gegend. Am wenigsten weit entfernt wohnt Luc Durtain, nämlich auf dem Boulevard Barbès, was für einen Mann aus der Rue de Flandre beinahe Savoyen oder Bulgarien bedeutet.
Das Prunkstück dieses Quartier, wo die Signalmasten in Blüte stehen und dessen natürliche Schönheiten sehr zahlreich sind, die Place du Maroc, die Rue de Kabylie, die Pompes Funèbres, zwischen Rue d'Aubervilliers und Rue Curial gezwängt, Speicher, Kliniken für Lokomotiven, das Prunkstück bleibt das große 106, das im Rücken des Hôpital Lariboisière errötet. Dieses Haus ist so sehr alt, so augenfällig für die Fahrgäste der Métro, ebenso für diejenigen der Taxis, daß man sich fragt, ob es nicht der Familienbesitz des Arrondissements ist …
Von ihm gehen die Legenden von La Chapelle aus. Die Pariser von Saint-Philippe-du-Roule oder der Rue de Varenne beheimaten hier zweifellos alle perversen Götter der Außenboulevards und kennen von dieser Provinz nur jenes Absteigequartier, von dem die Soldaten und die Obdachlosen träumen …
Am Sonntag streunen Knäuel von Fremdarbeitern unter dem hohen Baldachin der Métro, bleiben stehen und gruppieren sich um die Matten der Ringkämpfer und springen manchmal einander an die Gurgel, wegen eines Apéritifs oder einer Frau. Diese Kämpfe sind kurz und lautlos, denn seit einigen Monaten hat die mögliche Verweigerung der Arbeitserlaubnis oder der Carte d'Identité das Abenteuer mit dem Gendarmen und selbst die Angst vor ihm in der Einbildungskraft derer, die leicht in Hitze geraten, abgelöst.
In La Chapelle ist der Sonntag wirklich ein Sonntag, und die Verwandlung des Quartier vollkommen. Die großen Wagen, die von Industriellen mit Bürstenschnurrbart gefahren werden, kreisen um den Étoile oder verlassen Paris. Die Geschäfte sind geschlossen, mit Ausnahme der Fleischereien, deren Besitzer über das kalte Essen ihrer Untergebenen nachdenken. In Trauben, in Knäueln defilieren die Familien der Blumenhändler, der Milchhändler, der Schuster und Verzinker zwischen der Station Jaurès und der Eisenbahnbrücke der Gare du Nord, dem breiten Stück des luftigen Boulevards, der die Promenade des Anglais ersetzt, den Platz und Park von Saint-Cloud.
Der Gatte, der schon reichlich Vermouth getrunken hat, pfeift sich eins, dicht hinter seinen Söhnen. Die treue, standhafte Gattin setzt ihren ländlichen Tritt fest auf den Bürgersteig. Das heiratsfähige junge Mädchen schnuppert den Rauch des Engadin-Expreß oder des Expreß Paris–Bukarest, die ihr Herz weit über die geographischen Grenzen und über die Grenzen der Empfindung hinaustragen. Die Cafés hallen wider vom Jagdeifer der Kokotten, vom Wettstreit auf dem russischen Billard. Alle diejenigen, die aus dem einen oder anderen Grunde nicht dem Ruf der Humanité oder irgendeiner anderen Organisation gefolgt sind, geben La Chapelle eine bürgerliche Färbung, eine Atmosphäre der Beschaulichkeit, die man anderswo nicht findet …
Denn nur am Abend schlüpft das Quartier in sein wahres Kleid und erhält dieses phantastische, verwahrloste Aussehen, das gewisse Romanschriftsteller als chic in Mode gebracht haben, wie man sagt, und ohne die Reise zu riskieren. Am Abend, wenn die D-Züge geradewegs in das Herz von Paris zu eilen scheinen, wenn die jungen Sportfreunde sich vor den Geschäften mit Zubehörteilen für Automobile treffen und sich über Radfahren und Tauchen unterhalten, wenn die Matronen einwilligen, ihre Ehemänner für eine Partie Karten unter Kameraden freizugeben und die Kinos sich nach einem Rhythmus füllen, ähnlich dem bei der kostenlosen Untersuchung in den Krankenhäusern. Dann ist La Chapelle wohl jenes Land einer finsteren, ergreifenden Schwermut, dieses Paradies der Streitsüchtigen, der Bettelkinder und der Protzen, die die Ehre im Munde führen und denen die Ehrlichkeit an den Fingerspitzen klebt, dieses finstere, beengte Eden, in dem die Soldaten so sehr an Heimweh leiden, daß sie den Abend in ihren Mannschaftsstuben festlich begehen, um der einsamen Langeweile ein Ende zu machen. Dieses nächtliche La Chapelle kenne ich am besten und liebe es am meisten. Es hat mehr Schneid, mehr Gemüt und mehr Resonanz. Seine Straßen sind leer und ausgestorben, noch wenn der Schrei der Luxuszüge ihm Storchenschwingen schickt … Der Gänsemarsch der Straßenlaternen ersetzt die verschwundene Anhäufung der Läden nicht, wodurch das Quartier am Tage den afrikanischen Märkten ähnelt. Das ganze Quartier schwimmt in Tinte. Es ist die Stunde der verzweifelten Rufe, die alle Menschen gleich und zu Dichtern macht. In der Rue de la Charbonnière geben die Prostituierten im Laden, wie in Amsterdam, auf ihrem Platz eine Schaustellung mit einem schmutzigen Kartenspiel. Akkordeonmelodien, dünn wie Zigarettenrauch, schlüpfen aus den Türen, und der Bal[4] du Tourbillon fängt an aus seinem harten Mund zu bluten …
Ein bürgerliches Interieur, flüchtig im zweiten Stock eines Gebäudes wahrgenommen, abstoßend und starr, wie der Sockel einer Pyramide, anstatt Selbstmordideen einzuflößen und den Spaziergänger dazu zu zwingen, sich in Traurigkeit zu vergraben, läßt im Gegenteil in mir eine besondere Bewunderung für Tausende und Abertausende von Wesen entstehen, die das Leben zu ungesunden Wohnungen mit Wuchermietpreisen und von Bazillen wimmelnden Treppen verdammt, eine Menschheit, die durch nichts getröstet werden kann.
Denn was in La Chapelle am meisten fehlt, ist Geborgenheit. Man kann die Straßen und die Quartiers, aus denen es sich zusammensetzt, nicht erfassen: sie bestehen nur aus Menschengewimmel. Man erkennt niemanden, man bekommt keinen Kerl richtig zu Gesicht. Die Leute von La Chapelle stehen zu Diensten, sie sind darauf eingerichtet, Bestellungen entgegenzunehmen. Ihr Augenmerk ist auf den Schinken gerichtet, auf die Scholle, auf den Porree. Man arbeitet. Und man rasiert hier besser, glatter, zarter als auf den Boulevards, wo die ringgeschmückten Friseure englisch sprechen und keine Ahnung von der Haut eines Mannes haben …
Obwohl ich jetzt nicht dort wohne – aber in jedem Augenblick dahin zurückkehre, um hier meine teuren Phantome wiederzufinden, und vielleicht eines Tages wieder hierherziehen werde, beschämt und reuevoll – halte ich das, was ich mein Quartier nenne, das heißt dieses zehnte Arrondissement, für das poetischste, traulichste und geheimnisvollste von Paris. Mit seinen beiden Bahnhöfen, riesigen Music Halls, wo man Darsteller und Zuschauer zugleich ist, mit seinem wie ein Pappelblatt glasierten Kanal, der so liebevoll zu den unendlich Kleinmütigen ist, immer hat es mein Herz und meine Schritte mit Kraft und Traurigkeit erfüllt.
Es ist gut, ein stilles Wasser, wie eine Jadesuppe, auf deren Oberfläche Boote kochen, vor Augen zu haben, Fußgängerbrücken, gekrümmt wie verliebte Insekten, massige und trostlose Quais, Fenster, die entsetzliches Elend verschließen, Läden, für die die Hochbahn Wagner und Zeus imitiert, braune, schwere Beschläge wie Algen, schöne Straßenmädchen, in diesem kargen Garten gewachsen, gebildet, anmutig wie Akeleiblüten, Kohlenhändler, Züge, von der Länge eines Augenblicks der Depression, Katzen, die streng nach Kaffeemühlen riechen, seßhafte Töpfer, hundertjährige Arbeitsscheue, Zahnärzte zu viert … Das Ganze vom Dampf der Züge und Schiffe umschäumt, die die Brücken mit Rasierseife bestreichen und an die ›Geographie‹ denken lassen. Basel, Zürich, Bukarest, Chur, Nancy, Nürnberg, Mézières-Charleville, Reims und Prag, all dies Spielzeug der Erinnerung kommt mir von der Gare de l'Est …
Und dann, es gibt Dramen auf den Schiffen, den weißen Flecken auf dem Zink, leuchtend wie Schienenstränge; es gibt die grünlichen Amoretten der ungesunden, behaglichen Zimmer, das Innenleben der Concierges, den Galopp der Brauerpferde, die Kämpfe der Lastautos mit den Märkten; es gibt die Laufkunden und die Eingesessenen, die Akkordeonvorstellungen, die Bälle, wie den Tourbillon, die Banken, die Speicher, die Treppen, die Sirenen, Labyrinthe von Empfindungen und ein Kommen und Gehen, das mein Freund Eugène Dabit sehr fein empfunden hat, er, der aus meiner Ecke stammte, aus demselben Bau. Man hat wohl versucht, all das in einem Film wiederzugeben, den man seinem netten und traurigen großartigen Schmöker entrissen hat, aber »das ist nicht dasselbe …«.
Ich bin in diesem Quartier, bei dem meine Erinnerungen verweilen, noch mit Personen in Verbindung, die es gleich nach der Zeit der ersten Eisenbahnen gekannt haben; und das ununterbrochene Pfeifen auf den Bahnhöfen bringt sie darauf, mir einige Zahlen zu nennen, die für meine Einbildungskraft genausoviel Anziehendes haben wie der Kampf gegen die Ameisen, den man gegenwärtig in den Vereinigten Staaten ankündigt. Sie erzählen mir von der Zeit, wo es 812 Kilometer Eisenbahnschienen in Frankreich gab, das Ganze hatte zweihundertachtzig Millionen Francs gekostet. Man fuhr mit Dampfschiffen von Paris nach Rouen, mit den Étoiles und den Dorades. Der Doppeladler der zehn Golddollars war 55 Fr. 21 wert. Die Postmeister vermieteten einem ihre Pferde zu zwanzig Centimes den Kilometer … Ist das nicht genauso schön wie die Märchen von Andersen? Wer erzählte mir das alles? Meine Mutter, geboren 1838, die alte Freundinnen hatte. Und wenn wir im Faubourg Saint-Martin oder in der Rue Château-Landon zusammenkamen, um zu plaudern, sei es mit den Patriarchen von La Chapelle, sei es mit den vornehmen Damen der Rue Lafayette, den Champs-Élysées des Arrondissements, so war es, um von Paris als Hauptstadt der Zivilisation zu sprechen.
Wir waren dann von der Welt abgeschlossen, im Norden durch die Barriere von Saint-Martin, am äußersten Ende des Faubourg. Das war ein schöner Rundbau aus vier vorgewölbten Pfeilern in toskanischem Stil, das Ganze wurde von einer umlaufenden Galerie mit vier verbundenen Säulen gekrönt, die zwanzig Arkaden stützten. Das machte einen großartigen Eindruck. Eine meiner Kirchen ist immer Saint-Laurent, enthauptet durch die Revolution. Zu unseren Kuriositäten zählten wir das Maison Royale de Santé in der Rue du Faubourg Saint-Denis, das Hospice des Incurables für Männer im Faubourg Saint-Martin, das Hôpital du Plat d'Etain 256, Rue Saint-Martin, von wo die Postkutschen abfuhren. Dann kamen nach und nach sich an diese alten Häuser anschließend das Hôpital Lariboisière, das Théâtre Molière, das Maison de Santé Dubois, die Bahnhöfe, die großen Krämerläden, die schönen Fleischereien, die Métro, die Kinos, die Schwimmbäder, die Kliniken für unbemittelte Hunde, die ›Zähne für alle‹, die Taxistationen und die Radiomasten. Ganz zu schweigen von der Überfüllung, über die ich nichts sagen werde in Gedanken an das Vorwort, das Pierre Véron 1884 schrieb: »… Die Straßenbahnen, diese brüllenden Mastodonte, die ganz geradeaus fahren, ohne sich darüber zu beunruhigen was sie umwerfen, wen sie töten! … Die Reklame-Autos, die alberne Ankündigungen durch die Straßen schleppen … Keine fünf Jahre und der Verkehr wird seinen Höhepunkt erreicht haben, ich wette, daß sie den Boulevard de Strasbourg, den Boulevard de Sébastopol usw. nicht länger befahren können. Es wird materiell unmöglich sein. Wenn die Straßenbahnen achtundvierzig Stunden Verstopfungen herbeigeführt haben werden, dann wird man sich wohl entschließen müssen, uns von diesen Flußpferden zu befreien! Das ist sicher! Ich sage nichts mehr! Man hat nur zu warten! …« Das bringt einen zum Träumen, nicht wahr? Nicht von dem, was war, sondern von dem, was sein wird …
Für mich ist das ›zehnte‹, und wie oft habe ich es schon gesagt, ein Quartier der Dichter und Lokomotiven. Das ›zwölfte‹ hat auch seine Lokomotiven, aber es hat weniger Dichter. Einigen wir uns auf dieses Wort. Nicht nötig zu schreiben, um Poesie in seinen Taschen zu haben. Da sind zuerst diejenigen, die schreiben und eine fliegende Akademie begründen. Und dann gibt es welche, die jene Geheimnisse kennen, dank denen die Vereinigung der Sensibilität mit dem Quartier Glück zustande bringt. Deshalb schmücke ich Stellmacher, Fahrradhändler, Krämer, Gemüsehändler, Blumenhändler und Schlosser der Rue Château-Landon oder der Rue d'Aubervilliers, vom Quai de la Loire, der Rue du Terrage und der Rue des Vinaigriers mit dem vornehmen Titel des Dichters. Sie zu sehen, ihnen im Vorbeigehen zuzulächeln, sie nach ihren Töchtern zu fragen, ihre Söhne als Soldaten zu sehen, erfreut mich bis in die verborgensten Falten meines alten, vom Haß unberührten Herzens.
Und dann fühlen wir bei uns, ich will sagen im ›zehnten‹, auch noch das Vorbeistreifen der echtesten Phantome. Aus dem kränklichen Grün der Buttes-Chaumont niedergestiegen, aus den schimmernden Schienensträngen wie eine Tränenspur hervorgesprüht, verscheucht aus den Schlachthäusern, geboren in dem geheimnisvollen Dreieck, das aus dem Faubourg Poissonnière, den sogenannten großen Boulevards und dem Boulevard Magenta geformt ist, sind unsere Phantome keineswegs gebildet. Sie sind keine Lieferanten von Poesie für Filme, Ballette, von Lastern, Kostümen, abscheulichen Modernitäten. Es sind Glockentürme der Erinnerungen, Botenjungen, Schnellzuggespenster, Kobolde aus Postämtern. Sie helfen uns zu leben, wie Steinpflaster, Schieferdächer und Dachrinnen. Sie haben teil an der gleichen Pastete, demselben Kaviar wie die Lebenden. Und wir sind da unter uns, die Lebenden und die Toten, wir genügen unserer Daseinspflicht, unserer früheren Lebhaftigkeit beraubt, steuern wir in die Leere der Bequemlichkeiten und der Bedrohungen …
Unser Familienleben in dieser grauen Welt ist würzig wie ein großes Rosinenbrot, es ist das Leben mit alten Büchern, mit Blattpflanzen, mit der Küche ganz nahe dem Herzen, das Ohr, oh! das mütterliche Ohr in Reichweite euerer Zärtlichkeit, das einfache Nachtmahl, Schicksale von Freunden und alten Kumpanen, der Spektakel mit der Concierge, kurzum eine richtige Behaglichkeit wie mit Kaninchen und Reisig, mit jenen Musettemelodien, von den Lokomotiven aus dem Osten und dem Norden in den Himmel geschleudert, die, wenn sie bisweilen ein oder zwei Meter Verzweiflung nach der Schweiz oder nach Deutschland mitnehmen, uns bald zu den kräftigen und vertrauten Gerüchen der Rue d'Alsace und der Rue Louis-Blanc zurückführen. Liebes altes Quartier, mit echtem Feenzauber und sanft wie geliebte Geleise …
[1] Theater, heute Kino (Anm. des Übers.)
[2] Herren, im Marokkanischen
[3] Stierkämpfe, im Spanischen (Anm. des Übers.)
[4] volkstüml. Ball (Anm. des Übers.)