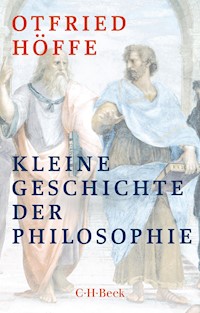Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was hat ein Philosoph der Aufklärung uns im 21. Jahrhundert noch zu sagen? Unser Autor hat sich zeit seines Lebens ausführlich mit dem Königsberger Denker, nach dem man die Uhr stellen konnte, wie eine populäre Anekdote lautet, auseinandergesetzt und ist sich sicher: Die Aktualität Kants liegt in seinem Kosmopolitismus. Kant war Weltbürger und überzeugter Demokrat und seine Philosophie, die er mit einer großen Fülle und Tiefe an Argumenten dargelegt hat, wird im Gegenzug auch weltweit anerkannt, da sie kulturübergreifend verständlich und einleuchtend ist, was ihn zu einem der wichtigsten Denker unter allen Philosoph:innen macht. Zu seinem runden Geburtstag sollen diese kantischen Gedanken aus sich selbst heraus zum Leuchten gebracht werden. Für die Lektüre benötigt man keine Vorkenntnisse in Kants Philosophie und er selbst wird ausführlich zitiert. Der umfangreiche und klar gegliederte Text geht auf viele Themen anhand der Hauptwerke ein, denn Kant hat sich mit fast allem befasst. Dabei sind die Fragen, die er aufwirft, auch noch heute radikal und provokant, was auch für viele seiner Antworten zutrifft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Otfried Höffe
Der Weltbürger aus Königsberg
Immanuel Kant heute
Person und Werk
Für Evelyn,die nach Aristoteles auch mit Kant vertraut wurde
INHALT
Vorwort
Die Person als Vorbild
1.Aufstieg aus einfachen Verhältnissen
2.Enzyklopädische Wissbegier
3.Bürgerliche Tugenden – mit Geselligkeit
3.1Sekundärtugenden
3.2Der »elegante Magister«
4.Der Philosophielehrer
5.Antriebskräfte
5.1Aufklärung
5.2Richterliche Kritik
5.3Moral
5.4Ortsgebunden und doch Kosmopolit
5.5Eine demokratische Grundhaltung
I. Was kann ich wissen? – Theoretische Philosophie
1.Der Mensch rückt ins Zentrum
2.Wider den »Eigendünkel der Spekulation«
2.1Eine tragische Situation
2.2Metaphysik revolutionieren, nicht abschaffen
3.Mathematik: kein Vorbild für die Philosophie
4.Aufwertung der Sinnlichkeit
4.1Kants Aktualität
4.2Neubewertung der Mathematik
4.3Individualität
4.4Apologie der Sinnlichkeit
5.Reine Verstandesbegriffe: die Kategorien
5.1Das neue Programm
5.2Bleibende Bedeutung
5.3Das transzendentale »Ich denke«
6.Philosophische Naturgesetze
6.1Fundamentalphilosophie ist erfahrungsunabhängig
6.2Ein erstes Naturgesetz: Die Natur ist mathematisch verfasst
6.3Zwei weitere Naturgesetze: Substanz- und Kausalitätsprinzip
7.Eine alternative Philosophie des Geistes
7.1Kritik der Unsterblichkeitsbeweise
7.2Zwei kleine Einsichten
7.3Wo bleiben der moralische und der ästhetische Geist?
7.4Kritik eines neueren Klassikers: Gilbert Ryle
8.Astrophysik und Mikrophysik
8.1Über Newton hinaus: rein säkular
8.2Die Biologie vermag weniger als die Physik
8.3Logik der Forschung: »Abgrund der Unwissenheit«
9.Revolution der philosophischen Theologie
9.1Ein überholtes Thema?
9.2Ein Gott für Naturforscher
9.3Weder die Existenz Gottes noch seine Nichtexistenz sind beweisbar
10.Zur Würde der Philosophie
10.1Aufklärung, demokratisch
10.2Ein epistemischer Kosmopolitismus
10.3Metaphysik in nachmetaphysischer Zeit
10.4Ein theorieinterner Übergang zur Praxis
10.5Die weltbürgerliche Philosophie
11.Ein Vorbild für wissenschaftliche Prosa?
11.1Für Fachkollegen: ein ciceronisches Deutsch
11.2»Wahre Popularität«
11.3Studentenfreundliche Vorlesungen
11.4Kant: Ein Kandidat für den Sigmund-Freud-Preis
II. Was soll ich tun? — Moral und Recht
1.Kants Doppelrolle: Vorbild und Provokation
2.Der kategorische Imperativ: Nur eine neue Formel
2.1Unbescheiden: eine erfahrungsfreie Moralphilosophie
2.2Drei Imperative, drei Stufen von Freiheit
2.3Bescheiden: eine Entdeckung, keine Erfindung
2.4Eine Maximenethik
2.5Fünf Vorteile
2.6Der Demokratie-Wert
3.Zwei Beispiele
3.1Lügeverbot
3.2Kein Recht, aus Menschenliebe zu lügen
3.3Das Depositum-Beispiel
4.Determinismus oder Freiheit?
4.1Die Herausforderung
4.2Freiheit 1: Denkbar, nicht erkennbar
4.3Freiheit 2: objektiv real
4.4Radikale Freiheit: Autonomie des Willens
5.Wider die Überhöhung des Wir
6.Ein Vernunftbegriff des Rechts
6.1Paradox: positiv-überpositiv
6.2Reine praktische Vernunft: Das Recht als Moral
6.3Der kategorische Rechtsimperativ
6.4Menschenwürde und Menschenrechte
6.5Warum Eigentum?
7.Zwangsbefugnis, legitime Herrschaft, Kriminalstrafe
7.1Braucht Kant eine Hermeneutik des Wohlwollens?
7.2Ärgernis 1: Zwangsbefugnis des Rechts
7.3Ärgernis 2: Politische Herrschaft
7.4Ärgernis 3: Strafe als Vergeltung
7.5Der Rechtsstaat
7.6»Den Staat braucht selbst ein Volk von Teufeln«
8.Ein ewiger Friede
8.1Vorbild eines politischen Denkers
8.2Welche Ewigkeit ist im »Ewigen Frieden« gemeint?
8.3Der Staat
8.4Völkerbund oder Weltrepublik?
8.5Ist jede humanitäre Intervention ein Unrecht?
8.6Sind Republiken beziehungsweise Demokratien per se friedfertig?
8.7Ein Besuchsrecht, kein Gastrecht
III. Was darf ich hoffen? — Geschichte, höchstes Gut, Religion
1.Ein verlorenes Thema: Hat Geschichte einen Sinn?
1.1Säkular
1.2Kosmopolitisch
1.3Rechtsfortschritt
1.4Die Antriebskraft: ungesellige Geselligkeit
2.Eine Provokation: das höchste Gut
2.1Vom Sollen zum Hoffen
2.2Zwei Postulate: Unsterbliche Seele und Existenz Gottes
2.3Der moralische Glaube
3.Religionsphilosophie für eine säkulare Gesellschaft
3.1Revolution der philosophischen Theologie
3.2Christentum ohne Offenbarung
3.3Ein verdrängtes Thema: das Böse
3.4Ein Philosoph liest die Bibel
3.5Ein ethisches Gemeinwesen: die unsichtbare Kirche
IV. Was ist der Mensch?
1.»Anthropologie in pragmatischer Hinsicht«
1.1Die neue wissenschaftliche Disziplin
1.2Vom Erkenntnisvermögen
1.3Vom Gefühl der Lust und Unlust
1.4Leidenschaften
1.5Humanität: Eine gelungene Tischgesellschaft
1.6Über Charaktere
2.Kultivieren, Zivilisieren, Moralisieren
2.1Eine kosmopolitische Pädagogik
2.2Leitzweck: Aufklärung
2.3Drei Erziehungsziele und eine Voraufgabe
2.4Der dreifache Wert des Menschen
2.5Das Kind soll spielen, aber auch arbeiten lernen
2.6Bürger bilden
3.Nur der Mensch als Endzweck
3.1Ein fremdes Thema?
3.2Allein der Mensch, kein Tier
3.3Gattungsegoismus?
V. Zweckdenken
1.Eine verlorengegangene Denkweise erneuern
2.Das Schöne und das Erhabene
2.1Geschmacksurteile
2.2Eine ästhetische Revolution: Kunst des Genies
2.3Das Schöne
2.4Das Erhabene
3.Zweckmäßigkeit in der Natur: Biologie
3.1Biologische Zweckmäßigkeit
3.2Kausalität plus Teleologie
4.Der Endzweck der Natur: der Mensch
4.1Teleologie der Gesamtnatur
4.2Welcher Mensch als Endzweck?
4.3Noch einmal: Ein moralischer Glaube
(K)Ein Schlusswort
Siglen
Literatur
Sachregister
VORWORT
Vor 300 Jahren, am 22. April 1724, wurde einer der größten Denker des Abendlandes geboren: Immanuel Kant. Dieser Umstand ist Anlass genug zu überlegen, was dieser Philosoph – ein Höhepunkt, zugleich Wendepunkt der europäischen Aufklärung, überdies einer der bedeutendsten geistigen Persönlichkeiten der Menschheit – uns heute noch zu sagen hat.
Ohne Zweifel hat Kant zur Geistesgeschichte der Gattung Mensch, zur globalen Ideengeschichte, einen überragenden Beitrag geleistet. Das trifft aber auch auf Thales, Pythagoras und Archimedes, auf Hippokrates und Galen, auf Galilei, Kopernikus, Kepler und Newton sowie viele weitere Mathematiker, Naturforscher, Ingenieure und Mediziner zu. Deren Gedanken wurden jedoch nach einiger Zeit von nachfolgenden Forschern überholt, sodass sie bei aller Wertschätzung heute nicht viel mehr als eine bloß archivarische Bedeutung haben. Verhält es sich bei Kant ähnlich? Ist sein Beitrag lediglich für seine Zeit von revolutionärer Bedeutung, muss jedoch mittlerweile als überwunden gelten? Hat der Philosoph nur noch einen geistesgeschichtlichen Wert?
Bekanntlich wird Kants Denken rasch europaweit berühmt. Trotzdem wird es bald für nicht mehr als eine Vorstufe der wahren Gestalt der Philosophie gehalten. Diese Ansicht vertritt jedenfalls das Dreigestirn des Deutschen Idealismus: Fichte, Schelling und Hegel. Handelt folglich, wer Kant viele Generationen später und nach manch weiterer Kritik noch vergegenwärtigen will, nur aus Mitleid mit einem in die Jahre gekommenen Denker?
Im Laufe meines Philosophenlebens habe ich mich, das versteht sich, nicht nur mit Kant befasst. Für die Antike etwa bin ich bei Platon und Aristoteles in die Lehre gegangen, für das Mittelalter bei Thomas von Aquin und Nikolaus von Kues, für die Moderne bei Machiavelli, Hobbes und Descartes, ferner bei Spinoza, Hegel, Nietzsche und neuerdings Rawls. Offensichtlich ist es müßig, diese und andere Philosophen gegeneinander auszuspielen. Ich persönlich gebe allerdings in Zweifelsfällen häufig Kant den Vorzug.
Auf der Grundlage zahlloser Lehrveranstaltungen und Veröffentlichungen zu Kant bin ich jedenfalls überzeugt, der Königsberger Philosoph gebe uns auch heute noch viel zu denken auf: »uns«, die wir mehr und mehr in einer die Sprach- und Kulturgrenzen überschreitenden, global gemeinsamen Welt leben. Nicht der geringste Grund, Kant zu vergegenwärtigen, liegt nämlich in seinem facettenreichen Kosmopolitismus: Kant ist ein dezidierter Weltphilosoph und ebenso entschieden ein demokratischer Denker.
In seinem Kosmopolitismus erörtert er in außergewöhnlicher Fülle und Tiefe Themen, die für die Menschen so gut wie aller Kulturen von Bedeutung sind. Die Begriffe und Argumente, die Kant dafür entwickelt, sind ebenfalls kulturübergreifend verständlich und einleuchtend, in vieler Hinsicht sogar überzeugend. Aus diesen Gründen darf man, ohne einer okzidentalen Überheblichkeit zu erliegen, Kant zu einem der wichtigsten Denker und Lehrer der Menschheit erklären. Seinen Universalismus, wie es neuerdings häufig geschieht, für kolonialistisch zu erklären, ist schlicht abwegig. Alle Welt erkennt dies durch die Tat an. Überall, von Skandinavien über die Mittelmeerländer bis nach Südafrika und von Indien, China und Japan über Nord- und Südamerika bis zum Vorderen und Mittleren Orient, wird Kant in seiner Bedeutung anerkannt und im Frühjahr 2024, um seinen 300. Geburtstag herum, vermutlich allerorten gefeiert.
Diese Wertschätzung kann man mit Hilfe eines Gedankenexperiments noch steigern: Man stelle sich vor, auch außerhalb unseres Globus gebe es sprach- und vernunftbegabte Lebewesen. Dann werden diese »Außerirdischen« ähnliche Erkenntnis-, Moral- und Rechtsprobleme wie wir haben. Falls sie aus einem glücklichen Zufall Kants Werke kennen lernen, werden sie sich der folgenden Wertschätzung kaum versperren: Für Aufgaben und Interessen, die sich sinnlichen Vernunftwesen stellen, bietet der Philosoph aus Königsberg so plausible Denkwege an, dass er sogar universumweit als einer der größten Denker anerkannt würde.
Gegen diese Behauptung sind allerdings zahlreiche Einwände zu erwarten. Obwohl dieser Essay von einem Kant-Freund verfasst ist, schiebt er diese erwartbaren Einwände nicht mit auktorialer Geste beiseite. Er nimmt sie ernst, glaubt aber, die gewichtigeren Einwände ließen sich entkräften. Vor allem empfiehlt er, Kant nicht wie den Angeklagten eines Strafprozesses zu behandeln, der sich nur dank der Unschuldsvermutung vor einer Verurteilung retten kann. Eher begebe man sich auf eine Art Angelexpedition, bei der man nicht schon vorab weiß, welche Köder man am besten einsetzt.
In der neueren Kant-Exegese sind gelegentlich Themen beliebt, die, wie etwa Armutsfragen, für ein heutiges Denken unverzichtbar seien, von Kant aber unzulänglich behandelt würden. Richtig ist, dass sich zu diesem Thema hilfreiche Hinweise finden. In einem Philosophieprojekt, das sich auf die Grundfragen menschlicher Theorie und Praxis richtet, sind sie aber nicht von erstrangiger, nicht einmal von zweitrangiger Bedeutung. Ähnliches gilt für die neuerdings leidenschaftlich diskutierte Frage, ob Kant ein Rassist war oder ob er »das schöne Geschlecht« nicht als gleichwertig und gleichberechtigt anerkenne. Ohne Zweifel gibt es zu diesen Themenfeldern fragwürdige Ansichten, auf die wir auch eingehen werden. Genauso zweifelsfrei sind sie aber für Kants Philosophie nicht wesentlich, weshalb sie kein Anathema aufdrängen, keinen Kirchenbann, der unseren Philosophen, wenn überhaupt, nur unter strengen Vorbehalten wertzuschätzen erlaubte.
Die – keineswegs großartige – Einsicht, dass auch ein überragender Denker »Kind seiner Zeit« und daher nicht all ihren Vorurteilen enthoben ist, ist für Sein wenig ergiebig. Mehr Urteilsfähigkeit, zumal Augenmaß, beweist, wer entsprechende Zeitbedingtheiten nicht verdrängt, jedoch prüft, ob sie auf die Kerngedanken, bei Kant also auf die Erkenntnistheorie und Moralphilosophie, auf die Rechtstheorie und Geschichtsphilosophie, auf die Religionstheorie, philosophische Ästhetik und so weiter, durchschlagen oder aber diese Bereiche im Wesentlichen unbehelligt lassen.
Kant benötigt jedenfalls nicht das gelegentlich vorgeschlagene »principle of charity«. Um ihn heute noch wertzuschätzen, muss man ihm gegenüber weder Nächstenliebe üben noch Mitleid haben. Um unseren Philosophen zum Sprechen, vielfach sogar zum Leuchten zu bringen, braucht es nicht einmal, was das Vorbild für das Philosophieren, Sokrates, von seinen Gesprächspartnern erwartete: Wohlwollen. Es genügt, Kant mit einer offenen Neugier für seine oft ungewohnten Gedanken zu lesen.
Ohne deshalb Nebenthemen und kritikwürdige Passagen beiseite zu schieben, hält es dieser Essay nämlich für wichtiger, auch für spannender, Fragen wie diese zu erörtern: Welche Theorieprojekte Kants, welche ihrer Grundideen, ihrer Begriffe und Argumente, welche Grundaussagen sind heute noch aktuell, teils sie selbst, teils ihr »Kantischer Geist«? Gelegentlich erlauben wir uns sogar die Frage, ob die politische Geschichte des 20. Jahrhunderts anders verlaufen wäre, wenn sie Kantische Gedanken ernster genommen hätte. Dann hätte sie, darf man vermuten, zum Beispiel ein weniger eurozentrisches Denken und eine weitsichtigere Theorie einer globalen Friedensordnung entwickelt.
Zuvor wenden wir uns jedoch einem Thema zu, dessen Wert selbst Kantkenner zu unterschätzen pflegen: Schon die Persönlichkeit des Philosophen hat einiges zu sagen. Kant stammt nämlich aus einfachen Verhältnissen, womit er zeigt: Man muss nicht aus dem Bildungsbürgertum stammen, um zu einem Muster für Bildung zu werden.
Die anschließenden Teile widmen sich Kants drei berühmten Fragen: 1. Was kann ich wissen? – 2. Was soll ich tun? – 3. Was darf ich hoffen? Hinzu kommt Kants in der Logikvorlesung vorgenommene Ergänzung um: 4. Was ist der Mensch? Abschließend wird Kants Zweckdenken erörtert.
In all diesen Teilen werden weder Kantkenntnisse vorausgesetzt, noch wird erwartet, bei der Lektüre dieses Essays habe man eine Kant-Ausgabe neben sich liegen. Deshalb kommt bei jedem Thema unser Philosoph selber ausführlich zur Sprache.
In der Musik nennt man die kunstvollen Abwandlungen eines Themas »Variationen«. Das, was sich große Komponisten nur für das eine oder andere ihrer vielen Werke vornehmen, wird bei manchen Philosophen zu einem einzigen Grundthema, dessen Erörterung sie in all ihren Werken lediglich variieren. Bei Kant findet das Gegenteil statt. Er behandelt so gut wie alle philosophisch erheblichen Themen. Sein Denken hat einen wahrhaft enzyklopädischen Charakter: Kant ist ein philosophisches Universalgenie. Aus diesem Grund kann dieser Essay zwar auf ziemlich viele Themenfelder eingehen, kommt ab er nicht umhin, da und dort eine Auswahl zu treffen.
Eines ist dabei wichtig: zu zeigen, wie provokativ noch für heute, zugleich wie radikal die Fragen sind, die Kant aufwirft, und wie ebenfalls für heute provokativ und radikal viele seiner Antworten sind. Kant ist nicht etwa nur dort aktuell, wo der heutige Zeitgeist mit ihm übereinstimmt, vielmehr vor allem dort, wo er für aktuelle Themen etliche unserem Zeitgeist widersprechende Fragen und ebenso widersprechende Antworten entwickelt. Nicht zuletzt ist Kant dort aktuell, wo sein Denken hinsichtlich vergessener oder verdrängter Themen eine zu erneuernde Aktualität empfiehlt. Insgesamt erweist sich Kant mindestens so häufig als sperriger wie als bequemer Zeitgenosse.
In einer Vorlesung über Negative Dialektik hat Adorno vor sechs Jahrzehnten in allem Ernst gefragt, ob Philosophie, die ihren Namen verdient, noch möglich ist. In diesem Essay schlage ich vor, es mit Kant zu versuchen. »Natürlich« muss man ihn weder nachmachen noch jeden seiner Gedanken für unkorrigierbar richtig halten. Auch muss man ihn nicht als Zelebrität feiern, der man nur mit Bewunderung entgegentreten darf. Vielmehr empfiehlt sich, mit Kants Begriff der Aufklärung den Mut aufzubringen, selber zu denken.
Dafür lässt sich freilich dieses schwerlich leugnen: Selbst für das Interesse am eigenen Denken kann man von einem Kant-Studium nie genug bekommen. In diesem Sinn darf man einen Songtitel der Rolling Stone abwandeln und erklären: »You K’ant get no satisfaction«. Weil von Kant immer wieder neu zu lernen ist, darf man ebenso, jetzt frei nach Hölderlin, sagen: »Kant musst Du studieren, und wenn Du nicht mehr Geld hättest, um eine Lampe und Öl zu kaufen, und nicht mehr Zeit als von Mitternacht bis zum Hahnenschrei«. Geht man dabei gründlich vor, so entdeckt man Kant als philosophischen Zeitgenossen: bis heute haben seine Theorieprojekte und deren Begriffe und Argumente weder ihre Überzeugungskraft noch ihr Provokationspotential verloren.
Tübingen/München, im Frühling 2023, ein Jahr vor dem Kant-Jubiläum Otfried Höffe
Kants Schriften werden nach der Akademieausgabe mit deren Bandzahl (in römischen Ziffern) und der Seitenzahl (in arabischen Ziffern) zitiert, die Kritik der reinen Vernunft nach deren überarbeiteter zweiter Auflage. Nähere Angaben finden sich am Ende dieses Buches im Abschnitt Literatur.
DIE PERSON ALS VORBILD
Bei manchen Philosophen bildet der Lebenslauf einen wesentlichen Teil ihres Werkes, bei anderen zählt allein das Werk selbst. Kant entzieht sich dieser Alternative. Für sein Denken sind zwar die Schriften am weitaus wichtigsten, für sein Werk spielt aber die soziale Herkunft des Philosophen ebenfalls eine Rolle. Wer sich näher mit seiner Persönlichkeit befasst, lernt nämlich das Gegenteil dessen kennen, was viele erwarten. Dass Kant in einer Provinzstadt lebte, dort eine eintönige Existenz führte und seinem Charakter nach ein pedantischer Misanthrop war, ist eine böswillige Legende.
1.Aufstieg aus einfachen Verhältnissen
Viele Geistesgrößen – Schriftsteller, Musiker und Wissenschaftler – stammen aus der gebildeten Mittelschicht, in Deutschland dabei auffallend viele aus evangelischen Pfarrhäusern. Kant hingegen wächst nicht in Bildungskreisen auf. Er wird vielmehr in die kinderreiche Familie eines Handwerkermeisters geboren, hier als viertes von neun Kindern, von denen allerdings vier schon in jungen Jahren sterben.
Die Familie war nicht reich, aber anfangs, bevor es mit dem Handwerksbereich des Vaters Johann Georg Kant (1683–1746), dem Sattleroder Riemerhandwerk, generell bergab ging, auch nicht arm. Zudem besaß der Vater als Mitglied einer Zunft, der damals alle Handwerker angehörten, und mit ihm die Familie eine beachtliche gesellschaftliche Stellung. Als Sohn eines Handwerksmeisters war Kant selber von Geburt an ein Zunftmitglied.
Wichtiger dürfte etwas anderes gewesen sein: In dem (kleinen) Handwerksbetrieb, in dem Kant aufwächst, und über Spielkameraden seiner Kindheit, namentlich Kinder aus Handwerkerkreisen, lernt er eine heute vielen Bildungsschichten recht fremde Welt kennen. Kants später außergewöhnlich weite Welterfahrung, auch die in seinen Pädagogik-Vorlesungen betonte Aufgabe, Kinder sollten für ihren Lebensunterhalt selber aufzukommen lernen, nehmen ohne Frage hier ihren Anfang.
Ebenfalls dürfte hier der Grundstein für Kants späteres Interesse gelegt worden sein, zu Personen außerhalb der Universitätswelt Kontakt zu suchen. Beispielsweise pflegte Kant Beziehungen zu britischen Kaufleuten, die im Seehafen seiner Heimatstadt Königsberg ihre »Kolonialwaren« im buchstäblichen Sinn, nämlich aus den Kolonien stammenden Waren wie Gewürze und Wein, gegen das Getreide und Vieh russischer Kaufleute eintauschten. Mit zwei der britischen Kaufleute, Joseph Green und Robert Motherby, schließt unser Philosoph sogar eine enge Freundschaft.
Kant, am 22. April 1724 geboren, wird nach dem »Tagesheiligen« Emmanuel (»Gott ist mit uns«) genannt und getauft. Da er »Immanuel« für die genauere Übersetzung des hebräischen Originals hält, nimmt er als junger Erwachsener, ab dem Jahr 1746, diesen Namen an. Auf seinen Namen stolz, zog Kant aus ihm die Zuversicht eines zwar nicht wahrhaft religiösen Gottvertrauens, aber dessen säkularer Variante: die lebenslange Zuversicht eines gefestigten Welt- und Selbstvertrauens.
Grundlegender für Kants letztlich optimistische Lebenseinstellung und positive Welteinstellung dürften jedoch die Geborgenheit und Liebe gewesen sein, die er in seinem behüteten Zuhause erfuhr. Die Mutter Anna Regina, geborene Reuter, Tochter ebenfalls eines Handwerksmeisters, schätzt er wegen ihres natürlichen Verstandes und einer echten Religiosität hoch. Sie stirbt freilich schon früh, als Immanuel Kant erst 13 Jahre alt ist.
In der Familie herrscht eine vom Pietismus geprägte Lebenshaltung. Deren Vorrang des Moralischen vor dogmatischen Fragen sowie eine unerschütterliche Gemütsruhe, die an das stoische Ideal des Weisen erinnert, dürfte dem Heranwachsenden willkommen gewesen sein. Vermutlich gehört sie zum Hintergrund eines der Leitmotive Kants: dass es selbst in der Philosophie, trotz ihrer begrifflichen und argumentativen Aufgaben und einer gewissen Gelehrsamkeit, letztlich auf die Moral ankommt – und in dieser Hinsicht alle Menschen gleich sind.
Wahrscheinlich werden in der Familie kaum mehr als die Bibel und einige religiöse Erbauungsschriften gelesen. Ohnehin dürften für Kants frühkindliche Entwicklung etliche bildungsexterne Faktoren wichtiger sein als die Bildung im engeren Verständnis: Bedeutsam sind Anregungen aus dem väterlichen Betrieb und aus der von Handwerkern und deren Angestellten geprägten Nachbarschaft. Bald kommen Erfahrungen hinzu, die er in der größeren Umgebung macht. Kants Heimatort ist nämlich kein Dorf, auch kein verschlafenes Landstädtchen, keine provinzielle Kleinstadt. Es ist vielmehr die wirtschaftlich und kulturell blühende, nach Berichten dieser Zeit architektonisch schöne Hauptstadt von Ostpreußen, die wegen ihrer vielen Brücken auch das »Venedig des Nordens« genannt wird.
Mit mehr als 50 000 Einwohnern immerhin etwa ein Drittel so groß wie Berlin, dank seiner Kontakte zum Baltikum und nach Russland international vernetzt und als Hafen- und Handelsstadt ähnlich bedeutend wie Hamburg, besaß Königsberg vor allem dank der Kaufleute aus Polen und Litauen, aus Dänemark, Großbritannien und Schweden sowie Russland auch atmosphärisch ein deutlich internationales Flair. Auf seinem Schulweg bleiben dem seit seiner Kindheit und Jugend höchst wissbegierigen Kant weder die verschiedenen Geschäftigkeiten seiner Heimatstadt noch deren wirtschaftliche und geistige Offenheit fremd.
Im Jahr 1730 tritt Kant in die Volksschule seines Stadtviertels, in die Vorstädter Hospitalschule ein. Schon im Alter von acht Jahren, im Herbst 1732, wechselt er ins Gymnasium, in das Collegium Fridericianum, das wegen seiner religiösen Strenge als »Pietisten-Herberge« gescholten wird. An die »Jugendsklaverei«, die Kant dort erlebt, denkt er sein Leben lang mit »Schrecken und Bangigkeit« zurück. In fachlicher Hinsicht ist das Collegium aber gut, es gilt sogar als eine der besten höheren Schulen Preußens.
Kant lernt hier unter anderem Theologie, Griechisch, Hebräisch und so weit Französisch, dass er zahlreiche Passagen des von ihm hochgeschätzten französischen Philosophen Montaigne aus dem Kopf wiedergeben kann. Besonders gründlich ist der Lateinunterricht. Seit dieser Zeit sind die römischen Philosophen und Dichter Seneca und Lukrez sowie der Dichter Horaz Kants Lieblingsschriftsteller. Dank seines herausragenden Gedächtnisses wird er bis ins hohe Alter längere Textstücke auswendig zitieren.
Um das Gymnasium besuchen zu können, ist Kant auf die finanzielle, auch ideelle Unterstützung von Freunden der Familie angewiesen. Große Hilfe erfährt er vom »Gewissensrat der Eltern«, dem evangelischen Theologieprofessor Franz Albert Schultz (1692–1763). Heutige Lehrer und Hochschullehrer könnten sich einen derartigen Förderer junger Hochbegabter zum Vorbild nehmen. Nicht zuletzt könnte man aus Kants Biographie auch dieses lernen: Wahrhaft hochbegabte Schüler sollte man früh zum Gymnasium und ebenso bald zum Universitätsstudium zulassen.
Kant, in den meisten Jahren Klassenbester, verlässt als 16-Jähriger das Gymnasium. Durch den Schulunterricht ist er hinreichend vorbereitet, um Theologie, Jurisprudenz, klassische Philologie oder Philosophie zu studieren. Kant geht an die heimatliche Universität, an die im Jahr 1544 als eine der ersten evangelischen Universitäten Europas gegründete Albertina. Von den sechs Jahren, die er dort verbringt, kann man die erste Zeit dem zuordnen, was heutzutage in der Oberstufe des Gymnasiums gelernt und in den USA in den beiden ersten Collegejahren angeboten wird.
Der wichtigste akademische Lehrer für Kants frühe philosophische Entwicklung ist der sehr junge, bloß zehn Jahre ältere Martin Knutzen. Von ihm wird er in die höhere Mathematik, namentlich die Infinitesimalrechnung, und in die damals modernste, nämlich die Newton’sche Physik eingeführt.
Obwohl Kant höchst sparsam lebt, braucht er in diesen Jahren erneut finanzielle Hilfe, die er von Verwandten erhält. Er gibt aber auch Privatstunden, manche freilich kostenlos. Und einiges an Geld verdient er, was man beim einem künftigen Philosophen kaum erwartet, beim Billardspiel.
Auch in den nächsten Jahren bleiben Kants materielle Verhältnisse bescheiden. Zunächst, in den Jahren 1747–1754, verdient er sich den Lebensunterhalt als Hauslehrer bei Familien in der näheren Umgebung. Später, nach seiner Habilitation zum magister legens, nach heutigem Verständnis zum Privatdozenten, lebt er, ohne ein staatliches Gehalt, allein von den Vorlesungsgebühren und der persönlichen Betreuung von Studenten. Heutigen Klagen über hohe Lehrbelastungen an deutschen Universitäten, insbesondere im Verhältnis zu den Spitzenhochschulen der Welt, könnte man Kants hohe Lehrbelastungen entgegenhalten: häufig mehr als 20, selbst im Durchschnitt 16 Wochenstunden. Allerdings fehlten die heute zahllosen und endlosen Kommissionssitzungen. Zudem darf man nicht übersehen, dass ein so fleißiger und so auffassungsrascher Dozent, wie es Kant ist, ein halbes Jahrzehnt lang, in den Jahren 1757–1761, keine einzige Schrift von Bedeutung veröffentlicht.
2.Enzyklopädische Wissbegier
Die meisten großen Philosophen der Neuzeit absolvieren zwar ein Universitätsstudium; insbesondere die Wortführer der europäischen Aufklärung leben und wirken jedoch außerhalb der Hochschulen. Kant ist nach dem deutschen Aufklärungsphilosophen Christian Wolff der erste Philosoph, dessen Arbeitsfeld und Wirkungskreis die Universität ausmacht. Mit ihm, später mit Fichte und Hegel, zeigt vor allem die deutsche Philosophie, was sich andernorts erst im 20. Jahrhundert mehr und mehr durchsetzt: dass die als Einheit von Lehre und Forschung gepflegte akademische Philosophie zu bahnbrechender Originalität fähig ist.
Der Preis, der dafür häufig gezahlt wird, liegt auf der Hand: Beruflich führt man zwar ein arbeitsreiches, ein – von etwaigen akademischen Querelen abgesehen – jedoch ereignisarmes Leben. Infolgedessen bleibt der Erfahrungshorizont in der Regel eng. Wie schon angedeutet, trifft dies für Kant nur zum Teil zu: Der Philosoph hat zwar eine große Lehrbelastung zu bewältigen; mangels einer eigenen Familie, könnte man meinen, spielten außerakademische Ereignisse und Erfahrungen aber eine im Vergleich zu heute noch geringere Rolle. In Wahrheit übersteigt Kants Erfahrungshorizont den vieler Hochschullehrer bei weitem. Er beginnt, wie gesagt, außerhalb der gebildeten Mittelschicht, in Handwerkerkreisen, und erweitert sich durch die vermutlich einzige Gier, die kein Laster ist: durch eine unbändige Neugier und Wissbegier. Diese tritt in dem schon erwähnten Interesse an Gesprächen mit ausländischen Kaufleuten zutage. Hinzu kommt die ausgedehnte Lektüre von Reiseberichten. Im Entwurf eines Colegii der physischen Geographie erklärt er, nichts weniger als »die gründlichsten Beschreibungen besonderer Länder von geschickten Reisenden, die allgemeine Historie aller Reisen, die Göttingische Sammlung neuer Reisen, das Hamburgische und Leipziger Magazin, die Schriften der Akademie der Wissenschaften zu Paris und Stockholm u. a. m. durchgegangen« zu haben. (II 4). Die genannte Vorlesung behandelt aber nur einen sehr kleinen Teil von Kants Forschungsinteresse, das sich als Ganzes durch einen außergewöhnlich weiten wissenschaftlichen und philosophischen Horizont auszeichnet.
Im Laufe der Zeit pflegen die Wissenschaften mitsamt der Philosophie sich in immer mehr Teilgebiete aufzuspalten. Man sagt: Sie differenzieren sich. Auch wenn diese Entwicklung kaum vermeidbar ist, beinahe in der Natur der Sache, der Wissenschaft, liegt, bietet Kant gegen die zunehmend eingeschränkte Kompetenz, gegen die Zuständigkeit für immer kleinere Arbeitsgebiete und Methoden, ein zumindest in Grenzen nachahmenswertes Gegenbild. Der Umstand, dass er vor vielen Generationen, mithin vor einem Großteil der heutigen Spezialisierung lehrte und forschte, ist nicht unerheblich, aber kein voll durchschlagendes Gegenargument.
Seit einiger Zeit liebt man es, zwei angeblich einander entgegengesetzte Wissenschaftsbereiche, die Natur- und die Geisteswissenschaften, zu unterscheiden. Kant hingegen bewegt sich in beiden akademischen Welten. Zum einen studiert er zwei der heute sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik), nämlich Mathematik und Naturwissenschaften, hier Theoretische Physik und Experimentalphysik. Denn ein eigenes Fach Informatik gab es damals noch nicht, und die Technik war kein Universitätsfach. Zum anderen befasst er sich intensiv mit Geisteswissenschaften, hier nicht weniger als mit Theologie, Philosophie (dabei Logik, Metaphysik, Ethik, Rechts- und Staatsphilosophie) und klassischer lateinischer Literatur, vermutlich auch mit Dichtkunst und Rhetorik.
Der zugrundeliegenden Einstellung bleibt unser Philosoph sein Leben lang treu: einen möglichst weiten geistigen Horizont zu durchschreiten, auch wenn dieser im Laufe der Jahre unterschiedliche Schwerpunkte erhalten und manche Horizontverschiebung erfahren wird.
Für Kant, den Wissenschaftler, versteht es sich, dass er sich dabei nicht von den Ansprüchen kreativer Wissenschaftlichkeit dispensiert. Kant verfasst zwar keine thematisch weitgespannten Lehrbücher oder Kompendien, die den bisherigen Wissensstand nur zusammenfassen, ohne ihn jedoch um neue Erkenntnisse zu bereichern. Im Gegenteil entwickelt unser Philosoph in jeder seiner Veröffentlichungen neue Einsichten. Die Themen ändern sich jedoch. Kant behandelt kaum einmal ein und denselben Gegenstand unter einem nur wenig abgewandelten Gesichtspunkt. Er nimmt sich immer wieder neue Fragen und Aufgaben vor, sodass auf ihn die verbreitete, aber häufig zu Unrecht angewandte Redensart passt: Der Philosoph ist ständig zu neuen Ufern unterwegs.
Kant beginnt, erst 23-jährig, seine Autorentätigkeit mit einer umfangreichen Abhandlung (256 Seiten im Erstdruck), die den barocken Titel trägt: Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurteilung der Beweise derer sich Herr von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedienet haben, nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen, welche die Kraft der Körper überhaupt betreffen (1747 beendet, 1749 veröffentlicht). Hier befasst sich Kant mit dem, was man heute »kinetische Energie«, damals »lebendige Kräfte« nennt. Es geht nämlich um die Frage, wie man die Kraft (K) aus Masse (m) und Geschwindigkeit (v) zu berechnen hat.
Knapp ein Jahrzehnt später veröffentlicht er als zweites Buch ein für die damalige Zeit geradezu revolutionär kühnes Werk: die Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755). Diese noch aus heutiger Sicht höchst moderne Evolutionstheorie des Universums schiebt alle theologischen Argumente beiseite. Da deshalb »von Seiten der Religion« Schwierigkeiten zu befürchten sind, lässt Kant die Schrift auf eine in der europäischen Aufklärungsepoche weit verbreiteten Weise, nämlich ohne seinen Autorennamen veröffentlichen. Nachdem jedoch die Anonymität gelüftet worden ist, sind die für etliche Theologen anstößigen Gedanken wohl ein Grund, dass Kant auf die frei gewordene Professur für Logik und Metaphysik, obwohl er für sie bestens geeignet war, 1756 nicht berufen wird. Die Stelle, die er, peinlicherweise, erst ein Jahrzehnt später erhält, ist, zweite Peinlichkeit, eine Professur der Dichtkunst.
Schon in der Vorrede der genannten Naturgeschichte stellt Kant seinen evolutionstheoretischen Grundgedanken vor: »dass Gott in die Kräfte der Natur eine geheime Kunst gelegt hat, aus dem Chaos von selber zu einer vollkommenen Verfassung auszubilden«. Daran schließt er die von hohem Selbstbewusstsein zeugende Behauptung an: »Gebt mir nur Materie, ich will euch eine Welt daraus bauen« (I 229).
Anders als der von ihm ansonsten bewunderte Newton beruft sich Kant nicht zusätzlich auf die Hand Gottes, sondern lediglich auf die »Hand der Natur« (I 337), nämlich auf ihr »eingepflanzte Kräfte und Gesetze« (I 334). Die aus rein natürlichen Ursachen folgende, ausschließlich mechanische Erklärung der Entstehung des Kosmos, die Kosmogonie, bleibt in der wissenschaftlichen Welt zunächst unbeachtet.
Zu den Gründen gehört, dass der Verleger noch im selben Jahr seinen Bankrott erklärt, weshalb die Schrift nur in wenigen Exemplaren ausgeliefert wird. Kant fasst zwar seine Grundgedanken im nächsten Buch zusammen: Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes. Weil aber das Titelthema der Schrift, ein Gottesbeweis, kaum an eine Evolutionstheorie des Universums denken lässt, bleibt Kants Theorie immer noch unbeachtet. Erst später wird sie zusammen mit der unabhängig entwickelten Theorie des französischen Mathematikers und Physikers Pierre-Simon Laplace (1749–1827) als Kant-Laplace’sche Theorie anerkannt und hat im Wesentlichen bis heute Bestand: In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wird niemand geringerer als der Physiknobelpreisträger Max Born die Bedeutung von Kants Schrift für die moderne Physik betonen. Noch in unserer Zeit würdigt der Theoretische Physiker und Astrophysiker Stephen Hawking Kants Theorie des Himmels als einen Höhepunkt der Ideengeschichte der Naturphilosophie. In der Tat ist der Kern der Theorie, insbesondere ihr Verzicht auf die Annahme eines Schöpfergottes, ein wichtiger Vorläufer moderner Kosmogonien.
Als kaum minder bedeutsam erweist sich ein Teil von Kants Schrift, ihre Theorie der Saturnringe und der Nebelsterne (Milchstraßen/ Galaxien). Und mit einer weiteren Veröffentlichung, den Neuen Anmerkungen zur Erläuterung der Theorie der Winde (1756), leistet Kant einen beachtlichen Beitrag zu den Gesetzmäßigkeiten für die Entstehung der Land- und der Seewinde, unter anderem der Passat- und der Monsunwinde.
Weitere Beiträge zur Naturforschung enthalten drei kurze Schriften aus dem Jahr 1756. Kant befasst sich hier mit einem damals die europäische Öffentlichkeit verstörenden Ereignis. Es ist das Erdbeben von Lissabon, das im Jahr 1755 die Stadt zu zwei Dritteln zerstörte und mit dem Tod zahlloser Unschuldiger den Gedanken der Theodizee, der Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel der Welt, infrage stellte. Kant hingegen schiebt jede theologische oder moralische Betrachtung beiseite. In aller Nüchternheit untersucht er das Erdbeben als reines Naturphänomen und schreibt die für Lissabon verheerenden Folgen nicht einem Strafgericht Gottes, sondern der Bebauungsart der Stadt zu.
Dass sich Kant überhaupt mit dem »welterschütternden Ereignis« befasst, zeigt ihn beispielhaft als einen Philosophen, der sich nicht in den sprichwörtlichen Elfenbeinturm zurückzieht. Im Gegenteil setzt er sich mit »großen Ereignissen, die das Schicksal aller Menschen betreffen« (I 419), den wichtigsten gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Geschehnissen der Zeit auseinander. Im Fortgang seines Lebensweges werden es etwa die europäische Bewegung der Aufklärung, später die Französische Revolution, weiterhin die endlosen Kriege unter den Völkern und der als Skandal eingeschätzte Kolonialismus sein.
Bald nach der Veröffentlichung der naturwissenschaftlichen Schriften treten deren Interessen in den Hintergrund. Denn für Kant werden Fragen jener Fundamentalphilosophie wichtiger, die traditionell Metaphysik heißt. In diesem Themenwechsel tritt erneut die für unseren Philosophen charakteristische, nämlich mit seinem jeweils bisherigen Denken selten zufriedene Wissbegier zutage. Trotzdem hält er noch 15 Jahre lang, von Beginn seiner Lehrtätigkeit im Jahr 1755 bis zur Übernahme eines Lehrstuhls für Philosophie im Jahr 1770, eine Vorlesung über Physik. Später liest er über Physische Geographie, ab dem Jahr 1772 zusätzlich und im Wechsel von Sommer- und Wintersemester über Anthropologie in pragmatischer Hinsicht.
Beide Themen zusammen bilden, was Kant die »Weltkenntnis« nennt. In der Physischen Geographie behandelt er unter anderem die Klimakunde und eine Entwicklungsgeschichte der Erde, danach die weite Tierwelt, beginnend mit dem Menschen, der trotz seiner herausgehobenen Stellung dem Tierreich angehöre, ferner die Pflanzenwelt und das Mineralreich, schließlich die vier damals bekannten Kontinente Asien, Afrika, Europa und Amerika. Die Anthropologie hingegen behandelt das am Menschen, »was er als frei handelndes Wesen aus sich selber macht, oder machen kann und soll« (VII 119).
In der Fundamentalphilosophie jedoch, die seitdem im Vordergrund von Kants Forschungsinteresse steht, stellt sich der Philosoph den in meinem Vorwort benannten berühmten Fragen: »1. Was kann ich wissen. – 2. Was soll ich tun? – 3. Was darf ich hoffen?« Zusammen mit der ihnen gemeinsamen, aber auch neue Themen ansprechenden vierten Frage: »Was ist der Mensch?« belaufen sich Kants Überlegungen auf eine wahre Enzyklopädie der Wissenschaften. Am Ende, darf man sagen, gibt es zusätzlich zu den weiten Themenfeldern der beiden genannten Vorlesungen so gut wie keinen philosophischen Gegenstandsbereich, mit dem sich Kant, dabei ohne Frage höchst gründlich, kreativ und originell, nicht befasst hat.
3.Bürgerliche Tugenden – mit Geselligkeit
3.1Sekundärtugenden
Kant war klein, seit der Geburt von schwacher Gesundheit, zudem etwas verwachsen. Abgesehen von einer herausragenden Begabung und einem nicht minder exzellenten Gedächtnis konnte er sein enormes Lehrdeputat und sein gewaltiges Forschungswerk nur durch ein hohes Maß jener sogenannten bürgerlichen oder sekundären Tugenden zustande bringen, die er schon zu Hause, bei der Arbeit seines Vaters, hatte lernen können. Es sind Tugenden, auf die man gelegentlich, dann zu Unrecht spöttisch herabsieht: Fleiß und Disziplin. Ihretwegen, und nicht etwa dank medizinischer Kunst, bleibt Kant bis ins hohe Alter körperlich und geistig frisch. Erst in seinem letzten Lebensjahr, in dem für damals weit überdurchschnittlichen Alter von 79 Jahren, stellt er erschreckend fest, dass seine körperlichen und geistigen Kräfte schnell verfallen. Anfang Oktober 1803 erkrankt er schwer, übrigens zum ersten Mal. Vier Monate später, am 12. Februar 1804, stirbt er.
Obwohl er in seinen letzten Jahren sehr zurückgezogen, beinahe menschenscheu gelebt hatte, blieb er wie zuvor als Person, als »Mensch in seiner Menschlichkeit«, sehr beliebt und als Universitätslehrer hochgeachtet. Ein kleiner Beleg: Nach seinem Tod wird der Trauerzug zu seinem Grab »von Tausenden begleitet« (Wasianski, in Groß 1968, S. 306).
ExkursSparsam, klug und großzügig: Vererben wie Kant
Wie sein Erbe und Testament zeigen, pflegt Kant eine weitere bürgerliche Tugend, nämlich die Sparsamkeit, die er um Großzügigkeit und Klugheit noch ergänzt (zu Kants Nachlass kenntnisreich: Ostertum 2022). Selber unverheiratet und kinderlos, hinterlässt Kant ein schuldenfreies Haus, dessen Wert auf 5000 Gulden geschätzt wird, und Wertpapiere von fünffachem Wert. Das Erbe geht überwiegend an Kants Geschwister, beziehungsweise deren Kinder, insgesamt wohl acht Neffen und Nichten, die nach anderen Berechnungen 21 352 Taler erben, was mehr als 25 Jahresgehältern einer damaligen Professur entspricht.
Bedacht werden aber auch, zudem sehr großzügig, die Hausangestellten: die Köchin Luise Nietschin, der geradezu legendäre, mehr als 40 Jahre beschäftigte Diener Martin Lampe und der letzte Diener Johann Kaufmann. Der Wert der ihnen zugesprochenen Vermächtnisse wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Generös bedacht wird auch der Testamentsvollstrecker und zeitweilige Privatsekretär, der Theologe Wasianski.
Heutige Professorengehälter hängen vor allem von Berufungen an auswärtige Universitäten, auch von akademischen Ehren wie der Aufnahme in wissenschaftliche Akademien und von Forschungsleistungen ab. Da Kant Berufungen an die Universitäten von Erlangen und von Jena ablehnte, allerdings Mitglied der Berliner, der St. Petersburger und der Sieneser Akademie der Wissenschaften war und mit der Kritik der reinen Vernunft ein fraglos schon damals europaweit berühmtes Werk verfasste, sollte er nach heutigen Maßstäben ein recht hohes Gehalt verdient haben. Danach könnten sich die mehr als 25 Jahresgehälter auf zwei bis drei Millionen Euro belaufen. Allerdings wurden Professoren damals so schlecht bezahlt, dass sie häufig einen Nebenverdienst benötigten. Und so betrug die Summe, die Kant vererbte, vermutlich nur die Hälfte des hier geschätzten Betrages. Auch dann fällt sie jedoch ziemlich hoch aus, wodurch sich deutlich genug die Sparsamkeit als ein Grundzug von Kants Persönlichkeit erweist.
Zurück zu den von Kant im persönlichen Leben gepflegten Tugenden. Die Haltung, sich der »Mittel zum Lebensgenuss« zu berauben, der Geiz, ist unserem Philosophen zutiefst fremd. In der Tugendlehre, § 10, verurteilt er als Laster sowohl den »kargen Geiz« gegen sich selbst, als auch den »habsüchtigen Geiz« gegen andere. Dem entspricht Kants Lebensweise; beispielsweise pflegte er zum Mittagstisch großzügig Freunde und Bekannte zu bewirten. Und armen Verwandten ließ er regelmäßige Zahlungen zukommen.
Eine weitere, freilich seltener geübte Sekundärtugend kommt bei Kant hinzu. Mit ihr praktiziert der Philosoph erneut ein attraktives Gegenbild zu unserer Gegenwart, zu einer Zeit nämlich, die nicht bloß in den Medien von Hektik bedroht ist. Selbst in den Wissenschaften hat sie sowohl mit dem Damoklesschwert »publish or perish« (»publiziere oder gehe zugrunde«), als auch mit dem Zwang, Drittmittel einzuwerben, Einzug gehalten.
Kant hingegen arbeitet sein Lebenswerk mit einem aus heutiger Sicht außergewöhnlich langen Atem aus. Im Alter von Mitte dreißig bis Mitte vierzig verfasst er zusätzlich zu den schon genannten, vorher veröffentlichten Abhandlungen eine Reihe weiterer bedeutsamer Schriften. Danach jedoch gerät seine wissenschaftliche Produktion ins Stocken. Denn bei seinem Versuch, die erwähnten, für ihn neuen fundamentalphilosophischen Fragen gründlich zu beantworten, stößt er auf Schwierigkeiten, die seines Erachtens mit den überlieferten Denkmitteln nicht zu überwinden sind. Um sie trotzdem zu lösen, unterwirft er sich einer langen, für ihn durchaus mühevollen Überlegungsphase.
In deren Verlauf mutet er der Fundamentalphilosophie eine radikal neue Aufgabe zu. Sie soll nicht mehr, mindestens zunächst nicht, die bisher üblichen Fragen beantworten, nämlich die nach Gott, Freiheit und einer eventuell unsterblichen Seele. Vielmehr hat sie die ihnen sachlich vorausgehende Frage zu klären, welche Erkenntnismöglichkeiten der menschlichen Vernunft überhaupt offenstehen und wo man auf nicht bloß vorläufig, sondern auf grundsätzlich nicht überwindbare Grenzen stößt.
Kant widmet sich dieser Aufgabe, seiner ersten Frage »Was kann ich wissen?«, mehr als zehn Jahre lang. In dieser Zeit, dem sogenannten »stillen Jahrzehnt«, entwirft er zahlreiche Antwortversuche, verwirft sie aber immer wieder. In dieser langen Zeit des Nachdenkens veröffentlicht er, der zuvor so hochproduktiv war, nichts. Dann endlich verfasst er, wie er in einem Brief schreibt, »innerhalb von 4 bis 5 Monaten gleichsam im Fluge« (Briefe, 206/115) die Schrift, die ihn bald weltberühmt macht. Sie ist schon dem Umfang nach ein wahres Opus magnum, ein Großes Werk. Unendlich wichtiger ist freilich der revolutionär neue Gehalt: Die Kritik der reinen Vernunft, darf man ohne zu übertreiben sagen, stellt alle anderen Neubegründungen der Philosophie in den Schatten und darf seitdem, seit dem Jahr 1781, und bis heute als die Gründungsschrift der modernen Philosophie gelten.
In einer weiteren Hinsicht zeigt Kant die seltene Sekundärtugend eines langen Atems: Schon während seines Studiums hört er Vorlesungen zum Naturrecht, was eine Rechts- und Staatsphilosophie meint. Später, ab dem Alter von 38 Jahren, studiert er sowohl rechtswissenschaftliche als auch rechtsphilosophische Werke und hält wenige Jahre danach regelmäßig Vorlesungen über Naturrecht. Trotzdem erscheint seine erste einschlägige Hauptschrift erst drei Jahrzehnte später.
Der Grund liegt in Kants auf viele Jahre hin angelegtem philosophischen Lebensplan. Als erstes will er für die Philosophie eine neue Grundlage erarbeiten. Das erfolgt in der genannten Kritik der reinen Vernunft. Schon in dieser Schrift, danach in weiteren Texten sucht er das auch für eine Rechts- und Staatsphilosophie einschlägige Fundament der Moral. Dabei geht es vor allem um das Prinzip der Freiheit. Dies geschieht in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (= GMS, 1785) und in der Kritik der praktischen Vernunft (= KpV, 1788).
Erst in einem dritten Arbeits- und Publikationsschritt trägt Kant seine rechts- und staatsphilosophischen Gedanken selber vor, zunächst in der Abhandlung Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793). Von ihr sind zwei der drei Teile thematisch einschlägig: II. Staatsrecht, III. Völkerrecht. Danach folgt die bis heute wichtigste Philosophie eines weltweiten Friedens: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf (1795), schließlich Kants System der Rechts- und Staatsphilosophie: Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre (1787).
3.2Der »elegante Magister«
Von einem so arbeitsamen und disziplinierten Wissenschaftler wie Kant erwartet man die Lebensweise eines gelehrten Einsiedlers, der seine Zeit nur im Hörsaal, in der Universitätsbibliothek und zwischen den eigenen Bücherwänden verbringt. Tatsächlich ist Kant im Gegensatz zu einem verbreiteten Gerücht alles andere als ein vertrockneter Pedant und verschrobener Stubengelehrter.
Der Lehre und Forschung widmet er nur die erste Hälfte seines Tageslaufs, in der man, wie er lebenserfahren klug seinem Schüler Marcus Herz schreibt, »nach einer ruhigen Nacht des Morgens selbst bis zur Ermüdung mit Nachdenken und Schreiben beschäftigt sein kann« (11. Mai 1781). In der anderen Hälfte erweist er sich als »Bürger von Welt«: Wie ein Gemälde zeigt, genießt er, dem jede asketische Lebensart zuwider war, im Kreis von Freunden und Bekannten ein ausgedehntes Mittagsmahl. Denn allein zu essen sei für einen philosophierenden Gelehrten im Unterschied zu anderen Gelehrten ungesund (VI 280). Noch in der Altersschrift Der Streit der Fakultäten (1798) erklärt er unter dem Titel Von dem krankhaften Gefühl aus der Unzeit beim Denken: bei dem, der »in einer Mahlzeit ohne Gesellschaft sich zugleich mit Büchereien oder Nachdenken beschäftigt«, »finden sich krankhafte Gefühle ein« (VII 109). Als Tischgenossen bevorzugt Kant nicht etwa Fachkollegen, sondern Kaufleute und andere Nichtphilosophen, denn sie konnten ihm »neuen Stoff zur Belebung« bieten. Obwohl er bei einem »Gelehrten« das Denken für »ein Nahrungsmittel« hält, ist ihm beim Essen, was wir »Fachsimpelei« nennen, zuwider.
Auch in anderer Hinsicht war der Philosoph gesellig. Er liebt das Kartenspiel und das Billardspiel, das er sogar so gut beherrscht, dass er dabei, wie bereits erwähnt, einiges an Geld verdient. Außerdem geht er ins Theater und besucht die angesehenen Salons von Königsberg, wo man ihn, einen charmanten und geistreichen Unterhalter, stets willkommen heißt. Die um 20 Jahre jüngere Frau eines befreundeten Bankiers, die »Prinzessin« genannte Maria Charlotta Jacobi, schickt dem »großen Philosophen« ein Degenband und »einen Kuss per Sympathie« (Briefe, 24/14). Und die Gräfin Caroline Charlotte Amalie Keyserlingk, für Kant das »Idealbild« einer Frau, hält in ihrem Salon für Kant einen ständigen Ehrenplatz bereit.
Der Philosoph war auch nicht, wie gelegentlich behauptet, gegen eine Heirat abgeneigt. Wie sein Jugendfreund Christoph Friedrich Heilsberg (1726–1806) berichtet, »verriet er zweimal in seinem Leben eine ernsthafte Absicht zum Heiraten«. In beiden Fällen zögerte er aber zu lange, sodass die eine Frau, »eine gut gezogene, sanfte und schöne Witwe«, mittlerweile den Antrag eines anderen Mannes angenommen hatte, und die andere, »ein hübsches westfälisches Mädchen«, inzwischen in ihre Heimat zurückgekehrt war (nach Vorländer, I 192 f.). Ein Frauenfeind war der Philosoph jedenfalls nicht.
Kant legte auch, was man von einem Philosophen kaum vermutet, auf sein Äußeres wert. Soweit seine finanziellen Möglichkeiten es erlaubten, kleidete er sich, was er für »eine Sache des Geschmacks hielt« (VII 245), nach der Mode.
In den von Karl Wilhelm Böttiger herausgegebenen zwei Bänden Literarische Zustände und Zeitgenossen heißt es zusammenfassend: »wirklich war damals Herr Magister Kant der galanteste Mann von der Welt, trug bordierte [fein eingefasste, O. H.] Kleider, einen postillon d’amour und besuchte alle Coterien« (I 133). Wegen dieser lebensfroh leichten Lebensart fürchtete man schon, Kant würde, salopp gesprochen, zum »Salonlöwen«, der seine philosophischen Pläne den gesellschaftlichen Zerstreuungen opfert. Jedenfalls zieht sich Kant erst in späteren Jahren mehr und mehr aus dem gesellschaftlichen Leben zurück.
4.Der Philosophielehrer
In einem kurzen Text, in der kaum zehn Seiten umfassenden Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre 1765–1766, stellt Kant seine »Lehrart«, Philosophie zu unterrichten, vor, denn sie unterscheidet sich von der bislang üblichen Art. Eineinhalb Jahrzehnte später, in der Methodenlehre der Kritik der reinen Vernunft, wird er das Leitziel bekräftigen: nicht Philosophie zu lehren, denn das sei »unmöglich«. In Bezug auf ihren Gegenstand, die Vernunft, dürfe man keine Kompendien zurate ziehen. Da Philosophie keine Wissenschaft sei, die man sich aus einem Lehrbuch aneigne, »könne man höchstens nur philosophieren lernen« (KrV, B 865). In den Worten der Nachricht soll man »nicht Gedanken, sondern denken lernen«, deshalb den Zuhörer »nicht tragen, sondern leiten«, damit er »in Zukunft von sich selbst zu gehen« vermag (II 306).
Nach der in der Nachricht näher skizzierten Didaktik der Philosophie (II 305–307) soll man sich »nach der Natur« richten und nicht etwa unmittelbar Fragen der Vernunft erörtern. Denn der »natürliche Fortschritt der menschlichen Erkenntnis« sehe anders, nämlich so aus: dass »sich zuerst der Verstand ausbildet, indem er durch Erfahrung zu anschauenden Urteilen und durch diese zu Begriffen gelangt, dass darauf diese Begriffe in Verhältnis mit ihren Gründen und Folgen durch Vernunft und endlich in einem wohlgeordneten Ganzen vermittelst der Wissenschaft erkannt werden«. Falsch hingegen ist es, von »Erfahrungsurteilen« zu »den höheren und entlegeneren Begriffen« durch »kühnen Schwung« gelangen zu wollen.
Noch später macht sich Kant über einen Rezensenten der Kritik lustig, der dieses Werk »ein System des … höheren Idealismus« nennt: »Hohe Türme sind nicht für mich … Mein Platz ist das Bathos«, d. h. die Tiefe, »der Erfahrung«. Ihretwegen soll man »den natürlichen und gebahnten Fußsteig« benutzen. Andernfalls lernt man nämlich nur ein »Blendwerk von Wissenschaft«, statt dessen, worauf es eigentlich ankommt: »die Methode selbst nachzudenken«. Hier klingt Kants späterer Begriff der Aufklärung an, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.
Von einem guten Dozenten der Philosophie ist jedenfalls laut Kant zu erwarten, dass er an seinem Zuhörer »erstlich den verständigen, dann den vernünftigen Mann und endlich den Gelehrten bilde«. Denn Aufgabe und Ziel sei es, »die Verstandesfähigkeit der anvertrauten Jugend zu erweitern und sie zur künftig reifern eigenen Einsicht auszubilden«. Dort, wo es tatsächlich geschieht, folgt man jener vielzitierten, häufig aber auch geschmähten Leitaufgabe allen vernünftigen Unterrichts: »non scholae sed vitae discimus« (»nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir«), was Kant ebenso selbstbewusst wie stolz für sich beanspruchen darf: Dank seiner gegenüber den traditionellen Unterrichtsarten revolutionär neuen Methode lernt man »nicht für die Schule«, sondern wird »für das Leben geübter und klüger geworden« sein.
Wie wir bei seinem Biographen Borowski lesen (in: Groß 1968, S. 86), ist sein Unterricht »ein freier Diskurs, mit Witz und Laune gewürzt. Oft Zitate und Hinweise zu Schriften, die er eben gelesen hatte, bisweilen Anekdoten, die aber immer zur Sache gehörten«.
Kants zeitweiliger Schüler, Johann Gottfried Herder, bestätigt dies: »Ich habe das Glück genossen, einen Philosophen zu kennen, der mein Lehrer war. Er, in seinen blühendsten Jahren, hatte die fröhliche Munterkeit eines Jünglings, die, wie ich glaube, ihn auch in sein greisestes Alter begleitet … Scherz und Witz und Laune standen ihm zu Gebot, und sein lehrender Vortrag war der unterhaltsamste Umgang … Er munterte auf und zwang angenehm zum Selbstdenken; Despotismus war seinem Gemüt fremde.« (Briefe zur Beförderung der Humanität, Brief 79).
Nicht nur bei Herder, sondern bei all seinen Studenten finden die zum eigenen Denken auffordernden Vorlesungen lebhaftes Interesse. Wie der Königsberger Theologe und Pädagoge Reinhold Bernhard Bachmann (1767–1843) schreibt, wurde Kant von seiner aus Preußen und Ausländern, vor allem Balten, Polen und Russen bunt zusammengewürfelten Zuhörerschaft über Jahrzehnte hinweg »fast vergöttert« (in: Groß 1968, S. 135 f.) Denn wie keiner seiner Kollegen verstand es Kant, in seiner von jedem schulmeisterlichen Ton freien Art ein eigenes, möglichst vorurteilsfreies Denken zu lehren, also das, was er von einem wahren Philosophieunterricht erwartete: nicht Philosophie, sondern Philosophieren.
5.Antriebskräfte
Dem wahrhaft enzyklopädischen Denken Kants, seinen vielen Themen und Methoden, liegen als Gemeinsamkeit dieselben vier Antriebskräfte zugrunde. Die Leitfragen unterscheiden sich zwar, trotzdem haben sie alle einen mehrdimensionalen Beweggrund. Sowohl die Frage nach dem Wissen, als auch die nach dem Sollen, weiterhin die nach dem Hoffen und schließlich die nach dem Wesen des Menschen sind gleichermaßen von vier in der Sache ineinandergreifenden Antrieben motiviert. Ohne Frage sind sie auch heute und nicht etwa nur für Philosophen aktuell: der Wille zur Aufklärung, eine wohlbestimmte, richterliche oder judikative Kritik, die Moral als Leitziel und ein in biographischer Hinsicht paradoxer Kosmopolitismus, denn Kant gibt, obwohl er sesshaft ist, trotzdem das Vorbild eines wahren Weltbürgers ab. Zu Kants Weltbürgertum gehört es, im Namen aller Menschen, für sie alle und im Prinzip auch für sie alle verständlich zu denken. Kant ist ein das übliche Verständnis von Demokratie übersteigend demokratischer Philosoph.
5.1Aufklärung
Die europäische Epoche der Aufklärung, das »Zeitalter der Philosophen«, ist schon weit fortgeschritten, als Kant ihr Wesen in einem bald hochberühmten Essay Was ist Aufklärung? auf den Begriff bringt: »Aufklärung«, definiert er dort wie in Stein gemeißelt, »ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit«. Wenige Zeilen später heißt es: »Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.«
Einmal ausgesprochen, klingt diese Bestimmung so überzeugend, dass man die darin liegende Provokation in der Regel übersieht. Nach ihrer wörtlichen Bedeutung will die Aufklärung nämlich, was in anderen europäischen Bezeichnungen wie »siècle des lumières«, »enlightenment« und »illuminismo« ebenso anklingt: Klarheit schaffen und Licht in das Dunkel bringen. Sie sucht Aberglauben und Vorurteile zu überwinden, Einsichten zu gewinnen und Fertigkeiten zu erwerben und beide, das Wissen und das Können der Menschheit, das der Mathematik, der Naturforschung, Technik und Medizin, auch der Geistes- und Sozialwissenschaften, zu erweitern und zu verbreiten.
Zu dem in der Tat enormen Wachstum der Erkenntnisse und Fertigkeiten kommen in der Epoche der europäischen Aufklärung zahllose Entdeckungen und Erfindungen, ferner Verbesserungen im Recht und Völkerrecht hinzu. Dabei steht vom Ausdruck der Aufklärung her der Zuwachs an Erkenntnis und Können in beiden Möglichkeiten seiner Betrachtung im Vordergrund: Auf die negative Aufgabe, das Austilgen von Irrtümern und Illusionen, soll die positive Leistung, die Zunahme dessen, was man weiß (»know that«) und kann (»know how«). Es kommt also auf die Welt des Wissens und Könnens an. Und es lässt sich schwerlich leugnen, dass die sich entsprechenden Fortschritte damals wahrhaft explosionsartig vollziehen.
Kant jedoch, darin typisch Philosoph, geht einen Schritt zurück. Er überlegt sich sowohl die Frage, wie die genannten Fortschritte denn möglich werden, als auch die weitere Frage, welche gemeinsame Antriebskraft all diesen Fortschritten zugrunde liegt. Die Antwort, die er dann gibt, hat eine meist unterschätzte Tragweite. Sie relativiert nämlich den Rang und Wert von Wissen und Können erheblich, was häufig übersehen oder in seiner Tragweite verdrängt wird. Denn diese beiden Domänen werden weder in die einleitende Definition noch in deren anschließende Erläuterung aufgenommen.
In einer späteren Schrift Was heißt: Sich im Denken orientieren? (abgekürzt: Denken) weist Kant den Vorschlag, »die Aufklärung in Kenntnisse zu setzen«, vehement zurück. Dort nennt er den Zuwachs von Kenntnissen – man darf ergänzen: und den von Fertigkeiten – für Aufklärung zu halten, eine »Einbildung«, mithin als den klaren Gegensatz von Aufklärung. In Wahrheit kommt es nämlich darauf an, »den obersten Probierstein der Wahrheit in sich selbst (d. i. in seiner eigenen Vernunft)« zu suchen. Denn die Aufklärung besteht in der »Maxime, jederzeit selbst zu denken« (VIII 146).
Kant pflegt für sich diese Maxime seit seiner ersten Schrift. Dort, in der erwähnten Abhandlung über die Berechnung der kinetischen Energie, nimmt er sich mit Nachdruck das Recht, »den Satz eines noch so berühmten Mannes freimütig zu verwerfen, wenn er sich meinem (!) Verstande als falsch darstellt« (I 9). Einen weiteren frühen Beleg bietet Kants Schrift zur Theorie der Winde. In deren Vorerinnerung appelliert der Autor an das »eigene Nachdenken des Lesers« (I 492), was er, wie erwähnt, in seiner Nachricht als Methode, »selbst nachzudenken«, bekräftigt (II 307).
Statt auf Kenntnisse, also eine theoretische Leistung, legt Kant also auf eine praktische, sogar moralische Aufgabe wert. Darin klingt schon die dritte Antriebskraft seines Denkens, die Moral, an. Und bei ihr zählt im Gegensatz zu einer verbreiteten Verkürzung nicht der Inbegriff von Pflichten gegen andere und von anderen, die Sozialmoral. Entscheidend ist vielmehr eine Eigenleistung, mithin eine Pflicht gegen sich.
Die Instanzen, die üblicherweise als verantwortlich benannt werden, erklärt Kant hier stillschweigend als bestenfalls nachgeordnet zuständig – er erwähnt sie nicht einmal. Die für sich und für andere beliebten Entschuldigungen, es seien doch die Eltern, die Lehrer und andere Autoritäten oder undurchschaute Vorurteile, ungerechte Institutionen und andere Vorgaben »der Gesellschaft« verantwortlich, werden, weil nicht einmal genannt, »beiseite gewischt«. Darin deutet sich erneut die dritte Antriebskraft an: Das entscheidende Hindernis der Aufklärung, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, also die Unmündigkeit, ist selbstverschuldet.
Eine gewisse geistige Fähigkeit, das Vermögen des Verstandes, setzt Kant freilich voraus. Wo die Fähigkeit wie bei Kindern noch nicht gegeben oder bei entsprechender geistiger Behinderung grundsätzlich nicht hinreichend vorhanden ist, dort hat die Aufforderung zur Aufklärung keinen Platz.
Nach der Anthropologie-Vorlesung ist die Aufklärung nichts weniger als eine »Revolution in dem Innern des Menschen«, dabei sogar »die wichtigste Revolution«. Während zuvor andere für den Menschen dachten, »wagt er es jetzt, mit eigenen Füßen auf dem Boden der Erfahrung … fortzuschreiten« (VII 229). Aufklärung ist also ein Wagnis, das zudem nicht sogleich von vollem Erfolg gekrönt ist, denn man bewegt sich zunächst, heißt es dort, »noch wackelnd«.
Nach den erwähnten Selbstbezeichnungen der Epoche kommt es auf Licht und Erleuchtung an, damit auf Leistungen, die vornehmlich von Wissenschaftlern, Gelehrten und Intellektuellen, auch Ingenieuren, jedenfalls von einer kleinen Gruppe der Menschheit, vollbracht werden. Die für Kant entscheidenden Begriffe widersprechen dem frontal. Sie bestehen nämlich in Mündigkeit, Selbstdenken und dem Aktivieren eines Vermögens, das gemäß der klassischen anthropologischen Bestimmung als animal rationale jedem Menschen offensteht: in der Begabung zu Sprache und Vernunft. Infolgedessen kann sich keiner damit entschuldigen, nicht über genügend Kenntnisse und geistige Fähigkeiten zu verfügen.
Eine erste, zweifellos auch heute aktuelle Provokation Kants besteht also in der Ablehnung des üblichen Verständnisses von Aufklärung als einer theoretischen (»Kenntnisse«), vielleicht zusätzlich praktischen (»Fertigkeiten«) Aufgabe. An deren Stelle tritt eine von jedem selber zu erbringende moralisch-praktische Leistung.
Eine zweite Provokation kommt hinzu: Entscheidend ist nicht die Überlegenheit von Fachleuten, von Wissenschaftlern, Gelehrten und Technikern, mithin einer geistigen Aristokratie. Um sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, braucht es keine herausragenden Verstandeskräfte, wohl aber eine Eigenschaft, die jedem Menschen offensteht: der Mut, selber zu denken. Darin steckt eine bislang kaum bemerkte, zumindest in ihrer Tragweite unterschätzte Spitze, die ein eminentes politisches Gewicht hat: Die geistig-aristokratische Definition der Aufklärung weicht bei Kant einer zutiefst demokratischen Bestimmung.
In Kants dritter kritischer Schrift, der Kritik der Urteilskraft (V 294, ähnlich in der Anthropologie, VII 228), führt Kant drei Maximen an, die sich auf drei Stufen eines allgemeinen Menschenverstandes belaufen. Die Grundstufe bildet das Selbstdenken. Auf sie folgt: »An der Stelle jedes andern denken«, und die dritte und höchste Stufe verlangt: »Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken«.
Weitere Erläuterungen sind für die folgende Einschätzung kaum erforderlich: Kants neuartiges Verständnis der Aufklärung, sowohl dessen Grundstufe, das »vorurteilsfreie« Selbstdenken, als auch die beiden Steigerungen, die um den Standpunkt des anderen erweiterte und die in sich konsequente »Denkungsart«, sind ohne Zweifel auch heute noch und fraglos ebenso in der Zukunft aktuell.
5.2Richterliche Kritik
Der gemeinsame Titelbegriff von Kants drei Hauptwerken, der Kritik der reinen Vernunft (KrV), der Kritik der praktischen Vernunft (KpV) und der Kritik der Urteilskraft (UK), nämlich der Ausdruck der »Kritik«, ist wohlbekannt. Kant stellt freilich so hochphilosophische Überlegungen an, dass die dort praktizierte Antriebskraft vielleicht für Fachphilosophen, aber kaum für uns andere aktuell sein kann. Geht daher bei der zweiten Antriebskraft die erwähnte antiaristokratische und prodemokratische Einstellung verloren?
Vergegenwärtigen wir uns zuerst die Bedeutung des Ausdrucks »Kritik«: Heute verstehen wir unter »Kritik« meist das Vorbringen von Einwänden und Bedenken. Wer etwas oder jemanden kritisiert, vertritt eine andere, nicht selten entgegengesetzte Position. Nach diesem Alltagsverständnis hat die Kritik einen negativen Charakter; sie bedeutet Tadeln, Missbilligen, Einspruch und Widerspruch. Bei Kant hingegen hat der Ausdruck eine andere, vornehmlich neutrale Bedeutung. Sie besteht in der im Griechischen krinein genannten Tätigkeit: im Trennen, Scheiden, Entscheiden und vor allem im Beurteilen.
Dieses Verständnis ist übrigens nicht etwa verloren gegangen, es wird vielmehr schon bei der Beurteilung religiöser Texte wie der Bibel und säkularer Texte der großen Literatur verwendet. Dort spricht man von Bibelkritik, hier etwa von Homerkritik. Wie auch in der Kunst- und der Literaturkritik zielt diese Kritik nicht auf einen »Verriss«. Ein guter Musik-, Theater- oder Romankritiker stellt dort Aufführungen, hier Texte vor, nennt Vorzüge, aber auch Schwächen und fällt abschließend ein Urteil, das – selbstverständlich eleganter und subtiler formuliert – auf ein (mehr oder weniger) »Gelungen« oder »Misslungen« hinausläuft.
Genau diesen in erster Linie weder anklagenden noch verteidigenden, vielmehr richterlichen Charakter haben Kants Kritiken. Ihr Muster bildet der Gerichtsprozess, des Näheren nicht ein Straf-, sondern ein Zivilprozess. In ihm streiten zwei gegensätzliche Parteien um einen Anspruch, beispielsweise um die Frage, wem eine Sache gehört oder wer für einen Schaden aufzukommen hat. Die streitenden Parteien tragen dann ihre Für- und Gegenargumente vor, die der Richter zur Kenntnis zu nehmen und gegeneinander abzuwägen hat, um schließlich ein Urteil zu fällen, das die berechtigten Ansprüche bestätigt, die unberechtigten hingegen als Anmaßungen zurückweist.
In Kants drei Kritiken geht es »natürlich«, weil der Philosophie gemäß, nicht um derartige Alltagsstreitigkeiten, sondern um wahre Grundfragen. In der ersten der drei Kritiken, der der reinen Vernunft, steht diese selbst auf dem Prüfstand, dabei vor allem die theoretische Vernunft. Diese will etwa wissen, ob es überhaupt eine im strengen Sinn objektive Erkenntnis gibt und ob diese gegebenenfalls auch für die Freiheit, die Unsterblichkeit der Seele und die Existenz Gottes zuständig ist.
Dabei kommt die erste Antriebskraft, die als Selbstdenken bestimmte Aufklärung, ins Spiel. Kant zufolge handelt man, wie es in der schon erwähnten Abhandlung Denken heißt, weder gesetzlos, mithin anarchisch, noch nach äußeren Gesetzen, also fremdbestimmt (heteronom), sondern lediglich gemäß den selbst gegebenen Gesetzen, folglich autonom. Über diese Selbstgesetzlichkeit, Autonomie, verfügt nicht lediglich der professionelle Philosoph, sondern jeder Mensch. Selbst wenn sich außerhalb der Philosophie kaum jemand für die allzu fundamentalen Fragen der ersten Kritik interessiert und man, um Kants Argumentationsgang nachzuvollziehen, erhebliche Mühe aufzuwenden hat, ist das Werk im Prinzip für jedermann lesbar.
Das von Kant auf den Weg gebrachte Gerichtsverfahren kommt insofern dem nahe, was im Strafprozess ein Geschworenengericht ist. Der Prozess mag zwar von methodisch geschulten Personen, von Fachphilosophen, angeleitet werden. Sie sind aber lediglich, wie Kant betont, »immer ausschließlich Depositär«, also jemand, der die Grundelemente der (theoretischen) Vernunft für andere Personen verwahrt. Diese anderen, die wirklichen Eigentümer der Gegenstände, sind wir alle. Weil die einschlägige »Gesetzgebung allenthalben in jeder Vernunft angetroffen wird« (KrV, B 867), trifft nicht der Fachphilosoph die Entscheidung, sondern jeder, der selber denken kann und will. Im Prozess um die Vernunft sind also Laienrichter, nicht Berufsrichter gefragt. Denn es kommt, es sei wiederholt, auf die »Einstimmung freier«, man darf hier pointierend sagen: aller freien Bürger an. Um diese Aufgabe nicht unnötig zu erschweren, verzichtet Kant übrigens weitgehend auf etwas, das Nichtphilosophen wenig bekannt ist, nämlich auf Kenntnisse der Philosophiegeschichte.
Kants richterliche, judikative Kritik kann man nun kaum für zeitgebunden, folglich für heute überholt erklären, nämlich bei Streitfragen besser nicht emotional zu reagieren. Vielmehr solle man sich als erstes überlegen, worauf es denn ankommt. Dabei lasse man sich von dem, was auf dem Spiel steht, nicht ablenken, sondern suche nach den einschlägigen Pro- und Contra-Argumenten. Deren Gewicht wäge man gegeneinander ab, um schließlich ein unparteiisches Urteil zu fällen.
Nachahmenswert ist auch ein zweiter Gesichtspunkt: Man halte sich nicht bei nebensächlichen Dingen auf, sondern konzentriere sich auf die grundlegenden Streitfragen.
5.3Moral
Für das Handeln erscheint die dritte Antriebskraft, die Moral, zwar nicht als selbstverständlich, denn man könnte den Bereich auch aus rein theoretischem Interesse erörtern. Die Moral als Antriebskraft liegt jedoch nahe. Nicht mehr naheliegend ist indes, dass das gesamte Denken eines Philosophen letztlich von der Moral her motiviert ist. Diese denn doch überraschende Eigenart trifft auf Kants intellektuelle Biographie sehr bald zu. Zudem ist sie dort nicht nur irgendwie, etwa nebensächlich und mitlaufend anzutreffen, sondern generell, zugleich grundsätzlich und in der letztentscheidenden Hinsicht: Kants Leitinteresse liegt erstaunlicherweise in der Moral.
Obwohl die erste Kritik, die der spekulativen bzw. theoretischen Vernunft, vornehmlich Erkenntnisfragen erörtert, hebt Kant schon in der Vorrede, freilich erst in der zur zweiten Auflage, sein moralisches Leitinteresse hervor. Nach ihrem »Weltbegriff«, wie ihn Kant im Unterschied zum »Schulbegriff« nennt, sucht er »allen Einwürfen wider Sittlichkeit … ein Ende«, und zwar »auf alle künftige Zeit« ein Ende zu machen (KrV, B xxxi).
Die Einwürfe, mit denen Kant sich auseinandersetzt, sind grundlegend, überdies unter Philosophen weit verbreitet. Sie sind teils moralskeptischer Natur – man weiß nicht, ob es so etwas wie Moral überhaupt gibt –, teils jener die Moral sogar leugnenden Natur, die das Dasein der Moral rundweg abstreitet. Kant nimmt diese Gegenpositionen ernst, sucht sie daher von Grund auf zu entkräften.
In Übereinstimmung mit seinem moralischen Leitinteresse heißt gegen Ende ersten Kritik, die Endabsicht aller Vernunftspekulation, obwohl er ihr in der Schrift so viel Platz einräume, liege nicht im spekulativen, sondern im praktischen Interesse (KrV, B 826 ff.). Im Anschluss daran unterscheidet Kant drei Grundarten des Für-wahr-Haltens: das Meinen, das Glauben und das Wissen. Spontan wird man erwarten, an die Spitze der drei Arten stelle er dort das Wissen, tatsächlich aber ist es das Glauben. Gemeint ist freilich kein religiöser Glaube, sondern eine wissenstheoretische Haltung, ein Überzeugtsein, das über ein Meinen im Sinne von Vermuten hinausgeht, aber kein unwiderlegbares, objektives Wissen erreicht.
Dieser Glaube, ein moralischer Glaube vom Rang eines Vernunftglaubens, richtet sich auf die drei »metaphysischen« Ideen: die Freiheit