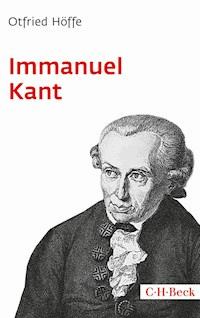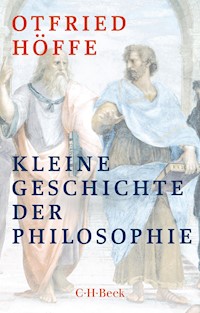
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Diese kurzgefaßte Geschichte der Philosophie von einem der renommiertesten deutschen Philosophen ist als illustrierte Ausgabe erstmals im Jahre 2001 erschienen. Für die preisgünstige Paperback-Ausgabe wurde der Text neu überarbeitet. Klar, anschaulich und mit Blick auf das Wesentliche schildert Otfried Höffe den Weg der Philosophie von den Anfängen im antiken Griechenland bis heute. Das Buch ist eine Einführung in die Philosophie mit dem Ziel, daß der Leser unter Anleitung der großen Philosophen selber zu philosophieren lerne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Otfried Höffe
Kleine Geschichte der Philosophie
Verlag C.H.Beck
Zum Buch
Diese kurzgefaßte Geschichte der Philosophie von einem der renommiertesten deutschen Philosophen ist als illustrierte Ausgabe erstmals im Jahre 2001 erschienen. Für die preisgünstige Paperback-Ausgabe wurde der Text neu überarbeitet. Klar, anschaulich und mit Blick auf das Wesentliche schildert Otfried Höffe den Weg der Philosophie von den Anfängen im antiken Griechenland bis heute. Das Buch ist eine Einführung in die Philosophie mit dem Ziel, daß der Leser unter Anleitung der großen Philosophen selber zu philosophieren lerne.
Über den Autor
Otfried Höffe lehrte unter anderem in Fribourg (Schweiz), Zürich, Sankt Gallen, Klagenfurt und St. Louis sowie in Tübingen, wo er noch die Forschungsstelle Politische Philosophie leitet. Bei C.H.Beck sind u.a. die Werke erschienen: Immanuel Kant (8.Aufl. 2014), Aristoteles (4. Aufl. 2014), Demokratie im Zeitalter der Globalisierung (1999, als Paperback 2002), Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Grundlegung der modernen Philosophie (4. Aufl. 2004, als Paperback 2011), Die Macht der Moral im 21. Jahrhundert. Annäherungen an eine zeitgemäße Ethik (2014), Kritik der Freiheit. Das Grundproblem der Moderne (2015), Geschichte des politischen Denkens (2016). Höffe ist Träger des Bayerischen Literaturpreises (Karl-Vossler-Preis) für wissenschaftliche Werke von literarischem Rang.
Inhalt
Warum Philosophie?
I. Anfänge. Vor Sokrates
II. Hoch-Zeit in Athen
III. Hellenismus und Spätantike
IV. Ein Blick nach Indien und China
V. Von Augustinus bis Bernhard von Clairvaux
VI. Islamische und jüdische Philosophie
VII. Von Albert dem Großen bis Marsilius von Padua
VIII. Renaissance und Humanismus
IX. Rationalismus und Empirismus
X. Zeitalter der Aufklärung
XI. Immanuel Kant
XII. Deutscher Idealismus
XIII. Von Schopenhauer bis Marx
XIV. Lebensphilosophien. Von Nietzsche bis Dewey und Bergson
XV. Phänomenologie, Existenzphilosophie und Hermeneutik
XVI. Analytische Philosophie. Von Frege bis Wittgenstein
XVII. Zur theoretischen Philosophie der Gegenwart
XVIII. Zur praktischen Philosophie der Gegenwart
Ausblick. Philosophie in der einen Welt
Literaturhinweise
Abbildungen
Register
Warum Philosophie?
Wir erwarten von der Philosophie, daß sie sich grundlegenden Fragen stellt, um sie ebenso grundlegend zu beantworten. In der Tat befaßt sie sich mit Grundfragen, die sogar die gesamte Menschheit bedrängen und sich zu drei Leitfragen bündeln lassen: (1)Was ist die Natur, und was können wir von ihr wissen? (2) Wie sollen wir als einzelne Personen und als Gemeinwesen leben? (3) Was dürfen wir von einem guten Leben erhoffen, sei es in diesem oder einem künftigen Leben? Dazu kommen Fragen, die eine ganze Epoche bewegen, etwa die Frage nach dem Verhältnis von Vernunft und Offenbarung oder die nach einem Fortschritt in der Geschichte.
Manche halten die Philosophen zwar für lebensfremd. Schon wer ihre allgemeinmenschlichen Fragen näher betrachtet, entdeckt aber bald Teil- und Unterfragen, die alles andere als lebensfremd sind: (1a) Gibt es einen Ur- und Grundstoff, aus dem die gesamte Natur entsteht und besteht; gibt es, was der Ausdruck «A-tom» wörtlich meint: letzte, nicht mehr teilbare Bausteine der Natur? (1b) Ist die Natur räumlich und zeitlich unendlich oder eher endlich und dann das Werk eines Schöpfers, einer Gottheit? Wenn nicht schon diese Fragen ein existentielles Gewicht haben, so zweifellos die nächsten: die Fragen (2a) nach Gut und Böse, (2b) nach der Freiheit, insbesondere der Freiheit des Willens, und (2c) nach der Gerechtigkeit von Recht und Staat. Schließlich wollen wir wissen, (3a) ob unser Wohlergehen, das Glück, von unserem Wohlverhalten, einem moralisch guten Leben, abhängt: Zahlt sich moralische Rechtschaffenheit aus, oder ist der Rechtschaffene letztlich der Dumme? (3b) Und falls der Ausgleich nicht «in diesem Leben» stattfindet, besteht dann Hoffnung auf eine unsterbliche Seele, auf ein ewiges Leben und auf einen Lohn im Jenseits? Weil sich derartige Fragen vielleicht verdrängen, aber schwerlich abweisen lassen, darf man sagen: Philosophieren tut not. Die Philosophie will nicht die Welt, in der wir leben, verzaubern oder ihr eine mystische Tiefe geben. Schon gar nicht schafft sie Illusionen, vielmehr sucht sie zu kaum vermeidbaren Grundfragen überzeugende Antworten. Bei der Suche kann sie sich freilich gezwungen sehen, den Erwartungshorizont für die Antworten und nicht selten sogar die Fragen selbst zu verändern.
Philosophie ist wie eine ungestillte Wißbegier, bei der nicht die Menge des Wissens zählt, sondern die Gründlichkeit, mit der man das Wissen sucht. Sie setzt die Fähigkeit zum Staunen voraus, freilich weniger zum bewundernden Staunen: zur Hochachtung vor der Harmonie in der Natur oder in der Gesellschaft, als zum sich wundernden Staunen. Bestimmt durch Fragen, die sich im Rahmen des bisherigen Wissens oder der bisherigen Lebensordnung nicht beantworten lassen, entsteht Philosophie in Zeiten von Konflikt, Kritik und Krise. Wo Erklärungs- oder Lebensmuster sich bekämpfen oder gegen die Religion und gegen sinngebende Instanzen Zweifel laut werden, dort braucht es die Fähigkeit, Bekanntes in Frage zu stellen: methodisch, aber auch in Kenntnis der Welt, gründlich und unter Einbezug der eigenen Voraussetzungen.
Die Philosophie im engen und strengen Verständnis ist relativ jung, nach Auskunft der überlieferten Quellen nicht viel mehr als zweieinhalb Jahrtausende alt. Die unvermeidbaren Fragen stellen sich aber schon lange vorher und werden auch später noch außerhalb der Philosophie behandelt. Infolgedessen braucht es für die Philosophie mindestens einen zweiten Grund: Sie entwickelt sich erst dort, wo man mit der bisherigen Art, die Fragen zu stellen oder sie zu beantworten, unzufrieden ist. Aus einer grundlegenden Unzufriedenheit, aus einer Radikalkritik, bildet sich eine neuartige Frage- und Antwortweise heraus, eine neue Weise, der Wirklichkeit zu begegnen und über sie zu reden.
Nach einem verbreiteten Verständnis ist der Philosoph ein intellektuelles Schreckgespenst. Weltfremd und mit abstrusen Wörtern hantierend, lebt er in luftigen Höhen und stellt ebenso unverständliche wie unnütze Behauptungen auf. Wahr ist, daß große Philosophen die uns vertraute Welt kennen, daher erfahrungsgesättigt denken; sie schauen sich die Welt aber gründlicher an und dringen dabei in neues, noch unvertrautes Gelände vor. Dabei kann es notwendig werden, neue Ausdrücke einzuführen. In der Regel geschieht dies aber behutsam. Selbst ein Fachausdruck wie «Idee» stammt aus der Umgangssprache, allerdings aus der Umgangssprache der ersten Philosophen, dem Griechischen. Nach einem anderen Mißverständnis ist die Philosophie lediglich ein Teil der Geisteswissenschaften. In Wahrheit ist sie bei jedem Thema sowohl der Alltagserfahrung als auch aller Wissenschaften der Alternative Natur- oder Geisteswissenschaften vorgelagert, trägt sie ebenso zu Grundlagendebatten der Mathematik und Naturwissenschaften wie denen der Geistes- und Sozialwissenschaften, nicht zuletzt der Medizin und Technik bei. Und vor allem läßt sie sich auch auf Fragen von Recht und Gerechtigkeit, von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, von Bewußtsein, Selbstbewußtsein und Sprache, von Bildung, Musik und Kunst unmittelbar, auch ohne die Vermittlung von Wissenschaften, ein.
In der Regel erzählen Philosophen nicht, was die Griechen Mythen nennen: Geschichten von Göttern und Helden, vom Anfang und der Ordnung sowohl der Natur als auch der Gesellschaft. Philosophen berufen sich auch nicht auf eine religiöse Offenbarung, ein Wort Gottes, oder auf die Überlieferung, eine Tradition. Selbst wenn sie diese zum Gegenstand machen, arbeiten sie ausschließlich mit Mitteln der allgemeinen Menschenvernunft: mit (sachgerechten) Begriffen, mit (widerspruchsfreien und erklärungskräftigen) Gründen, Argumenten, und mit elementaren Erfahrungen, beispielsweise daß es eine Welt gibt, die von verschiedenartigen Wesen bevölkert ist, und daß unter ihnen sprach- und denkfähige Lebewesen vorkommen. Bei allen drei «Mitteln»: Begriff, Argument und Erfahrung, suchen Philosophen eine weitreichende, oft sogar allgemeine Gültigkeit. Selbst wenn sie ihnen nicht gelingt, ist zumindest deren «kleine Schwester», eine allgemeine Überprüfbarkeit, zu erwarten.
Weil jedes der drei philosophischen Mittel in der Mehrzahl existiert, erweitert sich die Philosophie bald um die Suche nach einem geordneten Zusammenhang. Sowohl die Begriffe als auch die Argumente, nicht zuletzt ihre Ordnung und deren sprachliche Gestalt heißen bei den Griechen logos. Das Lebenselixier der Philosophie besteht im Logos mit seinen vier Gesichtspunkten: Begriff, Argument, «logische» Ordnung und deren leibhafte Gestalt, die Sprache. Durch die Sprache wird das Philosophieren zum Gespräch, sogar zum Streitgespräch: zum Disput sowohl mit Zeitgenossen als auch mit den großen Philosophen der Geschichte. Denn nicht aus einem Schatz ewiger Wahrheiten besteht die Philosophie, wohl aber aus einer mit- und gegeneinander durchgeführten Suche nach Wahrheit, ohne daß man dabei mit einer endgültigen Wahrheit oder auch nur mit einem linearen Fortschritt rechnen könnte, obwohl es durchaus Fortschritte gibt.
Begriffe und Argumente tauchen schon im Alltag auf, entsprechendes gilt für die Wissenschaften, so daß es für die Besonderheit der Philosophie einen dritten Grund braucht: Zur Philosophie kommt es erst dort, wo man den Mut aufbringt und zugleich die Fähigkeit entwickelt, Grundfragen des Alltags oder der Wissenschaften – «Was ist richtig?», «Was ist der Fall?» und für beide: «Warum?» – auf die Spitze zu treiben. Dann bewegt man sich freilich bald in Höhen, in denen es einem schwindlig werden kann. Philosophieren heißt daher zu lernen, im Denken schwindelfrei zu werden, nicht notwendig absolut, weitgehend schwindelfrei aber doch.
Noch ein anderes Bild erläutert die Besonderheit der Philosophie: Wer «Warum?» fragt, bohrt in die Sache hinein, wobei Philosophen tiefer und tiefer zu bohren pflegen, radikal im wörtlichen Sinn: Sie gehen unter die Oberfläche und suchen die Wurzeln der jeweiligen Sache. Dabei ist ihrem bohrenden Was- und Warum-Fragen nichts entzogen. Auch das Selbstverständlichste wird in Frage gestellt, die eigene Überlieferung eingeschlossen: Die Selbstkritik ist ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie.
Warum aber soll man das Was- und das Warum-Fragen auf die Spitze treiben, warum soll man tiefer und tiefer bohren? Im einzelnen – so zeigt die Geschichte – fallen die Antworten unterschiedlich aus, gleichwohl gibt es eine gemeinsame Antriebskraft: die Wißbegier. Zu Recht beginnt ein Hauptwerk der Philosophie, Aristoteles’ Metaphysik, mit dem Satz: «Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen.»Die Philosophie unternimmt nichts mehr, freilich auch nichts weniger, als eine natürliche Antriebskraft, die Wißbegier, voll zu entfalten. Daraus ergibt sich kein Vorteil im üblichen Sinn, kein Nutzen, außer dem vollentfalteten Wissen selbst. Die Philosophie sucht kein Sonderwissen neben anderen Bereichen des Wissens zu entwickeln, sondern die dem Menschen innewohnende Berufung zu einem Wissen auch ohne äußeren Nutzen zur Vollendung zu bringen.
Schlechthin neu ist ein vom Nutzen befreites Wissen allerdings nicht. Im Gegenteil kennt jeder ein Wissen als Selbstzweck, sichtbar in einer Lust der Sinne: in der Freude zu sehen, zu hören, zu schmecken und zu fühlen. Nicht zufällig leitet sich ein Element der Philosophie, der Begriff, von der Tätigkeit ab, mit der sich bereits Säuglinge die Welt erschließen, vom Be-greifen. Und weil sich die Philosophie letztlich nur der natürlichen Wißbegier verdankt, kann sie im Niederländischen «wijsbegeer» heißen.
Wer ein Wissen oder eine Fertigkeit vollendet beherrscht, den nennen wir Maestro oder Meister; die Griechen sagen sophos:Weiser. Während andere in einem Handwerk, in Rechtsgeschäften («Juristen»), bei der Heilung von Krankheiten («Ärzte») oder in politischen Geschäften Meister sind, suchen Philosophen die Meisterschaft im Wissen. Und weil diese sehr schwer zu gewinnen ist, beanspruchen sie nach Platon nicht die sophia selbst, sondern lediglich eine philo-sophia: die Liebe zur Weisheit. Der Zusatz philodrückt freilich auch die Vertrautheit mit Gegenwärtigem und nicht das Streben nach Unerreichbarem aus. Für Platon ist der philo-sophos ein philo-mathēs, einer, dem das Lernen Freude macht und der dabei unersättlich ist.
Ein zweites kommt hinzu: Während man üblicherweise über Sachverstand nur für einen schmalen Bereich verfügt, sucht die Philosophie den Sachverstand für das Allgemeine und Ganze: ein Wissen über die ganze Natur, ein Wissen über das allgemein und schlechthin Gute und Gerechte, nicht zuletzt ein Wissen über das Wissen überhaupt. Sie sucht zu klären, was ein sachgerechter Begriff und was ein triftiges Argument ist und wie man Begriffe und Argumente in einen geordneten Zusammenhang bringt.
Obwohl sich die Wißbegier als natürliche Anlage bei allen Menschen und in allen Kulturen findet, entwickelt sich die Philosophie im strengen Sinne bloß in einigen Kulturen und selbst in ihnen nur bei wenigen Menschen. Nach bisheriger Kenntnis gibt es das auf die Spitze getriebene Was- und Warum-Fragen vor allem bei den Griechen und den sich daran anschließenden Kulturen. Auch aus Indien und China sind weit mehr als nur Ansätze der Wißbegier bekannt; in Indien sind sie allerdings häufig mit religiösen, in China mit Staats- und Sittenlehren verknüpft. In allen drei Fällen entsteht die Philosophie in etwa zur selben Zeit zwischen 600 und 300 vor Christus, also in jener Epoche geistiger Neuorientierung, die Jaspers die Achsenzeit nennt.
Zu den Vorläufern der theoretischen Philosophie wiederum gehören Mathematik und Naturforschung. Aus Babylon kennen wir planmäßige Himmelsbeobachtungen und Messungen zum Aufstellen von Kalendern und zur Vorausberechnung von Mondfinsternissen. Ein Hilfsmittel ist der Tierkreis («Zodiakus»), der die von der Sonne im Laufe eines Jahres am Himmelsgewölbe durchlaufene Bahn in zwölf Teile gliedert. In Babylon entstehen die Rechen- und Meßverfahren ebenso wie in Ägypten und China aus der Praxis der Feldmesser und Bautechniker, und ihre Einsichten werden rezeptartig überliefert. Bei den Griechen dagegen wird die Mathematik zu einer Gründe angebenden, beweisenden Wissenschaft und ist dadurch der Philosophie verwandt.
Zu den Wegbereitern der praktischen Philosophie wiederum gehört die Lebensweisheit. Zwei Beispiele zeigen, wie hoch sie schon in Ägypten entwickelt ist. (1) Das Gebot der Hilfsbereitschaft: «Hilf jedermann./Befreie einen, wenn du ihn in Banden findest; sei ein Beschützer des Elenden./Gut nennt man den, der nicht die Augen zumacht./Wenn eine Waise sich an dich wendet,/die hilflos ist, da ein anderer sie verfolgt,/um sie zu Fall zu bringen,/so fliege zu ihr hin und unterstütze sie,/sei der Retter für sie./Das wird gut sein im Herzen Gottes,/und die Menschen loben es.» (2) Die Goldene Regel: «Tu niemandem etwas Böses an, um nicht heraufzubeschwören, daß ein anderer es dir antue.»
Daß wir von anderen Regionen bestenfalls Vorläufer der Philosophie kennen, mag an fehlendem Wissen über diese Kulturen liegen, so daß eine fortschreitende Kenntnis auch für sie eine entfaltete Philosophie zutage fördert. Es gibt aber noch einen anderen Grund: daß die Selbstvollendung des Wissens, die Philosophie, an drei anspruchsvolle Vorbedingungen gebunden ist. Erstens bewahrheitet sich das Sprichwort: «Vor den Preis haben die Götter den Schweiß gesetzt.» Wie jede Anlage, so vollendet man auch die Wißbegier nicht ohne Anstrengung. Zweitens gelangt man zum Gipfel des Wissens erst, nachdem man Vorgipfel bezwungen hat. Die Philosophie entsteht nur dort, wo schon die einfachen Was- und Warum-Fragen entfaltet sind, namentlich die Lebensweisheit und die gewöhnliche Wissenschaft, etwa als Astronomie. Für den Raum, in dem die griechische Philosophie entsteht, für das östliche Mittelmeer, kennen wir die Vorgipfel – wie angedeutet – vor allem aus Ägypten und Babylon. Die Griechen selbst beanspruchen nicht, Wissenschaft und Philosophie erfunden zu haben, sondern billigen diese Leistung schon den Ägyptern zu.
Ein vom Nutzen freies Wissen kann sich schließlich nur der leisten, der von der elementaren Nutzensuche entlastet ist. Erst wenn das Lebensnotwendige gesichert ist – für die ganze Gesellschaft oder für eine gewisse Gruppe–, hat man die Muße, sich dem Nicht-Lebensnotwendigen, der Philosophie, zuzuwenden. Nach dem Einleitungskapitel von Aristoteles’ Metaphysik wird diese «sozioökonomische» Bedingung vom Priesterstand der Ägypter erfüllt. Das Lebensnotwendige ist freilich eine bescheidene Voraussetzung; Philosophie gedeiht keineswegs erst in wohlhabenden Gesellschaften.
Die Besonderheit der Philosophie hat eine glückliche Folge. Wer sich weder auf das Herkommen noch die Überlieferung oder eine religiöse Offenbarung beruft, wer keine andere Autorität anerkennt als eine allen Menschen offene Erfahrung und eine allen Menschen gemeinsame Vernunft, der gewinnt Einsichten, die für alle Menschen jedweder Kultur von Belang sind. Religionen und Traditionen können die Menschen trennen, das Philosophieren verbindet sie. Aus diesem Grund eignen sich Philosophen zu Lehrern des Menschengeschlechts. Ohnehin haben sie das Selbstverständnis und die Weltorientierung der Menschen entscheidend geprägt, darüber hinaus die soziale und politische Welt tiefgreifend verändert.
Mit der ersten glücklichen Folge verbindet sich eine zweite: Die Philosophie hat einen weltbürgerlichen Charakter; wer bei ihr in die Schule geht, ist ein geborener Kosmopolit, ein Bürger der allen Menschen gemeinsamen Welt. Nicht zuletzt schaffen große Philosophen auch literarisch bedeutsame Werke; in der weiten Familie der Weltliteratur haben die klassischen Texte nicht den geringsten Rang.
Eine «Kleine Geschichte der Philosophie» verstrickt sich allerdings in zwei Schwierigkeiten. Die kleinere Schwierigkeit teilt sie mit jeder Geschichte: Aus dem schier unerschöpflichen Reichtum der Philosophie, einer Enzyklopädie des menschlichen Geistes und zugleich eines Kernstücks der Weltkultur, greift sie nur einen Bruchteil heraus: wichtige Beispiele jener Themen, Personen, Schulen und Werke, die sich durch besondere Originalität und Bedeutsamkeit auszeichnen.
Die größere Schwierigkeit liegt in der Philosophiegeschichte selbst. Wer erzählt, was einmal war, droht, seinen Gegenstand zu verfehlen. Denn er stellt die Gedanken als Vergangenheit vor, obwohl sie auf die Gegenwart zielen: Der Begriff soll die Sache treffen und das Argument die Warum-Frage beantworten. Um trotzdem ihrer Sache gerecht zu werden, darf eine Philosophiegeschichte ihren Gegenstand nicht wie ein Anatom als tote Gedanken vorstellen, sondern muß versuchen, Begriffe und Argumente «zum Sprechen zu bringen» und darüber hinaus auf gewisse Verbindungslinien hinzuweisen. Beides wird durch den Umstand erleichtert, daß sich die Philosophen selbst mit ihren Vorgängern auseinandersetzen: Die Geschichte der Philosophie ist auch ein Streitgespräch der (großen) Philosophen mit- und gegeneinander, wobei allerdings viele gern die eine Königin sein wollen, die im emsigen Bienenstock des Denkens allein regiert. Tatsächlich erweist sich die Philosophie aber als ein radikal offenes Projekt: offen in den Antworten und in den Wegen («Methoden») zu den Antworten, offen in den Qualitätskriterien sowohl für die Wege als auch die Antworten; nicht zuletzt bleibt offen, worin die für eine Epoche oder die ganze Menschheit entscheidenden Fragen liegen.
Will man dieses Projekt genauer kennenlernen, so muß man die großen Philosophen selbst lesen. In einer Zeit, in der mit philosophischen Grundkenntnissen nicht überall zu rechnen ist, wird hier auf dem Weg einer knappen Geschichte eine für die Sache selbst werbende Einführung versucht. Dabei liegt ein Akzent auf den klassischen Texten, die man am besten kritisch und zugleich con amore liest. Jedes Kapitel schließt mit einer Lektüreempfehlung, auf daß man unter Anleitung der großen Philosophen selber zu philosophieren: lebendig zu denken, lerne.*
* Text und Bildvorschläge für die illustrierte Ausgabe (2001) wurden in einer Vortragsreihe 1999/2000 an der Universität Tübingen erstmals vorgestellt. Ich danke dem hochinteressierten Publikum und für mannigfache Hilfe meinen Mitarbeitern Christoph Wolgast sowie für die Ausgabe in der Beck’schen Reihe (2005) Roman Eisele und Ina Goy.
I. Anfänge. Vor Sokrates
Wie die geistige Entwicklung eines jungen Menschen, so ist auch die Ausbildung der Philosophie ein längerer Vorgang. Der Übergang «vom Mythos zum Logos» erfolgt nicht plötzlich, durch eine innere Erleuchtung. Erst nach und nach geht dem Menschen die Frag-Würdigkeit der Welt auf, weshalb sich keine scharfe Grenze ziehen läßt. Wenn der böotische Dichter Hesiod (um 700 v. Chr.) in der Theogonie («Götterentstehung») die überlieferte Religion kritisiert, so greift er der Philosophie als Religionskritik vor. Und in seiner nachdrücklichen Unterscheidung von Falschem und Wahrem deutet sich Erkenntniskritik an.
Die Philosophie im engeren Sinne beginnt im kulturell offenen, handeltreibenden und Kolonialstädte gründenden Teil Griechenlands, in Ionien. Ihr Ursprung liegt in kleinasiatischen Hafenstädten wie Milet, Kolophon und Ephesus, auf Inseln wie Samos und in «Kolonialgriechenland», in Unteritalien. Die frühen Denker, zu denen spätere Philosophen immer wieder zurückkehren, sind aber nicht bloß Philosophen, sondern auch Naturforscher, überdies «Weise», nämlich Ratgeber der Politiker und des Volkes, nicht zuletzt bedeutende Meister der Sprache.
Weil Sokrates einen bedeutenden Einschnitt markiert, heißen die Philosophen vor ihm – von Thales bis zu Demokrit und den Sophisten – Vorsokratiker. Ihr Denken richtet sich zunächst auf die Natur als Ganze, auf den Kosmos und seine «logische» Ordnung, und auf die religiöse Welt. Die Philosophie fängt dementsprechend als Naturphilosophie bzw. Kosmologie und als Religionskritik an. Es folgt ein Nachdenken über alles, was ist, die Ontologie, und über die Möglichkeit wahrer Erkenntnis, die Erkenntnistheorie bzw. Epistemologie. Die menschlichen Angelegenheiten drängen sich erst später in den Vordergrund und mit ihnen die Ethik und die Politische Philosophie, ferner die Rhetorik und die Philosophie der Dichtung, die Poetik.
In dieser Entwicklung, die sich über mehr als zwei Jahrhunderte erstreckt, bilden sich nicht nur unterschiedliche Richtungen der Philosophie, sondern auch verschiedene Gestalten und Stile aus. Sie greifen freilich ineinander. Wer sie erkunden will, stößt auf schwierige Texte und auf die zusätzliche Schwierigkeit, daß sie bloß in Bruchstücken und späteren Zeugnissen vorliegen: als «Fragmente der Vorsokratiker», die sich nur dem kreativen Interpreten erschließen.
Die Hauptbegriffe der frühen Philosophen heißen physis: Natur; archē: Prinzip im Sinne von Ursprung oder Anfang, und zwar der Zeit, der Entstehung oder dem Rang nach, auch im Sinne von Herrschaft; logos: Begriff und Argument, Rechenschaft, Ordnung und Vernunft sowie Rede und Sprache; kosmos: die geordnete und in ihrer Ordnung erkennbare, überdies schöne Welt.
In diesen vier Begriffen zeichnet sich die weltgeschichtliche Bedeutung der Vorsokratiker ab. Sie entdecken, daß die uns vorgegebene Welt als ein Ganzes anzusehen ist (physis), das eine Ordnung hat (kosmos), die erkannt werden kann (logos), aber nicht an der Oberfläche liegt (archē) und deren Erkenntnis – so ein weiteres Element – vom Irrtum bedroht ist.
Milesische Naturphilosophie
Thales. Die frühe Naturphilosophie fragt nach dem Ursprung bzw. Prinzip, aus dem die Natur in all ihren Erscheinungen hervorgeht. Sie sucht ein umfassendes und zugleich einheitliches Woraus: das Eine im Vielen und das Allgemeine für alles Besondere. Der erste Vertreter, Thales aus Milet (um 624–546 v. Chr.), sieht Aristoteles zufolge den Ursprung in etwas Stofflichem, in einem «Ur- oder Grundstoff», dem Wasser. (Weil damit die Welt durch ein einziges – griech. monos – Prinzip erklärt wird, heißt ein solches Denken Monismus.) Mit Hilfe des Wassers erklärt Thales auch ungewöhnliche Naturerscheinungen; so greifen bei ihm Naturphilosophie und Naturwissenschaft ineinander. Zugleich werden mythische Erklärungen hinterfragt und entmachtet, womit Religionskritik anklingt: Thales erklärt Erdbeben nicht mehr mit dem Eingreifen des Gottes Poseidon, sondern mit Bewegungen des Wassers, auf dem die Erde «wie ein Stück Holz schwimmt». Außerdem bietet er Erklärungen für die jährliche Nilüberschwemmung und den Magnetismus an und sagt die Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 v. Chr. voraus. Überdies gehen auf Thales streng allgemeine Sätze der Geometrie zurück, z.B. der nach ihm benannte Satz, daß der Peripheriewinkel eines Dreiecks im Halbkreis ein rechter ist. Im entsprechenden Beweis zeigt sich Thales nicht bloß als ein bedeutender Mathematiker. Er nimmt auch den für die Philosophie grundlegenden Übergang zu allgemeingültigen Aussagen vor.
Nach einer berühmten, von Platon überlieferten Anekdote ist Thales das Muster eines lebensuntauglichen Philosophen: Beim Umhergehen sei er, weil in die Beobachtung des Himmels versunken, in einen Brunnen gestürzt und darüber von einer thrakischen Magd ausgelacht worden. Gegen seine angebliche Lebensuntauglichkeit sprechen aber Berichte über bedeutende politische und lebenspraktische Ratschläge, Spruchweisheiten, die Thales zugeschrieben werden und derentwegen er als einziger Philosoph zu den Sieben Weisen zählt: «Sei nicht reich auf schimpfliche Weise»; «Etwas Lästiges ist Untätigkeit. Etwas Schädliches Unbeherrschtheit. Etwas Schwererträgliches Unbildung»; «Beneiden laß dich lieber als Bemitleiden» und «Halte Maß».
Nicht zuletzt verfügt Thales über unternehmerische Weitsicht: Als man ihm seine Armut vorhält, mietet er, da er dank astronomischer Kenntnisse eine reiche Olivenernte voraussieht, im Winter zuvor alle Ölpressen an und erzielt mit deren Vermietung bei der Ernte einen satten Gewinn. Daraus schließt Aristoteles, «daß es für Philosophen leicht ist, reich zu werden, wenn sie nur wollen, daß ihnen aber daran nicht viel liegt».
Thales’ Prinzip, das Wasser, wirft drei Schwierigkeiten auf, an deren Lösung die nachfolgenden Philosophien arbeiten. Erstens ist die Funktion des Prinzips mehrdeutig: Ist etwas gemeint, aus dem alles besteht («alles ist Wasser») oder aber alles entsteht («alles kommt vom Wasser her»)? Und: Gilt das Prinzip unmittelbar oder nur in letzter Instanz, womit sich schon bei Thales der später oft vertretene «metaphysische» Schnitt zwischen der wahrnehmbaren Welt und ihrem nicht wahrnehmbaren Grund andeuten würde? Zweitens ist der Gehalt des Prinzips mehrdeutig. Für Thales ist das Wasser nicht lediglich Stoff, sondern auch Leben, Bewegung, sogar Seele. In diesem Sinn ist seine Behauptung zu verstehen, alles, pan, sei voll von Göttern, was man später Pantheismus nennt. Für die Lebendigkeit des Wassers kann Thales an eine Erfahrung anknüpfen: an das Nilwasser als die dort entscheidende Quelle der Fruchtbarkeit.
Anaximander. Thales’ «Verwandter, Schüler und Nachfolger» Anaximander (610/9–547/6 v. Chr.) gibt das Prinzip Wasser auf. Zu den Gründen gehört eine dritte Schwierigkeit von Thales’ Prinzip, und bei ihrer Lösung tritt eine Form philosophischen Fortschritts zutage: Bei einem radikalen Weiterfragen bemerkt man, daß nicht nur die bisherige Antwort, sondern sogar das Antwortmuster («Urstoff») zu verwerfen und durch ein neuartiges zu ersetzen ist:
Wenn die Erde ihre Stabilität dadurch gewinnt, daß sie auf dem Wasser ruht, so fragt sich, worauf denn das Wasser ruhe. Nennt man als Antwort einen anderen Stoff, so wiederholt sich die Frage, worauf dieser denn ruhe. Und an die neuerliche Antwort stellt sich erneut die Frage, so daß es einem in der Tat schwindlig wird: Das Weiterfragen verweist ins Unendliche. Anaximander gibt daher die Vorstellung auf, die Erde ruhe auf etwas. Nach seiner Ansicht beharrt die Erde schwebend im All, weil sie zu dessen Grenzen in jeder Richtung denselben Abstand hält. An dieser Antwort ist weniger die (falsche) Annahme von der Erde als dem Mittelpunkt des Kosmos interessant als das «moderne» Erklärungmuster: Im Gleichgewicht durch gleiche Abstände klingt der Gedanke der Schwerkraft an und die Erkenntnis, daß sie auf Massenanziehung beruht.
Bei Anaximander tritt an die Stelle des Prinzips Wasser das apeiron. Es bedeutet einerseits das Endlose und Unbegrenzte: Die Welt ist räumlich, vielleicht auch zeitlich unendlich, so daß das apeiron eine unerschöpfliche Quelle für alles Entstehen ist. Andererseits ist etwas (qualitativ) Unbestimmtes gemeint: Der Ursprung liegt nicht in den uns vertrauten Stoffen, etwa den vier «Elementen» Feuer, Luft, Wasser und Erde. Denn die Stoffe haben einander entgegengesetzte Grundeigenschaften: heiß (Feuer) und kalt (Luft), feucht (Wasser) und trocken (Erde), weshalb man sie nicht auf einen einheitlichen «Urstoff» zurückführen kann. Statt dessen – so Anaximander – besteht zwischen den verschiedenen Grundstoffen eine «kosmische Gerechtigkeit».
Der älteste im authentischen Wortlaut überlieferte Satz der griechischen Philosophie stammt von Anaximander und lautet: «Woraus aber das Entstehen für die Dinge ist, die existieren, dahinein erfolgt auch ihr Vergehen gemäß der Notwendigkeit; denn sie zahlen einander gerechten Ausgleich und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Ordnung der Zeit.» Gemäß diesen Bildern aus dem Rechtsbereich herrscht in der Welt eine zweiteilige Gesetzmäßigkeit («Notwendigkeit»): Wenn beispielsweise das Heiße vorherrscht, so wird das Kalte zurückgedrängt; ihm geschieht ein «Unrecht», jedoch nur vorübergehend. Durch ein späteres Übergewicht des Kalten wird ein «Ausgleich» geschaffen, der zugleich dem Heißen unrecht tut usw. Die Gesamtheit der Naturprozesse besteht nun in einem dynamischen Gleichgewicht.
Von Anaximander stammt auch eine «Theorie» sowohl kosmologischer als auch biologischer Evolution: Die Gattung Mensch sei aus nichtmenschlichen, im Wasser lebenden Tieren hervorgegangen.
Anaximenes. Anaximanders Schüler Anaximenes (gest. um 525 v. Chr.) verbindet die Einsichten seines Lehrers mit einem gewissen Rückgriff auf Thales. Er hält das Prinzip der Natur für zwar unbegrenzt, aber (qualitativ) bestimmt. Er nimmt wieder einen «Urstoff» an, überdies einen einzigen, die Luft: «Durch Verdünnung wird sie Feuer, durch Verdichtung dagegen Wind, dann Wolken, bei noch weiterer Verdichtung Wasser, dann Erde, dann Steine, alles andere aber entsteht aus diesem.»
Anaximenes entgeht Anaximanders Kritik dadurch, daß er den Urstoff qualitativ nur minimal bestimmt. Er spricht der Luft keine der bekannten Grundeigenschaften zu, sondern erklärt sie insgesamt durch die Grundprozesse der Verdichtung und Verdünnung. Daß er trotzdem die Luft privilegiert, dürfte sich einer etwas gewagten Verallgemeinerung verdanken: Wie die Atemluft das lebensstiftende Prinzip für den Menschen sei, so verhalte es sich mit der Luft überhaupt im Blick auf den gesamten Kosmos.
Xenophanes’ Religionskritik
Xenophanes (geb. um 570 v. Chr. in Kolophon), ein Wandersänger («Rhapsode»), der durch die griechischen Länder, vor allem Sizilien und Unteritalien, zieht, knüpft an die Naturphilosophie der drei Denker aus Milet an. «Alles, was entsteht, ist Erde und Wasser.» Er stützt sich dabei auf scharfsinnige Beobachtungen: auf den Fund steinerner Abdrücke von Meerestieren und Muscheln im Landesinneren und auf das in Höhlen herabtropfende Wasser.
Darüber hinaus relativiert er gewisse Wahrnehmungsurteile und verbindet generelle Zweifel an der Erkenntnis – es gibt nur Annahmen, nicht Wissen – mit dem Gedanken eines allmählichen Erkenntnisfortschritts. Vor allem entfaltet er eine zweite Gestalt der Philosophie: die Religionskritik und die philosophische Theologie. Seiner Originalität und Radikalität wegen gehört er hier zu den Großen.
Religionskritik klingt schon dort an, wo Xenophanes den Regenbogen zu einer natürlichen Erscheinung erklärt. Im überlieferten Mythos ist der Regenbogen die Erscheinung einer Göttin namens Iris. Xenophanes dagegen sagt: «Und was sie Iris nennen, auch das ist nur eine Wolke, purpurn und hellrot und gelbgrün anzuschauen.» Darin treten zwei Gestalten der Philosophie zutage: das Bemühen um eine «rationale» Erklärung der Natur und die Religionskritik, da die Gottheit nicht länger als eine sichtbare Naturerscheinung gilt.
Noch schärfere Kritik übt Xenophanes, wenn er die überlieferten Götter als durch und durch ungöttlich entlarvt, etwa als Projektionen der verschiedenen Völker – «Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und schwarz, die Thraker, blauäugig und blond» – oder als schlechte Vorbilder: «Alles haben den Göttern Homer und Hesiod angehängt, was bei den Menschen Schimpf und Tadel verdient: Stehlen und Ehebrechen und gegenseitiges Betrügen.» Und vor allem demaskiert er die Götter als gattungsbezogene Projektionen: «Wenn aber die Rinder, Pferde und Löwen Hände hätten und mit den Händen malen könnten und Werke schafften wie die Menschen, dann würden die Pferde pferdeähnliche und die Rinder rinderähnliche Bilder der Götter malen und Körper bilden von der Gestalt, die sie selber haben.»
Xenophanes bleibt bei dieser (negativen) Religionskritik aber nicht stehen. Aus dem Widerspruch zur überlieferten Volksreligion gewinnt er einen neuen, «aufgeklärten» Gottesbegriff: «ein einziger Gott, unter Göttern und Menschen der Größte, weder an Gestalt den Sterblichen ähnlich noch an Gedanken». In dem hier vertretenen Monotheismus tauchen schon vier der entscheidenden Elemente eines philosophischen Gottesbegriffs auf: daß Gott ein einziger ist, daß er sich durch einen «absoluten» Superlativ auszeichnet – er ist der Größte, überdies (ganz) Andere –, daß er Geist und, schließlich, Urheber von allem ist: «Ohne Mühe bringt er alles in Gang durch seines Geistes Denkkraft.»
Pythagoras
Zuverlässige Zeugnisse über Pythagoras sind rar; Schriften hat er nicht hinterlassen. Einigen Forschern gilt er nur als ein religiöser Magier und Prophet, andere halten ihn für einen bedeutenden Philosophen, Mathematiker und Musiktheoretiker, während ihm sein Zeitgenosse Heraklit «Vielwisserei» und «kunstvolle Gaunerei» vorwirft. Seine Schüler halten ihn für den vollkommenen Weisen und zugleich für eine Verkörperung Apollons, weshalb sie ihm göttliche Verehrung zollen. Folgendes darf als gesichert gelten:
Um 572 auf der Insel Samos, unweit von Milet, geboren, wandert Pythagoras nach 530 v. Chr. aus politischen Gründen nach Unteritalien aus. Hier gründet er, der sich als erster philosophos nennt, eine auch Frauen zulassende ordensähnliche Gemeinschaft, die erheblichen politischen Einfluß erlangt; er stirbt um 480 v. Chr.
Unter dem Leitsatz «Folge Gott» suchen die «Pythagoreer» einen Nachvollzug der göttlichen Weltordnung, indem sie die wissenschaftlich-philosophische Erkenntnis mit einer moralisch-religiösen Lebensführung verbinden, zu der eine Gütergemeinschaft, die Pflege einer bedingungslosen Freundschaft und zahlreiche Verhaltens- und Speisetabus gehören. Zugang zu Pythagoras’ Lehren erhält nur, wer sich einer initiationsartigen Vorbereitung und einer durch rituelle Vorschriften geprägten Lebensführung unterwirft. In dieser Einheit von (theoretischer) Erkenntnis und (moralisch) gutem Leben liegt nun eine dritte Gestalt: die Philosophie als Bildungs- und Lebensprogramm. Dessen charismatisches Vorbild, Pythagoras, dürfte in sich die Eigenschaften eines Gurus und eines Gelehrten vereint haben.
Wahrscheinlich von Orphikern (den Anhängern des mythischen Sängers Orpheus, der zuerst die Unerbittlichkeit des Todes besiegt haben soll) oder durch Eingeweihte der Eleusinischen Mysterien, vielleicht aber auch durch Ägypter beeinflußt, lehrt Pythagoras die den Griechen weitgehend fremden Gedanken von der Unsterblichkeit der Seele, der Seelenwanderung und einer Zusammengehörigkeit alles Beseelten. Er selber soll sich an frühere Leben erinnert haben. Weil die Seele auch in einem Tier wiedergeboren werden könne, ist den Pythagoreern Fleischverzehr verboten («Vegetarismus»).
Pythagoras nimmt eine grenzenlose Leere (kenon) an, deren Einatmung durch den Himmel zur Weltentstehung geführt habe. Für Pythagoras und seine Schule gilt die Summe der ersten vier Zahlen, die Zehn, als vollkommene Zahl: die Heilige Vierheit (tetraktys). Dargestellt wird sie als ein gleichseitiges Dreieck, dessen Seiten je eine Vier bilden. Berühmt ist Pythagoras aber vor allem für die Erkenntnis der Zahlenverhältnisse in den musikalischen Grundintervallen: der Oktave (1:2), der Quinte (2:3) und der Quarte (3:4).
Die Übertragung dieser Proportionen auf die gesamte Natur, insbesondere die Welt der Gestirne, führt zu einer «kosmologischen Zahlenlehre». Ihr zufolge ist die Welt nach Zahlenverhältnissen geordnet. Und weil große Körper beim Fallen Geräusche erzeugen und die Geschwindigkeiten der riesigen, folglich lauten Gestirnskörper den musikalischen Grundintervallen entsprechen, erzeugt ihre Kreisbewegung einen harmonischen Klang: die Sphärenharmonie. Als ein unveränderlicher Hintergrundklang läßt sie sich freilich nur vom «göttlichen» Pythagoras wahrnehmen und nicht vom Durchschnittsmenschen.
Der über fast zwei Jahrhunderte (530–350 v. Chr.) höchst einflußreichen Gemeinschaft der Pythagoreer gehören sowohl Philosophen als auch Mathematiker und Naturforscher an, ferner Ärzte, Musiktheoretiker und Gesetzgeber, selbst Bildhauer, Dichter und berühmte Athleten. Vom bedeutendsten der jüngeren Pythagoreer, Philolaos von Kroton (um 470–390 v. Chr.), dürfte Platon einen Großteil seiner Naturphilosophie für den Dialog Timaios übernommen haben. Philolaos gibt übrigens das geozentrische Weltbild auf und stellt in den Mittelpunkt des Kosmos ein Zentralfeuer, um das alle Himmelskörper kreisen.
Heraklit
Heraklit (geb. um 540 v. Chr.) entstammt einer vornehmen Familie aus Ephesus, ebenfalls Ionien. In seinen Texten, oft einem einzigen Satz, tritt eine eigene, vierte Gestalt des Philosophierens zutage: der wohlkomponierte, aphoristisch zugespitzte Sinnspruch. Weil er einem Orakelspruch ähnelt, heißt ihr Verfasser «der Dunk-le» und «der in Rätseln Sprechende». Wie die Naturphilosophen, so fragt auch Heraklit nach der allgemeinen Gesetzmäßigkeit der Welt. Er nennt ihr Grund-Gesetz, die Welt-Formel: Logos. Dieser betrifft nicht mehr bloß die außermenschliche Natur, sondern auch den Menschen, sein persönliches und soziales Leben. Schon Heraklit öffnet die Kosmologie zur Ethik und Politischen Philo-sophie.
Von seinem Grund-Gesetz glaubt er, daß die meisten es «nicht verstehen, auch wenn sie es vernommen; sie sind wie Taube. Das Sprichwort bezeugt’s ihnen: Anwesend sind sie abwesend.» Dieser Spruch besagt zweierlei: daß die Gesetzmäßigkeit im Leben von jedermann gegenwärtig («anwesend») ist, sich aber nicht an der Oberfläche («abwesend») zeigt. Denn: «Die Natur (hier als die Gesetzmäßigkeit oder das Wesen der Dinge verstanden) pflegt sich zu verbergen.» Und «worauf sie täglich stoßen, ist ihnen fremd».
Heraklit entfaltet die allgemeine Gesetzmäßigkeit («aus allem eines und aus einem alles») unter vier Gesichtspunkten: (1) Es gibt einen Urstoff, der aber nicht in Wasser (Thales) oder Luft (Anaximenes), sondern in einem «ewig lebendigen Feuer», modern gesprochen: in Energie, besteht. (2) Aus dem steten Entflammen und Erlöschen des Feuers ergibt sich die Dynamik der Welt. (3) Heraklit benennt Gegensatzpaare, die sich trotz aller Verschiedenartigkeit durch zwei Gemeinsamkeiten auszeichnen. Tag und Nacht, Winter und Sommer, Krieg und Frieden, Leben und Tod, Wachen und Schlafen, feucht und trocken, hinauf und hinab, Abfall und Gold – in all diesen Fällen treten die Elemente nicht selbständig auf, sondern verweisen wie gegensätzliche Pole aufeinander. Und bei ihrer Wechselwirkung – Heraklit sagt «Krieg» und nennt ihn «aller Dinge Vater, aller Dinge König» – handelt es sich um einen natürlichen Vorgang, der die Gegensatzpaare zusammenhält.
(4) Der berühmte Satz «Alles fließt» schließlich stammt zwar nicht von Heraklit; andere Flußfragmente, etwa «Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen», sind aber als echt anzusehen. Heraklit sieht im Fluß sowohl «naturphilosophisch» und zugleich «ontologisch» ein Sinnbild für die stete Veränderung in der gesamten Wirklichkeit als auch «erkenntnistheoretisch» ein Bild für die Art und Weise, wie man selbst im Veränderlichen etwas, das sich gleich bleibt, denken und erkennen kann. Nach Heraklit unterliegt alles einer Gesetzmäßigkeit der Veränderung.
Parmenides und Zenon
Parmenides (geb. um 540 v. Chr.) lernt in Unteritalien die Lehren von Xenophanes und Pythagoras kennen. Für seine Heimatstadt Elea war er ein hervorragender Gesetzgeber. In der Philosophie begründet er die Lehre dessen, was ist (griech. on): die Lehre vom Seienden oder Ontologie. Die provokative Gestalt, die er der Ontologie gibt – das Seiende ist ungeworden und unvergänglich, eines und einheitlich, unveränderlich und vollkommen–, beeinflußt die gesamte folgende Philosophie, etwa Platons Theorie der Ideen, Aristoteles’ Gottesbegriff und den Begriff, den die Atomisten Leukipp und Demokrit für die kleinsten Bestandteile der Wirklichkeit entwickeln.
Wie Xenophanes und Heraklit, so prüft auch Parmenides die Möglichkeit menschlicher Erkenntnis. Er unterscheidet dabei streng zwischen der durch Sinne vermittelten Erfahrung und der durch den Logos erschlossenen Erkenntnis. Zusätzlich behauptet er, nur der Logos erlaube eine wahre Erkenntnis und diese betreffe ausschließlich das unvergängliche Seiende. Diese Zusatzbehauptung, Parmenides’ gesteigerte Provokation, gibt dem entsprechenden Text, einem Lehrgedicht, die Gliederung vor: Der erste Teil handelt über Wahrheit und das Seiende («denn dasselbe ist Denken und Sein»), der zweite Teil von den «trügerischen Meinungen der Sterblichen». Und im Wissen um das Ärgernis dieser Lehre stellt Parmenides beiden Teilen eine «Vorrede» voran, die seine Lehre als eine göttliche, von der Vernunft zu prüfende Botschaft darbietet.
Sinn und Tragweite dieser Lehre sind umstritten. (1) Die ontologische Frage lautet: Bestreitet Parmenides die Wirklichkeit der Erfahrungswelt? Oder vollzieht er, «bescheidener», den bei Thales erst angedeuteten «metaphysischen Schnitt» und unterscheidet scharf zwischen der erfahrbaren Welt und ihrem nicht mehr erfahrbaren Grund? (2) Die erkenntnistheoretische Frage: Vertritt Parmenides einen extremen Rationalismus, der nur dem vollständig erfahrungsfreien Denken die Möglichkeit einer wahren Erkenntnis zubilligt? Oder behauptet er, «bescheidener», zur wahren Erkenntnis gehöre ein Moment des Unveränderlichen, und ausschließlich dieses Moment stehe für die Wahrheit der Erkenntnis ein? Da dieses Moment die gewöhnliche Wirklichkeit übersteigt (lat. transcendere) und zugleich die Bedingung für ihre Erkennbarkeit darstellt (Kant wird «transzendental» sagen), stößt Parmenides auf eine Wirklichkeit, bei der einem im wörtlichen Sinn Hören und Sehen vergeht: Er entdeckt eine transzendente und zugleich transzendentale Wirklichkeit.
Für das bescheidene Verständnis spricht der Umstand, daß Parmenides die alltägliche Weltsicht: die Rede von Entstehen und Vergehen, von Vielheit und Verschiedenheit, zwar als trügerisch verwirft, sich aber trotzdem mit ihr befaßt. Im zweiten Teil sieht er nämlich die Welt aus zwei Elementen – Licht und Nacht – aufgebaut, erklärt das Entstehen der Dinge aus einer Mischung beider und billigt auch dieser «Erklärung», so scheint es, eine gewisse Gültigkeit zu, allerdings nicht den hohen Anspruch der Wahrheit.
Um Parmenides’ provokative Lehre zu verteidigen und den Spott über sie seinerseits zu verspotten, hat Zenon (ca. 495–445 v. Chr.) berühmte Paradoxien aufgestellt. In ihnen tritt eine weitere Gestalt des Philosophierens zutage: ein konstruktiver Scharfsinn, verbunden mit einem pädagogischen Genie. Denn bei den Paradoxien handelt es sich um Widersprüche, in die sich der Alltagsverstand verstrickt und die ihn sowohl zum Nachdenken als auch zur Selbstbescheidung auffordern.
Nach einer von Zenons Paradoxien kann der schnelle Achill die langsame Schildkröte nie einholen. Denn «erst einmal muß der Verfolger dahin kommen, von wo aus der Verfolgte gestartet ist, so daß der Langsame immer etwas Vorsprung haben muß». Angenommen, Achill läuft hundertmal so schnell wie die Schildkröte und diese hat einen Vorsprung von hundert Metern, so gilt folgendes: Gelangt Achill zu der Stelle, an der die Schildkröte war, so hat diese sich um einen Meter weiterbewegt. Während Achill zu dieser Stelle läuft, bewegt sich die Schildkröte erneut, jetzt einen Zentimeter, weiter, so daß ihr Vorsprung zwar immer kleiner wird, aber stets gegeben bleibt.
Zenon macht damit auf die Schwierigkeit aufmerksam, ein räumliches Kontinuum zu begreifen. Die analoge Schwierigkeit eines zeitlichen Kontinuums erläutert seine Paradoxie, daß ein schnell fliegender Pfeil in Wahrheit ruhe, denn «was sich bewegt, bewegt sich weder an dem Ort, an dem es ist, noch an dem es nicht ist». Zenon geht wohl davon aus, daß der Zeitverlauf aus einer Reihe von unendlich vielen Zeitpunkten, von jeweils kurzem Jetzt, besteht, so daß der Pfeil, jeweils auf einen einzelnen Zeitpunkt festgenagelt, sich nicht zu bewegen vermag.
Aristoteles löst die Paradoxien, indem er zwei Bedeutungen von «unendlich» – unendliche Ausdehnung und unendliche Teilbarkeit – unterscheidet, so daß eine der Ausdehnung nach endliche, der Teilbarkeit nach aber unendliche (Raum- oder Zeit-)Strecke in endlicher Zeit durchlaufen werden kann.
Empedokles, Anaxagoras und die Atomisten
Im Gegensatz zu Zenon wollen Empedokles (um 495–435 v. Chr.), Anaxagoras (um 500–428 v. Chr.) und die Atomisten Leukipp (Anfang 5. Jh.) und Demokrit (um 460–um 370 v. Chr.) «die Phänomene retten». Sie versuchen, Parmenides’ provokative Ontologie und Erkenntnistheorie mit der Erfahrung in Einklang zu bringen.
Obwohl Empedokles selbst aus der Aristokratie stammt, soll er sich für demokratische Verhältnisse eingesetzt haben. Auch soll er den später berühmten Redner und Sophisten Gorgias unterrichtet haben und überdies selbst ein herausragender Redner gewesen sein; nach Aristoteles ist er sogar der Erfinder der Rhetorik. Bekannter ist er aber für seine Lehre, der Kosmos bestehe aus vier unveränderlichen Urstoffen, jetzt «Elemente» genannt: Feuer, Luft, Erde und Wasser; nur ihr Mischungsverhältnis ändere sich: Geburt gibt es von keinem einzigen unter allen sterblichen Dingen, auch nicht ein Ende im verwünschten Tod, sondern nur Mischung und Austausch von dem, was gemischt ist: Geburt wird nur bei den Menschen als üblicher Name dafür gebraucht. Bei den Atomisten dagegen wird das eine Seiende zu einer unzählbaren, aber nicht unendlichen Menge kleinster, nicht mehr teilbarer Dinge, den nicht unmittelbar beobachtbaren, unvergänglichen Atomen (atomos: nicht teilbar), die sich im leeren Raum bewegen. Seele und Geist bestehen aus den besonders leichten, fast immateriellen und besonders beweglichen Feueratomen. (Auch Anaxagoras’ bewegende Kraft, die Vernunft: nous, besteht aus feinster Materie.) Und das Sehen kommt durch feine Abbilder zustande, die die Dinge ausstrahlen und die auf Ausströmungen des Auges treffen.
Die Atomtheorie stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur modernen Naturwissenschaft dar. Schon Demokrit scheint um eine Schwierigkeit des Atombegriffs gewußt zu haben: daß die Atome als ausgedehnt und doch unteilbar gelten. Er versucht sie durch die Unterscheidung einer mathematischen von der physikalischen Betrachtung zu lösen. In Texten zur Ethik setzt sich Demokrit für Besonnenheit und für moralische Selbstachtung ein («Vor sich selbst vor allem muß sich schämen, wer Schlechtes tut»), für Eintracht der Bürger, für Unterstützung der Armen durch die Reichen und für die Demokratie, da sie Freiheit gewährleiste.
Sophisten
In den Sophisten zeigt sich erneut ein anderer Typ des Philosophen: der soziale Aufklärer, der hier zugleich ein Gelehrter und kritischer Intellektueller ist. Der Sophist stammt nicht mehr wie die meisten älteren Philosophen und noch Platon aus der Aristokratie und bietet deshalb seine Dienste gegen Honorar an. Als professioneller Wanderlehrer unterrichtet er die Söhne vor allem der Oberschicht in der Kunstfertigkeit, ihre Interessen und Meinungen in den Organen der Demokratie, der Volksversammlung und vor Gericht, erfolgreich zu vertreten; denn einen Juristenstand (Anwälte) gibt es noch nicht. In Athen Fremde ohne Bürgerrecht, werden die Sophisten oft mit Mißtrauen und Geringschätzung betrachtet. Andererseits werden nicht wenige berühmt, überdies reich.
Unter dem Einfluß ihres entschiedenen Gegners, Platons, aber auch durch die Komödie, namentlich Aristophanes’ Wolken, gelten die Sophisten als Gefahr für die Gesellschaft: als Zerstörer ihrer Moral und als Meister der rhetorischen Täuschung sowie einer Disputierkunst, mit der sich alles beweisen und widerlegen läßt, als «Händler mit Scheinwissen» (Aristoteles). Tatsächlich verdankt die Philosophie ihnen thematisch eine entschiedene Wende zum Menschen, weiterhin ein Interesse für Sprache und Sprachphilosophie und allgemein eine Haltung der Aufklärung, die nichts als wahr anerkennt, was sie nicht selbst geprüft hat.
Auf die Sophisten gehen mindestens fünf Neuerungen zurück. Als erstes stellen sie sich der Herausforderung ihrer Zeit, sozialen und politischen Strukturveränderungen, und werfen ihretwegen neue Fragen auf. Stand bisher weitgehend der Kosmos im Mittelpunkt, so ist es jetzt der Mensch: sein Reden und Handeln, sein Gemeinwesen und die Legitimation politischer Macht, nicht zuletzt seine Befähigung zur Erkenntnis.
Nach Cicero hat Sokrates «als erster die Philosophie vom Himmel heruntergerufen, sie in den Städten angesiedelt, sie sogar in die Häuser hineingeführt und sie gezwungen, nach dem Leben, den Sitten, dem Guten und Schlechten zu fragen». In Wahrheit verdanken wir die thematische Wende – nach Ansätzen bei Heraklit – den Sophisten. Auch Sokrates steht im Zusammenhang ihrer Aufklärungsbewegung, die die Philosophie aus einer engen, oft nach außen verschlossenen Genossenschaft auf den öffentlichen Markt führt.
Als zweites entwickeln die Sophisten ein neues Verhältnis zur Sprache. Sie entdecken den «agonalen», auf den Sieg der eigenen Meinung ausgerichteten Charakter der Rede. Für diese Seite, die Sprache als ein Machtinstrument, entwickeln sie eine Kunst der Rhetorik und der Argumentation. Dabei interessieren sie sich – drittens – für die Struktur und das «Wesen» der Sprache. Sie betreiben Sprachphilosophie, fragen beispielsweise, ob den Wörtern ihre Bedeutung von Natur aus (physei) zukommt oder durch Konvention (nomō): aus Gewohnheit und Vereinbarung.
Indem sie für die Verbindlichkeiten des Zusammenlebens dieselbe Frage aufwerfen, formulieren sie – viertens – die entscheidende Alternative im Nachdenken über Moral und Recht: Gibt es Moral und Recht von Natur aus («Naturrecht»), so daß sie allgemein: für alle Menschen und alle Zeiten, gelten, oder verdanken sie sich nur Konventionen, was auf einen moralischen Relativismus und Skeptizismus hinausläuft? Für die erste Auffassung spricht, daß Moral und Recht das Gemeinwohl und die Einigkeit eines Staates (polis) schützen, für die zweite Auffassung, daß man sich über moralisch-politische Ansichten streitet, daß Demokratien ihre überlieferten Gesetze ändern und andere Völker andere Sitten haben.
Nach dem bedeutendsten Sophisten, Protagoras (481–411 v. Chr.), hat der Mensch, ein Mängelwesen, eine soziale und sittliche Naturanlage. Gorgias – er soll 109 Jahre alt geworden sein (483–374 v. Chr.) – vertritt dagegen ebenso wie Sokrates’ Zeitgenossen Thrasymachos und Kallikles das Recht des Stärkeren, während Antiphon und Hippias eine naturgemäße Gleichheit aller Menschen behaupten. Sie ziehen daraus aber nicht die demokratische Konsequenz rechtlicher und politischer Gleichheit.
Versteht man die Rhetorik als bloße Technik, so kann man den Hörer von beliebigen Ansichten zu überzeugen suchen. Einer derartigen Kunst des Redestreits (Eristik) entspricht ein Relativismus des Erkennens, der einen moralischen Relativismus und Skeptizismus ergänzt. Protagoras faßt ihn in dem berühmten Satz zusammen: «Aller Dinge Maß ist der Mensch, der seienden, wie sie sind; der nichtseienden, wie sie nicht sind.» Und darin liegt – fünftens – eine radikale Herausforderung an die künftigen Philosophen: Wie lassen sich trotz der sophistischen Einwände noch allgemeingültige Aussagen gewinnen?
Lektüreempfehlung: Für die Naturphilosophie (von Thales bis zu Demokrit und den Pythagoreern) lese man Aristoteles, Metaphysik, Buch I, Kap. 3–5, zu Parmenides die von seinem Lehrgedicht übriggebliebenen Fragmente; zu Zenons Paradoxien: Aristoteles, Physik, Buch VI, Kap. 9, zu den Sophisten ihre Fragmente in der Ausgabe von Th. Schirren/Th. Zinsmaier (Stuttgart 2003) und, freilich mit Vorbehalt, Platons Protagoras und Gorgias. Ein ausführliches Gesamtbild der Epoche vermitteln G. Kirk/J. Raven/M. Schofield, Die vorsokratischen Philosophen. Einführung, Texte und Kommentare (Stuttgart 1994).
II. Hoch-Zeit in Athen
Nach zwei Jahrhunderten vorsokratischen Denkens erlebt die Philosophie in Athen eine Blüte, die ihr weder vorher noch nachher je beschert wird. Auf das Vor- und Urbild abendländischer Philosophie, Sokrates, folgen zwei der überhaupt größten Denker der Menschheitsgeschichte: Platon und Aristoteles. Es ist ein Glücksfall der Geschichte, daß zunächst Platon bei Sokrates, später Aristoteles bei Platon in die Lehre geht und damit zweimal hintereinander ein überragender Denker bei einem überragenden Denker «studiert», um an dessen wohlüberlegten Ansichten sich die eigenen zu erarbeiten.
Ein berühmtes Bild von Raffael, die «Schule von Athen», stellt die zwei bedeutendsten «Kirchenväter der Philosophie» in den Mittelpunkt. Platon, den naturphilosophischen Dialog Timaios (Timeo) in der Linken, zeigt mit einem Finger der Rechten nachdrücklich nach oben, in den Himmel (der «Ideen»). Aristoteles trägt dagegen seine Ethik (Etica) und weist mit einer mäßigenden Gebärde zu Boden. In diesem Gegensatz spiegelt sich die beliebte Ansicht wider, auf den Philosophen der Ideenlehre, den «Idealisten» Platon, folge der Philosoph des Alltagsverstandes, der «Empirist» und «Realist» Aristoteles. Wahr ist, daß Aristoteles die Ideenlehre kritisiert; die Kritik fällt aber subtiler aus, als daß sie Platons Idealismus einen schlichten Realismus bzw. Empirismus entgegenstellte.
Sokrates
Sokrates (etwa 470–399 v. Chr.) selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen. Wir kennen ihn jedoch aus den Dialogen seines «Schülers» Platon, namentlich aus dessen «frühen Dialogen». Während er in Xenophons Erinnerungen an Sokrates (Memorabilia, um 370/360 v. Chr.) als ein tugendhafter, aber etwas biederer Bürger erscheint und der Komödiendichter Aristophanes ihn in den Wolken (423 v. Chr.) als Sophisten und atheistischen Naturphilosophen verspottet, ist er nach Platon der «trefflichste, weiseste und gerechteste Mann unter den damals Lebenden». Durch Platons Dialoge wird er zu einer «weltgeschichtlichen Person», die nach der Devise «Tugend ist Wissen» Philosophie und Leben zu einer vollkommenen Einheit führt.
Im Peloponnesischen Krieg nimmt Sokrates an drei Feldzügen teil; als Ratsmitglied zeichnet er sich durch mutiges Auftreten aus. Sein «Philosophieren auf dem Markt» trägt ihm aber die Anklage ein, die Jugend zu verderben und neue Gottheiten einzuführen, statt an die überlieferten Götter zu glauben. In Platons Apologie (Verteidigung) weist Sokrates die Anklage entschieden zurück. Getreu seinem Grundsatz, lieber Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun,weigert er sich aber – so Platons Dialog Kriton–, mit Hilfe der Freunde zu fliehen, und stirbt lieber durch den Schierlingsbecher.
Bis heute wird Sokrates für ein «gnadenlos bohrendes» Fragen bewundert, das die Ansichten der Gesprächspartner als nur vermeintliches Wissen entlarvt, ohne zu beanspruchen, es besser zu wissen: «Ich weiß, daß ich nichts weiß.» Sokrates’ Methode besteht in einer faszinierend geschickten Gesprächsführung: einer «Hebammenkunst», die den Partnern eine Wahrheit zu gebären hilft, um die sie nicht ausdrücklich wußten, die sie aber schon unbewußt in sich trugen («Lehre der Wiedererinnerung»: anamnēsis). Zu diesem Zweck verhält sich Sokrates wie ein «Zitterrochen» und «Zauberer», der seine Partner in Verwirrung stürzt, indem er sie in Widersprüche ihrer Ansichten über das Gute und Gerechte verwickelt.
Das Sokratische Gespräch besteht in einer Lebensprüfung mit dem Ziel, das Leben von Grund auf zu ändern: Aus einer Erschütterung der bislang vorherrschenden Wertvorstellungen sollen jene neuen Vorstellungen hervorgehen, die das Leben wahrhaft lebenswert machen. Im Euthyphron beispielsweise geht es um die Frömmigkeit: Sokrates, der soeben von der gegen ihn erhobenen Anklage, neue Götter zu erdichten, gehört hat, trifft Euthyphron auf dem Weg zum Gericht. Unter Berufung auf das, was sich frommt, will dieser seinen betagten Vater wegen fahrlässiger Tötung anklagen. Von Sokrates zur Rede gestellt, gelingt es ihm nicht, das Fromme und sein Gegenteil, das Ruchlose, überzeugend zu definieren. Deshalb bleibt Sokrates doppelt unmutig zurück: Euthyphron erhebt eine Anklage, bevor er weiß, ob sie nicht vielleicht ruchlos ist, und Sokrates hat für sich nichts erfahren, womit er die gegen ihn selbst erhobene Anklage auf Unfrömmigkeit abwehren könnte.
Platon
Vom Leben des so berühmten Philosophen haben wir nur spärliche Kenntnis: Platon (428/7–348/7 v. Chr.) stammt aus einer reichen aristokratischen Familie Athens und wird Sokrates’ «Schüler». Durch Kratylos lernt er Heraklits Denken kennen, später bei Studienreisen nach Ägypten und Unteritalien auch ägyptische Weisheit und Pythagoras’ Zahlenmetaphysik sowie durch Eukleides von Megara, zu dem er nach Sokrates’ Tod zieht, Parmenides’ Philosophie. Platon kann daher so gut wie das gesamte vorangehende Denken verarbeiten. Versuche, mit seiner Politischen Philosophie Einfluß auf den Herrscher von Syrakus zu gewinnen, scheitern. Auf einem Grundstück am Rande Athens gründet er seine Schule, die Akademie. Diese wird bald zu einem internationalen Treffpunkt von Wissenschaftlern und Philosophen: zu einem intellektuellen Mekka der Epoche mit einer kaum je wieder erreichten Einheit von Forschung und Lehre. Die Akademie besteht mit Unterbrechungen fast tausend Jahre, bis Kaiser Justinian sie 529 n. Chr. schließt.
Platons Schriften zählen zu den bekanntesten Werken nicht bloß der Philosophie, sondern der Weltliteratur. Dialoge wie Phaidon, Politeia (Der Staat) und Symposion (Das Gastmahl), aber auch die Apologie, Gorgias, Kratylos, Protagoras und Timaios haben den Rang von welthistorischen Texten, die von ihrer Entstehung an bis heute einen kaum zu unterschätzenden Einfluß auf die Bildung des menschlichen Geistes nehmen. Der Dialog Phaidon, die vielleicht größte Leistung griechischer Prosa, stellt Sokrates am letzten Lebenstag dar. Im Gespräch mit seinen Freunden, aber ohne Platon («Platon aber, glaube ich, war krank»), bestimmt Sokrates die Philosophie als Kunst, sterben zu lernen. Darin liegt keine Absage an das Leben, wohl aber zweierlei, einerseits eine Relativierung des bloßen «Überlebens» zugunsten des guten Lebens, verbunden mit dem Glauben an eine Art Vorsehung: daß dem Guten, weil die Gottheit ihn führt, letztlich kein Übel zustößt, andererseits der metaphysische Gedanke, daß man für die eigentliche Erkenntnis, die der Ideen, von allem Leiblichen absehen muß. In vier Argumenten («Beweisen») sucht Platon die Unsterblichkeit der Seele glaubhaft zu machen. Das erste Argument beruft sich auf das Entstehen aller Dinge aus ihrem Gegenteil (die Seelen der Lebenden gehen aus denen der Toten hervor, deren Seelen also «erhalten» bleiben). Das zweite Argument behauptet, Erkenntnis sei Wiedererinnerung, so daß es ein Leben vor dem jetzigen Leben geben müsse. Das dritte Argument beruft sich auf die Verwandtschaft der Seele mit dem «Göttlichen, Unsterblichen, Vernünftigen», das vierte Argument auf die «Idee des Lebens»: Die Seele, die das Leben ist, könne unmöglich das Gegenteil ihrer selbst, den Tod, annehmen.
Platons Dialog Symposion (Gastmahl, Gelage) bildet das «Gegenstück» zum Dialog Phaidon mit der dort vertretenen Kunst, sterben zu lernen. In dramatisch sich steigernden Reden wird der Gott Eros von verschiedenen Sprechern gefeiert: von Phaidros als der älteste Gott, der im Menschen das Beste hervorbringt; von Eryximachos als das universale Prinzip der Natur, das Gegensätzliches vereinigt; von Aristophanes als die tiefste Sehnsucht des Menschen nach seiner verlorenen anderen Hälfte und von Agathon als der jüngste, in der Seele entspringende Gott, aus dessen Schönheit und Güte alles Gute bei Göttern und Menschen entsteht. Diesen Lobreden auf den Eros stellt Sokrates die «Wahrheit» entgegen, in die er durch die Seherin Diotima eingeweiht sei: Als daimonisches Zwischenwesen zwischen Gott und Menschen, an Aphrodites Geburtstag vom «wagemutigen» Poros und der «bedürftigen» Penia gezeugt, steht Eros nicht selber für das Schöne, wohl aber die Liebe zum Schönen und Guten. Dabei ist das Schöne weniger ästhetisch als moralisch zu verstehen; gemeint ist, was Wohlgefallen erregt und Zustimmung findet: das rundum und in sich Gute.
Lern-Prozeß: Dialoge. Während die Philosophen vor Platon ihre Einsichten in Sprüchen und Lehrgedichten «verkünden», entfaltet Platon sie in kommunikativen Denk-Prozessen: in Dialogen. Diese sind weder (sophistische) Rededuelle, noch belaufen sie sich auf eine Zustimmungs-(«Konsens-»)Theorie der Wahrheit. Denn der Sokrates, den Platon in seinen Dialogen als Protagonisten auftreten läßt, will «lieber mit allen anderen Menschen uneins als mit sich selbst in Widerspruch sein». Es sind Argumentations-Dramen, die so meisterhaft gestaltet werden, daß man oft nicht einmal Philosoph sein muß, um einer Bühnenaufführung «atemlos» zu folgen. Unübertrefflich an Platons Dialogen ist das Ineinandergreifen verschiedener Ebenen, die jeweils eine eigene Art von Einsicht vermitteln: (I) Die Szenerie des Dialogs verbindet sich mit (II) dem Drama der Argumente und (III) dem Charakter der argumentierenden Personen. Hinzu kommen gelegentlich (IV) eingestreute Lehrvorträge und (V) Gleichnisse («Mythen»), (VI) Verweise auf vorläufig nicht Erklärtes oder nicht Erklärbares und (VII) die Erläuterung der Dialogform:
(I) In einer Rahmenhandlung erhält das jeweilige Thema einen «Sitz im Leben». Zusätzlich kann eine philosophische Aussage vermittelt werden: Daß zu Beginn des Staates die Freunde Sokrates «zum Gespräch zwingen», greift einem Gesichtspunkt des Höhlengleichnisses vor: daß Philosophen lieber denken als herrschen.
(II) Die verhandelten Sachfragen bestehen im Fall der «frühen Dialoge» in einer Definition grundlegender Begriffe: Was ist bzw. was meinst du mit Tapferkeit (Laches), Besonnenheit (Charmides), Frömmigkeit (Euthyphron), Freundschaft (Lysis)? Was ist Rhetorik, und wozu dient sie (Protagoras, Gorgias)? Die «mittleren Dialoge» erörtern menschliche Grundgegebenheiten: die Liebe bzw. Eros (Symposion/Gastmahl, auch Phaidros und Lysis) und den Tod (Phaidon), die Sprache (Kratylos) und die Gerechtigkeit in ihrer personalen und politischen Dimension (Politeia/Der Staat). Die «späten Dialoge» widmen sich der Ontologie (Parmenides), der Dialektik (Sophistes), der Mathematik und der Kosmologie (Theaitetos, Timaios) sowie erneut dem Staat (Politikos/Der Staatsmann, Nomoi/Gesetze). In den frühen (auch Menon und Protagoras)und mittleren Dialogen fordert der Gesprächsführer, Sokrates, seine Gesprächspartner auf, eine allgemeine Aussage zu wagen, beispielsweise «Gerechtigkeit ist: jedem das Seine zukommen zu lassen und den Freunden Gutes, den Feinden Böses zu tun». Auf die Antwort folgt Sokrates’ kritische Prüfung. In ihrem Verlauf sieht sich der Antwortende zu Zugeständnissen gezwungen, die seiner ersten Aussage widersprechen. Der Dialog wird zum Widerlegungsgespräch (er ist «elenktisch»), das als planvoll herbeigeführte Erschütterung eines nur vermeintlichen Wissens beginnt. Die frühen Dialoge enden sogar damit; ohne positives Ergebnis, sind sie «aporetisch».