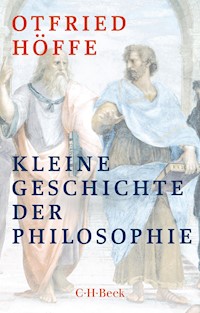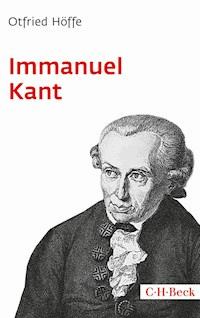16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Weisheit ist ein schillernder Begriff: Wir alle verbinden damit etwas besonders Wertvolles, wir schätzen weise Menschen und weise Entscheidungen, aber gleichzeitig spielt Weisheit in unserem Leben kaum eine Rolle. In seinem neuen Buch bringt uns Otfried Höffe die hohe Kunst der Weisheit wieder nahe. Er zeigt uns, dass sie kein unerreichbares Ideal ist, sondern ein Maßstab für das gute Leben, den wir wieder entdecken sollten. Weisheit beschreibt eine umfassende Daseinsorientierung. In Streifzügen durch die Geschichte des philosophischen Nachdenkens, die Glücksforschungen der Psychologie und die außereuropäische Weisheitsliteratur erkundet Otfried Höffe ihre verschiedenen Gestalten. Dabei geht es insbesondere um die Lebensklugheit – die Fähigkeit, das Leben als Ganzes zu begreifen und sich den Fragen zu widmen, die Menschen tief im Innersten bewegen. Es geht um die stoische Fähigkeit, selbst die schlimmsten Widrigkeiten in Gelassenheit zu ertragen und seine Eigenständigkeit und Freiheit zu bewahren. Ebenso geht es um die Weisheit, die darin liegt, ein bestimmtes Metier oder Handwerk auf herausragende Weise zu beherrschen. Und weil nicht bloß die Frage nach dem Wesen der Weisheit, sondern auch die Suche nach Wegen, sie zu erwerben, ein allgemeinmenschliches Ziel ist, geht es auch stets darum, wie und wie weit man Weisheit lernen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Otfried Höffe
Die hohe Kunst der Weisheit
Kleine Philosophie der Lebensklugheit
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Eine Höchstform des Wissens und Könnens: Zur Einführung
1. Was Weisheit bedeutet: Vier Verständnisse
Die Grundbedeutung der Weisheit: Sein Metier beherrschen
Lebensweisheit
Klugheit
Philosophie als Weisheit
2. Lebensweisheit als Lebenskunst
«Ethik» ist mehrdeutig
Die hohe Kunst der Lebensführung
Worin besteht das Glück unseres Lebens?
Welche Lebensweisen sind glückstauglich?
Zum Beispiel: Altersweisheit
Wie lässt sich Lebensweisheit lehren?
3. Die Lebensweisheit der Moral
Was ist Moral?
Das Prinzip der Freiheit: Autonomie
Der kategorische Imperativ
Lügenverbot und falsches Versprechen
Moralische Lebensweisheiten
4. Weisheit in der Psychologie
Vom Expertenwissen zur Spiritualität
Lässt sich Weisheit empirisch abfragen und messen?
5. Weltweisheitserbe
Ein Zeugnis der Weltweisheit: Tokios Schrein der Vier Weisen
Weisheit im Alten Orient
Indische Weisheit
Chinesische Weisheit
Japanische Weisheit
Koreanische Weisheit
Weisheit im Alten und Neuen Testament
Islamische Weisheiten
Eine exemplarische Weltweisheit: Die Goldene Regel
Zum Schluss: Können wir also die hohe Kunst der Weisheit lernen?
Anmerkungen
Personenregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Eine Höchstform des Wissens und Könnens: Zur Einführung
Von einem Philosophen erwartet man, einleitend seinen Gegenstand zu bestimmen. Die Erwartung ist dort umso berechtigter, wo der Gegenstand, hier die Weisheit, hochgeschätzt wird, aber unklar bleibt, was genau denn so schätzenswert sei. Hilfsweise kann man fragen, welche Menschen wir denn für weise halten. Je nach persönlicher Vorliebe wird man auf den Dalai Lama, auf Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela, vielleicht auch auf Papst Franziskus hinweisen. Weise nennen wir nämlich Vorbilder für unser Leben oder Vorzeigepersonen, gelegentlich freilich nur die fachkundigen Mitglieder eines wirtschaftspolitischen Beratungsgremiums, dem man den Beinamen der Fünf Weisen gegeben hat.
Auch wenn letztere Bezeichnung zu schmeichelhaft klingt, ist sie, werden wir sehen, prinzipiell betrachtet nicht unzulässig. Darin liegt auch ein Grund, warum die einleitende Bestimmung nicht leicht vorzunehmen ist: Der Gegenstand der Weisheit ist mehrdeutig; er kennzeichnet sowohl Vorzeigepersonen als auch Fachleute.
Beginnen wir mit den humanen Vorbildern: Weiß man, worin deren Weisheit besteht, weiß man es zumindest annäherungsweise, obwohl die erwähnten Personen doch auf sehr unterschiedliche Weise menschlich herausragen? Zur Beantwortung können Philosophen helfen. Sie können an ein antikes Ideal erinnern, das gegenüber dem Hinweis auf heutige Personen zwei Vorteile hat. Anders als diese wird das Ideal nicht erst für eine kurze Zeit anerkannt. Es dient nämlich über viele Jahrhunderte, von der griechischen Antike bis weit in die Neuzeit, als Vorbild. Gemeint ist der stoische Weise. Zum anderen ist dieses Ideal des Problems der unterschiedlichen Persönlichkeiten enthoben, denn es hat einen einzigen Gehalt: Nach dem stoischen Ideal ist weise, wer die Unbilden des Lebens in Gelassenheit, sogar in Heiterkeit, wer sie mit «stoischem Gleichmut» zu ertragen vermag. Diese Fähigkeit, selbst in den schlimmsten Widrigkeiten des Lebens seine Eigenständigkeit und Freiheit zu bewahren, wird ohne Frage auch heute noch als vorbildlich angesehen. Allerdings hält man sie für eine hohe – beinahe zu hohe, übermenschliche – Charaktereigenschaft.
Selbst wenn man den stoischen Gleichmut bescheidener, nicht mehr als ein so gut wie unerreichbares, sondern als ein menschenmögliches Ideal versteht, deckt er das Gesamtbild eines Weisen nicht ab. Da es nicht unberechtigt ist, den Dalai Lama, Gandhi und Mandela sowie Papst Franziskus als weise einzuschätzen, gehört zum heutigen Verständnis der Weisheit mehr als nur die Fähigkeit, alle Unbilden des Lebens zu meistern. Es braucht noch andere Vorzüge, insbesondere eine vorbildliche Beziehung zu den Mitmenschen, auch wenn dieser Bezug, zeigen die erwähnten Vorbilder, unterschiedlich ausfallen darf. Viele Menschen dürften den sozialen und politischen Bezug sogar für wichtiger halten als die im stoischen Gleichmut betonte Vorbildlichkeit, die bloß auf die eigene Person bezogen ist.
Aus diesen Gründen holt dieser Essay weiter aus. Er beginnt mit einer – selbstverständlich vorläufigen – Bestimmung, mit einem Definitionsvorschlag, der wegen der erwähnten Mehrdeutigkeit nicht zu eng ausfallen darf: Unter Weisheit verstehen wir eine nicht mehr zu überbietende Form von Wissen und Können. Bei beiden, beim Wissen um Tatbestände auf der einen Seite, einem «Knowing-that» oder Wissen-dass, und beim Beherrschen von Fertigkeiten auf der anderen Seite, einem «Know-how», ist jene Höchstform gemeint, für die man mit unterschiedlichen Bedeutungen zu rechnen hat. Bei der einen Bedeutung, bezeichnen wir sie als Expertenweisheit, geht es um die Höchstform eines abgrenzbaren Sach- und Fachbereichs wie etwa eines Handwerks oder der Medizin, der Ingenieurwissenschaften oder der genannten Ökonomen. Bei der anderen Bedeutung, der humanen Weisheit, auch Lebensweisheit genannt, kommt es auf das Leben als Ganzes an und dabei vornehmlich auf die Dinge, die den Menschen tief in seinem Innersten betreffen und treffen. Die für den Menschen existentiell wichtigen Fragen und Aufgaben stehen hier auf dem Spiel. Ob deren Bewältigung die gewöhnlichen Formen des Wissens und Könnens voraussetzt, sei dahingestellt. Vermutlich ist dies jedoch nicht der Fall. Denn warum soll ein Handwerker, etwa ein Installateur, warum ein Ingenieur oder ein Elektrotechniker oder ein Ökonom genau deshalb, weil er über seine doch eng begrenzten Fachkenntnisse und Fachfertigkeiten verfügt, für die derartige Grenzen übersteigende Lebensweisheit zusätzlich kompetent sein? Sie übersteigt nämlich alle Fachkenntnisse enorm, bildlich gesprochen «unendlich weit».
Dabei sei schon hier eine Eigentümlichkeit erwähnt, die, recht besehen, sich von selbst versteht, aber trotzdem nicht immer beachtet wird. Sie ist nicht belanglos, da sie diesen Essay ebenso wie jede andere Untersuchung der Weisheit entlastet: Wer die Weisheit als Philosoph, als Sozialwissenschaftler oder als Psychologe untersucht, muss die seinen Gegenstand auszeichnende Kompetenz für sich nicht beherrschen. Um die Lebensweisheit sachgerecht erörtern zu können, muss man nicht selber lebensweise sein.
Eine zweite Eigentümlichkeit kommt hinzu. Man könnte für Einsichten zur Lebensweisheit wissenschaftliche Disziplinen, etwa die Philosophie und die Psychologie, für allein zuständig halten. In Wahrheit gibt es zwei, zudem weitverbreitete Alternativen: die Erzählung oder den Mythos und die religiöse Offenbarung. Deren Art, Weisheit zu vermitteln, übernimmt dieser Essay aber nicht. Im Unterschied zur Erzählung kommt es ihm auf Begriffe und Argumente, im Gegensatz zum Mythos also auf den Logos an. Und dieser beruft sich ausschließlich auf eine allgemeinmenschliche Vernunft. Infolgedessen ist er im Gegensatz zu einer religiösen Offenbarung rein weltlicher, säkularer Natur.
Von diesen drei Formen – der mythischen, der geoffenbarten und der «logischen» Weisheit – befasst sich dieser Essay, von gelegentlichen Seitenüberlegungen abgesehen, lediglich mit der dem säkularen Logos vertrauten Weisheit. Deshalb wird im Verlauf dieses Buches die Eigenschaft des Logischen und Säkularen nur noch ausnahmsweise eigens betont; der schlichte Ausdruck «Weisheit» reicht in der Regel aus.
Aber selbst bei diesem eingeschränkten Begriff ist das Verständnis der Weisheit nicht eindeutig. Wie mit der Unterscheidung von Experten- und von Lebensweisheit schon angedeutet, hält sich dieser Essay für die Mehrdeutigkeit offen; er rechnet mit mehr als nur einem Begriff einer säkularen, vernünftig einsehbaren Weisheit. Deren Profil tritt übrigens dann besser zutage, wenn man sich immer wieder die einschlägigen Gegenbegriffe vergegenwärtigt.
Ohne Zweifel ist für den so verstandenen «Logos» der Weisheit nicht bloß mein Metier, die Philosophie, sachkompetent. Auch wer nur in der Philosophie über Fachkenntnisse verfügt, kann sich in anderen Zuständigkeiten kundig machen, und das sollte er auch. Denn er sollte nicht, wie oft der Fall, den Gegenstand nur vom Blickwinkel einer einzigen Disziplin aus untersuchen, hier lediglich vonseiten der Philosophie, andernorts allein vonseiten der Psychologie. Vielmehr ist es geboten, die Weisheit von verschiedenen Seiten aus zu erörtern.
Und noch eine weitere Erweiterung des Blicks ist empfehlenswert: Heute, in Zeiten der Globalisierung, darf man nicht länger mit der Perspektive des eigenen, westlichen Kulturraumes zufrieden sein. Auch der vordergründig bescheidene Hinweis genügt nicht, man wisse zwar, dass es noch andere Perspektiven gibt, sei für sie aber nicht kompetent. Ich halte es für ein Gebot der kulturellen Bescheidenheit, auch der interkulturellen Fairness, andere Kulturräume mit ihren teils eigentümlichen, teils ähnlichen Weisheitsvorstellungen mindestens selektiv und unter dem Vorbehalt zur Kenntnis zu nehmen, dafür nur ein Amateur, also ein Laie zwar, aber auch ein gewisser Liebhaber zu sein.
Aus diesen Gründen entwickelt dieser Essay seine Überlegungen in verschiedenen Gedankensträngen, wobei er kleinere Überschneidungen in Kauf nimmt: Er beginnt mit dem Hinweis auf vier Verständnisse von Weisheit (1), schließt daran die Lebensweisheit als Lebenskunst (2) und die Weisheit der Moral an (3). Diese drei Kapitel setzen stillschweigend voraus, dass die Weisheit nicht jenen Charakter einer angeborenen Begabung hat, die nur wenige Menschen, gewissermaßen eine geistige Elite, auszeichnet. Eine angeborene Begabung bedarf nämlich keiner längeren Untersuchung, denn die Antwort auf die Titelfrage dieses Essays würde schlicht lauten: Die Weisheit einer angeborenen Aristokratie der Weisheit lässt sich weder lehren noch lernen.
Ich gehe stattdessen von der Annahme aus, die Weisheit sei keine nur wenigen Menschen vorbehaltene Gabe. Sie gilt vielmehr als eine Eigenschaft oder, wahrscheinlicher, als ein Bündel von Eigenschaften, das erlernt werden kann und dafür Unterstützung, also ein Lehren, verdient. Für unsere demokratischen Zeiten und Gesellschaften wäre es jedenfalls ideal, wenn es jedem Menschen offenstünde, weise zu werden, und es dafür Möglichkeiten des Lernens und Lehrens gäbe.
Ein weiteres Argument: Offensichtlich braucht der Mensch schon für sein Überleben, ebenso für ein angenehmes und für ein humanes Leben, das «Lebensweisheit» genannte Wissen und Können. Mit ihrer Hilfe will er sich nämlich in allen existentiell wichtigen Aufgaben und Belangen auf eine möglichst optimale Weise zurechtfinden. Bei der dafür zuständigen Weisheit geht es also um eine ebenso umfassende wie gründliche, vor allem auch herausragende Daseinsorientierung und Daseinsbewältigung ‒ und dies in beiden, in deren theoretischer und deren praktischer Bedeutung.
Darüber hinaus, so darf man vermuten, gibt es trotz der unterschiedlichen Kulturen, die die Menschen prägen, einen gemeinsamen Kern aller Lebensweisheit. Zumindest elementare Aussagen könnten sich als Kulturen- und Epochengrenzen überschreitend gültig erweisen und selbst die Unterschiede der Religionen und Konfessionen relativieren. Damit das zutreffen kann, müssten beide Faktoren – sowohl diejenigen, die die Weisheit herausfordern, als auch diejenigen, die die Herausforderung zu bewältigen versprechen – eine allgemeinmenschliche, mithin anthropologische Bedeutung haben. Dieser Essay vermutet das jedenfalls und sucht diese Vermutung, diese Hypothese, im Verlauf seiner Überlegungen in ihrer Richtigkeit zu bestätigen oder aber zu widerlegen.
Falls die Vermutung zutrifft, wird ein Kennzeichen der uns bekannten Wissenschaften der Lebensweisheit fremd sein, nämlich das Merkmal, immer wieder neue Entdeckungen zu machen. Weisheit kann nur dann einen allgemeinen anthropologischen Charakter haben, wenn sowohl die existentiellen Herausforderungen, die das Leben des Menschen prägen, als auch die Grundformen ihrer Bewältigung eine über- oder transkulturelle und eine ebenso über- und transepochale Bedeutung haben. Dies ist in einem eigenen Teil, dem vierten, unter dem Titel «Weltweisheitserbe» zu untersuchen.
Mit der Vermutung einer die unterschiedlichen Kulturen und Epochen übergreifenden Bedeutung gibt sich dieser Essay aber nicht zufrieden. Er nimmt auch an, wegen des existentiell überragenden Gewichts werde der Superlativ an Kompetenz, ebendie Weisheit, in so gut wie allen Kulturen und Epochen hochgeschätzt. Weil nicht bloß die Frage nach dem Wesen der Weisheit, sondern auch die Suche nach Wegen, sie zu erwerben, ein allgemeinmenschliches Ziel ist, will man wissen, wie und wie weit man die Weisheit lernen und lehren kann.
Aus diesem Grund geht es in diesem Essay nicht nur um die Klärung eines mehrdeutigen Begriffs. Er interessiert sich auch für die Frage nach dem Lernen- und Lehrenkönnen – sowie mit der daran anschließenden Frage, welche Institutionen dafür zuständig seien: Kann man sich – so eine mögliche, eventuell aber naive Antwort – Schulen, Hochschulen oder Akademien für Weisheit vorstellen? Und: Wer wären dort die geeigneten Lehrer und wer die Schüler beziehungsweise Studenten? Mit der vermutlich nicht minder naiven Zusatzfrage: Gäbe es dort wie bei allen Schulen und Hochschulen verschiedene Stufen: eine erste Stufe für Anfänger, eine mittlere für Fortgeschrittene und eine Vollendungsstufe für die veritablen Kenner und Könner? Denn falls man die Weisheit wie ein Handwerk lernen kann, ist eine Lehr- und Lernstufe für den Lehrling, eine zweite für den Gesellen und schließlich eine dritte für den Meister anzunehmen.
Da wir freilich unter der Weisheit einen Superlativ verstehen, würde es sich bei den ersten beiden Stufen nur um Vorstufen handeln, während erst auf der letzten Stufe die zum vollen Rang der Weisheit gehörende Vortrefflichkeit erreichbar erschiene. Falls die Weisheit aber mit einem Handwerk vergleichbar wäre, würden freilich nicht alle Menschen die Höchstform von Wissen und Können erreichen, sondern lediglich wenige – jene Ausnahmepersonen, die von den anderen, den vielen, als Weise bewundert und dort, wo es sinnvoll ist, um Rat und Tat gebeten werden. Denn die gewöhnlichen Zeitgenossen sind häufig, wie eine Redensart sagt, «mit ihrer Weisheit am Ende». Gemeint ist, sie haben auf die anstehenden Probleme keine Antwort; sie sind für sich ratlos, folglich über Ratschläge anderer froh.
Bleiben wir beim Vergleich mit dem Handwerk: Wie die verschiedenen Handwerke auf unterschiedliche Weise zu lernen sind, ist auch von den verschiedenen Begriffen der Weisheit nicht zu erwarten, sie alle seien auf dieselbe Art zu erwerben. Vielmehr ist mit unterschiedlichen Methoden des Lehrens und Lernens zu rechnen, weshalb man sie besser nicht gemeinsam untersucht, sondern für den jeweiligen Begriff gesondert, also nach und nach in den verschiedenen Teilen.
So weitläufig und facettenreich wir das menschliche Dasein kennen, wird auch das Themenfeld der Weisheit sein. Für ein erstes Verständnis seien exemplarisch einige Gegenstände hervorgehoben: Der «Weisheit» genannten, auf das Ganze und das Große gerichteten Daseinsorientierung kommt es auf die verschiedenen Dimensionen des Lebens an: auf das Verhältnis des Menschen zu sich nicht weniger als auf die Beziehung zu den Mitmenschen, freilich auch zu nichtmenschlichen Lebewesen, insbesondere den Tieren, nicht zuletzt zur gesamten dem Menschen vorgegebenen Natur. Zu all diesen Beziehungen empfiehlt die Weisheit einen überlegten und überlegenen, aber nicht anmaßenden, vielmehr einen souveränen Umgang.
In etlichen Weisheitstexten spielen zudem Fragen folgender Art eine Rolle: Gibt es eine außermenschliche, in der Regel «göttlich» genannte Autorität? Wie soll man sich gegebenenfalls zu ihr verhalten? Und: Darf oder muss man sich auf ein Leben nach dem Tod einstellen? Diese gewöhnlich als religiös bezeichneten Fragen sind aber kein notwendiger Teil der Weisheit. Nicht nur finden wir in der Geistesgeschichte bedeutende Beispiele einer religionsfreien, insofern säkularen oder profanen Weisheit wie etwa das erwähnte Persönlichkeitsideal der Stoa. Ohnehin ist für die Philosophie ein säkulares Verständnis charakteristisch, vielfach sogar essentiell. Seit den Anfängen bei den antiken Griechen versteht sie sich nämlich von ihrer Selbstbezeichnung her als eine Liebe (philo-) zur Weisheit (-sophia), die sie mittels Begriffen und Argumenten selbst und allein sucht, ohne dafür auf eine außermenschliche Autorität, etwa eine göttliche Offenbarung, zurückzugreifen. Überdies sind auch andere, obwohl nichtphilosophische Weisheitsüberlegungen von aller Religion frei, mithin rein säkularer Natur.
Das hat zwei Gründe, die schon angedeutet wurden: Weil es der Weisheit auf eine allgemeinmenschliche Daseinsorientierung ankommt und weil nicht nur das westliche Denken danach sucht, ist das Themenfeld für unsere Zeiten der Globalisierung besonders geeignet. Deren normative Perspektive billigt nämlich keiner Kulturform das Recht auf Privilegien und deren Kehrseite, eine Diskriminierung anderer Kulturen, zu. Vielmehr sind sie alle als im Prinzip gleichberechtigte zu betrachten – vorausgesetzt, dass sie ihrerseits andere Kulturen als grundsätzlich gleichberechtigt anerkennen. Die Frage, wie diese Bedingung des Näheren zu erfüllen ist, kann hier offenbleiben. Der Gedanke der Weisheit schließt jedenfalls seinem Wesen nach einen Euro- und Amerikanozentrismus aus, freilich ebenso einen Indo-, einen Islamo- und einen Sinozentrismus sowie weitere Formen eines politischen oder kulturellen Imperialismus.
Sachgerechte und zugleich zeitgemäße Überlegungen machen sich freilich nicht bloß von den genannten Formen der Selbstprivilegierung frei. Sie sollen zwar, das versteht sich, für heute aktuell sein, binden sich aber nicht an die Gegenwart. Diese wird nämlich mit ihren oft zufälligen Tagesgeschäften allzu rasch zu einer überholten Vergangenheit. Ein Essay über die Weisheit sucht also beide Engführungen zu überwinden – sowohl die Bindung an den eigenen Kulturraum als auch die Fixierung auf das Heute. Der Versuch, die zweite Engführung zu überwinden, durchzieht den ganzen Essay, erhält daher keinen eigenen Teil. Das trifft auf die erste Verengung nicht zu, der deshalb ein gesondertes, unter anderem Einsichten der Kulturanthropologie zurate ziehendes Kapitel entgegenwirkt: das fünfte Kapitel zum Weltweisheitserbe.
Aktuelle Überlegungen zur Weisheit dürfen allerdings eine gegenwärtig erhebliche Schwierigkeit nicht unterschlagen: Obwohl die Höchstform von Wissen und Können der Sache nach seine Bedeutung nicht verloren hat, ist sie heute nicht mehr geläufig. In der Fachphilosophie spielt sie so gut wie keine Rolle. Einen ihrer klassischen Gegenstände, ein über Jahrhunderte untersuchtes Thema, hat sie nämlich so gut wie vollständig verloren.
Erfreulicherweise wird es neuerdings von einer Wissenschaft erörtert, die früher zwar ein Teil der Philosophie war, sich aber von ihrer philosophischen Herkunft längst und gründlich emanzipiert hat und zu einer weithin empirischen und experimentellen Wissenschaft geworden ist: der Psychologie. Sie sucht das Phänomen der Weisheit zu verstehen, sieht es als lehr- und lernbar an und überlegt, was des Näheren gelehrt und gelernt werden kann und wie die dafür notwendigen Prozesse aussehen. Das wird in einem eigenen, vierten Kapitel untersucht: «Weisheit der Psychologie».
Deren ohne Frage hilfreiche Überlegungen finden jedoch – das lässt sich schwerlich abstreiten – in öffentlichen Debatten ebenfalls kaum Resonanz. Auch in dieser Hinsicht ist also mit einem weithin vertrauten Vorverständnis von Weisheit nicht zu rechnen. Im Fall eines von der Philosophie getragenen Essays zur Weisheit muss man sogar mit einem abschätzigen Naserümpfen rechnen: Warum denn soll dieses – außerhalb der Psychologie und einiger Teile der Kulturanthropologie (Ethnologie, Völkerkunde) – bestenfalls altmodische Thema heute noch oder heute wieder diskussionswürdig sein?
Obwohl es derzeit weder prominent erscheint noch Aufmerksamkeit verspricht, könnte es aber dazu gemacht werden sollen. Denn die heutige Welt dürfte wegen ihrer gewachsenen Komplexität sowohl aufseiten der gewöhnlichen Einzelmenschen als auch aufseiten ihrer «Führungspersönlichkeiten» mehr Weisheit und mehr weise Menschen benötigen.
Da es zur Weisheit schon des Längeren keine relevante Debatte gibt, sind jene Gründe nicht leicht zu finden, die einen Skeptiker vom Sinn dieses Themas wenn nicht überzeugen, so doch auf es neugierig machen könnten. Wenn man bei der Weisheit alles von Grund auf sich selbst ausdenken müsste, wäre man ohne Zweifel überfordert. Glücklicherweise gibt es aber eine naheliegende Alternative: Weil das Thema sowohl in unserer westlichen Tradition als auch in der vieler anderer Gesellschaften bedeutsam ist, findet man dort zahlreiche Anregungen. Da der Gegenstand hier also nicht zum ersten Mal erörtert wird, wäre es sogar unredlich, zugleich naiv, die Fülle der Anregungen zu übergehen, die schon in der Geschichte der Philosophie entwickelt worden sind. Zu diesem Zweck werfe man einen Blick in die Überlegungen der Vergangenheit, wofür sich erneut kein eigener Teil empfiehlt. Einschlägige Hinweise – hier nur ein Beispiel: die Spruchweisheiten der Sieben Weisen der Griechen – gehen schon in die Kapitel 1 und 2 ein.
Die Weisheitsüberlegungen von außereuropäischen und außernordamerikanischen Kulturen werden dagegen besser in einem eigenen Teil, in dem schon erwähnten Kapitel 5, vorgestellt. Um dafür ein Gespür zu entwickeln, seien schon hier einige Quellen der weltweit zu findenden außereuropäischen Weisheitsliteratur genannt: Weisheitsbücher der Ägypter, im Alten Testament das dem König Salomon zugeschriebene Buch der Weisheit, ferner indische, chinesische und japanische Weisheitstexte. (Zahlreiche Beispiele des Weltweisheitserbes habe ich in einem Lesebuch zur Ethik zusammengestellt.)[1]
1.
Was Weisheit bedeutet: Vier Verständnisse
Beginnen wir mit dem Gedanken einer theoretischen und praktischen Daseinsorientierung sowie mit der in der Einführung geäußerten Vermutung, dass selbst die eine, hier vornehmlich zu erörternde Form der Daseinsorientierung, nämlich der säkulare Logos, mehrere Bedeutungen haben dürfte.
Die Grundbedeutung der Weisheit: Sein Metier beherrschen
Wir setzen bei den Bezeichnungen an: Die abendländische Philosophie existiert vor allem in zwei klassischen Sprachen, dem Griechischen und dem Lateinischen, sowie drei modernen Sprachen, in alphabetischer Reihenfolge: dem Deutschen, Englischen und Französischen. Zur Vereinfachung konzentrieren wir uns auf das Griechische, das Lateinische und das Deutsche.
Im Griechischen heißt weise, sophós, wer über ein außergewöhnliches Wissen und Können verfügt. Sophós ist, wer sein theoretisches oder praktisches Handwerk, wer sein Metier beherrscht. Der Betreffende bewegt sich nicht auf dem Niveau eines Gesellen oder sogar nur eines Lehrlings, sondern dem des Meisters. Sophía, Weisheit, meint also einen Superlativ, hier die überragende Fachkompetenz des maître, des Maestro: Die Weisheit besteht in einer nicht mehr steigerbaren Vollkommenheit.
Man kann es ein Wissen nennen, mit dem man, ein Einzelner oder eine Gemeinschaft, seine Zukunft zu meistern versteht. Dabei lassen sich zwei Ebenen unterscheiden. Auf der Elementarstufe meistert man sein langfristiges Überleben, weshalb man von einer Überlebensweisheit sprechen kann; auf der Steigerungsstufe meistert man, ebenfalls langfristig, sein Wohl, was ich einmal eine humanitäre Weisheit genannt habe. Die weitere Steigerung, die für ein gutes und schönes, ein humanes Leben, heiße eine humane Weisheit.[2]
Auch wenn es nicht superlativisch gemeint sein muss: Homer nennt für die damalige Agrar- und Handwerkerkultur sowohl diejenige Person «weise, die ein Feld zu graben und zu pflügen versteht» (Margites) als auch den kundigen Zimmermann (Ilias XV, 412). Einige Jahrhunderte später, in der städtischen Kultur Athens, legen sich andere Beispiele nahe. So führt in einer der wichtigsten Ethik-Schriften des Abendlandes, in der Nikomachischen Ethik (Buch VI, Kap. 7), der Autor, Aristoteles, für Fachkompetenz vom Rang der Weisheit jene beiden berühmtesten Athener Bildhauer an, die zu den überhaupt größten antiken Künstlern gehören: Phidias und Polyklet. Ihre Werke sind für Jahrhunderte, beinahe für die Ewigkeit geschaffen und ziehen bis heute Jahr für Jahr Tausende von Besuchern der Akropolis in ihren Bann.
Im Deutschen verhält es sich ähnlich, allerdings tritt der Superlativcharakter weniger in den Vordergrund. Nach dem Deutschen Wörterbuch, dem Grimm (Bd. 28, Spalten 1012 ff.), gilt seit den Anfängen des Deutschen, etwa schon beim althochdeutschen Verfasser eines Evangelienbuches, Otfried von Weißenburg, diejenige Person als weise, die einer Sache gewiss ist, weil sie diese kennt. Etymologisch ist der Ausdruck mit «Witz» verwandt, was ursprünglich Wissen und Klugheit bedeutet, erst später im Sinne des französischen esprit auf «geistreiche Formulierung» und schließlich auf «Scherz» verengt wird. Die ursprüngliche Bedeutung klingt im Wort «Mutterwitz» noch an, bedeutet es doch den in Pfiffigkeit und Schlagfertigkeit zutage tretenden allgemeinen, «gesunden» Menschenverstand.
Im Lateinischen ist der Ausdruck der Weisheit, sapientia, vom Verb sapere abgeleitet, das «schmecken», «verständig» und «klug sein» bedeutet. Von dort kommt Kants berühmte Definition der Aufklärung: «Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.» Der Weise folgt nicht vorgegebenen Denk- und Handlungsmustern, weder denen, die von noch so bedeutenden Autoritäten ausgehen, noch denen, die die Tradition oder der jeweilige Zeitgeist vorgeben.
Bildung, Intelligenz und Weisheit. Die drei Ausdrücke der Bildung, der Intelligenz und der Weisheit umschreiben ein Begriffsfeld, das man sinnvollerweise im Hinterkopf behalten sollte. Weil keiner der drei Ausdrücke eine einzige Bedeutung hat, lässt sich ihr Verhältnis zueinander unterschiedlich bestimmen. Ich mache hier einen Vorschlag, den ich mit Blick auf den dritten Ausdruck, die Weisheit, formuliere. Der das entsprechende Begriffsfeld zweifellos vereinfachende Vorschlag sollte nicht unplausibel, muss aber auch nicht zwingend sein.
Nach meinem Vorschlag handelt es sich um drei aufeinander aufbauende Stufen: Bildung heiße der Inbegriff des Wissens, das man sich angeeignet hat. Die Intelligenz besteht dann in der Fähigkeit, aus dem Wissen Verknüpfungen herzustellen. Bei der Weisheit schließlich verbinden sich Bildung und Wissen mit einer beträchtlichen Lebenserfahrung und vor allem mit der Fähigkeit, das Erfahrene im Blick auf das, was man für sinnvoll und vernünftig hält, zu verarbeiten.
Zum Wesen der Weisheit gehört nicht zuletzt, dass all dies nicht Theorie bleiben darf. Weisheit ist weit mehr als jedes noch so gründliche und umfassende Wissen. Sie besteht nicht in Gelehrsamkeit, weder in deren fachenger noch in der seltenen fächerübergreifenden Gestalt. Selbst eine enzyklopädische Gelehrsamkeit ist keine Weisheit, sondern steht ihr eher im Wege. Die Weisheit zeigt sich nämlich in der Persönlichkeit, d.h. in der Art und Weise, wie jemand (persönliche Weisheit) oder auch eine Gesellschaft oder sogar die Menschheit (kollektive Weisheit) das Leben führt.
Was ist ein weiser Lehrer? Wie lässt sich diese Art von Weisheit, die Meisterschaft im jeweiligen Metier, lehren und lernen? Nehmen wir als Beispiel eine Grundinstitution des Lehrens und Lernens, die Schule, und fragen: Was ist ein weiser Lehrer? Sinngemäß trifft die Frage ebenso wie ihre Antwort auch auf einen Hochschullehrer zu. In beiden Fällen würden wir allerdings lieber von einem begnadeten Lehrer beziehungsweise Hochschullehrer sprechen. Wegen des Leitbegriffs dieses Essays verzichten wir aber auf die Qualität des Begnadeten und bleiben bei dem schlichteren Ausdruck «weise».
Weise ist offensichtlich nicht, wer die Weisheit oder die Lebensweisheit zum Gegenstand seines Unterrichts oder seiner Vorlesungen macht. Wenn man trotzdem in diesem Zusammenhang die Eigenschaft des Weiseseins verwendet, betrifft sie nicht den Gegenstand des Unterrichts, sondern die Art und Weise, wie man den Unterricht durchführt. Infolgedessen haben die zuständigen Lehrer, die Philosophielehrer oder Philosophieprofessoren, hier kein Privileg. Auch nicht ihre Kollegen aus der Psychologie. Weise kann vielmehr der Lehrer jedes Unterrichtsfaches sein. Entscheidend sind zwei andere, zudem fachindifferente Dinge: dass man sein Fach, um welches auch immer es geht, beherrscht und dass man seine Schüler oder Studenten dafür zu begeistern vermag. Dazu mag «natürlich» auch ein Philosophie- oder ein Psychologielehrer imstande sein. Als weise gälte er dann aber nicht, es sei wiederholt, wegen des Faches, das er unterrichtet, sondern wegen der Art seines Unterrichtens.
Eigentlich hat jeder Lehrer eine doppelte Aufgabe zu erfüllen. Das, was einem weisen Lehrer in einem außergewöhnlichen Maß gelingt, muss sich jeder Lehrer in einem nicht zu geringen Maß vornehmen: den Schülern Freude am jeweiligen Stoff zu vermitteln und aufgrund dieser Motivationslage sie zu altersgemäßen Kennern und Könnern heranzubilden. Dabei schwingt durchaus der Sinn der Aufklärung mit: In Bezug auf das jeweilige Fach müssen die Schüler lernen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen.
Greifen wir ein Fach heraus, von dem etliche Teilnehmer öffentlicher Gesprächsrunden, sogenannter Talkshows, stolz sind, «keine Ahnung zu haben»: die Mathematik. Ein begnadeter Mathematiklehrer oder -dozent verschafft seinen Schülern oder Studenten, nehmen wir einfache Beispiele, Lust zunächst am Bruchrechnen, später an Differential-, Integral- sowie Vektorrechnung und macht sie unter anderem genau wegen dieser Lust zu stufengemäßen Kennern und Könnern, die Freude an einer Grundaufgabe der Mathematik, dem Beweisen, haben.
Entsprechendes gilt für Deutsch-, Englisch-, Französisch- und Lateinlehrer usw. Sie haben Vergnügen daran, die jeweilige Sprache und deren Kunstwerke zu vermitteln und dabei, aber nicht nebenbei, ihren Schülern die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten beizubringen. Dafür reicht die bloße Freude an der Sache freilich nicht aus. Um am Ende etwas zu können, um, wie ein verpöntes Wort besagt, gewisse Leistungen zu erbringen, müssen die Schüler das Lernen selbst lernen und folglich so banal klingende Dinge zustande bringen wie: rechtzeitig etwas einzustudieren, die mit jedem Lernen verbundenen Mühen nicht zu scheuen und gemäß der Redensart «Übung macht den Meister» die notwendigen Elemente wie Vokabeln sowie gewisse Formeln immer wieder einzuüben. Dass man auch eine gewisse Begabung braucht, ist nicht zu bestreiten.
Ein Muster für die Grund- und Hauptaufgabe, die Vermittlung von Lernlust, beschreibt der französische Schriftsteller und Philosoph Albert Camus in seinem autobiographischen Roman Le premier homme (Der erste Mensch). Ich halte die einschlägige Passage für so treffend, dass ich sie, man sehe es mir nach, immer wieder anführe: «In Monsieur Germains Klasse fühlten sie [die jungen Schüler] zum ersten Mal, dass sie existierten.» Man muss dazu wissen, dass für den Existenzphilosophen Camus «existieren» weit mehr als lediglich «bestehen», «vorhanden sein» und «da sein» bedeutet. Gemeint ist ein unverwechselbar und unvertretbar je eigenes Leben. Dieses zu vermitteln gelang Monsieur Germain, indem ihm seine Schüler ein «Gegenstand höchster Achtung waren». Denn er hielt sie «für würdig, die Welt zu entdecken». Die für den Menschen, namentlich das Kind und den jungen Menschen, natürliche Neugier, die Wissbegier und Entdeckungslust, wurde also von Camus’ Lehrer ernst genommen, gefördert und kultiviert. M. Germain hat seine Schüler inspiriert, ihnen die Augen geöffnet und war aus genau diesem Grund ein ‹begnadeter›, ein weiser Lehrer.
Nicht von derselben Bedeutsamkeit, trotzdem nicht bedeutungslos, sind weitere Dinge, die ein weiser Lehrer kennt und nicht nur durch Worte und Ermahnungen, sondern vor allem durch die Art lehrt, wie er mit seinen Schülern umgeht. Einem weisen Lehrer ist bewusst, dass Kinder und Jugendliche für ihre Entwicklung Regeln und Strukturen brauchen, vor allem aber jenes Gespür für Mitgefühl und Fairness, das sowohl vom Lehrer gegenüber den Schülern, allerdings auch von den Schülern untereinander wie auch gegenüber ihren Lehrern praktiziert werden sollte.
Kann es eine weise Schule geben? Können nicht nur einzelne Personen, sondern auch die Institutionen, in denen sie tätig sind, den «Weisheit» genannten Rang erreichen? Kann es eine weise Schule und entsprechend eine weise Hochschule geben? Wie das im Einzelnen auszusehen hat, ist hier nicht zu untersuchen. Es kommt nur auf die leitende Anforderung an, und diese muss sich generell aus der Sache, hier aus der der jeweiligen Institution gestellten Aufgabe, ergeben. Obwohl sie allzu bekannt sind, sei an sie erinnert: Schulen und Hochschulen sollen den Schülern beziehungsweise Studenten gewisse Fächer lehren, ihnen die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten beibringen und das Ganze in die Atmosphäre einer von Liberalität und Vorurteilslosigkeit geprägten Lernlust einbetten. Offensichtlich braucht es dafür eine gewisse Organisationsstruktur, weiterhin, dass die Lehrer nicht durch zu viel Bürokratie von ihrer eigentlichen Aufgabe, dem Unterrichten, abgehalten oder abgelenkt werden.
Ein heikles – weil ein in der Pädagogik, aber vermutlich noch mehr in der Schulpolitik umstrittenes – Thema: Schüler sind unterschiedlich begabt, brauchen daher unterschiedliche Förderung. Dass man die nicht so Begabten nicht vernachlässigen darf, versteht sich für eine demokratische Schulpolitik von selbst. Die der Demokratie wesentliche Gleichberechtigung verlangt Entsprechendes aber auch für die «normal» Begabten, nicht zuletzt für die Hochbegabten.
Für eine weise Schule nicht minder bedeutsam ist ein emotionales und soziales Klima, das lehr- und lernfreundlich ist. Selbst Schüler, denen das Lernen mehr Mühe macht und die im kaum vermeidbaren Vergleich mit ihren Mitschülern daher nicht so erfolgreich sind, sollten an ihre Schulzeit angenehme Erinnerungen haben. Als Minimum darf es kein Unbehagen und keinesfalls Angst oder sogar Schrecken geben: weder Angst vor der Leitung der jeweiligen Institution noch vor der Kultus- oder Wissenschaftsbürokratie. Das betrifft ebenfalls, besonders wichtig, das Verhältnis der Schüler zu ihren Lehrern und, Stichwort Mobbing, zu ihren Mitschülern, aber auch nicht zuletzt den Schutz der Lehrer vor aggressiven Schülern.
Gibt es ein Merkmal, an dem man eine gute, in herausragenden Fällen sogar weise Schule erkennen kann? Die positive Antwort muss nicht lange gesucht werden: Fühlen sich die Schüler mit ihrer Schule verbunden und engagieren sich zum Beispiel für gemeinsame soziale Projekte und für Weihnachts-, Abschluss- und andere Feiern? Sind sie vielleicht sogar stolz auf «ihre» Schule und denken später selbst dann, wenn ihnen das Lernen mehr Mühe gemacht hat, an ihre Schule und Schulzeit gern zurück?
Vielleicht lohnt es sich, zusätzlich zu den bekannten PISA-Studien auch dieses Thema, nennen wir es vorläufig die Zustimmungsrate oder Weisheitsrate, empirisch zu untersuchen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht einfach nur pauschal auf Unterschiede zwischen den Staaten und Bundesländern beziehungsweise Kantonen oder Provinzen geachtet wird, sondern auch auf Unterschiede zwischen einzelnen Schulen. Wie man aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung mit Kindern und Enkeln weiß, sind diese Art von Differenzen beträchtlich: Am selben Ort gibt es sowohl Vorzeigeschulen als auch abschreckende Beispiele, und dafür sind nicht nur Unterschiede in der Schülerschaft, sondern auch im sozialen und emotionalen Engagement der Lehrer und der Schulleitung verantwortlich.
Das «Design» der damit vorgeschlagenen empirischen Untersuchungen dürfte schwierig, aber nicht unüberwindbar schwierig sein. Dann stößt man vielleicht auf interessante, vermutlich aber kaum überraschende Befunde. Etwa könnte, diese Hypothese sei hier gewagt, sowohl bei den von ihrer Klientel her schwierigen Schulen, den sogenannten Brennpunktschulen, als auch bei den günstigeren Schulen die Weisheitsrate proportional zu ihren PISA-Leistungen ausfallen. Also: Je weiser eine Schule ist, desto höher dürfte ihr Leistungsniveau sein. Wenn diese Vermutung zutreffen sollte, böte sie einen Anreiz für Schulleiter und Lehrerschaft, ihre Schüler nicht ausschließlich auf Leistung zu trimmen, sondern auch die hier «Weisheit» genannte Lehr- und Lernatmosphäre zu schaffen. Die Leistung könnte dann sogar wie von selbst zustande kommen.
Ähnliches, was beim Lehrer und bei seinem Unterrichten anzutreffen ist, dürfte auch für die Schulen gelten: Sie müssen wissen, dass Kinder und Jugendliche Regeln und Strukturen brauchen, die auch gegen manche Widerstände seitens der Schüler, neuerdings auch mancher Eltern durchgesetzt werden müssen. Es versteht sich, dass dies nicht stur, sondern mit einem Gespür für individuelle Situationen und Personen, aber unparteilich und in Fairness, gelegentlich auch couragiert zu praktizieren ist.