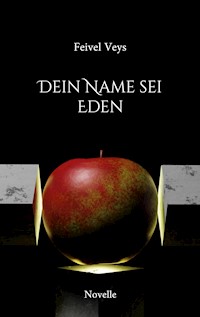Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zweifel. Hattest du schon einmal richtige Zweifel? Zweifel an dir selbst? Zweifel an deinen Fähigkeiten? Zweifel an deinen Überzeugungen? Sie sind ein schleichendes Gift, das sich langsam in dich hineinfrisst, bis es zu einem Teil deiner Selbst geworden ist und du nicht mehr sagen kannst, ob du überhaupt noch in der Lage bist, einen legitimen Gedanken zu formen, geschweige denn auch das Recht hast, ihn zu äußern. Richtig dosiert können sie dich jedoch herausfordern und in eine Richtung leiten, die du dir selbst in deinen kühnsten Träumen nicht hättest vorstellen können. Mein Name ist Valérie. Ich bin ein Werwolf. Und ich bin stolz darauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den AutorFeivel Veys ist ein leidenschaftlicher Fremdkörper in einer Welt, die nicht verstehen möchte, warum zwei plus zwei für gewöhnlich fünf ergibt. Schreibt er nicht gerade Bücher mit unverständlichen Hauptfiguren, zerbricht er sich den Kopf darüber, weshalb Hühner die Straße überqueren wollen. In seiner Freizeit sammelt er selbstkritische Gedanken über neurodivers-heterogene Denkmuster in ihrem alterisierten Verhältnis zu allistisch-homogenen Normvorstellungen und deren literarischer Rezeption.
Wer das verstanden hat oder sich nicht davon abschrecken lässt, darf gerne auf die nächste Seite umblättern.
Zu seinen Werken gehören:
Dein Name sei Eden
Die Schwanzfedern des Kranichs
Der Werwolf von Jevole
-Das Meer der Amsel-
Erscheint voraussichtlich 2024
Vorabhinweis
Dieser Roman erzählt nicht einfach nur eine Geschichte wie jede andere auch, sondern beschränkt sich auf einen kritischen Augenblick im Leben von Valérie de Jevole. Während Valérie für uns ihre Geschichte wiedergibt, findet keine tiefer gehende Reflexion statt. Es gibt keine erklärenden Anmerkungen, keine objektiven Kommentare und auch keine weiterführenden Kapitel, die ein besseres Licht auf die Hintergründe und Gedankengänge der anderen Figuren werfen könnten. Es wird ausschließlich Valéries Geschichte erzählt, so wie sie sie erlebt und wahrgenommen hat.
Für Leute, die sexualisierte oder ausgrenzende Gewalt direkt oder indirekt erlebt haben oder sich ungewöhnlich gut in sie hineinversetzen können, können manche der Szenen daher durchaus unangenehm werden. Als ein persönlicher Freund von Valérie empfehle ich daher, die Geschichte im Nachhinein mit einem vertrauensvollen Freund oder einer Freundin durchzusprechen und zu hoffen, dass solche Geschichten in all ihren möglichen Facetten in Zukunft genau das bleiben werden, was sie sind – bloße Geschichten.
Solltest Du wie Valérie jedoch dazu neigen, für Deine Erfahrungen und Gefühle kein anderes Ventil zu finden, als dich regelmäßig selbst zu verletzen, kannst Du dich für Fragen und Hilfestellungen an folgende Adresse wenden:
www.sorgenmail.de/selbstverletzendes-verhalten.php
oder Dich telefonisch von ihnen beraten lassen
0221 / 892031
Feivel Veys, November 2023
Von, durch & für Flosse —
You draw with silver, the ink turns red - pointless lines without a lining - and sharp thoughts on softer skin are forming a storm in our head — a sight of shameful, blind kept sin.
I see beauty in the lines that you’re designing.
Inhalt
Der Werwolf von Jevole
Nachwort des Verfassers
Anmerkungen zu Textinhalten (Empfohlen für Zweitleser)
Leseprobe
dramatis personae laetitiae dolorosi
Valérie
Hirtentochter und Werwolf in Jevole
Jean Jacques »Gé
« Vaudan
Fischersohn und engster Freund des Wolfs
André Portefaix
Waisenjunge und Anführer der Jugendlichen von Jevole; Fester Freund von Jeanne
Jeanne Boulet
Tochter des Bürgermeisters und Andrés Freundin
Mouton & Brebis
Geschwisterpaar und Freunde von André
Vater Étienne de Vézaley
Vater der Gemeinde und Priester von Jevole
Jean Veyrier
Junger Hirtenjunge
“ALL MEN HATE THE WRETCHED; HOW, THEN, MUST I BE HATED, WHO AM MISERABLE BEYOND ALL LIVING THINGS!”
M.S.
1. TEIL
“I WAS A POOR, HELPLESS, MISERABLE WRETCH; I KNEW, AND COULD DISTINGUISH, NOTHING; BUT FEELING PAIN INVADE ME ON ALL SIDES, I SAT DOWN AND WEPT.”
Sie sagen, ich wäre ein Monster. Ein Freak. Eine Missgeburt. Sie sagen, ich wäre verrückt. Findest du, es ist wirklich verrückt, unfreiwillig mit dieser bleichen Haut zu existieren? Unter Menschen leben zu müssen, ohne jedoch zu ihnen zu gehören? Gemeinsam mit ihnen zu atmen, ohne es sich verdient zu haben? Neben ihnen zu essen, zu trinken, zu schlafen, so wie jeder andere auch, obwohl man nicht so ist wie sie?
Zugegeben, ich möchte auch überhaupt nicht so sein, wie sie es sind, möchte nicht so sein, wie sie mich haben wollen. Ich bin ein Werwolf — stolz und wild und frei. Meine Klauen preschen durch das Unterholz hindurch, als wäre es eine gepflasterte Straße. Meine Krallen sind schärfer als die Sicheln und Sensen der Bauern. Und meine Zähne können selbst das zähste Stück Fleisch noch mühelos durchdringen. Ich bin ein Kind der Wildnis und kein eingepferchtes Schlachtvieh, das Tag für Tag geschoren und gemolken wird, bis es eines Tages zu eben jenem Metzger geführt wird, der ihm tags zuvor noch liebevoll den Kopf gekrault hat. Mein einziges Vergehen besteht darin, dass ich nicht mehr das verschreckte kleine Hirtenmädchen sein möchte, das andere in mir sehen wollen. Ich habe nie jemand anderen im Zorn verletzt, nie jemand anderem Schmerzen zugefügt oder bin auch nur auf den Gedanken gekommen, es tun zu wollen. Ich bin so sanftmütig wie die Schafe, die ich hüten soll, und zumindest sie akzeptieren mich dafür als eine der ihren.
Für die guten Menschen von Jevole reicht das jedoch nicht aus. Sie sehen das Fell auf meinem Rücken und schreien »Hund«. Sie sehen die Krallen an meinen Pfoten und schreien »Wolf«. Sie sehen, dass ich es bin und schreien »Monster«. Dass es sich in allen drei Fällen lediglich um eben jene Valérie handelt, die nun schon seit über sechzehn Jahren friedlich unter ihnen gelebt hat, spielt keine Rolle. Das Monster ist los und gegen Monster gibt es nur ein einziges Heilmittel.
Sie müssen ausgelöscht werden.
Ich erhöhte den Druck auf meine Krallen, bis ich das erste Blut an meinen Fingerspitzen spüren konnte. Blut ist so eine sanfte Flüssigkeit. Sie ist ehrlich, aufrichtig, liebevoll. Wurde sie vergossen, war es jedes Mal eine Tragödie — und doch war es manchmal die einzige Möglichkeit, eine noch größere Katastrophe zu verhindern.
Ich hasste mich, hasste mein Spiegelbild, das mir jedes Mal vorgaukelte, jemand zu sein, den ich nicht kannte, jemand, der sich mir ungefragt aufdrängte, jemand, den ich aus tiefstem Herzen verabscheute. Und ich hasste die Leute von Jevole, weil sie über all die Jahre hinweg diesen Hass in mich eingepflanzt hatten, hasste sie, weil sie mich verachteten, und hasste mich dafür umso mehr, dass ich ihnen auch noch bereitwillig glaubte. Die anderen konnten nur recht haben. Jemand, der so viel Hass in sich vereinigen konnte, musste einfach ein Monster sein. Und gegen Monster gab es nach wie vor nur ein einziges Heilmittel.
Sie mussten ausgelöscht werden.
Ich zog meine Krallen mit einem kräftigen Ruck quer über meine bleiche Haut. Ein fleischliches Schmatzen erfüllte die Luft und meiner Kehle entrang ein leises Wimmern. Für einen Moment starrte ich gebannt auf die vier schmalen Rillen in meinem Fleisch, aus denen gemächlich das Blut heraus sickerte.
Tropfen.
Für Tropfen.
Für Tropfen.
Für Tropfen.
»Merde!«
Ein Zittern lief durch meinen Körper und ich presste rasch meine Pfote auf die Wunde, bevor noch mehr Blut aus ihr austreten konnte. Ich hatte es schon wieder getan, dabei hatte ich mir geschworen nicht schon wieder auf meine Gedanken hereinzufallen. Sie waren einfach zu trügerisch, als dass ich ihnen unhinterfragt glauben schenken durfte. Ich war eigentlich in den Wald gegangen, um etwas Ruhe zu finden, doch musste ich irgendwo unterwegs meine Aufmerksamkeit verloren haben und unbemerkt abgedriftet sein. Jetzt hatte ich eine neue Wunde in meinem Fleisch und schon wieder das alte Versprechen an der Backe, es nächstes Mal nicht noch einmal so weit kommen zu lassen.
»Hi, Val. Hab’ ich was verpasst?«
Ich zuckte zusammen und löste meinen Blick von meinem Vorderlauf. Mir gegenüber lehnte Gé lässig an einem Baumstamm und grinste mich süffisant an. In seiner Hand hielt er einen unförmigen Lederbeutel und warf ihn wie einen kleinen Ball immer und immer wieder in die Luft, nur um ihn im nächsten Moment erneut aufzufangen. Ich brauchte einen Moment, um mich von der Bewegung loszureißen.
»Äh, nein? Ich denke nicht.«
»Ja, das dachte ich mir schon. Fang!«
Gé warf mir unvermittelt den kleinen Beutel entgegen und ich fing ihn mit beiden Pfoten auf. Meine Reflexe waren schon immer ausgezeichnet gewesen. Nun, zumindest gemessen an einem Menschen waren sie das. Für einen Werwolf war ich schrecklich ungeschickt.
Gé ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte sich neben mich auf den Boden. Mit einer Hand griff er sich meinen verletzten Vorderlauf und schob mit der anderen meinen Pelz auf die Seite. Kaum traten die feucht schimmernden Linien zutage, stieß er ein enttäuschtes Seufzen aus.
»Schon wieder, Val? Ich dachte, du hättest das inzwischen in den Griff bekommen?«
»Das dachte ich eigentlich auch.«
»Und warum müssen wir dann schon wieder hier sitzen und dieses Gespräch führen?«
Gé zückte eine weißliche Rolle aus seiner Hose und wickelte sie langsam um meinen Vorderlauf herum.
»Vielleicht, weil ich Männer mit Verbandszeug in der Hosentasche unwiderstehlich finde?«
»Dann solltest du dir langsam mal ernsthafte Gedanken darüber machen, wo du einen Heiler oder vielleicht sogar einen Doktor auftreiben kannst. Ich weiß nicht, wie lange ich noch die Vorräte meines Vaters plündern kann, bevor er bemerkt, dass sein Verbandszeug schneller ausgeht als sein Weinvorrat.«
»Ich wusste gar nicht, dass ihr einen Weinkeller habt.«
»Haben wir auch nicht, das ist ja das Problem. Warum sollten wir auch umständlich einen Weinkeller anlegen, wenn die Flaschen ohnehin schon halbleer sind, noch bevor sie zuhause ankommen? Sitz der Verband fest genug?«
Ich nickte und nutzte eine freie Kralle, um den Stoff durchzutrennen. Gé und ich waren ein eingespieltes Team und verstanden uns auch ohne große Worte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wie oft ich ihm schon Schwierigkeiten bereitet hatte, doch hatte er sich noch nie bei mir darüber beklagt. Nicht ein einziges Mal. Stattdessen war er immer für mich dagewesen, wenn ich ihn gebraucht hatte, und half mir, meine Wunden zu verbinden, wenn ich wieder einmal unaufmerksam gewesen bin.
»Und was ist das hier?«
»Mh?« Gé schielte auf den kleinen Lederbeutel zwischen meinen Pfoten, während er das Verbandszeug umständlich wieder in seiner Hose verstaute. »Ein kleiner Leckerbissen für dich. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass ich dich wieder flicken muss und wollte mal etwas Neues ausprobieren.«
Ich löste vorsichtig den Knoten an dem Säckchen und zupfte das Band aus der Öse heraus. Das Leder klappte auseinander und der salzige Geruch von frisch geräuchertem Fisch erfüllte die Luft. Ich sog den Geruch tief in meine Lunge hinein, rümpfte dann jedoch meine Schnauze.
»Baldrian?«
»Nein, Gänseblümchen.« Gé grinste mich an. »Natürlich ist es Baldrian. Du brauchst etwas für die Nerven und nachdem du das letzte Mal so heftig auf den Lavendel reagiert hast… nun ja.«
»Hey! Ich kann nichts dafür, dass du versucht hast, mich zu vergiften. Das ist immer noch meine Aufgabe.« Ich zückte eines der rostbraunen Fischblättchen und knabberte vorsichtig daran herum. »Wie geht es eigentlich deinem Vater? Hat er immer noch diese Rückenschmerzen?«
»Vermutlich.«
»Du weißt es nicht?«
Gé zuckte lustlos mit den Schulter und griff selbst in den Lederbeutel hinein. »Er jammert immer so viel. Da ist es auf Dauer schwer abzuschätzen, ob er wirklich Schmerzen hat oder einfach nur etwas Mitleid haben möchte. Solange er keine wirkliche Hilfe braucht, geht mich das nichts an.«
»Er ist dein Vater, Gé, und er hat Schmerzen.«
»Die hat Bertrand auch, aber du wirst mich nicht dabei erwischen, wie ich seine Hüfte mit irgendeiner stinkenden Salbe einreibe. Ich habe immer noch meinen Stolz.«
Ich musste lachen. Bertrand war der örtliche Ochsenbulle und hatte seit seinem Unfall mit einem umgestürzten Pflugscharen einen schiefen Rücken. Wir waren uns zwar sicher, dass er inzwischen keine Schmerzen mehr hatte, doch sobald eine Gruppe kleiner Kinder an ihm vorbeilief, fing er an, wehleidig zu blöken, bis sie ihn am Kopf kraulten. Die Vorstellung, wie Gé nun seinen massigen Körper mit einer klebrigen Salbe einschmierte, war einfach zu komisch, zumal ich ohnehin den Verdacht hatte, dass er sich insgeheim vor Bertrand fürchtete.
»Du bist wirklich gemein, Gé.«
»Na und? Wie ist der Fisch?«
»Überraschend gut.« Ich schob mir ein zweites Stückchen in den Mund und kaute energisch darauf herum. »Für meinen Geschmack ist er zwar ein bisschen bitter, aber es ist immer noch Fisch. Sollte ich davon eigentlich so furchtbar… furchtbar…«
Ich musste kräftig gähnen und hätte beinahe Gés Fischstückchen fallengelassen, hätte ich den Beutel nicht im letzten Moment gegen meinen Bauch gedrückt. Eine schwer fassbare Müdigkeit legte sich über meinen Verstand, ließ meinen Körper jedoch hellwach zurück. Gé dagegen grinste mich breit an. Der Mistkerl musste es darauf abgesehen haben und schien sich nun köstlich zu amüsieren.
»Müde, Val?«
Anstatt ihm zu antworten, gähnte ich noch einmal.
»Vielleicht habe ich es mit dem Baldrian doch etwas übertrieben, aber du brauchst offensichtlich etwas Ruhe. Wie geht es deinem Handgelenk?«
»Welches Handgelenk denn?«
Ich legte meinen Kopf auf Gés Schulter und drückte ihm den Lederbeutel zurück in die Hand, nicht ohne mir vorher noch eine Pfote voll Fischstückchen herauszunehmen. Für eine Weile saßen wir einfach nur schweigend im Wald und teilten uns den trockenen Fisch, während um uns herum langsam die Dämmerung heraufzog. Auch wenn ich mir den Abend anders vorgestellt hatte, hätte es nun wirklich schlimmer kommen können.
Ich kann dir nicht sagen, wie viel Fisch es gebraucht hat, um meine Nerven wieder vollständig unter Kontrolle zu bringen. Es muss aber eine ganze Menge gewesen sein, denn am Ende bin ich wohl eingeschlafen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, meine Augen nur für einen kurzen Moment zu schließen, um das Surren der Insekten, das Rascheln der Blätter im Wind, sowie das Gefühl von Moos unter meinen Läufen und Gés Atem auf meinem Pelz zu verinnerlichen, so wie ich das jedes Mal tat, wenn die Abenddämmerung über mich hereinbrach. Doch dieses Mal musste ich jegliches Zeitgefühl verloren haben, denn als ich meine Lider wieder hob, war es längst dunkel geworden. Mein Kopf dagegen lag nicht mehr auf Gés Schulter, sondern musste zwischenzeitlich auf seinen Schoß gerutscht sein. Vielleicht habe ich mich auch einfach hingelegt. Genau daran erinnern kann ich mich jedenfalls nicht mehr.
Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie peinlich mir das gewesen ist. Nicht einmal Gé gegenüber konnte ich mich überwinden, so vertraulich zu werden. Ich war eine eingeschworene Einzelgängerin und hatte daher weder sonderlich viele menschliche Freunde, noch die Möglichkeit, mir einen festen Freund zu suchen, dem ich überhaupt hätte näherkommen können. Als wölfisches Monster hatte ich ohnehin kein Anrecht auf Liebe, Zuneigung oder auch nur das flüchtige Interesse eines netten Jungen. Liebe war das gottgegebene Vorrecht von Menschen. Ich dagegen zählte zu Melloires Brut und musste mich damit begnügen, die Gesegneten heimlich aus der Ferne zu beobachten, während sie wie ein Schatten händchenhaltend an meinen Verstecken vorüber eilten. Ich selbst hatte keinen Anspruch darauf.
Gés liebevolle Anwesenheit betrachtete ich daher auch als meine persönliche Strafe. Tag für Tag hielt er es ohne zu murren in meiner Gegenwart aus, ertrug meine monströse Erscheinung und blieb an der Seite des Ungeheuers, ohne es dafür zu verdammen, dass es nicht so war, wie er selbst. Doch jedes Mal, wenn ich ein zärtlich umschlungenes Paar beobachtete, erinnerte seine Gegenwart mich schmerzlich daran, was ich ihm mit meiner Existenz für Qualen zufügen musste. Ich konnte ihm nicht geben, was er verdient hatte.
Durfte es nicht.
Dass er sich freiwillig in meiner Nähe aufhielt, hatte ihn schon früh den Respekt der anderen gekostet. Die Jungs nannten ihn »Fellstopfer«, die Mädchen »Pelzleger«. Dass wir uns körperlich nie nähergekommen waren, spielte für sie keine Rolle. Er zumindest ertrug den Spott mit einer stoischen Gelassenheit, die ich mir nicht einmal ansatzweise vorstellen konnte. Für seine Eltern dagegen musste es eine herbe Enttäuschung sein, mitansehen zu müssen, wie ihr Sohn seine Zeit mit einem Monster wie mir verschwendete. Es würde mich noch nicht einmal wundern, wenn sein Vater zu einem Trinker geworden war, weil er den Gedanken daran nüchtern einfach nicht mehr ertragen konnte.
Gé und ich jedenfalls waren nur gute Freunde. Entsprechend schockiert war ich zunächst auch, als ich auf einmal meinen Kopf auf seinem Schoß wiederfand. Ich zuckte zusammen, aber Gé lachte nur und strich mit seinen Fingern durch das Fell über meiner Stirn.
»Na? Gut geschlafen, Faulpelz?«
»Ja, viel zu gut. Jetzt werde ich die halbe Nacht über bestimmt kein Auge mehr zubekommen. Vielen Dank auch.«
Ich wand mich ungeschickt aus seinen Fingern heraus und hoffte inständig, dass er im Dunkeln das Blut in meinen Wangen nicht bemerkte. Warum konnte ich mich nicht mit meinen pelzbedeckten Gelenken schämen? Dann könnte ich das überschüssige Blut einfach loswerden, ohne dass es jemand mitbekommt.
»Ach, hab’ dich nicht so, Val. Wir wissen doch beide, dass du die meiste Zeit über ohnehin bei den Schafen auf der Weide schläfst, während Chien deine Arbeit für dich erledigt und du dafür nachts den Mond anheulst.«
»Das sind nur Gerüchte, Gé.«
Gés Zähne blitzten zwischen dem Grün der Sträucher hervor. »Ach, wirklich? Morgen ist Vollmond, Val.«
»Wirklich?«
»Soweit ich weiß.« Gés Grinsen floss in die Breite. »Heißt es nicht, dass ihr Wölfe euch dann die Klamotten vom Leib reißt, nackt in den Wald rennt und euch gegenseitig eure Körper mit Zaubersaft einreibt, damit ihr euch nicht versehentlich wieder in Menschen verwandelt?«
»Ha! In deinen Träumen vielleicht.« Ich zog meine Krallen zurück und boxte Gé in die Seite. »Vergiss nicht die Stelle, an der wir Melloires Geist beschwören, in seinem Namen dreizehn Jungfrauen opfern und schwarzen Hunden ihren pelzigen Arsch ablecken. Da fällt mir ein, ich habe irgendwo noch eine Einladung für dich, mein kleiner Bisclavret…«
Gé verzog sein Gesicht zu einer angewiderten Grimasse. »Nett, dass du an mich gedacht hast, aber ich denke, ich muss ablehnen. Mir fällt gerade ein, dass ich allergisch auf Menschenopfer reagiere. Aber falls eine der Jungfrauen übrigbleiben sollte, kannst du sie mir ja gerne mitbringen.«
»Quatschkopf.«
»Wolfsmädchen.«
Wir mussten beide kräftig lachen. Mit Gé war alles anders, alles einfach. Wir konnten uns ohne größere Probleme gegenseitig verstehen und stritten uns nie. Gemeinsam konnten wir über alles lachen, unabhängig davon, ob eine Ente beim Landeanflug schnatternd auf ihren Schnabel fiel oder ob die Nachbarskinder mich wieder einmal mit Steinen bewarfen. Gé brachte es stets irgendwie fertig, dass selbst der größte Schmerz sich wie ein gelungener Witz anfühlen konnte. Wie er das immer wieder aufs Neue anstellte, war mir jedoch schleierhaft. Sah man ihn durch das Dorf laufen, wirkte er stets so gefasst und ernsthaft, als wäre er auf dem Weg zu seiner eigenen Beerdigung. Sobald man ihn aber einmal unter vier Augen traf, war er genauso verspielt wie ein junger Welpe. Vielleicht steckte ja ein kleines bisschen Werwolf in ihm drin? Wundern würde es mich inzwischen nicht mehr.
»Darf ich dir eine Frage stellen, Val?« Gé kratzte sich umständlich an der Nase. »Wie fühlt es sich eigentlich an?«
»Was meinst du?«
Er nickte mit dem Kinn in Richtung meines neuen Verbands. »Das da. Es fällt mir immer noch schwer, das nachvollziehen zu können. Tut das nicht schrecklich weh?«
Ich zog meinen Pelz weiter nach unten, bis der Verband vollständig unter seinem weichen Flaum verschwand. »Nein. Zumindest nicht am Anfang. Es ist eher so, als ob du einen Fisch ausweidest. Ein kleiner Schnitt in fremdes Fleisch, um das schleimige Innere herauszuholen, bevor du den eigentlichen Fisch genießen kannst. Das Gefühl selbst ist widerlich, aber nicht weiter wichtig, da es nicht dein eigenes Fleisch ist, das aufgerissen wird, sondern das eines toten Fisches. Es tut mir nicht weh, bis ich feststelle, dass ich mir versehentlich dabei in den Finger geschnitten habe. Verstehst du, was ich meine?«
»Ich schätze schon.«
Ich schüttelte meinen Kopf. »Nicht wirklich. Ich möchte leben, Gé, möchte ein Leben führen, wie jeder andere auch. Aber wo ich auch hingehe, heißt es, ich hätte kein Anrecht darauf, ich würde nicht zu euch gehören, wäre ein Fehler, den man korrigieren muss. An manchen Tagen verstehe ich, was sie damit meinen, an anderen möchte ich einfach nur noch davonlaufen, damit ich sie nicht mehr verstehen muss.« Mein Körper fing wieder an zu zittern und ich zog meine Beine an mich heran, damit es nicht so sehr auffiel. »Kennst du das Gefühl, wenn tief in dir drin ein Feuer wütet, das du nicht kontrollieren kannst und das dich von innen heraus verzehrt, bis du nur noch eine leere Hülle bist, die von einer dünnen Schicht verkohltem Leder zusammengehalten wird? Wenn sich in dieser Hülle ein immer stärkerer Druck aufbaut, der sie zu zerreißen droht, wie ein mit Wasser aufgefüllter Trinkschlauch, in den mehr und immer mehr kochendes Wasser hinein gefüllt wird, obwohl er längst am überlaufen ist? Du kannst entweder danebenstehen und dabei zusehen, wie er früher oder später platzen wird…«
»…oder du kannst ein Loch in ihn hineinstechen und das überschüssige Wasser ablaufen lassen?«
Ich nickte. »Einen aufgestochenen Schlauch kannst du wieder reparieren, einen geplatzten wirft man weg. Ich möchte nicht weggeworfen werden, Gé.«
»Mhm. Könnten wir nicht auch einfach das Wasser woanders hingießen? Dann müsstest du den Schlauch schließlich auch nicht mehr reparieren.«
»Und wie stellst du dir das vor? Ich versuche das schon seit sechzehn Jahren. Sechzehn! Kannst du dir vorstellen, wie viel Zeit das ist? Das einzige, was ich inzwischen vorweisen kann, sind unzählige Brandblasen und Narben, immer noch mehr Narben. Mir geht langsam die Haut aus.«
»Und was ist, wenn du versuchst es positiv zu sehen?«
Ich fuhr herum und blickte Gé scharf an. »Was soll daran bitte schön positiv sein?«
»Deine Narben ergeben immerhin ein hübsches Muster.«
Ich blinzelte ihn irritiert an, brach dann jedoch in schallendes Gelächter aus.
»Du bist ein Arsch, weißt du das?«
»Danke. Ich gebe mir wirklich Mühe.«
Ich verpasste ihm noch einen sanften Schlag auf die Schulter und stemmte mich zurück auf die Läufe.
»Komm, gehen wir nach Hause. Es wird schon langsam spät.«
»Bin dir dicht auf den Fersen, Wolfsmädchen.«
“I, THE MISERABLE AND THE ABANDONED, AM AN ABORTION, TO BE SPURNED AT, AND KICKED, AND TRAMPLED ON.”
Jevole war ein ausgesprochen friedlicher Ort. Das Dorf lag eingekeilt zwischen den Ausläufern eines Bergmassivs, das die Einwohner einfach nur »Laroche« nannten, und dem Taré, einem wilden Grenzfluss zwischen Monguile und Lamoissac. Das Dorf selbst war zwar nicht sonderlich groß und zählte nur wenige hundert Einwohner, doch verlief die zentrale Verbindungsstraße zwischen Monguile und Lamoissac genau durch seine Mitte hindurch und teilte den Ort in zwei Hälften, die in einem stetigen Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der durchreisenden Händler miteinander standen. Dennoch verstanden sich die Einwohner Jevoles dabei auch immer als Nachbarn und pflegten einen fast schon familiären Umgang miteinander, unabhängig davon, ob man nun auf der nördlichen oder der südlichen Seite der Straße wohnte. Um es kurz zu machen: Jevole war ein geeigneter Ort, um ein beschauliches, friedliches Leben führen zu können.
Sofern man kein Werwolf war, versteht sich. Für mich galten andere Regeln.
Du hast auf deinen Reisen bestimmt schon viele solcher Dörfer gesehen. Kleine, abgeschiedene Orte, deren Existenz man längst wieder vergessen hat, sobald man die nächste größere Stadt betreten hat. Kleine Orte, in denen nichts als Friede und Eintracht zu herrschen scheint, in denen das Leben seinen geordneten Gang geht und die größte Bedrohung eine Wolke am Himmel darstellt.
Du weißt bestimmt auch, dass, wenn man sich nur lange genug in ihnen aufhält, die ganzen hässlichen Details gerüchteweise an die Oberfläche treiben wie verendete Fische auf dem Grund eines Sees. Der Metzger verkauft Fleisch von verwesenden Tieren, die er tags zuvor auf der Straße gefunden hat (natürlich nur an Durchreisende, aber das versteht sich schließlich von selbst). Der Müller wälzt sich mit seiner Tochter in eben jenem Mehl herum, aus dem er am nächsten Morgen das Brot für seine Nachbarn backt (dass es seine eigene Tochter ist – geschenkt. Das macht der Hufschmied schließlich auch und tauscht sie gelegentlich gegen den Sohn des Tischlers ein). Und was in der Sakristei von Vater Étienne vorgeht, möchte man ohnehin lieber gar nicht erst wissen, sofern man sich nicht dafür interessiert, woher der heilige Messwein wirklich stammt.
Für mich selbst spielte das alles keine Rolle. Auch wenn es von den Erwachsenen niemand wagte, mich auszustoßen, um bei seinen Nachbarn nicht als unhöflich dazustehen, bestand ihre größte Freundlichkeit mir gegenüber noch darin, mich nicht anzurempeln, wenn ich ihnen entgegenkam, sondern dass sie von vornherein auf die andere Straßenseite auswichen. Kam ich ihnen doch einmal zu nahe, rümpften sie die Nase. Wandte ich mich von ihnen ab, rollten sie mit den Augen. Befand ich mich augenscheinlich außer Hörweite, folgten mir leise Flüche und Verwünschungen. Gerüchte über mich sind mir erstaunlicherweise aber keine zu Ohren gekommen. Zumindest keine hinter vorgehaltener Hand.
Die einzigen, die mich mit so etwas wie Respekt behandelten, waren die durchreisenden Kaufleute. Kam ich langsam auf sie zu oder schielte auf ihre Waren, schüttelten sie unmerklich ihren Kopf oder traten instinktiv einen Schritt zurück. Doch sobald ich meinen Geldbeutel zückte, wich die Skepsis in ihrem Blick dem deutlich sichtbaren Geräusch klimpernder Münzen. Vermutlich hielten sie mich einfach nur für eine Närrin, die sie leicht über den Tisch ziehen konnten. Aber wenigstens versuchten sie ernsthaft, mit mir ins Geschäft zu kommen. Das war immer noch mehr als ich von den meisten anderen behaupten konnte.
Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, war das vermutlich wohl auch der Grund, warum ich mich immer besonders gerne in der Nähe der Hauptstraße aufgehalten habe. Am liebsten habe ich mich hinter einem der dichteren Büsche versteckt und dem malerischen »clic-clicety-clic-clic« der vorbeiziehenden Esel gelauscht, wenn ihre Hufe gleichmäßig auf die Steine schlugen. Für mich selbst hatte ich das immer als »le lai de l’âne«, »das Lied des Esels«, bezeichnet, auch wenn es am Ende nichts anderes war, als das willkürliche Schlagen von Hufen auf Stein. Ich hätte stundenlang im Gras liegen und ihrer unsteten Melodie lauschen können. Doch leider hat es nie länger als ein paar viel zu kurze Minuten gedauert, da nur die wenigsten Händler sich mehr als einen oder zwei Esel leisten konnten.
Inzwischen war das unschuldige »clicety-clic« der Esel einem anderen Lai gewichen, einem Lai, das einer dunkleren, melancholischeren Form von Poesie entstammte und einem düsteren Metrum folgte.
Tropfen.
Für Tropfen.
Für Tropfen.
Für Tropfen.
Auch wenn ich alles andere als begeistert davon war, mir seine blutigen Verse auf die Haut zu schreiben, war es bislang die einzige Möglichkeit für mich, den Druck in meiner Brust zu lindern. Sein ätherisches Lied wiegte mich in den Schlaf und entführte mich in eine Welt, die ohne beißende Traumgestalten auskam und in der ich genau der Wolf sein durfte, der ich schon immer gewesen bin.
Doch wie bei jedem anderen Lied auch, verstummte sein Klang wieder und wich der erschreckenden Stille leise tröpfelnden Blutes. Soweit ich mich erinnern kann, war das das einzige Mal, bei dem ich Gé nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich spürte den Schmerz, spürte ihn mit jeder Faser meines Körpers, und er beruhigte mich tatsächlich, auch wenn es sich nicht nach meinem Körper anfühlte. Doch was ich ihm nicht erzählt hatte, war, dass der wirkliche Schmerz erst dann einsetzte, sobald seine beruhigende Wirkung wieder nachließ. Denn dann übernahm mein Bewusstsein die Kontrolle über den Traum und zerriss seinen zarten Schleier mit der Gnadenlosigkeit eines tollwütigen Jagdhundes.
Der wirkliche Schmerz lag nicht in meinen Armen. Er lag auch nicht in der Erkenntnis, dass ich langsam verblutete. Der wirkliche Schmerz setzte erst dann ein, wenn mir bewusst wurde, dass ich Valérie schon wieder im Stich gelassen hatte, dass ich den Worten der anderen mehr Bedeutung zukommen ließ als den ihren, und dass ich schon wieder bereit gewesen war, sie in einem Anflug der Verzweiflung zu opfern, nur damit ich einen kurzen Moment der Ruhe genießen konnte. Ich hatte sie verraten. Ich war ein Monster.
Ich musste ausgelöscht werden.
Ha! Siehst du, was ich meine? Jevole war ein friedlicher Ort. Er war friedlich, weil all das Misstrauen, all die Verachtung, all der Hass, den die Dorfbewohner im Geheimen aufeinander hegen mochten, auf dem pelzigen kleinen Mädchen abgeladen werden konnte, das sich nicht zur Wehr setzte, weil es eine andere Sprache sprach als sie. Weil es anders war. Weil es glaubte, ihren Hass auch verdient zu haben — und ihn dankbar entgegen nahm.
Ja, dankbar. Tatsächlich war sie sogar ausgesprochen froh darum. Sie genoss die Beleidigungen und den Schmerz, der aus ihnen hervorging, weil es für sie bedeutete, eine Aufgabe zu besitzen, eine Funktion. Sie war kein bloßes Monster, keine zufällige Missgeburt. Sie war das gefeierte Opferlamm Melloires und damit ein fester Bestandteil von Jevole. Sie gehörte dazu, hatte einen Nutzen. Ihre bloße Anwesenheit stützte die Gemeinschaft und bewahrte sie davor, sich selbst zu zerfleischen. Und war das nicht unendlich viel wertvoller als die Tränen eines unbedeutenden Hirtenmädchens?
Für Valérie war das natürlich nur ein schwacher Trost. Sie wollte so frei sein, wie ich es war. An manchen Tagen wünschte sie sich nichts sehnlicher, als zu den anderen dazugehören und ihnen notfalls auch meinen Pelz als Friedensgeschenk anzubieten. An anderen Tagen wollte sie sich lieber in einen Wolf verwandeln, Jevole endgültig den Rücken zukehren und einfach spurlos im Wald verschwinden. Beides war für sie nicht möglich. Sie war nur ein verängstigtes kleines Mädchen und liebte ihre Schafe über alles. Sie brauchten sie, waren auf sie angewiesen. Den Gedanken, sie einfach in Jevole zurückzulassen, obwohl sie für sie verantwortlich gewesen ist, konnte sie nicht ertragen. Sie aber einfach mit sich in den Wald zu führen, war aus praktischen Gründen ebenfalls nicht machbar. Ihre einzige Möglichkeit bestand darin, sich ihrem Schicksal zu beugen und das dankbar entgegenzunehmen, was man ihr anbot. Sie war eine Gefangene in ihrem eigenen Körper.
Ich dagegen bin über das kleine Mädchen hinausgewachsen und allem Widerstand zum Trotz das geworden, was sie immer sein wollte. An dem Tag, an dem Gé ihr dabei geholfen hat, ihre Krallen wachsen zu lassen, habe ich geweint. Es waren keine Tränen der Trauer gewesen, keine Tränen der Verzweiflung oder der unbändigen Wut, wie in all den Jahren zuvor. Es waren Tränen der Freude. Ich habe Gé an den Schultern gepackt, ihn so fest umarmt, wie niemals zuvor, und bin freudestrahlend in den Wald gerannt. Ich habe erst später erfahren, dass ich ihn in meinem Übermut dabei versehentlich mit meinen neuen Krallen verletzt habe. Die Narbe auf seinem Rücken trägt er noch heute.
Damals habe ich mir geschworen, nie wieder jemand anderem Schmerzen zuzufügen. Ich bin zwar ein Werwolf, aber ich bin kein Monster, auch wenn sich das auf den ersten Blick zu widersprechen scheint. Seit meiner Verwandlung habe ich viel darüber nachgedacht, was das für mich bedeutet, warum ich existiere, warum ich nicht einfach auf den Laroche steigen und mich von der nächstbesten Klippe werfen sollte, um zumindest für einen kurzen Moment frei wie ein Vogel durch die Luft segeln zu können, bevor mein unnatürlicher Körper auf dem Boden zerschellt. Die Antwort lässt sich in einem Wort zusammenfassen, einem einzigen Wort.
Valérie.
Ich bin es dem armen Mädchen schuldig, dass ich am Leben bleibe und in ihrem Namen zu dem besten Werwolf heranreife, den Jevole jemals gesehen hat. Es macht mir nichts aus, wenn die anderen Dorfbewohner mich dafür meiden. Es macht mir nichts aus, wenn die anderen in meinem Alter mich deswegen beleidigen. Das kleine Hirtenmädchen steht unter meinem Schutz und ich werde nicht zulassen, dass sie ihr etwas antun. Ich liebe sie von ganzem Harzen und werde sie nicht leichtfertig aufgeben.
Ich bin Valérie, der Werwolf von Jevole.
Hey! Riechst du das auch? Ist das nicht der Geruch von verfaultem Fleisch?« Die Schritte auf der anderen Seite des Buschs wurden langsamer und verstummten schließlich vollständig. Kurz darauf raschelten einige der Zweige und Jeannes engelsgleiches Gesicht zwängte sich durch das Blattwerk hindurch. »Sieh mal, André! Meunier hat sich einen neuen Hund zugelegt. Ich wusste ja gar nicht, dass er ein Herz für verwahrloste Tiere hat und jetzt schon streunende Köter bei sich aufnimmt.«
Der Busch raschelte noch einmal und Andrés Gesicht tauchte wenige Zentimeter neben Jeannes auf. »Das ist kein Köter, Schatz, sondern Meuniers neue Schlampe. Ich hab’ gehört, der Alte kriegt in letzter Zeit seinen Schwanz nicht mehr hoch, weil seine Tochter gelernt hat, nein zu sagen.«
»Was? Und dann bespringt er jetzt schon Straßenköter? Ist ja widerlich.«
Jeanne zog ihren Kopf aus dem Gebüsch heraus, trat im nächsten Moment jedoch bereits um den Strauch herum und André folgte ihrem Beispiel. Ich hatte gerade noch genug Zeit, um mich aufzusetzen, als André auf mich zutrat und mir einen Tritt in die Seite verpasste. Ich jaulte auf und sprang mit einem Satz zurück auf meine Läufe.
»Lass den Scheiß, André, oder du ruinierst dir noch die Schuhe. Ich kann dir nicht schon wieder neue schenken. Die waren teuer.«
»Sorry.«
Ich rieb mir die schmerzende Seite und verfluchte mich dafür, dass ich nicht besser aufgepasst hatte, als ich mich hinter die alte Mühle geschlichen habe. Es war mir ausgesprochen wichtig, dass die anderen nichts von meinen Verstecken mitbekamen und die Mühle gehörte bisher zu meinen Lieblingsplätzen. Nicht nur war der Platz ausgesprochen abgeschieden, es lag auch immer ein Hauch von frisch gemahlenem Mehl in der Luft und das leise Kratzen des Mühlsteins war fast so betörend, wie das gleichmäßige Schlagen der Eselshufe. Jetzt würde ich mir wohl ein neues Versteck suchen müssen, bis Jeanne und André wieder vergessen hatten, dass sie mich hier entdeckt haben. Und das konnte dauern.
Jeanne selbst war eigentlich ein nettes Mädchen. Sie konnte beizeiten zwar wirklich gemein werden, doch beschränkte sie ihre Gemeinheiten für gewöhnlich auf einfache Beleidigungen und hielt die anderen durchaus zurück, wenn sie mit ihren »Späßen« zu weit gingen. Wirklich verwunderlich kam das nicht, war ihr Vater doch der Bürgermeister von Jevole und immer darauf bedacht, bei anderen einen guten Eindruck zu hinterlassen. Lediglich mit Meunier irrte sie sich gewaltig. Der alte Müller hatte seit einigen Monaten zwar tatsächlich eine Affäre am Laufen, doch war seine Geliebte nicht seine Tochter, sondern die Frau des Bürgermeisters — Jeannes eigene Mutter.
André dagegen war das genaue Gegenteil. Er hatte kein Problem damit, seine »Späße« auch einmal etwas handgreiflicher werden zu lassen. Die anderen Jugendlichen verehrten ihn dafür und rechneten damit, dass er in einigen Jahren selbst zum Bürgermeister ernannt werden könnte; immerhin war er es, der ihnen in Jevole eine lautstarke Stimme gab. Für mich war das natürlich ein Problem, doch gab es nichts, was ich dagegen hätte unternehmen können. André stammte zwar nicht von hier und lebte seit einigen Jahren im örtlichen Waisenhaus (Ja, Jevole besaß tatsächlich ein Waisenhaus, in dem durchreisende Händler Straßenkinder abgeben konnten, die sie unterwegs aus einem Anflug von Mitleid heraus aufgesammelt hatten. Die Idee dazu stammte übrigens von Jeannes Vater), doch zählte er schon lange als einer von uns. Und das erste, was er neuen Kindern beibrachte, war natürlich, wie man eine ordentliche Wolfsjagd organisierte. Eine Werwolfsjagd, sollte ich vielleicht sagen. Solange er die Kinder mit immer neuen Späßen unterhalten konnte, war er einer der einflussreichsten Einwohner vor Ort.
»Na, Köter, was machst du hier? Suchst du einen unbewachten Laib Brot, den du stehlen kannst?«
»Hunde fressen kein Brot, André.« Jeanne legte einen Arm um seine Schulter und sah sich demonstrativ nach allen Seiten um. »Aber du hast recht. Ich habe Filou schon länger nicht mehr gesehen. Hast du stattdessen etwa die arme Katze gefressen, Freak?«
Ich schüttelte meinen Kopf und stieß ein entschuldigendes Knurren aus. Das war keine Art, wie man mit einem Wolf umging, geschweige denn mit einem nahezu ausgewachsenen Werwolf. Dennoch standen die beiden in der Hierarchie unseres Rudels deutlich über mir und hatten meine respektvolle Demut verdient. André fing lauthals an zu lachen.
»Oh, sieh mal einer an. Der verlauste Köter beginnt zu knurren. Jetzt bekomme ich es aber mit der Angst zu tun. Hilfe. Hilfe.«
André holte plötzlich mit seinem Bein aus und trat mich in den Bauch. Ich taumelte zurück und stieß schmerzhaft mit dem Rücken gegen die Wand der Mühle. Auf der anderen Seite konnte ich hören, wie ein Sack Mehl laut polternd auf den Boden fiel.
»Scheiß Köter.«
»André! Die Schuhe!«
»Sorry. Es stört mich einfach, dass das Mistvieh nicht mit uns sprechen will. Sind wir ihm denn nicht gut genug?«
Ich schüttelte wieder meinen Kopf, verkniff mir aber das leise Winseln, das mir auf der Zunge lag. Ich war ein Werwolf und Wölfe sprachen nicht mit Menschen, wenn es sich vermeiden ließ. Für gewöhnlich ging das ohnehin nicht sonderlich gut aus. Da war es besser, von vornherein seine Schnauze zu halten und mit eingekniffenem Schwanz davonzuziehen. Lieber das, denn als ausgebreiteter Pelz vor irgendeinem Kamin zu enden.
Darüber hinaus hasste ich auch einfach meine Stimme. Für einen Wolf war sie viel zu hoch und fiepsig und klang in meinen Ohren wie das ängstliche Quieken eines langsam verblutenden Schweins. Für einen Menschen dagegen war sie viel zu rau und guttural, als dass sie von anderen Menschen noch als Stimme anerkannt worden wäre. Sie war eines echten Werwolfs einfach nicht würdig.
Du fragst dich jetzt bestimmt, wie Gé dort hineinpasst. Als er Valérie geholfen hat, ihre Krallen wachsen zu lassen und sie freudestrahlend in den Wald gelaufen ist, hat sie kurzerhand beschlossen, auch dort zu bleiben. Sie hat ihr altes Leben in Jevole aufgegeben und mir erlaubt, ihren Platz einzunehmen. Ich besuche sie zwar so oft ich kann, aber nur gelegentlich kehrt sie auch mit mir zurück und teilt mit mir ihre Zunge, aber auch das nur, wenn ich sie wirklich brauche. Für die restliche Zeit muss ich mit den knurrenden Fähigkeiten meines eigenen Mauls auskommen.
Gé hatte das alles nichts ausgemacht. Er kannte mich praktisch sein gesamtes Leben und verstand mich, unabhängig davon, ob er es nun mit einem Wolf oder einem Hirtenmädchen zu tun hatte. Er verstand, dass ich mich nicht beliebig in die arme Valérie zurückverwandeln kann, wenn ihm danach ist und konnte akzeptieren, dass ich ihn von Zeit zu Zeit lieber anknurrte anstatt ihn zu grüßen. Waren wir beide aber unter uns, war es mir oftmals möglich, Valérie zumindest zeitweise wieder die Kontrolle über meine Zunge zu geben. Für Leute wie André oder Jeanne dagegen hatte ich keine Worte übrig. Das war mir einfach zu riskant.
»Siehst du, Jeanne? Das Mistvieh gibt es auch noch offen zu. Wir sind ihm nicht gut genug.«
»Na und? Dann schweigt das Vieh eben. Was soll es dir denn ohnehin schon verraten können? Wie man einem Kätzchen am besten die Kehle aufschlitzt?«
»Hey, ich bin nun mal ein Menschenfreund und wenn andere nicht mit mir sprechen wollen, verletzt mich das zutiefst.«
Ich presste meine Kiefer zusammen, stieß aber dennoch ein tiefes Knurren aus. Ich war ein Werwolf und kein Mensch und ließ mir von niemandem etwas anderes einreden. Nicht von Jeanne, nicht von André und auch nicht von den freundlichen Leuten aus Jevole. Das heißt, meistens ließ ich mir genau das tatsächlich einreden und bezahlte dafür anschließend mit neuen Narben auf Valéries Haut, aber an manchen Tagen hatte ich einfach keine Kontrolle über meine Instinkte.
Jeanne ignorierte mein Knurren, aber Andrés Grinsen floss in die Breite. Er wusste ganz genau, wie ich mich fühlte und was er sagen musste, um mich mit einem gezielten Schlag verletzen zu können, selbst wenn er dabei nicht verstehen mochte, was hinter meinen Gefühlen stecken mochte. Er hatte einfach ein Talent dafür, anderen Schmerzen zu bereiten.
»Ihr zwei seid also nur gute Freunde, André? Ist es das, was du mir damit sagen willst? Muss ich jetzt etwa eifersüchtig werden und davon ausgehen, dass du hinter meinem Rücken damit anfängst, wilde Tiere zu bespringen, so wie Pelzleger und der alte Meunier?«