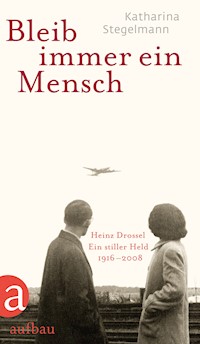10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie legt man eine Wildblumenwiese an, und was kann dabei schief gehen? Warum können nicht alle Hortensien blau sein? Ist es eine gute Idee, mit der Motorsäge in den Kirschbaum zu steigen? Und was kann man von Boris Palmer über Apfelbäume lernen? In ihrer beliebten Gartenkolumne bei SPIEGEL.DE widmen sich Barbara Supp und Katharina Stegelmann den Freuden, Fallstricken und Tücken, die einem ganzjährig im Garten begegnen können. Dabei sind die Experten-Tipps und Garten-Kniffe, die hier mitgegeben werden, von den Autorinnen selbst erprobt – und manchmal verworfen. Ein wunderschön illustriertes Buch mit vielerlei Wissen und Hilfestellung für alles, was grünt und blüht– unterhaltsame Lektüre für Menschen mit und ohne Garten. Und für Gartenliebhaber, die sich wünschen, ihr Daumen wäre ein wenig grüner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Wie legt man eine Wildblumenwiese an, und was kann dabei schiefgehen? Warum können nicht alle Hortensien blau sein? Ist es eine gute Idee, mit der Motorsäge in den Kirschbaum zu steigen?
In ihrer beliebten Gartenkolumne bei SPIEGEL.de widmen sich Katharina Stegelmann und Barbara Supp den Freuden, Fallstricken und Tücken, die einem ganzjährig im Garten begegnen können. Dabei sind die Experten-Tipps und Garten-Kniffe, die hier mitgegeben werden, von den Autorinnen selbst erprobt – und manchmal verworfen.
Ein schön illustriertes Buch für Menschen mit und ohne Garten. Und für Gartenliebhaber, die sich wünschen, ihr Daumen wäre ein wenig grüner.
Die Autorinnen
Katharina Stegelmann und Barbara Supp sind Pflanzenenthusiastinnen und bearbeiten ihre Gärten an zwei unterschiedlichen Enden dieser Republik: Katharina Stegelmann in Hamburg, Barbara Supp auf der Schwäbischen Alb. Die SPIEGEL-Redakteurinnen haben 2019 begonnen, ihre Kolumne »Der Wurm drin« im Wechsel zu veröffentlichen. Dies ist ihr erstes gemeinsames Buch.
Katharina Stegelmann / Barbara Supp
Ein ehrliches Buch übers Gärtnern
Mit Illustrationen vonPatrick Roscheund einem Nachwort vonJakob Augstein
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-2548-4
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage März 2022
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022
In Kooperation mit SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagabbbildung: Illustrationen von Patrick Rosche, Wien / Die Illustratoren, Hamburg
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Es gibt mehrere Arten Wurm im Garten, den Wurm im Kompost und den im Apfel, den einen mag man, den anderen nicht. Wir beide, Katharina Stegelmann und Barbara Supp, beschäftigen uns damit im eigenen Garten und in einer Kolumne auf SPIEGEL.de, die so heißt wie dieses Buch. Wir schreiben abwechselnd, Sie begegnen hier also zwei Gärten, die sich unterscheiden, und die Gärtnerinnen unterscheiden sich auch.
Ich, Barbara Supp, bin Tochter eines Schrebergärtners und hätte nie gedacht, dass ich mich einmal so definieren würde, aber so ist es nun. Aufgewachsen bin ich in einer Zeit, als der Kleingärtner routinemäßig mit der Giftspritze, nein, mit »Pflanzenschutzmitteln«, durch den Kleingarten zog. Mein Vater war keine Ausnahme, damals in den frühen 1960er-Jahren, später kam er glücklicherweise davon ab.
Wir vier Kinder hatten je ein eigenes Beet, in meines säte ich Radieschen und eine Wildblumenmischung, damals schon. Am besten gefiel mir die hellblaue Gretel im Busch. Ich mochte das sehr als Kind. Später, mit sechzehn ungefähr, dann nicht mehr so.
Noch später, in meiner ersten Tübinger Wohngemeinschaft mit Garten, kam wieder die Lust auf, in der Erde zu wühlen. Erstens musste die WG gefüttert werden, zweitens setzte sich der Ökogedanke durch. Wir hatten manchmal schönen Mangold, oft traurige Tomaten mit Braunfäule und immer wieder Kopfsalate, die nach WG-Partys völlig fertig im Beet hingen, zertrampelt und leider auch mit Flüssigkeiten malträtiert. Aber das war zum Glück nicht dauernd so – manche Salate kamen durch.
Gartenarbeit – oder Garteln, wie die Österreicher sagen, ein schönes Wort – war aber nicht nur in der Praxis wichtig, sie wurde auch politisch und schien uns wie das richtige Leben im falschen. Das Garteln sorgte für etwas Grün, während um uns herum so vieles dem Grau wich, dem Beton und der Chemie. Aber dann sang die schwäbische Band Schwoißfuaß 1980 ahnungsvoll: »Und isch mal in China a Atomexplosion, denn regnet’s auf euern Shit« – wir hatten im Garten keine Drogen gepflanzt, und die Atomexplosion war 1986 nicht in China, sondern in der Ukraine, aber mit allem anderen hatte die Schwabenband recht. In Tschernobyl explodierte ein Atomkraftwerk und schickte Trillionen von Becquerel in die Luft, der radioaktive Regen zog auch in unsere Richtung. Adorno, dachten wir, hatte doch recht: Das Richtige im Falschen konnte es nicht geben, jedenfalls nicht bei uns im Gemüsebeet. Ich gab das Gärtnern auf, für lange Zeit. Aber jetzt versuche ich es doch wieder.
Jetzt, vor sechs Jahren, haben wir den Garten der Schwiegereltern übernommen, rund ums Elternhaus des Mannes, der als mein »Mitgärtner« durch diese Seiten spukt.
Haus und Garten sind auf der Schwäbischen Alb, der Boden also: kalkig. Gelegentlich gibt es scharfe Fröste im Winter oder bisweilen auch im Frühling. Es sei hier »zwei Kittel kälter als in Stuttgart«, heißt es über die Region – mit der Feigenernte wird das eher nichts.
Wir rissen das kaputte Gewächshaus ab, mit dessen Hilfe die Schwiegermutter eine Sechs-Personen-Familie und Teile der Nachbarschaft versorgt hatte, mit Gurken, Paprika, Tomaten. Die sonnenwarmen Tomaten direkt vom Stock vermisst der Nachbar noch immer, sagt er.
Den Schuppen, in dem die Geräte standen, behielten wir, natürlich auch Sauzahn, Rechen, Sense, viele Werkzeuge der alten Art. Auch die Ehrungen vom Schwäbischen Albverein sind noch da und die Preise vom Kleintierzüchterverband, die sich der Schwiegervater mit den Angorakaninchen verdiente, die er pflegte, schor und schlachtete. Erst streicheln, dann essen – für die Kinder damals war dieser Umgang mit Tieren normal.
Wir übernahmen die Rosen im Vorgarten, ein paar Obstbäume und viel Rasen, denn als die Schwiegermutter alt wurde, ebneten wir ihre Kartoffel- und Erdbeerbeete ein und säten Gras. Der Rasen ist jetzt wieder auf dem Rückzug, muss Wildblumen weichen, Stauden- und Gemüsebeeten, wird mit Bäumen und Gehölz bepflanzt.
Die Schwiegermutter war immer gegen Gift, der Schwiegervater nicht so. Ich habe mir geschworen, ich halte es wie sie. Meine Mitkolumnistin sieht das ein bisschen anders. Und noch etwas: Ich hege den Wurm im Kompost und leide unter dem Wurm im Apfel, aber lieber als über den netten Wurm schreibe ich über den, der stört. Das unterscheidet uns.
Oder, Katharina?
Jein, würde ich sagen, liebe Barbara. Mit dem Gift bin ich nicht ganz so streng, das stimmt, vor allem, wenn es um Schnecken geht. Doch der böse oder trickreiche Wurm, der gibt auch mir Anlass, übers Gärtnern zu schreiben. Garteln bedeutet für mich: Lernen am lebenden Objekt, und das heißt nicht selten: scheitern. Oder feststellen, dass alles ganz anders kommt – und nicht selten trotzdem gut wird.
Aufgewachsen bin ich in der Südheide. In dem klassischen Nutzgarten meiner Eltern gab es Gemüse und Beerenobst, ein paar Blumen hier und da. Die Ernte war fester Bestandteil der Familienmahlzeiten und entlastete das Budget. Als Kind durfte ich bei Aussaat und Pflege helfen, ich durfte und musste nicht, und ich tat es sehr gern.
Nach dem Abitur zog ich in die Stadt und hatte das Landleben satt. Jahre später wohnte ich in einer Dachgeschosswohnung in Hamburg-Eimsbüttel, ohne Fahrstuhl, aber mit Dachterrasse, auf der bald große Pflanzgefäße standen. Mein Mann trug die Konsequenzen: viele Kilo Erde, viele Pflanzen hoch in den fünften Stock und dann noch die steile Treppe zur Terrasse hinauf.
Das Ende meiner Karriere als Dachgärtnerin begann mit ein paar Hornveilchen, die ich am Straßenrand pflanzte, weil ich sie loswerden wollte. Ein Jahr später begrünte ich einen harten Flecken Erde unter dem Baum vor unserer Haustür. Manche hielten mich für verrückt, viele freuen sich noch heute an dem Beet mit einer Rose in der Mitte.
Derweil sprengte das Chinaschilf die Pflanzgefäße auf der Terrasse, die Kletterhortensie drohte, das Geländer zu erwürgen. Es musste etwas passieren. Mein Mann sprach es aus: Du brauchst einen Garten.
Wir fanden unser Haus im Norden Hamburgs, fünfzehn Minuten dauert es mit der U-Bahn bis zur Binnenalster. Es liegt in einer der sogenannten Gartenstädte der Hansestadt, jedes Grundstück ist um die 500 Quadratmeter groß, jedes umsäumt von Buchenhecken.
Mein Mann und Mitbewohner hatte plötzlich sehr genaue Vorstellungen von der Gestaltung des Gartens. Es sollte ein Naturpool gebaut werden. Ich war entsetzt. Doch es nützte nichts. Der Mann blieb stur.
Die Anlage des Grundstücks wird heute vom ungefähr dreißig Quadratmeter großen Wasserbereich dominiert. Es sieht herrlich aus, und ich bin dankbar, so einen sturen und emsigen Hilfsgärtner an meiner Seite zu haben. Ein schmaler Streifen Grün neben dem Pool dürfte gern als Wildwiese wachsen, weigert sich bisher aber, denn der Boden unseres Grundstücks mit Südwestausrichtung ist vor allem eins: lehmig.
Auf der Holzterrasse stehen Pflanzgefäße, die zum Beispiel dem Rittersporn ein Asyl vor Schnecken bieten. Diverse Gehölze – Sommerflieder, Forsythie, Weigelie – schützen vor Blicken, ein alter Apfelbaum steht am hinteren Ende des Gartens, und vor dem Haus wachsen alte Hortensien und eine prächtige Magnolie. Es gibt Giersch in rauen Mengen und trockene Schattenplätze unter den Gehölzen, die zu begrünen ich mich bemühe. Manches ist vergeblich. Aber das gehört für mich zum Schönsten am Gärtnern: Es geht immer weiter.
Weiter zu garteln, weiter scheitern zu dürfen – wir beide, Katharina Stegelmann und Barbara Supp, empfinden das als Privileg.
Wir hoffen, wir scheitern immer besser.
Im Frühneuhochdeutsch hieß er früelinc, das Wort ist selbsterklärend, anschaulicher als dasjenige, das ihm voranging: Lenz sagte man früher zum Frühling und sagt es manchmal immer noch. Zeit des Wachsens, Blühens, Aufbrechens, seien es Blüten, seien es verkrustete, verknorzte Sitten. Arabischer Frühling, Prager Frühling heißt es dann, und immer hofft man, dass der Frost nicht die Blüten holt. Frühling ist Grün, ist Hoffnung, spät im Leben glaubte mein Vater im Winter nicht mehr recht dran, dass der Frühling kommen würde, aber dann kam er, mein Vater sah ihn nicht mehr gut, aber er spürte ihn. »Man möchte zum Marienkäfer werden, um in dem Meer der Wohlgerüche herumzuschweben«, das stammt von Johann Wolfgang von Goethe. Mein Vater hätte es nicht so gesagt, aber so sah er es auch.
davon sei in diesem Kapitel erzählt, wächst im Garten der Drang, an jedem Halm zu ziehen, an jeder Wildwiesenblüte, an jeder Blattspitze im Buchenbaum, wachs doch, blüh doch endlich, denkt man, und dann tun sie’s schließlich. Die nackte Erde will bedeckt sein, mit Kompost und mit Bodendeckern, mit allem, was man im Gartencenter so findet, das übrigens ein gefährlicher Ort sein kann. Es ist eine Zeit der Herausforderungen, nicht nur im Rosenbeet muss mutig geschnitten werden, und manchmal fließt dabei Blut. Kampfgeist kommt auf, wenn allüberall eine Pflanze wächst, die man zum Feind erklärt hat. An der Seite von Lieblingsgärtnern und Lieblingsgärtnerinnen lässt sich Gelassenheit lernen, die auch über Trennungen hinweghelfen kann: von einem störenden Baum mit vagabundierenden Wurzeln oder von einem Traum – dem von der eigenen Orangerie.
Und manchmal fließt Blut
Mein Mitgärtner war beim Heckenschneiden, dann kam er ins Zimmer und sagte: »Äh, haben wir eigentlich Jod?« In seiner Hose am Schenkel war ein Loch, im Schenkel auch. Ja, wir hatten Jod, abgelaufen im Jahr 2001. Die elektrische Heckenschere, 4.000 Schnitte pro Minute, war deutlich neuer.
Als er letztes Jahr vom Kirschbaum fiel, war er mit der Motorsäge am Werk, die Motorsäge hatte dankenswerterweise eine Abschaltautomatik und lief nicht weiter, als der Mitgärtner mit einem Bein eingeklemmt kopfunter in der Leiter hing, ich musste ihn befreien. Es war ein alter Kirschbaum, die ofenrohrdicken Äste waren morscher, als wir gedacht hatten.
In den sechs Jahren, die wir den Garten jetzt haben, ist mein Mitgärtner zweimal vom Kirschbaum gefallen, einmal vom Birnbaum, ich hole mir regelmäßig Zecken, von Kratzern, Spreißeln, blutigen Quetschwunden sollte man gar nicht erst reden. Neulich wollte ich mit der wunderbaren neuen scharfen Gartenschere einen kleinen Sanddorn zurechtstutzen und stutzte den linken kleinen Finger mit. Ich kam in die Notaufnahme. Man musste nähen.
Gärtnern ist gefährlich, die Natur schlägt gern zurück, Maschinen auch. Mein Mitgärtner weiß das, er hat früher viel beim Onkel auf dem Bauernhof gearbeitet. Er hat Erfahrung in Selbstverstümmelung.
Er stand als Sechsjähriger auf dem Kartoffelwagen, großkotzig, ohne sich festzuhalten. Der Wagen wurde damals noch von einem Pferd gezogen, einem Haflinger, klein, aber widerborstig, der lief plötzlich los. Der Mitgärtner steckte mit dem Kopf im Blecheimer, oder eher im Rand vom Blecheimer, die Narbe am Nasenrücken kann man heute noch sehen.
Zwei, drei Jahre später, beim Säen, ging derselbe Gaul mit ihm durch und zerlegte die Sämaschine. Diesmal blieb der Bub unverletzt, traute sich aber nicht nach Hause, weil: Schuld war er sowieso. Noch ein paar Jahre später fiel er vom Bulldog in die Pflugschar, beim Pflügen, und steckte mit dem linken Oberschenkel im messerscharfen Gerät. Er kam ins Krankenhaus. Auch davon blieb eine Narbe, circa 12 Zentimeter lang, die man noch gut sieht.
Gartenarbeit geht wie Landwirtschaft davon aus, dass Pflanze, Tier und Werkzeug beherrschbar seien, aber das ist nicht immer so.
Mein Mitgärtner mag Maschinen. Er denkt über einen Hochentaster nach, einen was? Einen Hoch-ent-aster. Damit kann man in großer Höhe Äste schneiden, ohne auf die Leiter zu müssen. Aber wie schwer ist so ein Ding? Ich sehe ihn schon auf dem Rücken liegen und zappeln wie einen Käfer. Ich denke an seine Vorerfahrung, ich zweifle. Jetzt im Frühjahr redet er auch beunruhigend oft über einen Hochdruckreiniger, einen Kärcher. Ich will das nicht. Ich muss immer an den französischen Ex-Präsidenten Sarkozy denken und seinen Säuberungswahn, er wollte ja einst mit dem Kärcher durch die Vorstädte ziehen.
Der Nachbar übrigens hat so ziemlich alle Maschinen, die ein Mensch im Eigenheim jemals brauchen könnte. Vielleicht kann der Mitgärtner sie dort leihen. Es ist ein Nachbar, dem die Maschinen aufs Wort gehorchen. So wirkt er jedenfalls.
Als die Nachbarin, die das Leben mit dem Nachbarn und seinen Maschinen teilt, vom Heckenschneiden und vom Loch im Schenkel hörte, sagte sie – das ist jetzt der Nutzwert dieser Kolumne: »Es gibt Schnittschutzhosen.« Die Maschine stoppt, wenn sie eine solche Hose berührt.
Das könnte ein Geburtstagsgeschenk sein. Oder vielleicht – heult da draußen nicht schon wieder die Maschine? – etwas für sofort.
BS
Der erste Rosenschnitt ist der schwerste
Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose: Philosophisch gesehen, stimmt der Satz möglicherweise, botanisch ist er definitiv Unsinn. Je nach Anschauung gibt es bis zu 250 Arten, es gibt Wild- und Kulturrosen, Kletter-, Beet-, Strauch-, Edel- oder Zwergrosen. Jede anders in Form, Farbe und Duft.
Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl für die Rosen in meinem Garten war die Farbe: Ich stellte mir eine luftige, frische Blütenpracht in Orange, Gelb und Weiß vor. Die Rosen sollten außerdem duften, gut winterhart sein und hohe Blattgesundheit aufweisen. Nach heutigem Stand war meine Wahl nicht schlecht: Von zehn Pflanzen haben neun überlebt, die meisten blühen auch üppig – und wachsen wie verrückt.
Und natürlich wachsen sie, wohin sie wollen. Im ersten Jahr habe ich sie so gut wie gar nicht beschnitten, dann immer nur sehr zaghaft, offenbar auch noch an den falschen Stellen. Das Ergebnis: Sie sind staksig, an der Basis zum Teil verholzt und kahl.
Mein Vater hat ein Mantra zum Rosenschnitt: Das dritte Auge über der Veredelungsstelle muss stehen bleiben, der Rest weg. Ich brachte das nie über mich. Ich hatte Angst, sie womöglich zu zerstören. Dass die Exemplare im Garten meiner Eltern bestimmt 20 Jahre alt sind und immer noch Jahr für Jahr wunderbar blühen, reichte nicht, mich zu überzeugen.
Es gibt die Theorie, dass man das gendern kann: Männer schneiden eher viel, Frauen meist viel zu wenig. Marieke Schulz-Gerlach, 42, passt in dieses Muster allerdings nicht hinein. Sie ist seit April 2012 »Revierleiterin Mitte« für den Bezirk Nord in Hamburg, als solche ist sie unter anderem für die Instandhaltung des Stadtparks verantwortlich. Allein in den vier je 1.000 Quadratmeter großen Rosengärten des Parks wachsen ungefähr 5.000 Rosen aller Art.
Schulz-Gerlach schneidet mit großer Beherztheit und in einem Tempo, dass einem schwindelig wird – sie hat schlicht keine Zeit, bei jeder Pflanze Augen zu zählen. Außerdem: »Drei, fünf oder sieben Augen sind nicht entscheidend«, sagt sie, »und auch nur für Beetrosen als Hinweis brauchbar.«
Zum Selberschneiden kommt die Ingenieurin für Landschaftsbau und Freiraumplanung eher selten. Das übernehmen die Mitarbeiter. Aber wenn Schulz-Gerlach zur Schere greift, dann fackelt sie nicht lange. »Das wichtigste ist, dass man weiß, warum man schneidet.« Sie weiß es ganz genau: »Ich will verjüngen.«
Ich habe gelesen, dass man Kletterrosen so gut wie gar nicht schneiden soll. Das stimmt nicht, sagt die Fachfrau: »Alle fünf Jahre kann auch die Kletterrose einen Schnitt zur Verjüngung vertragen.« In den Jahren dazwischen genüge es aber, sich auf optische und praktische Bedürfnisse zu beschränken. Wenn lange Zweige den Weg versperren, können die einfach weg.
In der Obeliskenform soll Ordnung herrschen, ohne Schnitt gäbe es ein riesiges Durcheinander, die Pflanze wäre struppig, und mit der Zeit verlören die Rosen – trotz Düngung – ihre Blühfreude. Anders als beim Haareschneiden, regt das Kürzen der Triebe das Wachstum an. Weil Rosen nur am neuen Holz blühen, ist das auch gut für die Blüte. »Nur wenn Sie schneiden, kann die Rose wieder blühen, der Schnitt verschafft ihr Vitalität, zu viel kann man nicht abschneiden«, sagt Schulz-Gerlach.
Ansonsten wird jede Rose anders beschnitten: Die Strauchrosen sollen buschig wachsen, die Edelrose hat nur eine Blüte pro Stengel, die Beetrose sieht schöner aus, wenn sie auch in den unteren Etagen Blüten trägt und nicht zu stark verholzte Stängel hat, daher muss sie unten geschnitten werden.
Die Rosen im Stadtpark dürfen nicht gespritzt werden, wie alle Pflanzen im öffentlichen Raum Deutschlands. Das bedeutet, die Exemplare, die sich als krankheitsanfällig erweisen, werden gnadenlos beseitigt. Schulz-Gerlach achtet bei der Auswahl neuer Pflanzen darauf, ADR-zertifizierte Rosen zu kaufen.
Auch im Privatgarten sollte man auf Spritzmittel verzichten; hat eine Pflanze zum Beispiel Rost entwickelt, muss man darauf achten, dass sie die anderen nicht ansteckt. Um das zu verhindern, schneidet man alle befallenen Blätter ab, auch ein Radikalschnitt kann ratsam sein.
Der alljährliche Rosenschnitt soll im Frühjahr gemacht werden, danach darf kein starker Frost mehr kommen. Wenn die Forsythien sich anschicken zu blühen, ist die beste Zeit, das sagt auch die Expertin im Stadtpark. Im Herbst kann man schon einen leichten Blütenrückschnitt machen, dann sieht alles etwas ordentlicher aus – allerdings verzichtet man damit auch auf die hübschen Hagebutten.
Meine leicht vermurksten Strauch- und Beetrosen haben schon ziemlich viele Blätter gebildet, weil der Winter so mild war. Sie sehen so lebendig aus, voll im Saft. Aber ich reiße mich zusammen, denke an die Fachfrau und schneide mutig drauflos. Und morgen schaffe ich vielleicht noch ein paar Zentimeter mehr.
KS
Wichtig ist, was hinten rauskommt
Mein Vater, der Schrebergärtner, nahm beim Spazierengehen manchmal Tüte und Schaufel mit, ich wusste, was er vorhatte, und schämte mich. Neulich zog ich los mit Tüte und Schaufel und tat es selbst. Ich machte mich auf den Weg zum Reiterhof, immer mit dem Blick nach unten, und fand etwas. Rossbollen. Braun, einigermaßen frisch, das Tier hatte, wenn ich es richtig interpretierte, viel Heu gefressen. Eine halbe Tüte schaufelte ich voll, dachte an meinen Vater und sagte zu einer Frau, die hoch zu Pferd den Weg entlangkam: »Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal mache.«
Sie sagte: »Für seine Blumen tut man alles.«
Ich fürchte, sie hat recht.
Man legt einen Komposthaufen an und freut sich über jeden Gemüseabfall und überlegt lange, ob zum Beispiel Eierschalen auf den Kompost dürfen. Mein Mitgärtner sagt Ja. Ich sage Nein. Es dauert zu lange, bis sie verrottet sind. Und es kann sein, dass die Ratte kommt, weil sie Eier mag.
Die Fachdiskussion: uneinheitlich. Von Ratten ist nicht viel die Rede, aber von anderen Lebewesen. Salmonellengefahr!, schreien die einen. Die anderen: Ja, theoretisch. Hypothetisch. Aber sie ist winzig klein. Eierschalen sind gut bei saurem Boden, sagen diese anderen auch. Wir haben viel Kalk, keinen sauren Boden, also ist die Sache geklärt.
Ich setze den Kompost zweimal im Jahr um und füttere ihn wie ein Haustier. Behauptet mein Mitgärtner jedenfalls. Ich stelle sozusagen Menüs zusammen, erst ein bisschen Vertrocknetes, dann frischen Grünschnitt, dann Kaffeesatz vom Morgen, etwas Obstschale, dann wieder kleine Stöcke und Äste dazwischen, die kommen automatisch vom Weidenbaum, der seine Äste darüber schwingt. Und dann manchmal besondere Liebesgaben: Reste vom Sauerteig, wegen der Mikroben. Oder die Pilze neulich. Der Mitgärtner war im Wald, allein, und brachte viel Falsches, das auf dem Kompost landete. Jetzt tanzen dort die Schnecken Tango, Pilze mögen sie offenbar sehr. Meinetwegen, denke ich, lieber tanzen sie dort als auf den kleinen, zarten, jungen Zucchini.
Für die Zucchini brauche ich reifen Kompost und deshalb Pferdeäpfel. Mit den Pferdeäpfeln hat mein Mitgärtner, nun ja, Probleme. Man kann es auch so sagen: Er lacht mich aus.
Das Pferd, finde ich, hat aus Gärtnersicht einiges gemeinsam mit dem Wurm: Wichtig ist jeweils, was hinten rauskommt. Der Wurm soll es schön haben bei mir, sich fröhlich durch den Kompost bewegen und bröckeliges Zeug fressen, das er hinten als Humus von sich gibt. Deshalb die Rossbollen.