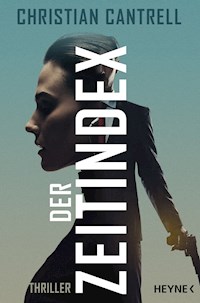
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die nahe Zukunft. Ein mysteriöser Serienkiller hält die Welt in Atem, denn die einzige Spur sind seltsame Zahlen, die er auf den Körpern seiner Opfer hinterlässt. CIA-Agentin Quinn Mitchell wird auf ihn angesetzt, und schon bald führt ihre Spur sie zu einer schockierenden Entdeckung – denn der Killer scheint mehr über Quinn zu wissen als sie selbst. Plötzlich muss Quinn sich den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit stellen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Ähnliche
Das Buch
Quinn Mitchell ist eine der führenden Analystinnen der CIA, doch ihr neuster Job stellt sie vor die Herausforderung ihres Lebens. In den letzten Monaten wurde in verschiedenen Ländern eine Reihe von Morden verübt, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben können. Die Opfer sind unterschiedlichen Alters und Geschlechts, gehen verschiedenen Berufen nach und kannten sich nicht. Doch eines haben sie alle gemeinsam – allen Toten wurde eine Nummer auf den Körper tätowiert, eingebrannt oder geätzt. Es muss sich um eine Art Code handeln, und Quinn soll ihn knacken. Sie folgt der Spur des Killers einmal rund um die Welt, doch immer ist sie dem Mörder einen Schritt hinterher. Bis ihre Ermittlungen ergeben, dass es eine Verbindung zwischen ihr und dem Killer geben muss – und als Quinn ihm Schritt für Schritt, Zahlencode für Zahlencode näher kommt, entdeckt sie ein Geheimnis, das alles, was Quinn über die Realität weiß, infrage stellt …
Der Autor
Christian Cantrell studierte an der George Mason University in Washington und arbeitet als Softwareentwickler bei Adobe Systems. In seiner Freizeit widmet er sich dem Schreiben von Science-Fiction-Romanen. Der Autor lebt in North Virginia.
Besuchen Sie uns auf
diezukunft.de
CHRISTIAN CANTRELL
DERZEITINDEX
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Norbert Stöbe
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
THE SCORPION
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Norbert Stöbe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 11/2021
Copyright © 2021 by Christian Cantrell
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabeund der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Hanne Hammer
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com(Jacob Lund, lassedesignen)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-24681-5V002
diezukunft.de
Inhalt
Prolog
ERSTER TEIL
1. Agentin des Chaos
2. Die Blase
3. Die Jagd auf Prime
4. Falsch-positiv
5. Ohne festen Wohnsitz
6. Gesundschrumpfen
7. Handwerkszeug
8. Heimvorteil
9. Mimikry
10. Verbrechen aus Leidenschaftslosigkeit
11. Kollateralschaden
12. Beinarbeit
13. Nachtschicht
14. Katastrophentourismus
15. Dharma
ZWEITER TEIL
16. Lungern in der Luxuslobby
17. Pitch-Rolling
18. Sechs Minuten
19. Amberley-Ash lächelt nicht
20. Abgetaucht
21. Alternative Realität
22. Schlechte Idee
23. Ablenkungsmanöver
24. Toter Briefkasten
25. Familienangelegenheit
26. Der Zeitindex
DRITTER TEIL
27. Männerhöhle
28. Gewebe
29. Geister
30. Tot bei Ankunft
31. Plüschfiguren, Katzen und Packen
32. Ausschlussverfahren
33. Schwarzer Ball
34. Backdoor
35. Das Rauschen
36. Positionsdaten
37. Nachbild
38. Kilonova
39. Überwinterung
40. Der Skorpion und die Schlange
41. Impakt
Danksagung
Prolog
Henrietta Yi und ihr Team sind seit drei Tagen unter der Erde.
Sie befinden sich in einer Tiefe von 150 Metern, unmittelbar unter der französisch-schweizerischen Grenze, und haben sich in das Leuchten einer Platte aus schwarzem Plasmaglas vorgebeugt. Der grüne, rechteckige Cursor an der Oberseite blinkt, doch ihre Augen sind gebannt von der Hoffnung auf Ergebnisse und blinzeln nicht.
Von dem Moment an, da er eingeschaltet wurde, hat der Large Hadron Collider weit mehr Rohdaten geliefert, als die Forscher verarbeiten können, weshalb der Großteil geradewegs in den PDB geleitet wurde, den Particle Detector Backlog, auch Kaltspeicher genannt. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit leitet Henrietta das Team, das den Auftrag hat, den Speicher aufzutauen, ihn in Scheiben zu zerlegen und eine unersättliche KI damit zu füttern, die darauf trainiert ist, Quantenanomalien zu identifizieren. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass in dem über Jahre hinweg gesammelten Rauschen unentdeckte Signale schlummern.
Was diese Signale bedeuten könnten, weiß niemand. Einige ihrer Kollegen hoffen, eine Bestätigung für die Theorie der Supersymmetrie zu finden und sich damit ihren Doktortitel zu verdienen. Andere würden gerne die Ersten sein, die auf einen Beleg für die Existenz von Multiversen stoßen. Und einige wenige glauben, dass möglicherweise ganz neue Teilchen gefunden werden – winzige Masseteilchen mit neuen Eigenschaften, die die Welt dazu zwingen werden, die Gesetze der Physik umzuschreiben.
Henriettas Hoffnungen sind nicht weniger ambitioniert. Ihr Vater ist bei einem Atomangriff auf Seoul umgekommen und hat seinem einzigen Kind das unermüdliche Streben nach dem Nobelpreis als Vermächtnis hinterlassen. Henrietta hat ihr Leben der Wissenschaft gewidmet und mehrere Angebote aus der Wirtschaft ausgeschlagen – inklusive der Aussicht auf ein unverschämt hohes Gehalt sowie Boni und Aktienoptionen –, nur weil sie unter der Erde arbeiten und genau das tun will, was sie gerade tut.
Als die ersten Zeilen hexadezimaler Daten erscheinen, wird es laut. Hinter ihr umarmen sich die Leute und recken die Daumen in die Luft, doch Henrietta bleibt fokussiert. Und dann verändert sich etwas in den Daten, und der Jubel verebbt.
Am Rand von Henriettas Gesichtsfeld tauchen Finger auf.
»Das ist ein Verschlüsselungsheader«, sagt jemand hinter ihr. »AES-Verschlüsselung, oder?«
»Seht mal. Es wiederholt sich. Wie bei einer … Blockchain.«
Die Zeichen werden nicht sequenziell angezeigt, sondern in unregelmäßiger Abfolge – manchmal fehlerhaft entschlüsselt, dann gleich wieder überschrieben. Doch mit dem Inhalt scheint irgendetwas anders zu sein. Das sind keine unverständlichen Bits, sondern zwei Textzeilen.
»Seht euch das an. Das ist kein Binärcode. Ich glaube, das ist …«
Mehrere Buchstaben werden verschoben und ersetzt, und dann, als der Algorithmus mit dem Buchstabengebilde zufrieden ist, springt der Cursor an eine andere Stelle:
Wir wissen wohl, was wir sind,
aber nicht, was wir werden können.
»Das ergibt keinen Sinn.«
»Weshalb sollte im Backlog des Teilchendetektors Text enthalten sein?«
»Woher zum Teufel kommt das?«
Henrietta rückt ihre große, runde Brille zurecht und blinzelt vor Konzentration. Im Geiste geht sie den Text mehrfach durch. Im Raum ist es so still geworden, dass sie das hochfrequente Heulen des angeregten Plasmaglases hört, das von Daten durchströmt wird.
»Woher ist die falsche Frage«, murmelt sie vor sich hin. »Wir müssen uns fragen, von wann das kommt.«
ERSTERTEIL
1
Agentin des Chaos
Bevor sie aufsteht, zieht Kira als Erstes ihre Beine an. Sie stehen in der Stehhilfe aus Stahl auf einer Ladematte neben dem Bett, und als die junge Frau sich aufrichtet, spannen sich ihre Rücken- und Schultermuskeln an. Die Nervenadapter in ihren Oberschenkeln justieren sich magnetisch an den Kontakten am Ende der Mulden aus Karbonfaser, und die Schnittstellen ziehen sich zusammen, bis die Verbindung stabil ist.
Irgendwo hat sie eine Kunsthaut, die sie darüberziehen kann, und wenn sie die Nahtstellen, an denen das texturierte Urethan und ihr Gewebe aufeinandertreffen, mit Shorts oder einem engen Rock kaschieren würde, sähe sie so aus, dass sie auf der Straße Begehren und Neid statt Neugier, Abscheu oder Mitleid erwecken würde.
Doch Kira lebt allein, deshalb bleiben die servomechanischen Gliedmaßen unkaschiert, und ihre Kleidung beschränkt sich auf Unterwäsche, Tanktop und die Metabrille im Pilotenstil. Ihre Zuflucht in der Penthouse-Suite des verdrehten und langsam rotierenden Infinity Moscow Tower hat sie seit fast vier Jahren nicht mehr verlassen. Sie hat keinen Grund, sich auch nur die Zähne zu putzen oder beim Pinkeln die Badezimmertür zu schließen.
Kira arbeitet nachts. Ihr Arbeitsplatz ist ihre Wohnung, und ihre Werkzeuge sind Instrumente der Täuschung und der Konspiration. Proxys verbergen ihre IP-Adresse und verweisen auf ihre zahlreichen Identitäten. Ihr Aufenthaltsort lässt sich vor der Außenwelt verbergen, doch Echtzeitinteraktion lässt sich nicht fälschen, weshalb Kira nachtaktiv geworden ist. Ihr Boss bezeichnet sie als »Triebkraft des Wandels«, doch das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Sie ist eine Triebkraft des Chaos.
Ihre Abendroutine beginnt damit, dass sie Tee macht. Sie schaltet den Wasserkocher in der Küche ein, und während sie wartet, bis das Wasser kocht, setzt sie sich hin, um den Monitor an ihrem Handgelenk einer Schnellladung zu unterziehen. Das Gerät lässt sich nicht entfernen, sodass sie es an Ort und Stelle laden muss. Sie verschränkt die Finger und beugt sich vor, beide Arme flach auf die Matte gelegt. Ein Blitz-Symbol taucht am Rand ihres Gesichtsfelds auf und zeigt an, dass ihre Brille über das biomagnetische Feld aufgeladen wird.
In die Ladematte sind Schichten einander überlappender Drahtspulen eingearbeitet, die warm, aber nicht heiß werden sollen, und als es verbrannt riecht und ein leiser Knall zu hören ist, schnellt sie hoch und weicht zurück. Ihr wird klar, dass es einen Kurzschluss gegeben hat. Mit einem Fußtritt löst sie sofort das Kabel aus der Steckdose, eilt zur Spüle und hält den Arm unter den kalten Wasserstrahl.
An der Innenseite des Unterarms haben sich bereits rundliche rote Quaddeln gebildet. Es tut weh, aber sie ist Schmerzen gewohnt. Sie hat ständig Schmerzen und deshalb gelernt, sie lediglich zu registrieren, statt sie an sich heranzulassen.
Bevor die Raketen eingeschlagen sind, war Kira die Haupteinnahmequelle ihrer Familie, und noch ehe sie das Krankenhaus verlassen konnte, hatten ihre Eltern dafür gesorgt, dass sie wieder vor einem Computer saß. Zu Hause hatte ihr Vater sie zwischen dem Schreibtisch und der Toilette hin und her getragen, und ihre Mutter hatte ihr die Verbände gewechselt, ihr Suppe gebracht und sie gebadet. Über den Vergeltungsangriff, den sie mit ihrer Arbeit provoziert hatte, hatten sie kein Wort verloren. Das gehörte der Vergangenheit an, und die ließ sich nicht ändern. Kira musste früh lernen, dass manche Menschen es sich nicht erlauben können, sich den Ängsten von gestern oder den chronischen Schmerzen der Gegenwart hinzugeben.
Wenn ihr persönliches Überwachungssystem ausfällt, soll sie unverzüglich ihre Betreuer informieren. Scheiß drauf. Sie weigern sich, irgendwas anderes als russische Ware zu verwenden, was bedeutet, dass die Hälfte davon Schrott ist und die andere Hälfte beschissene Firmware, die jedes Scriptkiddie hacken könnte. Wenn ihr Monitor ausfällt und ihre Biometrik plötzlich offline geht, können sie sich denken, dass ihr Ladegerät durchgeschmort ist.
Kira schiebt die Balkontür auf, um zu lüften. Für gewöhnlich sieht sie erst nach den Tauben, wenn der Tee zieht, doch heute tritt sie in den kalten Moskauer Abend hinaus.
Einmal pro Tag trifft ein Vogel mit einem handgeschriebenen Chiffrierschlüssel ein, den man ihm am Bein befestigt hat. Tauben übermitteln Botschaften eigentlich nur in eine Richtung. Sobald sie sich an ein Zuhause gewöhnt haben, fliegen sie immer dorthin zurück. Um sie erneut einzusetzen, muss man sie einsammeln und wieder verteilen. Diese Tauben aber sind genetisch verändert worden und haben ein zweigeteiltes Gehirn, dessen Hälften lichtabhängig dominieren. Tagsüber fliegen sie in die eine Richtung, nachts in die andere. Wie Kira haben auch die Taubenbetreuer gelernt, deren multiple Identitäten in Waffen zu verwandeln, die sich gegen zahlreiche Feinde einsetzen lassen.
Der heutige Vogel ist noch nicht eingetroffen, doch die Nachtluft tut gut, deshalb geht Kira nicht wieder hinein. Sie spürt den Frühling in den Silikonkacheln, als sie am Taubenschlag vorbeigeht, legt ihren verletzten Arm auf das kalte Metallgeländer und schaut über die Stadt. Sie fröstelt, doch ihr ist nicht so kalt wie früher. Die Beine machen 36 Prozent der Wärme abstrahlenden Oberfläche eines Erwachsenen aus. Und Kiras kybernetische Prothesen geben Wärme ab, die ihr Oberkörper absorbiert.
Kiras Beziehung zu ihren Beinen ist inzwischen symbiotisch. Sie kommuniziert mit ihnen über die Nervenbahnen, die sie als kleines Mädchen ausgebildet hat, und die Beine interpretieren ihre Absichten, stimmen sich miteinander ab und geben die sensorischen Eindrücke auf demselben Weg zurück. Meistens läuft dieser Prozess unbewusst ab, doch hin und wieder kommt es zu einer Fehlkommunikation. Wenn sie das Gefühl hat, ihre Beine seien plötzlich taub geworden, rekalibriert sie sie mittels einiger einfacher Diagnoseanweisungen.
Diesmal nimmt sie die nervliche Dissonanz als Schwindelanfall wahr. Ihre Beine befördern sie zwei Schritte zurück, als wollten sie ihr helfen, das Gleichgewicht wiederzuerlangen, das jedoch gar nicht gefährdet war. Und dann tritt das hintere Bein fest gegen das Geländer, sodass eine Delle entsteht.
Da die Signale in beide Richtungen übermittelt werden, versteht Kira genau, was vor sich geht. Ein Teil von ihr hat sogar aktiv Anteil daran, obwohl sie sich dagegen sperrt. Die Signale beeinflussen sie, als hätte sich die Kausalitätskette umgekehrt; indem sie daran denkt, dass sie gegen das Geländer getreten hat, sendet sie unwillkürlich weitere Signale an ihre Beine, was zur Folge hat, dass sie erneut gegen das Geländer tritt, sobald ihr Gleichgewicht wiederhergestellt ist.
Die Aluprofile lösen sich aus der Verankerung, und nach dem dritten Tritt stürzt das ganze Mittelsegment sich überschlagend in die Dunkelheit. Jetzt wird Kira klar, dass man sie infiltriert hat und dass ihr nur wenige Sekunden bleiben, um die Beine zu lösen. Doch die Verriegelung reagiert nicht. Und weil moderne russische Prothesen unmöglich kaputtgehen können, gibt es auch keinen Mechanismus für den Notfall.
Sie macht zwei Schritte nach vorn, und dann entsteht eine furchtbare, stille Pause. Das Scheppern, mit dem das Geländer auf die Straße knallt, hallt von den umliegenden Gebäuden wider, und ihr Verstand nutzt den Aufschub, um eine irrwitzige Berechnung anzustellen. Kira hat aufgehört, sich zu wehren, und versucht sich zu konzentrieren. Sie weiß, dass sie den nächsten Schritt physisch nicht verhindern kann, aber sie könnte vielleicht trotzdem die Kontrolle zurückerlangen.
Mit geschlossenen Augen atmet sie durch und zwingt sich zur Ruhe. Sie wird gelassen und ausgeglichen und fühlt sich auf einmal wieder kräftig und groß. Entschlossen und ihrer selbst gewiss. Sie kann nicht mehr genau sagen, wer oder was die Kontrolle hat, doch sie weiß, der einfachste und schnellste Weg fort von dem Schmerz ihrer Vergangenheit ist, den nächsten Schritt zu wagen. Erfüllt von einer tiefen Ruhe, tut sie den letzten Schritt und stürzt sich von der obersten Etage des Hochhauses.
Sie hat nicht das Gefühl zu fliegen, zu schweben oder frei zu sein. Freier Fall ist weder friedlich noch meditativ. Das Rauschen der vorbeiströmenden Luft schwillt zu einem Tosen an, zerrt an ihrem Hemd und reißt ihr die Brille vom Gesicht. Sie spürt, dass sie nach vorn kippt und sich dreht, und versucht unwillkürlich, sich aufzurichten. Doch sie kann nichts weiter tun, als in den kalten schwarzen Wind hineinzuschreien, bis sie keine Luft mehr hat, und als sie Atem holen will, merkt sie, dass ihre Lunge zu schwach ist, um Luft aus dem Tosen herauszusaugen. Die junge Frau ist still und erschlafft, als sie unten aufprallt, und der Knall, mit dem sie auf dem Beton aufschlägt, hallt durch die Dunkelheit.
Als ihr Körper verdreht und entstellt daliegt, röten sich die Verbrennungen an Kiras bleichem Unterarm noch stärker und werfen Blasen. Doch auch wenn sie von sich überlappenden konzentrischen Spulen im Inneren eines weichen Polymers herrühren, sind sie nicht kreisrund. Als wären nur bestimmte Drahtelemente defekt. Die frische Verletzung verwandelt sich in eine Reihe von Ziffern, gebildet aus Ringsegmenten – in die Zahlenfolge 6809.
»Niemand ist unantastbar«, sagt der Israeli. »Wie ich Ihnen bereits gesagt habe.«
Der groß gewachsene Mann steht hinter ihm. Beide betrachten das Bild einer angezapften Überwachungskamera, das auf einer Scheibe aus Plasmaglas angezeigt wird. Der Feed wird in den Falschfarben des Infrarotspektrums wiedergegeben, und das, was sie beobachten, war erst rot, dann grün und weist jetzt ein kühles Blau auf.
Zum Arbeitsplatz des Israelis gehören mehrere Monitore. Einige zeigen Nachrichtenfeeds an, andere eine Straße aus verschiedenen Blickwinkeln. Auf einem Monitor ist die Schemazeichnung einer kybernetischen Prothese zu sehen, auf einem anderen produziert ein Hexadezimal-Editor Tausende von Zeilen eines markierten Bytecodes.
Der Israeli schwenkt auf dem Stuhl herum und schaut hoch. »Ich glaube, es ist sicher, die zweite Hälfte jetzt zu transferieren.«
»Ich bin beeindruckt«, sagt der große Mann. »Aber eins kapiere ich nicht.«
Der Israeli hebt die Brauen. Seine Schädelseiten sind rasiert, und der schwarze Irokesenschopf ist zu einem verschlungenen französischen Dutt geflochten. Der Bart sprießt auf glatter dunkler Haut und umhüllt säuberlich die kantigen Konturen seines Kinns.
»Was Sie tun, ist gefährlich«, fährt der große Mann fort. »Aber Sie lassen mich in Ihre Wohnung hineinspazieren. Sie haben keinen Schutz. Kein Druckmittel. Woher wissen Sie, dass ich Sie nicht töten werde?«
»Weil ich ein System habe«, erwidert der Israeli.
»Ein Sicherheitssystem?«
»Etwas Besseres«, sagt der Israeli. »Ein ökonomisches System.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Wissen Sie, was die einzige Methode ist, Informationen zu schützen?«
»Sagen Sie’s mir.«
»Die Kosten eines Diebstahls müssen höher sein als der Wert des Diebesguts. Beim Schutz von Informationen geht es weniger um die Verschlüsselung als um die Kosten der Entschlüsselung. Es geht um Ökonomie.«
»Was hat das mit Ihrer Sicherheit zu tun?«
»Ich verlange nie so viel, dass es einfacher wäre, mich zu töten, statt mich zu bezahlen.«
»Doch was dem einen schwerfällt, ist für den anderen einfach.«
»Deshalb basiert mein Honorar nicht allein auf der Komplexität des Auftrags«, sagt der Israeli. »Das ist mein Geheimnis. Ich veranschlage es gemäß einer sorgfältigen Überprüfung des Kunden.«
»Welche Faktoren berücksichtigen Sie dabei?«
»Alles. Nettovermögen. Gesinnung. Auftreten. Sie glauben, es stelle ein Risiko dar, jemanden zu mir nach Hause einzuladen. Ich hingegen betrachte es als Vorteil.«
»Wie schätzen Sie mich ein?«
Der Stuhl des Israelis schwenkt herum, als er den großen Mann eingehend mustert.
»Für Sie wäre es billiger, mich zu bezahlen, als das Blut auf Ihrem Anzug entfernen zu lassen.«
»Das setzt voraus, dass ich rational handele«, sagt der große Mann.
»Ich verlasse mich nicht darauf, dass Sie rational handeln«, entgegnet der Israeli. »Ich verlasse mich darauf, dass Sie im eigenen Interesse handeln.«
»Glauben Sie nicht, dass jeder im eigenen Interesse handelt?«
»Selbstverständlich. Andernfalls würde totales Chaos auf der Welt herrschen.«
»Sie glauben nicht, dass Chaos herrscht?«
»Ich glaube, dass die Welt eine komplexe, vernetzte Maschine ist und dass die Menschen, die nicht sehen, wie die Einzelteile sich ineinanderfügen, deren Eleganz mit Chaos verwechseln. Ich aber sehe das. Deshalb tue ich, was ich tue. Deshalb haben Sie meine Dienste in Anspruch genommen und nicht die von jemand anderem, und deshalb weiß ich, dass Sie mich nicht töten werden.«
»Aber wenn ich etwas wüsste, was Sie nicht wissen?«, fragt der große Mann. »Wenn ich Teile sehen könnte, die Sie nicht sehen?«
Der Israeli wirkt skeptisch. »Was für Teile?«
»Die Art Teile, die die Spielregeln verändern. Die dazu führen, dass die Maschine rückwärtsläuft. Die die Menschen zu schwerwiegenden Fehlannahmen verleiten könnten.«
Der Israeli setzt sich in seinem Stuhl auf. Er ist nicht mehr gelassen, und sein Tonfall wird versöhnlich. »Hören Sie, Mann, wenn Sie mich nicht bezahlen wollen, meinetwegen. Dann sind wir eben quitt. Ich mache den Scheiß hauptsächlich deshalb, weil es mir Spaß macht.«
Die Sekunden verstreichen, dann senkt der Israeli den Blick auf die Hände des großen Mannes. Der große Mann greift unter sein Sakko und holt ein glattes, biegsames Handy hervor. Er authentifiziert sich, navigiert und überweist den ausstehenden Rest der beträchtlichen Summe.
Der Israeli beobachtet, wie sein Kunde nickt, kehrtmacht und geht. Erst als das hohle Geräusch seiner Schuhabsätze im Gang verklungen ist, wagt er wieder, Luft zu holen.
2
Die Blase
Vizedirektorin Vanessa Townes kommt es absurd vor, vor 770 Sitzplätzen zu sprechen, wenn nur siebzehn davon besetzt sind – ein Hinweis darauf, wie stark ihr Team in den vergangenen fünf Jahren, in denen immer mehr Ressourcen umgeleitet wurden, ausgeblutet ist. In einem bewundernswerten Versuch, möglichst viel Raum zu beanspruchen, hat sich ihre Taskforce in den ersten drei Reihen der Theatersessel verteilt, doch die Wirkung ist in etwa die, als würde eine Siebenjährige das Hochzeitskleid ihrer Mutter anprobieren.
Das Hauptauditorium des George Bush Center for Intelligence wird im allgemeinen Sprachgebrauch »Die Blase« genannt. Das Gebäude mit einer Grundfläche von 650 Quadratmetern steht separat und ähnelt aus der Luft betrachtet einem Golfball, der im Rough stecken geblieben ist. Eigentlich soll die Blase nicht für Meetings genutzt werden, doch in Vans Teil des Gebäudes waren keine anderen Räume verfügbar. Und als Vizedirektorin von Clandestine Services sollte es ihr eigentlich möglich sein, die Angelegenheit geheim zu halten.
Außerdem soll es ohnehin nur ein kurzes Meeting werden. Die Analysten, Officer, Manager der mittleren Ebene und die Assistenten wissen bereits, weshalb sie hier sind, doch als ihr Boss fühlt Townes sich verpflichtet, den Auftrag, dem sie die letzten fünf Jahre ihres Lebens gewidmet haben, zum Abschluss zu bringen. Und ihn, wenn das semantisch überhaupt machbar ist, positiv darzustellen.
Sie klappt das Notebook auf und gibt das Passwort ein, worauf der Bildschirm hinter ihr hell wird. Ihre Kollegen ziehen sie gerne damit auf, dass sie immer noch ein ramponiertes Klappgerät mit sich herumschleppt, doch das Dell-Notebook hat einen Ehrenplatz in ihrem Büro. Damals, als sie im Kongo stationiert war, hat es Van angeblich vor einer Kalaschnikow-Kugel geschützt und dient ihr seitdem als Beweis dafür, dass die Oberfläche eines Handys viel zu klein ist.
»Ich weiß, es geht bereits auf Mittag zu«, beginnt die Vizedirektorin, zum einen, um sich einen Eindruck von der Akustik zu verschaffen, und zum anderen, damit Ruhe einkehrt. Wie sich herausstellt, braucht sie kein Mikrofon, um sich in den ersten drei Sitzreihen verständlich zu machen. »Also lege ich gleich los.«
Die neueste Version von PowerPoint ist so smart, dass sie den Worten des Vortragenden folgt, den Kontext erfasst und nicht nur die Grafiken automatisch anzeigt, sondern im Bewusstseinsstrom-Modus auch die Präsentation umordnen kann, um selbst den planlosesten Vorträgen gerecht zu werden. Obwohl die CIA im Allgemeinen der aktuellen Softwareversion immer mindestens drei Versionsnummern hinterherhinkt, weiß Townes genau, wen in der IT sie bestechen muss, um die guten Sachen zu bekommen.
»Es ist kein Geheimnis, dass heute der letzte Arbeitstag der Taskforce zur Überwachung der Nichtverbreitung von Atomterrorismus ist. Desgleichen ist es kein Geheimnis, dass seit dem Angriff auf Seoul vor fast sechs Jahren keine Verschwörungen aufgedeckt, kein spaltbares Material sichergestellt wurde und keine Verhaftungen vorgenommen wurden. Also haken wir’s ab.«
Van sagt ihnen zwar nichts, was sie nicht schon wissen, doch die gefurchten Stirnen und die umherschweifenden Blicke lassen erkennen, dass ihr Team von seiner Leiterin vielleicht etwas weniger Offenheit und stattdessen etwas mehr Mitgefühl erwartet hätte.
»Einige sind der Ansicht, die Taskforce zur Überwachung der Nichtverbreitung von Atomterrorismus sei ein Fehlschlag gewesen. Wir alle kennen die Vorwürfe. Die Schuldzuweisungen. Die Gerüchte. Ihr alle wisst, wie viele Berichte ich in schlaflosen Nächten schreiben musste. An wie vielen Meetings ich teilnehmen musste, nur um mich im Beisein des Direktors heruntermachen zu lassen. Wie oft ich vor dem Kongress aussagen musste.«
Van hält inne und mustert scharf die Gesichter der gleichmäßig auf die Plätze verteilten Mitarbeiter, in denen sich Unbehagen widerspiegelt.
»Aber wisst ihr, was sehr viel mehr nach einem richtigen Scheitern ausgesehen hätte? Wenn man nach dem furchtbarsten Terroranschlag in der Geschichte keine Taskforce aufgestellt hätte. Wenn man nicht auf eine eindeutige aktuelle Gefahr reagiert. Wenn man nicht in der Lage ist, ohne das kleinste Quäntchen Zweifel sicherzustellen, dass sich das, was in Seoul geschehen ist, auf diesem Planeten nicht wiederholt. Wenn man nicht das tut, was jeder Einzelne von uns zu tun gelobt hat.«
Hier und da wird zustimmend genickt.
»Die Wahrheit ist die: So sieht Erfolg aus, Leute. So sieht es aus, die Vereinigten Staaten und deren Verbündete – verdammt, sogar deren Feinde – vor Massenvernichtungswaffen zu schützen. Erfolg besteht nicht darin, einen Verdächtigen zu foltern, damit er den Ort eines geplanten Anschlags verrät, anschließend den digitalen Timer zu finden, der an der Seitenwand eines Vans befestigt ist, und mit der Entscheidung, welchen Draht man durchtrennt, bis zum letzten Moment zu warten.«
Einige grinsen. Jetzt hat sie das Publikum für sich gewonnen.
»In Filmen ist das so. In keinen besonders guten Filmen. Helden sehen anders aus. Ihr wisst das. Besser als alle anderen. Helden sind Menschen, die jedem Hinweis nachgehen, ganz gleich, wie unwahrscheinlich er sein mag. Die jedem Dollar, jedem Euro und selbst dem kleinsten Fragment irgendeiner Kryptowährung nachspüren. Die Tag und Nacht, rund um die Uhr und auch an den Wochenenden Abfragen formulieren, die so elegant sind wie eine Komposition von Beethoven, und damit Tausende von Hinweisen durchforsten. Helden sind Menschen, die nicht nur hoffen, Vermutungen anstellen oder sich ›ziemlich sicher‹ sind. Sie verifizieren. Und verifizieren erneut. Und dann lassen sie ihre Verifikation von jemand anderem überprüfen. Und wenn sie nicht weiterkommen, verwerfen sie alles und fangen neu an, weil jeder unerforschte Pfad, so unbedeutend er auch erscheinen mag, Tausende Menschenleben kosten kann.«
Jetzt nicken alle – mit Ausnahme des Mannes, der soeben mit zwei Kaffeebechern auf einem Tablett hinten hereingekommen ist. Er lehnt sich mit der Schulter gegen die Wand und wartet darauf, dass Van fortfährt.
»Helden beschäftigen sich nicht nur sechs Monate, ein Jahr oder zwei Jahre lang mit einem Problem. Sie arbeiten so lange daran, wie es erforderlich ist. Sie arbeiten fünf Jahre, neun Monate und drei Wochen lang. Sie arbeiten so lange, bis jemand sie zum Aufhören zwingt, wenn es das ist, was nötig ist, um mit absoluter Sicherheit gewährleisten zu können, dass nicht irgendein Soziopath vorhat, Washington, D.C., New York City, Paris oder London von der Landkarte zu tilgen.«
Sie wirft einen Blick auf ihre Folien. Ja, da sind das Kapitol, das One World Trade Center, der Eiffelturm und Big Ben.
»Diese Taskforce wurde nicht als Reaktion auf Seoul zusammengestellt. Sie wurde als Reaktion auf einen historischen Auftrag gegründet. Wahrscheinlich war das die wichtigste Resolution, die die Vereinten Nationen jemals verabschiedet haben oder verabschieden werden: die Denuklearisierung des ganzen Planeten. Und es ist mir egal, was irgendein Weichei von Bürokrat dazu sagt – Dieses Mandat zu unterstützen, in welcher Funktion auch immer, ist eine Ehre.«
Jetzt wird sogar hörbare Zustimmung laut.
»Wenn die UN im Zuge einer Überprüfung feststellen, dass siebenunddreißig Prozent des angereicherten Kernmaterials verschwunden sind, nimmt man das ernst. Man stellt eine Taskforce der besten Ermittler, Analysten und Mitarbeiter der Welt zusammen, und man löst sie erst dann wieder auf, wenn sicher ist – absolut sicher –, dass jedes einzelne Milligramm spaltbaren Materials nicht mehr waffenfähig ist. Dass alle, die es gekauft, gestohlen oder sonst wie in ihren Besitz gebracht haben, um eine schmutzige Bombe zu bauen, entweder vom Mossad getötet, von ihren Geschäftspartnern verraten oder in einem verlassenen Lagerhaus in Protoplasma verwandelt worden sind, weil sie nicht wussten, wie man damit umgeht.«
Van behält den Typ weiter hinten im Auge, und einige ihrer Mitarbeiter drehen sich auf den Sitzen um. Das ist Alessandro Moretti. Offiziell ihr Boss, doch in letzter Zeit sind sie praktisch auf Augenhöhe. Moretti war in den vergangenen zwei Jahren häufiger abwesend, mit einem hochgeheimen Projekt beschäftigt, über das nicht einmal Van informiert ist, deshalb vertritt sie ihn, wann immer es nötig ist. Zwei Becher Kaffee bedeuten, dass er etwas von ihr will.
»Und genau das habt ihr getan. Ihr habt exakt das getan, was die Behörde von euch verlangt hat. Was euer Land von euch verlangt hat. Was die Welt von euch erwartet hat. Und ihr habt es gern, gründlich und mit Anstand getan.«
Sie mustert ihr Team einen Moment lang, während sie sich den nächsten Satz zurechtlegt.
»Ihr habt es perfekt gemacht, Leute. Und wisst ihr was? Ich würde es jederzeit wieder genauso machen. Jeden Hinweis, jedes Meeting, jeden Bericht …«, jetzt wird applaudiert, »… jedes Interview, jede Abfrage, jede Simulation, jede Sackgasse und jeden einzelnen Logarithmus. Alles!«
Sie wartet darauf, dass der Applaus versiegt, und bemerkt, dass ein paar feuchte Augen trocken gewischt werden, bevor die Hände wieder auf den Schoß zurückkehren.
»Die Welt schuldet euch Dankbarkeit. Das heißt natürlich nicht, dass ihr sie auch bekommt. Das liegt in der Natur unserer Arbeit. Ihr alle wisst das. Ihr alle wisst, worauf ihr euch eingelassen habt. Ich kann nichts daran ändern, doch ich kann euch im Namen der CIA danken. Und ich kann euch meinen aufrichtigen persönlichen Dank aussprechen. Also Leute, ich danke euch. Danke, dass ihr täglich zur Arbeit erschienen seid. Danke, dass ihr nicht nur euren Job gemacht, sondern eure Karriere und euer Leben darauf verwandt habt, die Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Danke, dass ihr Zeit geopfert habt, die ihr mit eurer Familie hättet verbringen können. Zeit, die ihr nicht nachholen könnt. Zeit mit euren Kindern.«
Vans Augen tun genau das, was sie nicht tun sollen: Sie richten sich geradewegs auf die Chefanalystin Quinn Mitchell. Sie bedauert sofort, dass sie Quinn vor dem ganzen Team gewissermaßen ausgezeichnet hat, doch ihre Topanalystin lächelt traurig und dankbar, und Van erwidert ihr Lächeln, bevor sie fortfährt.
»Ihr alle – jeder Einzelne von euch – seid meine persönlichen Helden.«
Das bringt ihr stehende Ovationen ein, und auf einmal wird Vizedirektorin Townes schmerzhaft klar, wie sie das alles hätte angehen sollen – wie sehr ihr Team danach verlangt hat zu hören, dass die Arbeit der vergangenen fünf Jahre nicht umsonst gewesen ist. Van fällt es immer noch schwer zu glauben, dass sie die Macht hat, dem Tun anderer Menschen Sinn zu verleihen, und sie fürchtet sich noch genauso davor wie an dem Tag, als sie zur Managerin befördert worden ist. Man nennt das Demut, pflegte ihre Mutter zu sagen. Das ist die Stimme Jesu, die dir ins Ohr flüstert, du sollst mit den Füßen auf dem Teppich bleiben. Das ist etwas Gutes, meine Liebe. Lass dir das nicht nehmen.
Als klar wird, dass ihr Boss noch etwas sagen will, setzen sich ihre Kollegen einer nach dem anderen wieder hin. Van nimmt sich im Stillen vor, nie wieder so viel Zeit verstreichen zu lassen, bevor sie anderen Menschen ihre Gefühle offenbart, dann kommt sie zum Ende.
»Einige von euch wurden bereits versetzt, andere warten noch darauf zu erfahren, wie es für sie weitergeht. Einige von euch werden bei mir bleiben, andere mit einem viel freundlicheren Boss gesegnet werden, und denen möchte ich gratulieren.«
Jene Art Gelächter ist zu hören, wie man es gegen Ende einer Grabrede vernimmt, wenn jemand einen Scherz macht, der die Spannung löst.
»Aber wohin ihr auch geht«, fährt Van fort, »vergesst nicht, dass es die größte Ehre meiner Laufbahn war, mit euch zusammenzuarbeiten.«
Jetzt kommt der Schlussapplaus. Van nimmt ihn lächelnd, nickend, winkend entgegen, bis sie sich vorkommt wie eine egomanische Politikerin und sich dareinflüchtet, ihren Laptop einzupacken. Der Applaus versiegt, geht in Gemurmel und Fußscharren über, doch als sie ihre Tasche schultert, stellt sie fest, dass sich eine Schlange gebildet hat. Eine Verabschiedungsschlange. Die Frauen stehen an, um sie in eine warme, wiegende Umarmung zu ziehen, und die Männer warten verlegen darauf, dass Townes den Körperkontakt herstellt. Quinn Mitchells Umarmung ist besonders herzlich. Wie sich herausstellt, war das, was bei Van die Befürchtung geweckt hatte, man könnte es als unhöflich oder geschmacklos auslegen – der Blick, mit dem sie Quinn bedacht hat, als sie die Kinder erwähnt hat –, genau das, was ihre Staranalystin gebraucht hat. Vielleicht, denkt Van, beruht unsere Scheu, menschliche Tragödien anders als nur beiläufig zur Kenntnis zu nehmen, weniger auf Anstand, sondern dient vor allem der Vermeidung des eigenen Unbehagens. Vielleicht verlängern wir letztlich die Schmerzen anderer nur, damit wir uns in unserer eigenen kleinen Blase wohlfühlen können. Doch wenn die Tragödie uns selbst trifft und wenn andere uns mit der gleichen Rücksicht behandeln, die wir ihnen gegenüber an den Tag gelegt haben, werden auch wir uns unerträglich einsam fühlen.
Vielleicht hat Jesus Van ja wieder ins Ohr geflüstert.
Moretti hat sich während des Rituals im Hintergrund gehalten, doch jetzt, wo sich Vans Team zerstreut hat, kommt er näher. Als Townes die Treppe am Rand der Bühne hinuntersteigt, reicht er ihr die freie Hand – die, in der er keine Koffeingranaten hält –, und sie ergreift sie dankbar.
»Sie sind ja ein richtiger Gentleman«, bemerkt Van.
»Stets zu Diensten«, entgegnet Moretti. Er nimmt den größeren der beiden Becher von dem Origamitablett und beginnt aufzuzählen. »Dreifach. Venti. Halbsüß. Fettfrei …« Dann fällt es ihm ein. »Karamell Macchiato. Ich habe auf dem ganzen Weg hierher geübt.«
»Woher zum Teufel wissen Sie, wie ich meinen Kaffee mag?«
»Ich bitte Sie. Das hier ist die CIA, nicht das FBI. Das sollten Sie mir zugutehalten.«
»Autsch. Sie wissen, dass mein Sohn in Quantico ist, oder?«
»Ich erinnere mich, das Empfehlungsschreiben aufgesetzt zu haben. Geben Sie mir Bescheid, wenn er sich dem Siegerteam anschließen will.«
Sie schlendern den Mittelgang entlang zur Rückseite des Auditoriums, langsamer, als wenn jeder allein gewesen wäre.
»Ich werd’s weitergeben.«
»War übrigens eine schöne Rede«, sagt Moretti.
»Seien Sie still.«
»Nein, ganz im Ernst. Kein Scheiß. Wenn man eingestellt wird, glaubt man, es gehe um Action, Abenteuer und Reisen. Niemand sagt einem, dass es normalerweise ziemlich ruhig zugeht, wenn alle ihren Job machen, wie man es von ihnen erwartet – wenn sie vorausschauend handeln. Geht etwas schief, wird schnell Kritik laut, aber wenn es gut läuft, bleibt das Lob aus.«
»Amen.«
Moretti drückt mit der Hüfte die Tür auf, gleißender Sonnenschein fällt durch die Öffnung. Townes tritt unter der Markise hervor in die Mittagswärme. Es hört sich so an, als wäre die Luft von Gezwitscher und Vogelrufen erfüllt, dabei werden die Laute dynamisch von den Überwachungsdrohnen erzeugt, die über dem Campus patrouillieren, sich automatisch laden und mit einem Wald modernster Funkmasten, die als allzu symmetrisches Immergrün getarnt sind, Daten austauschen. Der synthetische Klang eines CIA-Sommers.
»Sie haben mir noch nicht gesagt, was Sie eigentlich wollen«, sagt Van.
Moretti wirkt verletzt. »Wie kommen Sie darauf, dass ich etwas von Ihnen will?«
»Der Kaffee. Die Schmeicheleien. Die Tatsache, dass Sie immer nur dann auftauchen, wenn Sie etwas brauchen.«
»Ich weiß«, sagt Moretti. »Und das tut mir leid. Die Sache, an der ich arbeite … die bringt mich um. Aber es dürfte bald ausgestanden sein. Und ich werde Sie bestimmt daran beteiligen. Versprochen.«
»So wie Sie mich am LHC beteiligt haben?«
»Glauben Sie mir, damit habe ich Ihnen einen Gefallen getan«, sagt Moretti. »Der Zeitindex geht mir auf den Sack, seit er auf meinem Schreibtisch gelandet ist. Doch diese neue Sache ist etwas ganz anderes. Sie werden sehen. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen wirklich einen Gefallen tun.«
Auf einer nahe gelegenen Bank sitzt Quinn Mitchell und schaufelt sich aus einer milchigen Tupperware-Dose etwas in den Mund. Ihr einziger Gefährte ist eine Diät-Cola, die mitten auf einer Latte steht, damit sie nicht umfällt.
»Und was soll das sein?«
»Ich möchte Ihnen einen Analysten abnehmen.«
»Ahhh«, macht Townes. »Jetzt wird mir alles klar. Die Geier kreisen über dem Aas.«
Moretti verzieht das Gesicht. »Von Aas kann ja wohl kaum die Rede sein«, sagt er. »Soweit ich das beurteilen kann, ist es Ihnen irgendwie gelungen, die Besten Ihres Teams zusammenzuhalten.«
»Wen wollen Sie?«
»Die da.«
Van hat nicht mitbekommen, dass Moretti Quinn bemerkt hat. Verdammte Spione. Bei jedem anderen hätte Townes den Deal hier und jetzt besiegelt – und vielleicht sogar ein kleines Zusatzbudget oder bessere Hardware herausgehandelt, wenn sie dazu aufgelegt gewesen wäre. Aber Quinn steht auf einem anderen Blatt.
»Was haben Sie mit Mitchell vor?«
»Was glauben Sie? Ich will die Beste haben.«
»Schon klar«, sagt Van. »Aber warum?«
»Haben Sie schon von dem Elite-Killer gehört?«
Townes braucht einen Moment, um sich zu justieren. Wenn ihre Erinnerung an die letzten Briefings sie nicht täuscht, drehte sich die Unterhaltung um alle möglichen Themen, angefangen von der internen Umverteilung von Ressourcen bis zu bizarren, exotischen, international tätigen Serienkillern.
»Ja«, sagt sie unsicher. »Habe ich.«
»Interpol hat nichts in der Hand, und sie bitten uns um einen Analysten.«
»Und was haben wir auf einmal mit Interpol zu tun?«
»Der Direktor hat dieses neue Mandat für Gefälligkeiten im Bankensektor. Er meint, so würden die Dinge in der Privatwirtschaft geregelt.«
»Woher zum Teufel will er wissen, wie es in der Privatwirtschaft läuft? Er hat sein Leben lang für die Regierung gearbeitet. Der Mann ist mit Kaffeeatem und in einer Khakihose auf die Welt gekommen.«
»Hat wohl ein Buch darüber gelesen, schätze ich.«
»Und Sie«, fährt Van fort, »Sie glauben, indem Sie Interpol einen Gefallen tun, tun Sie dem Direktor einen Gefallen?«
»Nicht nur ich. Sie auch. Und Mitchell. Sehen Sie? Alle gewinnen dabei.«
Townes verfolgt, wie Quinn einen Schluck Diät-Cola trinkt und die Dose wieder auf die Latte stellt. Sie fragt sich, ob ihre Chefanalystin ahnt, dass sie beobachtet wird – dass sie beide gerade über ihre Zukunft verhandeln –, kommt aber zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall ist.
»Sie wissen, was sie durchgemacht hat, oder?«
»Ja.«
»Und Sie halten es für eine gute Idee, sie aus der Arbeitsnische abzuziehen, wo sie Anfragen verfasst, und auf einen Serienkiller anzusetzen?«
»Ich glaube«, sagt Moretti, »dass sie den Kerl schnappen kann. Und ich glaube, dass sie ein Erfolgserlebnis braucht. Sie wissen, ich halte große Stücke auf Ihre Taskforce. Das tue ich wirklich. Aber Sie haben es da drinnen selbst gesagt: Die ganze Sache war ein Sieg durch Auslassung. Ich biete ihr einen richtigen Sieg. Einen expliziten Sieg. Ich biete ihr die Chance, Menschenleben zu retten – einen Bösewicht aus Fleisch und Blut zu schnappen. Und zwar wegen dem, was sie durchgemacht hat.«
Townes fragt sich, wie oft Quinn wohl allein isst. Jetzt bedauert sie, dass sie sich nicht mehr bemüht hat, Quinn näherzukommen – dass sie sie nicht hin und wieder zum gemeinsamen Mittagessen oder sogar zum Abendessen eingeladen hat. Sie hatte es vor, doch es gab immer so viel zu tun. Es gab immer eine Ausrede, um am Schreibtisch zu essen. Das Gefühl, es sei unpassend. Zu viele Gründe, dem komplizierten Gespräch aus dem Weg zu gehen, das Quinn gebraucht hätte. Jetzt wird Van klar, dass sie mit dieser Meinung bestimmt nicht allein dagestanden hat – dass die übrigen Mitglieder der Taskforce vermutlich dem gleichen Muster gefolgt sind: gute Absichten ohne praktische Folgen. Offenbar neigen wir zu der Annahme, Tragik sei ansteckend.
»Woher der Name?«, fragt Townes. »Elite-Killer?«
»Wissen Sie, wie er seine Opfer markiert?«
»Ja«, antwortet Van. »Mit Seriennummern, oder?«
»Nicht mit Seriennummern. Seriennummern sind sequenziell. Er verwendet vierstellige Zufallszahlen. Die erste war 1337. Und 1337 steht in der Internetkultur für leet, was so viel wie elitär bedeutet.«
Vans Gesichtsausdruck verrät, was sie von Morettis Erklärung hält: Für sie ist das kompletter Blödsinn.
»Das ist eine Nerdsache«, sagt Moretti. »Mitchell würde das kapieren.«
»Und ich dachte schon, der Name käme daher, dass er einen teuren Geschmack hat.«
»Könnte durchaus der Fall sein. Sobald er in Gewahrsam ist, werde ich ihn danach fragen.«
»Was wissen Sie sonst noch über den Typ?«
»Ich weiß, dass er völlig abgedreht ist. Bislang gehen neunzehn Tote auf sein Konto. Vor zwei Wochen hat er in Moskau eine behinderte junge Frau von einem Balkon geworfen. Dann ist er nach Caracas geflogen, in das Anwesen eines reichen Hombres eingebrochen und hat die Alu-Sauerstoffflaschen seines Neffen einen Tag vor der geplanten Kernspintomografie gegen welche aus Nickel ausgetauscht.«
»Ist mir zu hoch.«
»Aluminium ist nicht magnetisch. Nickel ist magnetisch. Die Scheißdinger sind wie Geschosse in dem Gerät eingeschlagen. Haben den armen Kerl zerschmettert. Der Radiologe ist ins Koma gefallen.«
Van hebt die Brauen. »Zumindest ein Punkt für Kreativität.«
»Sie haben ja keine Ahnung«, sagt Moretti ernst. »Kapstadt und Beijing lasse ich mal außen vor.«
»Wie hat er sie markiert?«
»Er hat irgendwie den Arm des Mädchens gekennzeichnet. Keine Ahnung, womit. Bei dem Typ im MRT-Gerät war die Zahl auf den Gasflaschen eingeprägt. Sie … haben einen Abdruck hinterlassen.«
»Was haben diese Leute gemeinsam?«
»Das ist es ja«, sagt Moretti. »Es gibt keine einzige verdammte Gemeinsamkeit. Die meisten Killer besetzen eine Nische. Sie spezialisieren sich auf Kriminelle, Drogenbarone, Zeugen und so weiter. Auf Politiker und gut versicherte Ehegatten. Auf irgendwas. Aber der nicht. Entweder er tötet vollkommen wahllos – was es eigentlich nicht gibt –, oder wir übersehen etwas.«
»Daher der Bedarf an einer Analystin«, meint Townes.
»Bingo«, bestätigt Moretti. »Also, was sagen Sie? Glauben Sie, Ihr Mädel ist der Sache gewachsen?«
Townes beobachtet, wie Quinn die Gabel im Hühnersalat-Sarkophag einschließt und das Ding in ihrem wärmeisolierenden Lunchbeutel verstaut.
»Das meinen Sie doch nicht ernst, oder?«
Moretti zuckt mit den Schultern. »Immerhin gibts zu meinen Anfragen Kaffee gratis.«
Van mustert das Getränk, das sie in der Hand hält. Es ist »schmutziger Kaffee« – aus Geschmacksgründen koffeinhaltig –, doch Koffein ist Koffein. Und wenn sie ihn ablehnt, ändert das nichts an Quinns Schicksal.
»Wussten Sie, Al, dass Sie einen schlechten Ruf haben?«
»Was?«, sagt Moretti unschuldig. »Ich? Wieso denn das?«
»Es heißt, Sie missbrauchen Ihre Berichterstatter.«
»Blödsinn«, sagt Moretti. »Habe ich Sie jemals missbraucht?«
»Nein, weil Sie wissen, dass ich’s Ihnen heimzahlen würde. Aber Sie sind berüchtigt dafür, dass Sie die jungen Officer zu hart rannehmen.«
»Dafür sind junge Angestellte da«, sagt Moretti.
»Al …«
»Ist Quinn ein Junior Officer?«
»Quinn ist Analystin.«
»Ja, aber ist sie eine Junior-Analystin?«
»Keineswegs.«
»Dann hat sie ja wohl auch nichts zu befürchten, oder?«
»Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie sie in Ruhe lassen.«
Moretti blickt über seine Brille hinweg, die sich in dem Moment, da er ins Freie getreten ist, verdunkelt hat. »Jawohl, Ma’am«, sagt er. »Noch weitere Forderungen?«
»Ja«, sagt Van. »Versprechen Sie mir, dass Sie gut auf sie aufpassen. Sie ist etwas Besonderes.«
Moretti setzt ein Lächeln auf, das er für beruhigend hält. »Sie haben keinen Anlass zur Sorge«, sagt er. »Ich werde sie nicht aus den Augen lassen.«
3
Die Jagd auf Prime
Yῡgen ist noch einen Treffer von einem Eine-Million-Dollar-Zahltag entfernt.
Sie befindet sich in L.A., auf dem Gelände eines alten, umgebauten Filmstudios. Raum für Raum, Etage für Etage macht Yῡgen Jagd auf Prime durch den größten und modernsten V-Sports-Austragungsort des Planeten.
Wie E-Sports, aber virtuell. Herkömmliche Videospiel-Wettbewerbe werden mit mechanischen Tastaturen, Mäusen und großen Scheiben Plasmaglas gespielt. Die V-Sports-Player zwängen sich in einen eng anliegenden haptischen Anzug, setzen sich einen Karbonfaserhelm auf und decken das Gesicht mit einem Visier mit den Eigenschaften einer Metabrille ab. Sie schnallen sich Akku-Packs auf den Rücken und Laser-Handfeuerwaffen an die Hüfte.
Die Spiele werden in großen realen Gebäuden ausgetragen, die sattgrün gestrichen sind. In den Fugen sind Plasmaleuchtstreifen angebracht, in den Ecken Laufkameras. Die Tausend-Hertz-Plasmabildschirme in den Visieren vermitteln den Spielern eine 120-Grad-Sicht mit ultrahoher Auflösung. Im Publikumsfeed wird alles Grüne ausgeblendet und durch eine exotische, fotorealistische Umgebung ersetzt, die sich an unsichtbaren Trackingmustern orientiert, die mit Handzerstäubern aufgebracht werden.
Die Lagekarten können alles Mögliche wiedergeben, angefangen von herrenlosen Raumschiffen bis hin zu riesigen Fabriken, einer verwüsteten Botschaft oder der gestörten Ruhe eines geplünderten Vorstadthauses, einem Casino in Las Vegas oder dem lang gestreckten, schmucklosen Rumpf der Air Force One. In diesem Fall sind es die oberen drei Etagen zweier moderner, nebeneinanderstehender Bürotürme, die durch einen verglasten Catwalk miteinander verbunden sind. Es ist mitten in der Nacht, und es tobt ein heftiges Gewitter.
Yῡgen und ihr Clan sind von Japan nach L.A. gekommen, um bei Black Horizon anzutreten, dem beliebtesten und höchstdotierten V-Sports-Wettbewerb der Welt. Dem amerikanischen Team – die meisten davon ausgefuchste Spezialisten, die mit ADHS in Kleinstädten aufgewachsen sind, ohne dass ihre Eltern sich um sie gekümmert haben und die die Schule geschwänzt haben, um den ganzen Tag Call of Duty zu streamen – wurden in der Wettkampfklasse die größten Siegeschancen eingeräumt. Die Topspieler jeder Runde treten gegeneinander an, was als eigentliches Topevent angesehen wird: das Last-Man-Standing, der Battle Royale, bei dem es nur einen Sieger geben kann.
Keine Teams. Keine Bomben, die gelegt oder entschärft werden, und keine Geiseln, die es zu befreien gilt. Kein King of the Hill, keine Schädel, die man einsammeln, keine Fahnen, die man erobern muss. Das finale Black-Horizon-All-Star-Event ist ein einfaches, altmodisches Todesmatch um einen hohen Einsatz.
Der Ostturm muss gesäubert werden. Als Yῡgen den Catwalk überquert, wird sie von einem fraktalen weißen Blitz geblendet, gefolgt von einem gewaltigen Donnerschlag. Das Gewitter ist das Äquivalent wahllos gezündeter Blendgranaten und soll die im Dunkeln lauernden Scharfschützen sichtbar machen. Was Yῡgen im Lichtschein der schwächeren Blitze sieht, die auf den ersten folgen, ist ein Hindernislauf aus Toten.
Der Tunnel zwischen den beiden Türmen ist als Engpass gedacht. Yῡgen hat diese Karte noch nie gespielt, doch sie hat Dutzende früherer Matches analysiert und weiß, dass der Boden zu diesem Zeitpunkt immer mit Leichen und Patronenhülsen übersät und mit Blut getränkt ist. Die Hälfte der Glasscheiben ist zerbrochen, und durch die Hochgeschwindigkeitsgeschosse ist überall Blut verspritzt oder durch die Kurzdistanztreffer auf den Boden getropft. Pulverdampf wabert noch in der unbewegten Luft, und sie meint, ihn zu riechen, obwohl er nicht wirklich vorhanden ist. Für sie sind die Toten Opfer eines erbitterten Gemetzels. In Wirklichkeit steigt sie in einem grünen, hell erleuchteten, mit Sperrholz verkleideten Gang über eliminierte Spieler hinweg – die alle schweigend dem Endspiel zusehen, entweder durch Yῡgens Augen oder durch die von Prime.
Yῡgen kann sich furchtlos durch den Gang bewegen, denn inzwischen weiß sie genau, wo Prime sich aufhält. Den Akteuren werden am Rand ihrer Head-up-Displays Karten eingespielt, und alle anderen Spieler, die sich in Reichweite befinden, sind als rote Punkte dargestellt. Prime hat vor ihr in einer Ecke eines Besprechungsraums Stellung bezogen, dann ist er erloschen. Was bedeutet, dass er wartet. Er liegt bei den Treffern vorn, deshalb ist er der Gewinner, wenn sie das Match beide lebend abschließen. Er hat keinen Grund, sich auf eine offene Auseinandersetzung einzulassen. Prime verhält sich genau so, wie Yῡgen es tun würde: Er wartet und lässt sie kommen.
Yῡgen kennt nicht nur seine Strategie und seinen Aufenthaltsort. Sie weiß auch, dass er einer der weltbesten Player ist: dass er erheblich mehr Sponsoren- als Preisgelder einsackt; dass er Linkshänder ist, womit er schon viele Gegner ausgetrickst hat; und dass er knapp über achtzig Kilo wiegt und einen Meter achtzig groß ist – eine schöne breite Brust hat, um darauf zu zielen, und gerade die richtige Größe für einen schnellen Kopfschuss aus der Hüfte.
Doch Yῡgen interessiert sich vor allem für Primes Intelligenz. Nicht unbedingt für seine Spiele, sondern für sein Vorleben. Bevor er Profiplayer wurde, hat er ein paar Jahre als Techniker für Biomedizin gearbeitet. Er wurde wegen irgendetwas angeklagt, ohne dass das Gericht den Grund öffentlich gemacht hat. Am Ende gab es einen Deal. Reiche Eltern, teures Anwaltsteam. Den Namen hat er seiner Besessenheit von Primzahlen zu verdanken. Das Wort PRIME hat er sich eintätowieren lassen, jeweils einen Buchstaben pro Finger der rechten Hand. An der linken Hand ist es die Zahl 76543 – eine von nur zwei Primzahlen mit aufeinanderfolgenden Ziffern in absteigender Reihenfolge. Offenbar glaubt er, Primzahlen verkörperten eine besondere Kraft. In einem fundamentalen, kosmischen Sinn. Verschlüsselte Nachrichten, die die Raumzeit durchziehen.
Noch eine Minute Spielzeit.
Yῡgen hat das Ende des Catwalks erreicht. Der Besprechungsraum liegt in der Mitte des Gangs zur Linken und geht nach rechts auf. Doch das würde bedeuten, sie müsste sich dem Raum von ihrer schwachen Seite her nähern. Sie kann notfalls beidhändig feuern, doch nicht bei Prime. Sie wäre tot, bevor sie ihn auch nur bemerkt hätte.
Deshalb wendet sie sich nach rechts. Senkt das Gewehr und joggt los. Läuft einen Kreis, um sich dem Raum von ihrer starken Seite zu nähern. Sie weiß, dass ihr Plan übermittelt wird, doch sie hat keine Wahl.
Nur noch vierzig Sekunden. Keine Zeit mehr zu planen, keine Zeit mehr für Tricks. Sie weiß, dass Prime den Finger am Abzug haben wird, wenn sie den Kopf aus der Deckung steckt, also muss sie sich ganz auf ihren Instinkt verlassen.
Die letzte Ecke. Sie befindet sich jetzt unmittelbar vor dem Besprechungsraum. Auf ihrer starken Seite. Den Rücken an die Wand gepresst. Noch zehn Sekunden. Sie weiß, dass er ihre exakte Größe kennt und es auf einen Kopfschuss angelegt hat. Deshalb geht sie in die Hocke. So ist ihre Haltung weniger stabil, doch der Moment, den er braucht, um sich umzuorientieren, könnte den Ausschlag geben.
Neun.
Sie wünschte, sie hätte eine Splittergranate, die sie in den Raum schleudern und von der Wand abprallen lassen könnte.
Acht.
Oder eine Blendgranate. Aber wer bei diesem Spiel so weit kommt, der hat keine Granaten mehr.
Sieben.
Sie spürt ihren Herzschlag durch den haptischen Anzug hindurch. Hört ihn in den Ohren.
Sechs.
Ihr Herz schlägt so hektisch, dass es ihr das Zielen erschweren könnte.
Fünf.
Wahrscheinlich geht er davon aus, dass sie bis zur letzten Sekunde warten wird, deshalb muss sie jetzt aktiv werden.
Vier.
Tief Luft holen. Luft anhalten. Dann eine schnelle Drehung.
Zwei schnelle Einschläge auf Kopfhöhe, Glas zerschellt. Sie wartet darauf, dass die Haptik an der Brust oder am Helm anzeigt, dass sie getaggt wird, doch nichts passiert. Prime ist am Boden, kauert unter dem Tisch, die Waffenvisiere vor sich aufgereiht. Der Scheißkerl spielt mit ihr – genießt seinen Sieg.
Instinktiv senkt Yῡgen die Waffe und verpasst ihm zwei Kugeln in den Kopf.
In ihren Ohren tönt die V-Sports-Hymne, und eine tiefe, Respekt einflößende Stimme verkündet: GAMEOVER. DUHASTGEWONNEN.
Doch irgendetwas stimmt nicht. Sie entriegelt das Visier, schiebt es in den Helm zurück und taumelt angesichts des jähen Übergangs vom Wolkenkratzer bei Nacht zu hellgrünen Oberflächen und Plasmabeleuchtung. Und Rot. Blut, das bereits dunkel wird. Gerinnt. Das sich bereits ausgebreitet hat. Ihr erster Gedanke ist, dass sie jemanden getötet hat, doch sie korrigiert sich sofort. Sie weiß, dass das nicht sein kann. Spürt, dass die anderen Spieler sich hinter ihr versammeln – sie kommen angelaufen, um ihr zu gratulieren, dann bleiben sie stehen. Sie hört sie, versteht sie aber nicht. Sieht die Spritzmuster an der Wand. Die linke Hand ausgestreckt, das Sturmgewehr knapp außer Reichweite. Der ganze Zeigefinger fehlt, die fünfstellige Primzahl hat nur noch vier Stellen.
4
Falsch-positiv
Die Toten an der Wand machen es ihr schwer, sich aufs Reden zu konzentrieren.
Quinn sitzt ihrem Boss, Vanessa Townes, gegenüber. Die vom Boden bis zur Decke reichende Plasmaglasscheibe zu ihrer Linken gleicht einem makabren Moodboard, das Gewalt und Mord darstellt. Aufgedunsenes weißes Fettgewebe quillt aus einer aufgeschlitzten Kehle, vor Entsetzen geweitete Augen. Ein schlanker, junger, dunkelhäutiger Mann, grauenhaft zerschmettert, verdreht und entstellt. Eine junge Frau auf dem Gehsteig, Arme und Kopf verdreht, die beiden robotischen Beine gelöst, das eine vollkommen zertrümmert.
Und Zahlen. Alle vierstellig. Unterschiedlichen Körperteilen aufgeprägt. Eingebrannt, gestempelt und geritzt.
»Tut mir leid«, sagt Van. »Soll ich das ausschalten?«
»Ist schon in Ordnung«, sagt Quinn zu ihrem Boss. In Wahrheit wird ihr übel von der Collage des Grauens, doch sie mag es nicht, verhätschelt zu werden. Deshalb konzentriert sie sich auf den ramponierten Laptop, der neben einigen Dienstauszeichnungen hinter ihrem Boss im Regal steht. »Hat das Ding wirklich die Kugel eines AK-47 abgehalten?«
»Der Winkel war ausgesprochen günstig, wie jeder, der sich mit Ballistik auskennt, erkennen kann«, sagt Van. »Aber ja, das stimmt. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass man nie weiß, was einem am Ende das Leben rettet.«
Quinn lächelt. Richtet sich auf dem Stuhl auf. Streift etwas vom Knie, was gar nicht da ist.
»Ich möchte Ihnen danken«, sagt sie.
»Wofür?«
Eine subtile Geste nach links. »Dafür, dass Sie mich aus der Elitekiller-Sache rausgeholt haben.«
»Eigentlich habe ich Sie nicht rausgeholt, sondern jemand anderen reingeholt.«
»Wen?«
»Sie sehen sie vor sich«, sagt Van. »Aber nur auf Zeit. Wir checken noch andere Analysten.«
»Also, ich weiß das zu schätzen«, sagt Quinn. »Und ich möchte mich auch entschuldigen.«
»Quinn …«
»Nein, wirklich. Ich weiß, dass Sie mich für den Job haben wollten.«
»Ich fand, es wäre vielleicht gut für Sie«, sagt Van. »Das glaube ich ehrlich gesagt noch immer. Aber das ist etwas anderes, als Sie dabeihaben zu wollen. Ich möchte nicht, dass Sie etwas tun, wofür Sie noch nicht bereit sind oder womit Sie sich unwohl fühlen.«
»Ich habe einfach das Gefühl, ich brauche etwas … Vorhersagbares.«
»Ja, das wäre schön«, sagt Van. »Nach allem, was mir bei meiner Arbeit so untergekommen ist, habe ich das Konzept der Vorhersagbarkeit abgeschrieben.«
»Also, etwas Vorhersagbareres, als auf der ganzen Welt einem Serienkiller nachzujagen.«
»Na gut«, sagt Van. »Und wie sehen Ihre Pläne aus?«
»Fortgeschrittene Analytik«, antwortet Quinn. Sie versucht, ihrer Stimme einen zuversichtlichen Klang zu verleihen, doch sie weiß, dass es eher nach einer Entschuldigung klingt.
»Fortgeschrittene Analytik«, sagt Van. »Das haben Sie doch auch in ihrem letzten Job gemacht, bevor Sie zur Terrorismusbekämpfung gekommen sind, nicht wahr?«
»Aber jetzt in einer Führungsfunktion«, sagt Quinn. »Als Teamleiterin.«
Vans Kopfnicken soll neutral wirken, kommt aber als ausgesprochen wertend herüber.
»Was?«, fragt Quinn.
»Nichts«, sagt Van. »Ist in Ordnung für mich.«
»In Ordnung?«
»Wenn Sie glauben, das sei der richtige Ort für Sie in dieser Phase Ihrer Karriere, haben Sie meine volle Unterstützung.«
Quinn begegnet ihren Vorgesetzten stets mit Respekt, doch im Moment fühlt sie sich provoziert. »Was genau meinen Sie mit in dieser Phase meiner Karriere?«
Van zuckt mit den Schultern. »Ja, was meine ich damit? Dass Sie in der Mitte Ihrer Karriere angelangt sind?«
»Und?«
»Wenn Sie die zweite Hälfte mit fortgeschrittener Analytik verbringen wollen, mit einem Job, den Sie bereits gemacht haben – in dem Sie gut sind und den Sie, offen gesagt, im Schlaf erledigen können –, dann ist das wohl die richtige Entscheidung.«
»Es ist nicht exakt die gleiche Tätigkeit«, wendet Quinn ein. »Ich würde ein Team leiten.«
»Verzeihung«, sagt Van, was sich nicht nach einer Entschuldigung anhört. »Mein Fehler.«
»Bei Ihnen klingt das so, als wäre fortgeschrittene Analytik unwichtig. Diese Behörde würde ohne sie nicht funktionieren.«
»Aber sie kann ohne Sie funktionieren«, sagt Van.
»Was soll das heißen?«
»Das heißt, wenn Sie in den Ruhestand gehen, wollen Sie dann auf Ihre Karriere zurückblicken und feststellen, dass Sie einen Job gemacht haben, den auch viele andere hätten machen können? Oder wollen Sie mit dem Wissen in den Ruhestand gehen, dass Sie etwas getan haben, zu dem nur Sie imstande waren?«
»Was, zum Beispiel?«, fragt Quinn. »Wozu bin nur ich imstande?«
»Es ist an Ihnen, oder?«
»Jetzt mal ernsthaft«, sagt Quinn. »Schluss mit dem Bullshit, Vanessa. Sagen Sie mir, was ich Ihrer Meinung nach tun sollte.«
»Meine Meinung zählt nicht.«
»Für mich schon.«
»Warum?«
»Weil ich Ihre Meinung respektiere. Weil …« Quinn zögert, dann fasst sie Mut. »Weil ich sonst niemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann. Weil ich auf meine eigenen nervigen, selbstmitleidigen, ermüdenden Gedanken angewiesen bin, und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich mir in den letzten Jahren kein guter Fürsprecher.«
»Quinn, ich sollte mich bei Ihnen entschuldigen«, sagt Van.
»Wofür?«
»Weil ich nicht für Sie da war. Die ganze Zeit nicht.«
»Das ist nicht Ihr Job«, sagt Quinn. »Außerdem waren Sie für mich da.«
»Nicht so, wie ich es hätte sein sollen. Nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte.«
»Also, da habe ich gute Neuigkeiten«, sagt Quinn. »Sie können jetzt für mich da sein. Sagen Sie mir, was ich tun soll.«
Van lehnt sich auf ihrem Stuhl zurück. »Möchten Sie wirklich wissen, was ich denke?«
»Ja«, sagt Quinn. »Ich möchte, dass Sie vollkommen aufrichtig zu mir sind.«
Van senkt den Blick kurz auf ihren Laptop und sammelt sich. Doch ehe sie weiterreden kann, verändert sich etwas an der Plasmawand, und Quinn schaut unwillkürlich hin.
»Was ist das?«, fragt sie.
Es ist eine Männerhand. Der Zeigefinger ist abgetrennt. Eintätowierte Zahlen, in Reliefschrift: schwarze Blöcke mit fleischfarbenen Ziffern. Ein hellgrüner Hintergrund. Nicht so viel Blut, wie Quinn erwartet hätte. Vermutlich woanders ausgeblutet.
»Tut mir leid«, sagt Van. Sie beugt sich vor und nimmt die Fernbedienung aus der Halterung. »Ich schalte das verdammte Ding mal eben aus.«
»Warten Sie«, sagt Quinn. »Das ist eine Sechs.«
Vans Daumen verharrt über der induktiven Oberfläche. »Was meinen Sie?«
»Die Ziffer auf dem fehlenden Finger«, sagt Quinn. »Das ist eine Sechs.«
»Sind wir auch schon draufgekommen«, meint Van. »Die passt zu der Sequenz. Irgendein Countdown.«
»Das ist kein Countdown.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Weshalb sollte ein Countdown bei sieben einsetzen und nur bis drei gehen?«
»Tattoos sind eine sehr persönliche Ausdrucksform«, sagt Van. »Wer weiß schon, welche Bedeutung das für ihn hatte.«
»Genau«, sagt Quinn. »Das ist ausgesprochen persönlich, und es hat eine Bedeutung, doch das ist kein Countdown. Das ist eine Primzahl.«
»Eine Primzahl«, wiederholt Van.
»Eine von nur zwei Zahlen mit aufeinanderfolgenden Ziffern in absteigender Reihenfolge.«
»Interessant«, bemerkt Van. »Wie lautet die andere?«
»43.«
»Hm.«
»Wer ist das?«
»Da sind wir uns noch nicht sicher. Kam heute Morgen über Festleitung rein. Wahrscheinlich eine falsch-positive Meldung.«
»Wie meinen Sie das?«
Van legt die Fernbedienung in die magnetische Halterung zurück, dann sieht sie auf den Laptop.
»Der Fall-Bot hat mich wegen der Zahlen alarmiert, aber sie waren schon vorher da, deshalb habe ich ernsthafte Zweifel, dass unser Mann dafür verantwortlich ist.«
»Wer hat ihn dann getötet?«
»Der Gerichtsmediziner geht von einer Selbstverstümmelung eines geistig verwirrten Slasher-Selbstmörders aus.«
»Wieso das?«
»Weil er an dem Ort auf dem ganzen Planeten war, wo am wenigsten mit einem Mord zu rechnen ist.«
»Wo?«
»Mitten in einer V-Sports-Arena«, sagt Van. »Vor Hunderten von Kameras. Mit Millionen Zuschauern. Livezuschauern.«
Quinn steht auf und geht zu der Wand. Die anderen Bilder sind skaliert und überlappend angeordnet, um Platz zu schaffen für das neue Tatortfoto.
»Weshalb ist der Hintergrund grün?«
»Farbbasierte Bildfreistellung. Greenscreen. Die Spieler tragen VR-Headsets, doch das Publikum legt Wert auf eine Third-Person-Perspektive. Deshalb werden die großen Arenen vollständig grün ausgemalt, damit man sie durch eine virtuelle Umgebung ersetzen kann.«
»Alles, was grün ist, wird unsichtbar«, sagt Quinn.





























