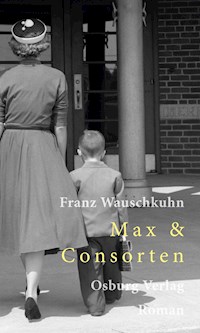Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Osburg Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Mittelpunkt der Handlung steht ein renommierter Bankier alter Schule, der trotz seiner Erfahrung in die Fänge einer internationalen Finanzmafia und ihrer kriminellen Finanztricksereien gerät. Ebenso geht es einem klugen Finanzminister. Der Bankier bezahlt mit Namen und Ruf, der Politiker mit seinem Leben. Der Roman der beiden Journalisten Carl-Ludwig Paeschke und Franz Wauschkuhn erzählt keine Geschichte aus einer südamerikanischen »Bananenrepublik«. Kaum zu glauben: Ihre Geschichte spielt im Hier und Jetzt der Bundesrepublik Deutschland unserer Tage. Einem der reichsten Länder der Welt, eingebunden in ein kaum noch zu durchschauendes internationales Finanzsystem, das von kriminellen Profiteuren ausgebeutet wird. Mit ihrem zeitgeschichtlichen Roman Derby der trojanischen Pferde wagen sich die beiden Autoren an ein Thema, das gerne von allen Beteiligten wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird: die oftmals unheilige Allianz zwischen maßlosen Investmentbankern und Spitzenpolitikern ohne jede Ethik. Die Autoren haben bewusst kein Sachbuch, sondern einen Roman geschrieben. Sie wollten ihren Lesern eine spannende Geschichte zum Zustand dieser Republik liefern und sie wissen, dass die Finanzjongleure längst schlau genug ist, so wenige Spuren wie möglich zu hinterlassen. So thematisieren seit Jahren die bundesdeutschen Medien beim Thema CumEx den milliardenschweren Steuerbetrug. Von der heimlichen Rettung von Großbanken oder der Subvention der Landesbanken ist aber kaum einmal die Rede. Und das hat seinen Grund.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Wauschkuhn · Carl-Ludwig Paeschke
Derby der trojanischen Pferde
Franz Wauschkuhn
Carl-Ludwig Paeschke
Derby der trojanischen Pferde
Eine Finanzgroteske
Roman
Osburg Verlag
Erste Auflage 2023
© Osburg Verlag Hamburg 2023
www.osburgverlag.de
Alle Rechte vorbehalten,insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Clemens Brunn, Hirschberg
Satz: Hans-Jürgen Paasch, Oeste
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-95510-333-0
eISBN 978-3-95510-341-5
Dieser Roman erzählt eine Geschichte. Er basiert zum Teil auf Anregungen und einigen realen Ereignissen, die Geschichte ist jedoch hiervon völlig unabhängig und rein fiktional. Weder Geschehnisse noch Personen und deren Umfeld sind real oder authentisch wiedergegeben. Ähnlichkeiten wären rein zufällig. Die Autoren haben mit diesem Roman ein eigenes neues Werk geschaffen.
Inhalt
Kapitel 1
Die Kriegserklärung
Kapitel 2
Der Tod des Finanzministers
Kapitel 3
Selbstmord Bankenprüfung
Kapitel 4
Schamlos übertrieben
Kapitel 5
Die wahre Krönung der Schöpfung
Kapitel 6
Von Mächten über dem Gesetz und ergebenen Hunden
Kapitel 7
Die Landesbank
Kapitel 8
Der alte Bankier
Kapitel 9
Justitia
Kapitel 10
Gift im Zoo
Kapitel 11
Im Handumdrehen mutterseelenallein
Kapitel 12
Der Erfinder der Gelddruckmaschine
Kapitel 13
Auch Richter lesen Zeitung
Kapitel 1
Die Kriegserklärung
Sebastian Franck hatte schlecht geschlafen. Die Autobahn nach Berlin war vollgestopft mit Lastern aus Polen, Lettland und Rumänien und ein Überholmanöver seines Chauffeurs mit Tempo 200 hatte ihn endgültig aus seinem unruhigen Schlummer gerissen. Wer hätte sich so etwas noch keine 25 Jahre zuvor, vor 1989, vorstellen können? Damals, als man noch im Schneckentempo über die von Vopo und Stasi strengstens überwachte Transitstrecke fahren musste.
Punkt neun entstieg er dem Mercedes. Seine Laune besserte sich: mitten in der Metropole frühsommerliches Blattgrün. Eine Drossel zog Würmer aus dem feuchten Rasen. Als die junge Kellnerin mit dem Kännchen Darjeeling First Flush kam, ärgerte er sich plötzlich über sich selbst: Warum tat er sich das an? Was wollte dieser Schacherl überhaupt von ihm? Dessen Vorschlag zu einem Treffen in der Wilhelmstraße hatte er sofort abgelehnt. Der graue Protzbau des Hermann Göring, wo nun der Bundesfinanzminister residierte, war ihm ein Gräuel.
Ideal sei vielmehr ein gemeinsames Frühstück im Café in der Fasanenstraße, hatte er durch seine Sekretärin mitteilen lassen. Hinterm Kurfürstendamm störe weder der Herr Bundesminister noch politische Prominenz oder das, was sich dafür halte.
Karl Schacherl erschien, als Sebastian Franck den ersten Schluck seines Darjeeling First Flush nippte. Genauso hatte er sich den Parteikarrieristen vorgestellt: blauer Anzug, hellblauer Schlips weiß gestreift, ungeputzte schwarze Schuhe mit Ledergeflecht. Man war sich schnell einig: Jeder zahle selbst. Sich als Beamter der Gehaltsstufe B einladen zu lassen ist in der schwatzhaften Hauptstadt selbstmörderisch. Schacherl grinste eisern: »Die Bankenaufsicht lässt sich nicht von Deutschlands reichstem Bankier einladen – auch nicht zu Brötchen und Rührei.« Als Repräsentant der »neuen Zeit« trug er Vollbart, hinter der Stirn entwickelte sich eine Halbglatze.
Der sichtlich gealterte Bankier bemühte sich zurückzulächeln: »Was ist Anlass zu unserem Tête-à-Tête?« Er wurde ernst: »Wir haben keinen Ärger mit dem Libor – so wie die Primus Bank. Wir hatten nie irgendwelche Derivate von Bankers Trust. Wir lassen uns nicht von Kanzleien wie Notex über Lücken im Steuerrecht unterrichten. Wir haben weder mit Schiffsfonds noch mit Subprime Geld in den Sand gesetzt. Geschweige denn verloren. Wir brauchten nicht wie die Primus Bank und ihre Töchter für zig Milliarden vom Steuerzahler gerettet werden. Wir haben keine kriminellen Berufspleitiers, keine Geldwäscher oder gar Politiker im Portefeuille.«
»Gott bewahre.« Schacherl fiel Rührei in den Schoß. »Die SEC-Leute von der Börsenaufsicht in Washington will ja niemand im Nacken haben.« Der »Stehkragenproletarier«, so nannte der Bankier diesen Typus Mensch, schlang einen weiteren Bissen hinunter. »Ich soll Sie übrigens vom Minister grüßen. ›Alle Achtung‹, hat er gesagt, ›wie dieser Franck sein Haus durch den Orkan gelotst hat.‹«
»Danke für diese elegante Lüge. Was hat Ihnen Ihr Herr Minister denn auf den Weg gegeben?« Dabei überlegte der alte Herr: Irgendwo ist mir der Name Schacherl doch bereits über den Weg gelaufen, oder?
Schacherl lächelte noch breiter als der Erste Bürgermeister von Hamburg: »Nein, das ist unsere wahre Meinung. Sowohl hier in der Wilhelmstraße als auch bei uns, also der gesamten Bankenaufsicht.«
Den Hamburger Bankier erinnerte das an einen Spruch von Herbert Wehner. Der längst verstorbene Spitzensozi, den er in seiner Jugend verehrt hatte, hatte im Bundestag gesagt: »Ministerialbeamte lügen immer.« Doch Franck mochte nicht weiter provozieren und fragte: »Kommen Sie bitte zur Sache: Wozu treffen wir uns hier? Kein Schwanz hat sich je um die Weinheim Bank gekümmert – außer den Nazis.«
Das saß. Trotzdem grinste Schacherl ungerührt weiter. Er legte sich Schinken auf die untere Hälfte des Brötchens. »Wissen Sie: Zürcher Banken wie die Credit Suisse kriegen in Hamburg keinen Fuß auf den Boden. Das ist alles Ihnen, verehrter Dr. Franck, und Ihrem Institut zu verdanken. Das wissen wir sehr wohl. Die echt Reichen – ich bediene mich mal des ordinären Terminus – im Norden sagen alle: Auf Franck und seine Bank war über Jahrhunderte und ist auch heute immer Verlass. Was sollen wir unser Geld auf den Kanalinseln oder etwa in der Karibik parken, wenn wir’s bei Franck, direkt vor der Haustür, nutzen können?«
Dem alten Herrn stieß sauer auf, wie ihn dieser Karrierist zu umschmeicheln suchte. Er blickte wieder zu der Drossel hin, die gerade einen weiteren Wurm erfolgreich aus dem Erdreich befördert hatte, als plötzlich ein schwarz-weißes Hündchen bellend unter dem Nebentisch hervorstieß und der Vogel davonflatterte. Die Idylle war dahin.
»Was besorgt den Herrn Minister und seine Behörde? Etwa unser Family-Office-Geschäft? Das betreiben wir seit zweihundert Jahren. Und es macht uns immer mehr Spaß.«
Schacherls Lächeln gefror. Lächeln Sie, was immer auch kommt. Das hatte der Personal Coach dem Bundesminister, dessen Staatssekretären und den Ministerialen über Monate hinweg eingebläut.
»Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie und Ihr Herr Minister uns das Family-Office-Geschäft nehmen und der Primus Bank zustecken wollen?« Der Privatbankier fixierte Schacherl mit so wütendem, stechendem Blick, dass der wegschaute. Zum ersten Mal in seiner Karriere packte ihn nackte Angst.
Franck hingegen kannte diese Reaktion seit Jahrzehnten: Alle seine Gegner, selbst die freche, nette Betriebsratsvorsitzende, hatten daraufhin stets klein beigegeben.
»Nein, bitte seien Sie unbesorgt«, erwiderte Schacherl. »Der Minister und wir von der Bonner Aufsicht haben lediglich darüber nachgedacht, dass Sie die siebzig schon gerundet haben. Wer außer Ihnen hat einen solchen Schatz an Erfahrung, die Milliarden in Deutschland zu halten und nicht über die Schweiz entschweben zu lassen? Es wird Ihr Schade nicht sein, darüber mit der Primus Bank zu sprechen.«
Plötzlich fühlte sich der Siebzigjährige wirklich alt: »So weit ist es also mit Erhards Marktwirtschaft gekommen, dass Sie und ein leibhaftiger Bundesminister mich zwingen wollen, unser bestes Pferd im Stall diesen Frankfurter Kanaillen zum Fraß zu geben?« Franck wurde regelrecht ausfällig: »Die können nur eins: Lügen, Milliardenverluste aufhäufen und sich selbst Bonuszahlungen in Milliardenhöhe zuschanzen. Ihre Aktionäre behandeln sie wie Volltrottel und die Presse schweigt dazu seit Jahren.«
Schacherl winkte der Kellnerin: »Die Rechnung. Getrennt. Und rufen Sie bitte ein Taxi für mich zur Wilhelmstraße.« Dann wandte er sich grinsend wieder dem Hamburger Bankier zu: »Dividendenstripping ist doch seit 1976 eine kleine, freundliche Dienstleistung ihrer Bank: Die hat alljährlich, brav am Tag vor der Dividendenausschüttung, die deutschen Aktien ihrer britischen und holländischen Kunden aufgekauft. Denn als deutsches Institut hatte die Weinheim Bank genauso wie alle übrigen deutschen Aktionäre Anspruch auf Rückerstattung der Kapitalertragssteuer. Dann habt ihr das Geld vom Finanzamt erhalten, an die Altaktionäre überwiesen und die Aktienpakete an sie zurückverkauft.«
»Ja, und was haben Ihr Herr Bundesminister und Ihre werte Behörde daran auszusetzen?«, fragte der alte Herr. Er hatte Mühe, sachlich zu bleiben: »Über Jahrzehnte sind ausländische Aktionäre vom deutschen Gesetzgeber diskriminiert worden. Keinen Finanzminister hat’s gekümmert. Das war ein krasser Verstoß gegen Europarecht. Aber mit Kreisgeschäften haben wir und viele andere deutsche Institute den DAX und den deutschen Aktienmarkt weltweit attraktiv erhalten.«
»Ja, ja, das war einmal«, antwortete Schacherl herablassend. »Heute sind wir aber im Zeitalter der digitalen Revolution. Da sausen Milliarden von Aktien in Sekundenschnelle rund um den Globus. Die Wall Street hat das Dividendenstripping mit allerlei hinterhältigen Tricks, insbesondere mit dem Leerverkauf, aufgehübscht und in ›Cum-Ex‹ umbenannt. Und mit Cum-Ex werd ich Sie fertigmachen.«
Schacherl verabschiedete sich nicht, wartete auch die verlangte Rechnung nicht ab, sondern drehte sich abrupt um und schritt durch den Garten zum Taxi. Der alte Herr winkte die hübsche Kellnerin heran. Er zahlte bar für zwei und ließ ihr acht Euro als Trinkgeld.
Um 10 Uhr 30 hatte der Krieg begonnen.
»Zurück nach Hamburg«, sagte Franck, als er in den Fond des Mercedes stieg.
»Wieso Hamburg? Hatten Sie nicht um zwölf einen Termin im Burenpalais in Mitte?« Sein Chauffeur, der den Bankier und dessen Frau seit über zwanzig Jahren als Faktotum von morgens bis abends durchs Leben begleitete, war bass erstaunt. »Wollten Sie nicht im Hotel de Venise übernachten? Da ist alles reserviert.«
»Robert, Sie wissen genauso gut wie ich, dass ich dort ganz bestimmt abgehört werde. Selbst mein Schnarchen. Früher war’s in Berlin die Stasi. Und heute?« Franck machte eine längere Pause. »Robert, ich brauch’s Ihnen nicht zu sagen. Sie waren doch dabei, als all die Wanzen entdeckt wurden. Siebzehn allein in meinem Hamburger Büro.«
Robert Weber fragte nicht weiter. Der Bankier hatte in Berlin und Frankfurt keine Freunde, nur Feinde. Das wusste er. Tagtäglich war er am Steuer Zuhörer der Gespräche seines Chefs.
Auf der Autobahn, auf Höhe von Fehrbellin, erinnerte sich Franck: »Schacherl!« – So hieß doch der schreckliche Wärter, der 1947 und 1948 im Frankfurter Zoo etwa fünfzig Tiere, darunter Zebras, Fasane, Paviane, Rhesusaffen, Zibetkatzen, Nutrias und Schimpansen mit Natriumfluorid vergiftet hatte. Schacherl hatte damit seinem Chef schaden wollen, dem Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek. Mutmaßlicher Auftraggeber der Giftorgie war der Münchner Zoodirektor. Der hatte Grzimek um dessen Popularität beneidet. Franck hatte die vom Frankfurter Zoo in Hagenbecks Tierpark verlegte Verfilmung Gift im Zoo als Zehnjähriger im Kino sehen dürfen.
»Mein Gedächtnis funktioniert«, dachte Franck und war wieder mit sich zufrieden.
Kapitel 2
Der Tod des Finanzministers
Acht Jahre später, an einem anderen Vormittag um die gleiche Zeit und rund 450 Kilometer südwestlich des Kurfürstendamms, wurden plötzlich die gellenden Entsetzensschreie dreier Schulkinder laut. Sie hatten von der Schmickbrücke im Frankfurter Osthafen herab eine menschliche Leiche treiben sehen. Der Schock war so heftig, dass eine Achtjährige in Ohnmacht fiel. Just als ein mit Sand beladenes Binnenschiff zum Anlegen an der linken Pier das Heckwassser aufschäumen ließ, entdeckte dann auch eine alarmierte Feuerwehrfrau den an die Oberfläche gespülten Körper. Irgendwoher meinte sie das Gesicht zu kennen. Jemand sagte: »Ist das nicht unser Finanzminister, der aus Wiesbaden?«
Sein persönlicher Referent hatte ihm die Nachricht gegen zehn Uhr zugesteckt, kurz vor Eröffnung der Bundesratssitzung in der Leipziger Straße, wiederum 450 Kilometer nordöstlich in Berlin. »Entsetzlich, grauenhaft«, entfuhr es Hessens Ministerpräsident Gotthold Vaupel. Er wurde augenblicklich weiß im Gesicht. Sein Kollege aus Bayern griff ihm unter den rechten Arm: »Was ist? Darf ich helfen?«
Doch sein sechzigjähriger Parteifreund aus Wiesbaden fasste sich schnell wieder. In zwölf Amtsjahren hatte Vaupel schon so manches erlebt. Doch dass sein eigener Finanzminister aus dem Osthafen geborgen worden war, war wirklich ein Schock für den politischen Fahrensmann. Vaupel kannte Jacob Kattenberger seit dem Landesparteitag 1986. Sie waren – so sagte man – sogar befreundet, was bei Mitgliedern derselben Partei Seltenheitswert hat. Die Kattenbergers waren gläubige Mennoniten aus Carlsdorf bei Hofgeismar. Menschen vom Land. Das Fachwerkhaus, in dem Jacob Kattenberger mit Frau, Tochter und Sohn lebte, war über fast dreihundert Jahre hinweg in der Familie vererbt worden. »Wir waren und sind immer Pazifisten gewesen«, pflegte Kattenberger zu sagen. »Mörder, Betrüger und Lügner bestraft unser Herrgott zu Lebzeiten. Dessen bin ich gewiss.« In der Partei hatte er den Ruf eines politischen Träumers. Was falsch war.
Die bestürzende Nachricht ließ Vaupel an jenes Gespräch zwischen ihm und Kattenberger einige Jahre zuvor zurückdenken, mit dem alles angefangen hatte.
Sie hatten vor aller Augen in der l’Osteria dreihundert Meter von Vaupels Amtssitz in der Hessischen Staatskanzlei am Wiesbadener Kochbrunnenplatz ein Mittagessen eingenommen. Dort hatte ihm sein Freund kleinlaut davon berichtet, wie ihn die Primus Bank seit Wochen unter Druck setze. Zwischen Spaghetti und einem Schluck Rotwein erfuhr Vaupel erstmals von den Millionenverlusten im Landeshaushalt, die sich durch die Wettverträge mit der Primus Bank dreistellig aufhäuften.
»Gerade die Primus Bank«, brummte Vaupel. Der Ärger stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Handwerkerfamilien schicken sie mir nichts, dir nichts zuhauf in die Pleite, tun das als Kleinkram ab. Wir von der Politik aber retten sie mit Steuermilliarden alle naslang vor dem Abgrund. Ich jetzt in meiner Amtszeit zum zweiten Mal. Werden dafür vom Wähler abgewatscht. Zum Dank erpressen sie uns. – Aber ich will dich nicht immer unterbrechen. Jacob, red weiter.«
Kattenberger holte erneut Luft. »Meine Familie und ich waren immer treue Kunden unserer Volksbank in Hofgeismar. Damals, eine Woche nachdem du mich 2009 ins Kabinett berufen hattest, lud der Bankenverband mich und meine Frau zum Violinkonzert mit dieser … du weißt schon.« Kattenberger wurde noch leiser. »Meine Frau war hell begeistert. Du kennst sie doch! Ja, und kurz darauf rief mich die Primus Bank an: Zwei Vorstände wollten mir ihr einzigartiges Modell zum Schutz gegen steigende Zinsen präsentieren. Ich hatte damals keine Ahnung von Derivaten und dem ganzen Teufelszeug. Aber die Primus-Banker legten – für mich – recht plausibel dar, dass die Zinsen infolge der weltweiten Finanzkrise wirklich schmerzhaft und dauerhaft über Jahre steigen würden.« Kattenberger atmete tief durch: »Ich hab das Papier von damals noch im Schreibtisch.«
»Und deine Mannschaft fand das toll?«, unterbrach ihn Vaupel.
Kattenberger nickte. »Ja, unser Haus, das ganze Finanzministerium, ging 2011 davon aus, dass der Zins rasant klettern würde. Und damit waren wir ja nicht allein: Alle anderen Finanzministerien, besonders NRW, sahen ebenfalls schwere Belastungen auf ihre Etats zukommen. Da hab ich mit der Primus Bank vertraglich vereinbart, dass wir für bestimmte Anleihen über die Dauer von vierzig Jahren nur den Minizins von gut drei Prozent zahlen müssen. Im Ministerium haben alle gejubelt. Der Kollege aus Düsseldorf rief mich an und beglückwünschte mich.«
»Und dann entlud sich kein Gewitter, nur Wetterleuchten, stattdessen senkte die EZB dank Draghi ihren Zins auf unter null«, sagte Vaupel. »Stimmt es, dass wir durch deinen Vertrag jährlich Buchverluste von neunzig Millionen verkraften müssen? Die Primus-Banker müssen sich ja ins Fäustchen lachen: Nur Politiker sind so blöd, auf so was reinzufallen.«
In diesem Moment wusste der Ministerpräsident nicht, über wen er sich mehr ärgern sollte: Über die selbstverliebten Primus-Banker oder über seinen Freund. Als er ihm zuprostete, bemerkte er erstmals, wie sehr seinem Kumpel die Angelegenheit tatsächlich an die Nieren ging. »Bleib ruhig. Lass Süddeutsche, Spiegel, Zeit, ARD und die Toskana-Sozis doch toben.« Er versuchte Kattenberger zu beruhigen: »Loyalität ist bei mir keine Einbahnstraße, das weißt du. Rede doch noch mal mit den Mistkerlen. Die sind zwar Scheiße in Seide – um Napoleon zu zitieren –, aber einen Versuch wär’s wert.«
»Ich hab’s ja schon mehrfach versucht. Aber da sitzen nur Tommys und Amis. Die wollen die Primus Bank sowieso an die Themse verfrachten. Ganz nach Margaret Thatcher: ›London, the biggest casino of the world.‹ Noch besser vielleicht nach Richmond, Virginia: ›The billion laundry of russian oligarchs.‹ – Die wollen lieber heute als morgen aus Frankfurt weg. Glaubst du, einer von denen spricht auch nur drei Wörter Deutsch? An der Ostküste der USA, auf den Bahamas und in Dubai häufen sie Berge an finanziellem Sondermüll auf. Mit dem zaubern sie jederzeit neue Weltfinanzkrisen herbei.«
»Du bist ja ein echter Marxist«, ging Vaupel dazwischen. Er lachte. »Wenn das der Spiegel wüsste. Die Zeit würde dir sogar drei ganze Seiten freiräumen und dich fragen, wann du denn das Kapital studiert hättest.«
Kattenberger winkte ab. »Du weißt doch selbst: Besonders den Tommys geht unsere deutsche Finanzaufsicht total auf den Wecker. Ethik halten die für Sonnencreme. Meinst du etwa, du könntest einen dieser Boni-Banker je bei uns im Theater oder etwa in der Oper treffen? Deutschkenntnisse hat keiner. Keiner von der Bande hat wenigstens zum Schein eine Wohnung im Taunus. Freitagnachmittag flüchten diese Hunde nach Heathrow. Und auf unser Hessen werden die von gestern auf heute verzichten. Deutschland, die ganze EU, ist denen alles Jacke wie Hose. Aber in Dubai und in Shanghai, da …«
»Hör auf«, unterbrach ihn Vaupel. »Wenn hier irgendwo ein Mikro steckt und jemand mithört …«
Kattenberger legte seine Gabel quer auf die Spaghetti. Ihm war der Appetit vergangen. Der Finanzminister versuchte sich zusammenzureißen: »Aber natürlich werde ich wieder das Gespräch mit den Primus-Bankern suchen. Aber ich hab gegen sie kein Ass im Ärmel. Denn mein geliebter Herr Amtsvorgänger hat ja unsere Steuerfahndung total enteiert. Wärest du, mein lieber Herr Ministerpräsident, Fahnder, würdest du auch keine Großbank mehr betreten.« Er wischte sich den Mund mit der Serviette: »Vielleicht kommen wir irgendwann doch zu einem vernünftigen Kompromiss.« Er glaubte nicht daran.
Selten war dem Ministerpräsidenten die innere Wutsuppe so hochgekocht wie in diesem Moment. Deshalb schimpfte er, nicht zum ersten Mal: »Und wir, Bund und Länder, haben diesen entsetzlichen Bankermob 2009 mit Hunderten von Steuermilliarden vor dem sicheren Absturz in den Orkus gerettet. Obendrein gab’s noch Cum-Ex-Geldsäcke für die Landesbanken. Das ist das Zehnfache von dem, was uns Wiedervereinigung samt Treuhandanstalt gekostet hat!« Vaupel schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. Gäste an den anderen Tischen blickten zu den beiden Politikern herüber.
Vaupel war Kind einer calvinistischen Familie, die vor dem vierzehnten Louis und seinen Mordbanden nach Frankfurt, in die Kapitale des »Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation«, geflohen war. Vaupel blieb in Fahrt: »Sag mir noch einer, wir hätten in Deutschland und Europa aus der Subprime-Krise gelernt. Absolut niente. ›Too big to fail‹ – damit können uns Primus-Banker und Wall Street jeden Tag erpressen. Unsere Enkel werden mit dem Finger auf uns zeigen, uns auslachen: ›Ihr Opas, ihr wart zu blöd!‹«
Die Personenschützer vom LKA warteten nervös vor der Tür, als sich Vaupel mit einem Schlag auf die Schulter von seinem Finanzminister verabschiedete. Er umarmte ihn sogar: »Mach’s gut. Du schaffst es – wie immer«, sagte er.
»War das Essen so schlecht?«, begrüßte ihn seine pfiffige Referentin, als Kattenberger in ihr Zimmer im Wiesbadener Finanzministerium schaute. Ewa Zeligmann wusste sofort, dass die Primus Bank Gesprächsthema gewesen war. »Den Libor zu drücken, das sind ja alte Kamellen«, spottete seine ›Kleine‹ in Anspielung auf gewisse Machenschaften internationaler Großbanken zur Manipulation des Referenzzinssatzes, an denen auch die Primus Bank nicht ganz unbeteiligt gewesen war. »Mit Investmentbanking lässt sich täglich – absolut genial – immer neuer und immer größerer Schaden anrichten: Heute ein Derivat auf erfolgreiches Nasepopeln, morgen eine Milliarden-Dollar-Anleihe auf das Häuschen, das Oma nie gehört hat, und gestern, da haben sie Putins Palast am Schwarzen Meer für schlappe zwei Milliarden finanziert. Der kleine Mann aus Petersburg ist ja so friedliebend und verlässlich.«
»Ist Sahra Wagenknecht Ihre neue Freundin?«
»Sie haben es erraten, mein Herr Finanzminister«, gab sie zurück.
Die Chuzpe seiner jungen Referentin begeisterte ihn stets aufs Neue. »Machen Sie mir bitte einen Termin«, bat er.
»Wenn Sie mich so verbiestert angucken, dann weiß ich schon mit wem.«
»Ja, mich dürstet förmlich nach der Saubande.« Kattenberger blickte wieder etwas entspannter zu der dreißigjährigen Volkswirtin hin, die innerhalb eines Vierteljahrs seine rechte Hand geworden war. 2004 bis 2008 hatte sie für zwei US-Trusts an der Wall Street gearbeitet und das ganze Finanzdebakel vor Ort erlebt. Sie würde ihr Leben lang nicht vergessen, wie gestandene Aktienhändler auf der Straße zu schluchzen und hemmungslos zu weinen begonnen hatten, wie Pappkartons mit persönlichen Unterlagen auf die Straße segelten, wie Freunde und deren Familien plötzlich vor dem Nichts standen. Ihre Schilderungen, wie sie diesen Orkan er- und überlebt hatte, hatten ihren Chef zutiefst beeindruckt.
Kattenberger hatte sie auch nicht korrigieren mögen, als sie gesagt hatte: »Die Subprime-Krise – das ist die letzte Stufe des Monopolkapitalismus.«
»Vier Millionen US-Bürger, Frauen, Männer und Kinder, per Zwangsvollstreckung aus ihren Häusern zu werfen, das kommt dem Bombardement auf Dresden gleich«, hatte Kattenberger ergänzt. Auch hier tröstete den seit seiner Kindheit tiefgläubigen Mennoniten sein fester Glaube, dass sein Herrgott alle Mörder, Lügner und Betrüger noch zu Lebzeiten ihrer wohlverdienten Strafe zuführen werde. Dazu zählte er ohne Weiteres auch die Primus-Banker.
»Frau Zeligmann, Sie werden mich selbstverständlich dorthin begleiten. Da gibt’s für Sie kein Wenn und Aber. Der Pöbel von der Primus Bank tritt immer zu zweit oder zu dritt auf. Nie allein. – Ewa, Sie sagen denen: Es gäbe da einiges zu regeln. Lassen Sie sich nicht weiter auf irgendetwas ein.«
Kattenberger fühlte sich an diesem Nachmittag besser. Er telefonierte mit seiner Frau und versprach: Er werde schon Freitagabend zu ihr nach Carlsdorf kommen. Und das tat er auch. Am Samstag blieb er zum Erstaunen der Familie ausgeglichen, goss die Bäume im Garten, riet seinem Sohn, erst einmal eine Handwerkerlehre zu machen. Er solle sich danach für ein solides Studienfach entscheiden: »Außer Karl Schiller kenne ich keinen Wirtschaftswissenschaftler, keinen dieser tollen Lehrstuhlinhaber, der sich je um seine Studenten gekümmert hat.«
Nach der Sonntagspredigt saß die kleine Mennonitengemeinde wie üblich im winzigen, kahlen Gemeindesaal beieinander, schwatzte und trank Kaffee. Alle waren für Umweltschutz – besonders die Frauen.
»Kattenberger – Entschuldigung: Herr Finanzminister –, wie sollen wir das alles denn bewerkstelligen? Neue Ställe für die Schweine, grüne Wiesen für die Kühe, doppelter, dreifacher Strompreis, Elektrozäune gegen die Wölfe …«, klagte ein junger Landwirt. »Steigen die Zinsen, kann ich mit meiner Familie einpacken. Und als Sahnebaiser obendrauf die CO2-Diskussion. Deutschland will wieder die Welt retten. Währenddessen heizen die Chinesen jeden Tag ein neues stinkendes Steinkohlekraftwerk an.«
Kattenberger hätte sich diese Diskussion gern erspart. Hessen werde seine Landwirte nicht im Stich lassen, erklärte er. Man denke in Wiesbaden wirklich ständig darüber nach, wie und wo zu helfen möglich sei. Aber jede Hilfe brauche eben Zustimmung aus Brüssel. Der Minister sah nur enttäuschte Gesichter. Das tat ihm weh. »Ich tu alles, was möglich ist. Ihr könnt es mir glauben.« Dann schwieg er und leerte seinen Becher. Über die Zukunft der Ortschaft machte er sich keine Illusion: Die nächste, womöglich die letzte Generation würde das Dorf vollständig verlassen. Dann sprössen hier Brennnesseln und der allseits ersehnte grüne Urwald.
»Immer dasselbe«, sagte seine Frau auf dem Weg nach Hause. Sie spürte, wie sich die Stimmung ihres Mannes wieder verdüstert hatte. »Wem nützt das ganze Geschrei vom Weltuntergang?«, fragte sie, während sie ihm den Rücken zukehrte und die schwere eichene Eingangstür öffnete. Sie lebte nach dem bewährten Motto: »Bevor isch misch uffreesch, isses mer liewer egal.«
Er hängte seine Joppe an den Haken. »Nutznießer des Untergangsgeschreis, dieser Orgie von Schreckensmeldungen, angefangen bei saurem Regen und dem Strahlentod durch Kernkraft über die unaufhaltsame Erderwärmung bis hin zum Meeresanstieg, das sind seit Urzeiten, seit der Mensch aufrecht geht: Eschatologen, politische Ideologen, fanatische Glaubensprediger und schlaue Kapitalisten, heue speziell britische und US-Fondsmanager«, antwortete er, während er es sich auf einem alten Gartenstuhl bequem machte. »Damit beherrschen sie die Menschheit. Philip II., die Jesuiten, Mao, Stalin oder Hitler, alle schreien vom morgigen Weltuntergang, predigen ständig Buße und mit dem Ablass plündern sie Arm und Reich. Selbst aber futtern sie Kaviar zuhauf. Herr Mao ging nie ohne drei blutjunge Mädels zu Bett.«
Seine Frau lachte. »Woher weißt du so was?« Sie fragte: »Und wer macht heute mit dem Weltuntergang Kasse?«
Kattenberger zog sie an sich: »Ich sag’s dir. Das sind die Digitalpäpste von Silicon Valley. Deren Klimaexperten forschen angeblich frei und gemeinnützig, aber sie unken immer mit Blick auf die Jugend. Sie sei die letzte Generation der Menschheit. So war es beim Kinderkreuzzug im Mittelalter und so ist es bei den Ökoaktivisten heute.«
Seine Frau gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf: »Sag das nie in der Öffentlichkeit. Du kriegst sofort den Stempel ›Faschist‹ aufgedrückt. – Selbst in deiner Partei. Mit Wahrheit und normalem Verstand bringt sich jeder heutzutage um Kopf und Kragen. Sei bitte still – meinetwegen. Ich möchte wenigstens nach deiner Ministerzeit ein paar Jahre in Ruhe mit dir verbringen.«
»Sie werden es kaum glauben«, sagte Ewa Zeligmann, als Kattenberger am Montagmorgen ins Büro trat. »Der amtierende Derivate-Zauberer aus London, der die Bande neuerdings anführt, der hat – so wurde mir gerade am Telefon bedeutet – extra für Sie, Herr Landesminister, einen Termin am Mittwochmorgen freigeschaufelt.«
»Ich kann’s kaum glauben.«
Nein, es waren nicht teuerste Möbel, auf die an besagtem Mittwochmorgen die Dame und der Herr aus dem Wiesbadener Finanzministerium zu sitzen kamen – sondern braves USM-Haller-Ambiente. »Treten Sie näher in unsere schlichten Räume«, hatte Professor h. c. Dr. Dr. Sigmund von Köz, der Vorstand Recht, bei seiner Begrüßung in der Eingangshalle der Primus Bank gesagt. »Unser Vorstandsvorsitzender ist leider – ich bedaure das wirklich sehr – kurzfristig verhindert. Sie müssen bitte mit mir und meinem Kollegen in Sachen Vertrieb vorliebnehmen. Außerdem, Sie wissen das bestimmt, Herr Dr. Kattenberger, unser Vorstandsvorsitzender ist – leider, leider – nicht so recht firm in der deutschen Sprache.«
Ewa Zeligmann wurde weder von dem einen noch dem anderen der beiden Primus-Banker ein Platz zugewiesen. Der Minister registrierte die Ungezogenheit. Die Beamtin platzierte sich jedoch wie selbstverständlich neben ihren Meister. »Ich bin gespannt auf das Geseiche dieser Machos«, flüsterte sie, während sie ihm die Unterlagen reichte.