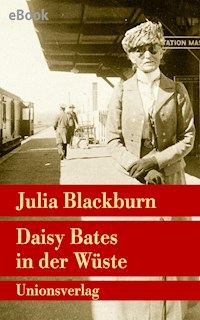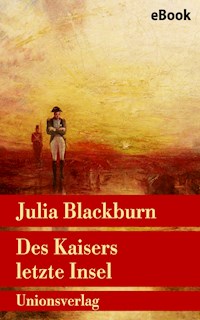
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die letzten sechs Jahre seines Lebens residierte Napoleon Bonaparte, einst Herrscher eines Weltreiches, in einem verfallenen Bauernhof auf Sankt Helena, einer unzugänglichen, sturmumtosten, struppigen Insel am Ende der Welt. Verfolgt von Erinnerungen an seine Macht, ist sein Reich nun begrenzt auf eine Natur, die dramatische Veränderungen durchlebt. Doch auch in dieser Welt können sich die Bewacher und der klägliche Rest eines Hofstaats der Aura des verbannten Kaisers nicht entziehen. Julia Blackburn erzählt die faszinierende Geschichte der Insel Sankt Helena und ihres wohl legendärsten Bewohners.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Die faszinierende Geschichte der Insel Sankt Helena und ihres wohl legendärsten Bewohners – Napoleon Bonaparte, verbannt ans Ende der Welt. Doch selbst auf der kargen, sturmumtosten Insel können sich die Bewacher und der klägliche Rest eines Hofstaats der Aura des einstigen Herrschers nicht entziehen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Julia Blackburn wurde 1948 in London geboren. Neben ihren Memoiren, die unter anderem auf der Shortlist des Ondaatje-Preises standen, hat sie Romane geschrieben, für die sie bereits zwei Mal den Orange-Prize und 2017 den New-Angle-Prize erhielt. Sie hat zwei Kinder und lebt in Suffolk und Italien.
Zur Webseite von Julia Blackburn.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Julia Blackburn
Des Kaisers letzte Insel
Napoleon auf Sankt Helena
Aus dem Englischen von Isabella König
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1991 bei Secker & Warburg, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 im Berlin Verlag.
Originaltitel: The Emperor’s Last Island
© by Julia Blackburn 1991
© der deutschen Übersetzung: Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2001
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: William Turner, Krieg - Das Exil und die Napfschnecke, Gemälde, 1842, Öl auf Leinwand; Foto © Steve Vidler (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31046-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 03:27h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DES KAISERS LETZTE INSEL
1 – »Gibt’s hier etwa Löwen oder Tiger?«, fragte sie …2 – Von dort, wo wir ritten, im Nordwesten …3 – Sei nicht in Angst! Die Insel ist voll …4 – »Die Zeit ist reif«, das Walross sprach5 – Mein schwarzer Diener führte mich einen weiten Weg …6 – »Wozu, glaubst du denn, soll ein Kind gut …7 – O, wär’s möglich, und wir könnten8 – Ich habe das Geräusch des Windes immer mehr …9 – »Seit diesem Tag«, fuhr der Hutmacher in kläglichem …10 – Ein Baum lässt sich am besten messen …11 – … denn an sich ist nichts weder gut …12 – Dulden muss der Mensch13 – Glück und Unglück haben keinen festen Wohnsitz14 – Des Menschen Schicksal wechselt ständig15 – »Was macht es denn, wie weit es ist?« …16 – »Du musst wissen«, fügte er sehr ernsthaft hinzu …17 – Vor langer Zeit die Welt entstand, Hop heisa …18 – »Ich denke oft, dass ihm der Friedhof gefallen …19 – Sind nicht die Bäume grün20 – Und da ging das Licht aus, und wir …21 – »Lasst uns auf der Hut sein«, sagte Don …22 – Ja, jeder Zoll ein König23 – »Wenn ich doch auch froh sein könnte!« …24 – Macht keinen Lärm, macht keinen Lärm; zieht den …DanksagungBibliografieMehr über dieses Buch
Über Julia Blackburn
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Julia Blackburn
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Meer
Zum Thema Natur
Zum Thema Geschichte
Zum Thema Biografie
Zum Thema Insel
Für Hein, in Liebe
Gott, ich könnte in eine Nussschale eingesperrt seinund mich für einen König von unermesslichem Gebiete halten, wenn nur meine bösen Träume nicht wären.
Shakespeare, Hamlet
Wie weit ist’s von St. Helena zum Feld von Waterloo?
Ein naher Weg – ein klarer Weg –das Schiff bringt dich bald hin.
Ein hübscher Ort für feine Herr’n mit wenig sonst zu tun.
Rudyard Kipling, »A St Helena Lullaby«
1
»Gibt’s hier etwa Löwen oder Tiger?«, fragte sie schüchtern.
»Es ist nur der Rote König, der so schnarcht«, sagte Tweedledee.
Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln
Als ich mir zum ersten Mal vorzustellen versuchte, was das hieß – ein Mann wie Napoleon, gefangen auf einer Insel wie St. Helena –, da fiel mir ein Zwischenfall vor vielen Jahren, auf einer Bergstraße irgendwo in Südspanien, ein, bei dem ich zufällig Zeuge wurde. Das kleine Auto vor mir prallte frontal gegen die breite Nase eines entgegenkommenden Lastwagens. Im Auto saßen drei Polizisten der Guardia Civil, auf dem vorderen Beifahrersitz ihr Anführer, ein Oberst, der sich von den anderen durch die Bänder und Orden abhob, die auf seiner dunklen Uniform prangten; er wurde durch den Aufprall nach vorn geschleudert, sein Kopf schlug gegen die Windschutzscheibe, und er erlitt eine leichte Gehirnerschütterung. Die anderen beiden Männer blieben unverletzt, und ich schaute zu, wie sie eilig aus dem Wagen kletterten und sich daranmachten, den reglosen Körper ihres Vorgesetzten auf die Straße zu hieven. Sein Gesicht war leichenblass, wirkte aber, obwohl es in diesem Augenblick vollkommen ausdruckslos schien, immer noch irgendwie bedrohlich – so als könnte der, dem es gehörte, jeden Augenblick die Kiefer aufklappen und zubeißen.
Die beiden Polizisten fühlten sich offenkundig gezwungen, in Gegenwart, und sei es auch der bewusstlosen Gegenwart, einer so wichtigen Persönlichkeit peinlich korrektes Verhalten an den Tag zu legen; um ihn nicht hilflos und allein liegen zu lassen, packten sie ihn also, einer an den Füßen, der andere unter den Armen, hoben ihn von der heißen nackten Straße hoch und gingen zum Lastwagenfahrer hinüber, um den Unfallhergang mit ihm zu besprechen. Dort standen sie dann, endlos lange, wie es schien, in der Hitze des Tages; der schwere Körper hing kraftlos zwischen ihnen, die funkelnden Orden waren zur Seite gerutscht, die Socken den Blicken preisgegeben, und eine militärische Kopfbedeckung balancierte auf einer sanft bewegten Brust. Endlich schien entschieden, wer woran die Schuld trug, und schwankenden Schritts kehrten die beiden Männer zu ihrem Auto zurück, zogen und zerrten den General der Länge nach auf die Rückbank, kletterten selbst hinein und setzten die unterbrochene Fahrt fort. Die Versuchung war groß, mir einzubilden, der bewusstlose Mann hätte ganz kurz die Augen geöffnet und ungläubig auf die Szene gestarrt, die sich da abspielte, um sogleich wieder in ein unruhiges Vergessen zurückzusinken; aber vielleicht war es nur die gleißende Sonne, die mich täuschte.
Was das alles mit Napoleon zu tun hat? Er steckt in der misslichen Lage des erschütterten Generals: fein gekleidet und alle Poren voll vom Geruch seiner Macht und Autorität, einem Geruch, so beißend wie der eines Fuchses, und dennoch für die letzten sechs Jahre seines Lebens hilflos der Zeit und der Geschichte enthoben; gestrandet an einer winzigen vulkanischen Insel mitten im südatlantischen Ozean.
1812, als er sich auf dem Rückzug aus dem Blut und dem Chaos von Moskau und dem Russischen Feldzug befand, bemerkte Napoleon, es sei nur ein kleiner Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen. Von dem Augenblick an, da man ihn auf St. Helena absetzte, bis zu dem Tag fünfundzwanzig Jahre später, als sein Körper schließlich von der Insel entfernt wurde, rückten das Erhabene und das Lächerliche oft so eng zusammen, dass man sie gar nicht mehr voneinander trennen konnte. Die Diener und Begleiter, die mit ihm auf der Insel waren, brachten ihm nach wie vor all die Ehrfurcht entgegen, mit der ein Kaiser behandelt sein will, doch je mehr sie in Napoleons Gegenwart katzbuckelten und knicksten und versuchten, die Illusion eines höfischen Lebens aufrechtzuerhalten, umso sorgsamer mussten sie jeden Spiegel meiden, der ihnen gezeigt hätte, was sie taten und wie sie dabei aussahen. Ähnlich erging es all den Besuchern, die haltmachten und auf die Insel strömten, in der Hoffnung, einen Blick auf den berühmten Gefangenen zu erhaschen, den Bataillonen von Soldaten, die ihn bewachten, dem Stab von Beamten, die seine Gefangenschaft verwalteten: Jedem Einzelnen fiel es auf seine Weise schwer, in Napoleon zu sehen, was er damals war, und nicht, was er einst gewesen war oder gewiss wieder sein würde, sollte ihm je die Flucht gelingen. Selbst als er schon tot war, steif und kalt in seiner Uniform, näherten sich ihm die Menschen, die geduldig vor dem Leichnam Schlange standen, um ihn anzustarren, mit äußerster Vorsicht – als könnte er jeden Augenblick wieder auf die Beine springen.
In der Zwischenzeit aber saß, sechs lange Jahre, ein übergewichtiger Mann mittleren Alters in einem baufälligen Haus, umzingelt von der Hitze, dem Regen und dem Wind, von Ratten, von Soldaten und von Vertretern der Regierung, und er tat, was er konnte, um in der gleichförmigen Langeweile seiner Existenz von einem Tag in den nächsten zu gleiten. Er konnte ganze Vormittage lang zusehen, wie die Wolken über die ferne Bergkette hinter seinem Haus wanderten; er konnte eine Blume knicken und ihre prächtigen Farben betrachten, bis die Menschen um ihn unsicher und unruhig wurden, oder stundenlang in seinem Bad liegen: Wenn man sein Bad besichtigt, so hat man mir erzählt, könne man sehen, wie seine Hand die flache Schale abgegriffen hat, die einst die Seife hielt.
Was mich hier beschäftigt, sind die Geschichten und Mythen, Kuriositäten und Tatsachen, die sich um Napoleon ansammelten, während er auf St. Helena lebte, und weiterwucherten, nachdem er schon längst gestorben und an einem unauffälligen Ort in einem kleinen Tal begraben worden war, das von da an »Tal des Grabes« hieß. Im Hintergrund ist dabei immer die Insel selbst gegenwärtig, die ferne, steil abfallende Bühne, auf der dieses besondere Drama zur Aufführung kam; ein Ort, von dem es heißt, er sei so abgeschieden wie kein anderer auf dieser Welt.
Als sich Napoleon zum ersten Mal mit der Insel St. Helena konfrontiert sah, schockierten ihn ihre Stille und Trostlosigkeit; aus der Entfernung glich sie einer Festung aus massivem Fels. Sein erster Eindruck ist in all den Jahren nie korrigiert, nie gemildert worden; immer mehr hasste er diese Insel, die sich in ihrer unerbittlichen Gleichgültigkeit über ihn lustig zu machen schien und die doch auf gewisse Weise mit ihm litt. Man hat mir gesagt, St. Helena habe sich kaum verändert seit der Zeit, als Napoleon es wegen seines kargen Bodens und der plötzlichen Nebel verfluchte. Jeder, der einmal dort war, bestätigt, dass es immer noch wirkt wie abgeschnitten vom Rest der Welt; ein Land wie eine winzige Felsspitze, umgeben von einem Ozean, der nirgends aufzuhören scheint; ein Ort, eingeschlossen in sich selbst, vollkommen beschäftigt mit den Erinnerungen an alles, was er erlebt und gesehen hat. Und da Napoleon ihre schonungslos lastende Gegenwart so heftig empfand, ist die Insel nicht weniger Teil dieser Geschichte als der Mann selbst.
2
Von dort, wo wir ritten, im Nordwesten, sieht man eine Küste, so zerklüftet, steil, steinig, hoch, schroff, felsig, kahl, verlassen und trostlos, wie es wohl keine zweite gibt. Weiter oben jedoch ist der Boden von ausgezeichneter Beschaffenheit.
The Voyage of Peter Mundy
St. Helena ist weiter entfernt von allem als jeder andere Fleck der Erde, ein Pünktchen im Südatlantik, etwas unterhalb des Äquators, 3562 Kilometer von der Küste Brasiliens und 1863 Kilometer von Porto Alexandre an der Küste Angolas entfernt. Selbst von seinem nächsten Nachbarn, der blassgrau spröden Insel Ascension, trennen es rund tausend Kilometer tiefen Ozeans.
Noch war ich nicht auf St. Helena, aber ich habe eine Passage auf dem Schiff gebucht, das sechsmal im Jahr dorthin fährt. Seit einigen Monaten trage ich nun schon all die einzelnen Teilchen zusammen, die beanspruchen, zum Puzzlebild dieses Fleckens Erde zu gehören, den ich noch nie gesehen habe. St. Helena wird mir langsam vertraut, wie ein Traum es wird, wenn man ihn im Wachzustand noch einmal vorüberziehen lässt, die einzelnen Szenen betrachtet, die sich vor dem geistigen Auge wie auf einer Leinwand wiederholen. Und wenn ich dort gewesen bin, werden es zwei Inseln sein, die Insel, die ich mir vorgestellt habe, und die Insel, die ich gesehen habe, und wenn sie auch einige Züge gemeinsam haben werden, so wird es doch andere geben, die sich nicht verknüpfen und nicht zur Deckung bringen lassen.
Die Schiffsreise von England nach St. Helena dauert sechzehn Tage. Nach einem kurzen Aufenthalt auf den Kanarischen Inseln geht es immer weiter südwärts, zwischen den Kontinenten Südamerika und Afrika hindurch, bis nach Ascension. Man hat mir erzählt, dass sich die Männer und Frauen auf dieser kahlen Insel niemals gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen; sie laufen auseinander wie Schafe, wenn ein Fremder auftaucht, und wenn es gar kein Entkommen gibt, schlagen sie die Augen nieder, drehen sich um und warten, bis die Zumutung vorüber ist. Man hat mir erzählt, dass es am einen Ende der Insel eine Ansammlung von Wellblechhütten und Hangars gibt, die der britischen Luftwaffe als Basis auf dem Weg zu und von den Falkland-Inseln dienen, und am anderen Ende eine Stadt, unter der ich mir ein Gewirr weiß getünchter, quadratischer niedriger Gebäude vorstelle, wie sie gut zu einem scheuen Volk passen könnten, aber vielleicht liege ich damit ganz falsch. Ich habe bisher nur zwei Fotografien von Ascension gesehen: Eine davon zeigt nichts als die dunkle Silhouette eines Körpers auf ruhigem Wasser und einen Wolkenfleck, hinter dem die Sonne hervorscheint, während die andere eine Gruppe von Grabsteinen im Stadtfriedhof ins Bild rückt, mit den Namen und Lebensdaten der Menschen, die hier im 18. Jahrhundert starben, in roh behauene Blöcke vulkanischen Gesteins gemeißelt; einen Grabstein ziert das Gesicht eines Engels, ein einfaches, verängstigtes Gesicht, die Züge dunkle Höhlen, eingegraben in die runde Scheibe des Kopfes, mit kleinen Flügeln, die da hervorwachsen, wo man normalerweise die Ohren erwarten würde.
Von Ascension werde ich drei Tage lang durch unbekannte Gewässer fahren, immer weiter nach Süden, und die Passatwinde werden mit all ihrer Wucht über den Körper des Schiffes fegen. Dann endlich werde ich sie sehen, die steilen Klippen von St. Helena, der Felsenfestung, mit den Wolken, die sich immer über den Bergen an der Ostseite ballen. Und wenn das Schiff sich dem Land nähert, werde ich die weißen Gebäude des Hafens von Jamestown sehen, eingezwängt in ein steiles Tal. Man hat mir gesagt, die hohe Landschaft hinter Jamestown werde mich an Nordwales erinnern, mit den Schafen im niederen Gras, zwischen grauen Steinhäusern und grauen Steinblöcken, die sich von den kahlen Bergkämmen gelöst haben. Um die grauen Häuser herum aber wachsen Zitronen- und Mangobäume und Geraniensträucher, so hoch wie Bäume, mit zwitschernden Sittichen in ihren Zweigen, und tellergroße Spinnen gibt es dort und das erbarmungslose Quaken der kleinen grünen Frösche überall, wo Wasser aus dem Boden quillt. Ich werde im Sommer hinreisen, dann ist dort Winter, es wird also feucht sein, aber nicht kalt, außer auf Deadwood Plain, wo Napoleons Haus steht. Die Menschen auf der Insel sprechen mit einem weichen, musikalischen Akzent, sodass sie wie Jamaikaner klingen, die lange Zeit in Cornwall oder einer anderen südenglischen Grafschaft gelebt haben.
St. Helena ist nur gut fünfzehn Kilometer lang und neun Kilometer breit, aber es sieht viel größer aus, weil es so zerklüftet und gebirgig ist. Die Insel entstand vor rund sechzig Millionen Jahren, gegen Ende des Tertiärs, der Zeit, als die Kontinente der Welt auseinanderbrachen und die Erdkruste sich faltete und aufwarf und schmelzflüssiges Felsgestein aus ihrem Innern erbrach. Mein kleiner Sohn hat ein Buch, das diese Vorgänge auf einer großen farbigen Bildtafel veranschaulicht. Rechts stürzt eine riesige Flutwelle alle möglichen prähistorischen Ungeheuer in den sicheren Tod, links spuckt eine wellenförmig angeordnete Reihe von Vulkanen Feuer und Schwefel in die Luft. St. Helena ist Teil einer solchen Vulkankette, die sich von Tristan da Cunha im Süden über Ascension und die Kapverden bis zu den Kanarischen Inseln hinaufzieht. Wäre da nicht der Atlantische Ozean, die Berge sähen etwa aus wie die Anden in Südamerika; so aber ragen nur ihre Spitzen aus dem Wasser.
Die Küste von St. Helena ist außerordentlich steil. Aus der Entfernung sieht sie aus wie eine blankwandige Festung, wenn aber das Licht der Sonne auf die Felsen fällt und ihre Struktur und ihre Farben sichtbar macht, wirken sie wie ein welliger, faltiger Vorhang, purpurn und schwarz und rostbraun gesprenkelt. Der Rand des Vulkankraters hat einen halbkreisförmigen Kamm von Bergen gebildet, und die Erosion durch Regen und Süßwasserbäche hat tiefe enge Schluchten in die Flanken der Berge gefräst. Am Ende seiner Eruptionen hat der Vulkan Massen von weichen Basaltbrocken hochgeschleudert, die jetzt wie Zinnen und wacklige Türmchen aus der Landschaft wachsen und heute noch das einstige Bersten und Brodeln flüssiger Felsen erkennen lassen. Eine blassgraue Säule, die aussieht wie eine riesige verhüllte Figur, heißt »Lots Weib«, und etwas weiter denselben Bergkamm entlang erblickt man die kleinere der beiden Riesenfiguren, Lot selbst. Auch anderen eigenartigen Formationen hat man Namen gegeben – »Eselsohren«, »Türkenkappe«, »Kamin«, »Mönch« –, und im Osten ragt die »Scheune« über das Meer, jener Berg, der aussieht wie ein Gesicht im Profil, mit einem Zweispitz auf dem Kopf – das Ebenbild Napoleons, wie manche behaupten. In den Jahren seiner Gefangenschaft konnte der Kaiser, wenn er aus seinem Schlafzimmerfenster blickte, dieses mächtige Spiegelbild seiner selbst sehen, ein Scherenschnitt, mit dem Himmel als Hintergrund.
Lange Zeit, Millionen von Jahren, nehme ich an, war St. Helena nichts als eine nackte Felslandschaft. Aufgrund ihrer isolierten Lage konnten nur gewisse Arten auf die Insel gelangen und dort Fuß fassen. Die Samen mancher Pflanzen und Bäume wurden vielleicht auf den Wellen herbeigetragen, oder sicher geborgen in einem Stück Ast, und blieben dann irgendwo an der Küste liegen, während für die kleinsten Samen die Klauen der Seevögel das Transportmittel sein konnten. Auch die Eier gewisser Insekten, Landschnecken und Spinnen konnten mit etwas Glück die lange und ungewisse Reise über den Atlantik schaffen. So wurde St. Helena allmählich von bestimmten Pflanzen und verschiedenen unscheinbaren wirbellosen Geschöpfen kolonisiert. Die Insel wird so ununterbrochen von Wind geschüttelt und von Regen begossen, dass sie keine extremen Temperaturen kennt; warme feuchte Winter folgen auf warme feuchte Sommer und schaffen die ideale Atmosphäre für Grünzeug aller Art. Die Samen, die irgendwo ein Plätzchen zum Anwurzeln fanden, gediehen deshalb trotz steiler Felsen und Mangel an gutem Boden vorzüglich und verwandelten St. Helena bald in einen einzigen Wald. Bäume krallten ihre Wurzeln fest in die steilsten Felsspalten, selbst mitten ins glatte Gesicht der Felsen, die schroff aus dem Meer ragen, und eroberten auch noch die höchsten Bergspitzen. Die verschiedensten milchsafthaltigen Holzpflanzen gab es da, Redwood oder Küstenmammutbäume und Zwergbäume, männliche und weibliche Kohlpalmen, Baumfarne, diverse Araliengewächse und viele andere, die nie eine lateinische Bezeichnung oder botanische Beschreibung bekamen. Die prächtigsten unter all diesen Bäumen waren die Koromandel-Ebenhölzer mit dem schwarzen Kern, die so langsam wachsen wie Eichen und ihre sperrigen störrischen Äste ausstrecken, als seien sie riesige Kandelaber. Gräser gab es keine, doch auf den kleinen Lichtungen zwischen den Bäumen wuchsen blühende Sträucher und Büsche, dickblättriger gelber Meerfenchel entlang der Klippen, wilder Sellerie und Brunnenkresse in der Nähe der kleinen Bäche und Quellen.
Von den Pflanzen und Bäumen nährten sich mindestens einhundertneunundzwanzig verschiedene Käferarten. Bis auf eine gab es sie ausschließlich auf dieser Insel, die meisten waren kleine, mattfarbene Mitglieder der Rüsselkäfer-Familie, ausgerüstet mit den langen harten Nasen, die sie brauchen, um unter den Rinden der Bäume ihre Gänge und Brutstätten ins Holz zu bohren. Es gab auch zehn verschiedene Arten von Spinnen, die ihrerseits von Käfern lebten, und eine ganze Reihe großer Landschnecken, die sich von Blättern und Halmen ernährten. In einer bestimmten Phase der Frühgeschichte dieser Insel war dort eine einzige Vogelart heimisch, die sogenannten Helenenregenpfeifer, kleine, nervöse, unscheinbare, isabellfarbene Geschöpfe, die auf Englisch wirebirds heißen, wegen ihrer langen dürren Beine.
Abgesehen von dieser Vogelart und den Kolonien von Käfern, Schnecken und Spinnen, war die Insel unbewohnt; eine grüne Stille, unwegsam, beinahe geräuschlos, beinahe bewegungslos. An ihren steilen Klippen jedoch herrschte meist reges Treiben. Robben und die plumpen pflanzenfressenden Seekühe ruhten sich gern auf den Felsbrocken aus, die vom Südrand des Vulkankraters übrig geblieben waren. Das Wasser war hier flach und reich an Fischen aller Art: Meeraale tummelten sich da, Soldatenfische, Drückerfische, Ochsenaugen und der seltene Köhlerfisch. Schildkröten kamen, um in der sandigen kleinen Bucht, die jetzt der Hafen von Jamestown ist, ihre Eier abzulegen. Tausende von Seevögeln nisteten in den Klippen, und Shore Island, ein Felsen vor der Küste, war so dicht bedeckt von ihren weißen Exkrementen, dass man ihn leicht für ein Schiff mit geblähten Segeln halten konnte.
Bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts wusste niemand von der Existenz dieser kleinen grünen Insel. Doch St. Helena liegt genau in der Schneise der südöstlichen Passatwinde, und folglich mussten die ersten Seefahrer, sobald sie einmal das Kap der Guten Hoffnung umschifft und Zugang zum Südatlantik gefunden hatten, früher oder später auf die Insel stoßen. Die Portugiesen waren die Ersten. Admiral da Nova, der drei Kriegsschiffe kommandierte, befand sich gerade auf der Rückkehr von Indien nach Portugal, als er am 21. Mai 1502 einen einsamen dunklen Landbuckel mitten im Ozean sichtete. Der Tag der Entdeckung war der Geburtstag Helenas, der Mutter Kaiser Konstantins des Großen, und so kam die Insel zu ihrem Namen.
Da Nova umkreiste das Eiland, bis er eine Stelle fand, wohl die einzig mögliche, an der er vor Anker und an Land gehen konnte, ohne erst über die Klippen klettern zu müssen. Er und seine Leute verbrachten einige Tage auf der Insel. Sie erforschten das dichte Grün der großen Wälder und holten sich frisches Wasser aus den vielen Quellen. Sie fingen eine Menge Fische, die hochschnellten, um nach dem glitzernden Köder zu schnappen – einem gebogenen Nagel an einem Stück Bindfaden. Sie kosteten von dem wenig schmackhaften Fleisch der Seevögel, die in dichten Schwärmen herumsaßen und zusahen, wie die Seeleute mit Stöcken auf sie losgingen: Sie machten nicht einmal den Versuch wegzufliegen, weil sie gar nicht begriffen, in welcher Gefahr sie schwebten.
Bevor sie ihre Reise wieder aufnahmen, befahl da Nova seinen Männern, ein paar Ziegen auszusetzen, wie es damals der Brauch war, damit alle möglicherweise Nachkommenden sich mit frischem Fleisch versorgen konnten. Die Ziegen fanden auf St. Helena reichlich Nahrung und keine natürlichen Feinde, sie vermehrten sich also rasch und wurden fett und groß. Als Kapitän Cavendish dreißig Jahre später auf die Insel kam, hatte er nie zuvor so große Ziegen gesehen, und da er annahm, es handle sich um eine besondere, nur hier ansässige Rasse, nannte er sie caprus Hellenicus. Er hat die Nachkommen von da Novas kleiner Herde beschrieben:
… man sieht immer hundert oder zweihundert davon beisammen, und manchmal laufen sie mehr als eine Meile weit in der Herde. Manche von ihnen sind so groß wie ein Esel, mit einer Mähne wie ein Pferd und einem Bart, der bis zum Boden hinunterhängt. Sie klettern die Klippen hinauf, die so steil sind, dass man kaum seinen Augen traut.
Wir fingen und töteten viele von ihnen, trotz ihrer Behändigkeit, denn es gibt Tausende davon in den Bergen.
(Zitiert bei Gosse, S. 18)
3
Sei nicht in Angst! Die Insel ist voll Lärm,Voll Tön’ und süßer Lieder, die ergötzen,Und niemand Schaden antun.
Shakespeare, Der Sturm
Es gibt Orte, an denen man die Gegenwart der Menschen spürt, denen sie vor langer Zeit vertraut gewesen sind, der Menschen, die dort auf die Steine zu ihren Füßen gestarrt haben, auf die Blätter an den Bäumen und hinaus in die Ferne, auf den Horizont, über den sie nicht hinauskonnten. St. Helena, irgendetwas an seiner Abgeschiedenheit, vermittelt einem dieses Gefühl besonders stark – das Gefühl, dass in diesem Land die Geister wohnen, dass es durch und durch erfüllt ist vom Leben der Menschen, die einst hier waren und nun schon lange tot sind. Es ist, als erzeuge die Einsamkeit dieser Insel ein Gefühl der Verwandtschaft mit allen, die je auf dieser kleinen Plattform standen, mit ihr in der Schwebe, am Band der Welt.
Man hat mir erzählt, dass die Kinder auf St. Helena bei der Frage, wen sie für die wichtigste Persönlichkeit in der Geschichte ihrer Insel halten, nie an Napoleon denken – der den Historikern gehört und neugierigen Fremden –, sondern immer gleich an die Geschichte eines portugiesischen Adeligen namens Fernando Lopez. Er steht ihnen von allen, die in dieses Land eingebettet sind, am lebendigsten vor Augen. Napoleon hat man bestimmt auch von Lopez erzählt; er hat ja den Sklaven und den Kindern immer gern zugehört, Menschen, die keine Rolle in der Öffentlichkeit spielten und die nicht das Gefühl hatten, sie müssten sich vor ihm in Acht nehmen; die einfach kamen, sich zu ihm setzten und auf seine Fragen Antwort gaben. Auf diese Weise mag er alles erfahren haben, was es über diesen seltsamen Verbannten zu wissen gab, jenen ersten Bewohner der Insel, der wohl so einsam und verlassen war wie der Ort, an dem er lebte. Und wer weiß, vielleicht haben in späteren Zeiten – die beiden Männer hatten ja einiges gemeinsam – ihre Geister zusammengesessen und Gedanken über das Leben ausgetauscht, das sie einst auf der Insel führten.
Auch nach seiner Entdeckung im Jahr 1502 blieb das Eiland noch einige Jahre unbewohnt. Die Helenenregenpfeifer, die Schnecken und Insekten setzten ihre ruhigen Existenzen fort, und die Ziegen breiteten sich in ihrem neuen Territorium aus. Vielleicht machten die Portugiesen auf ihrem langen Weg zurück vom indischen Subkontinent gelegentlich hier halt, um die Wasser- und Lebensmittelvorräte aufzufüllen, aber es schien ihnen offensichtlich nicht der Mühe wert, diesen Umstand in einem der Berichte zu erwähnen, die sich bis heute erhalten haben; und außer ihnen wusste niemand, dass die Insel überhaupt existierte.
Fernando Lopez kam 1515 hier an. Er hatte ein Verbrechen begangen, deshalb fehlten ihm jetzt die rechte Hand, der linke Daumen, die Nase und die Ohren; auch die Haare – Kopfhaare, Barthaare, Augenbrauen – hatte man ihm ausgerissen, eine Praxis, die als »Abschuppen« bekannt war. Einem anderen Bericht zufolge hatte man ihm nicht nur den Daumen, sondern auch alle Finger der linken Hand abgehackt.
Lopez verbrachte dreißig Jahre auf der Insel, die meisten davon vollkommen allein; jahrelang hat er mit niemandem gesprochen und wurde von niemandem gesehen, lief davon und versteckte sich im dichten Grün des Waldes, sobald sich ein Schiff der Insel näherte. Einmal kam er kurz nach Portugal, hatte aber sehr schnell nur noch den Wunsch, man möge ihm erlauben, in seine einsame Heimat zurückzukehren.
Die Geschichte des Mannes mit dem grotesk entstellten Gesicht und den verstümmelten Händen kennen wir aus den Berichten dreier früher Chronisten der portugiesischen Geschichte. Einer von ihnen sah ihn selbst auf der Insel, allerdings, wie es scheint, nur aus der Entfernung; mit Lopez zu sprechen, ist ihm nie gelungen. Die beiden anderen schrieben kurz nach seinem Tod über ihn. Ihre Berichte sind einfach, ohne Kommentar, emotionslos, aber schon der Gedanke daran, wie dieser Mann ausgesehen haben muss, lässt ihn als komplexe Persönlichkeit erscheinen, und man kann sich leicht vorstellen, wie die letzten Jahre seines Lebens im Herzen der Insel versickerten und sich mit ihr vermischten, bis der Mensch und seine Umgebung nicht mehr voneinander zu unterscheiden waren.
Lopez war ein portugiesischer Adeliger; er verließ einst Heimat und Familie und zog mit einem Trupp Soldaten unter der Führung von General D’Alboquerque aus, um neue Länder zu entdecken und für die portugiesische Krone zu erobern. Im Jahre 1510 überquerten sie von Arabien aus den Indischen Ozean und landeten in Goa, an der Südwestküste Indiens. Nach kurzem Kampf nahmen sie die alte Festungsstadt ein und erklärten das Land, auf dem sie standen, mitsamt dem Kontinent dahinter zu ihrem Eigentum. Da sie militärisch aber nicht stark genug waren, ihren Gebietsansprüchen den nötigen Nachdruck zu verleihen, machte sich D’Alboquerque auf den Weg zurück nach Portugal, um Verstärkung zu holen, während Lopez und einige Männer mit dem Auftrag vor Ort blieben, die Festung zu halten, bis der General zurückkehren würde. Zwei Jahre lang war D’Alboquerque unterwegs, doch als er schließlich mit großer Verstärkung ankam, musste er entdecken, dass die Männer ihn verraten, den moslemischen Glauben und die Landessitten angenommen hatten. Die Abtrünnigen wurden zusammengetrieben und vor den General gebracht, sie leisteten keinen Widerstand. Da er Nachsicht versprochen hatte, wurden sie nicht getötet; dennoch starb mehr als die Hälfte der Männer während der drei Tage, an denen »schwarze Folterknechte und junge Männer« die Körperstrafen vollzogen. Lopez wurde am schwersten bestraft, denn er war adeliger Herkunft und daher für die ganze Gruppe verantwortlich. Nachdem alles vorüber war, befreite man ihn und die anderen Überlebenden von den Stricken und Ketten, und sie konnten gehen, wohin sie wollten. Alle versteckten sich irgendwo auf dem Land, um ihre grauenhaften Verletzungen und ihre Schmach vor den Augen der Menschen zu verbergen.
Drei Jahre später starb D’Alboquerque; Lopez tauchte aus seinem Versteck auf und nahm ein Schiff nach Portugal. Er hatte vor, zu seiner Frau und seinen Kindern zurückzukehren, die er so lange nicht gesehen hatte, zu seinem Haus, seinem Volk, seiner Muttersprache, zurück in seine Heimat. Nach vielen Tagen auf See legte das Schiff vor St. Helena an, um die Wasservorräte aufzufüllen, und bei dieser Gelegenheit wurde ihm klar, dass er seine Reise nicht zu Ende bringen konnte. Er ging an Land und versteckte sich tief im Wald. Als das Schiff bereit war zur Weiterfahrt, suchte ihn die Besatzung, konnte ihn aber nicht finden; sie ließen also ein paar Vorräte zurück und setzten die Reise ohne ihn fort.
Lopez grub sich ein Loch in die Erde, um darin zu schlafen. Man hatte ihn mit einem Fass Schiffszwieback versorgt, mit ein paar Streifen Dörrfleisch, einer Zunderbüchse und einer Pfanne. Essbare Kräuter und Früchte konnte er überall finden, und es kann nicht schwer für ihn gewesen sein, Fische zu fangen oder nistende Vögel oder sogar eine von den Ziegen. Die Insel meinte es gut mit ihm; es gab keine wilden Tiere, die ihn bedroht, keine Insekten oder Reptilien, die ihn gebissen, keine Krankheiten, die ihn entkräftet hätten. Trotz Wind und Regen war das Wetter immer mild und die Bäume dicht bewachsen mit schützenden Blättern. Ein ganzes Jahr verging, ehe wieder ein Schiff auftauchte und in der Bucht vor Anker ging, die jetzt der Hafen von Jamestown ist.
Die Besatzung wunderte sich, als sie die Grotte erblickte und das Strohbett, auf dem er schlief […], und als sie die Kleider sahen, kamen sie überein, dass es sich um einen Portugiesen handeln müsse.
Sie luden also ihr Wasser ein und berührten nichts, ließen aber Zwieback zurück und Käse und andere Nahrungsmittel sowie einen Brief, in dem stand, er solle sich das nächste Mal nicht verstecken, wenn ein Schiff käme, niemand würde ihm etwas zuleide tun.
Dann legte das Schiff ab, und als es in See stach, fiel ein junger Gockel über Bord, und die Wellen trugen ihn an Land, und Fernando Lopez fing ihn ein und fütterte ihn mit dem Reis, den sie für ihn zurückgelassen hatten.
(Hakluyt Society, No. 62)
Der Hahn war das erste Lebewesen, mit dem der Mann seine Einsamkeit teilen konnte. Nachts schlief er auf einer Stange über seinem Kopf, tagsüber trippelte er hinter ihm her und kam, wenn er nach ihm rief. Die Zeit verging, und Lopez lernte, weniger Angst zu haben; allmählich wagte er es, sich zu zeigen, wenn ein Schiff vor Anker ging, näherte sich den Menschen, die an Land kamen, und sprach mit ihnen. Lopez hat wohl in allen, die ihn je zu Gesicht bekamen, eine Mischung aus Furcht und Mitleid erregt, und da er sich weigerte, seine Insel zu verlassen, behandelten ihn die Seeleute, als sei er eine Art Heiliger, einer, der auf seinen Schultern ein übergroßes Bündel menschlichen Leids und menschlicher Entfremdung trägt. Und da sie ihn nicht mitnehmen und ihm die Freiheit ihrer Lebensweise geben konnten, machten sie ihm Geschenke; sie überhäuften ihn förmlich mit allem, was sie finden konnten und wovon sie annahmen, es könnte ihm Freude machen. Sie gaben ihm Gemüsesamen und Blumensamen; sie gaben ihm Palmensetzlinge und Bananenstauden, Granatäpfel und Zitronen, Orangen und Limonen. Auch einige Lebewesen ließen sie für ihn zurück: Enten und Hühner, Fasane und Rebhühner, die Perlhühner mit ihrem schrillen Warnruf und die Pfauen mit ihrem unwirschen Geschrei, Truthähne, Ochsen und Kühe, Schweine, Hunde, Katzen, noch mehr Ziegen und, unabsichtlich, eine ganze Menge Ratten, die an Land liefen, wenn niemand achtgab. So wurde Lopez also zum Gärtner und Viehzüchter. Mit seiner einen Hand arbeitete er entschlossen und unermüdlich, pflanzte und rodete, grub und hegte, bis sich unter seiner Obhut ganze Landstriche vollkommen verändert hatten. Zwischen den Ebenhölzern, den Sequoien und den Gummibaumgewächsen schuf er Gärten, Weinberge und Obsthaine. Dank Regen, Wind und fruchtbarer Erde gingen die Samen vieler Pflanzen auch in Gegenden der Insel auf, wo er sie gar nicht pflegte, und da es unmöglich war, so viele Vögel und andere Tiere in Gefangenschaft zu halten, lernten sie, frei durch die steile grüne Landschaft zu streifen.
Und so kam es, dass sich die Insel St. Helena in den Köpfen der Menschen mit der Vorstellung eines fruchtbaren Gartens auf einem Felsen in einem weit entfernten Ozean verband, einem Ort von natürlicher und zugleich unnatürlicher Vollkommenheit, fruchtbar das ganze Jahr über, kultiviert und dennoch wild, von Menschen ungestört. Kein Wunder also, dass jeder, der einmal hier gewesen war, von dem Ort erzählte, den er gesehen hatte, und von dem Mann, der dort herrschte wie ein König ohne Untertanen. Irgendwann kam die Geschichte auch dem König und der Königin von Portugal zu Ohren, und sie zitierten Lopez in den königlichen Palast zu Lissabon. Er kam, ungern, aber gehorsam, und als er sich wünschen durfte, was immer er wolle, bat er lediglich, man möge ihn zum Papst nach Rom bringen, damit er seine Sünden beichten könne, und um die Erlaubnis, danach auf die Insel zurückzukehren, von der er gekommen war. Nach diesem kurzen Intermezzo in der Welt der Menschen befielen Lopez wieder die alten Ängste, und wieder blieb er in seinem Versteck im Wald, sobald er ein Schiff nahen sah. Erst als man ihm im Namen des Königs versprochen hatte, dass man ihn kein zweites Mal von seiner Insel wegholen würde, war er bereit, sich blicken zu lassen.
Und Fernando Lopez war wieder beruhigt, sodass er sich nicht mehr versteckte, und er sprach mit denen, die hierherkamen, und gab ihnen, was die Insel im Überfluss schenkte. Und auf der Insel starb er, nachdem er dort eine lange Zeit gelebt hatte, im Jahr des Herrn 1546.
(Hakluyt Society, No. 62)
Diese außergewöhnliche Oase, die ein einzelner Mensch geschaffen hatte, blieb bis einige Jahre nach seinem Tod ziemlich unverändert. Portugiesische Seeleute und Soldaten, die zu krank waren, um ihre Reise fortzusetzen, ließ man oft hier zurück, damit sie sich erholten und Kraft schöpften. In der Nähe des Hafens errichtete man eine hölzerne Kapelle, auch ein paar einfache Häuser, aber nie hielt sich mehr als eine Handvoll Menschen zugleich hier auf; zu einer kontinuierlichen Besiedlung kam es nicht. Die Zitrushaine, die Dattelpalmen und Bananenstauden, die Ananas und Granatäpfel, alles wuchs und gedieh, vor allem in dem geschützten Tal, das sich steil vom Hafen hinaufzieht, und in einem Tal weiter östlich, das später Lemon Valley hieß. Die frei laufenden Haustiere, das Geflügel und die Ratten streiften auf der ganzen Insel umher, fraßen, was sie brauchten, und vermehrten sich. Es hieß damals, auf dieser Insel gebe es zu jeder beliebigen Jahreszeit genug frische Früchte, um den Laderaum von sechs Schiffen zu füllen, und wundersame Kräuter, die den Skorbut angeblich innerhalb von acht Tagen zu heilen vermochten. Und mit einem Stock in der Hand könne man jederzeit, ohne weit zu laufen und ohne große Anstrengung, irgendeinen schwerfälligen Vogel oder ein anderes großes, wohlgenährtes, bekanntes Tier erbeuten und so zu frischem Fleisch kommen.
Die uralten Wälder auf allen Seiten der Insel standen da als stumme Zeugen der Veränderungen, die im Lauf der Zeit herbeigeführt wurden. Die Schweine, Hunde, Ziegen, Katzen und Rinder zogen durch die Landschaft wie dicke Schwärme schwerer flügelloser Wanderheuschrecken, aber es dauerte geraume Zeit, bis die Folgen ihres Daseins spürbar wurden. Die Ziegen konnten die niedrigen Äste und die jungen Triebe der Bäume abfressen, aber der Rinde der alten Ebenhölzer, der Gummibäume und ihrer Verwandten konnten sie nichts anhaben. Mochten die Schweine auch die Wurzeln aus der fruchtbaren, aber nicht tief reichenden Erde graben: solange die Bäume stehen blieben, hatte der Boden festen Halt, und noch so viel Regen oder Wind konnten ihn nicht abtragen. Die Insel behielt also trotz der neu importierten Bewohner ihre fremdartige fruchtbare Schönheit, und auf ihrem Rücken schienen Alte und Neue Welt in Harmonie zu gedeihen.
Die Allgemeine Beschreibung Afrikas war das erste Buch, das eine gründliche und genaue Darstellung von St. Helena zu geben versuchte. Es erschien 1573, der Text scheint sich aber auf Berichte von Reisenden zu stützen, die in den Fünfzigerjahren des 16. Jahrhunderts auf der Insel waren. St. Helena wird darin als irdisches Paradies beschrieben, als ein Ort, an dem der Mensch Körper und Seele gleichermaßen laben könne, an dem das Klima gleichbleibend mild und Nahrung im Überfluss vorhanden sei; ein Ort, an dem es keine Krankheiten und kein einziges wildes Tier gebe, das dem Menschen etwas zuleide tun könnte. Als das Buch herauskam, hatte die Insel schon begonnen, ihr Gesicht zu verändern, war ihre milde Freigebigkeit bereits erschüttert. Riesige giftige Spinnen, so groß wie eine geballte Faust, waren von Afrika herübergekommen und ließen sich in den Bananenstauden nieder, auch eine Spezies von heuschreckengroßen Stechfliegen unbekannten Ursprungs hatte sich angesiedelt. Die Hunde-, Katzen- und Rattenkolonien bekämpften einander in wilden Schlachten: Die Ratten waren im Aufstieg und hatten begonnen, hoch in den Bäumen zu nisten, wo sie die Pfauen und andere Vögel aus der gewohnten Ruhe rissen.
1581 verlagerte sich der Kampf um Vorherrschaft und Macht aus dem tierischen in den menschlichen Bereich. Ein englischer Piratenkapitän namens James Fenton stieß zufällig auf St. Helena und beschloss, die Portugiesen zu verjagen, um die Insel selbst in Besitz zu nehmen und sich »dort zum König ausrufen zu lassen«. Aus diesem Plan wurde nichts, aber im Jahr darauf entdeckte ein anderer Engländer, Kapitän Cavendish, auf dem Heimweg von einer Reise um die Welt St. Helena. Er blieb zwölf Tage lang, erforschte die Insel, beschrieb sie, zeichnete eine Karte und ortete sie sehr genau in der Mitte des Atlantischen Ozeans. Damit war das Geheimnis gelüftet, und scharenweise kamen die Menschen aus aller Herren Länder, um das Land zu begutachten und um seinen Besitz zu kämpfen. Dabei entwickelten sie die Gewohnheit, Früchte zu ernten, indem sie zum Beispiel ganze Zitronenbäume umhieben und die Stämme mit den schwer beladenen Ästen an Bord nahmen, wenn sie die Insel wieder verließen. Manchmal rissen sie auch die Pflanzen in den wild wachsenden Gärten samt Wurzel aus und zertrampelten die Früchte, für die sie selbst keine Verwendung hatten: die einfachste Art, allen möglicherweise Nachkommenden jedes Recht darauf zu verwehren.
Um 1610 gab es nur noch wenige Zitronenbäume, und die waren schwer zu finden. Auf den Hügeln in Hafennähe gab es keine mehr, aber immerhin noch einen Hain in Lemon Valley, weiter die Küste entlang, der pro Ernte vierzehntausend Zitronen lieferte. Um 1634, so heißt es, waren auf der Insel weniger als vierzig Zitronenbäume übrig: zwanzig in Lemon Valley und der Rest verteilt über das ganze Land. Die einheimischen Bäume wuchsen allerdings an den meisten Stellen der Insel noch dicht, und es gab »Schweine im Überfluss, eine ganze Menge kleine gesprenkelte Perlhühner, Rebhühner und Tauben, auch Hunde und (streunende) Katzen, von denen die Kompanie eine beträchtliche Anzahl tötete« (Gosse, S. 29 f.).
Vielleicht, weil St. Helena so weit weg war und wenige es tatsächlich gesehen hatten, obwohl viele von der Existenz der Insel wussten, oder vielleicht, weil der Mensch nicht sehr viel Wirklichkeit verträgt und häufig seine Vorstellung von den Dingen dem vorzieht, was direkt vor seinen Augen liegt: was immer der Grund sein mag, die Beschreibungen St. Helenas veränderten sich jedenfalls kaum, trotz der Zeit, die verging, und trotz der Veränderungen, die sie mit sich brachte. So konnte zum Beispiel der Portable Geographer’s Gazetteer, ein Standardwerk, das in einer Reihe französischer und englischer Ausgaben verbreitet war, St. Helena gegen Ende des 18. Jahrhunderts – als die Insel beinahe nackt war, ihrer schützenden Erddecke entblößt, aller Pflanzen und Bäume beraubt, ausgenommen in Gärten und höheren Regionen – immer noch wie folgt beschreiben:
Die Hügel sind größtenteils von Grünpflanzen und großen Baumarten, wie Ebenholzgewächsen und Ähnlichen, bewachsen. Die Täler sind üppig und reich an hervorragenden Früchten, an Gemüse und Pflanzen aller Art. Die Obstbäume dort tragen zur selben Zeit Blüten, grüne Früchte und reife Früchte. Die Wälder sind voll von Orangenbäumen, Zitronenbäumen und anderen Zitrusgewächsen. Es gibt Jagdvögel in Fülle, ebenso Geflügel und frei laufende Rinder. Wilde oder gefährliche Tiere fehlen, und das Meer wimmelt von Fischen.
(Masson, S. 98)
Schon lange vor der weiten Reise, die Napoleon von Frankreich nach St. Helena führte, hatte ihn die Insel gelegentlich beschäftigt. Als junger Mann und Student der Militärakademie von Auxonne hatte er ein ganzes Heft mit Informationen über die Länder gefüllt, die damals unter britischer Herrschaft standen, und an den Kopf einer sonst leer gebliebenen Seite hatte er in seiner unruhigen Handschrift geschrieben: »St. Helena, eine kleine Insel«. 1804 machte er sich sogar Gedanken, wie diese kleine Insel zu erobern wäre, die als militärischer Stützpunkt in der Mitte des Südatlantiks so nützlich sein konnte: »1200 bis 1500 Mann wären erforderlich […] Die Engländer erwarten diese Expedition in keiner Weise, es wird also sehr einfach sein, sie zu überraschen.« (Masson, S. 97) Die Expedition fand nie statt, aber er hatte sich darauf vorbereitet, indem er so viel wie möglich über St. Helena herauszufinden versuchte. Mit Sicherheit hat er den Portable Geographer’s Gazetteer in der französischen Ausgabe gelesen, ebenso wie die anderen damals erhältlichen Landesbeschreibungen, die allesamt dieselben klangvollen Berichte über eine grüne Oase enthielten, wo die Früchte das ganze Jahr über reiften. So kam es, dass Napoleon sich dem Ort, der für den Rest seines Lebens sein Gefängnis sein sollte, bereits mit einer festen Vorstellung näherte.
4
»Die Zeit ist reif«, das Walross sprach,
»von mancherlei zu reden –
Von Schuhen – Schiffen – Siegellack,
Von Königen und Zibeben – «
Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln
Es ist Oktober, und wir schreiben das Jahr 1989. Der Himmel ist weiß, mit schmutzig grauen Wolkenfetzen. Ich komme gerade von einem Spaziergang über Wiesen und ein gepflügtes Feld zurück, auf dem überall Feuerstein und Kreide herumliegt. Man findet hier oft Fossilien, vor allem in einer Senke im Zentrum des Feldes, wo einst, nehme ich an, das Meer über einen tiefen Teich hinwegschwappte. Heute fand ich ein Stück von einem gelben glatten Stein mit beulenartigen Erhöhungen und Vertiefungen – Abdruck der Haut irgendeines Reptils, oder vielleicht eines Fisches, und auch einen schön gerundeten, unversehrten grauen Feuerstein mit dem stufenförmigen Abdruck von zwei kleinen Schwanzskeletten: das eine zusammengerollt, sodass es aussieht, als könnte es jeden Augenblick in eine andere Lage schnellen; das andere gerade ausgestreckt, irgendwie schlaff und weich, obwohl es Stein geworden ist.
Jenseits dieses Feldes liegt ein Gebiet, das einmal ein Eichenwald war; die meisten Bäume wurden vor einiger Zeit gefällt, an ihre Stelle ist eine spärlich bepflanzte Lichtung getreten, mit mickrigen Nadelbäumchen und noch jüngeren Setzlingen, die vorsichtig aus ihren Plastikschutzhüllen herausschauen. Gelegentlich findet sich eine vereinzelte ausgewachsene Weide oder Pappel: Man hatte es offenbar nicht der Mühe wert gefunden, sie zu beseitigen. Instand gehalten wird das Areal wegen der Fasane, die im harten Gras und dornigen Gestrüpp herumlaufen wie Flöhe in einem Hundefell. Als ich vorhin dort war, fand ich zwei Eichhörnchen und fünf Elstern, die mit blauen Plastikschnüren um den Hals an einem herabgefallenen Ast hingen. Der Grundeigentümer dachte vermutlich, sie würden seine Gewinne aus der gewerblichen Nutzung der Fasane bedrohen.
Es scheint so seltsam und ist doch so allgemein üblich, eine Landschaft ausschließlich mit Blick auf ihren möglichen Nutzen und Profit zu betrachten; die Augen über das zerbrechliche, ständig bewegte Weiß der Antarktis gleiten zu lassen und dabei nichts vor sich zu sehen als Rohrleitungen und Pumpen, mit deren Hilfe sich Öl aus dem Herzen des Steins saugen ließe; oder selbst aus der größten Stille immer schon den irgendwie beruhigenden Klang von Maschinen und menschlicher Arbeit herauszuhören. Ich erinnere mich an das Tagebuch eines frühen Siedlers in Nordamerika, das ich einmal gelesen habe; er erzählt darin, dass für ihn und andere Neuankömmlinge die Geräusche der großen Bäume, wenn sie, von Menschen gefällt, zu Boden stürzten, und der Geruch des Rauches, wenn die Wälder niedergebrannt wurden, um das Land zu roden, der Gegend etwas von ihrer Fremdheit und ihrem Schrecken nahmen.
So viel zu einigen Gedanken, die mich gerade nicht loslassen wollen. Die Vergangenheit führt in die Gegenwart, und so ist die Insel St. Helena Zeugin vieler Veränderungen und doch immer noch derselbe Ort, obwohl die Menschen, die nacheinander Anspruch auf sie erhoben, die Insel vielen Zwecken dienstbar machten, sie einmal so, dann wieder anders gestalteten, je nachdem, welchen Nutzen sie gerade aus ihr ziehen wollten. Wenn man heute auf die eigenartig nackte Landschaft blickt, sieht man, was sie verloren hat und wie sie einmal gewesen sein muss. Napoleon versuchte mühsam, einen Garten anzulegen, der ihm ein wenig Privatsphäre gewähren sollte – und ein bisschen Schatten in einer trostlosen Ebene, wo nichts wuchs; derselbe Ort, an dem sich Fernando Lopez einst in einem grünen Dickicht versteckte.