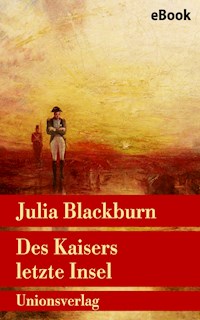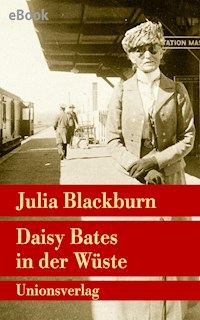
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In langem schwarzem Rock, Bluse, Krawatte und Hut sitzt Daisy Bates auf einem Stuhl in der Wüste. Sie sieht finster aus, Furcht einflößend, stolz, traurig, ernst, sehr schön und in jeder Hinsicht so gefährlich, wie eine Frau ihres Schlags nur sein konnte. Dreißig Jahre verbringt sie bei den Aborigines in der Wüste, schließt Freundschaft mit ihnen, taucht in ihre Traditionen ein. »Kabbarli« nennen sie sie, die Großmutter. Julia Blackburn sucht in Tagebüchern, Briefen und vergilbten Fotografien nach dem wahren Leben der Daisy Bates. Die Spuren erzählen von der roten Monotonie der Sandhügel, von einem blendend hellen Himmel und einer wütenden Sonne, die dunkle Flecken auf der Haut hinterlässt. Und von einer bemerkenswerten Frau, die alles zurücklässt, um einen neuen Weg zu begehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch
Auf dem vergilbten Foto in der Wüste sieht Daisy Bates Furcht einflößend aus, stolz, traurig, schön und so gefährlich, wie eine Frau ihres Schlags nur sein konnte. Dreißig Jahre verbringt sie bei den Aborigines, taucht in ihre Traditionen ein. »Kabbarli« nennen sie sie, die Großmutter. Julia Blackburn spürt diesem beeindruckenden Leben nach.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Julia Blackburn wurde 1948 in London geboren. Neben ihren Memoiren, die unter anderem auf der Shortlist des Ondaatje-Preises standen, hat sie Romane geschrieben, für die sie bereits zwei Mal den Orange-Prize und 2017 den New-Angle-Prize erhielt. Sie hat zwei Kinder und lebt in Suffolk und Italien.
Zur Webseite von Julia Blackburn.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Julia Blackburn
Daisy Bates in der Wüste
Aus dem Englischen von Isabella König
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1994 bei Secker & Warburg, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 im Berlin Verlag.
Originaltitel: Daisy Bates in the Desert
© by Julia Blackburn 1994
© der deutschen Übersetzung: Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2001
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Daisy Bates an einem Bahnhof, wahrscheinlich Südaustralien (State Library of South Australia)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31115-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 14:00h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DAISY BATES IN DER WÜSTE
Erster Teil1 – Es war einmal eine Frau, die lebte in …2 – Es war einmal eine Frau, die lebte in …3 – Zum ersten Mal hörte ich von Daisy Bates …4 – Wie ist sie dorthin gelangt? An welchem Punkt …5 – Ich kann mich sehr genau an meine Kindheit …6 – Eine ganze Menge Tatsachen aus ihrem Leben versuchte …7 – Ich habe beschlossen, ihre Kindheit mit einem Traum …8 – Sie verlässt Australien, und fünf Jahre später kehrt …9 – Was hatte sie erwartet, als sie nach so …10 – Daisy Bates ließ sich 1905 mit ihrem Zelt …11 – Ich habe mich einmal kurze Zeit bei Roma …Zweiter Teil12 – Ich bin Daisy Bates in der Wüste …13 – Ich habe gerade an Eucla gedacht, meinen Geist …14 – In Irland sah ich einmal einen Toten auf …15 – Es muss während meiner Zeit in Eucla gewesen …16 – Ich wünschte, ich besäße eine Fotografie von Fanny …17 – Ich habe die Metallkassetten durchgesehen, in denen ich …18 – Meine Blicke schweifen durch mein Zelt, immer im …19 – Letzte Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich lag …20 – Sie nennen die Dornteufel ming-ari, das heißt »voll …21 – Vor langer Zeit. Als ich noch ein Kind …22 – Der heutige Tag ist so heiß und lautlos …23 – Der Stationsvorsteher hat mir einen Stapel alter Protokollbücher …24 – Das Fieber bewirkte, dass ich mich alt fühlte …25 – Und dann kam Annie Lock nach Ooldea …26 – Ich erschien 1934 auf der Neujahrs-Ehrenliste, das britische …Dritter Teil27 — Mrs Bates im Radio28 — Mrs Bates und die Tomaten29 — Mrs Bates und der Polizist30 — Mrs Bates und die süßen Orangen31 — Mrs Bates läuft weg32 — Mrs Bates und das Inselschiff33 — Mrs Bates in OoldeaBibliografische HinweiseDanksagungAbbildungsverzeichnis
Mehr über dieses Buch
Über Julia Blackburn
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Julia Blackburn
Zum Thema Aborigines
Zum Thema Australien
Zum Thema Biografie
Zum Thema Frau
Zum Thema England
Zum Thema Wüste
Zum Thema Geschichte
In Erinnerung an meinen Vater,Thomas Blackburn, 1916–1977
Daisy Bates beim Seilspringen in Adelaide im Alter von 89 Jahren. Foto Douglass Glass.
Erster Teil
1
Es war einmal eine Frau, die lebte in der Wüste. Es hatte lange Zeit nicht geregnet, und ihre Augen waren müde von der blendenden Helligkeit des Himmels über ihr, von der roten Monotonie der Sandhügel, die sie umgaben wie ein endloser Ozean. Sie sehnte sich nach Grün, also nahm sie einen Kohlstrunk und lehnte ihn gegen den glatten Stamm einer Akazie, die nahe bei ihrem Zelt stand. Dann saß sie da, den Blick starr auf den Strunk gerichtet, während ihre Gedanken durch die Blitze des Tages wanderten.
Ich frage mich, wie lange dieser Kohlkopf seine Farbe halten konnte und ob die Frau lachen musste, als sie ihn plötzlich wieder bewusst wahrnahm, wahrnahm, dass er immer noch da stand, ein Beschützer, der Wache hielt, nachdem alle anderen längst nach Hause gegangen waren. Oder war ihr gar nicht zum Lachen, als sie so im Eingang ihres Zeltes saß und hinausstarrte, wie hypnotisiert von einem Stückchen Grün?
Sie blickt hinunter auf die sanft pulsierende Haut der Eidechse, die sich nachmittags manchmal auf ihrem Schoß sonnt und ab und an nach einer Fliege schnappt. Sie stellt sich das Geräusch vor, das der Regen machen würde, wenn er endlich käme, wie von tausend Fliegenbeinen, die über ihr Zelt trappeln. Der Regen wird durch den metallfarbenen Schaum dringen, der sich über dem letzten Rest Wasser im Tank gebildet hat. Der Regen wird die Vögel mit ihrem glänzenden Gefieder wiederbringen; er wird der Wüste wieder Leben einhauchen, und sie wird dann wieder zusehen, wie Gruppen nackter Menschen sich auf ihr Lager zubewegen. Sie blickt an sich hinunter auf den Stoff ihres langen Rockes, dessen ursprüngliches Tiefschwarz sich mit der Zeit in ein seltsames Gemisch matter, dunkler Grüntöne verwandelt hat. Sie sieht sich als Kind in Irland durch Felder von hohem Gras laufen; sieht sich als junge Frau, deren Blick einer Küstenlinie in die Ferne folgt; sieht sich als alte Frau, hier, in der Wüste.
2
Es war einmal eine Frau, die lebte in der Wüste, und ihr Name war Daisy Bates. Ich habe eine Reihe von Fotografien dieser Frau auf dem Tisch vor mir ausgelegt, wie Spielkarten vor einer Partie Patience. Ich betrachte die Bewegung von der Jugend zum Alter, einem außergewöhnlich hohen Alter, und trotz der wechselnden Masken der Zeit erkenne ich mühelos immer wieder dasselbe herausfordernde Gesicht, denselben kerzengeraden Körper.
Ein Ohrring hängt am kleinen rechten Ohrläppchen der jungen Frau, die mit blassen Augen seitwärts in die Ferne blickt. Wie alt mag sie sein, zwanzig vielleicht? In diesem Fall hat sie noch einundsiebzig Jahre ihres Lebens vor sich, all die Kämpfe, all das Anrennen gegen verschlossene Türen und die Macht der Umstände. Ich versuche von ihrem Gesicht abzulesen, ob sie so wohlhabend ist, wie sie es später behauptete, oder so arm, wie sie mit einiger Wahrscheinlichkeit gewesen sein könnte. Daisy Bates war eine Lügnerin, wenigstens da bin ich mir sicher; aber das Ausmaß und die genauen Einzelheiten ihrer Lügen bleiben unwegsames Gelände, für das es keine verlässlichen Karten mehr gibt.
Ich mache einen Zeitsprung, und das Subjekt meiner Nachforschungen ist nun mittleren Alters, steht, wie ich jetzt, an jenem Scheitelpunkt im Leben, wo sich Vergangenheit und Zukunft gerade noch die Waage halten. Ihre Hände, in weißen Handschuhen, hat sie im Schoß übereinandergelegt.; sie trägt einen schwarzen Rock, eine weiße Bluse mit hohem Kragen, eine schwarze Krawatte, einen schwarzen Turban von einem Hut, der aussieht, als eigne er sich auch gut als Teekannenwärmer, und eine schreckliche Brille mit runden dunklen Gläsern, die sie finster aussehen lässt, Furcht einflößend, stolz, gefährlich; in jeder Hinsicht so schwierig, wie eine Frau ihres Schlages nur sein konnte. Ich meine, durch das dunkel getönte Glas hindurch gerade noch ihre Augen zu erkennen, und wieder scheint sie ihren Blick von der Kamera fortzulenken, aber jetzt liegt etwas Hochmütiges in ihm; als möchte sie ihre Zeit nicht damit verschwenden, nach vorn zu sehen, wo es doch anderswo so viel wichtigere Dinge wahrzunehmen gilt.
Die nächste Aufnahme, die ich ausgewählt habe, könnte irgendwo auf der Nullarbor Plain entstanden sein, jener baumlosen Ebene im Süden Australiens. Man sieht, wie sich um sie herum das Land erstreckt, eine riesige konturenlose Fläche, die sich ohne die geringste Abwechslung, einen kleinen Busch etwa oder eine kleine Erhebung, in der Unendlichkeit verliert. Daisy Bates sitzt auf einem Stuhl, inmitten dieser Ausdehnung, ihr Rücken so steif und gerade wie immer, und ich kann nirgends ihr Zeh entdecken. Neben ihr auf der Erde steht eine kleine Teekiste und ein wenig weiter weg, links von ihr, ein großer, nicht identifizierbarer Gegenstand unter einem Leintuch; sie ist vielleicht gerade dabei, ihr Lager zu verlegen – dann wären diese Dinge ein Teil ihrer Habe, verpackt und bereit zum Aufbruch. Sie trägt eine elegante, schwarz und weiß gestreifte Jacke, nicht zugeknöpft, und einen weichen Hut von unbestimmter Form tief über den Kopf gezogen – sie sieht traurig aus und ernst, aber sehr schön. In ihrem Schoß hat sie ein weißes Tuch ausgebreitet, darauf liegt ein menschlicher Schädel ohne Unterkiefer. Möglicherweise wurde das Foto gemacht, um zu illustrieren, dass ihrer Ansicht nach die Aborigines eine vom Untergang bedrohte Rasse seien, dass diese Menschen bald alle tot und vom Erdboden verschwunden sein würden, ohne dass dies irgendjemanden außer Daisy Bates kümmern würde, ohne dass irgendjemand außer Daisy Bates Zeugnis ablegen würde von ihrem Leben und ihrem Sterben; aber auch das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen; es könnte sich ebenso gut um den Schädel eines weißen Mannes oder einer weißen Frau handeln.
Und hier schließlich Daisy Bates gegen Ende ihres Lebens, eine Frau in den hohen Achtzigern, die Haut am Hals schlaff, reptilartig; die Linien ihres Gesichts sind so tief gefurcht, dass ihr Kinn weit hinten an Scharnieren zu hängen scheint, wie bei einer Bauchrednerpuppe; aber auch die senkrechten Fältchen in ihren Wangen und die waagrechten, die ihre Stirn durchqueren, wären wohl für Hände zu spüren, die im Dunkeln behutsam nach ihnen tasteten. Der englische Gesellschaftsfotograf Douglas Glass hat die Aufnahme gemacht. Er hielt sich 1948 einige Tage in Adelaide auf, wo er auf das Schiff zurück nach England wartete, und er begann bei dieser Gelegenheit, sich nach Daisy Bates zu erkundigen. Er hatte ihr Buch The Passing of the Aborigines gelesen und muss damals wohl schon eine ganze Menge von ihr gehört haben, denn sie war inzwischen so etwas wie eine Legende geworden, vor allem in diesem Teil Südaustraliens. Alle, die er fragte, behaupteten, sie sei gestorben; vor einigen Jahren, in einem Krankenhaus; erst vor Kurzem, in Streaky Bay, nein, in Yuria Waters, weiter unten an der Küste. Es hieß, sie sei sehr traurig gewesen, geistig verwirrt, in die Irre geleitet, ein guter Mensch, tapfer, schlecht; die Eingeborenen hätten sie einfach verlassen – Bettler und Trinker und Syphilitiker –, nein, die Eingeborenen seien bei ihr geblieben, bis zum Ende, große Trauer. Endlich fand er ihre Spur. Sie lebte in einem kleinen Vorortbungalow gleich außerhalb von Adelaide, wo sich eine befreundete Dame um sie kümmerte, von der sie allerdings nicht viel zu halten schien. Der Besuch des Fotografen bereitete ihr ganz offensichtlich großes Vergnügen. Sie zog das Kostüm an, das sie 1905 in Perth hatte anfertigen lassen, ihr bestes, nahm ihren Schirm fest in die eine Hand, die Handtasche in die andere und setzte sich auf der Veranda für ein Foto in Pose: eine betagte Kaiserin auf ihrem Thron. Im Garten blühten Gänseblümchen. Sie pflückte ein paar daisies, hielt sie zwischen Finger und Daumen und blickte gedankenversunken auf die Blumen, denen sie ihren Vornamen verdankte. Dann ging sie in ihr kleines Zimmer, setzte sich, wobei die Sonne durch ihre weißen Haarsträhnen hindurchleuchtete, und gab sich den Anschein, als lese sie gerade mit dem Vergrößerungsglas in ihren Aufzeichnungen. Sie führte Mr Glass hinaus in den briefmarkengroßen Garten und zeigte ihm, dass sie immer noch imstande war, mit den Fingerspitzen ihre Zehen zu berühren, die Arme wirbeln zu lassen wie die Flügel einer Windmühle, und wie sie immer noch hüpfen konnte: auf, und hoch, und noch einmal. »Schauen Sie nur, Mr Glass, schauen Sie!« Mrs Bates, neunundachtzig Jahre alt, hüpfend in einem Feld von Gänseblümchen – oder doch wenigstens am Rand eines Blumenbeets, in dem ein paar Büschel Gänseblümchen blühen. Sie lacht: »Nun, Mr Glass. Die Aufnahmen müssen Sie an die Zeitungen schicken. Das wird den Leuten zeigen, dass ich noch keineswegs tot bin – und auch noch gar nicht daran denke, es gibt noch so viel zu tun.«
Ich stelle mir vor, Mrs Bates hat Mr Glass alles über ihr Leben erzählt, besonders über die Zeit, nachdem sie ihre Aufgabe in der Wüste gefunden hatte. Ihre Stimme war tief, weich und klar, auch noch im hohen Alter, und auch im hohen Alter noch nahm sie selbstverständlich an, dass jeder Mann, der ihr gefiel, nichts lieber tun würde, als sie in seine Arme zu schließen – wenn sie es nur zuließe. Ich stelle mir vor, wie sie stundenlang ohne Unterbrechung redete, der Monolog eines isolierten Menschen, der die Fäden seiner privaten Gedanken hier und da in Briefen und Gesprächen durchschimmern lässt, selbst in Gesprächen mit Fremden. Aber vielleicht ist sie jetzt viel zu alt, um so zu reden, und sitzt stattdessen auf der Veranda, trinkt Tee, lächelt und lässt es bei winzigen Schnipseln von Information bewenden, die in der Luft schweben wie Rauch.
Könnte ich den Text diktieren, könnte ich ihre Gedanken, so wie ich sie mir vorstelle, in die Sprache umsetzen, die dieser Vorstellung entspricht, dann würde sie das Gespräch etwa so begonnen haben: »Ich war einmal sehr schön, Mr Glass, aber nun bin ich stattdessen sehr alt, wie Sie sehen« – hier würde Sie eine kleine Pause machen, ihm Gelegenheit geben, sie anzusehen, sie anzulächeln mit der verständnisvollen Vertrautheit dessen, der nicht lange bleiben wird, ihn ermutigen, die Bürde des Alters von ihren Schultern zu streifen. Sie verschweigt ihm, dass sie sich immer noch jeden Morgen nackt vor den Spiegel stellt, dass ihr aus diesem Spiegel – ihre Augen sind trüb geworden vom ewigen Sand – wieder die rosige, zarte Erscheinung eines jugendlichen Körpers entgegenschimmert. Sie verschweigt es ihm, aber sie schaut in seine Augen, und einen flüchtigen Augenblick lang kann sie sich darin sehen, so, wie sie einmal war.
Eine alte Dame spricht mit einem jungen Mann, bestrebt, ihn zu bezaubern, ihn mit der komplexen Einzigartigkeit ihrer Geschichte zu beeindrucken, sodass er etwas davon mitnimmt, wenn er geht, ihr hilft, sich selbst zu überleben. So entsteht sie vor mir, indem sie spricht, und wenn sie gelegentlich vielleicht mehr sagt, als sie jemals in einem tatsächlichen Gespräch gesagt hätte – hätte sagen können –, so liegt es daran, dass ich ihr erlaube, ihren Gedanken so viel Ton zu geben wie ihrer Stimme.
»Ich habe beinahe dreißig Jahre lang in der Wüste gelebt«, sagt sie, »deshalb ist mein Gesicht so zerfurcht. Sehen Sie, die Sonne hat dunkle Flecken auf die Flaut meiner Hände, meines Gesichts, meines Halses gebrannt – trotz Handschuhen und Hüten mit langen Schleiern. Meine Augen sind so müde, Mr Glass, und manchmal frühmorgens habe ich beim Aufwachen das Gefühl, als öffnete ich meine Augen in einen Sturm von Hitze und Staub hinein.
In Eucla, an der Südküste mit den hohen steilen Klippen, war ich fünf Jahre lang. Es war nicht mein erstes Lager, aber der Ort, an dem ich zum ersten Mal fühlte, ich hatte die wenigen Fäden endgültig durchschnitten, die mich mit meiner eigenen Welt verbanden. Im Frühling konnte ich die Wale füreinander singen hören, mit ihren wunderbaren feierlichen Stimmen. Ihr Klang trägt weit und vermischt sich mit dem Rauschen der Wellen und dem saugenden Geräusch, das entsteht, wenn die Luft in den langen unterirdischen Tunneln im Kalkstein verschwindet; das Land dort ist überall hohl, eine Honigwabe unter den Füßen. Haben Sie wohl je den Gesang der Wale gehört, Mr Glass, oder gesehen, wie sie sich im Wasser hin und her werfen, männliche und weibliche Tiere im Tanz miteinander?
Danach habe ich sechzehn Jahre in Ooldea verbracht, viel weiter im Landesinneren, viel karger, aber auf seine Weise wunderschön. Dort hockte ich, in meinem kleinen Zelt, das ich an allen Ecken mit leeren Kerosinkanistern beschwerte – ich füllte sie mit Sand, um zu verhindern, dass mir mein Zelt wie irgendein großer Vogel davonflatterte; und es wäre bestimmt davongeflattert, wenn der kräftige Südwind über das Land blies, das können Sie mir glauben. Hockte dort und tat, was ich konnte, ganz in der Nähe der Transaustralischen Eisenbahn, die den stillen roten Sand durchschnitt und damit einen Pfad markierte, dem die Spatzen und Kaninchen, die Füchse, die Katzen und alle Weißen folgen konnten; weißer Pöbel hauptsächlich – wegen dieser Weißen brauchte ich einen Revolver, nicht wegen der Aborigines. Ooldea war immer schon ein wichtiger Ort für die Aborigines, denn dort gab es das ganze Jahr über frisches Süßwasser, selbst während der schlimmsten Trockenperioden. Irgendwann gab es dann kein Wasser mehr, jedenfalls nur noch wenig, weil die Züge so viel davon verschlangen; aber die Aborigines kamen weiterhin, zogen durch, wie sie es immer getan hatten. Ihre Pfade kreuzten sich dort, es war einer ihrer Treffpunkte. Man hatte immer den Eindruck, als hielten sich an diesem Ort zu allen Zeiten zahllose Menschen auf, nicht nur die Lebenden, sondern auch die Toten, um gemeinsam zu schauen, zu sehen und miteinander zu sprechen. Deshalb blieb ich wohl so lange: Ich fühlte mich dort zu Hause.
Im Traum, Mr Glass, finde ich mich oft auf der Nullarbor Plain wieder; ich sehe mich einen wassergefüllten Kerosinkanister auf einer Schubkarre über einen steinigen Pfad balancieren, ein wenig wie der gute alte Sisyphos mit seinem Felsblock, rauf und runter, jeden Tag, und immer allein, niemand, der ihm geholfen hätte. Ich träume von einem Sturm, einem Wind, der so heftig durch mein Zelt fegt, dass der Deckel der metallenen Truhe auffliegt, in der ich meine Notizen verwahrte; der Windstoß wirbelt ein Gestöber zerrissener Blätter in der Luft herum, gebrauchte Kuverts, die zerfledderten Schreibhefte, die ich wieder zusammengenäht hatte, alles, worauf ich den Bericht über mein Leben festgehalten hatte; einen wichtigen Bericht über ein wichtiges Leben. Im Traum renne ich hin und her, versuche, wenigstens noch die eine oder andere Namensliste, die Beschreibung eines Insekts, eines Vogels, eines Baumes, die Erzählungen, die Gesetze, die Traditionen dieses Volkes zu retten, mit dem ich Freundschaft geschlossen hatte, dieser Menschen, die mich Kabbarli, die »Großmutter«, nannten. Immer noch habe ich die Gesichter der Männer, Frauen und Kinder genau vor Augen, die kamen, um ihre Lager in der Nähe des meinigen aufzuschlagen, und mit mir in ihrem eigenartigen, singenden Tonfall sprachen. Manchmal, wenn ich lange genug einen Punkt am fernen Horizont fixiere, ist mir, als könne ich umrisshaft eine neue Gruppe von Aborigines erkennen, die nackt und schimmernd aus der roten Wüste auf mich zukommt.
Ich habe ein paar Fotografien von Aborigines aufbewahrt, aber nicht viele; sie sind nicht sehr fotogen. Dieser Mann zum Beispiel, mit dem weißen Bart, das ist mein lieber Freund Joobaich, einer der Letzten aus dem Volk der Bibbulman in der Gegend um Perth; und diese Frau, die hier inmitten von leeren Flaschen und alten Blechdosen in der Sonne sitzt, ist seine Nichte Fanny Balbuck, eine wunderbare Geschichtenerzählerin. Die Wollmütze, die sie trägt, hat sie von mir bekommen. Sie vermisse ich wahrscheinlich mehr als jeden Menschen, den ich je gekannt habe – ob Sie das wohl verstehen können, Mr Glass? Und dies hier ist Binilyia, eine Wolken-Frau aus Tarcoola, mit Dowie und Jinjabulla. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie erkennen, dass sie blind sind. Beinahe drei Jahre lang saßen wir immer wieder am gleichen Fleck in der Nähe von Evela zusammen, aber die Zeit verging so schnell. Das bin ich, mit meinem Schirm, meinem »königlichen Schirm«, wie ich ihn nenne, und jede einzelne der Frauen um mich herum hat mindestens eines ihrer Neugeborenen aufgefressen. Kannibalismus. Aber niemand wollte mir glauben, auch nicht, nachdem ich alle Beweise zusammengetragen hatte.
Schauen Sie, Mr Glass, hier ist ein Foto von der Eisenbahn: diesem mächtigen, schwarzen, lärmigen, metallenen Ding – und man sieht, wie die Landschaft dort ist, wie kahl. Die Ansammlung von Gebäuden im Hintergrund ist der Bahnhof von Ooldea, eigentlich nur ein Bahnsteig mit einer Holzhütte, ja, und mit einer Anschlagtafel natürlich, der man entnehmen kann, wo man sich befindet. Ich bin ziemlich sicher, dass es sich kaum verändert hat seit damals; ich würde gern dorthin zurückkehren und alles noch einmal wiedersehen.«
3
Zum ersten Mal hörte ich von Daisy Bates vor etwa fünfundzwanzig Jahren; ich war damals gerade kein Teenager mehr, beinahe schon erwachsen: Rücken gerade, schmale Taille, mit immer schmerzenden Kiefern, weil ich ständig die Zähne zusammenbiss – vor Angst oder vielleicht vor Zorn. Zwischen mir und einer Dame namens Edith Young, die mir unendlich alt erschien, hatte sich eine eigenartige Freundschaft entwickelt. Mrs Young war damals wohl um die achtzig, aber für mich eine Art körperhafter Geist, ein Wesen, dem es gelungen war, der Zeit und dem Tod zu trotzen, möglicherweise, weil sie unendlich viel redete, sodass weder Zeit noch Tod je eine Chance hatten, sie zu unterbrechen. Sie bewohnte das Dachgeschoss eines Hauses, das eine namhafte Kulturinstitution beherbergte; dort saß sie wie eine Eule im Baum. Man gelangte über drei (oder waren es vier?), mit dickem Teppich belegte Treppen zu ihr hinauf, und wann immer man kam, schrieb sie gerade an der Geschichte ihres Lebens oder aquarellierte Bilder von nackten üppigen Damen und hageren nackten Männern. Da sie beinahe taub war und immer schlechter sah, rückte sie ganz nahe an jeden heran, mit dem sie sprach, das Kinn nach oben gestreckt, weil sie so klein war; aus grauen Augen fixierte sie ihr Gegenüber mit dem intensiven Blick der Halbblinden. Sie erzählte mir von ihren Büchern, ihren Geliebten, vom Blitzkrieg und den Luftangriffen, hielt mir Vorträge über Orgasmus, Sonnenuntergänge und Buddhismus: eine Sturzflut von Wörtern, die ich begierig aufnahm als Belehrung darüber, was im Leben wirklich zählte. Sie hatte während der Dreißigerjahre in Australien gelebt, und als ich sie fragte, ob es ihr dort gefallen habe, antwortete sie in ihrer komischen schrillen Stimme: »Gott, nein, ich hasste Australien! Ich habe mich dort entsetzlich gelangweilt!« Dann fügte sie aber hinzu, dass es dennoch nicht völlig verschwendete Zeit gewesen sei, weil sie dort von Daisy Bates gehört habe – der einzigen interessanten Person weißer Hautfarbe, die jemals auf diesem ganzen weiten Kontinent gelebt habe, das sei jedenfalls ihre Meinung, und angloirischer Herkunft, wie sie selbst. »Sie müssen ein Buch über diese Frau schreiben«, sagte sie zu mir, und obwohl ich damals noch nie auf den Gedanken gekommen war, irgendetwas über irgendjemanden zu schreiben, ist dies vielleicht doch einer der Gründe, warum ich mich jetzt wieder der Geschichte einer Frau zugewandt habe, die in der Wüste lebte und die so lange Zeit irgendwo in meinen Gedanken einen kleinen Raum bewohnt hat, dass ich manchmal meine, ich müsse ihr wirklich begegnet sein und hätte nur einfach die genauen Umstände dieser Begegnung vergessen.
Es gibt noch eine Verbindung mit Daisy Bates, eine, die ich seit Jahren mit mir herumgetragen habe. Auf einem Londoner Flohmarkt hatte ich einmal ein altes Fotoalbum erstanden: ein großes, schwarz gebundenes Buch mit unerwartet schönen Aufnahmen – manche immer noch kräftig und klar, andere schon recht vergilbt, sodass man annehmen musste, sie würden, hellem Licht ausgesetzt, bald vollends unkenntlich sein. Das Album scheint die Chronik einer Weltreise zu sein, die vier Varietékünstler in den Zwanzigerjahren gemeinsam unternommen hatten, zwei Männer und zwei Frauen namens Frankie, Heath, Osborne und Perryer. Sie kamen bis nach Afrika, Indien, Australien, Neuseeland und Japan, vielleicht auch noch in andere Länder, das lässt sich schwer sagen, weil kein einziges Bild beschriftet ist. Es sieht aus, als habe jemand die ganze Welt wahllos durcheinandergewürfelt; die Kontinente und Kulturen scheinen ineinander überzugehen, wenn man darin blättert, und der einzige rote Faden sind die lächelnden Gesichter der vier Schauspieler. Sie stehen zusammen, eine kleine, fest gefügte Gruppe, und lächeln, während hinter ihnen tosende Wassermassen in die Tiefe stürzen – es muss wohl der Niagarafall sein; sie lächeln vor dem Hintergrund eines Dschungels, einer Lehmhütte, einer religiösen Prozession. Eine der Damen, in einem Kleid aus kariertem Gingan mit Fransen in Kniehöhe, eine Blume im Haar, hält lächelnd ein nacktes, dunkelhäutiges Kind an der Hand; rundherum sind die wundervollen Bienenkorbhütten eines Zulu-Dorfes zu sehen. Die andere Dame – in einem vernünftigen Gabardinemantel und mit einer Haarklemme, die ihre Bubikopffrisur in Form hält – lächelt beim Nasenkuss mit einem Maori im rituellen Festgewand. Drei von ihnen stehen da und starren auf eine riesige Welle, die an einem Damm zerbirst, der irgendeine namenlose Stadt vor dem Meer schützen soll; zwei von ihnen bestaunen respektvoll die Dampfwolken, die ein Geysir in die Luft speit – in welchem Land, konnte ich nie herausfinden.
Vor Kurzem habe ich mir die Bilder aus Australien in diesem Album wieder angesehen: das Eingangstor zu irgendeinem Regierungsgebäude; ein Eukalyptuswäldchen an einem See, mit Brücke; ein Café namens Petersons in einer schäbigen Stadt mit einer dampfbetriebenen Eisenbahn, die mitten durch eine Straße – offensichtlich die Hauptstraße – fährt. Auf der nächsten Seite posieren die Künstler abwechselnd auf der untersten Stufe einer geöffneten Waggontür ebendieses Zuges, der mittlerweile die städtische Zivilisation hinter sich gelassen hat. Sie winken und strahlen, der kargen Landschaft um sie herum zum Trotz. Danach kommen einige Aufnahmen von Aborigines: ein barfüßiger Mann, der die Gleise entlanggeht, dünn und schäbig gekleidet, einen Stock in der Hand und einen Ausdruck schrecklicher Verzweiflung im Gesicht; eine Frau, die im Staub sitzt, mit dem Rücken an einen Tisch gelehnt, dem irgendwann die Platte abhandengekommen ist; noch eine Frau mit kurzem, blondem, zottigem Haar; sie trägt ein Kind auf dem Rücken, das sich an sie klammert – eine plötzliche Bewegung von der Kamera weg lässt sie nun beide geisterhaft verschwommen aussehen; und andere Aborigines, einzeln oder in Gruppen, Männer, Frauen und Kinder, alle denselben Ausdruck einer benommenen, verwirrten Traurigkeit im Gesicht.
Mein Blick blieb oft an diesen Bildern hängen, an der Schäbigkeit der Kleider, der leeren Landschaft, der geradezu kriegerischen Kompaktheit der Eisenbahn. Aber erst vor Kurzem fiel mir auf, dass eines der beiden Holzgebäude Ooldea hieß, das andere Wynbring – es stand in deutlich erkennbaren Lettern auf weißen Tafeln. Plötzlich wurde mir bewusst, dass diese Fotos die Orte zeigen, die Daisy Bates so gut kannte, als sie zur selben Zeit in der Nähe der Transaustralischen Eisenbahn ihr Lager hatte. Diese gebeutelten Überbleibsel der Menschheit, die barfuß und scheinbar ziellos durch den Staub und zwischen den Abfällen herumliefen, waren also die Menschen, an deren Leben Daisy Bates teilhaben wollte. Ich nahm ein Vergrößerungsglas zu Hilfe, um mit meinen Blicken die blassen Abstufungen von Grau und Braun nach möglichen Spuren von Daisy Bates abzusuchen, vielleicht die Umrisse eines Zelts zu entdecken, einen Windschutz oder eine Frau im langen Rock bei der Arbeit; aber ich konnte nichts finden, keine Spur von ihr.
4
Wie ist sie dorthin gelangt? An welchem Punkt hat ihre Reise begonnen, welche Spur hat sie Schritt für Schritt bis zu einem Zelt in der Wüste geführt, in dem sie eisern aushielt, Jahr für Jahr, sich festklammerte wie eine Schiffbrüchige auf hoher See an einem Floß – obwohl oft monatelang kaum jemand vorbeikam, mit dem sie hätte sprechen können, obwohl sie dort nicht viel mehr zu tun hatte, als die Hitze und die Einsamkeit zu ertragen, Notizen zu machen, Briefe zu schreiben?
Vor langer Zeit war ich einmal bei einem Astrologen, der aufmerksam die Innenfläche meiner rechten Hand betrachtete. »Sehr interessant«, sagte er, »deshalb also. Sehen Sie, wie sich diese Linie gabelt? Sie müssen irgendwann Ihrem Leben eine ganz andere Richtung gegeben haben, als es bis dahin zu nehmen schien. Das ist mir erst ein einziges Mal untergekommen: bei einem Matrosen, der die Seefahrt aufgab.« Jetzt betrachte ich selbst das komplizierte Liniengewirr auf meiner Handfläche, das ich nicht zu deuten weiß, und frage mich, welche dieser Linien wohl für das Leben steht, das ich nicht gelebt habe.
Als ich noch zur Schule ging, nahm einmal eine Geschichtslehrerin einen Bleistift zur Hand und schob ihn, Spitze voraus, durch ein leeres Blatt Papier. »So ist es auch in unserem Leben«, erklärte sie, »das Ende des Stiftes, an dem er immer kürzer wird, entspricht unserer Zukunft, das längere unserer Vergangenheit. Wir selbst befinden uns hier, wo die beiden aufeinandertreffen« – ein Bild, das in seiner Eindeutigkeit und Geradlinigkeit mit meinem eigenen Lebensgefühl gar nicht übereinstimmte: dem Gefühl, mitten in einem Labyrinth vieler kleiner Pfade zu stecken, ähnlich den Spuren, die ein kleines Tier auf der Nahrungssuche hinterlässt; und immer das Gefühl, die Zeit sei eine unendlich weite Landschaft, die verschiedene Figuren in diese und jene Richtung durchqueren.
Ich sitze ganz ruhig in einem kleinen Zimmer, umgeben von Dingen, die sich im Lauf der Zeit bei mir angesammelt haben: Bücher, Bilder, Briefe, alle möglichen Gegenstände, die jeder für sich mit einer Geschichte verbunden sind und mit einem Haken versehen, der mich zu einer Erinnerung oder einer Assoziation zurückziehen kann, bis sie vor meinen Augen tanzt. Auch viele Spuren von Daisy Bates finden sich hier zwischen dem Strandgut meines Lebens; manchmal sieht es so aus, als habe sie ihr Lager hier eingerichtet, wie eine streunende Katze auf der Suche nach einem geschützten Plätzchen für den Winter, immer nur vorläufig, immer bereit, gleich weiterzuziehen, sobald das Wetter sich bessert. Der Aborigine zu meiner Rechten, mit seinem Buddelstock in der Hand, dessen Gesicht Daisy Bates vertraut gewesen sein muss, wandert im Staub der Nullarbor-Ebene und starrt mich abweisend an. Auf der Fensterbank liegt ein dreieckiger, silbergrauer Stein, daneben ein kleines Bild vom Horizont hinter einem ruhigen Meer; beide zusammen erinnern mich an Gedanken über die Wüste, wenn ich auch nicht recht weiß, warum. Hinter meinem Rücken steht eine schwarze metallene Kiste; sie hatte einmal der Schwester meiner Mutter gehört, die sich, lange vor meiner Geburt, in einem Garten das Leben nahm, und auf dieser Kiste ein kleiner Stapel glänzender Kontaktabzüge: von den Aufnahmen, die Douglas Glass 1948 gemacht hat. Sein Sohn hat sie mir vor ein paar Wochen geschickt, zusammen mit einem Tagebuchauszug, aus dem hervorgeht, wie schwierig es für Mr Glass gewesen war, Mrs Bates zu finden, weil niemand wusste, wo sie inzwischen wohnte, ob sie überhaupt noch am Leben war.
Auf meinem Arbeitstisch stapeln sich Bücher und lose Blätter, die alle mit dem einen Gegenstand in Verbindung stehen. Ich habe eine blaue Mappe für Briefe angelegt, die sie an Freunde schickte, eine rote für Exzerpte aus ihren Tagebüchern und Notizheften. Langsam habe ich mich daran gewöhnt, die Handschrift dieser fremden Toten zu lesen: die Denkart der immer gleichen Person, die sich über Seiten und Seiten erstreckt, zurück in die Vergangenheit, voraus in die Zukunft, kreuz und quer durch die Jahre, Zeiten der Gesundheit und der Krankheit, der Entschlossenheit und der Verzweiflung. Manchmal ist ihre Schrift klar und ordentlich, reiht die Buchstaben aneinander wie Zierstiche entlang sorgfältig gezogener Linien; manchmal sehr unordentlich: ein paar Wortnester auf der eingerissenen Rückseite eines alten Kuverts, Listen, die keinen rechten Sinn ergeben, Fragen ohne Antworten, Wörter in der Sprache der Aborigines ohne Übersetzung. In ihrem Zelt in der Nähe eines Nebengleises namens Ooldea schrieb sie nicht lange vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs:
ohne festen Wohnsitz – nardoo
Zahncreme, Salz, Backpulver, Kreide, Borax, Ina, Junbur
Wirbelwinde
Telefone
dröhnender Lärm
Zusammenbruch
Winde und Winde
Die dead days (oder dead dogs?) des Nachmittags.
Ich versuche, aus all den Einzelteilen ein Bild vom Leben und Wesen dieses fremden Menschen zusammenzufügen, sie erkennbar zu machen, auch dort, wo sie sich widerspricht; ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ihr gefallen haben könnte, was ihren Zorn weckte; ich will die Fäden finden, die sie in diese oder jene Richtung zogen. Ab und zu ertappe ich mich dabei, wie ich in ihren Notizbüchern lese, als wären es meine eigenen: undatiert, abgenutzt, hastige Aufzeichnungen der Ereignisse und Gefühle, die an einem bestimmten Tag wichtig zu sein schienen:
Die Sonne sinkt schnell.
Angenommen, man hätte weder Vergangenheit noch Zukunft, lebte ausschließlich in den jeweils gegenwärtigen vierundzwanzig Stunden. Einsamkeit schützt nicht vor den eigenen Gedanken. Leider.
Bank = 16
59 Beutel
8
176 insgesamt
Die Eidechse mit dem verstümmelten Schwanz ist zu langsam für diese Gegend, wo sich alles Lebendige schnell bewegen muss, um Unterschlupf vor seinen Feinden zu finden. Stell dir vor, wie der Wind an einem klaren Tag über die Mulga fegt.
5
Ich kann mich sehr genau an meine Kindheit erinnern. Vielleicht, weil die Welt, in der ich damals lebte – eine Art flache Schüssel, wie Kinder sich ihre Welt eben vorstellen – mir ungeheuer gefährlich erschien; so gefährlich, dass man sie sich sehr genau ansehen musste, um auf alle möglichen, plötzlichen Schrecken vorbereitet zu sein. Ich kann mich, wenn ich will, jederzeit mit geradezu hypnotischer Genauigkeit in diese vergangenen Tage zurückversetzen. Ich kann steile Treppen hochsteigen und die Anstrengung empfinden, die es kostet – als hätte ich eben erst laufen gelernt; ich bewege mich durch Korridore, die endlos lang scheinen, und betrete einen Raum nach dem anderen. Gelegentlich halte ich inne, sehe zu, wie das Licht durch ein Fenster fällt oder unter der Schwelle einer verschlossenen Tür hervorschimmert. Menschen kommen und gehen, sprechen und schweigen; ein flüchtiger Gesichtsausdruck bleibt mitten in der Bewegung stehen, wie ein Standbild aus einem Film.
Ich weiß, ich würde die Häuser, die ich in meinem Gedächtnis aufbewahre, kaum wiedererkennen, sollte ich ihnen eines Tages tatsächlich einen Besuch abstatten; die Form der Räume, die Deckenhöhe, alles wäre wohl anders, als ich es erwartete. Und die Menschen, deren Stimmen ich so deutlich zu hören, deren Gesichter ich so deutlich zu sehen glaube, erschienen mir möglicherweise ganz fremd, ich würde mir bewusst machen müssen, dass ich eine Reihe verschiedener Jahre fest zu einem einzigen dichten Bündel zusammengeschnürt, eine ganze Schar weit auseinanderliegender Ereignisse wie Schafe in einer Ecke zusammengetrieben hatte, dass ich einem jungen Gesicht die Kennzeichen des Alters oder einem Menschen den Gesichtsausdruck eines anderen gegeben hatte. Trotz all dieser Überlagerungen und Vermischungen bin ich aber überzeugt davon, dass jede einzelne meiner Erinnerungen auf ihre Weise wahr ist – eine Art von Gewissheit, die an die zitternde Sicherheit einer Kompassnadel erinnert.
Aber Daisy Bates hat Lügen verbreitet. Mittlerweile glaube ich, sie hat sogar sich selbst solche Lügen erzählt, wenn sie so ganz allein in der Wüste saß und in ihrem Gedächtnis kramte wie in einem Warenlager. Eine seltsame Vorstellung: in die eigene Kindheit zurückzublicken und zu erfinden, was es dort zu sehen gibt; einen Vater zu erschaffen, eine Mutter, Verwandte und Freunde, ein Haus und sogar eine ganze Landschaft, die außerhalb der Fantasie eines einzelnen Menschen nie existiert haben. Es scheint, als habe die Vergangenheit für sie keine festen Umrisse, kein bestimmtes Muster; sie gleicht eher einer Kristallkugel, in die sie starrte, um aus den schimmernden Brechungen von Licht und Farbe Bilder zusammenzusetzen, die sie nach Belieben deutete. An manchen Tagen konnten diese Bilder verschwommen und undeutlich sein, sodass sie nichts sah als ein steinernes Bauernhaus auf einem Flügel in strömendem Regen; ein andermal jedoch lichtet sich der Nebel, und sie sieht aus der Flanke desselben Flügels ein wunderschönes Herrenhaus wachsen, und sie läuft darauf zu, öffnet eine Tür, tritt ein und weiß, dass sie hier zu Hause ist.
Es muss aufregend gewesen sein, wie ein Traum, den man vollkommen in der Hand hat, den man beliebig verlangsamen kann, um eine flüchtige Einzelheit in den Blick zu bekommen, oder schnell vorwärtsspulen, seitwärts schwenken, Unliebsames überspringend: ein Traum, dem man jede beliebige Richtung geben und den man beenden kann, sobald man genug hat. Sie nimmt ein Kleid, ein feines himmelblaues Satinkleid, streift es wie eine kühle zweite Haut über ihre Nacktheit. Sie nimmt ein Haus, ein schönes Haus, schenkt es ihrer Großmutter und zieht mit ihr dort ein. Das Haus ist aus großen, gelblichen Steinquadern erbaut, mit tiefen Fenstern und Türen, groß genug für Elefanten; für sich wählt sie einen Platz ganz oben auf der weit ausladenden, elegant geschwungenen Haupttreppe. Dort steht sie, in ihrem himmelblauen Kleid, und nimmt den Klang von fröhlichem Lachen in sich auf, den Geruch des Holzfeuers im Kamin, der sich mit dem süßen Tabakduft aus der Pfeife ihres Vaters mischt; das Hundegebell; ein Teich aus Sonnenlicht am Fußboden. Sie hört, wie jemand nach ihr ruft, eine volle, zärtliche Stimme: »Daisy, komm doch bitte herunter. Daisy, wir warten alle auf dich. Daisy, wir wollen ausfahren, komm jetzt, sonst verspäten wir uns noch.« Langsam schreitet sie die Treppe hinunter, Schritt für Schritt, immer weiter hinunter, in das summende Leben zu ihren Füßen; beinahe ist sie angekommen – da reißt der Faden, und sie sitzt wieder in ihrem kleinen Zelt in der australischen Wüste mit dem Wind, der Stille und der Hitze.
Vor langer Zeit einmal hatte ich eine Freundin, die aus einer chaotischen Familie stammte. Ihr Stiefvater betrank sich regelmäßig, ihre Mutter wurde hilflos mitgerissen, wie ein zerzauster kleiner Vogel im Sturm, und ihr Bruder, der ihr sonst vielleicht geholfen hätte, machte sich mit einer fetten wilden Prostituierten davon, die die Augen verdrehte, wenn sie mit Fremden zusammenkam, und alle »Schätzchen« nannte, mit ihrer unglaublich tiefen Stimme. Meine Freundin flüchtete sich vor all dem in eine Art überkorrektes Benehmen. Sobald ein Mitglied der königlichen Familie im Fernsehen erschien, sprang sie auf und salutierte, und jeden Tag tauchte sie untadelig adrett aus dem Gewirr und dem Geschrei dieses verrückten Haushalts auf. Wenn jemand sie nach ihrem Bruder fragte, erzählte sie, er habe eine Lehrerin aus Schottland geheiratet und sich in Glasgow niedergelassen, und kam ich dazu, wenn ihr Stiefvater wieder einmal auf dem Fußboden herumrobbte wie ein gestrandeter Fisch, dann schritt sie erhobenen Hauptes an ihm vorbei und zeigte sich entrüstet über die Unordnung – als handelte es sich nicht um ihren Stiefvater, sondern um einen verrutschten Teppich oder einen zufällig umgekippten Stuhl.
Vielleicht hatte Daisy Bates schon als kleines Kind damit begonnen, sich selbst ihre Geschichte und ihre Erinnerungen zu erfinden, und es später nicht mehr geschafft, diese Gewohnheit aufzugeben, oder einfach nicht bemerkt, dass dies nicht ganz die übliche Art war, der Welt Sinn zu verleihen. Ein Kind irgendwo in Irland, das zu einer Versammlung von unsichtbaren Freunden spricht, verwandelt sich langsam in eine alte Dame in der Wüste, die immer noch mit Menschen spricht, die niemand sonst sehen kann. Ein Kind nimmt ein Blatt, nennt es einen goldenen Teller und schneidet lächelnd ein Stück Erdkuchen ab; auch die alte Dame lächelt, nennt ihr Marmeladenbrot ein großartiges Festdiner, an dem sie mit vielen anderen Gästen teilnehme.
»Wer bist du, kleines Mädchen?«
»Oh, eine Prinzessin. Das hier ist nicht mein wirkliches Zuhause. Eine böse Hexe hat mich entführt und hierher verschleppt, aber bald wird man kommen, mich befreien und in meinen glänzenden Palast zurückbringen.«
»Wer sind Sie wirklich, Mrs Bates?«
»Ich bin Kabbarli, die weiße Großmutter. Ich bin die Große Weiße Königin des Niemandslands, und ich bin aus dem Reich der Toten hierhergekommen, um meinem Volk in der Stunde der Not beizustehen. Außerdem stamme ich aus sehr guter Familie, aber das haben Sie natürlich selbst sofort bemerkt, man hört es ja schon an meiner Stimme. Eine Reihe bedeutsamer Männer wollten mich zur Frau nehmen, darunter ein Bischof und ein englischer Lord, aber mein Schicksal hat mich hier festgehalten.«
Als sie berühmt wird, wenn auch nicht ganz so berühmt wie in ihrer Vorstellung, wollen viele von Daisy Bates etwas über ihr früheres Leben erfahren, und sie erzählt ihnen, was ihr gerade einfällt, immerfort eine andere Geschichte, je nach Stimmung. Sie schwärmt von der Schönheit ihrer Mutter, von der Güte und Freundlichkeit ihres Vaters, den sie so leidenschaftlich geliebt hat, von der guten Erziehung und der Großzügigkeit ihrer Großmutter. Sie erinnert sich an ihre Geschwister, an das Tafelsilber, die Porträts an den Wänden, die Spitzenkleider, die Bälle und die Ausritte. Vor allem wird sie nie jenen strahlenden, sonnigen Tag vergessen, an dem sie Königin Viktoria die Hand schüttelte. Sie kann nicht viel älter als sechs gewesen sein. Ihre Majestät schritt über die Gartenwege von Schloss Balmoral auf sie zu, sie kann alles so genau sehen, als hätte es sich erst vor wenigen Tagen zugetragen. Angst habe sie nicht empfunden; sie habe ihren Knicks gemacht, wie man es ihr beigebracht hatte, und der Königin die Hand gereicht, die sie denn auch schüttelte. Nie wird sie das freundliche, wohlwollende Lächeln der Königin vergessen, ein Gesicht, das dem ihrer Großmutter erstaunlich ähnelt.