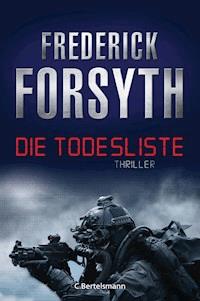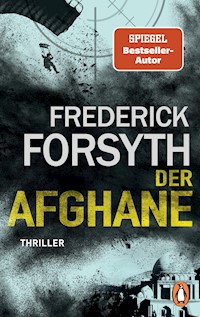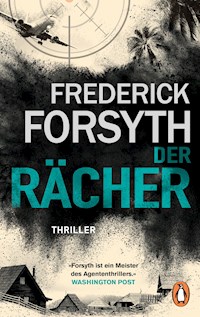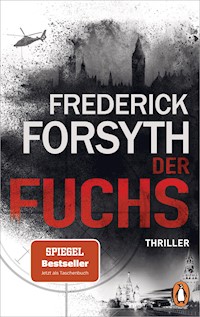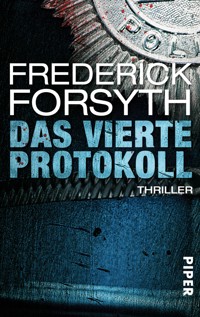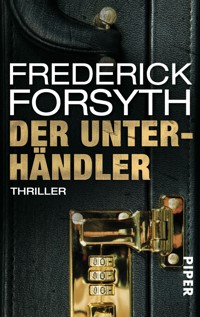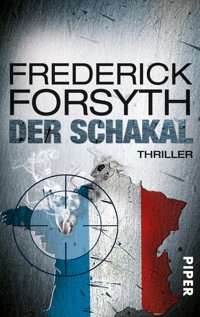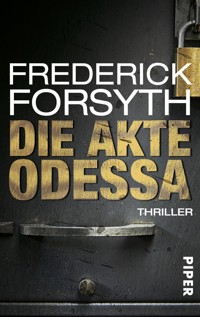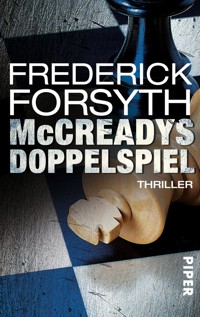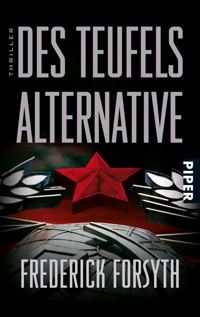
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Über Nacht gerät die Welt an den Rand der Katastrophe. In der Sowjetunion droht eine Hungersnot, und im Politbüro entbrennt ein gnadenloser Machtkampf. Ukrainische Autonomisten kapern in der Nordsee den größten Öltanker der Welt und erpressen Ost und West. Nur einer kennt den Ausweg und wählt des Teufels Alternative.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Frederick Stuart,
der von alldem noch nichts weiß
Übersetzung aus dem Englischen von Wulf Bergner
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
ISBN 978-3-492-96047-2 Mai 2017 © 1979 Ahiara International Corporation S.A. Titel der englischen Originalausgabe: »The Devil’s Alternative«, Hutchinson & Co. Ltd., London 1979 © der deutschsprachigen Ausgabe: 1979 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur Umschlagabbildung: Hayden Verry / plainpicture / cg-textures Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Der amerikanische Präsident las den Bericht mit einem Ausdruck wachsenden Entsetzens.
»Es ist grauenvoll«, sagte er, als er fertig war, »aber mir bleibt keine Wahl. Welche Entscheidung ich auch treffe – es werden Menschen sterben.«
Adam Munro betrachtete den Präsidenten ohne Mitgefühl. Er wußte aus langer Erfahrung, daß Politiker im Prinzip nur wenig gegen das Opfer von Menschenleben einzuwenden haben, solange die Öffentlichkeit sie persönlich nicht damit in Verbindung bringt.
»So was hat es schon früher gegeben, Mr. President«, stellte er entschlossen fest, »und es wird ohne Zweifel wieder vorkommen. Bei uns in der Firma nennen wir das ›des Teufels Alternative‹.«
Prolog
Der Schiffbrüchige wäre vor Sonnenuntergang tot gewesen, wenn ein italienischer Matrose namens Mario nicht so scharfe Augen gehabt hätte. Als der Mann gesichtet wurde, war er bereits bewußtlos. Die ungeschützte Haut seines fast nackten Körpers hatte unter der erbarmungslosen Sonne Verbrennungen zweiten Grades erlitten, und die von Meerwasser überspülten Teile waren zwischen den Salzgeschwüren weich und weiß wie die Schenkel einer verwesenden Gans.
Mario Curcio war Schiffskoch und Steward der Garibaldi, eines rostigen alten Frachters aus Brindisi, der an der Ostecke der türkischen Nordküste durchs Schwarze Meer stampfte, mit Kurs auf Kap Indsche und Trabzon. Dort sollte das Schiff eine Ladung Mandeln aus Anatolien an Bord nehmen.
Warum Mario ausgerechnet an diesem Morgen der letzten Aprilwoche des Jahres 1982 seinen Eimer mit Kartoffelschalen über die Leereling statt in die Müllrutsche auf dem Achterdeck kippte, hätte er nicht erklären können – allerdings fragte ihn auch keiner danach. Vielleicht kam er an Deck, um frische Schwarzmeerluft zu atmen und dem Einerlei der heißen Küchendämpfe in seiner engen Kombüse zu entrinnen; jedenfalls trat er an die Steuerbordreling und schüttete seinen Abfall in das geduldige Meer. Dann wandte er sich ab, um an seinen Arbeitsplatz zurückzuschlurfen. Nach zwei Schritten blieb er stehen, runzelte die Stirn, machte kehrt und ging, zögernd und verwirrt, an die Reling zurück.
Das Schiff lief Ostnordostkurs, um Kap Indsche zu umfahren. Als Mario, eine Hand über die Augen gelegt, nach achtern blickte, schien ihm die Mittagssonne fast genau ins Gesicht. Aber er wußte bestimmt, daß er in der blaugrauen Dünung zwischen dem Schiff und der türkischen Küste zwanzig Seemeilen südlich irgend etwas gesehen hatte. Da er es nicht mehr ausmachen konnte, trottete er übers Achterdeck, stieg die Leiter zur Brückennock hinauf und suchte die Wasserfläche erneut ab. Dann sah er es eine halbe Sekunde lang ganz deutlich zwischen den sanft wogenden Wellenbergen. Er drehte sich nach der offenen Tür des Ruderhauses um und rief: »Capitano!«
Da Mario ein einfältiger Bursche war, bedurfte es einiger Überzeugungskraft gegenüber Kapitän Ingrao; aber Ingrao war Seemann genug, um zu wissen, daß es seine Pflicht war, auf Gegenkurs zu gehen und das Wasser abzusuchen, falls auch nur der geringste Verdacht bestand, daß ein Mann in den Wellen trieb; und sein Radargerät hatte tatsächlich ein Echo angezeigt. Der Kapitän brauchte eine halbe Stunde, um die Garibaldi zu wenden und die Stelle zu erreichen, auf die Mario gezeigt hatte. Und dann sah er es auch.
Das Ruderboot war knapp dreieinhalb Meter lang und nicht sonderlich breit: ein leichtes Boot, das das Beiboot eines Schiffes hätte sein können. Vor der Bootsmitte befand sich eine einzelne Ducht mit einer Masthalterung. Aber das Boot hatte entweder nie einen Mast gehabt, oder er war längst über Bord gegangen. Während die Garibaldi mit gestoppter Maschine in der Dünung rollte, stand Kapitän Ingrao an der Brückenreling und beobachtete, wie Mario und der Bootsmann Paolo Longhi das Motorrettungsboot zu Wasser brachten. Von seinem erhöhten Standpunkt aus konnte der Kapitän in das Ruderboot hinuntersehen, als es von seinen Leuten herangeschleppt wurde.
Der Mann im Ruderboot lag in zehn Zentimeter tiefem Salzwasser auf dem Rücken. Er war hager und abgezehrt, und in seinem Gesicht standen Bartstoppeln. Er war ohne Bewußtsein, sein Kopf war auf die Seite gesunken, und er atmete keuchend. Er stöhnte ein paarmal, als er an Bord gehievt wurde und Seemannsfäuste seine verbrannten Arme und Beine anpackten.
An Bord der Garibaldi wurde eine Kabine ständig freigehalten, um als eine Art Lazarett benutzt werden zu können. In sie brachte man den Schiffbrüchigen. Mario wurde auf eigenen Wunsch zum Krankenpfleger des Mannes bestimmt, den er bald als sein Privateigentum betrachtete – so wie ein Junge sich besonders um einen kleinen Hund kümmert, den er vor dem Tode gerettet hat. Bootsmann Longhi gab dem Mann eine Morphiumspritze aus der Bordapotheke, um dessen Schmerzen zu lindern, und behandelte dann mit Mario den Sonnenbrand.
Als Kalabrier verstanden sie etwas davon und bereiteten das beste Sonnenbrandmittel der Welt zu. Mario brachte aus seiner Kombüse eine Schüssel mit einer Mischung aus Zitronensaft und Weinessig, einen Leinenstreifen von seinem Kopfkissenbezug und eine Schüssel mit Eiswürfeln. Er tauchte das Tuch in die Mischung, packte ein Dutzend Eiswürfel hinein und drückte es leicht auf die schlimmsten Stellen, wo die ultravioletten Strahlen fast bis auf die Knochen gedrungen waren. Dampfschwaden stiegen von dem Bewußtlosen auf, als das eisige Adstringens dem verbrannten Fleisch die Hitze entzog. Der Mann erbebte unter einem Schauer.
»Lieber Fieber bekommen als am Sonnenbrand sterben«, erklärte Mario ihm auf italienisch. Der Mann hörte nichts – und hätte auch nichts verstanden.
Auf dem Achterdeck, wo das an Bord geholte Ruderboot lag, stieß Longhi auf den Kapitän.
»Irgendwas Besonderes?« fragte der Bootsmann.
Kapitän Ingrao schüttelte den Kopf.
»Der Mann hatte nichts auf dem Leib als eine billige Unterhose ohne Etikett. Keine Uhr, keine Erkennungsmarke. Und sein Bart scheint ungefähr zehn Tage alt zu sein.«
»Das Boot war auch leer«, sagte Ingrao. »Kein Mast, kein Segel, keine Riemen. Kein Proviant und kein Wasserbehälter. Das Ding hat nicht mal einen Namen. Aber der kann auch abgeblättert sein.«
»Ein Tourist, der von einem Badeort aufs Meer hinausgetrieben worden ist?« meinte Longhi. Ingrao zuckte mit den Schultern.
»Oder ein Überlebender von einem kleinen Frachter«, sagte er. »In zwei Tagen sind wir in Trabzon. Die türkischen Behörden sollen sich darum kümmern, sobald er zu sich kommt und reden kann. Na ja, wir werden sehen. Wir müssen unseren Agenten über Funk informieren, damit er einen Krankenwagen schickt, wenn wir anlegen.«
Zwei Tage später lag der Schiffbrüchige, die meiste Zeit bewußtlos und noch immer unfähig zu sprechen, in einem weißbezogenen Bett des kleinen städtischen Krankenhauses von Trabzon.
Mario hatte seinen Schützling auf dem Transport im Krankenwagen vom Kai bis zum Hospital begleitet – gemeinsam mit dem Schiffsagenten und dem Hafenarzt, der darauf bestanden hatte, den delirierenden auf ansteckende Krankheiten zu untersuchen. Nach einer Stunde hatte Mario seinem bewußtlosen Freund Lebewohl gesagt und war an Bord zurückgekehrt, um das Mittagessen für die Besatzung zu kochen. Abends war der alte italienische Frachter bereits wieder ausgelaufen.
Am nächsten Tag stand ein anderer Mann in Begleitung eines Polizeibeamten und des Arztes am Bett des Schiffbrüchigen. Alle drei waren Türken, aber der untersetzte, breitschultrige Zivilist sprach passables Englisch.
»Er kommt durch«, sagte der Arzt, »aber noch ist sein Zustand kritisch. Hitzschlag, Verbrennungen zweiten Grades, allgemeine Entkräftung. Er scheint seit Tagen nichts gegessen zu haben und ist sehr schwach.«
»Was ist das?« fragte der Zivilist und deutete auf die Tropfe, die an die Arme des Mannes angeschlossen waren.
»Glukose zur Stärkung, Kochsalzlösung gegen den Schock«, antwortete der Arzt. »Die Seeleute haben ihm mit ihrer Sofortbehandlung wahrscheinlich das Leben gerettet. Wir haben ihn in Kamille gebadet, um den Heilungsprozeß zu fördern. Alles übrige muß er mit Allah ausmachen.«
Urmit Erdal, Gesellschafter der Schiffahrts- und Handelsfirma Erdal & Sermit, war der Unteragent von Lloyds für den Hafen Trabzon, und erleichtert hatte der Agent der Garibaldi den Fall des Schiffbrüchigen an ihn weitergeben. Die Lider des Kranken zuckten in dem nußbraunen, bärtigen Gesicht. Urmit Erdal räusperte sich, beugte sich über den Mann und sprach sein bestes Englisch.
»Wie … Sie … heißen?« fragte er langsam und deutlich.
Der Mann stöhnte und warf den Kopf von einer Seite auf die andere. Der Lloyds-Agent beugte sich noch tiefer über ihn. »Sradscheny«, murmelte der Kranke, »sradscheny.«
Erdal richtete sich auf. »Er ist kein Türke«, stellte er fest, »aber er scheint Sradscheny zu heißen. Aus welchem Land kommt man mit so einem Namen?«
Die beiden anderen zuckten mit den Schultern. »Ich benachrichtige Lloyds in London«, entschied Erdal. »Vielleicht ist dort etwas von einem im Schwarzen Meer verschollenen Schiff bekannt.«
Die Bibel aller Handelsmarinen der Welt ist Lloyds List. Das Blatt erscheint täglich außer sonntags und bringt Abhandlungen, Dokumentationen und Nachrichten über ein einziges Thema – über die Schiffahrt. Ihm beigelegt ist Lloyds Shipping Index mit den Bewegungen der 30 000 aktiven Handelsschiffe der Welt: Name des Schiffs, Eigner, Nationalität, Baujahr, Tonnage, letzter und nächster Hafen.
Die Redaktionen beider Blätter befinden sich in einem Gebäudekomplex am Sheepen Place in Colchester in der englischen Grafschaft Essex. Dorthin übermittelte Urmit Erdal per Fernschreiber die Schiffsbewegungen im Hafen von Trabzon und fügte eine kurze Anfrage an Lloyd’s Shipping Intelligence hinzu.
Der Nachforschungsdienst überprüfte seine Unterlagen, stellte fest, daß in der letzten Zeit keine Schiffe im Schwarzen Meer als verschollen, gesunken oder auch nur als überfällig gemeldet worden waren, und gab die Anfrage an die Redaktion von Lloyds List weiter. Dort machte ein Redakteur eine kurze Meldung für die erste Seite daraus und erwähnte auch den Namen, den der Schiffbrüchige genannt hatte. Die Notiz wurde am nächsten Morgen veröffentlicht.
Die Nachricht von dem nicht zu identifizierenden Mann in Trabzon fand bei den meisten Lesern, die an diesem Tag Ende April Lloyd’s List in die Hand nahmen, nur wenig Beachtung. Aber sie fesselte die Aufmerksamkeit eines ungefähr dreißig Jahre alten Mannes, eines bewährten leitenden Angestellten einer Schiffsmaklerfirma, deren Geschäftsräume in der Crutched Friars lagen, einer kleinen Straße im Bankenviertel der Londoner City. Seine Kollegen in der Firma kannten den Mann als Andrew Drake.
Nachdem Drake die Meldung gelesen hatte, verließ er seinen Schreibtisch und ging ins Konferenzzimmer, wo eine gerahmte Weltkarte hing, auf der die vorherrschenden Windrichtungen und Meeresströmungen eingetragen waren. Im Frühjahr und Sommer wehen die Winde über dem Schwarzen Meer hauptsächlich aus Norden, und die Strömung fließt gegen den Uhrzeigersinn von der Südküste der Ukraine an den Küsten Rumäniens und Bulgariens vorbei, wo sie nach Osten abgelenkt wird und die Schifffahrtsroute zwischen Istanbul und Kap Indsche erreicht.
Drake stellte auf einem Schmierzettel ein paar Berechnungen an. Ein kleines Boot, das etwa aus dem Gebiet der Dnjestrmündung südlich von Odessa kam, konnte bei günstigen Wind- und Strömungsverhältnissen vier bis fünf Knoten Fahrt an Rumänien und Bulgarien vorbei in Richtung Türkei machen. Aber nach drei Tagen bestand bei schlechtem Wetter die Gefahr, daß das Boot im Schwarzen Meer nach Osten abgetrieben wurde, anstatt den Bosporus zu erreichen.
Aus der Rubrik »Wetter und Navigation« in Lloyd’s List ging hervor, daß in diesem Seegebiet vor neun Tagen tatsächlich schlechtes Wetter geherrscht hatte. Vielleicht schlecht genug, überlegte Drake, um einen unerfahrenen Seemann mit seinem Ruderboot kentern zu lassen. Dabei konnte der Mast ebenso wie das gesamte übrige Zubehör verlorengegangen sein. Selbst wenn es dem Insassen gelungen war, wieder ins Boot zu klettern, so war er doch Sonne und Wind gnadenlos ausgeliefert.
Zwei Stunden später bat Andrew Drake um eine Woche Urlaub. Er wurde ihm bewilligt, aber erst ab dem folgenden Montag, dem 3. Mai.
Drake war ziemlich aufgeregt. Er wartete auf das Wochenende und buchte bei einem Reisebüro in der Nähe einen Rückflug London–Istanbul. Er beschloß, das Ticket für den Weiterflug nach Trabzon in Istanbul zu kaufen und bar zu bezahlen. Er vergewisserte sich, daß er mit einem britischen Reisepaß kein Visum für die Türkei brauchte, und ließ sich nach Büroschluß beim Ärztedienst der British Airways in der Victoria Station vorschriftsmäßig gegen Pocken impfen.
Drake war aufgeregt, weil er es für möglich hielt, nach jahrelangem Warten endlich den Mann gefunden zu haben, den er suchte. Im Gegensatz zu den drei Türken, die vor zwei Tagen am Bett des Schiffbrüchigen gestanden hatten, wußte er, aus welcher Sprache das Wort sradscheny kam. Er wußte auch, daß das nicht der Name des Mannes war. Der Kranke hatte das Wort »verraten« in seiner Muttersprache gemurmelt – auf ukrainisch. Das konnte bedeuten, daß der Mann ein geflüchteter ukrainischer Partisan war.
Auch Andrew Drake war, trotz seines anglisierten Namens, ein Ukrainer. Und er war ein Fanatiker.
Nach seiner Ankunft in Trabzon suchte Drake als erstes Urmit Erdal auf, dessen Namen und Adresse er sich von einem Freund bei Lloyds beschafft hatte mit der Begründung, er werde eine Woche Urlaub an der türkischen Schwarzmeerküste machen und vielleicht etwas Unterstützung brauchen, da er kein Wort Türkisch spreche. Urmit Erdal, dem Drake ein Empfehlungsschreiben vorlegen konnte, interessierte sich nicht dafür, warum der Engländer den Schiffbrüchigen, der immer noch im Krankenhaus lag, besuchen wollte. Er schrieb dem Chefarzt ein paar Zeilen, und kurz nach dem Mittagessen wurde Drake in das kleine Einzelzimmer geführt, in dem der Mann lag.
Von dem Lloyds-Agenten wußte Drake bereits, daß der Kranke zwar wieder bei Bewußtsein war, aber viel schlief und in wachem Zustand bisher noch kein einziges Wort gesagt hatte. Als Drake den Raum betrat, lag der Mann, die Augen geschlossen, auf dem Rücken. Drake zog sich einen Stuhl heran und nahm neben dem Bett Platz. Eine Zeitlang starrte er das abgezehrte Gesicht des anderen an. Nach einigen Minuten zuckten die Lider des Mannes, öffneten sich halb und sanken wieder herab. Drake wagte nicht zu beurteilen, ob der Kranke den Besucher wahrgenommen hatte, der ihn so intensiv beobachtete. Aber er wußte, daß der Mann zumindest halbwegs wach war. Langsam beugte er sich vor und sagte mit deutlicher Stimme in das Ohr des Kranken:
»Schtsche ne wmerla Ukraina.«
Die wörtliche Übersetzung lautet: »Die Ukraine ist nicht tot« – freier heißt es: »Die Ukraine bleibt bestehen.« Mit diesen Worten beginnt die ukrainische Nationalhymne, die, obwohl von den russischen Unterdrückern verboten, jedem nationalbewußten Ukrainer vertraut ist.
Der Kranke schlug die Augen auf und betrachtete Drake prüfend. Nach einigen Sekunden fragte er auf ukrainisch: »Wer sind Sie?«
»Auch ein Ukrainer«, antwortete Drake. Der Blick des anderen wurde mißtrauisch.
»Schnüffler!« fauchte er.
Drake schüttelte den Kopf. »Nein«, widersprach er gelassen. »Ich bin britischer Staatsbürger, in England geboren und aufgewachsen. Mein Vater war Ukrainer, meine Mutter Engländerin. Aber meiner tiefen Überzeugung nach bin ich ein Ukrainer wie Sie.«
Der Mann im Bett starrte hartnäckig die Zimmerdecke an.
»Ich kann Ihnen meinen in London ausgestellten Reisepaß zeigen, aber das wäre kein Beweis. Auch ein Tschekist könnte einen vorlegen, wenn er wollte, um Sie damit auf die Probe zu stellen.« Drake hatte den gängigen Ausdruck für sowjetische Geheimpolizisten und KGB-Agenten gebraucht.
»Aber Sie sind nicht mehr in der Ukraine, und hier gibt es keine Tschekisti«, fuhr er fort. »Sie sind nicht auf der Krim, nicht in Südrugland und auch nicht in Georgien angetrieben worden. Sie befinden sich auch nicht in Rumänien oder Bulgarien. Sie sind von einem italienischen Schiff aufgefischt und nach Trabzon gebracht worden. Sie sind in der Türkei – im Westen. Sie haben es geschafft!«
Die Augen des Mannes ruhten jetzt auf Drakes Gesicht: wach, verständig, hoffnungsvoll.
»Können Sie aufstehen?« fragte Drake ihn.
»Ich weiß nicht«, antwortete der Mann. Drake nickte zu dem kleinen Fenster hinüber, durch das Verkehrslärm hereindrang.
»Das KGB kann das Krankenhauspersonal als Türken verkleiden«, sagte er, »aber es kann keine ganze Stadt für einen Mann verändern, dessen Geständnis viel leichter durch die Folter zu bekommen wäre. Schaffen Sie es bis zum Fenster?«
Mit der Hilfe von Drake schaffte es der Schiffbrüchige, zum Fenster zu humpeln. Er blickte auf die Straße.
»Dort draußen fahren aus England importierte Austins und Morris«, sagte Drake. »Peugeots aus Frankreich und Volkswagen aus Deutschland. Die Texte auf den Plakatwänden sind türkisch. Dort drüben sehen Sie eine Coca-Cola-Reklame.«
Der Mann preßte einen Handrücken gegen den Mund und biß sich auf die Fingerknöchel. Er blinzelte mehrmals heftig.
»Ich hab’s geschafft«, murmelte er.
»Ja«, bekräftigte Drake, »wie durch ein Wunder haben Sie’s geschafft.«
»Ich heiße Miroslaw Kaminski«, sagte der Schiffbrüchige, als er wieder im Bett lag. »Ich komme aus Ternopol. Ich war der Führer einer Gruppe von sieben ukrainischen Partisanen.«
Es dauerte eine Stunde, bis er seine Geschichte erzählt hatte. Kaminski und sechs Gleichgesinnte aus dem Gebiet um Ternopol, der einstigen Hochburg des ukrainischen Nationalismus, hatten beschlossen, sich gegen die brutale Russifizierung ihrer Heimat zu wehren – gegen das in den sechziger Jahren intensivierte Programm, das in den siebziger und frühen achtziger Jahren zu einer »Endlösung« für Kunst, Literatur, Sprache und Nationalbewußtsein der Ukrainer geführt hatte. In den sechs Monaten ihrer Untergrundtätigkeit hatten sie zwei kleine Parteisekretäre – Russen, die Ternopol von Moskau aufgezwungen waren – und einen KGB-Agenten überfallen und erschossen. Dann waren sie verraten worden.
Wer immer der Verräter gewesen war – auch er war in dem Kugelhagel der KGB-Sondereinheit getötet worden, die das einsame Haus umzingelt hatte, in dem die Gruppe die nächste Operation vorbereitete. Nur Kaminski war die Flucht gelungen. Er war wie ein Tier durchs Unterholz gehetzt, hatte sich tagsüber in Scheunen und Wäldern versteckt und war nachts mit der vagen Idee, sich im Hafen von Odessa an Bord eines Schiffes aus dem Westen zu schleichen, nach Süden marschiert.
Aber Kaminski war nicht einmal in die Nähe des Hafens gelangt. Er hatte sich von Kartoffeln und Rüben auf den Feldern ernährt und in dem sumpfigen Mündungsgebiet des Dnjestr südwestlich von Odessa Zuflucht gesucht. Eines Nachts war er schließlich auf ein Fischerdorf gestoßen und hatte ein kleines Boot mit Hilfsmast und Segel gestohlen. Zum erstenmal in seinem Leben in einem Segelboot, ohne eine Ahnung von Nautik, hatte er versucht, mit Segel und Ruderpinne zurechtzukommen. Tatsächlich war es ihm gelungen, vor dem Wind zu segeln und seinen Südkurs nach dem Stand der Sonne und der Sterne zu richten.
Reines Glück hatte ihn vor einer Begegnung mit den Schnellbooten, die in den Küstengewässern der Sowjetunion patrouillierten, und der Fischereiflotte bewahrt. Sein winziges Holzboot war von den Radaranlagen an der Küste nicht geortet worden. Schließlich befand Kaminski sich irgendwo zwischen der Krim und Rumänien mit Kurs nach Süden auf dem Meer, weit entfernt von der nächsten Schiffahrtsroute, deren Verlauf er ohnehin nicht gekannt hätte. Der Sturm brach unerwartet über ihn herein. Da er das Segel nicht schnell genug reffen konnte, kenterte er und verbrauchte seine letzten Kraftreserven damit, sich eine ganze Nacht lang an dem kieloben treibenden Bootsrumpf festzuklammern. Am Morgen richtete er das Boot wieder auf und zog sich hinein. Die Kleidungsstücke, die er am Abend abgelegt hatte, um sich die Haut vom Nachtwind kühlen zu lassen, waren verlorengegangen. Auch seine wenigen rohen Kartoffeln, die offene Limonadenflasche mit Süßwasser, das Segel und das Ruder waren fort. Die Schmerzen setzten kurz nach Sonnenaufgang ein und nahmen mit der Tageshitze zu. Am dritten Tag nach dem Sturm verlor Kaminski das Bewußtsein. Als er wieder zu sich kam, lag er in einem Bett, ertrug schweigend seine Schmerzen und lauschte der Sprache, die er für Rumänisch hielt. Sechs Tage lang hatte er weder die Augen geöffnet noch den Mund aufgemacht.
Andrew Drake jubelte innerlich. Das war sein Mann, auf ihn hatte er jahrelang gewartet!
»Ich gehe in Istanbul aufs Schweizer Generalkonsulat und versuche, Ihnen vom Roten Kreuz einen vorläufigen Reisepaß ausstellen zu lassen«, sagte er, als Kaminski Anzeichen von Müdigkeit zeigte. »Falls das klappt, kann ich Sie wahrscheinlich nach England mitnehmen – zumindest mit einem Touristenvisum. Dort können wir einen Asylantrag stellen. Ich bin in drei, vier Tagen wieder da.«
Als Drake schon an der Tür war, blieb er noch einmal stehen.
»Sie können nicht wieder zurück, das ist klar«, sagte er zu Kaminski. »Aber ich kann es, wenn Sie mir helfen. Und zurück will ich. Genau das habe ich schon immer gewollt.«
Andrew Drake benötigte in Istanbul mehr Zeit, als er veranschlagt hatte, und konnte erst am 16. Mai mit einem vorläufigen Ausweis für Kaminski nach Trabzon zurückfliegen. Er hatte seinen Urlaub nach einer langen telefonischen Auseinandersetzung mit dem Juniorchef der Maklerfirma in London verlängert bekommen. Das war ihm die Sache wert. Durch Kaminski, davon war Drake überzeugt, würde er sich den einen brennenden Wunsch seines Lebens erfüllen können.
Nach außen ein festgefügter Machtblock, hat die Sowjetunion, wie schon früher das Zarenreich, zwei schwache Punkte. Einer ist das Problem, die 250 Millionen Bürger zu ernähren; der andere wird beschönigend als »die Nationalitätenfrage« bezeichnet. In den 14 von der Russischen Sozialistischen Sowjetrepublik beherrschten Republiken leben Dutzende nichtrussischer Völker, von denen die Ukrainer das größte und wahrscheinlich auch jenes mit dem ausgeprägtesten Nationalbewußtsein sind. Im Jahre 1982 entfielen auf die Russische S. S. R. nur 120 Millionen von insgesamt 250 Millionen Einwohnern. Die nächstgrößte und reichste Sowjetrepublik war die Ukraine mit ihren 70 Millionen Menschen. Dies war der eine Grund, weshalb sie sowohl zur Zeit der Zaren als auch unter der Herrschaft des Politbüros streng kontrolliert und besonders rücksichtslos russifiziert wurde. Der zweite Grund ergab sich aus der Geschichte. Seit jeher ist die Ukraine in eine westliche und eine östliche Hälfte geteilt gewesen. Dadurch war sie zum Niedergang verurteilt. Die Westukraine erstreckt sich von Kiew bis zur polnischen Grenze. Der Ostteil ist stärker von Rußland beeinflußt, weil er jahrhundertelang unter zaristischer Herrschaft gestanden hat, während die Westukraine im gleichen Zeitraum zu Österreich-Ungarn gehört hat.
Die geistige und kulturelle Ausrichtung der Ukraine war und ist westlicher als die der übrigen Sowjetrepubliken – vielleicht mit Ausnahme der drei baltischen Staaten, die aber zu klein sind, um Widerstand zu leisten. Die Ukrainer verwenden lateinische statt kyrillischer Buchstaben; die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung gehört der unierten, nicht der russisch-orthodoxen Kirche an. Ihre Sprache, Literatur, Kunst und ihre Bräuche sind älter als die der aus dem Norden vorgestoßenen russischen Eroberer.
Als Österreich-Ungarn 1918 zerbrach, bemühten sich die Westukrainer verzweifelt, aus den Trümmern des Kaiserreichs eine unabhängige Republik zu errichten. Aber im Gegensatz zu den Tschechen, den Slowaken und den Ungarn hatten sie keinen Erfolg, sondern wurden 1919 als Provinz Galizien von Polen annektiert. Als Hitler 1939 in Westpolen einmarschierte, rückte Stalin von Osten mit der Roten Armee vor und besetzte Galizien. Im Jahre 1941 wurde die Ukraine von den Deutschen erobert. Ein Chaos aus Hoffnung, Angst, richtigen und falschen Loyalitäten entstand. Manche Ukrainer kämpften gegen die Deutschen in der Hoffnung auf Konzessionen von Moskau; andere glaubten fälschlicherweise, es werde eine freie Ukraine geben, sobald Berlin Moskau besiegt habe, und meldeten sich zur Ukrainischen Division, die in deutschen Uniformen gegen die Rote Armee kämpfte. Wieder andere, zu denen auch Kaminskis Vater gehörte, zogen sich in die Karpaten zurück und kämpften als Partisanen erst gegen den einen Eroberer, dann gegen den anderen und schließlich wieder gegen den ersten. Sie alle verloren; Stalin siegte und vergrößerte sein Reich bis zum Bug, der neuen Ostgrenze Polens. Die Westukraine geriet unter die Herrschaft des Politbüros, des neuen Zaren, aber die alten Träume lebten weiter. Abgesehen von einer kurzen Entspannungspause am Ende der Chruschtschow-Ära waren die Bemühungen, die Ukraine ein für allemal auszulöschen, stetig intensiviert worden.
Stefan Drach, Student aus Rowno, hatte sich zur Ukrainischen Division gemeldet. Er gehörte zu denen, die Glück hatten: Er überlebte den Krieg, wurde 1945 von den Engländern in Österreich gefangengenommen und als Landarbeiter in Norfolk eingesetzt. Als 1946 das britische und das amerikanische Außenministerium übereinkamen, Stalin die zwei Millionen sowjetischen Staatsbürger auszuliefern, die später als »Opfer von Jalta« bekannt wurden, lief er Gefahr, zur Hinrichtung durch das NKWD nach Hause geschickt zu werden. Aber er hatte wieder Glück. Er hatte in Norfolk hinter einem Heuhaufen eine Erntehelferin verführt, die prompt schwanger geworden war, hatte sie geheiratet und war so sechs Monate später der Repatriierung entgangen. Von der Zwangsarbeit befreit, nützte er seine als Funker erworbenen Kenntnisse, um in Bradford, einem der Zentren der 30 000 in Großbritannien lebenden Ukrainer, ein kleines Radiogeschäft aufzumachen. Das erste Kind starb als Säugling; das zweite, ein Sohn, kam 1950 zur Welt und wurde Andrej getauft.
Andrej lernte auf den Knien seines Vaters nicht nur Ukrainisch. Er lernte auch die Heimat des Vaters lieben, die weiten Landschaften der Karpaten und Rutheniens. Und er lernte, die Russen zu hassen. Als der Junge zwölf war, kam der Vater bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Mutter, der endlosen Abende, die ihr Mann mit anderen Vertriebenen vor dem Kamin im Wohnzimmer verbracht hatte, überdrüssig, weil dabei in einer Sprache, die sie nie gelernt hatte, über die Vergangenheit gesprochen worden war, änderte den Familiennamen in Drake und Andrejs Vornamen in Andrew. So besuchte der Junge als Andrew Drake Schule und Hochschule, und sein erster Reisepaß war auf den Namen Andrew Drake ausgestellt.
Seine Wiedergeburt erlebte er als junger Student an der Universität. Dort lernte er andere Ukrainer kennen, und bald beherrschte er wieder die Sprache seines Vaters. Damals, Ende der sechziger Jahre, war das kurze Aufleben nationaler Literatur in der Ukraine bereits vorüber, und die meisten ihrer Exponenten waren inzwischen in Arbeitslagern verschwunden. Drake nahm diese Entwicklung erst im nachhinein wahr, in dem Wissen, was den Autoren zugestoßen war. In den frühen siebziger Jahren las er alles, was er sich beschaffen konnte – die klassischen Werke Taras Schewtschenkos, des Gelehrten und Dichters, und jene aus der kurzen Blütezeit unter Lenin, auf die Unterdrückung und Liquidierung unter Stalin folgten. Aber vor allem las er die Werke der sogenannten »Sechziger«, die nur einige wenige Jahre hatten schreiben können, bevor Breschnew ihnen Arbeitsverbot erteilte, um den von ihnen geforderten Nationalstolz zu unterdrücken. Drake las und trauerte um Osdatschi, Tschornowil, Moros und Dsjuba; und als er die Gedichte und das Geheimtagebuch Pawel Symonenkos las – des mit 28 Jahren an Krebs gestorbenen Idealisten, der für ukrainische Studenten in der UdSSR zu einer Kultfigur geworden war –, weinte er bittere Tränen um ein Land, das er noch nie gesehen hatte.
Mit der Liebe zur Heimat seines toten Vaters wuchs Drakes Haß gegen die, die für ihn die Unterdrücker der Ukraine waren. Er verschlang die von der Widerstandsbewegung in den Westen geschmuggelten Untergrundschriften und den Ukrainian Herald mit seinen Berichten über Hunderte von Unbekannten, Elenden und Vergessenen, deren Schicksale nicht das weltweite Aufsehen erregten, das die großen Moskauer Prozesse gegen Daniel, Sinjawski, Orlow, Scharanski erzielten. Sein Haß wuchs mit jeder Einzelheit, die er erfuhr, bis die Personifizierung alles Bösen auf der Welt für Andrew Drake kurz KGB hieß.
Andrew war Realist genug, um den primitiven, blindwütigen Nationalismus der älteren Vertriebenen und ihre säuberliche Trennung zwischen West- und Ostukraine abzulehnen. Ebenso lehnte er ihren tiefverwurzelten Antisemitismus ab und zog es vor, die Schriften Glusmans, eines Zionisten und ukrainischen Nationalisten, einzig als Werk eines Landsmannes zu akzeptieren. Er beobachtete das Verhalten der in England und auf dem Kontinent lebenden ukrainischen Vertriebenen und stellte fest, daß es vier verschiedene Gruppen gab: die Sprachnationalisten, die sich damit begnügten, ihre Muttersprache zu sprechen und zu schreiben; die debattierenden Nationalisten, die endlos redeten, aber nie handelten; die unermüdlichen Parolenschmierer, die ihre Gastgeber irritierten, ohne dem sowjetischen Koloß zu schaden; und die Aktivisten, die vor Staatsbesuchern aus Moskau demonstrierten, von der Special Branch fotografiert und identifiziert wurden und für kurze Zeit Schlagzeilen machten.
Drake hielt von ihnen allen nichts. Er blieb unauffällig, wohlerzogen und zurückhaltend. Er ging nach Süden, nach London, und wurde dort Angestellter. Es gibt viele Angestellte, die, ohne daß ihre Kollegen etwas davon ahnen, eine geheime Leidenschaft pflegen, die ihre Ersparnisse, ihre Freizeit und ihren Urlaub verschlingt. Drake war so ein Mann. Er versammelte in aller Stille eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich; er spürte sie auf, traf sich mit ihnen und schloß Freundschaften, ließ sie einen Treueid schwören und befahl ihnen, Geduld zu haben. Denn Andrej Drach hatte einen Traum, und, wie T. E. Lawrence gesagt hat, er war gefährlich, weil »er mit offenen Augen träumte«. Er träumte davon, eines Tages einen gewaltigen Schlag gegen die Männer im Kreml zu führen, der sie erschüttern sollte, wie zuvor noch nie sie etwas erschüttert hatte. Er wollte die Wälle ihrer Macht durchdringen und sie in ihrer eigenen Festung treffen.
Sein Traum lebte und war durch die Entdeckung Kaminskis der Wirklichkeit einen Schritt nähergerückt; und so war Drake seiner Sache sicher und zugleich aufgeregt, als sein Flugzeug erneut in Trabzon zur Landung ansetzte.
Miroslaw Kaminski sah zu Drake hinüber. »Ich weiß nicht, Andrej«, sagte er. »Ich weiß es einfach nicht. Trotz allem, was du für mich getan hast, bin ich mir nicht sicher, ob ich dir soviel Vertrauen schenken darf. Es tut mir leid, aber schließlich mußte ich mein Leben lang vorsichtig sein.«
»Miroslaw, du könntest mich weitere zwanzig Jahre kennen und würdest dann auch nicht mehr über mich wissen als jetzt. Was ich dir von mir erzählt habe, ist die reine Wahrheit. Du kannst nicht zurück, also laß mich nach Ternopol fahren. Aber ich brauche dort Kontakte. Falls du irgend jemanden kennst, der mir weiterhelfen kann …«
Kaminski war schließlich einverstanden.
»Ich kenne zwei Männer«, sagte er zögernd. »Sie sind nicht gefaßt worden, als meine Gruppe ausgehoben wurde. Selbst die anderen haben sie nicht gekannt. Ich hatte die beiden erst vor ein paar Monaten kennengelernt.«
»Aber sie sind Ukrainer, sind Widerstandskämpfer?« fragte Drake gespannt.
»Ja, sie sind Ukrainer. Aber das ist für sie nicht das ausschlaggebende Motiv. Auch ihr Volk hat leiden müssen. Ihre Väter sind, ebenso wie meiner, zehn Jahre lang in Arbeitslagern gewesen – aber aus einem anderen Grund. Sie sind Juden.«
»Aber sie hassen Moskau? Sie wollen auch den Kreml bekämpfen?«
»Ja, sie hassen Moskau«, bestätigte Kaminski. »Genau wie du und ich. Sie scheinen von der sogenannten Jüdischen Verteidigungsliga angeregt worden zu sein. Sie hatten davon im Radio gehört. Genau wie wir wollen sie sich nicht länger drangsalieren lassen, sondern in Zukunft zurückschlagen.«
»Dann laß mich mit ihnen in Verbindung treten!« drängte Drake.
Als Drake am nächsten Morgen zurück nach London flog, trug er die Namen und Adressen der beiden jungen jüdischen Widerständler in Lwow in der Tasche. Innerhalb von vierzehn Tagen hatte er eine von Intourist geleitete Rundreise gebucht, die Anfang Juli nach Kiew, Ternopol und Lwow führen sollte. Außerdem hatte er in der Firma gekündigt und seine gesamten Ersparnisse abgehoben.
Ohne daß irgend jemand etwas bemerkte, begann Andrew Drake, alias Andrej Drach, seinen Privatkrieg – gegen den Kreml.
Kapitel 1
Mitte Mai 1982 schien eine sanft wärmende Sonne auf Washington herab. Auf den Straßen tauchten die ersten Hemdsärmel auf und im Park des Weißen Hauses blühten vor den Terrassentüren des Ovalen Zimmers die ersten dunkelroten Rosen. Aber obwohl die Türen offenstanden und der frische Duft von Gras und Blumen ins Arbeitszimmer des mächtigsten Mannes der Welt drang, konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der vier im Raum anwesenden Männer auf andere Pflanzen in einem anderen Land.
Präsident William Matthews saß dort, wo amerikanische Präsidenten schön immer gesessen haben: mit dem Rücken zur Südwand des Arbeitszimmers, hinter einem großen, alten, kostbaren Schreibtisch mit Blick auf den klassischen Marmorkamin, der die Nordwand beherrscht. Im Gegensatz zu den meisten seiner Vorgänger hatte Matthews auf einen eigens für ihn angefertigten Stuhl verzichtet; er benutzte einen serienmäßigen Drehsessel mit hoher Rückenlehne, wie ihn jeder leitende Angestellte hätte haben können. Denn »Bill« Matthews, wie er sich auf Wahlplakaten nennen ließ, hatte in allen seinen erfolgreichen Wahlkampagnen seine durchschnittlichen, in keiner Weise übertriebenen Ansprüche in bezug auf Kleidung, Essen und Bequemlichkeit herausgestellt. Sein Stuhl, der von den zahllosen Abordnungen, die der Präsident im Ovalen Zimmer persönlich zu empfangen pflegte, gesehen wurde, mußte deshalb einfach sein. Den kostbaren alten Schreibtisch hatte Matthews von seinen Vorgängern übernommen, worauf hinzuweisen er stets bemüht war; dieses Möbel war ein Stück Tradition des Weißen Hauses geworden. Das machte sich immer gut.
Aber das war für Bill Matthews das Äußerste. Selbst im Kreis seiner engsten Mitarbeiter war die Anrede »Bill«, die er sich von jedem kleinen Wähler bieten ließ, nicht zulässig. Außerdem sparte er sich den netten Tonfall und das faltige Grinsen, Eigenschaften, die die Wähler dazu bewogen hatten, den netten Jungen von nebenan ins Weiße Haus zu entsenden. Er war nicht der nette Junge von nebenan, und seine Mitarbeiter wußten das; er war der Mann ganz oben.
Vor dem Schreibtisch des Präsidenten saßen auf Lehnstühlen die drei Männer, die darum gebeten hatten, ihn an diesem Morgen allein sprechen zu dürfen. Matthews’ engster Mitarbeiter war der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates, sein Berater in Sicherheitsfragen und Vertrauter auf außenpolitischem Gebiet: Stanislaw Poklewski, ein Mann mit auffallend scharfen Gesichtszügen, in der Umgebung des Kapitols abwechselnd als »der Doc« und »dieser verdammte Polacke« bezeichnet, wurde gelegentlich angefeindet, aber nie unterschätzt.
William Matthews und Stanislaw Poklewski bildeten ein seltsames Gespann: der blonde, hellhäutige, angelsächsische Protestant aus dem tiefsten Süden der Vereinigten Staaten und der dunkle, schweigsame, fromme Katholik, der als kleiner Junge aus Krakau herübergekommen war. Aber was Bill Matthews an Verständnis für die komplexe Psychologie der Europäer im allgemeinen und der Slawen im besonderen fehlte, konnte diese von Jesuiten erzogene menschliche Rechenmaschine wettmachen, die deshalb stets sein Ohr hatte.
Und noch zwei weitere Gründe sprachen für Poklewski: Er war Bill Matthews bedingungslos ergeben und hatte keinerlei politische Ambitionen, die über dessen Schatten hinausreichten. Es gab nur einen einzigen Vorbehalt gegen ihn: Der Präsident mußte die mißtrauische Abneigung, die der Doktor für die Moskauer Machthaber empfand, stets durch die unvoreingenommeneren Beurteilungen seines aus Boston stammenden Außenministers ausgleichen.
Der Außenminister fehlte an diesem Morgen bei der Besprechung, um die Poklewski gebeten hatte. Die beiden anderen Männer vor dem Schreibtisch waren Robert Benson, der Direktor der Central Intelligence Agency, und Carl Taylor.
Es heißt oft, die National Security Agency sei für die gesamte elektronische Spionage der Amerikaner zuständig. Diese Meinung ist weit verbreitet, aber falsch. Die NSA ist für den Teil der elektronischen Überwachung und Spionage im Ausland verantwortlich, der die Vereinigten Staaten durch Abhöroperationen schützen soll. Sie belauscht Telefongespräche und überwacht den Funkverkehr. Tagtäglich fängt sie Milliarden von Wörtern aus Hunderten von Sprachen und Dialekten aus dem Äther auf, um sie aufzuzeichnen, zu entschlüsseln, zu übersetzen und zu analysieren. Aber sie setzt keine Spionagesatelliten ein. Die optische Überwachung der Erde durch Kameras in Flugzeugen und vor allem in Satelliten ist stets Aufgabe der von der U. S. Air Force und der CIA gemeinsam betriebenen National Reconnaissance Office gewesen. Carl Taylor, der diese Dienststelle leitete, war ein Zweisternegeneral des Luftwaffen-Nachrichtendienstes.
Der Präsident schob die gestochen scharfen Satellitenfotos auf seinem Schreibtisch zu einem Stapel zusammen und gab sie Taylor zurück, der aufstand, um sie entgegenzunehmen und in seinen Aktenkoffer zu legen.
»Also gut, meine Herren«, sagte Matthews langsam, »Sie haben mir gezeigt, daß die Weizenernte in einem kleinen Teil der Sowjetunion verkümmert – vielleicht sogar nur auf den hier abgebildeten wenigen Hektaren. Was beweist das?«
Poklewski sah zu Taylor hinüber und nickte. Taylor räusperte sich.
»Mr. President, ich habe mir erlaubt, eine Direktübertragung von einem unserer Condor-Satelliten vorbereiten zu lassen. Möchten Sie sie sehen?«
Matthews nickte und folgte Taylor mit den Augen, als der an die Bücherschränke vor der sanft geschwungenen Westwand trat. Dort waren seit neuestem in der untersten Reihe Fernsehapparate eingebaut, die hinter Schiebetüren aus Teakholz verschwanden, wenn der Präsident offiziellen Besuch empfing. Taylor schaltete das Gerät ein, das sich ganz links außen in der Reihe befand, und kam an den Schreibtisch zurück. Er nahm einen der sechs Telefonhörer ab, wählte eine Nummer und sagte kurz: »Vorführen.«
Präsident Matthews war über die Condor-Satelliten informiert. Sie operierten mit noch empfindlicheren Kameras und aus noch größeren Höhen als früher und konnten Objekte von der Größe eines Fingernagels aus 300 Kilometern Entfernung selbst bei Nebel, Regen, Schnee und in absoluter Dunkelheit erfassen. Es waren die neuesten und besten Modelle.
In den siebziger Jahren war die fotografische Überwachung zwar gut, aber langsam gewesen. Die belichteten Filmpatronen mußten an bestimmten Positionen von den Satelliten ausgestoßen werden, um in ihren Schutzkapseln in freiem Fall zur Erde zu gelangen. Sie wurden mit Hilfe ihres Peilsenders aufgespürt, ins NRO-Zentrallabor geflogen, entwickelt und ausgewertet. Direktübertragungen von Satelliten waren nur möglich innerhalb der Flugabschnitte oder von einer der Relaisstationen, von denen eine gerade Verbindungslinie mit den USA hergestellt werden konnte. Bewegte sich ein Satellit aber über der Sowjetunion, verhinderte die Erdkrümmung einen Direktempfang, so daß die Beobachter warten mußten, bis der Satellit wieder ihre Station passierte.
Im Sommer 1978 fanden die Wissenschaftler die Parabel-Lösung, die es ermöglichte, jeden Himmelsspion direkt vom Weißen Haus abzufragen. Per Computer berechneten sie ein höchst kompliziertes Netz für die Flugbahnen von sechs erdumkreisenden Spionagesatelliten. Auf ein Signal hin übermittelte der jeweilige Satellit seine Bilder einem anderen Satelliten in seiner Reichweite, dieser zweite Satellit gab sie an einen dritten weiter, der das Material unter Umständen wiederum weiterreichte – wie Basketballspieler, die sich den Ball im Laufen zuspielen. Sobald die gewünschten Aufnahmen auf diese Weise in einer flachen Parabel bei einem Satelliten über den USA angelangt waren, wurden sie in die NRO-Zentrale übertragen.
Die Satelliten rasten mit 65 000 Stundenkilometern durch den Weltraum; die Erde drehte sich um ihre Achse und wies je nach geografischer Breite unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeiten auf. Die Überlagerung all dieser Bewegungen ergab eine astronomisch hohe Anzahl von Rechenschritten, aber die Computer schafften es. Im Jahre 1980 konnte der amerikanische Präsident auf einen Knopfdruck hin Tag und Nacht jeden Quadratzentimeter der Erdoberfläche betrachten.
Das beunruhigte ihn manchmal. Poklewski dagegen stieß sich nie daran; er war dazu erzogen worden, alle privaten Gedanken und Taten im Beichtstuhl zu offenbaren. Und die Condors glichen Beichtstühlen, mit ihm als Geistlichen, der er beinahe einmal geworden wäre.
Während der Bildschirm hell wurde, breitete General Taylor auf dem Schreibtisch des Präsidenten eine Karte der Sowjetunion aus und tippte mit dem Zeigefinger darauf.
»Was Sie jetzt sehen, Mr. President, kommt von Condor fünf. Er bewegt sich gerade zwischen Saratow und Perm nach Nordosten über dem neuen Weizenanbaugebiet und dem Schwarzerdegebiet.«
Matthews blickte zu dem Bildschirm hinüber. Der Ausschnitt eines etwa 30 Kilometer breiten Geländestreifens zog langsam vorbei. Der Boden schien kahl zu sein, wie im Herbst nach der Ernte. Taylor murmelte einige Anweisungen ins Telefon; Sekunden später verengte sich der Blickwinkel, und ein nur mehr fünf Kilometer breiter Abschnitt war zu sehen. Ein paar Bauernkaten, aus Holz gebaute Isbas, verloren in den endlosen Weiten der Steppe, schoben sich am linken Bildrand vorbei. Eine unbefestigte Straße kam ins Bild, blieb sekundenlang in der Mitte des Schirms und verschwand wieder. Taylor gab erneut leise Anweisungen, und das Bild konzentrierte sich auf einen 100 Meter breiten Geländestreifen. Die Einzelheiten traten schärfer hervor. Ein Mann mit einem Pferd tauchte auf.
»Nicht so schnell!« befahl Taylor am Telefon. Der Film rollte langsamer ab. Condor fünf behielt Höhe und Geschwindigkeit bei; in den NRO-Laboratorien wurden die Bildausschnitte verkleinert und das Wiedergabetempo verringert.
Das Bild rückte noch näher heran, wurde langsamer. An einem einzeln stehenden Baum stand ein russischer Bauer, der sich langsam die Hose aufknöpfte. Präsident Matthews war kein Mann der Technik und staunte deshalb jedesmal wieder. Da saß er an einem Frühlingstag in Washington in seinem Arbeitszimmer und beobachtete einen Mann, der irgendwo im Schatten des Urals an einen Baum urinierte. Der Bauer kam langsam am unteren Bildrand außer Sicht. Jetzt war auf dem Bildschirm ein mehrere hundert Morgen großes Weizenfeld zu sehen.
»Stop!« rief Taylor ins Telefon. Das Bild wurde langsamer, blieb stehen. »Nahaufnahme.«
Die Einzelheiten wurden größer und größer, bis der Bildschirm von etwa zwanzig jungen Weizenhalmen ausgefüllt war. Alle sahen dünn, schwach und krank aus. Matthews hatte solche Halme schon einmal gesehen; in seiner Kindheit vor fünfzig Jahren im Mittleren Westen – in einem Dürregebiet.
»Stan?« fragte der Präsident. Poklewski, der um diese Besprechung und die Vorführung gebeten hatte, wählte seine Worte sorgfältig.
»Mr. President, die Sowjetunion hat sich dieses Jahr eine Getreideernte von zweihundertvierzig Millionen Tonnen zum Ziel gesetzt. Nach Sorten lauten die Planziele folgendermaßen: hundertzwanzig Millionen Tonnen Weizen, sechzig Millionen Tonnen Gerste, vierzehn Millionen Tonnen Hafer, vierzehn Millionen Tonnen Mais, zwölf Millionen Tonnen Roggen und zwanzig Millionen Tonnen Reis, Hirse, Buchweizen und Leguminosen. Am wichtigsten sind natürlich Weizen und Gerste.«
Poklewski stand auf und trat an den Schreibtisch, auf dem noch immer die Karte der Sowjetunion ausgebreitet lag. Taylor schaltete das Fernsehgerät aus und nahm wieder Platz.
»Etwa vierzig Prozent der sowjetischen Getreideernte – ungefähr hundert Millionen Tonnen – kommen hier aus der Ukraine und dem Kubangebiet im Süden der Russischen Republik.« Poklewski umriß die Gebiete auf der Karte. »Hier wird nur Winterweizen angebaut, also Weizen, der im September und Oktober ausgesät wird. Wenn im November der erste Schnee fällt, haben die Körner bereits ausgetrieben. Der Schnee bedeckt die jungen Pflanzen und schützt sie vor den harten Frösten.«
Poklewski, der die Angewohnheit hatte, beim Sprechen auf und ab zu wandern, löste sich vom Schreibtisch und ging auf die leicht geschwungenen, wandhohen Fenster hinter dem Sessel des Präsidenten zu.
Von der Pennsylvania Avenue aus ist das Ovale Zimmer auf der Rückseite des kleinen Westflügels nicht einzusehen. Aber die nach Süden gehenden Fenster sind von dem etwa einen Kilometer entfernten Washington Monument gerade noch zu erkennen. Sie wurden für den Fall, daß ein Scharfschütze sein Glück vom Denkmal aus versuchen könnte, schon vor langem mit 15 Zentimeter dickem, grün gefärbtem Panzerglas gesichert. Als Poklewski sie erreichte, wirkte sein blasses Gesicht in dem grünlichen Licht noch blasser. Er machte kehrt und kam zurück, als Matthews sich eben mit seinem Drehsessel nach ihm umwenden wollte.
»In den ersten Dezembertagen des vergangenen Jahres hat es in der Ukraine und am Kuban überraschend getaut. Das hat es auch früher gegeben – aber so warm ist es um diese Zeit noch nie gewesen. Eine Warmluftfront ist vom Bosporus über das Schwarze Meer nach Nordosten in die Ukraine und das Kubangebiet vorgedrungen. Nach einer Woche hatte sich die fünfzehn Zentimeter hohe Schneedecke in Wasser verwandelt. Die jungen Weizen- und Gerstenhalme waren ungeschützt. Wie’s der Teufel will, trat zehn Tage später das andere Extrem auf: strenger Frost mit fünfundzwanzig bis dreißig Grad unter Null.«
»Was dem Weizen bestimmt geschadet hat«, ergänzte der Präsident.
»Mr. President«, mischte sich Robert Benson von der CIA ein, »unsere besten Landwirtschaftsexperten sind sich darüber einig, daß die Sowjets von Glück sagen können, wenn sie fünfzig Prozent dieser Ernte retten können. Die schweren Schäden sind praktisch irreparabel.«
»Also das haben Sie mir eben vorgeführt?« fragte Matthews.
»Nein, Sir«, antwortete Poklewski. »Der Film zeigte den Anlaß für diese Besprechung. Die restlichen sechzig Prozent der sowjetischen Getreideernte, etwa hundertvierzig Millionen Tonnen, kommen aus neuen Anbaugebieten. Sie wurden Anfang der sechziger Jahre unter Chruschtschow erstmals unter den Pflug genommen. Es handelt sich dabei um das Schwarzerdegebiet, das an den Ural grenzt, und um kleine Regionen jenseits des Gebirges in Sibirien. Diese Anbauflächen haben wir Ihnen gezeigt.«
»Und was ist mit denen los?« fragte Matthews.
»Etwas ist merkwürdig, Sir. Mit dem sowjetischen Getreide stimmt irgendwas nicht. Bei diesen restlichen sechzig Prozent handelt es sich um Sommerweizen, der nach dem Tauwetter im März und April ausgesät worden ist. Er müßte jetzt frisch und grün auf den Feldern stehen. Statt dessen ist er dünn und verkümmert, als sei er von einer Art Mehltau befallen.«
»Ist daran auch das Wetter schuld?« fragte Matthews.
»Nein. Das Frühjahr ist in diesem Gebiet zwar ziemlich feucht gewesen, aber das war nicht weiter schlimm. Jetzt ist das Wetter ideal – warm und trocken.«
»Wie verbreitet ist dieser – Mehltau?«
Benson meldete sich wieder zu Wort. »Das wissen wir nicht, Mr. President. Wir haben ungefähr fünfzig Filme, auf denen dieses eigenartige Phänomen zu erkennen ist. Normalerweise konzentrieren wir uns auf Militäreinrichtungen, Truppenverschiebungen, neue Raketenstellungen und Rüstungsfabriken. Aber aus unseren Unterlagen geht hervor, daß die Sache ziemlich weit verbreitet sein muß.«
»Was haben Sie also vor?«
»Wenn Sie einverstanden sind, möchten wir uns ausführlicher mit diesem Problem befassen, um herauszubekommen, was es für die Sowjets bedeutet«, sagte Poklewski. »Wir müßten versuchen, sowohl Delegationen als auch Geschäftsleute in die Sowjetunion zu schicken. Wir sollten einige Beobachtungssatelliten von weniger wichtigen Zielen abziehen. Wir sind überzeugt, daß es für Amerika von lebenswichtigem Interesse ist, genau festzustellen, was da auf Moskau zukommt!«
Matthews überlegte, während er auf seine Uhr sah. In zehn Minuten sollte er eine Gruppe von Umweltschützern empfangen, die ihm eine weitere Plakette überreichen würde. Und für den späten Vormittag hatte sich der Justizminister wegen Ergänzungen zum Arbeitsrecht angesagt. Er stand auf.
»Gut, meine Herren, ich bin einverstanden. Das scheint eine Sache zu sein, über die wir informiert sein sollten. Aber in spätestens vier Wochen will ich Ergebnisse sehen!«
Zehn Tage später saß General Taylor in Robert Bensons Büro im sechsten Stock in Langley und blätterte in dem von ihm verfaßten Bericht, der zusammen mit einem dicken Stapel Fotos auf dem Couchtisch vor ihm lag.
»Eine komische Sache, Bob«, meinte er. »Ich werde einfach nicht schlau daraus …«
Benson, der Direktor der Central Intelligence, der DCI, wandte sich von den großen Panoramafenstern ab, die sich über die ganze Wandbreite erstrecken und nach Nordnordwesten gehen, wo der Potomac unter den Bäumen vorbeifließt. Wie seine Vorgänger genoß Benson diese Aussicht – vor allem im Frühling und Frühsommer, wenn der Wald ein Meer aus zartem Grün bildet. Er ließ sich in einen Sessel gegenüber Taylor fallen.
»Meine Landwirtschaftsexperten auch nicht, Carl. Und ich habe keine Lust, mich ans Landwirtschaftsministerium zu wenden. Was auch in Rußland passiert, wir dürfen die Sache nicht an die große Glocke hängen. Wenn ich irgendwelche Außenstehenden hinzuziehe, landet das Ganze eine Woche später bei einer Zeitung. Also, was haben Sie rausgekriegt?«
»Na ja, unsere Aufnahmen zeigen, daß der Mehltau oder was immer es ist, nicht allgemein verbreitet ist«, antwortete Taylor. »Er tritt nicht einmal flächenweise auf. Das ist eben das Verrückte! Wäre das Klima daran schuld, müßten Wetterstürze aufgetreten sein. Aber die hat es nicht gegeben. Wenn es sich um eine Pflanzenkrankheit oder um Schädlingsbefall handelte, wären zumindest bestimmte Gebiete betroffen. Aber die Streuung ist rein zufällig. Schwache, verkümmerte Pflanzen wechseln mit kräftigen, kerngesunden Trieben ab. Die Condor-Aufklärung läßt keine logische Verteilung erkennen. Wie sieht’s bei Ihnen aus?«
Benson nickte zustimmend.
»Es ist tatsächlich nicht logisch. Ich habe ein paar von unseren Leuten losgeschickt, damit sie die Schäden vor Ort begutachten, aber ihre Berichte sind noch nicht da. Die sowjetische Presse läßt nichts verlauten. Meine Landwirtschaftsexperten haben sich lange mit Ihren Aufnahmen befaßt. Sie können sich die Sache nur mit einer Saatgut- oder Bodenkrankheit erklären. Aber auch sie haben keine Erklärung für die scheinbar zufällige Verteilung. Sie haben so etwas noch nie gesehen. Entscheidend ist jedoch, daß ich dem Präsidenten eine Schätzung über die für dieses Jahr zu erwartende Getreideernte vorlegen soll – und zwar bald!«
»Ich kann unmöglich jedes verdammte Weizen- und Gerstenfeld in der Sowjetunion fotografieren, selbst mit den Condors nicht«, protestierte Taylor. »Das würde Monate dauern. Habe ich soviel Zeit?«
»Auf keinen Fall!« wehrte Benson ab. »Ich brauche Informationen über die Truppenbewegungen an der chinesischen Grenze und über die Konzentrationen an den Grenzen zur Türkei und zum Iran. Außerdem ist die ständige Überwachung der Roten Armee in der DDR und der Ausbau der Stellungen für die SS 20 hinter dem Ural wichtig.«
»Unter diesen Umständen kann ich nur anhand unserer Aufnahmen Durchschnittswerte ermitteln und die auf die gesamte Sowjetunion umrechnen lassen«, sagte Taylor.
»Aber sie müssen stimmen«, betonte Benson. »Ich will keinen Reinfall wie vor fünf Jahren erleben.«
Obwohl Taylor damals noch nicht NRO-Direktor gewesen war, zuckte er bei dem Gedanken an diesen Vorfall zusammen. Im Jahre 1977 waren die amerikanischen Geheimdienste auf einen Riesenschwindel der Sowjetunion hereingefallen. Die Sachbearbeiter der CIA und des Landwirtschaftsministeriums hatten dem Präsidenten den ganzen Sommer über versichert, die sowjetische Getreideernte werde etwa 215 Millionen Tonnen betragen. Rußlandbesuchern waren prächtig wogende Weizenfelder gezeigt worden – wie sich später herausstellte, hatte es sich bei ihnen um Ausnahmen gehandelt. Luftaufnahmen waren fehlerhaft ausgewertet worden. Im Herbst hatte der damalige Parteichef Leonid Breschnew seelenruhig verkündet, die sowjetische Ernte werde sich nur auf 194 Millionen Tonnen belaufen.
Daraufhin war der Preis für amerikanischen Überschußweizen emporgeschnellt. Schließlich stand fest, daß die Russen fast 20 Millionen Tonnen Getreide würden dazukaufen müssen. Aber es war zu spät. Mit Hilfe französischer Mittelsmänner hatte Moskau bereits im Sommer Lieferverträge über die benötigten Mengen abgeschlossen – zum alten, niedrigen Preis. Durch Strohmänner hatten die Russen sogar Trockengutfrachter gechartert, die sie von ihrem Kurs auf Westeuropa in sowjetische Häfen umdirigierten. Dieser Reinfall war in Langley unter dem Codewort »Stachel« bekannt.
Carl Taylor stand auf. »Okay, Bob, dann knipse ich also fröhlich weiter.«
»Carl!« rief der DCI ihm nach, als Taylor schon im Begriff war, das Zimmer zu verlassen. »Hübsche Bildchen genügen nicht. Ich will, daß die Condors ab ersten Juli wieder Militärziele überwachen. Machen Sie mir die genaueste Ernteschätzung, die bis Ende dieses Monats möglich ist – und seien Sie lieber etwas zu vorsichtig damit. Und falls Ihre Leute irgend etwas entdecken, das eine Erklärung für dieses Phänomen sein könnte, nehmen Sie’s sofort noch mal auf. Wir müssen irgendwie rauskriegen, was zum Teufel mit dem russischen Weizen los ist!«
Präsident Matthews’ Condor-Satelliten sahen fast alles in der Sowjetunion. Aber sie konnten nicht Harold Lessing, einen der drei Ersten Sekretäre in der Handelsabteilung der Britischen Botschaft in Moskau, am nächsten Morgen an seinem Schreibtisch beobachten. Das war vielleicht ganz gut so, denn Lessing selbst hätte als erster zugegeben, daß er keinen erbaulichen Anblick bot. Er war leichenblaß und fühlte sich todkrank.
Das Hauptgebäude der Britischen Botschaft ist ein schönes altes Herrenhaus aus der Zeit vor der Oktoberrevolution, das am Maurice-Thorez-Kai an der Moskwa genau gegenüber der Südmauer des Kremls steht. In der Zarenzeit Eigentum eines reichen Zuckerhändlers, wurde es kurz nach der Revolution von den Briten für billiges Geld gekauft. Seither bemüht sich die sowjetische Regierung, die Briten da wieder hinauszubefördern. Stalin haßte das Gebäude; jeden Morgen sah er beim Aufstehen den Union Jack auf dem anderen Flußufer in der Morgenbrise flattern und ärgerte sich.
Was die Handelsabteilung betrifft, so hat sie nicht das Glück, in diesem eleganten beige-goldenen Herrenhaus zu residieren. Sie arbeitet in einem nach dem Krieg errichteten häßlichen Bürohaus, das sich drei Kilometer von der Botschaft entfernt am Kutusow-Prospekt erhebt, fast genau gegenüber dem im Zuckerbäckerstil erbauten Hotel Ukraina. Auf demselben Grundstück, dessen einziger Eingang von mehreren aufmerksamen Milizsoldaten bewacht wird, stehen noch ein paar heruntergekommene Apartmenthäuser, in denen die Mitarbeiter von über zwei Dutzend Botschaften wohnen. Der ganze Komplex wird Korpus Diplomatik oder Diplomatenlager genannt.
Harold Lessing hatte sein Büro im obersten Stock des Verwaltungsgebäudes. Als er an diesem strahlenden Maitag schließlich gegen 10 Uhr 30 ohnmächtig wurde, riß er sein Telefon mit sich zu Boden und alarmierte auf diese Weise seine Sekretärin im Nebenzimmer. Die Sekretärin, eine ruhige und tüchtige Person, verständigte den Leiter der Handelsabteilung. Auf dessen Veranlassung hin wurde Lessing, der inzwischen wieder zu sich gekommen, aber noch benommen war, auf seinem Weg aus dem Gebäude über den Parkplatz zu seiner 100 Meter entfernten Wohnung im fünften Stock des Korpus 6 von zwei jungen Attachés begleitet. Außerdem informierte der Abteilungsleiter den Kanzler in der Botschaft am Maurice-Thorez-Kai und bat ihn, den Botschaftsarzt herüberzuschicken. Nachdem Lessing in seiner Wohnung untersucht worden war, wollte der Arzt kurz nach 11 Uhr den Leiter der Handelsabteilung unterrichten. Zu seiner Überraschung schnitt ihm dieser das Wort ab und schlug vor, in die Botschaft hinüberzufahren und den Kanzler zu dem Gespräch hinzuzuziehen. Erst später erkannte der Mediziner – ein einfacher praktischer Arzt aus England, der sich für drei Jahre nach Moskau verpflichtet hatte und im Rang eines Ersten Sekretärs stand –, warum dieser Umzug nötig war. Der Botschaftskanzler ging mit ihnen in einen bestimmten Raum des Hauptgebäudes, der im Gegensatz zu den Büros der Handelsabteilung abhörsicher war.
»Lessing hat ein aufgebrochenes Magengeschwür«, erklärte der Arzt den beiden Diplomaten. »Er scheint seit Wochen, vielleicht Monaten an etwas herumgedoktert zu haben, das er für Magensäureüberschuß gehalten hat. Hat es auf Überarbeitung zurückgeführt und massenweise Tabletten geschluckt. Natürlich Unsinn; er hätte zu mir kommen sollen.«
»Muß er ins Krankenhaus?« fragte der Kanzler, während er angelegentlich die Zimmerdecke betrachtete.
»Unbedingt!« antwortete der Arzt. »Ich werde dafür sorgen, daß er noch heute nachmittag aufgenommen wird. Bei den russischen Kollegen ist er in guten Händen.«
Schweigend wechselten die beiden Diplomaten einen Blick. Der Leiter der Handelsabteilung schüttelte den Kopf. Beide Männer dachten das gleiche. Ihre Positionen bedingten, daß sie über Lessings wahre Aufgabe in der Botschaft unterrichtet waren. Der Arzt aber wußte davon nichts. Schließlich ergriff der Botschaftskanzler das Wort.
»Das ist leider nicht möglich«, sagte er höflich. »Nicht in diesem Fall. Lessing muß mit der Nachmittagsmaschine nach Helsinki geflogen werden. Können Sie dafür sorgen, daß er reisefähig ist?«
»Aber warum …«, begann der Arzt. Er brachte seinen Satz nicht zu Ende. Plötzlich war ihm klar, warum sie für dieses Gespräch drei Kilometer weit gefahren waren. Lessing mußte der Mann des Secret Intelligence Service in Moskau sein. »Nun ja … Er steht unter Schock und hat ungefähr einen halben Liter Blut verloren. Ich habe ihm hundert Milligramm Pethidin zur Beruhigung gegeben. Um drei Uhr nachmittags könnte er noch einmal eine Spritze bekommen. Wenn er zum Flughafen gefahren wird und jemand während des Fluges bei ihm ist, wird er wohl bis Helsinki durchhalten. Aber dort muß er sofort in ein Krankenhaus. Ich würde am liebsten selber mitfliegen, damit nichts schiefgeht. Ich könnte morgen zurückkommen.«
Der Botschaftskanzler stand auf. »Sehr gut!« meinte er entschieden. »Nehmen Sie ruhig noch einen Tag Urlaub dazu. Und meine Frau würde Ihnen gern eine kleine Einkaufsliste mitgeben, wenn Sie so freundlich wären. Ja? Vielen Dank, Doktor. Ich veranlasse alles Nötige von hier aus.«
In Zeitungen, Illustrierten und Büchern gilt seit Jahren ein bestimmtes Bürogebäude im Londoner Stadtteil Lambeth als Hauptquartier des britischen Secret Intelligence Service, auch SIS oder MI 6 genannt. Die Mitarbeiter der »Firma« amüsieren sich im stillen darüber, denn in Lambeth arbeitet nur eine tüchtige Tarnorganisation. Auf ähnliche Weise wird im Leconfield House in der Curzon Street, das noch immer als Hauptquartier der Spionageabwehr, der MI 5, gilt, eine Scheinorganisation am Leben erhalten, um ungebetene Besucher zu täuschen. In Wirklichkeit haben die Abwehragenten schon seit Jahren nicht mehr ihre Büros in der Nähe des Playboy Clubs.
Das eigentliche Hauptquartier des geheimsten Geheimdienstes der Welt ist ein modernes Bürogebäude aus Glas und Stahlbeton. Es wurde im Auftrag der Regierung ganz in der Nähe eines der südlichen Londoner Bahnhöfe errichtet und Anfang der siebziger Jahre bezogen.
Die Nachricht von Lessings Erkrankung erreichte den SIS-Generaldirektor nach dem Mittagessen in seinem geräumigen Arbeitszimmer in der obersten Etage, durch dessen getönte Scheiben man auf den Big Ben und die Parlamentsgebäude auf dem anderen Flußufer blickt. Am Haustelefon war der Personalchef, auf dessen Schreibtisch der Text aus der Entschlüsselungsabteilung gelandet war. Der Generaldirektor hörte aufmerksam zu.
»Wie lange ist er außer Gefecht?« fragte er schließlich.
»Sicher ein paar Monate«, antwortete der Personalchef. »Einige Wochen Krankenhausaufenthalt in Helsinki, dann eine Zeit bei sich zu Hause. Und anschließend wahrscheinlich noch drei bis vier Wochen Erholungsurlaub.«
»Sehr bedauerlich«, meinte der Generaldirektor. »Dann müssen wir ihn so schnell wie möglich ersetzen.«
Sein gutes Gedächtnis sagte ihm, daß Lessing zwei russische Agenten geführt hatte: niedrige Dienstgrade in der Roten Armee und beim sowjetischen Außenministerium – nichts Weltbewegendes, aber doch Nützliches.
»Benachrichtigen Sie mich, sobald Lessing in Helsinki sicher untergebracht ist. Und schlagen Sie mir bitte bis spätestens heute abend zwei bis drei Ersatzleute vor.«
Sir Nigel Irvine war der dritte Berufsagent, der zum Generaldirektor des SIS oder der »Firma«, wie sie in einschlägigen Kreisen heißt, aufgestiegen war.
Die weitaus größere amerikanische CIA, von Profis wie Allan Dulles aufgebaut und zum Gipfel des Erfolgs geführt, war infolge ihrer selbstherrlichen Machtausübung in den frühen siebziger Jahren schließlich der Kontrolle eines Außenstehenden, des Admirals Stanfield Turner, unterstellt worden. Eine Ironie des Schicksals wollte es, daß die britische Regierung sich zur gleichen Zeit endlich für das genaue Gegenteil entschlossen und mit der Tradition, die Firma von einem bewährten Mann aus dem Außenministerium leiten zu lassen, gebrochen hatte. Sie ernannte einen Profi zum SIS-Generaldirektor.
Das Risiko hatte sich gelohnt. Die Firma hatte lange unter den Nachwirkungen der Affären Burgess, MacLean und Philby gelitten, und Sir Nigel war fest entschlossen, dafür zu sorgen, daß auch nach Ablauf seiner Dienstzeit die Reihe der Professionellen an der Spitze der Firma fortgesetzt würde. Aus diesem Grund war er ebenso wie jeder seiner unmittelbaren Amtsvorgänger peinlich darauf bedacht, keine ehrgeizigen Einzelkämpfer aufsteigen zu lassen.
»Wir sind ein Dienst und keine Trapeztruppe«, erklärte er den Neuen in Beaconsfield jedesmal bei der Begrüßung. »Wir sind nicht da, um Applaus einzuheimsen.«
Es war bereits dunkel, als Sir Nigel die drei Personalakten auf den Schreibtisch bekam, aber er wollte die Wahl noch an diesem Tag treffen und nahm dafür Überstunden in Kauf.
Er verbrachte eine Stunde damit, die Unterlagen durchzusehen, obwohl eigentlich schnell feststand, für wen er sich entscheiden würde. Schließlich rief er den Personalchef an, der ebenfalls noch im Hause war, und bat ihn zu sich herauf. Zwei Minuten später führte seine Sekretärin den Abteilungsleiter in sein Büro.
Sir Nigel, ein liebenswürdiger Gastgeber, schenkte seinem Besucher und sich einen Whisky-Soda ein. Nicht bereit, auf die Annehmlichkeiten des Lebens zu verzichten, hatte er sich sein Arbeitszimmer geschmackvoll eingerichtet – vielleicht als Entschädigung für seinen Fronteinsatz in den Jahren 1944/45 und die heruntergekommenen Wiener Hotels, in denen er Ende der vierziger Jahre als junger Agent der Firma gehaust hatte. Damals hatte er Russen in der sowjetisch besetzten Zone Österreichs anzuwerben versucht. Er konnte mit sich zufrieden sein: Zwei seiner damals angeworbenen Informanten, sogenannte »Schläfer«, die sich jahrelang still verhalten hatten, arbeiteten noch heute für den SIS.
Obwohl der SIS in einem modernen Gebäude aus Stahl, Beton und Glas untergebracht war, dominierte im Arbeitszimmer des Generaldirektors ein älterer, eleganterer Stil. Die Tapete war in warmem Hellbraun gehalten, der Spannteppich in dunklem Orange. Der Schreibtisch mit dem Lehnstuhl, die beiden Besuchersessel und das schwarze Ledersofa waren echte alte Stücke.
Aus den Kunst-Beständen des Staates, die den britischen Behördenchefs für die Ausschmückung ihrer Arbeitszimmer zur Verfügung stehen, hatte Sir Nigel sich einen Dufy, einen Vlaminck und einen möglicherweise tatsächlich echten Breughel ausgesucht. Er hatte auch mit einem kleinen, exquisiten Fragonard geliebäugelt, der ihm dann aber von einem Emporkömmling aus dem Schatzamt vor der Nase weggeschnappt worden war.
Im Gegensatz zum Außenministerium, an dessen Wänden Ölporträts früherer Minister wie Canning und Grey hängen, hat die Firma von jeher eine Ahnengalerie abgelehnt. Wahrscheinlich hätten auch die auf äußerste Zurückhaltung bedachten englischen Spitzenspione wenig Wert darauf gelegt, ihre Bilder in der Öffentlichkeit zu sehen. Auch Porträts der Königin in vollem Ornat waren nicht sonderlich beliebt, während im Weißen Haus und in Langley die Wände mit signierten Fotos des jeweiligen Präsidenten bepflastert waren.
»Daß man in diesem Gebäude für Königin und Vaterland arbeitet, braucht nicht eigens unterstrichen zu werden«, war einem erstaunten CIA-Mann aus Langley einmal erklärt worden. »Wer das nicht weiß, würde ohnehin hier nicht arbeiten.«
Sir Nigel wandte sich von seinem angelegentlichen Studium der Lichter jenseits der Themse ab.
»Sieht so aus, als müßten wir Munro nehmen, nicht wahr?« fragte er.
»Ja, das glaube ich auch«, antwortete der Personalchef.
»Was für ein Mensch ist er? Ich habe seine Akte gelesen und kenne ihn nur flüchtig. Wie ist Ihr persönlicher Eindruck?«
»Er ist schweigsam.«
»Gut.«
»Neigt zum Einzelgängertum.«
»Schlecht.«
»Seine Russischkenntnisse dürften entscheidend sein«, sagte der Personalchef. »Die beiden anderen sprechen passables Russisch. Munro dagegen kann sich glatt als Russe ausgeben. Was er normalerweise nicht tut. Offiziell spricht er mit starkem Akzent und keineswegs fehlerfrei. Sobald er diese Tarnung aufgibt, ist er nicht mehr von einem Einheimischen zu unterscheiden. Bei einer so kurzfristigen Übernahme von Mäusebussard und Moorente wären hervorragende Russischkenntnisse von Vorteil.«
Mäusebussard und Moorente waren die Codenamen der beiden von Lessing rekrutierten und geführten Informanten. Russische Agenten der Firma in der Sowjetunion erhalten im allgemeinen Vogelnamen, deren Anfangsbuchstabe auf den Zeitpunkt der Rekrutierung hinweist. Die beiden mit dem Buchstaben M waren erst vor kurzem angeworben worden. Sir Nigel knurrte.
»Gut, wir nehmen Munro. Wo ist er jetzt?«
»Im Ausbildungszentrum in Beaconsfield. Gibt praktischen Unterricht.«
»Lassen Sie ihn morgen nachmittag herkommen. Da er ledig ist, kann er vermutlich sofort abreisen. Er soll nicht lange herumsitzen. Ich besorge morgen früh die Zustimmung des Außenministeriums zu seiner Ernennung als Lessings Nachfolger in der Handelsabteilung.«