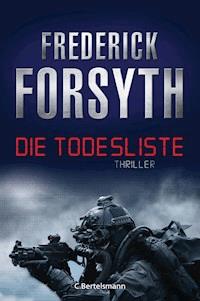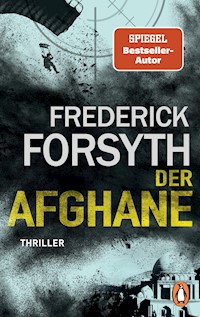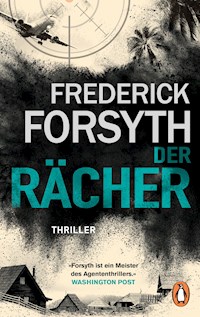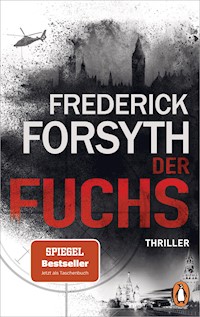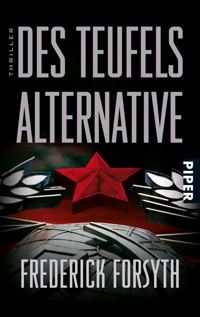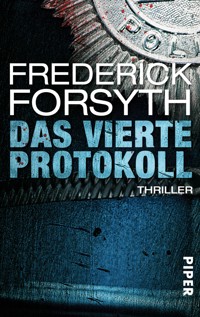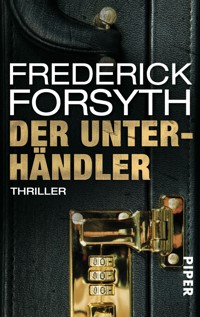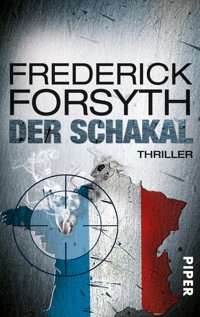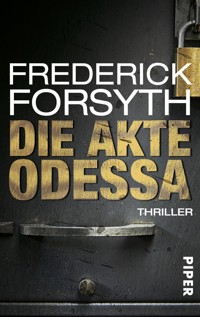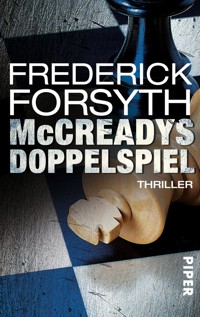
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Veränderung der politischen Landkarte hat auch Folgen für den britischen Geheimdienst. Sam McCready, genannt »der Täuscher« und Spezialist für verdeckte Aktionen, rollt die riskanten Operationen hinter den weltpolitischen Fronten auf: die lautlosen Kriege der Agenten und Spione, ihre Doppelspiele zwischen Moskau und der Karibik, dem Nahen Osten und Washington.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Englischen von Christian Spiel und Rudolf Hermstein
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96439-5
© 1991 Frederick Forsyth Titel der englischen Originalausgabe: »The Deceiver«, Bantam Press, London 1991 Deutschsprachige Ausgabe: © 1991 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur Umschlagmotiv: Gregor Schuster/Corbis Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
London, Century House
Im Sommer des Jahre 1983 hob der damalige Chef des britischen Geheimdienstes SIS gegen einen gewissen Widerstand innerhalb seiner Behörde eine neue Abteilung aus der Taufe.
Die Opposition ging vor allem von den etablierten Abteilungen aus, die fast alle territoriale »Lehen« in sämtlichen Weltgegenden hatten, denn die neue Abteilung sollte umfassende Kompetenzen erhalten, die in andere Zuständigkeitsbereiche eingriffen.
Die Einrichtung der neuen Abteilung ging im wesentlichen auf zwei Gründe zurück. Der eine war die Hochstimmung, die nach dem britischen Erfolg im Falklandkrieg des Vorjahres in Westminster und Whitehall, vor allem aber innerhalb der konservativen Regierung herrschte. Trotz des militärischen Sieges hatte die Episode zu einer unerquicklichen und zuweilen giftigen Auseinandersetzung um die Frage geführt: Wie konnte es geschehen, daß wir derart überrumpelt wurden, als General Galtieris Streitkräfte in Fort Stanley landeten?
Zwischen den Ressorts schwelte der Streit über ein Jahr lang, und unvermeidlich verkam er zu Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen nach dem Motto: Wir-wurden-nicht-gewarnt-Doch-ihr-wurdet-gewarnt. Der Außenminister, Lord Carrington, sah sich genötigt, seinen Hut zu nehmen. Jahre später brach in den USA ein ähnlicher Zwist aus, als nach der Zerstörung der Pan-Am-Maschine über Lockerbie ein Geheimdienst behauptete, er habe eine Warnung weitergegeben, und ein anderer, er habe sie nie erhalten.
Den zweiten Anstoß lieferte der Umstand, daß Juri W. Andropow, fünfzehn Jahre lang KGB-Chef, in die höchste Machtposition gelangt war, als er Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wurde. Unter Andropow, der seinem alten Geheimdienst die Gunst bewahrte, weitete der KGB seine aggressive Spionage und die sogenannten »aktiven Maßnahmen« gegen den Westen stark aus. Es war bekannt, daß Andropow, was die »aktiven Maßnahmen« anging, das Mittel der Desinformation bevorzugte: Lügen, demoralisierende Propaganda, gezielte Irreführung.
Margaret Thatcher, die sich zu jener Zeit ihren (von sowjetischer Seite verliehenen) Titel der »Eisernen Lady« verdiente, vertrat die Ansicht, daß man den Spieß auch umdrehen könne, und ließ durchblicken, sie würde nicht gerade erschrecken bei der Vorstellung, daß Englands eigener Geheimdienst den Sowjets auf diesem Gebiet ein wenig Kontra gäbe.
Die neue Abteilung erhielt einen höchst gewichtigen Namen: Deception, Disinformation and Psychological Operations (Täuschung, Desinformation und psychologische Operationen). Die Bezeichnung wurde natürlich sofort auf DD and P und schließlich nur noch auf DD verkürzt.
Ein neuer Abteilungschef wurde ernannt. So wie der Mann, der für das Gerät zuständig war, Der Quartiermeister, und der Mann, dem die Rechtsabteilung unterstand, Der Anwalt hieß, so wurde dem neuen Chef von DD von irgendeinem Witzbold in der Kantine der Beiname Der Täuscher verpaßt.
Im Besitz der Weisheit des Hinterher-Wissens, jener kostbaren Gabe, die viel häufiger gewährt wird als ihr Gegenstück, die kluge Voraussicht, hätte man (was später auch geschah) an der Wahl Sir Arthurs, des SIS-Chefs, Kritik üben können. Seine Wahl fiel nicht auf einen Karrierebeamten aus der Chefetage, gewohnt, Umsicht und Bedeutsamkeit walten zu lassen, wie es einem wahren Beamten ansteht, sondern auf einen ehemaligen Außenagenten, der der Abteilung DDR angehörte.
Der Mann hieß Sam McCready, und er leitete die neue Abteilung sieben Jahre lang. Aber alle guten Dinge haben einmal ein Ende. Im Spätfrühjahr 1990 fand im Herzen des Regierungsviertels Whitehall ein Gespräch statt …
Der junge Sekretär erhob sich mit einem geübten Lächeln hinter seinem Schreibtisch im Vorzimmer.
»Ah, Sir Mark. Der Herr Staatssekretär hat Weisung erteilt, Sie sofort zu ihm zu führen.«
Er öffnete die Tür zum Privatbüro des Beamteten Staatssekretärs im Außen- und Commonwealth-Ministerium, ließ den Besucher eintreten und schloß hinter ihm die Tür. Der Staatssekretär, Sir Robert Inglis, begrüßte seinen Gast mit betonter Freundlichkeit.
»Mark, mein lieber Junge, wie nett von Ihnen, daß Sie gekommen sind.«
Man wird nicht Chef des SIS, ohne – auch wenn man erst kurz im Amt war – ein gewisses Mißtrauen zu entwickeln, wenn einem ein Mann, den man kaum kennt, mit solcher Herzlichkeit entgegentritt und sich sichtlich anschickt, einen wie einen Blutsbruder zu behandeln. Sir Mark wappnete sich für ein heikles Gespräch.
Als er wieder saß, öffnete der höchste Beamte im Außenministerium die abgenützte Kuriertasche, die auf seinem Schreibtisch lag, und entnahm ihr ein lederbraunes Dossier, geschmückt mit dem roten diagonalen Kreuz, das je zwei Ecken miteinander verbindet.
»Sie haben eine Inspektionsreise durch Ihre Provinzen hinter sich und werden mir zweifellos Ihre Eindrücke schildern, nicht?« fragte er.
»Gewiß, Robert – zu gegebener Zeit.«
Sir Robert Inglis ließ auf das streng geheime Dossier eine Mappe folgen, deren Rücken eine schwarze Kunststoffspirale bildete.
»Ich habe«, begann er, »Ihre Vorschläge ›Der SIS in den neunziger Jahren‹ zusammen mit der neuesten Einkaufsliste des Koordinators der Geheimdienste gelesen. Sie haben, wie es scheint, seinen Anforderungen vollkommen entsprochen.«
»Danke, Robert«, sagte der SIS-Chef. »Ich darf also mit der Unterstützung des Außenministeriums rechnen?«
Das Lächeln des Diplomaten hätte in einer amerikanischen Quiz-Sendung Preise errungen.
»Mein lieber Mark, wir haben keine Schwierigkeiten mit dem Tenor Ihrer Vorschläge. Aber einige wenige Punkte würde ich doch gern mit Ihnen durchsprechen.«
Aha, jetzt kommt’s, dachte der SIS-Chef.
»Darf ich es beispielsweise so verstehen, daß diese zusätzlichen Auslandsfilialen, die Sie vorschlagen, die Zustimmung des Schatzamtes gefunden haben und die notwendigen Gelder in irgendein Budget eingeschmuggelt worden sind?«
Den beiden Männern war natürlich bestens bekannt, daß das Budget für den Unterhalt des SIS nicht zur Gänze vom Foreign Office bestritten wird. Ja, tatsächlich stammt nur ein kleiner Teil aus dem Budget des Außenministeriums. Die tatsächlichen Aufwendungen für den beinahe unsichtbaren SIS, der sich, anders als die amerikanische CIA, ungemein zurückhält, werden auf alle Ministerien aufgeteilt. Einen Beitrag muß, überraschenderweise, sogar das Ministerium für Landwirtschaft, Fischwirtschaft und Ernährung leisten – vielleicht weil man dort eines Tages möglicherweise wissen möchte, wieviel Tonnen Kabeljau die Isländer aus dem Nordatlantik holen.
Weil die Zuschüsse für den SIS so breit verteilt und so gut versteckt sind, kann das Außenministerium mit der Drohung, Gelder zurückzuhalten, wenn seinen Wünschen nicht entsprochen wird, den SIS nicht unter Druck setzen. Sir Mark nickte.
»In diesem Punkt gibt es keine Probleme. Der Koordinator und ich waren im Schatzamt. Wir haben die Situation geschildert, und das Schatzamt hat die notwendigen Summen bewilligt, alle in den Forschungs- und Entwicklungsbudgets der Ministerien versteckt, wo man sie am wenigsten vermutet.«
»Ausgezeichnet«, sagte der Staatssekretär strahlend, ob seine Zufriedenheit nun echt war oder nicht. »Dann wollen wir uns jetzt einmal etwas vornehmen, was nun wirklich in meinen Zuständigkeitsbereich fällt.
Ich weiß nicht, wie Sie zur Personalproblematik stehen, aber wir sehen uns gewissen Schwierigkeiten gegenüber, was den gestiegenen Personalbedarf für den diplomatischen Dienst betrifft, der sich als Folge der Beendigung des Kalten Krieges und der Befreiung von Ländern in Mittel- und Osteuropa ergeben wird. Sie verstehen, was ich meine?«
Sir Mark wußte genau, was Sir Robert meinte. Der praktische Zusammenbruch des Kommunismus während der beiden vergangenen Jahre veränderte die diplomatische Karte des Globus, und zwar sehr rasch. Die britischen Diplomaten erhofften sich erweiterte Chancen überall in Mitteleuropa, Osteuropa und auf dem Balkan. Möglicherweise dachte man schon an Mini-Botschaften in Lettland, Estland und Litauen, falls es den baltischen Staaten gelingen sollte, sich von Moskau unabhängig zu machen. Damit gab Sir Robert zu verstehen, daß nun, da der Kalte Krieg das Zeitliche gesegnet hatte, die Situation für seine Kollegen vom Geheimdienst sich genau umgekehrt entwickeln werde. Das wollte Sir Mark nicht gelten lassen.
»Genauso wie Ihnen bleibt auch uns nichts anderes übrig, als Leute anzuwerben. Aber abgesehen davon nimmt allein die Ausbildung ein halbes Jahr in Anspruch; erst dann können wir einen Neuen ins Century House holen und einen, der schon Erfahrung gesammelt hat, ins Ausland schicken.«
Der Staatssekretär hörte zu lächeln auf und beugte sich mit ernster Miene vor.
»Mein lieber Mark. Damit sind wir genau bei dem Thema, über das ich mit Ihnen diskutieren wollte. Die Zuteilung von Räumen in unseren Botschaften und an wen.«
Sir Mark stöhnte innerlich. Der Kerl wollte ihm einen Tiefschlag verpassen. Das Außenministerium kann dem SIS zwar nicht im Punkt der etatmäßigen Ausstattung beikommen, hat aber immer eine Trumpfkarte in der Hinterhand. Die große Mehrzahl der im Ausland dienenden Geheimdienstmitglieder arbeitet unter dem Schutz der britischen Botschaften. Die betreffende Botschaft wird damit für sie zur Gastgeberin. Stellt die Botschaft keine Räume zur Verfügung, kann der SIS niemanden hinschicken.
»Und wie sehen Sie allgemein die Zukunft, lieber Robert?« fragte er.
»In Zukunft, fürchte ich, werden wir einfach nicht in der Lage sein, Alibijobs für einige Ihrer … exotischeren Mitarbeiter anzubieten. Beamte, die eindeutig enttarnt worden sind. Mit dem Messingtäfelchen ›Agent‹ an der Tür. Während des Kalten Krieges konnte man das akzeptieren, aber in dem neuen Europa würden sie nur Anstoß erregen. Ich bin überzeugt, daß Sie das einsehen.«
»Illegale« Agenten arbeiten nicht unter dem Schutz der Botschaft und interessierten daher Sir Robert Inglis nicht. Geheimdienstbeamte, deren Wirkungsbereich innerhalb der Botschaft war, waren entweder »dedared« oder »undeclared«.
»Declared« war ein Geheimdienstmann, dessen wirkliche Tätigkeit weithin bekannt war. In der Vergangenheit waren mit solchen Leuten in britischen Botschaften traumhafte Erfolge erzielt worden. Überall in der kommunistischen und in der Dritten Welt wußten Dissidenten, Oppositionelle und andere Unzufriedene, wem sie ihre Kümmernisse anvertrauen konnten wie einem Beichtvater. Eine reiche Ernte an Informationen wurde auf diese Weise eingefahren, so mancher prominente Überläufer zum Absprung veranlaßt.
Die Worte des Staatssekretärs bedeuteten, daß er solche Leute nicht mehr in den Botschaften haben wollte und ihnen keine Räume mehr zur Verfügung stellen würde. Sein ganzer Eifer galt dem Ziel, die schöne Tradition seines Ministeriums zu erhalten, allem, was nicht britisch war, mit Beschwichtigungspolitik zu begegnen.
»Ich höre, was Sie sagen, lieber Robert, aber ich kann und werde meine Amtszeit als SIS-Chef nicht damit beginnen, hochgestellte Beamte, die dem Amt lange, loyal und gut gedient haben, um ihre Posten zu bringen.«
»Suchen Sie andere Posten für sie«, schlug Sir Robert vor. »Zentralamerika, Südamerika, Afrika …«
»Ich kann sie doch nicht so lange nach Burundi verfrachten, bis sie das Pensionierungsalter erreicht haben.«
»Dann Verwaltungsarbeit. Hier zu Hause.«
»Sie meinen, was man als ›reizlose Beschäftigungen‹ bezeichnet«, sagte der SIS-Chef. »Die meisten werden so etwas nicht akzeptieren.«
»Dann müssen sie eben um ihre Frühpensionierung einkommen«, sagte der Diplomat glatt. Wieder beugte er sich nach vorne.
»Mark, mein lieber Junge, hier gibt es nichts zu verhandeln. Ich werde in diesem Punkt die Fünf Weisen auf meiner Seite haben, lassen Sie sich das gesagt sein. Ich gehöre ja selbst dazu. Wir werden uns bereitfinden, ansehnliche Entschädigungen …«
Die Fünf Weisen sind die Beamteten Staatssekretäre des Cabinet Office, des Außenministeriums, des Innenministeriums, des Verteidigungsministeriums und des Schatzamtes. Zusammen üben diese fünf Männer eine enorme Macht in den Korridoren der Regierung aus. Unter anderem ernennen sie den SIS-Chef und den Generaldirektor des Security Service MI-5. (Beziehungsweise sie sprechen gegenüber dem Premierminister entsprechende Empfehlungen aus, was praktisch auf das gleiche hinausläuft.) Sir Mark war zwar todunglücklich, aber er kannte die Realitäten der Macht nur zu gut. Er würde nachgeben müssen.
»In Gottes Namen, aber ich brauche eine ›Empfehlung‹, wie ich vorzugehen habe.«
Er wollte damit sagen, daß er, seiner Position gegenüber seinen Mitarbeiter zuliebe, den Eindruck erwecken wollte, man habe sich über ihn hinweggesetzt. Sir Robert Inglis zeigte sich aufgeschlossen; er konnte es sich leisten.
»Die ›Empfehlung‹ wird Ihnen sofort erteilt werden«, sagte er. »Ich werde die anderen Weisen um eine Anhörung ersuchen, und wir werden neue Richtlinien für die veränderte Situation festlegen. Mein Vorschlag geht dahin, daß Sie gemäß diesen neuen Regeln, die Ihnen übermittelt werden, einen ›Musterprozeß‹, wie es die Juristen nennen, in die Wege leiten.
»Musterprozeß. Wovon reden Sie da eigentlich?« fragte Sir Mark.
»Von einem Präzendenzfall, mein lieber Mark. Einem Präzendenzfall, der dann für die ganze Gruppe gültig sein wird.«
»Ein Sündenbock?«
»Das ist unfreundlich ausgedrückt. Von einem Sündenbock kann schwerlich die Rede sein, wenn jemand mit ansehnlichen Bezügen in den Vorruhestand geschickt wird. Sie nehmen einen Beamten, bei dem man sich vorstellen kann, daß er sein frühes Ausscheiden aus dem Dienst ohne Widerspruch schluckt, halten eine Anhörung ab und haben damit Ihren Präzedenzfall geschaffen.«
»Einen Beamten? Haben Sie an einen bestimmten Mann gedacht?«
Sir Robert legte die Fingerspitzen aneinander, so daß seine Hände eine Art Giebel bildeten, und schaute sinnend zur Decke hinauf.
»Nun ja, Sam McCready wäre ein solcher Kandidat.«
Natürlich. Der »Täuscher«. Seit McCreadys energischem, wenn auch nicht autorisiertem Auftritt in der Karibik ein Vierteljahr vorher hatte Sir Mark immer wieder gespürt, daß man im Außenministerium McCready als eine Art von der Leine gelassenen Dschingis-Khan betrachtete. Wirklich sonderbar. Dieser … zerknautschte Typ.
Sir Mark war sehr nachdenklicher Stimmung, während er über die Themse in sein Amt zurückgefahren wurde. Er wußte, der Staatssekretär im Außenministerium hatte nicht nur »vorgeschlagen«, daß Sam McCready aus dem Dienst ausscheiden sollte – er bestand darauf. Vom Standpunkt des SIS-Chefs hätte Sir Robert keine heiklere Forderung erheben können.
1983, als Sam McCready zum Leiter der DD-Abteilung ernannt worden war, war Sir Mark Deputy Controller gewesen, ebenso alt wie McCready und nur eine Rangstufe über ihm. Er hatte den respektlosen, eigenwilligen Agenten gern, dem Sir Arthur den neuen Posten übertragen hatte, aber schließlich fanden beinahe alle im Amt McCready sympathisch.
Kurz danach war Sir Mark auf drei Jahre in den Fernen Osten geschickt worden (er sprach fließend Mandarin) und nach seiner Rückkehr 1986 zum stellvertretenden Chef aufgerückt. Sir Arthur trat in den Ruhestand, und auf dem Schleudersitz saß ein neuer Chef. Diesen wiederum hatte Sir Mark dann im vorigen Januar abgelöst.
Vor seiner Abreise nach China hatte Sir Mark, wie auch andere, angenommen, daß Sam McCready sich nicht lange würde halten können. Der »Täuscher«, so die allgemeine Ansicht, ein Mann mit einer rauhen Schale, würde mit der »Innenpolitik« im Century House nicht so leicht zurechtkommen.
Zum einen würde keine der regionalen Abteilungen es begrüßen, wenn der Neue versuchte, in ihren eifersüchtig gehüteten Territorien zu operieren. Es würde zu »Revierkriegen« kommen, in denen sich nur ein diplomatisches Genie behaupten konnte, und diese Eigenschaft traute, bei all seinen Talenten, niemand McCready zu.
Zum anderen würde sich der in seinem Äußeren etwas schlampige Sam kaum in die Welt geschniegelter hoher Beamter einfügen, von denen die meisten Produkte der exklusiven Internatsschulen Englands waren.
Zu seiner Überraschung hatte Sir Mark bei seiner Rückkehr festgestellt, daß Sam McCready offensichtlich bestens zurechtkam. Anscheinend gelang es ihm in beneidenswerter Weise, die Loyalität seiner eigenen Leute zu gewinnen und zugleich die konservativsten Chefs der »territorialen« Abteilungen nicht gegen sich aufzubringen, wenn er sie um eine Gefälligkeit ersuchte.
Er konnte sich mit den anderen Außenagenten, wenn sie auf Heimaturlaub oder zu einer Einsatzbesprechung nach Hause kamen, im Jargon des Metiers unterhalten und brachte es offenbar fertig, von ihnen mit einer Fülle an Informationen versorgt zu werden, die sie eigentlich für sich hätten behalten sollen.
Es war bekannt, daß er sich gern mit den technischen Kadern, den Männern und Frauen der Praxis, zu einem Bier zusammensetzte solche Kameraderie stand den hohen Beamten nicht immer zu Gebote – und auf diese Weise zu einer Verwanzung eines Telefons, einer aufgefangenen Funkmeldung oder einem gefälschten Paß kam, während andere Abteilungsleiter noch damit beschäftigt waren, Formulare auszufüllen.
All dies und so manche Marotte, der unbekümmerte Umgang mit Vorschriften oder daß er verschwand, wie es ihm gerade in den Sinn kam, waren schwerlich dazu angetan, ihn höheren Orts beliebt zu machen. Aber er blieb auf seinem Posten, und der Grund dafür war einfach – er lieferte das Produkt, das Material. Er führte einen Laden, der dafür sorgte, daß der KGB die Bauchschmerzen nicht los wurde. Also blieb er … bis jetzt.
Sir Mark stieg in der unterirdischen Garage des Century House seufzend aus seinem Jaguar und fuhr mit dem Lift hinauf in sein Dienstzimmer in der obersten Etage. Fürs erste brauchte er nichts zu unternehmen. Sir Robert Inglis würde sich mit seinen Kollegen besprechen und die neuen Richtlinien für die veränderten Umstände formulieren, die es dem bekümmerten SIS-Chef ermöglichen würden, wahrheitsgemäß und schweren Herzens zu erklären: »Mir bleibt nichts anderes übrig.«
Erst Anfang Juni traf aus dem Außenministerium die »Empfehlung« oder vielmehr das Diktat ein, und Sir Mark berief seine beiden Stellvertreter zu sich.
»Das ist ein ziemlich starkes Stück«, sagte Basil Gray. »Können Sie sich nicht dagegen wehren?«
»In diesem Fall nicht«, sagte der Chef. »Inglis hat den Bissen zwischen den Zähnen und, wie Sie sehen, die anderen vier Weisen auf seiner Seite.«
Das Papier, das er seinen beiden Stellvertretern zu lesen gab, war ein Muster an Klarheit und makelloser Logik. Darin wurde festgestellt, daß die DDR, einst der erfolgreichste der osteuropäischen Staaten unter einem kommunistischen Regime, am 3.Oktober praktisch zu existieren aufhören werde. Es würde keine britische Botschaft in Ost-Berlin mehr geben, die Mauer sei längst eine Farce, die gefürchtete Geheimpolizei, der Staatsicherheitsdienst, im Begriff, das Feld zu räumen, die sowjetischen Streitkräfte würden über kurz oder lang abziehen. Ein für den SIS einst wichtiger und umfassender Tätigkeitsbereich werde zu einer Nebensache verkümmern.
Außerdem, hieß es in der Denkschrift weiter, sei dieser sympathische Vaclav Havel im Begriff, die tschechoslowakische Präsidentschaft zu übernehmen, und es sei zu erwarten, daß der tschechoslowakische Geheimdienst künftig im Kirchenchor mitsingen werde. Wenn man den Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft in Polen, Ungarn und Rumänien und die sich anbahnende Auflösung des Regimes in Bulgarien dazurechne, könne man sich ausmalen, wie die Zukunft ungefähr aussehen werde.
»Nun ja«, sagte Timothy Edwards seufzend, »man muß zugeben, daß wir in Osteuropa nicht mehr so viel zu tun haben werden wie früher und auch weniger Personal dort brauchen. Das muß man ihnen lassen.«
»Wie nett von Ihnen«, sagte der Chef lächelnd.
Basil Gray hatte er selbst befördert, seine erste Amtshandlung, nachdem er im Januar SIS-Chef geworden war. Timothy Edwards hatte er von seinem Vorgänger übernommen. Er wußte, daß Edwards darauf brannte, in drei Jahren selbst im Chefsessel zu sitzen; und er wußte auch, daß er selbst keineswegs gesonnen war, Edwards zu empfehlen. Nicht daß Edwards ein Schwachkopf wäre. Im Gegenteil, er war brillant, aber …
»Sie erwähnen nichts von den anderen Gefahren«, knurrte Gray. »Kein Wort über den internationalen Terrorismus, den Aufstieg der Drogenkartelle, die Privatarmeen … und auch kein einziges Wort über die Weiterverbreitung von Atomwaffen.«
In seinem eigenen Memorandum »Der SIS in den neunziger Jahren« (das Sir Robert Inglis gelesen und anscheinend gebilligt hatte) hatte Sir Mark hervorgehoben, daß die globalen Bedrohungen nicht geringer würden, sondern sich nur verlagerten. An der Spitze dieser Gefahren stand die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen – die gewaltigen Waffenarsenale, die Diktatoren, einige von ihnen völlig unberechenbar, ansammelten; kein überschüssiges Kriegsmaterial wie in früheren Zeiten, sondern High-Tech-Ausrüstung, Raketen, chemisch oder bakteriell bestückte Gefechtsköpfe, sogar Kernwaffen. Das Papier, das vor ihm lag, glitt über diese Dinge sorglos hinweg.
»Was passiert also jetzt?« fragte Timothy Edwards.
»Was jetzt passiert?« sagte der Chef milde. »Wir werden eine Bevölkerungsverschiebung erleben – eine Verschiebung unserer Bevölkerung. Aus Osteuropa zurück in die Heimatbasis.«
Er wollte damit sagen, daß die Veteranen des Kalten Krieges, die ihre Operationen, ihre »aktiven Maßnahmen« durchgeführt, die von den britischen Botschaften hinter dem Eisernen Vorhang aus ihre lokalen Agentennetze gesteuert hatten, nach Hause kommen würden – wo es keine Jobs für sie gab. Sie würden natürlich Nachfolger erhalten, aber jüngere Männer, deren wahre Tätigkeit verschleiert blieb und die sich unerkannt unter das Botschaftspersonal mischten, um bei den sich herausbildenden Demokratien im Osten keinen Anstoß zu erregen. Die Anwerbung würde natürlich weitergehen; der Dienst mußte ja ergänzt werden. Aber es blieb das Problem der Veteranen. Wohin mit ihnen? Es gab nur eine einzige Antwort – in den Ruhestand abschieben.
»Wir müssen einen Präzedenzfall schaffen«, sagte Sir Mark. »Einen Präzedenzfall, der für die übrigen den Weg für einen glatten Übergang in den vorzeitigen Ruhestand freimacht.«
»Denken Sie da an jemand Bestimmten?« fragte Gray.
»Sir Robert Inglis denkt an einen Bestimmten. An Sam McCready.«
Basil Gray blieb der Mund offenstehen.
»Chef, Sie können doch nicht Sam an die Luft setzen!«
»Niemand setzt Sam an die Luft«, sagte Sir Mark. Er griff Robert Inglis’ Worte auf. »Von einem Sündenbock kann schwerlich die Rede sein, wenn jemand mit ansehnlichen Bezügen in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wird.«
Der Gedanke ging ihm durch den Kopf, wie schwer die dreißig Silberlinge wohl wogen, als die Römer sie Judas auszahlten.
»Es ist natürlich traurig, weil wir alle Sam sehr gern haben«, sagte Edwards. »Aber der Chef muß seinen Laden am Laufen halten.«
»Genau. Danke Ihnen«, sagte Sir Mark.
Plötzlich wurde ihm zum erstenmal klar, warum er Timothy Edwards nicht empfehlen würde, wenn es eines Tages darum ging, wer sein Nachfolger werden sollte. Er, der Chef, würde tun, was getan werden mußte, aber er würde es höchst ungern tun. Edwards würde es tun, weil es seiner Karriere zugute kommen würde.
»Wir müssen ihm drei Alternativjobs anbieten«, sagte Gray. »Vielleicht akzeptiert er einen davon.«
»Vielleicht.«
»Woran denken Sie dabei, Chef?« fragte Edwards.
Sir Mark schlug einen Aktendeckel auf, der die Ergebnisse eines Gesprächs mit dem Personalchef enthielt.
»Drei Positionen stehen zur Verfügung: im Schulungszentrum, in der Rechnungsabteilung oder der Dokumentenabteilung.«
Edwards lächelte schwach. Das müßte eigentlich hinhauen.
Zwei Wochen später trabte der Gegenstand all dieser Gespräche und Konferenzen wie ein Raubtier durch sein Büro, während sein Stellvertreter, Denis Gaunt, düster auf das Blatt starrte, das vor ihm lag.
»So schlimm ist es auch wieder nicht, Sam«, sagte er. »Sie wollen, daß Sie bleiben. Es geht nur darum, in welcher Position.«
»Irgend jemand will mich rauswerfen«, sagte McCready mit ausdrucksloser Stimme.«
London wurde in diesem Sommer von einer Hitzewelle heimgesucht. Das Fenster des Büros stand offen, und beide Männer hatten ihre Sakkos ausgezogen. Gaunt hatte ein elegantes, hellblaues Hemd von der Firma Turnbull and Asser an; McCready steckte in einem Viyella-Hemd, das vom häufigen Waschen wollähnlich geworden war. Außerdem hatte er es nicht richtig zugeknöpft, so daß die rechte Seite höher stand als die linke. Bis zum Mittag, dachte Gaunt, wird sicher irgendeine Sekretärin die Schlamperei entdeckt und mit gespielter Mißbilligung behoben haben. Die jungen Frauen im Century House warteten anscheinend nur darauf, Sam McCready umsorgen zu können.
Für Gaunt war McCreadys Wirkung auf Frauen ein Rätsel. Übrigens nicht nur für ihn, sondern für alle. Er, Denis Gaunt, war groß und überragte seinen Boß um fünf Zentimeter. Er war blond, sah gut aus und war als Junggeselle nicht schüchtern, was Frauen anging.
Sein Abteilungsleiter war von mittlerer Größe, mittlerer Statur, hatte schütteres, braunes, zumeist unordentliches Haar, und die Sachen, die er trug, sahen immer aus, als hätte er darin geschlafen. Gaunt wußte, daß McCready seit einigen Jahren Witwer war, nicht mehr geheiratet hatte und es anscheinend vorzog, in seiner kleinen Wohnung in Kensington allein zu leben.
Es muß doch jemanden geben, der ihm die Wohnung putzt, sinnierte Gaunt, der ihm das Geschirr spült und die Wäsche besorgt. Eine Putzhilfe vielleicht. Aber danach fragte nie jemand, und von sich aus sprach McCready auch nie darüber.
»Sie könnten natürlich einen der Jobs akzeptieren«, sagte Gaunt. »Es würde ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen.«
»Denis«, antwortete McCready sanft, »ich bin kein Schulmeister, ich bin kein Buchhalter und ich bin kein Scheißbibliothekar. Richten Sie ihnen aus, daß ich um eine Anhörung ersuche.«
»Das könnte den Ausschlag geben«, stimmte ihm Gaunt zu. »Es muß nicht unbedingt sein, daß die Kommission mit der Entscheidung einverstanden ist.«
Die Anhörung im Century House fand wie immer an einem Montagvormittag statt, im Sitzungssaal eine Etage unter den Diensträumen des SIS-Chefs.
Den Vorsitz führte der stellvertretende Chef, Timothy Edwards, in seinem dunklen Blades-Anzug und mit der College-Krawatte wie immer wie aus dem Ei gepellt. Er wurde flankiert von den Controllern der Abteilungen »Inlandsoperationen« und »Westliche Hemisphäre«. An der Seite saß der Personalchef, neben einem jungen Mann der Dokumentarabteilung, der vor sich einen umfangreichen Stapel Aktendeckel hatte.
Sam McCready trat als letzter ein und setzte sich auf den Stuhl, der dem Tisch gegenüberstand. Mit seinen einundfünfzig Jahren war er noch immer schlank und wirkte fit. Aber er hatte nichts Auffallendes an sich: ein Mann von der Sorte, die es leicht schafft, unbemerkt zu bleiben. Und das hatte ihn so gut, so verdammt gut gemacht. Das und dazu, was in seinem Kopf steckte.
Man hatte ihm bereits die drei vorgeschriebenen Alternativjobs angeboten: Kommandeur des Schulungszentrums, irgendein hoher Posten in der Verwaltung (ein besserer Büroangestellter, hatte er dazu bemerkt) und Chef des Zentralregisters (ein blöder Bibliothekar). Er hatte alle drei abgelehnt, was nicht anders erwartet worden war.
Sie kannten alle die Regeln. Wurden drei »reizlose Beschäftigungen« abgelehnt, konnten sie von einem verlangen, sich vorzeitig pensionieren zu lassen. Aber er hatte Anspruch auf eine Anhörung, bei der er für eine Ausnahmeregelung plädieren konnte.
Er hatte, als Sprecher in seiner, McCreadys, Sache, seinen Stellvertreter Denis. Gaunt mitgebracht, der zehn Jahre jünger war und den er im Lauf von fünf Jahren zu seiner Nummer Zwei herangezogen hatte. Denis mit seinem strahlenden Lächeln und seiner Public-School-Krawatte, so nahm McCready an, würde mit ihnen besser umgehen, als er selbst es könnte.
Alle Männer in diesem Raum kannten einander und redeten sich mit Vornamen an, sogar der junge Mann von der Dokumentenabteilung. Vielleicht weil das Century House eine so abgeschlossene Welt ist, herrscht in seinen Mauern die Tradition, daß jeder jeden mit Vornamen anreden darf, abgesehen vom Chef, der mit »Sir« und »Chief« angesprochen wird, während man hinter seinem Rücken vom »Master« oder ähnlichem spricht. Die Tür wurde geschlossen, und Edwards gebot mit seinem Räuspern Stille. Das war so seine Art.
»Schön. Wir sind hier, um uns mit Sams Antrag zu befassen, eine Anweisung aus der Zentrale abzuändern, wobei es nicht um die Wiedergutmachung eines Unrechts geht. Einverstanden?«
Alle Anwesenden stimmten zu. Es wurde festgestellt, daß Sam McCready keinen Anlaß zu einer Beschwerde hatte, da ja gegen keine Vorschriften verstoßen worden war.
»Denis, ich nehme an, daß Sie für Sam sprechen wollen?«
»Ja, Timothy.«
Der SIS in seiner heutigen Form wurde von einem Admiral, Sir Mansfield Cumming, geschaffen, und viele der internen Traditionen (allerdings nicht die Vertraulichkeit im Umgang) haben noch heute etwas, was vage an die Navy erinnert. Dazu gehört auch das Recht eines Mannes, sich bei einer Anhörung durch einen »Offizierskameraden« vertreten zu lassen.
Die Erklärung des Personalchefs fiel kurz und sachlich aus. Die maßgeblichen Stellen hätten beschlossen, Sam McCready aus dem Referat DD in einen neuen Tätigkeitsbereich zu versetzen. Er habe sich geweigert, eine der drei angebotenen Positionen zu akzeptieren. Das sei gleichbedeutend mit der Entscheidung, vorzeitig in den Ruhestand zu treten. McCready ersuche darum, Chef von DD bleiben zu können oder wieder für praktische Aufgaben eingesetzt zu werden oder einer Abteilung zugeteilt zu werden, die sich mit den Außeneinsätzen von Agenten befaßte. Ein solcher Posten sei nicht zu vergeben. Quod erat demonstrandum.
Denis Gaunt erhob sich.
»Wir kennen doch alle die Regeln«, begann er. »Und wir kennen alle die Realitäten. Es stimmt, daß Sam darum gebeten hat, nicht dem Schulungszentrum, der Rechnungs- oder der Dokumentenabteilung zugeteilt zu werden. Weil er nach seiner Ausbildung und Begabung ein Mann für den Außeneinsatz ist. Und einer der besten dazu, wenn nicht überhaupt der beste.«
»Unbestritten«, murmelte der Controller für die Westliche Hemisphäre. Edwards warf ihm einen warnenden Blick zu.
»Die Sache ist die«, fuhr Gaunt fort, »wenn der SIS wirklich wollte, ließe sich wahrscheinlich etwas für Sam finden. Rußland, Osteuropa, Nordamerika, Frankreich, Deutschland, Italien. Ich schlage vor, daß man sich darum bemüht, weil …«
Er trat an den Schreibtisch, an dem der Mann von der Dokumentenabteilung saß, und nahm einen Akt zur Hand.
»… weil er noch vier Jahre bis zur Pensionierung mit vollen Bezügen hat …«
»Man hat ihm eine ansehnliche Ausgleichszahlung offeriert«, warf Edwards ein, »manche würden sie vielleicht sogar als äußerst großzügig bezeichnen.«
»Weil er«, nahm Gaunt seinen Faden wieder auf, »dem SIS lange Jahre loyal gedient hat, oft unter sehr unerquicklichen und manchmal unter höchst gefährlichen Umständen. Es geht nicht um das Geld, es geht darum, ob der Dienst bereit ist, sich für einen seiner Männer wirklich einzusetzen.«
Er hatte natürlich keine Ahnung von dem Gespräch, das einige Zeit vorher zwischen dem Chef, Sir Mark, und Sir Robert Inglis im Außenministerium stattgefunden hatte.
»Ich schlage vor, daß wir uns vier Fälle ansehen, mit denen Sam in den letzten sechs Jahren befaßt war. Beginnen wir mit folgendem …«
Timothy Edwards warf einen Blick auf seine Uhr. Er hatte gehofft, die Sache werde sich noch an diesem Tag erledigen lassen. Jetzt kamen ihm Zweifel, ob das möglich war.
»Ich denke, wir erinnern uns alle daran«, sagte Gaunt. »Die Geschichte mit dem sowjetischen General, Jewgeni Pankratin …«
Grenzgänge
1
Mai 1983
Der russische Oberst trat langsam und vorsichtig aus dem Schatten, obwohl er das Signal gesehen und erkannt hatte. Begegnungen mit seinem britischen Führungsoffizier waren gefährlich und daher tunlichst zu vermeiden. Um die heutige aber hatte er selbst gebeten. Er mußte ihm Dinge sagen, Forderungen stellen, die nicht in Form einer schriftlichen Nachricht in einen toten Briefkasten geworfen werden konnten. Ein Stück Blech auf dem Dach eines Schuppens weiter unten am Bahngleis flatterte knarrend, als es von einem frühmorgendlichen Windstoß erfaßt wurde. Er drehte sich um, registrierte die Quelle des Geräuschs und starrte wieder auf den dunklen Fleck neben der Lokomotivendrehscheibe.
»Sam?« rief er leise.
Sam McCready lag schon auf der Lauer. Bereits seit einer Stunde wartete er im Dunkeln auf dem aufgelassenen Rangierbahnhof am Stadtrand von Ost-Berlin. Er hatte gesehen oder vielmehr gehört, wie der Russe eintraf, aber trotzdem gewartet, um sich zu vergewissern, daß auf dem staub- und schuttbedeckten Gelände keine anderen Schritte zu hören waren. So oft er das alles auch schon erlebt hatte, der Knoten unten im Magen wollte sich nicht auflösen.
Zur verabredeten Zeit, nachdem er die Überzeugung gewonnen hatte, daß außer ihnen beiden niemand hier war, hatte er mit dem Daumennagel das Zündholz angerissen, so daß es einmal kurz aufflammte und dann verlosch. Der Russe hatte das Signal gesehen und war hinter dem alten Wartungshäuschen zum Vorschein gekommen. Die beiden Männer hatten allen Grund, lieber in der Dunkelheit zu operieren, denn der eine war ein Verräter und der andere ein Spion.
McCready trat aus dem Dunkel und blieb stehen, damit der Russe ihn sehen und sich vergewissern konnte, daß auch er allein war. Dann trat er auf den Russen zu.
»Jewgeni! Lange nicht gesehen, mein Freund.«
In einem Abstand von fünf Schritten konnten sie einander deutlich sehen und feststellen, daß sie keinem Double gegenüberstanden, daß sie nicht hinters Licht geführt worden waren. Denn das war immer das Gefährliche bei einer Begegnung von Mann zu Mann. Es hätte sein können, daß man den Russen enttarnt und ihm bei den Verhören das Kreuz gebrochen hatte, so daß der KGB und der Staatssicherheitsdienst der DDR einen hochrangigen britischen Geheimdienstmann in eine Falle locken konnten. Oder aber die Nachricht des Russen war abgefangen worden, und nun ging er in die Falle und anschließend in die lange dunkle Nacht der Verhöre, die schließlich mit einem Genickschuß endete. Mütterchen Rußland kannte kein Erbarmen mit seiner Verräter-Elite.
McCready umarmte den andern nicht, gab ihm nicht einmal die Hand. Manche Spitzenleute brauchten das; die persönliche Note, den ermutigenden körperlichen Kontakt. Jewgeni Pankratin, Oberst der Roten Armee, Angehöriger der sowjetischen Streitkräfte in der DDR, war eine kalte Natur, reserviert, verschlossen, voll selbstbewußter Arroganz.
Er war zum erstenmal 1980 in Moskau dem scharfen Auge eines Attachés an der Britischen Botschaft aufgefallen. Auf einem diplomatischen Empfang mit höflich-banaler Konversation plötzlich die beißende Bemerkung des Russen über die Gesellschaft seines eigenen Landes. Der Diplomat hatte sich nichts anmerken lassen, kein Wort gesagt. Aber er hatte die Bemerkung registriert und weitergemeldet. Ein möglicher Kandidat. Zwei Monate danach war ein erster, tastender Annäherungsversuch unternommen worden. Oberst Pankratin hatte unverbindlich, aber nicht abweisend reagiert. Das galt als ein positives Zeichen. Dann war er versetzt worden, nach Potsdam, zur Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte, der aus zweiundzwanzig Divisionen mit 330000 Mann bestehenden Armee, die dafür sorgte, daß die Ostdeutschen botmäßig blieben, daß die Marionette Honekker sich an der Macht hielt, die Westberliner in Furcht lebten und die NATO sich für einen alles niederwalzenden Vormarsch durch die norddeutsche Tiefebene in Bereitschaft hielt.
McCready hatte den Fall übernommen; es war sein Revier. 1981 unternahm er selbst einen Annäherungsversuch, und Pankratin wurde gewonnen. Kein großes Theater, keine Gefühlsausbrüche, die man sich anhören und für die man Verständnis zeigen mußte … Er machte kein Hehl daraus, daß er Geld sehen wollte.
Menschen verraten das Land ihrer Väter aus vielerlei Gründen: aus persönlichem Groll, aus ideologischen Motiven, wegen einer entgangenen Beförderung, aus Haß auf einen bestimmten Vorgesetzten, aus Scham wegen bestimmter sexueller Vorlieben, aus Angst, wegen eines Versagens zur Rechenschaft gezogen zu werden. Bei den Russen war es in der Regel eine tiefe Ernüchterung; sie hatten genug von der Korruption, den Lügen und der Vetternwirtschaft, die sie rings um sich erlebten. Pankratin jedoch handelte aus rein materiellen Beweggründen, ihm ging es schlicht und einfach nur ums Geld. Eines Tages, sagte er, werde er hinüberkommen, aber dann wolle er ein reicher Mann sein. Er hatte das Treffen in Ost-Berlin, das im Morgengrauen stattfand, vereinbart, um mehr herauszuschinden.
Pankratin griff in seinen Trenchcoat und zog einen dicken, braunen Umschlag heraus, den er McCready reichte. Kühl beschrieb er den Inhalt des Umschlags, während McCready das Päckchen in seiner dicken Jacke unsichtbar verstaute: Namen, Örtlichkeiten, Gefechtsbereitschaft einzelner Divisionen, Operationsbefehle, Truppenbewegungen, Abkommandierungen, Verbesserungen von Waffensystemen. Am wichtigsten war natürlich, was Pankratin über die SS-20 beizusteuern hatte, die schreckenerregenden Mittelstreckenraketen auf mobilen Abschußrampen, jede mit drei nuklearen Sprengköpfen bestückt, die individuell gesteuert werden konnten und auf britische oder kontinental-europäische Städte gerichtet waren. Pankratin zufolge rückten sie zu dieser Zeit in die Wälder Sachsens und Thüringens, in größere Grenznähe vor, so daß sie Ziele in einem Bogen, der von Oslo über Dublin bis nach Palermo reichte, bedrohen konnten. Im Westen zogen gleichzeitig gewaltige Kolonnen naiver Linker, die es aufrichtig meinten, hinter den Bannern der Friedensbewegung durch die Städte und forderten, ihre Regierungen sollten als Zeichen ihrer Friedensliebe auf ihre Defensivwaffen verzichten.
»Es hat natürlich seinen Preis«, sagte der Russe.
»Klar.«
»200000Pfund Sterling.«
»Einverstanden.« Seine Regierung hatte zwar nicht ihr Einverständnis erklärt, aber McCready wußte, daß man das Geld irgendwo auftreiben würde.
»Noch etwas. Soviel ich weiß, bin ich für eine Beförderung vorgesehen. Zum Generalmajor. Und für eine Versetzung. Zurück nach Moskau.«
»Gratulation. Und was sollen Sie dort werden, Jewgeni?«
Pankratin legte eine Pause ein, um seine Eröffnung wirken zu lassen.
»Stellvertretender Direktor des gemeinsamen Planungsstabs im Verteidigungsministerium.«
McCready war beeindruckt. In Moskau, in der Frunse-Straße Nr.19, einen Mann zu haben, das wäre einzigartig.
»Und wenn ich hinüberkomme, möchte ich eine große Luxuswohnanlage haben. In Kalifornien. Auf meinen Namen im Grundbuch eingetragen. Vielleicht in Santa Barbara. Dort soll es sehr schön sein.«
»Das stimmt«, sagte McCready. »Sie möchten sich nicht in England niederlassen? Wir würden uns um Sie kümmern.«
»Nein, ich möchte in der Sonne leben. In der Sonne Kaliforniens. Und eine Million Dollar, US-Dollar, auf mein Konto dort.«
»Eine Wohnung, das ließe sich einrichten«, sagte McCready. »Und auch eine Million Dollar. Wenn das Material stimmt.«
»Keine Wohnung, Sam. Eine Luxuswohnanlage. Damit ich von den Mieteinnahmen leben kann.«
»Jewgeni, Sie verlangen da zwischen fünf und acht Millionen US-Dollar. Ich glaube nicht, daß meine Leute eine solche Summe aufbringen können. Nicht einmal für Ihr Material.«
Unter dem militärischen Schnauzbart des Russen schimmerten in einem kurzen Lächeln die Zähne auf.
»Wenn ich in Moskau bin, wird das Material, das ich Ihnen liefern werde, Ihre kühnsten Erwartungen übertreffen. Sie werden das Geld schon auftreiben.«
»Warten wir erst mal ab, bis Sie befördert werden, Jewgeni. Dann sprechen wir über eine Wohnanlage in Kalifornien.«
Oktober 1983
Bruno Morenz klopfte an die Tür und trat ein, als er das joviale »Herein« hörte. Sein Vorgesetzter war allein in dem Büro, er saß in seinem gewichtigen, ledernen Drehsessel hinter seinem gewichtigen Schreibtisch. Er rührte gerade genüßlich seine erste Tasse Kaffee an diesem Tag um, den ihm das aufmerksame Fräulein Keppel, die gepflegte alte Jungfer, die alle seine legitimen Bedürfnisse befriedigte, in der Tasse aus Chinaporzellan serviert hatte.
Wie Morenz gehörte auch der »Herr Direktor« der Generation an, die sich noch an das Kriegsende und an die Nachkriegsjahre erinnerte, als die Deutschen sich mit Zichorienkaffee behelfen mußten und nur die amerikanischen Besatzer und gelegentlich die Engländer an echten Kaffee herankamen. Diese Zeiten waren vorüber. Dieter Aust genoß seinen kolumbianischen Kaffee am Morgen. Morenz bot er keinen an.
Beide Männer gingen auf die Fünfzig zu, doch damit waren die Gemeinsamkeiten auch schon zu Ende. Aust war klein, rundlich, sorgfältig rasiert und gekleidet und stand an der Spitze des Kölner Amtes. Morenz war größer, kräftig, ergraut. Aber er hielt sich schlecht, schien beim Gehen zu watscheln, und bot einen klobigen, schlampigen Anblick in seinem Tweedanzug. Außerdem war er ein bescheidener Beamter, der nicht im Traum daran gedacht hätte, nach dem Direktorentitel zu streben, samt dem dazugehörigen hochbedeutsamen Büro und einem Fräulein Keppel, das ihm seinen kolumbianischen Kaffee in Chinaporzellan servierte, ehe er sich an die Arbeit setzte.
Die Szene, wie ein Vorgesetzter einen Untergebenen zu einem Gespräch zu sich bestellte, spielte sich an diesem Morgen wahrscheinlich in zahlreichen Chefbüros überall in Deutschland ab, doch der Arbeitsbereich dieser beiden Männer hätte wohl schwerlich einen Vergleich gefunden. Und dies galt auch für die anschließende Unterhaltung. Denn Dieter Aust war Chef der Kölner Außenstelle des Bundesnachrichtendienstes (BND).
Die Zentrale des BND befindet sich in einem ausgedehnten, von einer hohen Mauer umgebenen Gelände am Rand der bayerischen Gemeinde Pullach, rund acht Kilometer südlich von München auf dem Hochufer der Isar gelegen – auf den ersten Blick eine Kuriosität, wenn man bedenkt, daß seit 1949 Bonn am Rhein, Hunderte von Kilometern entfernt, Bundeshauptstadt ist. Der Grund ist historischer Natur. Die Amerikaner nämlich schufen nach dem Krieg eine westdeutsche Spionageorganisation, um ein Gegengewicht zu den Bemühungen des neuen Feindes, der UdSSR, auf diesem Gebiet zu schaffen. Zum Leiter dieses Dienstes bestimmten sie Reinhard Gehlen, früher Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, und der Dienst selbst trug nur die schlichte Bezeichnung »Organisation Gehlen«. Die Amerikaner wollten Gehlen innerhalb ihrer Besatzungszone halten, und dazu gehörte eben auch Bayern.
Konrad Adenauer, Oberbürgermeister von Köln, war damals ein noch nicht sehr bekannter Politiker. Als 1949 die Bundesrepublik Deutschland ins Leben gerufen und Adenauer ihr erster Kanzler wurde, bestimmte man erstaunlicherweise seine Heimatstadt Bonn zur Hauptstadt. Beinahe sämtlichen Bundesorganen wurde nahegelegt, dort ihren Sitz zu nehmen, doch Gehlen widersetzte sich, und seine Organisation, inzwischen in BND umbenannt, blieb in Pullach, wo sich noch heute die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes befindet. Allerdings unterhält der BND in sämtlichen Bundesländern Außenstellen, und eine der wichtigsten findet sich in Köln. Der Grund liegt darin, daß Köln Bonn am nächsten liegt. Schon allein die zahlreichen Ausländer in Bonn boten ein reiches Betätigungsfeld für den BND, der sich im Unterschied zu seiner Schwesterorganisation, dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), mit der Auslandsaufklärung befaßt.
Morenz folgte Austs Aufforderung, Platz zu nehmen, und überlegte, was er, wenn überhaupt, falsch gemacht haben könnte. Die Antwort lautete: nichts.
»Mein lieber Morenz, ich will nicht lange um die Sache herumreden.« Aust betupfte sich mit einem frischen Leinentaschentuch die Lippen. »Nächste Woche tritt unser Kollege Dorn in den Ruhestand, wie Sie natürlich wissen. Seine Pflichten übernimmt sein Nachfolger. Er ist viel jünger und, das dürfen Sie mir glauben, ein Typ, der es noch weit bringen wird. Eine Aufgabe aus seinem Bereich verlangt jedoch einen Mann in reiferen Jahren. Ich hätte gern, daß Sie sie übernehmen.«
Morenz nickte, als hätte er verstanden, was keineswegs der Fall war. Aust formte mit seinen pummeligen Fingern eine Art Giebel und blickte versonnen zum Fenster hinaus, wobei sein Gesicht einen Ausdruck des Schmerzes über die Extravaganzen seiner Mitmenschen annahm. Er wählte seine Worte mit Bedacht.
»Hin und wieder treffen bei uns Gäste ein, ausländische Politiker, die nach einem mit Verhandlungen oder offiziellen Begegnungen verbrachten Tag das Bedürfnis nach Zerstreuung … nach Unterhaltung verspüren. Unsere verschiedenen Ministerien arrangieren natürlich gerne Besuche in erstklassigen Restaurants, von Konzerten, von Opern und Ballettaufführungen. Sie verstehen?«
Morenz nickte wieder. Die Sache war klar wie Kloßbrühe.
»Leider gibt es unter unseren Gästen einige, zumindest aus arabischen oder afrikanischen Ländern, gelegentlich auch aus europäischen, die recht deutlich zu verstehen geben, daß sie sich lieber in weiblicher Gesellschaft entspannen würden. In bezahlter weiblicher Gesellschaft.«
»Callgirls«, sagte Morenz.
»Kurzum: ja. Und, um zu vermeiden, daß wichtige ausländische Besucher die Dienste von Hotelportiers oder Taxifahrern in Anspruch nehmen, den Rotlichtbezirk in der Hornstraße aufsuchen oder in Bars und Nachtklubs in Schwierigkeiten geraten, bietet die Bundesregierung ihnen eine bestimmte Telefonnummer an. Glauben Sie mir, lieber Morenz, so etwas geschieht in jeder Hauptstadt der Welt. Wir bilden da keine Ausnahme.«
»Wir beschäftigen Callgirls?« fragte Morenz. Aust war schockiert.
»Beschäftigen? Davon kann keine Rede sein. Wir beschäftigen und wir bezahlen sie nicht. Das tut der Kunde. Und, ich muß das betonen, wir werten auch nicht die Erkenntnisse bezüglich der Gepflogenheiten einiger unserer hochgestellten ausländischen Gäste aus, die dabei vielleicht anfallen. Die sogenannte Honigfalle. Wir können uns nicht über die Vorschriften und Bestimmungen unserer Verfassung hinwegsetzen, die ganz eindeutig sind. Die Honigfallen überlassen wir den Russen und …« Er rümpfte die Nase, »… den Franzosen.«
Er nahm drei Aktendeckel von seinem Schreibtisch und reichte sie Morenz.
»Es handelt sich um drei junge Frauen. Körperlich ganz verschiedene Typen. Ich bitte Sie, diese Sache zu übernehmen, weil Sie ein reifer, verheirateter Mann sind. Beaufsichtigen Sie die drei jungen Damen mit einem väterlichen Blick. Sorgen Sie dafür, daß sie sich regelmäßig ärztlich untersuchen lassen und auf ihr Äußeres achten. Kontrollieren Sie, ob sie in der Stadt oder krank oder auf Urlaub sind – kurzum: ob sie verfügbar sind.
Und als letztes: Es kann sein, daß Sie hin und wieder von einem Herrn Jakobsen angerufen werden. Denken Sie sich nichts, wenn sich die Stimme des Anrufers verändert – es handelt sich immer um Herrn Jakobsen. Entsprechend den Neigungen des jeweiligen Gastes, über die Herr Jakobsen Sie aufklären wird, wählen Sie eine der drei Damen aus, legen den Zeitpunkt für einen Besuch fest, sorgen dafür, daß sie zur Verfügung steht. Herr Jakobsen wird sich dann bei Ihnen telefonisch nach Zeit und Ort erkundigen und beides dem Besucher mitteilen. Das übrige überlassen wir dem Callgirl und dem Kunden. Wirklich keine sehr beschwerliche Aufgabe. Sie dürfte Ihre übrigen Pflichten kaum beeinträchtigen.«
Morenz, die Aktendeckel in der Hand, rappelte sich schwerfällig hoch. Toll, dachte er, als er das Chefbüro verließ, da habe ich dem BND dreißig Jahre lang treu gedient, und drei Jahre vor der Pensionierung kommt es so weit, daß ich Nutten für Ausländer betreuen muß, die eine Nacht über die Stränge schlagen wollen.
November 1983
Sam McCready saß in einem abgedunkelten Raum in einem tiefen Kellergeschoß des Century House in London, der Zentrale des britischen Geheimdienstes SIS, von der Presse zumeist fälschlich MI-6 und von den Insidern »die Firma« genannt. McCready blickte auf einen zuckenden Bildschirm, auf dem die geballte militärische Macht der UdSSR (beziehungsweise ein Teil davon) in endloser Formation über den Roten Platz zog. Die Sowjetführung hält zweimal in jedem Jahr auf diesem Platz voller Stolz eine gewaltige Parade ab; die eine zum 1.Mai und die andere zur Feier der Großen Oktoberrevolution. Letztere findet am 7.November statt, und heute war der 8.November. Die Kamera verließ die Kolonnen dahinrumpelnder Panzer und schwenkte über die Reihe der Gesichter auf der Tribüne oberhalb des Lenin-Mausoleums.
»Langsamer«, sagte McCready. Der Techniker neben ihm fuhr mit einer Hand über das Pult, und der Schwenk wurde langsamer. Präsident Reagans »Reich des Bösen« (wie er die Sowjetunion später nannte) machte mehr den Eindruck eines Altersheims. Vor dem kalten Wind verschwanden die verfallenen, vom Alter gezeichneten Gesichter beinahe in den hochgeschlagenen Mantelkrägen, die fast bis zu den grauen Filzhüten oder Tschapkas reichten.
Der Generalsekretär selbst war nicht anwesend. Juni V. Andropow, KGB-Chef von 1963 bis 1978, der Ende 1982 die Nachfolge des allzu spät verstorbenen Leonid Breschnew angetreten harte, ging in der Politbüro-Klinik draußen in Kunzewo selbst Schritt für Schritt dem Tod entgegen. Er hatte sich seit dem vergangenen August nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt, und dazu sollte es auch nicht mehr kommen.
Tschernenko (der ein paar Monate später Andropows Nachfolger werden sollte) stand oben auf der Tribüne, zusammen mit Gromyko, Kirilenko, Tichonow und dem Parteitheoretiker Suslow. Der Verteidigungsminister, Ustinow, war in seinen Marschallmantel gehüllt, der vom Kinn bis zur Taille derart mit Orden geschmückt war, daß er sicher einen guten Windschutz abgab. Ein paar der Anwesenden waren immerhin noch jung genug, daß man qualifizierte Arbeit von ihnen erwarten konnte, beispielsweise der Moskauer Parteichef Grischin und der Parteiboß von Leningrad, Romanow. Am Rand stand der jüngste von allen und noch immer ein Außenseiter, ein untersetzter Mann namens Gorbatschow.
Die Kamera schwenkte nach oben, um die Gruppe der Offiziere ins Bild zu bringen, die hinter Marschall Ustinow standen.
»Moment«, sagte McCready. Das Bild erstarrte. »Der dort, der dritte von links. Kann ich den schärfer haben, können Sie ihn ranholen?«
Der Techniker warf einen Blick auf sein Pult und tat das Gewünschte. Die Gruppe der Offiziere kam immer näher. Manche gerieten aus dem Bild. Derjenige, den McCready gemeint hatte, rückte zu sehr nach rechts. Der Techniker ging drei oder vier Bilder zurück, bis der Mann ganz in der Mitte war, und holte ihn näher heran. Der Offizier war durch einen General der Strategischen Raketentruppen halb verdeckt, aber sein Schnauzbart, bei sowjetischen Offizieren etwas Unübliches, beseitigte jeden Zweifel. Die Schulterstücke auf dem Offiziersmantel zeigten, daß er Generalmajor war.
»Donnerwetter«, flüsterte McCready, »er hat es geschafft! Er hat es nach dort oben geschafft.« Er wandte sich dem Techniker mit seiner unbewegten Miene zu. »Jimmy, wie zum Teufel kommen wir an eine Luxuswohnanlage in Kalifornien ran?«
»Nun, die Antwort ist kurz, mein lieber Sam«, sagte Timothy Edwards zwei Tage später. »Das schaffen wir nicht. Ich weiß, es ist bitter, aber ich habe die Sache dem Chef und den Geldfritzen vorgelegt, und die Antwort lautet: Er ist für uns zu kostspielig.«
»Aber sein Material ist von unschätzbarem Wert«, protestierte McCready. »Der Mann ist mehr wert als Gold. Er ist eine Hauptader aus reinem Platin.«
»Das ist unbestritten«, sagte Edwards ruhig. Er war zehn Jahre jünger als McCready, ein Erfolgstyp mit einem guten Universitätsdiplom, und kam aus begüterten Verhältnissen. Er hatte kaum die Dreißiger hinter sich und war bereits Stellvertreter des Chefs. Die meisten Männer seines Alters würden sich glücklich schätzen, wenn sie an der Spitze einer Auslandsstation stünden, Abteilungschef wären, würden sich danach sehnen, es zum Controller zu bringen. Und Edwards hatte schon beinahe die oberste Etage erreicht.
»Sehen Sie«, sagte er, »der Chef war gerade in Washington. Er hat Ihren Mann erwähnt, für den Fall, daß der wirklich befördert wird. Unsere amerikanischen Vettern haben immer sein Material bekommen, seit Sie ihn an Land gezogen haben. Sie waren immer begeistert darüber. Und jetzt hat es den Anschein, daß sie ihn mit Freuden übernehmen und auch die Kohle rausrücken werden, die er verlangt.«
»Er ist empfindlich, mimosenhaft. Er kennt nur mich. Vielleicht will er für niemand anderen arbeiten.«
»Jetzt aber, Sam. Sie werden mir als erster zugeben, daß es ihm nur ums Materielle geht. Der Typ geht dorthin, wo das Geld lockt. Und wir bekommen ja das Material. Sorgen Sie bitte dafür, daß die Übergabe glatt vor sich geht.«
Er legte eine Pause ein und strahlte McCready mit seinem gewinnendsten Lächeln an.
»Übrigens, der Chef möchte Sie sehen. Morgen früh um zehn. Ich denke nicht, daß ich meine Kompetenzen überschreite, wenn ich Ihnen verrate, daß er an einen neuen Auftrag für Sie denkt. Ein Schritt nach oben, Sam. Sehen Sie, manchmal entwickelt sich alles so, daß es gar nicht besser gehen könnte. Pankratin ist wieder in Moskau, und damit kommen Sie schwerer an ihn heran; Sie haben sich eine ganze Ewigkeit mit Ostdeutschland beschäftigt. Unsere Vettern sind bereit, die Sache zu übernehmen, und Sie bekommen eine wohlverdiente Beförderung. Vielleicht eine Abteilung.«
»Ich bin ein Mann für die Front«, sagte McCready.
»Warum hören Sie sich nicht erst einmal an, was der Chef Ihnen erzählen wird«, schlug Edwards vor.
Vierundzwanzig Stunden später wurde Sam McCready zum Chef von DD and P ernannt. Betreuung, Führung und Bezahlung von General Jewgeni Pankratin übernahm die CIA.
Juli 1985
In diesem Sommer war es in Köln sehr heiß. Wer es sich leisten konnte, hatte Frau und Kinder an die Seen, in waldige Gegenden, ins Gebirge oder auch in die Villa am Mittelmeer geschickt und plante, sich ihnen später zuzugesellen. Bruno Morenz besaß kein Feriendomizil. Er war ein unermüdlicher Arbeiter. Sein Gehalt war nicht hoch und würde vermutlich auch nicht mehr steigen, denn eine weitere Beförderung war ganz unwahrscheinlich, da er nur noch drei Jahre bis zu seiner Pensionierung hatte.
Er saß auf einer Caféterrasse und trank kleine Schlucke aus seinem hohen Bierglas. Er hatte die Krawatte gelockert und das Sakko über die Stuhllehne gehängt. Niemand würdigte ihn auch nur eines flüchtigen Blickes. Er hatte seinen winterlichen Tweedanzug gegen einen aus Leinen vertauscht, der womöglich noch formloser wirkte. Er saß vornübergebeugt bei seinem Bier und fuhr sich hin und wieder mit der Hand durch das dichte, graue Haar, bis es zerzaust war. Bruno Morenz war ein Mann ohne jede Eitelkeit, was sein Äußeres anging, denn sonst wäre er sich mit einem Kamm durchs Haar gefahren, hätte er sich ein bißchen sorgfältiger rasiert, ein anständiges Kölnisch Wasser benutzt (schließlich lebte er in der Stadt, wo es erfunden worden war) und sich einen eleganten, gutgeschnittenen Anzug zugelegt. Er hätte das Hemd mit den leicht ausgefransten Manschetten weggeworfen und die Schultern durchgedrückt. Dann hätte er durchaus den Eindruck eines Mannes gemacht, von dem Autorität ausgeht. Nein, persönliche Eitelkeit kannte er nicht.
Träume immerhin hatte er. Oder vielmehr: Er hatte sie gehabt. Früher, vor langer Zeit. Sie waren nicht in Erfüllung gegangen. Ein Mann von zweiundfünfzig Jahren, verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder, starrte Bruno Morenz düster auf die Passanten drunten auf dem Gehsteig. Er litt, ohne sich dessen bewußt zu sein, an Torschlußpanik.
Hinter der Fassade des stämmigen, freundlichen Mannes, der unverdrossen seiner Arbeit nachging, am Monatsende sein bescheidenes Gehalt entgegennahm und jeden Abend in den trauten Familienkreis zurückkehrte, war Bruno Morenz ein zutiefst unglücklicher Mann.
Er war in einer Ehe ohne Liebe an seine Frau Irmtraut gekettet, ein Wesen von abgrundtiefer Torheit und den Konturen einer Kartoffel, die es sich, indes die Jahre dahingingen, sogar abgewöhnt hatte, über sein kärgliches Gehalt und die ausgebliebenen Beförderungen zu jammern. Was seinen Beruf betraf, wußte sie nur, daß er in einer der staatlichen Dienststellen arbeitete, die sich mit der Beamtenversorgung beschäftigten, und es interessierte sie auch gar nicht. Wenn er ungepflegt aussah, mit ungebügelten Hemden und in einem unförmigen Anzug, lag das zum Teil daran, daß Irmtraut Morenz sich auch dafür nicht mehr interessierte. Sie sorgte dafür, daß ihre kleine Wohnung in einer gesichtslosen Straße in Porz halbwegs in Schuß und aufgeräumt war, und wenn er abends nach Hause kam, stand zehn Minuten später sein Abendessen auf dem Tisch, kalt, wenn er verspätet eintraf.
Seine Tochter Ute hatte sich sofort nach dem Schulabschluß von den Eltern abgesetzt, sich verschiedenen linken Ideen verschrieben (er hatte sich wegen Utes politischer Aktivitäten in seinem Amt überprüfen lassen müssen, ob er nicht ein Sicherheitsrisiko darstelle) und lebte nun zusammen mit mehreren gitarrenklimpernden Hippies in einem besetzten Haus in Düsseldorf. Bruno Morenz wurde sich nie klar darüber, mit welchem von ihnen sie etwas hatte – vielleicht mit allen. Sein Sohn Lutz lebte noch zu Hause, wo er unausgesetzt vor der Glotze hockte. Der picklige Jüngling war durch jede Prüfung gerasselt, an der er jemals teilgenommen hatte, und wollte von Bildung und einer Welt, die auf derlei Dinge viel Wert legte, nichts mehr wissen. Statt dessen hatte er sich, als Zeichen seines persönlichen Protests gegen die Gesellschaft, eine Punkfrisur und entsprechende Klamotten zugelegt, und sich zugleich gehütet, irgendeine Arbeit zu akzeptieren, welche ihm diese Gesellschaft vielleicht anzubieten bereit war.
Bruno Morenz hatte sich Mühe gegeben; jedenfalls sah er es so. Er hatte sein Bestes getan, so wie er es verstand. Er hatte fleißig gearbeitet, seine Steuern gezahlt, seine Familie nach bestem Vermögen durchgebracht und selbst nichtviel, ja, herzlich wenig vom Leben gehabt.
In drei Jahren, in ganzen sechsunddreißig Monaten, würde man ihn aufs Altenteil schicken. Im Büro würde es eine kleine Party geben, Aust eine Rede halten, man würde mit Sektgläsern anstoßen, und dann ging er seiner Wege. Wohin? Er bezog dann seine Pension, und er hatte die Ersparnisse aus seiner »anderen Arbeit«, die er in verschiedenen deutschen Städten auf kleinen bis mittleren Konten sorgsam gehortet hatte. Es würde genug da sein, mehr als irgend jemand annahm oder argwöhnte; genug, um ein Heim für seinen Lebensabend zu kaufen und zu tun, woran ihm wirklich etwas lag …
Hinter seiner freundlichen Fassade hatte Bruno Morenz auch seine Geheimnisse. Er hatte niemals Aust oder sonst jemandem in der Organisation von der »anderen Arbeit« erzählt – es war schließlich eine streng verbotene Tätigkeit, und wäre sie ruchbar geworden, hätte dies zu seiner sofortigen Entlassung geführt. Auch Irmtraut hatte er nie etwas über diese Arbeit und ebensowenig über seine geheimen Ersparnisse anvertraut. Aber das war nicht sein eigentliches Problem – so, wie er die Sache sah.
Sein wirkliches Problem, so wie er es sah, das war sein Wunsch, frei zu sein. Er wollte noch einmal von vorne anfangen, und genau zur rechten Zeit war ihm auch klar geworden, wie. Denn Bruno Morenz, ein Mann in vorgerückten Jahren, hatte sich verliebt. Hatte sich bis über beide Ohren rettungslos verliebt. Und das Wunderbare daran war, daß Renate, seine phantastische Renate in ihrer jugendlichen Schönheit, in ihn ebenso verliebt war, wie er in sie.
Dort, in diesem Café, an diesem Sommernachmittag, faßte Bruno Morenz endlich seinen Entschluß. Ich werde es tun, nahm er sich vor, ich werde es ihr sagen. Er würde ihr sagen, daß er vorhatte, Irmtraut – wohlversorgt – zu verlassen, in Frühpension zu gehen und sie mitzunehmen in ein neues Leben, in dem Traumhaus, das sie sich droben im Norden seiner Heimat an der Küste zulegen würden.
Bruno Morenz’ wirkliches Problem, wie er es nicht sah, bestand darin, daß er auf eine massive Mid-life-crisis nicht etwa zusteuerte, sondern daß er schon mitten drin steckte. Weil er das nicht erkannte und weil er in seinem Beruf gelernt hatte, sich zu verstellen, bemerkte auch sonst niemand etwas davon.
Renate Heimendorf war sechsundzwanzig, eine mit 1,75Meter hochgewachsene und wohlproportionierte Brünette. Mit achtzehn Jahren war sie die Geliebte und Gespielin eines wohlhabenden Unternehmers, dreimal so alt wie sie, geworden, und dieses Verhältnis hatte fünf Jahre gedauert. Als ihr Liebhaber an einer Herzattacke verschied, die er sich vermutlich durch allzu üppigen Genuß von Essen, Trinken, Zigarren und Liebesfreuden mit Renate zugezogen hatte, hatte er ungalanterweise vergessen, sie in seinem Testament zu bedenken, und die rachsüchtige Witwe war nicht gesonnen, diesem Versäumnis abzuhelfen.
Renate Heimendorf war es gelungen, die Ausstattung ihres teuer eingerichteten Liebesnestes zu verscherbeln, die zusammen mit dem Schmuck und den Kinkerlitzchen, die er ihr im Laufe der Jahre geschenkt hatte, bei einer Versteigerung eine ansehnliche Summe erbrachte.
Allerdings nicht genug, um sich damit zur Ruhe zu setzen, nicht genug, um den Lebensstil, an den sie sich gewöhnt hatte, aufrechterhalten zu können. Sie hatte nicht die Absicht, darauf zu verzichten und sich mit der Position und dem armseligen Gehalt einer Sekretärin zu begnügen. So beschloß sie, ins Geschäftsleben einzusteigen. Angesichts ihrer Begabung, aus einem übergewichtigen älteren Mann ohne jede Kondition eine gewisse Erregung herauszukitzeln, gab es eigentlich nur eine einzige Branche, in der sie sich etablieren konnte.
Sie schloß einen langfristigen Mietvertrag für ihre Wohnung im ruhigen und bürgerlich-gesetzten Hahnwald ab, einem baumreichen Villenvorort von Köln. Die Behausungen in dieser Gegend waren solide Back- oder Sandsteinhäuser, auch das Haus, in dem sie wohnte und wirkte. Es war ein vierstöckiges Gebäude, dessen Wohnungen jeweils eine ganze Etage einnahmen. Ihr Zuhause befand sich im ersten Stock. Nachdem sie eingezogen war, ließ sie einige Umbauten vornehmen.
Die Wohnung hatte ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad, zwei Schlafzimmer sowie eine große Diele und einen Korridor. Das Wohnzimmer befand sich links von der Diele, die Küche daneben. Noch weiter hinten, links vom Korridor, der von der Diele aus nach rechts führte, waren ein Schlaf- und das Badezimmer. Das größere der beiden Schlafzimmer befand sich am Ende des Flurs, so daß das Badezimmer zwischen den Schlafzimmern lag. Bis zur Tür des größeren Schlafzimmers war in die linke Wand ein zwei Meter breiter Schrank für Winterkleidung eingebaut, der dem Badezimmer etwas Platz wegnahm.
Renate Heimendorf schlief in dem kleineren Schlafzimmer und benützte das größere am Ende des Korridors als Arbeitsstätte. Zu den Arbeiten, die sie hatte vornehmen lassen, hatte neben dem Einbau des Schranks die Schallisolierung des großen Schlafzimmers gehört: die Wände wurden mit Korkplatten verkleidet, die Tür erhielt an der Innenseite eine dicke Polsterung. Aus dem Zimmer konnten nur wenige Geräusche nach außen dringen und die Nachbarn stören oder alarmieren, was kein Schaden war. Der Raum mit seiner ungewöhnlichen Ausstattung war immer sorgfältig verschlossen.
Der Schrank im Korridor enthielt nur normale Wintersachen und Regenmäntel. Weitere Schränke im »Arbeitszimmer« bargen ein reichhaltiges Sortiment exotischer Damenunterwäsche, alle möglichen Outfits vom Schul- und Dienstmädchen über Braut und Kellnerin, Kinderfrau, Krankenschwester, Erzieherin, Schuldirektorin, Stewardeß, Polizistin, BDM-Mädchen und KZ-Wärterin bis zur Pfadfinderführerin; und dazu noch die üblichen Leder- und PVC-Gerätschaften, samt hüfthohen Stiefeln, Umhängen und Gesichtsmasken.
Eine Kommode enthielt ein kleineres Sortiment von Kleidungsstücken für Kunden, die nichts mitgebracht hatten, so etwa für die Verkleidung als Pfadfinder, Schuljungen und römische Sklaven. In einem Winkel waren der Hocker für den Missetäter und der Fußblock versteckt, während eine Truhe die Ketten, Handschellen, Riemen und Reitpeitschen enthielt, die für die Versklavungs- und Züchtigungsszene gebraucht wurden.
Sie war eine Hure, die ihre Sache verstand, und erfolgreich sowieso. Viele ihrer Kunden kamen regelmäßig wieder. Ein Stück weit Schauspielerin – alle Nutten müssen etwas von einer Schauspielerin haben, das Umgekehrte kommt wahrscheinlich eher selten vor —, konnte sie sich vollkommen überzeugend in die Wunschphantasien ihrer jeweiligen Kunden einleben. Doch zugleich blieb sie immer distanziert-beobachtend, registrierend, von heimlicher Verachtung erfüllt. Nichts an ihrer Tätigkeit berührte sie selbst – ihre persönlichen Vorlieben sahen ganz anders aus.
Sie war seit drei Jahren in der Branche tätig und beabsichtigte, sich nach zwei weiteren Jahren zurückzuziehen, einmal wirklich ordentlich abzusahnen und irgendwo weit weg von ihrem gutangelegten Geld ein Leben im Luxus zu führen.
An diesem Nachmittag klingelte es an der Wohnungstür. Sie war, wie immer, spät aufgestanden und noch im Negligé und Morgenmantel. Sie runzelte die Stirn; Kunden kamen nur zu der vereinbarten Zeit. Ein Blick durch das Guckloch in ihrer Wohnungstür zeigte, wie in einem Goldfischbecken, das zerzauste graue Haar von Bruno Morenz, ihrem väterlichen Freund aus dem Außenministerium. Sie seufzte, setzte ein ekstatisches Willkommenslächeln auf und öffnete die Tür.
»Bruno, Liiiiiebling …«
Zwei Tage später wurde Sam McCready von Timothy Edwards zum Lunch in den Brook’s Club im Londoner Stadtteil St.James ausgeführt. Edwards war in mehreren Herrenklubs Mitglied, aber zum Mittagessen suchte er am liebsten Brook’s auf. Dort bestand immer eine gute Chance, daß man bei einem zufälligen Zusammentreffen ein paar Worte mit Robert Amstrong, dem Kabinettssekretär, wechseln konnte, der als der vielleicht einflußreichste Mann in England galt, ganz sicher aber als der Wortführer der fünf Weisen, die eines Tages beschließen würden, wen sie Margaret Thatcher als neuen Chef der SIS empfehlen wollten.
Beim Kaffee in der Bibliothek, unter den Porträts der Dilettantes, der Gründer des Klubs, kam Edwards allmählich zur Sache.
»Wie ich unten schon gesagt habe, Sam, alle sind sehr zufrieden mit Ihnen, wirklich sehr zufrieden. Aber jetzt bricht eine neue Ära an, Sam, eine Ära, die, dafür spricht viel, unter dem Leitmotiv ›immer äußerst korrekt‹ stehen muß. Es geht darum, daß ein paar von den alten Methoden, zum Beispiel das Umgehen von Vorschriften – wie soll ich mich ausdrücken? – gezügelt werden müssen.«
»Gezügelt ist sehr gut ausgedrückt«, pflichtete Sam McCready bei.