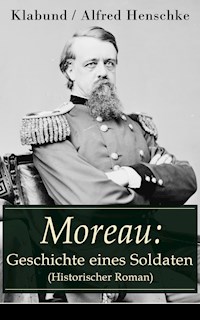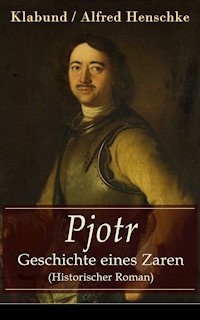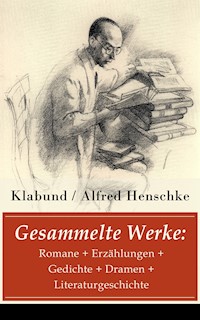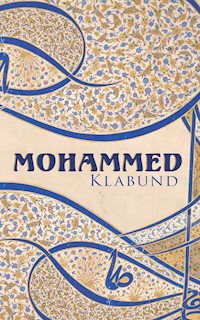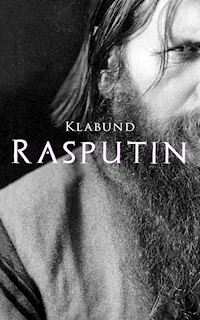2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde
Impressum
Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde
Klabund
1922
Impressum
Copyright: vss-verlag
Jahr: 2023
Lektorat/ Korrektorat: Hermann Schladt
Covergestaltung: Hermann Schladt unter Nutzung eines Porträts von Emil Stumpp (1886–1941)
(Die Bühne. Wochenschrift für Theater, Kunst, Film, Mode, Gesellschaft, Sport5. Jahrgang, Heft 198 vom 23. August 1928; S. 7https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=bue& datum=1928&page=2009&size=45, Bild-PD-alt, https: //de.wikipedia.org/w/index.php?curid=11770598)
Verlagsportal: www.vss-verlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.
Buchtext
Urzeit
Diese kleine Literaturgeschichte verfolgt weder philosophische noch philologische Absichten. Sie ist nichts als der Versuch einer kurzen, volkstümlichen, lebendigen Darstellung der deutschen Dichtung. Die Dichtung eines Volkes beruht auf dem Eigentümlichsten, was ein Volk haben kann: seiner Sprache. In diesem Sinne wird und soll sie immer »völkisch« sein. Die deutsche Dichtung ist vergleichbar einem Baum, der tief in der deutschen Erde wurzelt, dessen Stamm und Krone aber den allgemeinen Himmel tragen hilft. Es gibt eine deutsche Erde. Der Himmel ist allen Völkern gemeinsam.
Blüten vom Baum der deutschen Dichtung mögen vom Wind da- und dorthin getragen werden. Zu Früchten reifen werden nur die, die am Baum bleiben. Sie werden im Herbst geerntet werden, und im Schatten des Baumes wird ein ganzes Volk sich an ihnen erquicken.
*
Jener germanische Jüngling, der einsam im Eichenwald am Altare Wotans niedersinkend, von ihm, der jeglichen Wunsch zu erfüllen vermag, in halbartikuliertem Gebetruf, singend, schreiend, die Geliebte sich erflehte, dessen Worte, ihm selbst erstaunlich, zu sonderbaren Rhythmen sich banden, die seiner Seele ein Echo riefen, war der erste deutsche Dichter.
Wie eine Blüte brach ihm das Herz in einer Nacht auf, dass es der Sonne entgegenglühte, eine Schwestersonne. dass er dem Sonnengott sich als geringerer Brudergott verwandt fühlte, dass er Worte fand wie nie zuvor. Unbewusstes ward bewusst. Liebe machte den Stummen beredt. Er sang einen heiligen Gesang. Er neigte sich dem Gott, er neigte sich der Geliebten, er versank vor sich selbst. Himmel, Erde, Mensch verschmolz in seinem Gedicht.
Die Sehnsucht wurde Wort, das Wort wurde Erfüllung. Aller Dichtung Urbeginn ist die Liebe. Der Weg zur Liebe führt durch Hass und Kampf und Schmerz. Der Urmensch sang den Hass gegen den Feind, den Feind seines Gottes und Räuber seines Weibes. Er singt den Schmerz seiner im Weltall verlorenen einsamen Seele, die dahinfliegt wie ein Meervogel über den Ozean, und nur die Sonne ist ihre Hoffnung. In ihr verehrt er Gottes Auge, das ihn beglänzt, jeden Tag neu, nach fürchterlicher Nacht. Und er sieht auch in sich die ewige Nacht, aus der er nur immer kurz zu Dämmerung und Helle erwacht, und seine Sehnsucht sucht die Nacht immer mehr mit Licht zu erfüllen. Und das Licht zeigt ihm den langen mühseligen Weg des Menschen, welcher aus Finsternis und Sumpf emporführt zu Licht und Gebirg, bis über die Wolken, bis an Gottes Thron selbst.
Nibelungen- und Gudrunlied
Eines der ältesten deutschen Sprachdenkmäler ist das Wessobrunner Gebet, um 800 entstanden, voll von großer Anschauung und starker dichterischer Kraft. Karls des Großen Biograph Einhart († 840) erzählt, dass Karl der Große alle alten Sagen habe aufschreiben lassen. Leider haben seine frömmelnden Nachfolger, von un-verständigen Pfaffen aufgereizt, dafür gesorgt, dass derlei »heidnisches« Zeug ausgerottet wurde, wo es sich zeigte. Unersetzbares ist verloren gegangen. Als Ersatz werden uns blasse, versifizierte Heiligenlegenden und Christusgeschichten aufgetischt.
Unter den Nachfolgern Karls des Großen blüht, begünstigt von den Priestern, die lateinische Poesie. Da wir nur von der deutschen Dichtung, dem deutschen Wort sprechen wollen, gehört sie nicht in unsere Betrachtung. Die deutsche Sprache wurde höchstens dazu verwandt, um dem Laien heilige Texte zu über-setzen.
Das stolzeste Epos der Deutschen ist das Nibelungenlied (um 1210). Die sagenhafte deutsche Urzeit entsteht in den Rittern der Völkerwanderung noch einmal. Jeder der Hel-den: Siegfried, Hagen, Gunther ist ein Held seiner Zeit, aber mit den strahlenden Attributen der Vorzeit umgeben. »Welch ein Gemälde der menschlichen Schicksale stellt uns das Lied der Nibelungen auf«, schreibt A.W. von Schle-gel .»Mit einer jugendlichen Liebeswerbung hebt es an, dann verwegene Abenteuer, Zauber-künste, ein leichtsinniger, aber gelungener Betrug. Bald verfinstert sich der Schauplatz; gehässige Leidenschaften mischen sich ein, eine ungeheure Freveltat wird verübt. Lange bleibt sie ungestraft; die Vergeltung droht von ferne und rückt in mahnenden Weissagungen näher; endlich wird sie vollbracht. Ein unentfliehbares Verhängnis verwickelt Schuldige und Unschuldige in den allgemeinen Fall, eine Heldenwelt bricht in Trümmer.« Haben wir nicht alle das Nibelungenlied am eigenen Leib und an eigener Seele verspürt? Ein unentfliehbares Schicksal hat uns, Schuldige und Unschuldige, in den allgemeinen Fall verwickelt, und eine Welt ist in Trümmer gebrochen.
Das Gudrunlied (um 1230) klingt sanfter, bürgerlicher, versöhnender aus. Zwar stehen auch hier Gewalttat und Schande am Anfang. Aber das Lied endet heiter mit einer vierfachen Hochzeit und hellen Blicken in eine rosenrote Zukunft, da kein Haß und kein Kampf mehr sein wird.
Der Minnesang
Der Minnesang war von Vaganten und fahrenden Sängern gern gepflegt und in Volksliedern von Mund zu Mund gegangen, ehe sich, unter dem romantischen Einfluss der Troubadoure, die deutschen Dichter seiner annahmen und die Frau als Geliebte und Gattin auf einen goldenen Throne setzten, wie man ihn auf mittelalterlichen Miniaturen der Madonna mit dem Jesuskinde weihte. Von Österreich nahm der Minnesang seinen Anfang. Der von Kürenberg sang um 1150 das Lied vom Falken, den er sich mehr denn ein Jahr gezähmt und der ihm dann »in anderiu lant« entflog. Ein Spielmann, genannt der Spervogel (†1180), dichtete die ersten lehrhaften Sprüche und Fabeln, z.B. vom Wolf, der in ein Kloster ging und ein geistlich Leben führen wollte. Im Kloster vertraute man ihm das Hüten der Schafe an. Die Nutzanwendung braucht man einem Menschen heutiger Zeit nicht besonders nahe zu legen. Derartige Wölfe – und derartige Schafe sind leider heute verbreiteter denn je.
Walter von der Vogelweide
Von 1160 bis 1230 ritt Herr Walter von der Vogelweide durch die Welt. Er kam von Tirol, dort, wo die Berge das Eisacktal vom Himmel abschließen, wo man den Himmel in der eigenen Brust suchen muss. Er trieb seinen mageren, schlecht genährten Klepper durchs Burgtor von Wien, und die Ritter neigten sich vor ihm. Im Bischofssitz von Passau erklang sein Gelächter, das er dem Bischof wie eine Handvoll Haselnüsse an den tonsurierten Kopf warf. Dem heiligen Vater in Rom war er aus deutschem Herzen feindlich gesinnt: er sah, politischer Denker, der er war, dass die Päpste sehr diesseitige römische Politik und Diplomatie trieben, der die deutschen Kaiser sich selten genug gewachsen zeigten. Er stand auf der Wartburg und sah hinab auf das thüringische und deutsche Land. Wie blühte der Frühling, wie sangen die Amseln! Unter einem Wacholderstrauch lagen zwei Liebende. Unter der Linde stand ein fahrender Geiger und geigte zum Tanz. Ein schönes Fräulein lächelte seitwärts, selbstvergessen. Da lächelte Walter von der Vogelweide. Er bückte sich und wand in Eile mit geschickten Fingern einen Kranz aus Butterblumen, die zwischen den Steinritzen auf dem Burghofe blühten, nahm den Kranz, sprang zu dem errötenden Mädchen, verneigte sich, und sprach:
Nehmt, Fraue, diesen Kranz,
So zieret ihr den Tanz
Mit schönen Blumen, die am Haupt ihr tragt.
Und der alte Geiger, mit dem Totenkopf zum Tanz taktierend strich den Bogen. Tod spielte zum Leben auf. Der Ritter tanzte mit dem Fräulein. Sie hieß Maria wie die Mutter Gottes selber und war ihm Gottesmutter, Gottesschwester, Gottestochter all in eins.
Mit Friedrich dem Zweiten ritt Walter von der Vogelweide 1227 auf den Kreuzzug. Er hasste die Pfaffen und den falschen Gott in Rom. Er wollte den wahren Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Er sang den Kreuzfahrern das Kreuzlied. Und am heiligen Grab sank er ins Knie:
Jetzt erst bin ich beseligt,
da mein sündig Auge
die heilige Erde betrachten darf.
Dahin kam ich, wo den Pfad
Gott als Mensch betreten hat.
Ernst und wie von einer Wolke beschattet, kehrte er aus dem heiligen Lande heim. Es war Frühling in ihm gewesen, als er auszog. Palästina war sein Sommer geworden. Nun sah er Herbst und Verwesung, Elend und Bitternis überall. Die Nebelkrähen hingen in Schwärmen über dem deutschen Land. Und in Würzburg war es, wo er den Blick auf den fließenden Main gerichtet, sein letztes Gebet dichtete: jene schönste Elegie deutscher Sprache: Owê war sint verswunden alliu miniu jâr! Im Lusamgärtchen, vor der Pforte des neuen Münsters, wurde das Sterbliche von Walter von der Vogelweide 1230 bestattet. Die letzte Zeit vor seinem Tode hielt er sich von den Menschen fern: er stand stundenlang am Main und fütterte die Vögel und die Fische mit Brotkrumen. Und in seinem Testament bestimmte er, dass aus seiner Hinterlassenschaft mehrere Säcke Körner zu kaufen seien und dass auf seinem Grabe die Vögel stets Körner und Wasser vorfinden sollten.
Noch im Tode wollte er seinem Namen Ehre machen: sein Grab noch sollte den Vögeln eine Weide sein. Lest seine Liebeslieder, ihr Liebenden! Klausner Schwermut, weise uns die Kapelle seiner Melancholie! Wo im kahlen Winter ein frierender Vogel hungrig an eure Fensterscheiben pickt: gebt ihm zu fressen, gedenkt des Herren von der Vogelweide! Solange die deutsche Dichtung besteht, wird sein Name unvergessen sein. ‚ Her Walther von der Vogelweide, swer des vergaez’, der taet mir leide’, rief 1300 Hugo von Trimberg über sein Grab.
Die deutsche Mystik: Mechthild von Magdeburg, Meister Eckhard und Johannes von Saaz
Die Blume der deutschen Mystik keimte zuerst in den Klöstern. Schwester Mechthild v. Magdeburg (1212 bis 1294) schrieb ihr Buch vom fließenden Licht der Gottheit: voll seliger Versunkenheit in Christo. In ihren Ekstasen sah sie Jesus als schönen Jüngling ( Schöner Jüngling, mich lüstet dein) ihre Zelle betreten, er war ihr wie ein Bräutigam zur Braut, und ihre himmlischen Sprüche sind wie irdische Liebeslieder. Ihre Gottesminne (Eia, liebe Gottesminne, umhalse stets die Seele mein!) war der Gottesminne des Wolfram tief verwandt. Die reine Minne (nicht jede höfische oder ritterliche oder bäurische Minne) galt ihr als oberstes Prinzip.
»Dies Buch ist begonnen in der Minne, es soll auch enden in der Minne; denn es ist nichts so weise, so heilig, noch so schön, noch so stark, noch also vollkommen als die Minne«.
Mechthild von Magdeburg ist trunken vor Askese. Ihr Geist kennt die Wollust des Fleisches. Jesus ist ihr zärtlicher Gespiel und sie seine Tänzerin.
Meister Eckhard (1260 bis 1327, gestorben in Köln), ihr mystischer Bruder, verhält sich zu ihr wie ein Kauz oder Uhu zu einer Libelle. Ihr Leben und Dichten war ein Schweben und Ja-sagen, das seine ein tief in sich Beruhen und Ent-sagen. Er liebte das Leid um des Leides willen: jeder Schmerz war ihm eine Station zum Paradies. Er riss die Wunden, die in ihm verheilen oder verharschen wollten, künstlich wieder auf: dass nur sein Blut fließe. Seine Gedanken scheinen verschleiert, ja manche haben dunkle Kapuzen übers Haupt gezogen und sind unerkennbar. Sein Buch der göttlichen Tröstung ist ein Trostbuch für die, die am Tode und am Leben leiden.
Ein Trostbuch rechter Art will auch der »Ackermann von Böhmen« sein, den Johannes von Saaz 1400 in die Welt schickte. Der Dichter kleidet seine Trostschrift in die Form eines Zwiegesprächs zwischen einem Witwer und dem Tod. Der Witwer fordert vor Gericht (dem Gottesgericht) sein Weib vor dem Räuber und Mörder Tod zurück.
»Schrecklicher Mörder aller Menschen, Ihr Tod, Euch sei geflucht! Gott, der euch schuf, hasse Euch; Unheils Häufung treffe Euch; Unglück hause bei euch mit Macht; ganz entehret bleibt für immer!« so beginnt der Kläger seine Klage.
Und der Tod antwortet:
»Du fragst, wer wir sind: wir sind Gottes Hand, der Herr Tod, ein gerecht schaffender Mäher. Braune, rote, grüne, blaue, graue, gelbe und jeder Art glänzende Blumen und Gras hauen wir nacheinander nieder, ihres Glanzes, ihrer Kraft und Vorzüge ungeachtet. Sieh, das heißt Gerechtigkeit.«
In immer verzweifelteren Ausbrüchen pocht der Mensch, aller Menschheit Abgesandter, an das Rätsel des Todes, der ihm sinnlos wie ein Mäher im Herbst unter den Menschen zu hausen scheint, das Glück des Liebenden und die Tat des Künstlers, die Stellung des Königs nicht achtet, bis Gott selbst das Urteil spricht:
»Kläger, habe die Ehre, du Tod aber, habe den Sieg! Jeder Mensch ist dem Tode sein Leben, den Leib der Erde, die Seele uns zu geben verpflichtet.«
Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg
Mit den Minnesängern wurde die deutsche Literatur sich ihrer bewusst. Zwar gab es noch nicht das Wort, aber der Begriff war vorhanden. Die öffentliche Kritik trat auf: es waren die Fürsten, die als Mäzene das erste Recht der Beurteilung für sich in Anspruch nahmen.
Die Themen, die Hartmann von Aue († 1215) in seinen kleinen Epen anschlägt, sind von schönster Intensität: in »Gregorius« überträgt er den Ödipusstoff auf ein mittelalterliches Milieu. Gregorius liebt und heiratet unwissentlich seine eigene Mutter. Als er die Schande erfährt, sucht er die Sünde zu sühnen, indem er sich prometheisch an einen Felsen schmieden lässt. Nach siebzehn Jahren unerhörter Qual erlösen ihn die Römer; er wird von ihnen im Triumph ob seiner Heiligkeit auf den verwaisten Papstthron erhoben und spricht, unfehlbar geworden durch sein titanisches Leid, die eigene Mutter ihrer Schuld ledig.
Im »Armen Heinrich« bemächtigt sich Hartmann eines deutschen Stoffes. Ein Ritter wird vom Aussatz befallen. Ein Mittel nur gibt es, ihn zu retten: Das Blut einer unberührten Jungfrau. Aus Liebe zu ihm entbietet sich ein Mädchen für ihn zu sterben. Aber der arme Heinrich nimmt das Opfer nicht an: trotz teuflischer Versuchung. Da erbarmt sich auf Flehen des Mädchens Gott der Liebenden; er macht den armen Heinrich gesund und zum reichen Heinrich durch den Besitz der Geliebten.
Ein jüngerer Zeitgenosse von Hartmann ist Wolfram von Eschenbach (etwa 1170 bis 1250), ein Bayer aus Eschenbach bei Ansbach. Er war eine armer Teufel wie Walter von der Vogelweide, mit dem er am Hofe des Landgrafen von Thüringen öfter zusammentraf. Als er 1217 dem Hofleben für immer den Rücken wandte, und auf sein kleines Gut heim zu Weib und Kind ritt, vollzog er eine symbolische Handlung. Er kehrte wirklich heim: zu sich, in sich. Er hatte die höfische Minne, die schon einen eigenen Komment entwickelte, dessen Verstöße unnachsichtlich geahndet wurden, von Herzen satt und sehnte sich nach einem einfachen, ungezierten Wort aus unverzerrtem Frauenmund.
Nach Lippen, die ohne Anfragung einer Etikette auf den seinen lagen, nach einem Herzen, das ihm herzlich zugetan war. Nach einem Kinde, das nicht »Fräulein« oder »junger Herr« tituliert wurde, sondern mit dem er reiten und spielen durfte wie mit sich selbst. Er hatte 1200 bis 1210 in 24 810 Versen im » Parzival« den Ritterroman der Deutschen geschaffen, er hatte ihnen den Spiegel vorgehalten. Aber es war schon eine vergangene edlere Zeit, die sich in ihm spiegelte. Der Dichter ist oft nur der Vollstrecker des letzten Willens einer Epoche, der er schon längst nicht mehr angehört. Der Stoff ist französischen und provenzalischen Vorbildern entnommen. Die Idee der Erlösung christlich. Aber der Leidens- und Freudensweg, den Parzival gehen muss, seine Entwicklung vom ahnungsvollen, aber ahnungslosen Kind zum seiner Seele bewussten Mann ist ganz Wolframsche Prägung. Er ist den Weg des Knaben Parzival selbst gegangen.
Gottfried von Straßburg (um 1210), Wolframs größter Zeitgenosse, war auch sein größter Gegner. Er fand den Parzival dunkel und verworren, ohne einheitliche Handlung und stellenweise schwer verständlich. Im Tristan stellte er dem Parzival sein Ritterepos gegenüber: von einer leidenschaftlichen Klarheit des Themas und der Formulierung und trotz der Leidenschaft nicht ohne Zierlichkeit und Zartheit. Er hatte von seinem Standpunkt mit der Beurteilung des Parzival recht. In Wolfram und Gottfried spitzten sich, wie später bei Goethe und Schiller, zwei dichterische Typen bis ins Polare zu: der Pathetiker und der Erotiker. Wolfram-Schiller, das besagt: Kampf, Forderung, Dornenweg, Verblendung und Erlösung, Gottesminne, Jenseits. Goethe-Gottfried, das heißt: Sein, Genuß, selbst des Schmerzes, Blumenpfad, Sonnenblendung, Glanz und Erfüllung: Menschenminne, Diesseits.