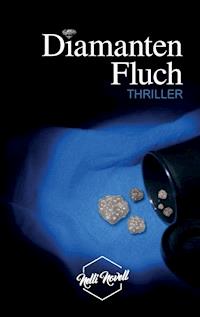
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Moarito und Rando fristen ihr Leben als Arbeiter in einer südafrikanischen Diamantenmine. Jeden Tag lassen sie sich quälen und demütigen, nur um am Ende ein Leben in Armut zu fristen. Nachdem sie unbemerkt einige Diamanten aus der Mine geschmuggelt haben, ist ihre Freiheit zum Greifen nah. Aber es kommt ganz anders als geplant. Im Tumult eines Aufstands der schwarzen Minenarbeiter wird Rando schwer verletzt. Bevor er stirbt kann er die sorgsam in einer Filmdose verborgenen Beutediamanten dem deutschen Botschafter, Frederick von Minnehagen, zustecken. In dessen Jackentasche treten die Diamanten eine unfreiwillige Reise nach Europa an. Moarito überwindet alle Widerstände und schafft es, den Diamanten bis nach Spanien zu folgen. Doch kurz vor seinem Ziel kommt ihm der skrupellose spanische Gauner Aurelio in die Quere ... ein Spiel um Leben und Tod beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Alle beschriebenen Personen, Begebenheiten und Gedanken sowie Dialoge sind Fiktion. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen oder Begebenheiten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für
Nina und Julia
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Südafrika, Kimberley
London
Südafrika
Spanien, Busot
Südafrika, Kimberley
Spanien, Busot
Südafrika, Kimberley
Spanien
Südafrika, Kimberley
Spanien, Busot
Südafrika, Kimberley
Spanien, Busot
Südafrika
Spanien
Südafrika
Spanien
Südafrika
Spanien
Südafrika
Spanien
Deutschland
Spanien
Deutschland/Spanien
Südafrika
Spanien
Südafrika
Spanien
Hohenschäftlarn
Spanien
Hohenschäftlarn
Spanien
Hohenschäftlarn
Spanien
London
Spanien
Karibik
Spanien
Südafrika
London
Südafrika
Prolog
Caroline und Natalie waren gerade erst aus ihrer Betäubung aufgewacht. Sie lagen ganz ruhig da, weil sie nicht wussten, wo sie waren. Es war stockdunkel. Als sie Schritte hörten, richteten sie sich auf. Caroline tastete vorsichtig nach Natalies Hand. Natalie drückte ihre Hand fest und flüsterte: „Hab keine Angst. alles wird gut.“
Die Tür wurde aufgestoßen und es fiel ein Lichtstrahl in den Raum. Er blendete sie so, dass sie sich die Augen zuhalten mussten. Nur langsam gewöhnten sie sich an die Helligkeit.
José ging zögernd auf sie zu. Er hasste diesen Job.
„Geht es euch gut?“, fragte er freundlich.
Es entstand eine längere Pause. Natalie und Caroline waren verwirrt. Wer war dieser Mann? Warum fragte er, wie es ihnen ging?
„Es würde uns besser gehen, wenn wir nicht hier wären. Was soll das ganze eigentlich?“, fragte Natalie mutig.
Caroline fing unwillkürlich an zu zittern. Sie hatte Angst. Sie wollte nicht weinen, aber die Tränen liefen ihr einfach über die Wangen und tropften auf ihr T-Shirt. Natalie nahm sie in den Arm und drückte sie.
José schaute zu Caroline und sagte mit einem hilflosen Schulterzucken: „Wir führen nur einen Auftrag aus. Unser Chef sucht eine Filmdose, die in dem Haus der von Minnehagens sein sollte. Leider haben wir sie nicht gefunden. Entweder hat sie der Schwarze da oder aber ihr habt sie.“
Als José mit der Hand auf Moarito zeigte, schauten Caroline und Natalie erstaunt in die gegenüberliegende Ecke des schmuddeligen Raums. Dort lag ein magerer schwarzhäutiger Mann auf einer Matratze und schaute sie mit großen Augen traurig an.
1. Südafrika, Kimberley
Rando und Moarito saßen auf einer Anhöhe am Rande ihres Dorfes und rauchten ihre selbstgeschnitzten Pfeifen.
„So kann es nicht weitergehen“, unterbrach Rando die Stille. „Wir können uns diese Gemeinheiten nicht länger bieten lassen. Wir sind nicht dümmer als die Weißen, werden aber bei den wenigen lukrativen Posten nie berücksichtigt. Weißt Du, wer der neue Oberaufseher geworden ist? Natürlich ein Weißer. Uns wurde noch nicht einmal mitgeteilt, dass der Posten neu besetzt wird. Wenn wir es nicht wagen, einen Aufstand anzuzetteln, wird sich nie etwas für uns verbessern.“
Wütend und enttäuscht stieß er mit seinem Fuß gegen die Steine am Boden und sah ihnen nach, wie sie die Anhöhe hinunterrollten.
Moarito konnte den Ärger von Rando nicht so ganz nachempfinden, obwohl er natürlich auch mehr Geld gebrauchen könnte. Von seiner einzigen Frau Safira hatte er vier Kinder, drei Mädchen und einen Jungen.
Ramoto, sein einziger Sohn, würde sich schon durchschlagen, aber seinen Töchtern Naomi, Selina und Namira wollte er gerne eine gute Schulbildung zukommen lassen, denn er könnte es nicht ertragen, wenn sie mit dreizehn Jahren heiraten und kurz darauf Kinder bekommen würden.
Er selbst konnte weder lesen noch schreiben und sah dadurch keine Chancen für sich, irgendwann einen besseren Posten zu bekommen.
Moarito war Rando sehr dankbar, weil er es irgendwie geschafft hatte, ihn vom Diamantenabbau zum Sortieren der Steine befördern zu lassen. Es war kein Traumjob, aber es war der beste Job, den er hatte bekommen können. Seitdem bewunderte er Rando und tat alles, um sich erkenntlich zu zeigen.
Rando war gebildeter. Er konnte lesen und schreiben und ließ keine Möglichkeit aus, sich weiter zu bilden. Wie er das schaffte, war Moarito schleierhaft, aber Rando lernte immer wieder jemanden kennen, der mit ihm über die Politik diskutierte und ihn auf neue Ideen brachte.
„Aufstand ist gut. Aber noch besser wäre, wir würden ein paar Steine mitgehen lassen. Das kann doch nicht so schwer sein“, murmelte Rando.
„Bist Du verrückt?“, rief Moarito entsetzt. In seinen Augen standen Angst und das blanke Entsetzen.
„Pssssst. Schrei doch nicht so. Du könntest doch auch ein bisschen Geld gebrauchen. Wenn Deine Rückenschmerzen schlimmer werden, kannst Du bald auch keine Steine mehr sortieren. Was wird dann aus Safira und den Kindern? Stell Dir vor, wir könnten in eine Großstadt ziehen und die Kinder bekommen alle eine anständige Schulbildung. Und ich könnte meine Schwester zu mir holen und ihr ein angenehmes Leben ermöglichen.“
Moarito war zu entsetzt, um zu antworten, aber Rando sah das kurze Flackern in Moaritos Augen, das ausdrückte, dass er vielleicht doch nicht so abgeneigt wäre.
Rando klopfte ihm auf die Schulter und sagte leise: „Lass es Dir noch einmal durch den Kopf gehen. Aber zu niemandem ein Wort. Auch nicht zu Safira. Versprich es mir.“
„Nein, natürlich nicht. Ich bin ja nicht lebensmüde.“
Rando lachte und lief den Berg hinunter. Moarito blieb noch lange sitzen und dachte nach.
* * *
Safira fegte die letzten Krümel aus der Hütte. Sie holte sich ihr Tragetuch und band sich gekonnt ihr jüngstes Mädchen Namira an die Brust. Namira konnte mit ihren eineinhalb Jahren zwar schon laufen, aber der Weg zu Safiras Oma war so beschwerlich, dass sie Namira doch lieber gleich ins Tuch nahm.
Sie verließ die dunkle Hütte und hielt nach ihrer zweitjüngsten Tochter Ausschau. „Selina!“, rief sie laut, konnte sie jedoch nirgendwo entdecken.
Sie ging zu dem nahegelegenen Bach, da sie wusste, dass ihre älteren Kinder Ramoto und Naomi dort gern mit ihren Freunden spielten. Tatsächlich stand Selina mitten im Bach und spritzte die anderen Kinder nass, die am Ufer mit den Steinen spielten.
„Selina!“, rief Safira empört. „Ich habe Dir doch schon hundertmal gesagt, dass Du nicht zum Bach darfst. Komm sofort aus dem Bach heraus.“
„Warum denn?“, fragte Selina mit einem frechen Lachen.
„Weil es erstens viel zu gefährlich für Dich ist und...“, setzte Safira an.
„Und zweitens?“, fragte die dreieinhalb Jahre alte Selina, die sich mit vor der Brust verschränkten Armen nicht von der Stelle bewegte. Sie lachte immer noch, als ihr fünfjähriger Bruder Ramoto sie packte und aus dem Bach zerrte.
„Danke, Ramoto, aber ich habe Dich doch gebeten, Selina nicht mit hierher zu nehmen“, sagte Safira tadelnd.
Als ihr Sohn jedoch den Kopf hängen ließ, zerzauste sie ihm zärtlich die Haare. Sie wusste, dass Selina gerne einfach das tat, was ihr gerade einfiel und sich nicht danach richtete, was ihr jemand aus der Familie sagte.
„Ich gehe jetzt zur Oma, möchtest Du mitkommen?“, fragte sie Ramoto. Doch der schüttelte nur den Kopf. „Nein, ich möchte lieber mit Jamon weiter an dem Damm bauen.“ Auch Naomi ließ sich nicht dafür begeistern.
„Oh, fein. Wir gehen zur Oma“, jubelte Selina.
„Ja, aber wir müssen Dir erst trockene Sachen anziehen. Also komm“, sagte Safira. Es freute sie, dass Selina ihre Uroma so gern hatte.
Safiras Oma weigerte sich, zu ihnen ins Dorf zu ziehen. „Ich brauche meine Ruhe, das weißt Du doch“, sagte sie ihr immer, wenn Safira sie bat, zu ihnen zu ziehen.
Niemand, nicht mal Safira wusste, wie alt Oma Naomi war. Sie lebte schon seit ewigen Zeiten in ihrer Hütte, die tief im Wald verborgen war.
Safira schaute so oft es ging bei ihr vorbei, weil sie das Gefühl hatte, ihre geliebte Oma hatte Schmerzen. Wenn sie sie jedoch danach fragte, wollte ihre Oma nicht antworten. Sie schüttelte dann immer nur verärgert ihren Kopf.
Der Weg zu Oma Naomis Hütte war sehr beschwerlich. Safira fühlte, wie ihr der Schweiß den Rücken hinunterlief. So schlapp hatte sie sich schon lange nicht mehr gefühlt.
„Namira, Du wirst auch immer schwerer. Ich fürchte, bald musst Du diesen Weg selbst laufen“, stöhnte Safira. Selina hüpfte dagegen leichtfüßig über jeden Stamm, der ihr in die Quere kam.
* * *
Oma Naomi saß auf einem Baumstumpf vor ihrer Hütte und sortierte Kräuter. Als sie ihre Enkelin und ihre Urenkel sah, strahlte sie.
„Safira, Namira, Selina! Schön, dass ihr mich besucht“, sagte sie glücklich. Als sie ihr jedoch in die Augen sah, setzte sie besorgt hinzu: „Aber in Deinem Zustand solltest Du Dich mehr schonen. Komm setz Dich zu mir, ich hol Dir einen Tee. Der wird Dir gut tun“, und verschwand im Haus.
„In welchem Zustand? Ich bin heute einfach nur müde, weil ich letzte Nacht kaum geschlafen habe.“ Doch noch während Safira redete, wurden ihr alle Anzeichen einer Schwangerschaft bewusst, die sie in der letzten Zeit verdrängt hatte. Sie schaute auf und sah in das lächelnde Gesicht ihrer Oma.
„Oh nein. Wie sollen wir das nur schaffen“, sagte sie geschockt. „Moarito hat so große Rückenschmerzen, dass er morgens kaum aus dem Bett kommt. Wie sollen wir noch ein fünftes Kind durchbringen, wenn er seine Arbeit verliert.“
Oma Naomi streichelte ihr beruhigend über den Kopf. „Moarito soll keine Dummheiten machen. Mach ihm immer wieder bewusst, dass er eine große Verantwortung für seine Familie hat.“
„Aber er ist doch schon so verantwortungsbewusst. Er will keine zweite Frau. Er sagt, dass er nur mich liebt. Er ist immer für die Kinder da und arbeitet mehr, als für seinen Rücken gut ist. Es gibt keinen besseren Mann als ihn, Oma“, erwiderte Safira.
Oma Naomi ging kopfschüttelnd in ihre Hütte. „Mehr als warnen kann ich nicht“, murmelte sie vor sich hin.
Safira setzte sich auf die weiche Erde und lehnte sich an einen Baumstamm. Der Tee tat ihr so gut. Sie fühlte sich entspannt und schläfrig.
Als sie wieder aufwachte, war es schon spät am Nachmittag. Erschrocken über ihren langen Schlaf suchte sie ihre Oma und die Kinder.
Oma Naomi zeigte Selina und Namira gerade verschiedene Kräuter und erklärte ihnen, wofür die Kräuter gut waren. Selina war erstaunlich aufmerksam.
„Jetzt habe ich fast den ganzen Nachmittag geschlafen. Warum habt ihr mich denn nicht geweckt?“, fragte Safira.
„Weil Du diesen Schlaf dringend nötig hattest“, sagte Oma Naomi bestimmt. Sie reichte Safira einen Topf. „Mit dieser Salbe massierst Du Moarito jeden Abend den Rücken ein. Es wird seine Schmerzen lindern. Und sag meinen anderen zwei Urenkeln schöne Grüße. Es würde mich freuen, auch sie wieder einmal zu sehen.“ Sie küsste alle zum Abschied und winkte ihnen nach.
2. London
„Diesmal musst Du Dir wirklich einen anderen suchen.“ Seufzend ließ sich Henry Hayes in den abgewetzten Ledersessel fallen. „Ich kann Maggy zurzeit nicht allein lassen. Sie ist im achten Monat schwanger und hat wahnsinnige Angst vor der Geburt.“
Hilflos hob er seine Schultern. „Obwohl mich die Unruhen in Südafrika schon immer interessiert haben.“ Resigniert starrte er auf den Perserteppich, der seine besten Tage bereits hinter sich hatte.
Richard Piquet ging ruhelos im Zimmer auf und ab. „Und wenn Helen sich solange um Maggy kümmert, bis Du wieder zurück bist? Du weißt, sie ist eine hervorragende Krankenschwester. Maggy könnte in unserem Gästeappartement wohnen und sich von Helen rundum verwöhnen lassen. Damit würden wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil Helen sich ohnehin zu Hause tödlich langweilt.“
Als Richard Henrys zweifelnde Mine sah, versuchte er ihm den Auftrag noch einmal auf eine andere Art schmackhaft zu machen. „Stell Dir vor, wenn wir von der „The Times“ den Artikel als Erste bringen. Seit Beendigung des Burenkrieges brodelt es dort schlimmer als je zuvor. Die Politiker wollen uns weismachen, dass seit der Einigung zwischen den burischen Generälen und den britischen Militärführern Friede, Freude, Eierkuchen herrscht.“
Richard blieb stehen und lachte freudlos auf. „Pahh, nichts davon ist wahr!“, rief er aufgeregt. Hektische rote Flecken breiteten sich in rasender Geschwindigkeit auf seinem Gesicht und Hals aus. Als er sich mit einem Seitenblick Henrys Aufmerksamkeit versichert hatte, durchquerte er noch ruheloser als zuvor den Raum.
Henry wusste, dass dieses Thema Richards Blut in Wallung brachte, da er kurz vor der Beendigung des Burenkrieges von einem Querschläger schwer verletzt und außer Landes gebracht worden war. „Mit den Fotos und Deinen Berichten über die Diamantenmine und die Anführer, die den Aufstand planen, werden wir beweisen, dass dort kein Friede herrscht. Gabrielle ist sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern kann. Danach wird es dort von Reportern nur so wimmeln und Du hast bis dahin schon alles im Kasten.
Wenn einer es hinbekommt, das Vertrauen der Schwarzafrikaner zu gewinnen, dann bist Du das. Du schaffst es sicher, dass sie uns Fotos von sich und ihren wahren Lebensbedingungen machen lassen. Wir brauchen eine Fotoreportage, die die persönlichen Umstände der Familien zeigt. Damit können wir den Aufstand so richtig dramatisch mit den Schicksalen der Schwarzen in Südafrika begleiten. Niemand kann die Geschichte sensibler und erfolgreicher aufziehen als Du.“
An dem Glanz in Henrys Augen konnte Richard sehen, dass er Feuer gefangen hatte. Richard hatte sein Ziel fast erreicht.
„Die Kollegen von der „Diamant Fields News“ in Kimberley würden sich natürlich gar nicht freuen, wenn wir aus London schneller sind als sie selbst, obwohl es direkt vor ihrer Haustür passiert“, setzte Richard böse grinsend hinzu.
„Wer ist eigentlich Gabrielle?“ Henry beobachtete Richard neugierig.
Richard lachte erneut laut auf. „Ein Kontakt, der mir förmlich in die Arme gelaufen ist.“ Mit einem Augenzwinkern setzte er bedeutungsschwanger hinzu: „Mehr darf ich nicht verraten, aber glaube mir eines, wenn sich jemand vor Ort auskennt, dann sie.“
„Ich muss erst einmal sehen, was Maggy dazu sagt“, antwortete Henry, während er sich aus dem Ledersessel schwang. Mit einem kurzen Gruß in Richards Richtung verließ er das Büro. Er hasste Richards Heimlichkeiten. Wer ist diese ominöse Gabrielle? Hatte er mit ihr eine Affäre? Eigentlich war Richard kein Schwerenöter, aber wenn es zu seinem Vorteil war, konnte er gelegentlich schon auf Tuchfühlung gehen. Nun ja, beruhigte er sich, er würde es schon noch herausfinden.
* * *
„Oh nein! Du hast mir versprochen, dass Du nicht mehr so weit wegfliegst, bis unser Baby da ist.“ Maggy weinte vor Enttäuschung.
Henry nahm sie behutsam in seine Arme, doch Maggy stieß ihn ärgerlich von sich.
„Aber bis zur Geburt ist es doch noch mindestens einen Monat hin. Die Ärztin ist überzeugt, dass unsere Stefanie eher nach als vor dem errechneten Termin kommt. Ich brauche allerhöchstens drei Wochen, dann bin ich für euch zwei da. Richard hat mir versprochen, dass ich im Anschluss an diese Sache meinen gesamten Resturlaub nehmen kann.“
„Ach ja, was Richard Dir immer so verspricht. Ich will Dich in meiner Nähe haben. Du wolltest doch unbedingt bei der Geburt dabei sein. Und jetzt sind plötzlich irgendwelche Wilde in Südafrika wichtiger für Dich als die Geburt Deines ersten Kindes.“ Maggy verzog schmollend ihren kleinen Mund.
„Du weißt genau, dass es nicht irgendwelche Wilde sind. Es sind Menschen, die in ihrem eigenen Land als Arbeitskräfte ausgenutzt, gequält und verachtet werden. Sie schuften wie Sklaven für Hungerlöhne in den Minen und gefährliche Sprengungen kosten täglich viele Arbeiter das Leben. Sie sind dort einfach nichts wert und wenn sie sich gegen die Ungleichbehandlung auflehnen, sind sie ihren Job los. Und wenn sie ihren Job los sind, können sie ihre Familien nicht mehr ernähren. Die kleinen Kinder und die Alten sterben zuerst. Dort gibt es kein soziales Auffangnetz.“
„Aber was kannst Du schon mit ein paar Fotos an der Lage der Armen ändern?“, fragte Maggy leise.
„Ich kann den Menschen hier das Leid in Südafrika zeigen und sie dafür interessieren. Je mehr ich von den Einheimischen dort privat fotografieren und berichten kann, desto mehr Chancen haben wir, dass sich unsere Politiker über den Aufstand Gedanken machen und die Engländer viel Geld spenden. Das könnte das Leben einiger Kinder retten und für Veränderungen im Land sorgen.“
„Du bist gemein. Du weißt genau, dass ich in meinem jetzigen Zustand nichts über sterbende Kinder hören mag“, sagte Maggy noch leicht verärgert. Aber Henry sah, dass Maggy ihn fliegen lassen würde.
„Außerdem würde es nicht schaden, wenn diese Berichterstattung meine Karriere vorantreiben würde und ich eine Gehaltserhöhung bekomme, oder?“
„Aha, da liegt der Hund also begraben“, erwiderte Maggy besänftigt. Da sie nun wusste, dass auch sie Nutznießer dieser Aktion werden würde, fiel es ihr gleich viel leichter großzügig zu sein. Schließlich hatten sie demnächst mit dem Kind höhere Ausgaben und ihr Gehalt würde in den nächsten Jahren ausfallen.
„Ich werde die Zeit ohne Dich schon durchstehen.“
Er nahm sie in den Arm und küsste sie dankbar. „Jetzt gehen wir etwas essen. Ich will ja nicht, dass unsere Stefanie hungern muss.“
Zärtlich streichelte er ihr über den schon beachtlichen Bauch. Als hätte ihn Stefanie gehört, boxte sie gegen Henrys Hand.
3. Südafrika
Henrys Flieger landete bei Sonnenaufgang in Kimberley. Trotz des frühen Morgens schlug ihm die angenehm milde Luft beim Aussteigen entgegen. Das kalte und verregnete März-Klima in London war eine Zumutung, dachte er. Gutgelaunt und motiviert zog er sein Jacket aus und krempelte die Ärmel seines weißen Leinenhemdes hoch.
Nach einer kurzen Taxifahrt kam er im Holiday Inn Garden Court in der Du Toitspan Road an, in dem Richards Sekretärin ihm ein Zimmer reserviert hatte.
Er war überwältigt vom freundlichen Service im Hotel. Dafür sensibilisiert, fiel ihm jedoch auf, dass das Personal an der Rezeption ausschließlich weißhäutig und nur die Kofferträger Schwarzafrikaner waren.
Henry entließ den Kofferträger mit einem großzügigen Trinkgeld und erntete ein breites Grinsen und eine tiefe Verbeugung als Dank.
Er wollte keine Zeit verlieren und sich gleich heute noch auf den Weg zur Diamantenmine machen. Doch zuerst musste er diese Gabrielle anrufen, um zu erfahren, wo Rando und Moarito wohnten und vielleicht konnte er ebenfalls in Erfahrung bringen, wie Richard sie kennen gelernt hatte.
Er hob den Telefonhörer von der Gabel und wählte die Nummer, die Richard Piquet ihm für den Notfall gegeben hatte.
„Hallo!“, ertönte eine weibliche, etwas genervte Stimme.
„Guten Morgen, mein Name ist Henry Hayes. Ich bin Reporter der ...“ „Verdammt!“, unterbrach Gabrielle ihn. „Hat Ihnen Richard nicht gesagt, dass Sie hier nur im Notfall anrufen dürfen? Sie glauben gar nicht, was los ist, wenn mein Mann erfährt, dass ich da mit drinstecke!“
„Ich muss nur wissen, wo ich Rando und Moarito treffen kann.“ Henry zügelte seine Ungeduld und versuchte wie immer freundlich zu bleiben. Er hasste zickige Frauen, aber in diesem Fall war er auf sie angewiesen.
“Also gut“, fuhr sie nach einer kleinen Pause etwas ruhiger fort. „Ich sage Ihnen, wo Sie Rando finden, aber rufen Sie mich nur noch im absoluten Notfall an. Ich darf mit dieser Sache auf keinen Fall in Zusammenhang gebracht werden.“
Nachdem Gabrielle ihm den Weg so genau wie möglich erklärt hatte, legte sie grußlos auf.
* * *
Als Rando am Abend nach Hause kam, sah er einen weißen Mann vor seiner Hütte sitzen. Der fremde Mann stand auf und reichte ihm die Hand. Rando war auf der Hut, aber das Lächeln des fremden Mannes sah ehrlich aus, daher gab er ihm die Hand.
„Mein Name ist Henry Hayes. Ich bin Reporter aus London und möchte über das Leben der Schwarzafrikaner in Kimberley berichten. Eine gewisse Gabrielle hat mich zu Dir geschickt. Sie meinte, Du könntest mir weiterhelfen.“
Rando stand erst einmal nur da und beobachtete Henry misstrauisch. Warum wollte plötzlich jemand über sie berichten? Und warum sollte sich ein Weißer für die Armut eines Schwarzen interessieren? Das konnte doch nur gelogen sein.
„Gabrielle hat mir nichts gesagt. Warum sollte ich Ihnen trauen?“
„Ich weiß, ich komme ein wenig überraschend. Gabrielle war auch nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, ich stelle mich erst einmal vor und komme in den nächsten Tagen noch einmal wieder“, sagte Henry, gab Rando zum Abschied die Hand und machte sich wieder auf den Weg zu seinem Hotel.
Rando sah ihm nachdenklich hinterher. Wenn sich die internationale Presse wirklich für ihre Situation und ihre Lebensumstände interessierte, dann wäre das vielleicht eine Chance. Denn wenn sie erst einmal die Aufmerksamkeit der Presse hätten, könnten sie auch einen Aufstand wagen. Die Eigentümer der Mine würden ihren Aufstand nicht einfach gewaltsam und brutal unterdrücken können, wenn die Presse alles an die Öffentlichkeit bringt.
Eigentlich wäre dies der perfekte Zeitpunkt für einen Aufstand, aber zuerst musste er die andere Sache über die Bühne bringen. Nach dem Aufstand könnte es gut möglich sein, dass er keine Arbeit mehr hatte. Hoffentlich entschied sich Moarito, bei dem Diamantenraub mitzumachen. Alleine würde er das niemals schaffen.
4. Spanien, Busot
Frederic von Minnehagen hasste die angespannte Atmosphäre, wenn er während des Urlaubs beruflich verreisen musste. Seine Frau lief nun schon den ganzen Morgen mit dieser anklagenden Mine herum. Frederic konnte sich nicht erklären, warum seine Frau Südafrika nicht mochte. Es war damals ihre gemeinsame Entscheidung gewesen, nach Südafrika zu ziehen.
Er hatte alles versucht, sich diesmal vor dem Flug nach Südafrika zu drücken, schon allein seiner Frau zuliebe. Aber er war nun mal Botschafter und bei so wichtigen Angelegenheiten musste ihr gemeinsamer Urlaub in ihrem Ferienhaus in Busot eben für kurze Zeit unterbrochen werden.
„Bitte, Cecile. Mach es mir nicht schwerer, als es ohnehin schon ist. Ich wäre doch wirklich gern bei Dir geblieben.“ Er breitete einladend seine Arme aus, doch als Cecile ihn anschaute, ließ er sie traurig wieder sinken.
„Es ist jedes Mal dieselbe Ausrede. Leider werde ich hier gebraucht und leider werde ich dort gebraucht. Aber dass ich Dich hier brauche, scheint Dich nicht zu interessieren. Südafrika, wenn ich das schon höre. Du wirst da ganz sicher nichts ausrichten können. Aber die Hauptsache ist ja, dass ein deutscher Botschafter auch da war, wenn die Kameras an sind.“
Traurig beobachtete Frederic von Minnehagen, wie sich das schöne Gesicht seiner Cecile bei ihren Zornesausbrüchen zu einer hässlichen Maske verzerrte.
„Du hast doch Freunde hier, mit denen Du Dich verabreden und auf Partys gehen kannst. In einer Woche bin ich wieder da und dann können wir noch ein paar ruhige Tage gemeinsam hier genießen.“
„Mach, was Du nicht lassen kannst, aber ich weiß nicht, ob ich noch da bin, wenn Du wiederkommst.“ Wütend schlug sie die Tür hinter sich zu und verschwand in den Garten.
5. Südafrika, Kimberley
Bei Einbruch der Dunkelheit machte sich Moarito auf den Weg nach Hause. Er wusste nicht, was er machen sollte. Natürlich konnte er das Geld gut gebrauchen, das sie mit dem Verkauf der gestohlenen Steine bekommen würden. Aber was würde mit seiner Familie geschehen, wenn die Aufseher in der Diamantenmine ihn beim Diebstahl erwischen?
Er erreichte die Hütte, als Safira mit Namira und Selina gerade aus dem Wald kamen. Moarito lief seiner Frau entgegen und nahm ihr Namira aus dem Tragetuch.
„Warum bist Du denn um diese Uhrzeit noch unterwegs? Du bist ja ganz erschöpft.“ Besorgt nahm er seine Frau in den Arm. Ihr Gesicht war schweißnass. Er führte sie zur Hütte.
„Komm, setz Dich erst einmal auf die Bank. Ich hole Dir schnell ein Glas Wasser.“
Naomi, ihre älteste Tochter, kam aus der Hütte gerannt. „Mama, Mama, was ist denn los“, rief sie ängstlich. Safira lächelte matt. „Nichts Schlimmes, mein Schatz. Ich habe mir nur ein wenig zu viel zugemutet. Es ist gleich wieder besser.“
Moarito kam mit einem Glas Wasser und hielt es Safira an die Lippen. So hatte er seine tapfere Frau noch nie erlebt. Safira sah Moarito traurig lächelnd an und strich sich über ihren Bauch. Verwirrt starrte er auf ihren Bauch und dann wieder in ihre traurig blickenden Augen.
Als ihm klar wurde, was Safira ihm sagen wollte, sackte er innerlich zusammen. Eigentlich bräuchte sie jetzt einen Arzt, dachte er sich. Aber woher sollte er das Geld nehmen? Und wie sollte er noch ein Kind ernähren? In diesem Moment wusste er, wie seine Antwort auf Randos Frage ausfallen würde.
* * *
Am nächsten Morgen nickte er mit ernstem Gesicht, als er Randos fragendem Blick begegnete. Stillschweigend wussten beide, dass es nun besser war, nicht zusammen gesehen zu werden und vor den anderen nicht miteinander zu reden. Wenn Moarito Zweifel über seine Entscheidung kamen, redete er sich selbst ein, dass er keine andere Wahl hatte. Seine Frau und seine Kinder gehörten in ein anständiges Haus und nicht in die dunkle Hütte.
An diesem Abend beeilte er sich so schnell er konnte, um zu dem Treffpunkt zu gelangen. Er hielt die Anspannung kaum aus und war froh, als er Rando bereits auf der Anhöhe sitzen sah. Außer Atem setzte er sich neben ihn und sie saßen schweigsam nebeneinander, bis sich sein Atemrhythmus wieder normalisiert hatte.
„Ich habe mir einen Plan ausgedacht. Allerdings brauchen wir dafür einen dritten Mann“, sagte Rando leise. „Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als meinen Onkel Kalakua zu fragen.“
„Nein, nicht Kalakua. Dem traue ich keinen Meter. Er hat so etwas Verschlagenes in seinem Blick. Nein Rando, nicht den!“, widersprach Moarito energisch.
Rando sah ihn erstaunt an. „Was meinst Du wohl, wem Du Deine Beförderung zum Steinesortierer zu verdanken hast? Ohne ihn wärst Du jetzt am Ende Deiner Kräfte. Vielleicht lägst Du ohne meinen Onkel schon unter der Erde. Das letzte Grubenunglück hat niemand überlebt.“
Fassungslos sah Moarito zu Rando. „Warum hätte er mir helfen sollen?“
„Weil ich ihn darum gebeten habe. Er hat es sogar ohne jede Gegenleistung getan.“
„Also gut. Du müsstest ihn inzwischen gut genug kennen, um zu wissen, ob wir ihm trauen können, aber irgendwie stört es mich, dass wir dann zu dritt sind“, sagte Moarito mit einem flauen Gefühl im Magen.
„Es wird schon glatt gehen, also pass auf.....“
* * *
Rando ging langsam den Weg entlang des Baches zur Hütte seines Onkels. Er war sich nicht sicher, wie er seinen Onkel einschätzen sollte. Irgendwie musste er Moarito Recht geben. Auch er hatte gewisse Bedenken, aber er sah keine andere Möglichkeit, diesen Deal zu drehen.
„Hallo Rando, komm herein, mein Junge. Was führt Dich zu uns?“, begrüßte ihn sein Onkel freudestrahlend. In diesem Moment waren Randos Zweifel verflogen.
„Onkel Kalakua, ich würde gern mit Dir unter vier Augen sprechen. Es ist etwas Wichtiges.“
Kalakua ließ sich von seiner Frau eine Decke reichen, dann gingen sie auf die nächstliegende Steppe und setzten sich auf die Decke.
„Onkel Kalakua, Du weißt, wie es mir finanziell geht. Ich muss immer noch den größten Teil meines Gehalts an meinen Vater abgeben. Ich tue es nur meiner Schwester zuliebe, weil er droht, sie sonst auf die Straße zu setzen. In meine kleine Hütte kann ich sie nicht holen, weil ich an ihren Ruf denken muss. Außerdem wäre es an der Zeit, dass auch ich einmal ans Heiraten denke. Nun ja, diese ganzen Umstände haben mich auf den Gedanken gebracht, ein paar Steine mitgehen zu lassen.“ Rando wurde immer leiser.
„Das kannst Du Dir aus dem Kopf schlagen, mein Junge. Es ist nicht so, dass ich nicht selbst schon einmal daran gedacht hätte, aber es gibt keine Chance, diese Steinchen da herauszubringen.“ Sie blickten sich lange an und schwiegen. Er sah die Entschlossenheit in Randos Augen. „Also, schieß los. Ich bin gespannt, ob Du ein klügeres Köpfchen als dein Onkel Kalakua bist!“
* * *
Zwei Tage später saß Henry Hayes wieder vor der Hütte, als Rando nach Hause kam. Diesmal grüßte Rando ihn freundlich und ließ ihn in seine kleine dunkle Hütte treten. Alte Holzkisten dienten als Tisch und Stühle. Aufgeschüttetes Stroh mit einer Decke darauf, war Randos Bett.
„Das ist mein Reich. Es ist zwar ein bisschen klein, aber dafür muss ich die Hütte nicht mit zehn Geschwistern, einem ständig besoffenen Vater und einer bösen Stiefmutter teilen.“ Als er Henrys ehrlich interessierten Gesichtsausdruck sah, fing er von vorne an:
„Meine Mutter starb bei der Geburt meiner Schwester Janina. Mein Vater holte seine Zweitfrau in unser Haus und bat sie, Janina und mich mit großzuziehen. Mein Vater griff immer mehr zur Flasche und merkte nicht, wie kalt und herzlos seine Zweitfrau zu uns beiden war.
Als sie Janina wieder einmal den ganzen Haushalt machen ließ, während sie und ihre Kinder faul herumsaßen, platzte mir der Kragen. Ich beschwerte mich bei meinem Vater, in der Hoffnung, dass er seinem ältesten Sohn glauben und seiner Zweitfrau einmal auf die Finger sehen würde.
Stattdessen jagte er mich aus dem Haus und drohte mir meine Schwester auch vor die Tür zu setzen, falls ich die Weitergabe meines Lohnes von der Diamantenmine an ihn einstellen würde. Tja, jetzt sitze ich hier und überlege, wie ich an mehr Geld komme, um meine Schwester aus ihrem Elend zu befreien.“
Henry und Rando saßen schweigend auf den Kisten und starrten auf den Boden. Henry wollte nach dieser Lebensgeschichte nichts Belangloses sagen. Wie konnte er ihm helfen?
„Leider haben wir in der Diamantenmine auch keine Chance auf Weiterbildung. Alle Stellen, die besseres Ansehen und höheres Einkommen bedeuten könnten, werden ausschließlich mit Weißen besetzt.“
„Aber ihr könnt euch doch dagegen auflehnen. Ihr dürft es nicht als gegeben akzeptieren“, wandte Henry ein.
„Natürlich könnten wir uns dagegen auflehnen. Ich habe mit meinem Freund Moarito bereits ein paar Versuche gestartet. Wenn wir allerdings verlieren, dann haben wir keine Arbeit mehr. Ich bin allein und könnte mich durchschlagen, aber was sollen die Schwarzafrikaner machen, die Familien ernähren müssen? Die Kinder würden sich so lange von irgendwelchen Abfällen ernähren, bis sie krank werden und dann doch verhungern. Ein Vater überlegt genau, bevor er seine Familie dem Hungertod überlässt.“
„Das wissen die Minenbesitzer natürlich ganz genau und nutzen eure Angst aus“, warf Henry ein. „Wenn ihr um eure Rechte kämpfen wollt, müssten wir einen genauen Plan erstellen. Und wir müssen vorher mindestens achtzig Prozent der Schwarzafrikaner auf unserer Seite haben. Wenn alle gleichzeitig die Arbeit niederlegen, müssen die Minenbesitzer euch zuhören. Ich werde alles filmen und kommentieren. Ich kann dafür sorgen, dass die ganze Welt von dieser Ungerechtigkeit erfährt. Schon allein deshalb müssen sie euch zuhören.“
„Es muss sich endlich etwas ändern“, erwiderte Rando erbost. Er würde so gern einen Aufstand anzetteln. Eigentlich musste er nur Arende überzeugen. Er war so etwas wie ein Stammesältester, dem die meisten Schwarzafrikaner im Umkreis vertrauten. Zu ihm kamen sie, wenn sie einen weisen Rat brauchten. Arende hatte immer den Überblick, so wie sein Name schon sagte: Arende, der Adler. Wenn Arende den Aufstand guthieß, würde sich kaum jemand trauen, sich dagegen auszusprechen.
„Vor allem müssen die im Abbau Tätigen mehr abgesichert werden und mehr maschinelle Hilfen bekommen. Wenn sie nicht durch ungenügende Stollenabsicherungen verschüttet werden, sind sie spätestens nach fünf Jahren im Abbau nicht mehr in der Lage aufrecht zu stehen.“
Henry schrieb alle Punkte zu dem geplanten Aufstand auf und ging sie mit Rando so oft durch, bis Rando sie auswendig konnte. Rando vertraute Henry voll und war ihm dankbar, dass er sich offenbar schon viele Gedanken über das Leben der Schwarzafrikaner gemacht hatte.
Rando versprach, sich sofort auf den Weg zu machen, um die anderen Schwarzen zu einem Aufstand aufzustacheln.
* * *
Der deutsche Botschafter Frederic von Minnehagen wurde standesgemäß am Flughafen in Johannesburg begrüßt. Eine klimatisierte Luxuslimousine fuhr ihn zu der Residenz des südafrikanischen Präsidenten Dr. Louis Blyed in Pretoria. Wie immer war auch seine Frau Gabrielle an seiner Seite, was Frederic von Minnehagen einen Stich versetzte. Wie gern hätte er Cecile auch an seiner Seite.
Normalerweise tagte das südafrikanische Parlament in der ersten Jahreshälfte in Kapstadt. Aber Dr. Blyed ordnete Parlamentssitzungen immer wieder einmal in Pretoria an, wenn es besser in seinen Terminkalender passte. Daher hatte auch der deutsche Botschafter zwei Residenzen in Südafrika. Für die erste Jahreshälfte eine in Kapstadt und für die zweite Jahreshälfte eine in Pretoria.
Nach einem Abend anstrengender Konversation über die Situation in Südafrika wurde Frederic von Minnehagen zu seinem Haus in Pretoria gebracht. Da sein Hauspersonal in der ersten Jahreshälfte in seinem Anwesen in Kapstadt war, wollte er sich ausnahmsweise selbst versorgen.
Er sank in sein Bett und versuchte seine Frau in ihrem Feriendomizil in Spanien zu erreichen. Cecile ging jedoch nicht ans Telefon. Seufzend legte er wieder auf. Sein Aufenthalt würde sich wahrscheinlich in die Länge ziehen, da er vom südafrikanischen Präsidenten keine ausreichenden Informationen erhalten hatte.
Der Abend bei Dr. Louis Blyed war für ihn äußerst unbefriedigend verlaufen. Es wäre alles in Ordnung. Momentan gäbe es keine Aufstände in Südafrika, usw., usw… Das übliche Bla Bla, dachte er sich enttäuscht.
Am nächsten Morgen würde er sich von einem Taxi zum Flughafen fahren lassen und die nächste Maschine nach Kimberley nehmen. Jetzt wollte er sich selbst vor Ort ein Bild machen. Sein Sekretär in Berlin konnte sich doch nicht geirrt habe, als er behauptet hatte, in Kimberley gäbe es Unruhen.
* * *
Rando lief zuerst zu Arendes Hütte und erklärte ihm, wie der Aufstand wirklich funktionieren könnte. Er war erstaunt und begeistert zugleich, wie gut sein Plan bei Arende ankam. Arende war stolz auf ihn, das spürte er sehr deutlich, daher machte er sich sofort daran, von Hütte zu Hütte zu laufen und alle anderen auch dafür zu begeistern. Zuerst waren seine Leidensgenossen zurückhaltend, aber als sie merkten, dass der Plan diesmal wirklich gut durchdacht war und Arende ihn unterstützte, machten sie ihrem aufgestauten Ärger Luft.
Manche Schwarze waren gar nicht mehr zu bremsen und begleiteten Rando. Immer mehr Männer schlossen sich ihm an und gerieten außer Kontrolle, wenn jemand Einwände vorbrachte.
„Wir wollen eine gerechte Aufteilung der Arbeitsplätze!“
„Wir wollen bessere Löhne!“
„Wir wollen mehr Sicherheit!“, schrieen alle durcheinander. Jeder rief die für ihn persönlich wichtigste Forderung so laut er konnte.
Irgendwann stellte sich Rando auf einen Baumstumpf und rief:
„Seid leise, meine Brüder. Niemand hat etwas davon, wenn die Minenbesitzer vorzeitig erfahren, was wir vorhaben. Also bewahrt bitte Ruhe bis übermorgen. Übermorgen ist unser großer Tag. Geht nach Hause und schlaft euch aus. Morgen arbeiten alle ganz normal, als wäre heute nichts passiert. Übermorgen treffen wir uns dann um sechs Uhr morgens vor dem großen Tor und verlangen die Minenbesitzer selbst zu sprechen. Aber jetzt müsst ihr euch beruhigen, sonst war alles umsonst.“
„Warum denn erst übermorgen?“, riefen einige Schwarze, die es jetzt besonders eilig hatten.
Rando überlegte kurz, bevor er antwortete: „Wir müssen morgen noch die anderen zum Mitmachen überzeugen. Es bringt uns nur etwas, wenn alle dabei sind.“
Er konnte ja schlecht sagen, dass er für morgen etwas anderes, noch viel Größeres geplant hatte.
Endlich beruhigte sich die aufgebrachte Menge und verzog sich langsam in ihre ärmlichen Hütten. Rando saß da und konnte seinen Erfolg kaum glauben.
Wenn es nur morgen auch so gut klappen würde. Er war allein bei dem Gedanken daran schon total aufgeregt.
* * *
Ein lautes Klopfen weckte Rando, der erst im Morgengrauen eingeschlafen war.
„Guten Morgen, ich hoffe Du hast unsere Verabredung nicht vergessen?“, fragte Henry grinsend.
Natürlich hatte Rando an alles andere, nur nicht an diese Fotos gedacht. Henry wollte heute Fotos von seiner Hütte machen und anschließend Safira den ganzen Tag mit seiner Filmkamera begleiten.
Zum Glück war Henry bald mit den Aufnahmen der Hütte fertig. Rando musste sich an den Tisch setzen, sich kurz ins Bett legen, wo er am liebsten liegengeblieben wäre. Dann noch ein paar Fotos vor der Hütte und er hatte es geschafft.
„Danke Rando. Für heute sind wir fertig. Jetzt werde ich mich auf den Weg zu Moarito und Safira machen. Hast Du schon mit ihnen besprochen, dass ich heute komme?“
„Ja, natürlich. Es geht alles klar“, erwiderte Rando müde.
„Also dann bis morgen.“
Wenn weiterhin alles so reibungslos läuft, bin ich in spätestens einer Woche wieder bei meiner Maggy, dachte sich Henry unterwegs.
Rando legte sich noch einmal kurz hin. An Schlafen war nicht mehr zu denken. Um heute ja nichts zu vermasseln, musste er nachdenken. Sein Ziel war greifbar nahe. Sein Puls beschleunigte sich und er hörte sein Herz klopfen, als er den Ablauf nochmals vor seinem geistigen Auge wie einen Film abspielte. Er hoffte, dass Moarito und Kalakua sich an ihren gemeinsam erarbeiteten Plan hielten.
Als er endlich aufstand, sah er, dass Henry eine Filmdose auf seinem Tisch vergessen hatte.
6. Spanien, Busot
Das Telefon klingelte schon zum fünften Mal, aber Cecile von Minnehagen konnte sich nicht aufraffen abzuheben. Es könnte Frederic sein. Und der sollte auf keinen Fall den Eindruck bekommen, dass sie auf ihrer Couch saß, Trübsal blies und nichts Besseres zu tun hatte als auf seinen Anruf zu warten. Sie hatte heute Nacht geträumt:
Sie sah ihren Mann an der Seite einer wunderschönen Frau durch die Straßen von Johannesburg flanieren. Jeder konnte sehen, wie sehr sie sich zueinander hingezogen fühlten. Sie lachten unbeschwert und freuten sich des Lebens.
Sie hörte Frederic sagen, dass er schon lange nicht mehr so viel gelacht habe und dass sein Leben sonst so trostlos sei. Die Frau fasste seinen Arm und blickte ihm ganz tief in die Augen, während sie mit ihrer dunklen, etwas rauchigen Stimme hauchte: „Das könntest Du immer haben, und noch viel mehr.“
An dieser Stelle war sie aufgewacht und hielt es im Bett nicht mehr aus. Sie lief ins Wohnzimmer und machte alle Lampen an. Dann ging sie in die Küche und riss den Kühlschrank auf. Sie brauchte jetzt irgendetwas, um ihre Nerven zu beruhigen. Aber während sie den Blick über die Diätjoghurts und andere Light-Produkte schweifen ließ, wurde ihr übel.
„Nein, das war es nicht, was sie jetzt brauchte.“, dachte Cecile.
Ihr Blick fiel auf die Karaffen im Wohnzimmer. Normalerweise trank sie keinen Alkohol. Höchstens mal ein Glas Champagner. Aber jetzt brauchte sie etwas von diesem fürchterlichen Zeug. Die gelblich braune Flüssigkeit gefiel ihr am besten. Sie schenkte sich das größte Glas voll ein, trank es in einem Zug aus und schüttelte sich. „Wie konnte Frederic dieses furchtbare Zeug nur so genussvoll trinken?“, fragte sie sich.
Nur nicht wieder an Frederic denken, der jetzt vermutlich Arm in Arm mit dieser Frau in Richtung Hotel ging.
„Nein, das darf doch nicht wahr sein“, rief sie sich selbst zur Ordnung. „Wie kann ich Frederic solche furchtbaren Dinge unterstellen. Er liebt mich und würde mir niemals wehtun.“
Sie fing an zu weinen und konnte nicht mehr aufhören, bis sie vor Erschöpfung einschlief.
Ein lautes Klopfen holte sie in die Wirklichkeit zurück. Sie zog die dünne Kaschmirjacke eng um sich zusammen und öffnete die Tür.
„Hallo Cecile. Wie schaust denn Du aus. Bist Du krank? Du bist ja noch gar nicht hergerichtet. Weißt Du wie spät es schon ist?“
Das war typisch Annabella. Sie stürmte ins Haus, ohne danach zu fragen, ob es einem gerade recht war, dass sie vorbeischaute. Langsam machte Cecile die Tür zu und folgte ihr ins Wohnzimmer.
Annabella achtete gar nicht weiter darauf, dass ihre Freundin Cecile so traurig und müde wirkte. Sie baute sich in voller Größe auf - sie war in ihren besten Jahren Model gewesen - und fing an, wild gestikulierend die neuesten Neuigkeiten zu erzählen.
„Stell Dir vor, wir haben eine Einladung des schwerreichen Pablo Mendacci bekommen. Zu seinem sechzigsten Geburtstag. Er feiert ihn in seiner Villa in València. Was meinst Du, wen wir da alles sehen werden. Bei ihm treffen sich alle wichtigen Leute und wir sind mittendrin. Was ist denn los? Du freust Dich ja gar nicht.“ Ihr hübsches Gesicht war vor Aufregung leicht gerötet und als sie ihre Lippen zu einem Schmollmund verzog, entlockte sie Cecile doch ein kleines Lächeln.
„Doch, natürlich freue ich mich für Dich. Aber wie willst du denn nach València kommen?“, fragte Cecile träge.
„Na endlich ist mein Schneckilein aufgewacht!“, rief Annabella fröhlich und klatschte in die Hände. „Das ist das Beste an der ganzen Geschichte. Er schickt uns seinen Hubschrauber.“ Erwartungsvoll sah sie Cecile an.
Als sie die Bewunderung in Ceciles Augen aufblitzen sah, lief sie zu ihr, packte voller Freude ihre Hände und wirbelte ihre noch etwas benommene Freundin wild durchs ganze Wohnzimmer.
„Wir müssen sofort los, um uns etwas Passendes zum Anziehen zu besorgen. Ich habe uns schon in unseren Lieblingsboutiquen angemeldet. Aber zuerst ziehst Du dich um und schminkst Dich ein wenig.“
Annabella lief schon in die Richtung von Ceciles Ankleidezimmer, als Cecile ihr nachrief: „Warum soll ich mir etwas Neues zum Anziehen besorgen, wenn Du und Alexander zu einer Party eingeladen seid?“
„Weil Alexander am Telefon geistesgegenwärtig genug war und gleich gefragt hat, ob wir eine sehr gute Freundin mitbringen dürfen. Da staunst Du, was?“
Annabella verdrehte die Augen und ahmte eine Männerstimme nach: „Ja natürlich. Ich würde mich sehr freuen, Eure Freundin kennenzulernen.“
Annabella lachte sich tot. Ganz langsam kam jetzt auch Leben in Cecils traurige Mine. „Also gut, gib mir zwanzig Minuten.“
Was Annabella Cecile verschwieg, war, dass ihr Mann Frederic sie angerufen und darum gebeten hatte, nach Cecile zu sehen, weil er sie telefonisch nicht erreichen konnte.
Annabella hatte einen mittleren Schrecken bekommen, als sie Cecile in der Tür stehen sah. Es sah so aus, als ob Cecile gleich anfangen würde zu weinen. Und das hätte sie wirklich nicht ertragen.
Aber jetzt hatte sie ja die Kurve mit Bravour genommen. Gute alte Cecile. Sie müsste sich ein bisschen häufiger hier sehen lassen, dann würde es schon wieder werden.
Annabella stand vor Ceciles prall gefülltem Kleiderschrank und zog ihr nach kurzem Überlegen einen leichten Zweiteiler aus weißem Leinen heraus.
„Der ist so wunderschön, den könntest Du doch heute anziehen“, schlug Annabella vor, als Cecile duftend und gestylt aus dem Bad kam.
„Meinst Du wirklich?“, fragte Cecile unsicher, aber schon viel besser gelaunt.
„Ja, natürlich. Deine dunklen Haare kommen damit so schön zur Geltung und Deine braunen Augen. Herrlich!“
„Du übertreibst mal wieder maßlos, aber heute tut es mir gut“, erwiderte Cecile glücklich.
Lachend verließ Annabella das Schlafzimmer und ließ sich im Wohnzimmer in einen Sessel fallen.
7. Südafrika, Kimberley
Moarito schwitzte an diesem Tag übermäßig viel. Er hatte das Gefühl, jeder würde ihm ansehen, dass er heute etwas Unrechtes vorhatte.
Wenn es ihm heute jedoch gelingen würde, ein paar dieser Steinchen in seine Hemdjacke zu stecken, müsste er nie wieder an dieser verhassten Sortieranlage stehen.
Heute glitzerten die Steine noch mehr als sonst. Zehn Männer sortierten die Diamanten, bei fünf Aufsehern. Einer der Aufseher war Randos Onkel Kalakua. Er beachtete Moarito wie immer überhaupt nicht, sondern sah zwei anderen Arbeitern auf die Finger.
Er hat etwas von einem Fuchs, ging es Moarito durch den Kopf. Listig und unehrlich. Es war schon Nachmittag und es hatte sich noch keine Gelegenheit zum Diebstahl ergeben. Aufgeregt wartete er auf Kalakuas Einsatz.
Moarito hatte den Eindruck, dass die Aufseher ausgerechnet heute doppelt so gut aufpassten. Kein Wunder, denn sie konnten viel Geld verdienen, wenn sie einen der Arbeiter beim Diebstahl erwischten.





























