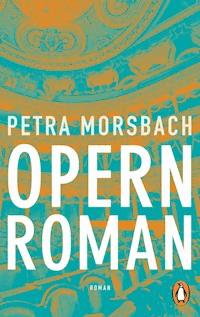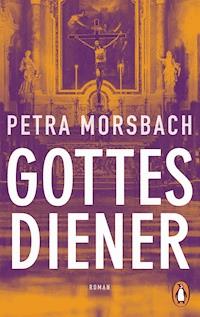8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein hintergründiger Roman über deutsche Befindlichkeiten und sensible Künstlerseelen.
Der Lyriker Henry Steiger war in der DDR ein Star. Dann kam die Wende und mit ihr ein unsanftes Erwachen. Im Westen liest niemand Gedichte, sagt sein Verleger und rät zu einem Liebesroman. Aber Henry hält Prosa für unter seiner Würde. Bis die junge West-Kollegin Sidonie seine Phantasie beflügelt. Ein deutsch-deutscher Roman, der der Welt der DDR die raue Wirklichkeit nach der Wende gegenüberstellt, treffsicher und voll subtiler Komik.
Für Henry Steiger bedeutet die Wende 1989 nicht nur Befreiung. Der so eigensinnige wie angesehene DDR-Lyriker ist nun ein auf Stipendien angewiesener Hungerkünstler. Ein alter silberner Porsche ist das letzte Relikt der Hoffnung, den Ruhm in die neue Zeit retten zu können. In Wahrheit steckt Henry in einer Lebenskrise. Mit anderen Stipendiaten führt er in einer Künstlerenklave bei billigem Wein lächerliche Kämpfe um die wahre Kunst, buhlt um jeden Rock und trauert seinem alten Status hinterher. In Dichterliebe fragt Petra Morsbach ernst und ironisch zugleich nach dem Platz des Künstlers in der Gesellschaft. Dabei gelingt ihr ein überraschend klarer und humorvoller Blick zurück auf eine vermeintlich „gute alte Zeit“, als die Welt, auch die der Literatur, noch in Ordnung schien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Petra Morsbach
DICHTERLIEBE
Roman
Knaus
Dieses Werk wurde mit dem Literaturstipendium des Freistaats Bayern
sowie mit dem »Grenzgänger«-Stipendium der
Robert Bosch Stiftung gefördert.
Dank auch der Stiftung kunst:raum syltquelle.
1. Auflage
Copyright © 2013 beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz aus der Stempel Garamond von
Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-10580-8
I
BEGEGNUNGEN
Über die Asche gebeugt, brannte mein Herz
Peter Huchel
Eine Frau kommt über den Rasen auf mich zu und fragt: »Ist das hier das Künstlerhaus?« Ich muß in der Hitze eingenickt sein auf meinem Plastestuhl, das Hemd klebt mir am Rücken, Schweiß rinnt in die Augen. Vor dem weißen Rock die dunklen Schlieren eines Traums. Alptraum, was sonst… Ich kam zu spät zur Lesung, suchte vergeblich den Ort, landete in der falschen Stadt, rannte durch einen Bahnhof ohne Anzeigetafeln. Eine Durchsage meldete zwanzig Minuten Verspätung, aber von welchem Zug? Bahnbedienstete standen herum und erklärten: »Das alles geht uns nichts mehr an.« Eine Schaffnerin rief: »Geschieht Ihnen recht!« Endlich fand ich die Bibliothek, Zuhörer waren auch da, aber es stellte sich heraus, ich war gar nicht eingeladen.
Der weiße Rock jetzt vor mir. Eine blaue Bluse mit silbernen Blättchen auf der Brust– die Silhouette eines Einhorns. Wieso Einhorn? Frau mit Sonnenbrille, Typ Westschnepfe: So stelle ich mir eine Zahnarztgattin auf Kulturtourismus vor. »Ja«, seufze ich, »das ist das Künstlerhaus.«
»Dann sind Sie sicher ein Künstler?«
»Ja.« Was sonst?
»Ich auch!« Sie strahlt mich an. Streckt mir die Hand entgegen: »Sidonie Fellgiebel. Ich trete heute mein Stipendium an!«
Eine Mitbewohnerin, o Gott. Ich stehe mühsam auf und reiche ihr die Hand. »Heinrich Steiger?« Den Namen hört sie sichtlich zum ersten Mal. Natürlich hört sie ihn zum ersten Mal. Deine Zeit ist vorbei, gewöhne dich daran.
»Sonntags ist das Büro nicht besetzt«, bemerke ich lahm.
»Ich weiß. Irene Ammann vom Appartement vier soll meinen Schlüssel haben. Aber vorn macht niemand auf. Das ist doch das Haupthaus? Wohnen Sie auch dort?«
Nein, ich wohne nicht dort, ich wohne hier im Schafstall, im sogenannten. Und was geht mich Irene Ammann an? Wahrscheinlich ist sie drüben bei den Bildenden Künstlern und kocht. Warum kocht sie nicht mit mir? Seit Tagen habe ich sie nicht gesehen, immer hockt sie auf ihrer Bude, na, vielleicht ist sie krank. Bei schönem Wetter sitzt sie manchmal abends mit einem Schreibblock auf dem Mäuerchen und notiert Einfälle für ihre Extremlyrik. Aber noch ist nicht Abend.
»Was ist Extremlyrik?«
Habe ich laut gesprochen? Auch das noch. »Vielleicht erklärt Ihnen besser Irene selbst… Entschuldigen Sie mich, ich bin… Hof der Bildenden Künstler ist das nächste große Haus, die Straße entlang links…«
»Vielen Dank!« Die Schnepfe hüpft davon. Nicht mehr ganz jung, Mitte Dreißig vielleicht, etwas schwerer Hintern. Wirkt wie eine Anfängerin. Westanfängerin. Wehe, sie schenkt mir ihr Erstlingswerk.
Zwei Stunden später taucht sie wieder auf und erkundigt sich, wo sie was zu essen bekäme. Den Schlüssel hat sie inzwischen ergattert, aber gekocht habe dort niemand, sie wolle mich auch nicht schröpfen, nur meinen Rat. Eben habe ich selber Abendbrot aus der Küche geholt, auf dem Plastetisch stehen Käse, Tomaten und Rotwein, der Edeka hat zu, was soll ich tun? Ich lade sie ein, und sie macht sich über alles her. Dabei stellt sie Fragen, und während ich antworte, sehe ich die Vorräte schrumpfen. »Halle?« fragt sie. »Ach, aus der DDR? Halle bei Bitterfeld? Und wieso leider jetzt Speyer?«
»Ich mußte irgendwohin. Meine Frau… Ich hatte eine Pechsträhne. Ich hatte wohl immer schon… aber die Wende hat mir den Rest gegeben. Das heißt, nicht die Wende an sich– die haben wir alle begrüßt…« Immer noch benebelt. So schnell wie Sidonie ißt, trinke ich Rotwein, er macht mich ruhiger, wenn auch nicht klar.
»Meine Frau… Ein Westonkel hat ihr etwas vererbt. Da wollte sie plötzlich ein neues Leben anfangen– als ob es das gäbe. Das Leben ist niemals neu…«
»Wegen der Erbschaft ist die Ehe in die Brüche gegangen?« fragt Sidonie erstaunt, während sie meine letzte Tomate zerschneidet.
»Nein! Natürlich nicht nur deswegen. Es gab seit jeher Differenzen, aber unter normalen Bedingungen rauft man sich zusammen. Wir Ostler haben die Sprengkraft des Geldes unterschätzt… Jetzt führen wir Scheidungsprozesse. Meine Tochter habe ich seit zwei Jahren nicht gesehen, sie ist gerade zehn…«
»Schreiben Sie ihr?«
»Ach, das hätte doch keinen Zweck. Das heißt, ich habe die Nerven verloren…« Und ich erzähle alles– ungebremst, unbremsbar, einem wildfremden Menschen, warum? Seit fünf Jahren ohne Heimat, wie hält man das aus, findet man Halt, indem man erzählend in ein anderes Leben dringt? Diese Sidonie hat inzwischen ihre Sonnenbrille abgenommen und schaut mich mit staunenden grauen Augen an… ihr Haar ist schwarz… fast wie eine Italienerin, eine italienische Braut im weißen Rock… Italien, denke ich, »Italien«, sage ich, »war die erste Station meiner Flucht.« Das Stipendium in der Villa Tedesca… halbverlassenes italienisches Bergdorf, außer mir dort nur ein alkoholkranker Maler und zehn Greisinnen in Schwarz… Die Kälte, die Dusche im Keller… Der launische Verwalter, der sich mit Commendatore Schmidt anreden ließ und mich, als ich um Frühstück bat, anfuhr: »Was bilden Sie sich ein! Das ist kein Hotel, das ist eine Stiftung! Seien Sie froh, daß Sie hier wohnen dürfen!« Rückkehr nach Deutschland, auf Rat meines Verlegers in die Psychiatrie, ganz vergeblich, grauenhaft… Einmal machte ich einen Ausflug nach Speyer, das in der Nähe lag, und sah an der Glastür einer Apotheke den Aushang: Zweizimmer-Wohnung zu vermieten. Die Wohnung lag direkt in der Fußgängerzone und war warm, hell und ruhig. Erst nach meinem Einzug begriff ich, warum die Miete so günstig war: Außer mir wohnte niemand in dem Haus. Meine Vormieterin war verrückt geworden, sie verbarrikadierte die Tür mit einem Stahlriegel und schrie. Die Polizei sprengte die Tür auf und schaffte die Frau fort. Kein Wunder, daß die durchdrehte in dem leeren Haus– ich könnte dort verwesen, ohne daß es einer merkt. Zuerst dachte ich: Fußgängerzone, da ist’s schön still, aber das stimmte nur zeitweise: Zweihundert Meter weiter steht der Dom, das Wummern der Glocken ging mir durch Mark und Bein…
Ich starre Sidonie an. Schwerstes Geläut jetzt auch hier; in dem Dorf von sechstausend Einwohnern gibt es ein Dutzend tonnenschwere Glocken, die dröhnen wie fürs Ende aller Tage… und durch dieses stählerne Wabern schwebt gelassen, als würde sie es nicht hören, Irene Ammann herbei, lächelt uns zu, hebt entschuldigend Stift und Block… klar, muß dichten… setzt sich auf das niedrige, breite Mäuerchen, Rücken gegen den Torpfosten, Beine hoch, und dreht ein paar Samsons. Ich will auch rauchen– Schachtel leer– kein Essen, keine Zigaretten, das unerträgliche Geläut– ich will aufspringen, kann nicht, Fuß schmerzt– langsam… Und jetzt auf einmal steht Robert mit einem Tablett vor uns. Barfuß wie immer, ich hasse das… mit einem Tablett! Will mit uns essen, das will er sonst nie– hat offenbar durchs Fenster die neue Frau gesehen. Auf dem Tablett Brot, Margarine, Käse, Tomaten, Chianti für 2 Mark 99, nicht lachen, Sidonie, gestrandete Ossis ernähren sich billig, du kannst uns ja zeigen, wie eine Westschnepfe es besser macht.
Robert begrüßt Sidonie, ohne sie anzusehen, und reibt sich die picklige Stirn. Irene hinten auf dem Mäuerchen steckt sich mit zarten gelben Fingern die erste Samson an. Fünfzehn Schritte zu ihr, riskiere ich das? Soll ich Robert bitten? Sinnlos bei dem Lärm, also Schweigen, Robert mampft, Sidonie nippt Wein, und ich kämpfe gegen das Jüngste Gericht in mir.
Allmählich verebbt das Geläut. Aufatmen… Grillen zirpen, die Linde knistert, ein Windhauch trägt Traktorengebrumm und Heuduft herbei. »Das war unser Staverfehner Klöppelkrampf«, erklärt Robert. »Den kriegen Sie jetzt jeden Sonntag von 17.50 bis 18.18 Uhr.« Gleich wird er davon anfangen, daß er eigentlich Mathematiker ist, immer rühmt er sich seiner Akkuratesse mit Zahlen, aber diese Unterhaltung überlasse ich ihm nicht, noch bin ich mit meinem Unglück nicht zu Ende.
»Eine Ewigkeit«, unterbreche ich. »Ein endloser Vorwurf, Versäumnis, Schuld.«
»So ist das, glaube ich, nicht gemeint«, bemerkt Sidonie zögernd.
»Aber so klingt es. Und so wirkt es. Einmal riß es mich in Speyer aus dem Schlaf, und ich bin gestürzt, weil ich hochtaumelte, um das Fenster zu schließen. Knöchel geprellt, Sehne gerissen, deswegen der Gips. Kurz darauf fiel ich gegen das Klavier, als ich, schlaftrunken aufstehend, versehentlich den geprellten Fuß belastete.« Ich hebe mein bandagiertes Handgelenk. Mitleid hilft ein bißchen, ich brauche das Mitleid einer Frau.
»Die Glocken sind schuld«, faßt Robert zusammen.
Hat Sidonie gekichert?
»Nicht nur, natürlich. Ich war in schlechter Verfassung, das habe ich schon gesagt. Ich hatte Sorgen. Dann der Autounfall– Schulden wegen des Unfalls, das teure Auto…«
»Silberner Porsche!« wirft Robert ein. »Ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen. Unser Henry lebt auf großem Gipsfuß.«
»Der Porsche ist uralt, der hat nur sechstausend Mark gekostet! Die Werkstattkosten allerdings sind immens, und die Haftpflichtversicherung– ich wage gar nicht den Brief zu öffnen, sicher wurde die Police erhöht…«
Mein Gott. So viel erlebt in den letzten Jahren, aber mir fällt nichts zum Schreiben ein, die Zeit vertan. Nur noch Nachdichtungen, Fremde, Einsamkeit– Irene träumt auf ihrem Mäuerchen, von Robert gibt’s sowieso nur unverschämte Kommentare, und jetzt steht auch noch Sidonie auf mit der Erklärung, sie sei müde, Stau, lange Fahrt bei glühender Hitze, außerdem habe sie einen Rausch. Einen Rausch, nach anderthalb Gläsern Wein? Robert amüsiert sich. Es ist noch nicht mal dunkel. Eine Spießerin. Wie konnte ich mich so gehenlassen? Diese Sidonie muß mich für einen Idioten halten.
*
Heute etwas besser. Sonderbare Bitte von Dietmar, ob ich Siddharta-Sprüche in Verse setzen mag für ein Musical. Er wisse, es sei unter meiner Würde, aber ob ich eine Ausnahme– fünfhundert Mark… Beigefügt hat er drei zusammengeheftete Blätter. Auf dem Deckblatt steht:
Siddharta heißt: Der sein Ziel erreicht hat
und ausgerechnet ich, dessen Weg sich seit der Geburt immer weiter vom Ziel entfernt hat, soll Siddhartas Vier heilige Wahrheiten in Verse bringen, »am liebsten in Dreiviertel- und Viervierteltakt.« Fünfhundert Mark.
Alles Leben ist Leiden;
alles Leiden hat seine Ursache in der Begierde, im Durst;
die Aufhebung dieser Begierde führt zur Aufhebung des Leidens…
der Weg… ist der heilige achtteilige Pfad, der da heißt rechtes Glauben, rechtes Denken, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Gedenken, rechtes Sich-Versenken.
Grauenhafte Sprache, widerlicher Inhalt, jedes Wort auf mich gemünzt, reiner Hohn. Fünfhundert Mark, dringend, selber schuld, schuld, schuld. Ich laufe im Zimmer auf und ab, rauche Kette und trällere Buddhas fünf Gebote:
Töte kein Lebewesen.
Nimm nicht, was dir nicht gegeben.
Sprich nicht die Unwahrheit.
Trinke keine berauschenden Getränke.
Sei nicht unkeusch.
Ich greife zur Flasche.
Es ist töricht anzunehmen, daß ein anderer uns Glückseligkeit oder Elend verschaffen könnte.
Klar.
*
»Schreib doch einen Roman, wenn in der Lyrik nichts mehr kommt!« sagte Kadletz beim letzten Treffen vor einem dreiviertel Jahr. »Das ist einfacher als Verse.«
Offenbar weiß ein Verleger nicht, daß in der Kunst nichts einfach ist. Prosa ist wie eine andere Sprache, wie könnte ich die jetzt noch lernen, zumal in der Fremde? Ich kenne mich nicht aus in dieser neuen Welt. Ja, ich habe sie bewundert, vielleicht sogar ersehnt, aber ich kann nichts zu ihr beitragen, und sie hat keine Aufgabe für mich.
Wir hockten an der chromblitzenden Theke einer Frankfurter Edelbar und erholten uns von der Buchmesse; er von der übermäßigen Inanspruchnahme, ich von der Mißachtung.
»Kopf hoch, Alter!« Er legte mir väterlich den Arm um die Schulter (er ist jünger und kleiner als ich). »Hast du Lust auf einen Ausritt zu Suzie Wong? Wie kann ich dich auf Vordermann bringen?« Jetzt amüsierte er sich über seinen Kalauer. Übrigens ist er durchaus nicht so großzügig, wie er tut. Ins Bordell sind wir nie gegangen, da riskiert er nichts.
»Prosa…«, seufzte ich. »Diese elenden Strecken, das halte ich nicht aus…«
»Prosa kann jeder. Wenn du lange Strecken nicht kannst, mach kurze. Was dir so einfällt. Erfahrungen eines Lyrikers in der DDR: die feinste Kunst der Sprache in den Mühlen des gröbsten Apparats…«
»Ach, was soll schon gewesen sein. Ich habe mich geduckt, um dichten zu dürfen, und begann unwillkürlich, über das Ducken zu dichten. Ich wollte demonstrieren, wie man dichtend sich wegduckt, und habe, indem ich das Ducken verdichtete, mich selbst weggedichtet.«
Ob das stimmte? Kadletz fragte nicht nach; das tut er ohnehin selten. Er balancierte auf seinem Barhocker, saugte an einer Zigarre und machte noch in dieser Erschöpfung Pläne. Er nimmt Scheitern nicht wahr, in jeder Mauer sieht er ein Haus, in jeder Ruine einen Sanierungsknüller.
Er stieß eine Rauchwolke aus. »Dann schreib über die Liebe!«
Weißt du überhaupt, was das ist? dachte ich.
Er hat eine reiche Frau, die seinen Verlag bezahlt, macht in Kunst wegen des Glamours und genießt das Leben; nichts kann ihm passieren. Seine literarischen Ideen bringt er im Gestus des Gauners vor, der sich den Scherz der Ehrbarkeit erlaubt. In Wirklichkeit darf er gar keinen Gewinn machen, hat mir Jakob erklärt, der sich als firm ausgibt in Kapitalismus. Der Verlag sei ein Abschreibungsmodell. Um auch das zu verbergen, täuscht Kadletz strenge Wirtschaftlichkeit vor, zumal im Umgang mit Autoren. Meine Rolle in dieser Konstruktion: Ich soll seine Ideen verwirklichen, seine Ernsthaftigkeit bestätigen und seinen Gewinn sichern, indem ich einen Verlust verursache, für den ich allein aufkomme, mit meinem Herzblut, meinen Ressourcen, meiner Zeit. Leider war ich zu geschwächt, um ihn vom Barhocker zu stoßen. Deswegen spottete ich nur ein bißchen. Die Liebe, haha, öfter mal was Neues.
Er aber geriet in Feuer. »Das ist es! Die Liebe unter DDR-Aspekt! Liebe als einziger Freiraum in den Zwängen der Zone. Das muntere Liebesleben der Ossis, war es nicht legendär? Und dann die neuen Bedingungen nach der Wende. Keine Pornographie, du verstehst mich, obwohl ich deine Zurückhaltung in dieser Sache unzeitgemäß finde, sondern eben im gesellschaftlichen Spannungsfeld… Kunst, Krise, Diktatur als Nebenthemen… das alles in Verschlingungen…«
Ich dachte an die Nebenthemen und ihre Verschlingungen. Seltsamerweise nicht an Marita, die aktuelle Wunde, sondern an Franziska, die unbesiegbare Kunstmalerin. Die fröstelte etwa in ihrem kalten Atelier, und eine Stunde später hatte sie ein paar tolle rosa Weiber in dampfenden Badewannen gemalt. Ich ließ mich dort wärmen, aber als mein Hymnus an Franziska erschien, kippte auch diese Geschichte. Franziska schimpfte: »Du redest nur über dich!« Ich versuchte mich zu verteidigen: »Ich rede darüber, wie du auf mich wirkst.«– »Dich interessiert von allem immer nur, wie es auf dich wirkt«, und so weiter.
»Und schließlich«, Kadletz in Exaltation, »wer, zu allen Zeiten, hätte besser Auskunft über die Liebe geben können als die Dichter?«
»Das war immer ein Irrtum«, sagte ich. »Wir Dichter hätten aufstehen sollen gegen die Arroganz der Macht. Statt dessen machten wir uns wichtig auf Kosten der Frauen.«
Ich war selbst nicht überzeugt von diesem Aphorismus, doch er schien Eindruck zu machen, ich sah sogar einen Schimmer von Respekt auf Kadletz’ Gesicht. »Versuch’s halt«, sagte er. »Von irgendwas mußt du schließlich deine Zigaretten bezahlen.«
*
Sidonie ist immer guter Laune, streunt durch den Garten und genießt. In plumpen Nietenhosen übrigens, keine Ahnung, warum sie bei ihrer Anreise so aufgedonnert war. Wollte sie auf uns Eindruck machen und will es jetzt nicht mehr? Haben wir sie enttäuscht? Habe ich sie enttäuscht? Nun, sie winkt freundlich, hält aber Abstand, wenn sie mich vor meinem Schafstall unter der Linde arbeiten sieht, hat Respekt… gut. Wenn ich winke, kommt sie sofort.
»Herrlich«, sagt sie, »so ein Stipendium. An so einem schönen Ort, in dieser schönen Landschaft…«
Was ist daran schön? Weit, flach, moorig, eine Art Sibirien.
»Und jeden Monat tausendfünfhundert Mark!«
Aber nur noch bis Dezember! Was dann?
»Immerhin bis Dezember! Tolle Einrichtung, diese Stipendienstätten, und ich wußte bis vor kurzem nicht mal, daß es so was gibt!«
Stipendienstätten.
»Endlich Zeit und Freiheit zum Arbeiten, endlich unter seinesgleichen…«
Deinesgleichen?
»Ich habe jahrelang einen Roman geschrieben, ohne mit jemand reden zu können. Das war schon sehr einsam…«
Einsam? Liebe, ich sehe dich an, du weißt nicht, wovon du redest.
»Und dann so ein gutes Wetter!«
»Bald werden die Tage kürzer…«
»Aber jetzt sind sie lang!«
Macht sie sich lustig über mich?
»Warum sind Sie hergekommen?« fragt sie entwaffnend schlicht.
»Gabriel hat mich eingeladen. Ich hätte keinen Antrag mehr gestellt.«
»Gabriel Herzgeber? Unser Herbergsvater?«
Wenn man’s so nennen will, ja. Gabriel Herzgeber, der Leiter des Künstlerhauses, kennt mich von früher und wollte helfen. Schlimm genug, daß das nötig war. Aber die Güte hat auch Nachteile. Zum Beispiel gilt meine Wohnung als Privileg, weil der Schafstall etwas abseits steht und im ersten Stock ein separates Schlafzimmer und ein Gästezimmer hat. Aber das Gästezimmer brauche ich nicht, mich besucht keiner, und mit dem Gipsfuß die Wendeltreppe raufzuklettern ist kein Spaß.
»Ach, unsere Klausen sind auch alle im ersten Stock, und die Treppe ist viel länger! Seien Sie froh!«
Ich bin nicht froh. Und mich reizt diese Mischung aus Naivität und Pragmatismus. Na, Liebe, wenn dich nicht schon bald ein Dichter frißt.
*
Gabriel ist wieder da, zurück aus der Klinik. Er steht vor meiner Schafstalltür, sauber, rasiert, im karierten gelbbraunen Jackett und senfgelben Cordhosen, die weißen Strähnen fliegen um seine Platte. Wir umarmen uns. Er zieht eine Flasche Grappa aus einer Papiertüte. Wir stoßen an. »Schön, daß es dich gibt, Henry!« sagt er herzlich, sinkt in den Sessel und schluchzt zweimal.
Er erklärt mit bebender Stimme, seine Anna vertrage die Chemo ganz schlecht. Er will mir sein Leid klagen, doch das wiederum vertrage ich schlecht. »Wir alten Kämpen«, sagt er. »Wir müssen zusammenhalten! Unser ganzes Leben haben wir…«
Hier scheint mir, er übertreibt. Wir stammen beide aus dem Erzgebirge, das ist aber alles. Er ist älter, er war noch Soldat und wurde nach der Kriegsgefangenschaft zur Arbeit im Uranbergbau gezwungen. Dann türmte er und machte im Westen eine bescheidene Karriere als Abteilungsleiter in einer Keramikfabrik. Dichtete nebenbei. Führte eine glücklose Ehe, obwohl– oder weil– er einen mächtigen Schlag bei Frauen hatte. Als ich Mitte der Siebziger erstmals in den Westen durfte, lud er mich sofort zu einer Lesung ein. Er zitierte meine Gedichte auswendig. In seinem Literaturzirkel, der aus einem andächtigen Kreis ihm ergebener Frauen bestand, führte er mich als einen der »Drei großen Sachsen« ein und begann aus Begeisterung zu sächseln; die Frauen schmolzen dahin. Übrigens mochte er mir nicht verhehlen, daß diese Frauen, seine Sponsorinnen, ihm nicht nur aus Kunstliebe hörig seien. Ich glaubte es sofort. Er trat vital und generös auf, kein athletischer, aber ein sinnlicher Mann mit einem strahlenden fleischlichen Zynismus. Als er mich Mitte der Achtziger wieder einlud, wirkte er immer noch vital und generös, aber auf den zweiten Blick zerrüttet. Er bestand darauf, mich zu beherbergen, und ich erschrak über die winzige, schmuddelige Wohnung, in die er nach seiner Scheidung gezogen war. In der Küche stapelten sich die leeren Flaschen, wir wateten durch Staub. »Na und?« rief er. »Die feinen Damen besuchen mich noch immer! Hier finden sie das, was ihnen ihr Bankdirektor zwischen den Seidenlaken schuldig bleibt«, und so weiter.
Heute klingt er anders. »Was war ich verkommen. Gevögelt habe ich, was die Vorhaut hielt, aber ohne Herz, ein zielloses, rüdes Leben. Erst mit Anna habe ich die Liebe kennengelernt. Anna hat mich von der Keramikfabrik befreit. Sie sagte: Gabriel, du bist ein Diplomat und Organisator, du kennst die Kunst und liebst die Künstler, machen wir doch das zu deinem Beruf! Gemeinsam reisten wir durch das Land und entdeckten in Staverfehn die beiden verfallenden Höfe– wir hatten sofort dieselbe Vision. Wir entwickelten das Konzept, fanden Sponsoren… Ohne Annas ministeriale Kontakte wäre es nicht gegangen, aber auch die Gestaltung ist von ihr, die Aufteilung der Häuser, die Einrichtung der Wohnungen– sogar die Kacheln im Kaminzimmer hat sie ausgesucht. Hier sind wir zur Ruhe gekommen. Hier wollten wir zusammen alt werden. Und jetzt bricht alles zusammen!«
Ich habe Anna vielleicht dreimal getroffen. Sie ist breit, flachbrüstig, gepflegt und hat eine spitze Nase im skeptischen Gesicht unter der Zwiebelturm-Frisur. Anna hält Distanz, sie siezt alle so konsequent, wie Gabriel uns duzt. Von Beruf war sie Oberstudiendirektorin, doch sie arbeitete nicht in der Schule, sondern im Ministerium, jedenfalls bis kürzlich: eine der vielen verklemmten Akademikerinnen, die Gabriel immer so gern und stolz erlöste. Ich stelle mir vor, wie die willensstarke Anna und der lüsterne Gabriel einander erlösten, während ich einsam in Speyer verzweifelte– Mißgunst, ja, obwohl ich weiß, daß ich dankbar sein sollte für dieses Künstlerhaus, das sie zu meiner vorübergehenden Rettung gegründet haben. Seine Statur, ihre Initiative, seine Herzlichkeit, ihr Geschmack, was will man mehr? Nichts bricht zusammen. Das Künstlerhaus floriert, Gabriel ist ein beliebter Gastgeber. Anna verträgt die Chemo schlecht, na und? Das kann passieren, aber warum soll die Westmedizin sie nicht heilen? Ich kann das Traumpaar nur beneiden. Wenn eine Lage wirklich hoffnungslos ist, dann meine.
*
Schon drei Nächte ohne Alpträume. Korrekturfahnen sind abgegeben, die östlichen Weisheiten in Zweiviertel- und Dreivierteltakt gesetzt, alles ein Hohn, aber bezahlt, und nun hat mir auch Sander einen Anschlußauftrag gegeben: Nachdichtung eines vergessenen Gedichtzyklus von Leonid Karatschinzew. Die Sendung war heute in der Post, ich überfliege das russische Bändchen und die losen Blätter mit der Interlinearübersetzung. Sehr anspruchsvolles Russisch; da aber der Übersetzer jede Zeile mit einem Kommentar zu Versmaß und Klangwerten versehen hat, bin ich im Bilde. Ein 600-versiges Gedicht Haus der Schöpfer (wörtlich: Schöpferisches Haus), vierhebig, gereimt– das ist im Deutschen kaum zu machen. Ich notiere ein paar Einfälle und prüfe den Ton. Teilweise nicht ohne Reiz, schlank und keusch wie das Beste von Karatschinzew, teilweise aber auch ziemlich verquast. Neben dem Brunnen der Datsche höre ich das Weinen der Witwe vom anderen Ende des Dorfs– hoffentlich mache ich mich damit nicht lächerlich. Probeweise übersetze ich die ersten zwei Seiten, flüssig, direkt in die Maschine… Wird wohl gehen. Morgen werde ich um den Vorschuß bitten.
Die Tage sind brütend heiß, die Abende tropisch. In der Dämmerung kommen die Kollegen vor meinem Haus zusammen, sitzen auf meinen Gartenstühlen, vergießen Wein auf meinem Tisch und schnattern– da ich’s nicht abstellen kann, setze ich mich dazu, wie immer steht billiger Dornfelder auf dem Tisch, Brot, Schafskäse, Tomaten– es stellt sich heraus, daß Sidonies Ernährungspraxis sich von unserer wenig unterscheidet. Dabei ist, oder war, die Frau wirklich Zahnarztgattin. Mir gefällt, daß es mit dem Zahnarzt aus ist, doch Robert wirkt enttäuscht. »Eine Zahnarztgattin, das wär’s gewesen!«
»Wieso?«
»Als Geliebte!«
»Und wieso Zahnarztgattin?«
»Na, dann hab ich keine Verantwortung! Den soliden Bereich würde der Zahnarzt abdecken, den romantischen Teil ich.«
Sidonie lacht perplex.
»Den romantischen Teil?« frage ich scharf. Welch dümmliche Formulierung für einen Literaten. Und welch eine Idiotie für einen Mann. Wie kann man so was laut sagen? Wäre ich nicht so ein Wrack, ich würde es besser machen. Nun sitze ich ohnmächtig dabei, halb besorgt, weil Robert wirklich interessiert scheint, halb erleichtert, weil er sich um Kopf und Kragen quasselt.
»Was ist aus dem Zahnarzt geworden?« fragt er.
»Er hat mich verlassen«, sagt Sidonie errötend, »vor drei Jahren.«
Vor drei? Wieso errötet sie dann?
»Wer kam danach?« fragt Robert.
»Mein Roman!«
Sie hat drei Jahre lang an einem Roman geschrieben! Tatsächlich ihr Erstlingswerk. Nie hatte sie es sich zugetraut. Nach der Trennung aber habe sie »Valenzen frei gehabt«. Heraus kam ein– dramatischer Roman. Man möchte es nicht glauben. Was ist ein dramatischer Roman?
Hat der Zahnarzt den Roman finanziert? Leider fragt Robert das nicht. »Mich hat auch meine Frau verlassen«, erzählt er, »vor fünf Jahren! Kurz nachdem die Mauer gefallen war. Da bin ich fort aus Dresden, das Kind war alt genug, um allein Abitur zu machen, und ein Schulfreund, der in den Achtzigern rübergemacht war, nahm mich auf. Mit fünftausend Mark habe ich immerhin fünf Jahre durchgehalten, auf einem Speicher in Westberlin. Das Zimmer hatte sechs Quadratmeter, aber ein großes Fenster mit einem Erker, auf dessen morschen Holzboden eine Blechplatte genagelt war– durch die Ritzen sah man vier Stockwerke tiefer die Straße. Im Sommer habe ich mal fünfundvierzig Grad gemessen, allerdings bei nur zehn Prozent Luftfeuchtigkeit. So hielt man’s aus.«
Wieder diese Angeberei mit Zahlen. Und Sidonie läßt sich beeindrucken! »Da haben Sie gearbeitet?« fragt sie ungläubig.
»Wie besessen! Ich saß nackt an meiner Schreibmaschine und schrieb fünfzehnmal den gleichen Roman. Fünfzehnmal, weil… ich den richtigen Ton nicht fand. Erst hier habe ich zufällig entdeckt, daß Version acht stimmte, nur Anfangs- und Schlußsätze waren falsch gewesen.«
Dödel. Dilettant.
»Wer druckt es?« frage ich.
»Ach, darauf kommt’s nicht an, oder?«
»Oder? Auf was kommt es sonst an?«
»Es ist wie ein Rausch, von dem ich noch nicht weiß, ob er ein Traum oder Alptraum wird. Einerseits: die Freiheit. Andererseits: Man sinkt ins Nichts. Der ganze Westen wirkt auf mich absurd. Ich konnte monatelang nicht schlafen, weil ich so viel lachen mußte. Der Freund, bei dem ich wohnte, von Beruf Psychiater, diagnostizierte eine Manie…«
Sieh mal an. Der schmächtige Mann mit dem schütteren Haar, der sich oben mit seinem Computer einschloß und den man wochenlang kaum zu Gesicht bekam, offenbart eine Manie und führt sie sogleich vor.
»Wünschen Sie sich die DDR zurück?« fragt Sidonie.
»Ach, nee. An der DDR bin ich erstickt. Ich hab’s nicht gemerkt, man merkt ja nie, mit wieviel tausend Fäden man an seiner Wirklichkeit hängt. Aber ich war zuletzt von einer wahnsinnigen Unruhe…«
Manie.
»…und als die Mauer aufbrach…«
Aufbrach!
»…da ist das ungelebte Leben in mir explodiert. Ich hielt es keinen Tag mehr in Halle aus.«
Das ungelebte Leben– was für eine vulgäre Formulierung. »Sie sollten nicht alles für bare Münze nehmen«, muß ich Sidonie warnen. (Bei Gelegenheit muß man ihr beibringen, daß hier alle per Du sind.) »Er hatte eine Familie, er hat einen Sohn gezeugt, fünf Bücher publiziert und seine Frau betrogen. Was daran ungelebt sein soll, weiß wohl nicht mal er selbst.«
*
Robert doziert: »Wir waren keine Dissidenten gewesen. Wir sahen, wieviel im Argen lag, aber es war unser Arges, wir kämpften um unsere kleinen Freiräume und faßten sie in Worte– Lyrik kann das besser als Epik und Dramatik, sie ist formal am stärksten verschlüsselt und dadurch inhaltlich im tiefsten Sinn frei. Wenn Literatur ein Modell für die Welt liefert, ist Lyrik das versponnenste und unabhängigste Modell. Das Publikum verstand das. Hier im Westen braucht uns keiner. Selbst wenn wir uns hier auskennen würden, hätte der Markt keine Verwendung für uns, hier stechen die simplen Formen. Ein doppeltes Fiasko: Wir sind nicht auskunftsfähig, und wären wir’s, nützte es auch nichts.«
Sidonie hängt an seinen Lippen.
Obwohl er nicht falschliegt, ist mir unangenehm, daß er mich einbezieht. »Ich bin in keiner Welt kompetent gewesen«, stelle ich richtig. »Daß ich kein Dissident war, gebe ich zu, wobei über mich eine sechs Ordner dicke Opferakte existiert. Aber fremd habe ich mich überall gefühlt, dort wie hier.«
»Gefühlt fremd«, spottet Robert, »aber meßbar kompatibel. Henry war bei uns ein Star: Heinrich-Heine-Preis, Heinrich-Mann-Preis, Großer Akademie-Preis, Nationalpreis, Reisekader, höher konnte ein Dichter nicht steigen. Er hat mehr verloren als ich. Aber auch mich ernährte die Kunst, meine Gedichtbände hatten Auflagen von fünftausend Stück. Im Westen wäre das undenkbar, hier gibt es mehr Lyrikschreiber als -leser. Auf einmal sind wir lächerliche Figuren. Kein Wunder, daß unsere Frauen uns verlassen haben.«
Quatschkopf. Ich bin nicht freiwillig zu Hause ausgezogen; ich liebte meine Wohnung in Halle-Neustadt. Als meine Frau sagte, sie gehe jetzt zu einer Freundin und erwarte, mich nach der Rückkehr nicht mehr vorzufinden, besoff ich mich, hörte dröhnend laut das Dies Irae aus dem Verdi-Requiem und dachte: Hier bringt dich keiner raus. Spätabends kam Marita mit der Freundin zurück, sah mich im Lehnstuhl hängen und rief die Polizei. Im Protokoll stand später wegen Randalierens– ich hätte einen Schokoladeosterhasen nach ihr geworfen. Daran erinnere ich mich nicht. Ich weiß aber, daß ich zu einem der beiden jungen Polizisten sagte: »Wir können das ganz schnell erledigen. Geben Sie mir Ihre Dienstpistole, dann erschieß ich mich.« Der Polizist rief auf der Wache an: »Hier will sisch eener mit meiner Dienstpistole erschießen, was soll ma duhn?«
Sie nahmen mich mit. Ich lachte mich halbtot und winkte aus dem Auto den Passanten zu; noch bei der Aufnahme lachte ich. Ich bekam eine Zwei-Mann-Zelle für mich allein. Alles versifft, verkeimte Decken und Matratze, Ausblühungen von Kalk an den Wänden, und ich lachte immer noch, deckte mich nicht zu und schlief lachend ein. Um sechs Uhr früh erwachte ich, fahles Morgenlicht hinter dem Gitterfenster und stürmischer Vogelgesang. Erst da überfiel mich Panik. Was, wenn sie mich hierbehielten? Ich rief. Von da an kam jede Stunde ein Polizist, der mir eine Zigarette gab und anzündete. In der Zelle durfte ich nichts haben.
Am Vormittag entließen sie mich. Ich kehrte ein letztes Mal in die Wohnung zurück, duschte, packte meinen Koffer, warf den Schlüssel auf den Boden und ging.
*
Gestern abend hat uns ein Gewitter überrascht, wir flohen ins Haus und machten Feuer im Kamin. Nachbar Sayed kam dazu, später Gabriel. Gabriel, dem unser Rotwein nicht gut genug war, stiftete zwei Flaschen aus dem Künstlerhauskeller, stieß mit allen an, leicht gerötete Augen, angedeutetes Sächsisch, zitternder Schnurrbart: »Schön, daß es euch gibt!« Auch Sidonie duzte er, bei der dann endlich der Groschen fiel. Sie ist sechsunddreißig, erfuhr ich bei der Gelegenheit, und hat wirklich wenig Ahnung von uns– eine Gelegenheit für Gabriel, seine robusten Künstlerhauslegenden anzubringen.
Einführung: »Wir trinken auf meine Anna! Sie hat diesen Ort entdeckt! Die Höfe waren Ruinen, keiner der Bauern traute sich ran, weil sie unter Denkmalschutz standen. Dreihundert Jahre alt! Dieses Kaminzimmer war die Gesinde- und Viehküche, deswegen der riesige Kamin. Der Steinboden ist historisch. Hinter der Tür begann der Stall, über dem Stall in Kojen schlief das Gesinde, links die Mägde, rechts die Knechte, nächtlicher Kreuzverkehr unvermeidlich… Am Dachbalken der heutigen Bibliothek hat sich die letzte unverheiratete Erbin mit einem Kälberstrick erhängt.«
Zweite Runde: »Meine Anna! So viel Einsatz, so viel Liebe, ein Drama nach dem anderen, wenig Dank. Und nun, da es endlich rundläuft, darf sie nicht dabeisein– Anna, wir trinken auf dich!« Er prostet in die Luft. »Das erste Jahr war ich vor allem damit beschäftigt, René Uherek am Selbstmord zu hindern. Er hatte angekündigt, sich zu Tode zu saufen. Ein einziges Mal war ich für ein paar Tage fort, da trank er drei Flaschen Wodka, und ausgerechnet Anna mußte ihn retten– ihr waren die Fliegenschwärme vor seinem Fenster aufgefallen. Jetzt muß ich, Gnädigste«, eine leichte Verbeugung zu Sidonie, »rasch hinzufügen, daß wir grundsätzlich keine Stipendiatenwohnungen betreten, wir achten die Privatsphäre. Du hast also, Gnädigste«, er stößt mit ihr an, »nicht zu befürchten, daß eventuell jemand deinen eventuellen Kreuzverkehr stört! Aber im Fall von Uherek war’s richtig einzudringen– er lag komatös in seiner– nun, er lag seit Tagen…«
Mir graust, nicht wegen des von mir bewunderten Uherek, der schon in der DDR als Untergeher galt, sondern wegen mir; in diesem Fliegenschwarm erblicke ich meine Zukunft, sie platzt als Vision direkt vor meinen Augen, ich pralle zurück, niemand merkt es. Gabriel fährt begeistert fort– er genießt diese Geschichten, sie bedeuten für ihn Pathos, Existentialität, Bohème, all das, was er nie wirklich riskiert hat, abgesehen von einer durch Keramikfabrik und Anna gesicherten Zügellosigkeit.
Immerhin muß man sagen, daß Gabriel keinem Künstler je etwas übelnahm, er verzeiht jede Unverschämtheit, jeden Wahnsinn. Er lacht über den Maler, der vom Bibliothekstelefon aus mit Chile telefonierte, angeblich um Honecker zu sprechen, und über die Autorin, die Schadensersatz forderte, weil nach einem Rohrbruch ihr Computer naß wurde. Er lacht besonders über den Autor, der aus Eifersucht mit dem Messer die Gemälde eines Bildenden zerfetzte– die Eifersucht galt nicht mal einer Frau, sondern dem Talent des Bildenden, bemerkt Gabriel kopfschüttelnd, und auch der Bildende zog vor Gericht, nicht gegen den Eifersüchtigen, sondern gegen das Künstlerhaus…
Wir lassen ihn reden, er braucht das, um sich zu vergewissern, um sich abzulenken, um uns zu imponieren, und er imponiert uns auch: Wie er Künstler bändigt, Klagen abweist, Streit schlichtet, die Dörfler beruhigt, weil Künstler am Dorfeingang ein Verkehrsschild aufstellten: Auschwitz 1001km.»Kürzlich hat der Bildhauer Fritz was mit der Fernsehfrau Steinbrecher angefangen– sie heißt wirklich so«, lacht Gabriel, »vielleicht hat das den Fritz stimuliert. Die Steinbrecher kam eigentlich zu uns, um fürs Fernsehen eine Künstlerhaus-Doku zu drehen, und dann verliebte sie sich in den Steine brechenden Fritz und brannte mit ihm durch. Leider ist der gehörnte Gatte ausgerechnet der Regierungsbeamte, der für uns zuständig ist, und er wollte sofort die Subventionen streichen. Nächsten Monat ist das frevelhafte Paar bei uns zu Gast, und ich weiß noch nicht, welche Taktik ich anwenden werde: die beiden auseinanderbringen, damit uns Steinbrecher wieder unterstützt, oder dafür sorgen, daß Fritz sie weiterbumst, um Steinbrecher zu demütigen.«
Gegen elf sagt er, er gehe jetzt zu Bett: »Kommst du mit rauf, Sidonie, auf ein Gläschen Grappa?«
»Wie hat er das gemeint?« fragt Sidonie verblüfft, als Gabriel verschwunden ist.
»Genau so!« amüsiert sich Sayed mit seinem gaumigen arabischen Akzent. »Wir nennen ihn Grappiel.«
*
Nachts wirft sich Sayed auf seinem Bett hustend hin und her. Da seine Wohnung im Schafstall direkt an meine grenzt, nehme ich an, daß auch die Räume gleich aufgeteilt sind, wir schlafen also gewissermaßen Kopf an Kopf. Die Trennwand zwischen den Wohnungen ist aus Pappe oder Gips– was an diesem Schafstall ein Privileg sein soll, weiß ich wirklich nicht. Als Sayed letzte Woche die Frau dahatte, habe ich alles gehört– ziemlich klägliche Vorstellung übrigens, und ich regte mich auf, weil ich nicht wußte, ob mich das befriedigen oder erniedrigen sollte, bis mir klarwurde, daß es darauf nicht ankommt, denn, viel schlimmer, er hört mich genauso gut, mein Taumeln, mein Schimpfen, meine Schreie im Traum.
Sayed trinkt. Nicht laut und heftig, sondern gemächlich; nicht Schnaps, sondern Wein. Wahrscheinlich kifft er auch. Ich erkenne es am Glitzern in seinen Augen und am Grinsen. Er verbirgt es nicht, im Gegenteil, er präsentiert es wie eine Narrenkappe. Dabei ist er tüchtiger, als er tut. Er arbeitet in drei Sprachen für Exilzeitschriften in fünf Ländern und schreibt massenhaft Briefe, die er immerzu zur Post trägt. Jetzt sehe ich ihn in zerfallenden Sandalen auf den Schafstall zulatschen. Pferdeschwanz, Mäusebart, zerrissene Hosen, die Schulter gebogen unter einer schweren Umhängetasche– hoffentlich klopft er nicht. Ich habe versprochen, sein Buch zu lesen, und es nicht getan, es deprimiert mich. Jetzt merke ich: Alles, was ich statt dessen getan habe, war noch deprimierender. Wenn er mich schont und vorbeigeht, werde ich lesen.
Er klopft.
Ich humple auf dem Gipsfuß zur Tür in der Hoffnung, er wird die Geduld verlieren. Er verliert sie nicht. Ich öffne.
Er greift in seine Ledertasche, zieht grinsend und hüstelnd einen Apfel hervor, reicht ihn mir und geht.
Gott sei Dank ist sein Buch dünn.
*
Es ist ein autobiographischer Text. Sayed schlurft, wie ihm die Sandalen von den Füßen fallen, und so schreibt er auch: ausdrucksvoll nachlässig, insgeheim pathetisch.
Sayed stammt aus dem Libanon und floh Anfang der Achtziger vor dem Krieg nach Deutschland. Schon früher war er vor seinem Vater geflohen, einem kurdischen Großgrundbesitzer, der im Dorf ein eisernes Regiment führte. Sayed hat einundzwanzig Geschwister. Seine Mutter war von vier Frauen die zweitjüngste, und die kinderreichste: Sie allein hatte zehn Kinder. Dabei war sie halb geächtet, denn nach der Heirat verkrachte sich ihr Clan mit dem ihres Mannes, und der Mann betrachtete seine eigenen Kinder von ihr als Feinde. Sayed mußte ständig arbeiten, Geschwister hüten, das Vieh füttern. Er wurde geschlagen. Der Alte schlug auch seine Frauen und seine anderen Kinder, aber Sayed am häufigsten, da er seinen Widerstand spürte.
Sayed wollte fort, seit er denken kann. Er durfte aufs Gymnasium, weil er begabt war. Ein Gymnasium gab es in der Stadt, siebzig Kilometer weiter. Sayed packte sein Bündel mit der Gewißheit, nie mehr zurückzukehren. Beim Abschied sah er die Mutter weinen und meinte zu wissen, daß sie es wußte und ihn beneidete. Er prägte sich das Bild ein, die verschorften Wangen, die runzligen Hände, den wieder einmal dicken Bauch. Manchmal sitzt mir der Tod auf der Brust, dann sehe ich deine Trauer, die mir das Glück befiehlt.
Neulich bekam er mit der Post eine Tonbandkassette, besprochen vom Vater, der kaum schreiben kann. Der Patriarch sagte, nachts fühle er im Herzen die Liebe zu seinem Sohn pochen. Billige Reue, schreibt Sayed, ein Taschenspielertrick! Ihm schenkt er Erlösung, mir stiehlt er das Mark.
Damals auf dem Dorf bekam keiner ein Zeichen der Liebe. Die einzelnen Frauen schliefen mit all ihren Kindern in jeweils einem Zimmer. Sayed weiß nicht, wie das Eheleben geregelt war. Vielleicht schlich sich die Frau, die jeweils dran war, nachts heimlich aus dem Zimmer? Vielleicht merkte man, wer fällig war, daran, welche sich abends schminkte? Manchmal stritten die Frauen darum. Selten kam das Thema zur Sprache. Einmal erwähnte die zweite Frau, daß sie erschrak, als ihrem Mann während des Hochzeitsaktes plötzlich Speichel aus dem Mund lief.
*
Sind unsere Väter schuld, daß wir so geworden sind? Oder sind es die Mütter, die die Väter gewähren ließen? Ich erinnere mich an die Wutanfälle meines Vaters– ich weiß bis heute nicht, ob sie echt oder gespielt waren. Ständig nörgelte er am Essen, im günstigsten Fall spottete er, im ungünstigsten warf er mit Geschirr. Meine Mutter wußte von vornherein, daß sie es ihm nicht recht machen konnte, und versuchte es doch jeden Tag. Beim Kochen war sie ein Nervenbündel.
Sie ließ es an den Kindern aus, das heißt an mir, denn meine viel ältere Schwester arbeitete bald irgendwo als Sekretärin und war kaum mehr zu Haus. Jemand sagte mir, daß Kinder schlechte Bedingungen normal finden, solange sie nichts anderes kennen. Auf mich trifft das nicht zu, ich spürte früh, daß etwas nicht stimmte. Dabei habe ich weniger unter den armseligen Verhältnissen gelitten als unter der Heuchelei, der Angeberei des Vaters, der mütterlichen Bigotterie. Die Erwachsenen schienen einen heimlichen Genuß aus diesen verdrehten Spielen zu ziehen. Bald suchte auch ich meinen kleinen parasitären Genuß. In der engen Wohnung erwachte ich nachts vom rhythmischen Stöhnen des Vaters. Es war grotesk und erregend zugleich. Am Morgen suchte ich gierig nach Spuren des Widerwillens auf Mutters Gesicht.
Vater ging fremd. Einmal, da war ich vielleicht sieben, nahm er mich auf dem Fahrrad irgendwohin mit, ich erinnere mich an Feldwege, Sonne und Mais. Bei einer Scheune stiegen wir ab. Eine tschechische Magd kam uns entgegen, die mir als Eva vorgestellt wurde– »Aber erzähl der Mama nicht, daß wir sie getroffen haben, die ist sonst traurig.« Vater und Eva redeten miteinander Tschechisch, dann gingen sie in die Scheune. Ich saß im Staub und spielte. Schließlich kam Vater wieder heraus, lächelnd.
Im dritten Kriegsjahr wurde er eingezogen, allerdings nicht an die Front, sondern als Verwalter eines Lazaretts nach Mähren. Wir besuchten ihn in unserem Protektorat, das mir wie Ausland vorkam: Kreuze, bunte Kirchen voller Gipsschnörkel, gedrechselte Säulen, schwarzgekleidete Frauen. Man verbot uns zu streunen, von Partisanen war die Rede. Das Lazarett war in einem alten Kloster eingerichtet. Mönche liefen herum. Im Refektorium lagen Schwerverwundete– Armlose, Beinlose, Eiternde, Blutende, Fiebernde und Schreiende. Man mußte zwischen ihnen hindurch zur Treppe ins Obergeschoß, das Vater bewohnte. Vater war aufgeräumt und zynisch. Mutter warf ihm vor, er schlafe mit den Krankenschwestern; es gab Tränen. Übrigens hat wohl auch Mutter in Aue einen Liebhaber gehabt. Er kam, wenn ich schlief. Ich wachte auf und hörte eine fremde Männerstimme.
Meine Kindheit unterschied sich also von Sayeds weniger, als es scheint. Trotzdem meine ich, daß er es leichter gehabt hat, denn er ließ die fatalen Verhältnisse für immer hinter sich. Ich indessen wurde in die Pflicht genommen und habe weiter versagt.
Das erste Mal in Leipzig. Ich studierte bereits am Literaturinstitut und bewohnte ein Zimmer in der Altbauwohnung einer Bürgerwitwe, in Untermiete nur, aber für mich allein; zum ersten Mal fühlte ich mich frei. Natürlich versuchte ich Frauen hereinzulocken, und einmal glückte es, ich kam sogar ans Ziel. Als ich später erwachte, störte mich die fremde Frau. Ich setzte mich auf die Bettkante, drehte das Radio auf und rauchte. Sie rückte nach, ich fühlte mich bedrängt und griff reflexhaft auf die kalten Sprüche meines Vaters zurück, schließlich nannte mich die Frau unausstehlich und ging. Am Morgen fragte ich mich voller Unruhe, was schiefgelaufen war. Ich erinnerte mich an die Dringlichkeit, die Fremdheit, die Angst zu versagen, den Streß, den Triumph, und das alles erregte mich derart, daß ich nicht wußte, wie ich über den Tag kommen sollte ohne die Frau, die ich vergrault hatte; ich rannte durchs Zimmer, um mich nicht an mir zu vergreifen. Da hörte ich schüchternes Klingeln, ganz anders als das der üblichen Besucher der Witwe. Ich stürmte durch den Flur und riß die Tür auf, bereit, über jede Frau herzufallen. Im muffigen Treppenhaus stand kläglich und ergeben meine Mutter.
Natürlich bat ich sie herein. In meiner Verwirrung bot ich ihr eine Zigarette an, aber sie sank weinend aufs Sofa und erklärte, daß sie es mit Vater nicht mehr aushalte. Sie musterte fast hoffnungsvoll mein häusliches Chaos, das zerwühlte Bett, das schmutzige Geschirr, die Staubmäuse unterm Tisch, und bot an, Ordnung zu machen. Dann fragte sie stotternd vor Verlegenheit, ob sie nicht vorübergehend– nur ein paar Tage– bei mir unterkommen könne. Sie würde auf dem Boden schlafen. Sie würde überhaupt nicht stören, sondern sofort was Neues suchen. Aber für heute wisse sie einfach nicht wohin.
Ich lehnte ab. Wie sollte das gehen, nur ein paar Tage? Ich kannte die Wohnungsnot in Leipzig, und ich kannte die Passivität meiner Mutter. Ich wollte nicht den Jammer einer dreißigjährigen Katastrophenehe auffangen, an der ich mich unschuldig fühlte, ich wollte Unabhängigkeit und Sensationen und Lust. Ich erklärte also, daß es Menschen gebe, die für die Freiheit geschaffen seien, und andere, und daß Mutter meiner Meinung nach zu den letzteren gehöre. Es war leicht, ihr das einzureden. Sie war demoralisiert.
KÄMPFE
Die Macht, die ich gewinne–
die habe ich zwar inne.
Sie aber übt mich aus…
Manfred Streubel
Während ich übersetze, kommt ein Einschreibebrief. Absender: Der Polizeipräsident. Ein Stromschlag ins Gehirn, Flimmern vor den Augen. Ich entziffere mühsam: Urteil nach §§, Strafbefehl, Unfall vom… April, Trunkenheit, Gefährdung des Straßenverkehrs, Punkte in Flensburg. Geldstrafe: 30 Tagessätze à 50,– Mark, die ich nicht habe, oder 30 Tage Gefängnis.
Ich falte den Brief zusammen, stecke ihn in die Tasche und humple ohne nachzudenken rüber zum Edeka. Ich kaufe vier Flaschen Dornfelder Rotwein und eine Flasche Wodka, eine Stange Zigaretten, Käse, Brot. Als ich zurückkehre, sitzt Sidonie vor meinem Haus. Sie blickt von einem Buch auf und fragt: »Wie siehst du denn aus?«
»Ich muß ins Gefängnis!«