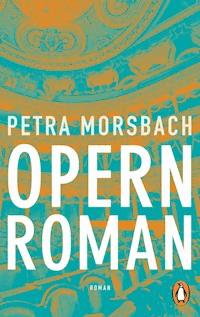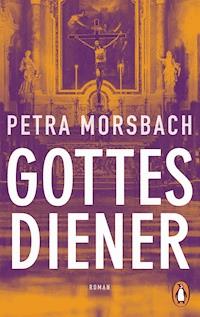9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Gesellschaftsroman über Recht und Gerechtigkeit
Thirza Zorniger stammt aus einer desaströsen Schauspielerehe und will nichts anderes, als für Gerechtigkeit sorgen. Unter der Obhut des Großvaters und zweier ältlicher Tanten wird aus dem kleinen Mädchen eine fleißige Studentin und zuletzt Richterin im Münchner Justizpalast. Doch auch hier ist die Wirklichkeit anders als die Theorie: Eine hochdifferenzierte Gerechtigkeitsmaschine muss das ganze Spektrum des Lebens verarbeiten, wobei sie sich gelegentlich verschluckt. Und auch unter Richtern geht es manchmal zu wie in einer chaotischen Familie ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch:
Thirza Zorniger stammt aus einer desaströsen Schauspielerehe und will nichts anderes, als für Gerechtigkeit sorgen. Unter der Obhut des Großvaters, eines ehemaligen Strafrichters, und zweier ältlicher Tanten wird aus der kleinen Thirza ein linkischer Teenager, dann eine fleißige Studentin, zuletzt eine Vorsitzende Richterin im Münchner Justizpalast. Doch wie überall ist auch dort die Wirklichkeit anders als die Theorie:
Eine hochdifferenzierte Gerechtigkeitsmaschine muss das ganze Spektrum des menschlichen Lebens verarbeiten, wobei sie sich gelegentlich verschluckt. Die Menschen sind oft weniger unschuldig, als sie denken. Und für die Richterin ist es nicht einfach, unter Bergen von Akten und zwischen tausend ermüdenden, verworrenen, erschütternden und bisweilen absurd komischen Fällen ein eigenes Glück zu finden.
Pressestimmen
»So einen profunden Blick in den deutschen Justizapparat gab und gibt es bisher nicht.«
Heribert Prantl in seiner Laudatio zum Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2017
»Wer aus diesem Roman herauskommt, der ist nicht nur fortan in lingua iustitiae gestählt, ohne selbst vor Gericht gemusst zu haben, der ist auch klüger.«
Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Als Skulptur würde Morsbachs Justizia, statt eine Augenbinde zu tragen, leise mit den Augen lächeln.«
Hubert Winkels, Süddeutsche Zeitung
Über die Autorin:
Petra Morsbach, geboren 1956, studierte in München und St. Petersburg. Danach arbeitete sie zehn Jahre als Dramaturgin und Regisseurin. Seit 1993 lebt sie als freie Schriftstellerin in der Nähe von München. Bisher schrieb sie mehrere von der Kritik hoch gelobte Romane, u.a. Opernroman, Gottesdiener und Dichterliebe. Ihr Werk wurde u.a. mit dem Marieluise-Fleißer-Preis, dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung, dem Jean-Paul-Preis und dem Roswitha-Preis der Stadt Gandersheim sowie mit zahlreichen Stipendien ausgezeichnet. Für die Arbeit an Justizpalast recherchierte die Autorin über neun Jahre.
Petra Morsbach
Justizpalast
Roman
Knaus
Diese Arbeit wurde vom Deutschen Literaturfonds e.V. und vom Adalbert Stifter Verein e.V. gefördert.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Copyright © 2017 beim Albrecht Knaus Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Zitat stammt aus dem Roman »Um Diamanten und Perlen« von Hedwig Courths-Mahler.
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: Lookphotos
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-21666-5V003www.knaus-verlag.de
Tue das, was dich würdig macht, glücklich zu sein.
Immanuel Kant
Inhalt
I
Der Traum
Die Arbeit
Studien
Erste Schritte
II
Vorbilder
Die Mühle
Rückblicke
Die Zeit
III
Begegnungen
Max
Das Glück
Der Palast und die Gnade
IV
Weiteres Glück
Der Schlag
Danach
Die Robe
Dank
I
Der Traum
Schon Thirzas Mutter wäre gern Richterin geworden. Doch dann kam Carlos Zorniger dazwischen.
Carlos Zorniger war Schauspieler und recherchierte am Strafgericht für eine Filmrolle. Thirzas Mutter, damals Referendarin, hatte ihn im Residenztheater als Gessler gesehen und errötete am Richtertisch. In einer Verhandlungspause trat er auf sie zu und sagte: »Ich bin Carlos Zorniger und würde Sie gern löchern.« Die kleine Thirza hat noch erlebt, wie er auf Partys mit dieser Anekdote brillierte, wenn einer fragte, wie er, der alte Troll, die junge Schönheit erobert habe. »Ganz einfach«, antwortete er in farbigem Bass. »Ich sah sie, als …« und so weiter. Zunächst hatte die Mutter mitgespielt, indem sie sich neben ihn stellte und wisperte: »Gerne … wenn ich Ihnen helfen kann?« Dann gab es sprachbewusste und genießerische Lachsalven. Carlos und Gudrun waren ein angesagtes Schwabinger Bohemepaar.
Carlos Zorniger, Augenbrauenwunder, Hufschmiedstatur, gebürtiger Berliner, war sechsundzwanzig Jahre älter und hatte bereits vier Kinder aus drei Ehen. Gudruns Eltern sträubten sich vergeblich. Sie wohnten bescheiden als Heimatvertriebene in einem alten Handwerkerhaus in München-Pasing und hüteten ihre begabte Tochter. Gudrun lebte noch als Referendarin zu Hause. Als einziges überlebendes Kind sollte sie die Familie für verschiedene Katastrophen und Bedrückungen entschädigen und tat auch ihr Bestes und verbarg oder verdrängte darüber ihr eigenes Temperament. Doch lehnte sie alle soliden Verehrer ab, die strebsamen Kommilitonen ebenso wie zwei junge Kollegen des Vaters, der als Jurist beim Bayerischen Rundfunk angestellt war. Ihre Gefühle nährte Gudrun in Theater und Oper: gebilligte Fluchten, denen väterliche Vorträge über Schiller und Puccini vorausgingen, während Gudrun davon träumte, mit Mortimer durchzubrennen oder von Scarpia vergewaltigt zu werden. Einmal begleiteten die Eltern sie ins Residenztheater zu Wilhelm Tell und sahen Carlos Zorniger als wilden Gessler. Im Foyer stand Gudrun lange vor einem Zorniger-Starfoto. Ihr Vater bemerkte im Vorübergehen: »Der sieht verkommen aus.« Das war die Vorgeschichte.
Übrigens verdiente Zorniger gut und konnte etwas bieten: Beletage in der Hohenzollernstraße, Prominenz zu Gast, Feste bis in den Morgen. Gudrun trat zum zweiten Staatsexamen nicht mehr an. Die Ehe war turbulent. Fotos zeigen ein begeistertes, fast atemloses Paar. Carlos war viel unterwegs. Wenn er ging, war es wie Dämmerung, wenn er kam, wie eine bunte Wolke, er brachte alles zum Leuchten und hinterließ Leere. Einmal gab es Streit. Danach lagen sie auf einer Wiese und hielten einander umschlungen, mit der zweijährigen Thirza dazwischen oder darauf. Thirza rief immer wieder: »Mütich! Mütich!« – was »gemütlich« heißen sollte. So hat es Thirzas Mutter später erzählt. Thirzas Erinnerung setzt erst später ein.
Manchmal waren fremde Frauen am Telefon. Gudrun schimpfte. Carlos lachte: Schließlich komme sie nicht zu kurz; wenn sie etwas entbehre, möge sie sich melden. »Es geht in einer Ehe nicht nur um das Eine«, stieß Gudrun hervor. – »Ach nein? Und worum dann? Soll ich dich auf Händen tragen?«, fragte Carlos, hob sie hoch und trug sie auf Händen. Es gibt ein Schwarzweißfoto aus dieser Zeit, das anscheinend nach einem Ehekrach aufgenommen worden war, übrigens von einem sehr guten Fotografen. Die Gatten kleben Rücken an Rücken aneinander. Geknipst außen, tags. Gudrun – im Trenchcoat, weiche Locken, lange Wimpern, zartes Profil – blickt trotzig nach rechts aus dem Bild und kann sich doch nicht lösen. Carlos, kleiner als sie, Lederjacke, wendet das Gesicht nach vorn, halb über die Schulter ihr zu. Die Augen sind vom Schirm einer Schiebermütze verdeckt; eigentlich sieht man nur sein muskulöses Grinsen. Der ganze Mann strahlt die gelassene Erwartung eines bewährten Zuchthengstes aus.
Allerdings hatte der unwiderstehliche Carlos eine dunkle Seite. Sie zeigte sich zunehmend häufig, mal als Zynismus, mal als eisige Fremdheit. Die kleine Thirza prüfte vor jeder Begegnung unauffällig seine Stimmung. War er gut gestimmt, sprang sie in seine Arme, war er böse, schlich sie vorbei. Es war, als hätte sie zwei Väter. Die Mutter war stabiler: am Anfang verlässlich neugierig und lebensfroh, später ebenso verlässlich grau, bitter, krank.
Irgendwie geriet alles in Schieflage. Eine unbekannte Frau klingelte an der Tür, als die Eltern unterwegs waren, trat ungefragt ein, lief schimpfend durch die Zimmer und blickte hinter Vorhänge und in Bücherregale, als suche sie etwas. Die kleine Thirza verstand nur einzelne Worte: »Pah … abgeschmackt! Du ahnst es nicht … mein Gott, ist das … unverschämt!« Thirza hatte das Gefühl, Verantwortung übernehmen zu müssen, und traute sich nicht; sie folgte der Frau gepeinigt und beschämt. In der Küche ging die Fremde in die Knie, starrte Thirza aus hellblauen Augen an und sagte mit flirrender Stimme: »Hier hab ich ein Geschenk für deinen Papa.« Sie zog etwas aus der Handtasche wie ein großes Ei, in Wachspapier gewickelt. »Aber sag der Mama nichts davon. Ist nur für ihn.« Sie öffnete den Kühlschrank, musterte schimpfend den Inhalt und schob das Geschenk ins Gefrierfach. »Du gehst da nicht ran, verstanden?« Dann glitt sie hinaus wie eine Schlange; Thirza, die nicht gewagt hatte, ihr zu folgen, hörte erleichtert, wie die Tür ins Schloss fiel.
Weil Thirza meinte, versagt zu haben, erzählte sie keinem davon. Carlos erschien missgelaunt, da sprach man ihn nicht an, und Gudrun war eine nachlässige Hausfrau, die ihre Vorräte ohnehin nicht kannte. Thirza hatte das Geheimnis beinahe vergessen wie einen schlechten Traum, da flog es auf.
»Was ist das?«
»Das war … für Papa!«, wisperte Thirza erschrocken.
»Wie kommt das hierher?«
Thirza brach in Tränen aus. Die Eltern starrten in das geöffnete Wachspapier und begannen zu streiten, fauchend und pfeifend, es klang wie Peitschenhiebe. Thirza floh auf die Straße und lief bis zum Bahnhof, wo sie den gewohnten Zug nach Pasing zu den Großeltern nahm – sie hatte sich den Weg gemerkt, ohne es zu wissen.
Die Großmutter erzählte später, ein Fahrgast habe das panische Kind bei ihnen abgeliefert; sie ihrerseits brachte es zu Tante Schossi und Tante Berti, die den oberen Stock des Häuschens bewohnten. Tante Schossi und Tante Berti waren Schwestern der Großmutter. Da der Großvater gegen Kindergeräusche empfindlich war, nahmen sie Thirza in ihre Obhut.
Thirza habe mit aufgerissenen Augen auf der Couch gesessen, während sie ihr heiße Milch mit Honig einflößten – es war ein dämmriger Herbstabend. Später nahm Tante Berti sie mit in ihr schmales Bett. Thirza spürte am Rücken den warmen, weichen Leib, weinte ein bisschen und schlief darüber ein. Als sie aufwachte, schien die Sonne durch die grauen Gardinen, es duftete nach Kaffee und Orangenschalen, die Tür stand offen, in der gemeinsamen Wohnstube sprachen die Tanten mit gedämpften Stimmen. Man hatte ermittelt. Der Opa kam langsam die knarzende Stiege hinauf. »Wusstest du nicht, dass man keine fremden Leute einlässt, wenn Mama und Papa nicht da sind?« Thirza hatte es nicht wirklich gewusst, nur geahnt; ihre Augen füllten sich mit Tränen, gleichzeitig fühlte sie eine betäubende Hitze in sich aufsteigen und sank in die Kissen. »Aber siiiehste nicht, Willi, se hat Fiiieber«, das war die volle, tiefe Stimme von Tante Berti, und Opa verschwand. Unter der schweren Glocke dieses Fiebers erholte sich Thirza und lernte nebenbei ein neues Wort: Embryo. Wieder zu Hause, lernte sie ein weiteres: Simulantin.
Ein Jahr später, Thirza war sechs, stand der Vater mit einem Koffer vor ihr und sagte, er ziehe jetzt aus, sie sähe ihn nicht wieder. Er sprach mit schwerer Stimme und schwankte.
»Und Mama?«
»Sag ihr, mit abber Brust läuft bei mir nüscht.«
Wieder würgende Stummheit, schlimmer als der drohende Verlust. Wieder ein schreckliches Geheimnis und das Gefühl, versagt zu haben; Thirza wusste nicht genau, was die Worte bedeuteten, und ahnte doch, dass man sie besser nicht weitergab. Sie wartete allein in der großen Wohnung und wünschte sich verzweifelt das dicke, heiße Kissen des Fiebers zurück, übergab sich ins Gästeklo, wieder war Spätherbst, wieder Dämmerung, sie lief durch alle Zimmer und knipste alle Lichter an. Draußen fiel Schnee.
»Warum ist Papa nicht da?«
»Er kommt nicht wieder«, flüsterte Thirza.
»Das hat er gesagt? Und was noch?«
»Nichts«, kaum hörbar.
»Ich sehe dir an, dass du lügst.«
Als Alptraum kehrte die Szene später wieder. Thirza, im Traum doppelt so groß und dreimal so alt, wusste jetzt, was der Satz bedeutete, und schämte sich in Grund und Boden. Ihr Kopf begann zu schmerzen, sie ächzte laut, und die Mutter sagte: »Spiel dich nicht auf, kleine Verleumderin, es geht hier nicht um dich.«
*
Die Mutter musste ins Krankenhaus. Thirza kam in Pasing unter, ging von nun an dort in die Schule und fühlte sich gerettet. Wieder wohnte sie bei den Tanten im ersten Stock. Wenn der Opa in der Arbeit war, machte sie unten in seiner Bibliothek Hausaufgaben. Es war ein verrauchtes kleines Zimmer auf der Rückseite des Häuschens mit Blick in einen langen, schmalen Garten zwischen hohen Ziegelmauern. Im Vordergrund beackerte die Großmutter ihre Gemüsebeete, im Mittelfeld gab es sieben Apfelbäume, an denen stumpfbraune Äpfel mit hartem, süßsaurem Fleisch wuchsen, am Ende stand ein alter, ungenutzter Schuppen.
Opa, Oma und die beiden Tanten waren aus Ostpreußen geflohen und pflegten ihre kleine Enklave mit einer entschlossenen Inbrunst, die Thirza sich sofort zu eigen machte. Ein kleines Ölbild neben dem Kaffeetisch zeigte stahlblaues zerwühltes Wasser vor einem kalt leuchtenden Abendhimmel, der von einer weißgesäumten schwarzen Wolke zerschnitten wurde. Das war der Ort der Sehnsucht: Okullsee!, schmachtend auszusprechen.
Alle Besucher stammten aus derselben alten Heimat, und Thirza lauschte hingerissen den nie versiegenden Fluchterzählungen im weichen, singenden Ton: Karlchen is im Krieje jeblieben, der Russ kam über den zujefrorenen See, den Verwalter hat der Pole ans Hoftor jenagelt. Die neue Heimat war ein trauriges Provisorium. Ein des Russischen mächtiger Cousin aus dem Baltikum wollte in einer St. Petersburger Enzyklopädie unter dem Stichwort »Bayern« die Auskunft »listiges Bergvolk« gefunden haben. Darüber lachten die Tanten noch beim Zubettgehen, »listijes Bergvolk, haha«, und schon flossen Tränen: Sie hatten als Flüchtlinge in Bayern so viel Hunger gelitten, dass sie, meist vergeblich, bei den Bauern bettelten. Einmal war Tante Berti nachts im Hungerwahn in einen Hühnerstall eingedrungen, um – nein, kein Huhn zu rauben, sondern Hühnerfutter. Der Bauer stürzte mit Lampe und Flinte heraus und brüllte in dieser kollernden, unförmigen Sprache, und Tante Berti konnte nicht anders, als sich weiter mit beiden Händen Körner und Federn in den Mund zu stopfen, während Tante Schossi im Gebüsch laut weinte.
Thirza lachte und weinte mit ihnen, aus Zugehörigkeit. Sie profitierte vom Verlust der Gatten und Söhne: als einziges Kind im Haus war sie ein Quell des Entzückens. »Tizzilein, Kindchen, schon wieder eine Eins, wie machst du das nur?« Thirza lieferte ihre Zeugnisse ab wie Trophäen und sah in leuchtende faltige Gesichter.
Ab und zu besuchte sie ihre Mutter. Gudrun bewohnte immer noch die große Schwabinger Wohnung, rauchte Kette und sah hart und schmal aus wie ein Bügelbrett. Fast alle Möbel waren fort. In der Mitte des ehemaligen Salons stand auf einem Tischchen eine weiße Urne als irgendwie bedeutsames Requisit der gescheiterten Ehe, und Gudrun kreiste rauchend um diese Urne. »Hast du von Carlos’ neustem Streich gehört? Seine Braut ist davon, weil sie ihn am Vorabend der Hochzeit mit der Schwiegermutter in flagranti ertappte.«
Thirza wusste nicht, was in flagranti war, teilte aber die Verachtung für Carlos, dem sie übrigens glich: untersetzt, dunkel, eigensinnig. »Du kommst auf ihn«, sagte die Mutter, »du kleine Egoistin. Na, fühlst du dich wohl als Sonnenschein der alten Nazis? Opas Lieblingsenkelin. Dass ich das erleben durfte. Sag bloß, du willst auch Richterin werden.«
Der Großvater war in Allenstein Strafrichter gewesen. Sein erster Sohn starb als Kind an Diphterie, der zweite kam als Halbwüchsiger auf der Flucht ums Leben. Die Tochter glich den Verlust nicht aus. Im Hintergrund standen weitere Probleme, von denen nicht gesprochen wurde, und eines, von dem viel die Rede war: Wegen einer ungerechten Haftstrafe nach Kriegsende war er erst im Jahr siebenundvierzig hier eingetroffen, als alle Posten in der Justiz schon vergeben waren. Erst im Jahr neunundvierzig kam er in der Verwaltung des Bayerischen Rundfunks unter. Trotz aller Schwierigkeiten hatte er Frau, Tochter und Schwägerinnen in verschiedenen Lagern ausfindig gemacht und ihnen in Pasing ein neues Heim schaffen können. Er war hochgewachsen, gerader Rücken, Anzug und Krawatte, Pfeifenraucher, bedächtiger Redner, intellektuelles, von den Zeitläuften leicht beleidigtes Gesicht – ein stiller, zäher Patriarch. Nur eines störte die noble Erscheinung: eine Landkarte brauner Flecken auf dem kahlen Schädel, als wüchsen Pilze darauf.
Seine Tochter wollte mit ihm nichts zu tun haben. »Er denkt, was alle denken. Ein juristischer Zinnsoldat. Carlos war zwar ein Schwein, aber er hat mich da rausgesprengt. Glück im Unglück. Oder soll man sagen Unglück im Glück?« Vielleicht gab es gar keine Rettung für Gudrun – auch wenn nicht eines Tages Carlos Zorniger im Gerichtssaal aufgetaucht, oder wenn er in eine andere Verhandlung gegangen wäre. Viel später fand Thirza eine These dazu: Gudrun erfüllte eine komplizierte Vorgabe, nach der sie gleichzeitig retten und versagen musste, und rächte sich für diesen vermeintlichen Verrat des Vaters durch eigenen Verrat.
*
Und der Großvater? Falls er sie verraten hatte, war es ihm nicht bewusst. Von der verlorenen Tochter sprach er mit einer edlen Melancholie, die er sogar verschämt als Bußübung zu genießen schien: Melancholie als abgeklärte Form der Trauer. Edel der Verzicht auf formelle Zurückweisung einer Schuld, an die man nicht glaubt. Von der Justiz, die sein Lieblingsthema blieb, redete er ähnlich, und da er sich in der Rundfunkverwaltung nicht ausgelastet fühlte, verfasste er ein Traktat darüber. Das Eingangskapitel gab er Thirza für Gudrun mit, die nach den ersten Zeilen in Hohngelächter ausbrach und alle Blätter wieder in Thirzas Rucksäckchen stopfte. Thirza erzählte dem Großvater von dieser Zurückweisung nichts, und er fragte nicht nach. Als sie Jahre später ihr Kinderzimmer ausräumte, fand sie die Papiere und las: »Bedauerlicherweise ist das Rechtswesen im öffentlichen Diskurs beklemmenden Anzweiflungen ausgesetzt. Sogar die Kunst löst extra muros mehr Vertrauen aus als die methodologisch so durchdachte und für das Staatswesen so unentbehrliche Rechtswissenschaft.«
»Ja, das ist sein Kardinalthema«, war Gudruns Kommentar gewesen. »Da wird er wohl bis an sein Lebensende die eine oder andere Krokodilsträne fallen lassen. Frag ihn doch, warum seinesgleichen im Dritten Reich die Justiz nicht vor den Nazis bewahrt hat.«
Thirza trug Berichte zwischen den Haushalten hin und her, wobei sie die Provokationen unterschlug. Da der Großvater bei aller Rigidität durchblicken ließ, dass er verletzlich sei, hatten die Frauen des Haushalts eine Kultur entwickelt, die ihn schonte, ohne es zu zeigen, da sie zu spüren meinten, dass das Bewusstsein, geschont werden zu müssen, ihn gekränkt hätte. In der Praxis sah das so aus, dass sie ihm fast ehrerbietig begegneten, während sie in seiner Abwesenheit von ihm sprachen wie von einem Kind. »Ach, der Willi. Nein, er bejreift es nicht.« Es ging um Fehler, die nicht benannt werden durften. Er selbst stellte ungnädig fest, er habe immer nach der geltenden Rechtslage gehandelt. Thirza registrierte die Verstrickungen, ohne zu wühlen, schonte die Empfindlichkeiten, profitierte von den Schweigeabkommen und nahm sich vor, später alles besser zu machen. Vor allem war sie heilfroh, dass Gudrun nicht auf die Idee kam, sie zu sich zu nehmen. Tante Berti deutete an, dass der Willi Gudrun finanziell unterstützte, obwohl sie offiziell keinen Umgang hatten. Vor Thirza sollte dieses Arrangement verheimlicht werden. Warum? In einem Alptraum streckte Gudrun die qualmende Hand nach ihr aus und sagte: »Braves Kind! Keine Laster, lernst wie eine Maschine, du wirst in der Justiz Karriere machen. Ist der Heiligenschein schon bestellt?« Thirza fühlte sich keineswegs heilig, wusste aber schon im Traum, dass sie lieber noch schuldiger werden würde, als sich dem Schwabinger Niedergang auszusetzen. Gudrun zog die verkohlten Finger zurück und sagte: »Versteh schon, mit abber Hand läuft bei dir nüscht.«
*
Tante Schossi war sanft und bescheiden, Tante Berti drehte sich Locken und sang im Chor. Bisweilen zankten sie wie müde alte Tauben, doch bald teilten sie wieder gurrend Klage und Glück. Ihre Schwester, Thirzas Großmutter, genoss nichts, sondern trauerte still um die verlorenen Kinder, während sie dem Hausherrn diente. Sie hatte Bauchbeschwerden, wurde operiert, kam nach Hause, genas leidend, erkrankte aufs Neue, erbrach keuchend. Thirza lernte das alarmiert auszusprechende Wort »Darminfarkt« und wurde zu ihrem Entsetzen für einige Tage zu Gudrun geschickt, wo sie die Tiraden und den beißenden Zigarettenqualm ertrug und sich als Märtyrerin fühlte. Nach dem Begräbnis durfte Thirza nach Pasing zurück und trauerte mit den Tanten. »Zuletzt war es eine Erlösung«, sagte Schossi benommen. »Für alle«, fügte Berti hinzu. »Zuletzt hat se jesacht: Tut mir lejd, dass es so lange jedauert hat.«
*
Gudrun starb im Jahr darauf mit der Bemerkung: »Bei mir soll es nicht so lange dauern.« Sie deutete an, »der Friedrich« habe Morphium besorgt. Mit dem Vater versöhnte sie sich nicht. »Er wird niemals … zugeben …« Thirza fragte wie immer nichts. Es wäre die letzte Gelegenheit gewesen. Gudrun saß aufrecht am Küchentisch und redete geistesabwesend mit langen Pausen, die Thirza als Unhöflichkeit empfand. »Wie soll ich … was soll … äh … vielleicht sollte ich Kaffee kochen?« Sie griff mit ihrer schmalen, knochigen Hand nach Thirzas prallem Unterarm. Heißer Juni, das Fenster stand offen, der Holunderbaum im Hof schien nur aus Blüten zu bestehen, ein Berg aus stumpfweißen Schirmchen, Dampfwolken über der Stadt. »So, du bist also … ausgerechnet … das Leben? Für dich … das … ich? Da machen wir doch jetzt lieber einen Kaffee.«
*
Bei Gudruns Beerdigung, die von den überraschend zahlreichen Schwabinger Freunden ausgerichtet wurde, hörte Thirza respektvolle Reden. Locker gekleidete grauhaarige Männer, die andeuteten, Gudruns Liebhaber gewesen zu sein, rühmten die Verstorbene in Fremdwörtern: Esprit, Eleganz, Charisma, Courage. Ein Zylinder-Herr mit Theaterstimme erinnerte sich an die anmutige junge Gastgeberin. Er sei den Einladungen des unausstehlichen Zorniger nur gefolgt, um gelegentlich für ein paar Stunden die schöne Gudrun ansehen zu dürfen. Der unausstehliche Zorniger, der danebenstand, lachte stolz und erzählte seinerseits, er sei extra aus Berlin angereist, obwohl er dort morgen den Wallenstein geben müsse in der berühmten Fels-Inszenierung, sie hätten sicher davon gehört: die ganze Trilogie an einem Tag, jede Aufführung seit Wochen ausverkauft. Der Großvater stand bleich als Fremder daneben. Zu Hause hatte er bis gestern gewütet, es war dabei ums Prinzip gegangen, um die Art der Feier und den Text der Todesanzeige. Anscheinend hatte er nichts ausgerichtet. Heute Morgen hatte er sich beim Rasieren fast massakriert, ein Schnitt wie ein Schmiss vom linken Ohr bis zur Backe. Doch auf dem Friedhof stand er stumm und ausdruckslos.
Die Tanten weinten leise, und Thirza weinte mit, wie immer mehr aus Sympathie als aus Trauer. Sie fragte sich, ob Gudrun sie überhaupt geliebt hatte, zumal sie sie so leichten Herzens an die Großeltern abgetreten hatte. »Abgetreten«, dieses Wort befiel Thirza wirklich vor dem offenen Grab, und nun weinte sie laut und ehrlich, aus Selbstmitleid wie aus Dankbarkeit. Als sie vom Grab zurücktrat, zog jemand von hinten sie in seine Arme, so geübt, dass sie nicht auf die Idee kam, sich zu wehren, und so stark und warm, dass es viel zu kurz erschien. Carlos drückte seine unrasierte Wange gegen ihre nasse Schläfe und flüsterte: »Na, meine kleine Thirza, schon in der Pubertät? Wir müssen mal telefonieren.«
*
Er rief nicht an, und Thirza bildete sich ein, ihn nicht zu vermissen. Eigentlich vermisste sie nichts. Sie hatte keine Klagen, ihre Kindheit betreffend. Nur eine Spätfolge ließ sich vielleicht feststellen: Als Familienrichterin fand sie keinen Kontakt zu den verzweifelten, verstockten, verschlagenen Scheidungswaisen. Brüllende, keifende Paare waren zu ertragen, doch nicht die deformierten Kinder. Thirza war sogar dem Ruf ins Ministerium gefolgt, um das Familiendezernat loszuwerden. Dass die Freunde ihr Karrierismus vorwarfen, schien das geringere Übel. Nur ein Schmerz blieb zurück: Hätte sie es den Freunden nicht erklären können?
Sie erklärte es nicht, weil sie fürchtete, es würde als Eingeständnis von Versagen gelten. Ein doppelter Fehler. Erstens, es war kein Versagen. Zweitens, es wurde ein Versagen durch das Verschweigen. Mit dieser Hypothek machte Thirza Karriere. Vielleicht ist das Schicksal eine Summe falscher Motive?
*
Im Übrigen war Pasing nicht nur stickige Gemütlichkeit. Thirza führte dort, vom Großvater unbemerkt und von den Tanten still gebilligt, ein Nebenleben aus Traum und Freiheit. Und das verdankte sie Beni.
Beni, gleichaltrig mit Thirza, wohnte in Pasing fünf Hausnummern weiter auf einem ebenfalls schlauchartigen Grundstück in einem ebenso kleinen Haus und spielte dort überhaupt keine Rolle, denn er war der zweitjüngste von sechs lauten Brüdern. Er nahm die aus Schwabing geflüchtete, verschreckte kleine Thirza unter seine Fittiche, brachte sie mittags nach Hause und holte sie morgens ab. Am dritten Nachmittag führte er sie zur Verlobung.
Die Verlobung bestand in einem Radrennen auf einer laubbedeckten Allee, die in ein verwildertes Grundstück führte. Das Feld bestand aus Beni und seinem kleinen Bruder Wiggerl. Der Sieger würde Thirza heiraten. Thirza rief am Zielstrich »Los!«, und auch der kleine Wiggerl auf seinem Dreirad strampelte wild, wurde aber um zwanzig Längen geschlagen. Beni sagte feierlich: »So, Tizzerl, du werst mei Wei.«
Da zu einer Ehe Geheimnisse gehören, schickte er Wiggerl nach Hause und drang mit Thirza in das Kellergewölbe einer im Krieg zerstörten Villa ein, indem sie sich durch ein geschmiedetes Gitter zwängten. Beni präsentierte Thirza wie ein Geschenk einen zerfallenen Pappkoffer, der mit Briefen gefüllt war, doch Thirza fürchtete sich vor Ratten und ergriff die Flucht. Er nahm eine Handvoll Papiere mit hinaus. Sie waren von Mäusen halb zerfressen und zeigten auf dem Briefkopf einen Reichsadler. »Des hoaßt Heil Hitler!«, behauptete Beni. Die Worte standen wirklich da, aber woanders, vor der Unterschrift. Thirza erklärte Beni die Buchstaben, und er erklärte ihr, wer Hitler war. Beni bewunderte Thirzas Verstand, sie seine Weltläufigkeit.
Als er größer wurde, trug er den Tanten die Einkaufstaschen. Dadurch gewann er ihr Vertrauen, und Thirza durfte nachmittags mit ihm hinaus. Er zeigte ihr alle Felder, Brachen und Schutthaufen des Pasinger Umlandes. Im Keller einer anderen Kriegsruine wollte er sogar eine Leiche entdeckt haben. Als Beweis brachte er einen grauen, porösen Knochen, an dem vertrocknete Fasern hingen. Thirza war aufgewühlt von diesen Sensationen. Beni baute aus Ästen und faulen Brettern hinter der zerstörten Villa für das Paar eine Hütte, auf Thirzas Wunsch sogar mit einem kleinen Schreibtisch und einem kleinen Bücherregal. Kniend an diesem Tischchen erledigte Thirza seine Hausaufgaben, während er draußen in der Glut eines Lagerfeuers Kartoffeln buk, die er aus einem Acker gegraben hatte. Nach einer instinktiv bestimmten Garzeit rollte er die schwarzgebrannten Kugeln mit einem Stock aus der Asche. Man brach die verkohlte Schale auf, schüttete Salz auf das dampfende gelbe Fleisch und aß aus der Hand. Thirza kannte nichts Köstlicheres. Sie genoss diese Abenteuer in vollen Zügen und achtete gleichzeitig darauf, Benis Schulhefte vor der Mahlzeit zu verpacken, damit sie ohne Rußspuren blieben.
Als auf dem verwahrlosten Grundstück gebaut und die schiefe Kinderhütte abgeräumt wurde, erlaubten die Tanten Beni, den Schuppen am Ende ihres Gartens herzurichten. Dieser Schuppen erlebte im Laufe der Jahre etwa dreizehn Bauphasen, denn Benis Ansprüche stiegen mit seinem handwerklichen Vermögen. Das Werkzeug entwendete er einem älteren Bruder, der Schreiner war.
Er hängte sich einfach bedenkenlos an Thirza, während ihr immer mehr Bedenken kamen. Er wollte zum Beispiel Thirza ins Gymnasium folgen und fiel durch die Aufnahmeprüfung; schon für die Anmeldung hatte er die Unterschrift seines Vaters gefälscht. »Der Beni, der sucht ein Zuhause«, bemerkte mild Tante Schossi, die von der Fälschung nichts ahnte oder vielleicht doch. Allen Frauen war unausgesprochen klar, dass Benis Suche vergeblich war, nur Beni selbst schien es nicht zu merken. Während Thirza immer weniger Zeit für ihn hatte, baute er weiter am Schuppen, meist unbemerkt, denn er betrat und verließ das Grundstück durch ein Loch, das er in die rückwärtige Mauer geschlagen hatte. Manchmal brachte ihm Thirza Semmeln und Limonade. Inzwischen baute er ein Bett. Er rauchte, und abends sah Thirza immer öfter durch die Sträucher das Glimmen seiner Zigarette. Er wurde ihr unheimlich.
Eines Herbstabends stand er mit blutender Nase im Regen vor der Tür. Thirza schaffte ihn herein und zog ihm den nassen Pullover aus. Sein Körper war von Aufschürfungen und blauen Flecken übersät. Thirza starrte so erschrocken wie begeistert auf diesen malträtierten mageren, drahtigen Leib, und Beni, in aller Angst und Spannung, spürte es und geriet darüber in einen fiebrigen Stolz. In diesem Augenblick trat der Großvater ein. Dr. Wilhelm Kargus.
Dr. Wilhelm Kargus hatte Tante Berti erwischt, als sie leise aus seinem Wäscheschrank eine trockene Jacke zog. Zum ersten Mal seit Jahren betrat er die von ihm sonst gemiedene Frauenetage, sah drei Frauen in Betrachtung des jugendlichen geschändeten Heldenleibs und fragte: »Was ist das?«
Beni, immer noch stolz, stellte sich selbst vor: »Kagerbauer Benedikt, Herr Doktor!«
Großvater zu Thirza: »Was hat der hier zu suchen?«
»Er hilft uns, den … äh, den Schuppen herzurichten …«
»Warum weiß ich davon nichts?«
Er hatte sich nie dafür interessiert, was im oberen Stock geschah. Die Frauen heizten, wuschen, kauften ein, kochten, schmückten, pflegten, beruhigten, sie waren für das Menschliche zuständig, ein so heimeliges wie unheimliches Naturelement, zu dessen Beherrschung es keiner weiteren Qualifikation als der Weiblichkeit bedurfte, während er, Dr. Wilhelm Kargus, sich den Höhen ziviler Abstraktion zugehörig fühlte, einer Männerwelt aus Logik und Vernunft. Übrigens schätzte er die Fürsorge und vergalt sie mit Ritterlichkeit und Verantwortung; er war kein Wüterich. Er wirkte in Frauennähe sogar befangen, wie auf schwankendem Boden. Doch angesichts des geprügelten Beni wurden seine Züge auf einmal starr, irgendwie besessen. Thirza sah die Tanten erbleichen.
»Ortsbesichtigung!«, stieß er leise hervor. Thirza warf den Tanten einen flehenden Blick zu, doch beide blieben zurück; Berti rang die Hände, Schossi krümmte sich und drückte sich eine Faust zwischen die Kiefer, wie um nicht zu schreien. Beni ging mit langen Schritten halbnackt trotzig voraus durch den Regen, der Großvater folgte ihm mit einem Schirm. Sie passierten die Bäume voller Äpfel, die er nie geerntet hatte, und eine von Beni gepflanzte Hecke, von der er nichts wusste. Sie standen vor dem Häuschen, das inzwischen ein regenfestes Vordach hatte, eine Tür und ein Fenster.
»Woher stammt die Dachpappe?«
Beni, im Regen: »Vom Bruada.«
Woher stammte das Glas? Das Holz? Das Werkzeug?
Während des Verhörs sah Beni nur sein Werk an; vielleicht gab ihm der Anblick Halt, vielleicht hoffte er auch, die Schönheit der Arbeit würde den Alten von ihrer Berechtigung überzeugen.
»Aha, alles vom Bruder. Und was sagt der dazu?«
Beni zeigte wortlos auf seine Wunden. Thirza wisperte kindlicher, als es ihren Jahren entsprach: »Der Bruder haut den Beni immer!«
»Dich hätte ich für klüger gehalten!«, fuhr er sie an. Er reichte ihr den Schirm, bückte sich mit steifem Rücken, griff die Axt, die auf dem Boden lag, und begann auf Türe und Fenster einzuschlagen, schweigend, mit einer seltsam kontrollierten Brutalität.
*
Beni verschwand. Thirza forschte ihm nicht nach. In gewisser Hinsicht profitierte sie vom Ende dieser Ära, obwohl sie um Beni einige Tränen vergoss. Sie hatte inzwischen neue Interessen. Und stieß auf weniger Widerstand als erwartet.
Schämte sich der Großvater seiner Härte? Dachte er an seine Tochter, die sich vielleicht nach ähnlichen Ausbrüchen von ihm abgewandt hatte? War er im Grunde schwach und hatte allen mit seiner Überkorrektheit eine Autorität vorgespielt, die er gar nicht besaß? Oder war nur Thirzas Blick auf ihn ein anderer? Sie hatte ihn immer für kauzig und unnahbar, aber auch für untadelig gehalten. Damit war jetzt Schluss. Nach diesem Sündenfall durfte sie den Aufstand proben.
Der Großvater verfügte über das einzige Telefon im Haus. Es stand unten im engen Flur. Thirza, am oberen Treppenabsatz lauschend, hörte ihn sagen: »Nein, Sie können nicht mit ihr sprechen.« Thirza kombinierte: eine Nachricht von Beni, über Dritte. Aber was tun? Hinuntergehen und den Großvater bloßstellen? Das würde er nicht verkraften. Dann fiel ihr ein: Vor allem sie selbst würde es nicht verkraften, und zwar nicht aus Mitleid, sondern aus Feigheit. Sie begann sich zu wappnen.
Einmal fragte er: »Wie war der Name? Ja, ich richte es aus.«
Thirza schlenderte wie zufällig die Treppe hinab. »War das für mich?«
»Eine Schulfreundin namens Isolde bittet um Rückruf. Seit wann hast du Freundinnen, die Isolde heißen?«
Er rückte den Zettel nicht heraus, sondern wählte selbst die Nummer, um Thirzas Miene zu beobachten. Thirza hörte eine schön modulierende Altstimme: »Ich bin deine Halbschwester Isolde und rufe im Auftrag von Carlos Zorniger an. Er möchte uns treffen. Kannst du morgen Nachmittag in den Hofgarten kommen?«
»Isolde ist meine Halbschwester und will mich morgen im Hofgarten treffen«, sagte Thirza langsam. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Er ließ sie gehen.
*
Isolde war lang und grazil, hielt das Kinn erhoben und blickte über rassige Wangenknochen auf Thirza herab. Ihre Augen waren grün, mit blauen Strahlen darin. Sie war ein Theaterkind und wollte nach dem Abitur ebenfalls Schauspielerin werden. »Filmstar«, bemerkte sie knapp. Deswegen hatte sie sich schon mit vierzehn angewöhnt, kerzengerade auf dem Rücken zu schlafen. »Ich will morgens keine Kissenabdrücke auf der Wange. Wer hohe Ziele hat, muss auch was dafür tun. Komm mit, er erwartet uns im Bayerischen Hof.«
Auf dem Weg erfuhr Thirza, dass Carlos inzwischen sieben Kinder hatte, alle mit theatralischen Namen: Jeanne, Roderich, Elektra, Isolde, Thirza, Amalia. Das jüngste, gerade geboren, hieß Faust. Sein Höchstes sei, zu Geburtstagen alle Frauen, Ex-Frauen, Geliebte, Kinder und Enkel um sich zu versammeln. »Hast du nie eine Einladung gekriegt?«
Isolde betrat das Hotel selbstbewusst wie eine Diva und führte Thirza zu Carlos’ Suite. Carlos öffnete: energisch, funkelnd, mächtige Tränensäcke, magische Augen. »Meine Mädchen, lasst euch ansehen!« Sie ließen sich ansehen: die schlanke bronzene Isolde mit dem erhobenen Haupt. »Meine Giraffe! Nofretete!« Stürmische Umarmung. Die linkische, unfertige Thirza. »Mein Kobold!« Diese Umarmung neugierig, Schultern wie Stahl, feste, genießerische Hände. Thirza elektrisiert. Ein Kellner brachte auf einem Rollwagen Champagner und Häppchen, es war wie Kino.
Die Unterhaltung bestritt Carlos allein. Sie handelte von seinen Rollen, seinen Inszenierungen, seinen Filmen, Rivalen und Frauen. Stärker als die Geschichten fesselte das Schauspiel seiner Augen. Sie waren groß und grün, aber nicht klar wie die von Isolde, sondern feucht und hypnotisch, mit wechselndem Ausdruck. Einmal sah er Thirza an, da meinte sie, in einem Strudel zu versinken. Im nächsten Augenblick schossen sie Blitze, da machte sich Carlos über Großvater Kargus lustig, den er Dr. Argus nannte. Dr. Argus habe ihn bei der Scheidung von Thirzas Mutter »in Grund und Boden prozessieren« wollen und sei von Gudrun »zurückgepfiffen« worden. Mehrmals habe der Alte versucht, beim Rundfunk Carlos’ Verträge zu torpedieren. »Superverträge«, also besonders hoch dotierte, gingen über Dr. Argus’ Tisch, na ja, da habe Carlos eben den Intendanten einschalten müssen. »Schöne Rollen übrigens, zuletzt Captain Ahab im furiosen Sechsteiler Moby Dick, habt ihr das gehört?«
Beim Abschied fragte er: »Na, Thirza, immer noch Jungfrau?«
Thirza hatte sich kürzlich mit dem kleinen roten schülerbuch aufgeklärt und wusste immerhin, was er meinte. Trotzdem fühlte sie sich blamiert. »Mach dir nichts draus«, sagte Isolde, als sie Thirza zum Hauptbahnhof begleitete. »Das wird er ab jetzt jedes Mal fragen. Es interessiert ihn halt.«
Die hohe dünne, schneidig-zerbrechliche neunzehnjährige Isolde, sie redete von Carlos wie von einem verwöhnten älteren Bruder. »Immerhin empfing er uns nicht nackt. Ist auch schon vorgekommen. Keine Angst, er tut einem nichts; er will nur bewundert werden.«
*
Erst nach dem Abitur hörte Thirza wieder von Carlos. In einem Rundschreiben lud er »all meine Lieben, Kinder und Kegel, Freunde und Feinde« nach Hamburg ins Hotel Atlantis zu seinem siebzigsten Geburtstag ein. Thirza sagte nicht mal ab. Nichts, was sie zu bieten hatte, interessierte Carlos, und ob sie noch Jungfrau sei, wollte sie nicht gefragt werden, denn sie hatte als Frau nichts vorzuweisen und schämte sich.
Inzwischen urteilte Thirza über alle harsch. Carlos war ein Hochstapler und Verderber, er brauchte Menschen als Brennstoff für seine überhitzte Selbstliebe. Wie wenig Selbstachtung mussten Frauen haben, um so einem zu verfallen? Gudrun hatte es sich nie verziehen und jahrelang mehr mit dieser Schande gerungen als mit ihrem Krebs. Arme Mama! Kein Vorbild, nein. Und die Tanten? Die Tanten vergaßen sich selbst in einer Diplomatie, die ihnen beim Marmeladekochen ein paar überlegene Willi-Scherze bescherte, sie letztlich aber zu Sklavinnen machte. Dr. Wilhelm Kargus nun hatte für die Karriere seine Prinzipien verraten, ohne es zu merken. Er wusste nicht mal, dass er nicht gerecht war.
Es gab nur eine einzige Profiteurin all dieser Verhältnisse, und das war Thirza. Denn auf absurde Weise hatten alle, ob absichtlich oder nicht, sie begünstigt. Die Eltern, die niemals hätten heiraten dürfen, schenkten ihr das Leben. Carlos verlieh ihr aus der Ferne Namen und Glanz, ohne sie weiter zu behelligen. Gudrun hatte Thirza das Pasinger Asyl gegönnt, statt sie ihrem unfruchtbaren, tödlichen Groll auszusetzen. Beni gab ihr Freiheit und Selbstvertrauen. Die Tanten liebten sie und entzogen sie unauffällig dem Großvater. Der Großvater schließlich hatte sie, obwohl er Kinder lästig und unheimlich fand, in seinen Haushalt aufgenommen und sich durch seinen Anfall von Grausamkeit gerade zur rechten Zeit selbst entzaubert.
*
»Ich will Richterin werden.«
»Das ist in dieser Familie schon einmal auf tragische Weise missglückt.«
Thirza hatte diesen Wunsch vor zwei Jahren schon einmal ausgesprochen, damals in Opas sporadischer Herrenrunde. Inzwischen bediente Thirza an Schossis statt diese Runde, die aus Kargus und drei pensionierten Justizkollegen aus der alten Heimat bestand, und einer der Gäste hatte bemerkt, wie aufmerksam sie lauschte, während sie Bier, Cognac und Lachsbrötchen brachte oder die vollen Aschenbecher hinaustrug.
»Na, junge Dame, interessiert an der Justiz?«
»Ja …«
»Und, was möchten Sie werden? Protokollführerin?«, fragte er gönnerhaft.
»Richterin …«
Dr. Kargus, der das zum ersten Mal hörte, reagierte geistesgegenwärtig wie immer. »Tizzi weiß, worauf es ankommt, nicht wahr? Na Tizzi, worauf kommt es beim Richteramt an?«
Sie wusste nicht, worauf er hinauswollte.
»Auf die richterliche Kontrolle des Gegenstandes …«, soufflierte er und beendete selbst den Satz, wie um sie aus ihrer Verlegenheit zu erlösen: »… die richterliche Kontrolle des Gegenstandes nach den normativen Regeln in materiellrechtlicher und prozessualer Hinsicht.«
»Danke …«, flüsterte Thirza.
Er konnte durch Großzügigkeit disqualifizieren. Jetzt fuhr er mit seiner alten grauen Zungenspitze über den Rand des leeren Glases, um zu zeigen, dass er nachgeschenkt haben wollte; eine Geste, die Thirza noch nie bei ihm gesehen hatte. Er leckte sozusagen lächelnd das Blut vom Florett, während Thirza eben erst realisierte, dass sie durchbohrt worden war.
Das war vor zweieinhalb Jahren gewesen. Diesmal hatte Thirza sich vorbereitet.
Also, da capo: »Ich will Richterin werden.«
»Das ist in dieser Familie schon einmal auf tragische Weise missglückt.«
»Du hast es ja auch geschafft.«
Er zuckte zusammen. Er begriff die Provokation, doch verbieten konnte er nichts. Thirza war volljährig und hatte im Abiturzeugnis mehr Einser als Zweier.
»Warum gerade Richterin?«
Thirza taumelte. In Gedanken war sie klar, doch heikle Situationen verschlugen ihr immer die Sprache. Eigentlich wollte sie genau diese Ohnmacht besiegen: die Ohnmacht der Frauen, die ihren Verzicht auf Wort und Recht als Rücksicht auf den zerbrechlichen Männerstolz ausgaben und nicht merkten, wie ihnen darüber der Respekt der zerbrechlich Stolzen abhandenkam. Was also tun? Thirza wollte in eine Struktur hineinfinden, die Gehör erzwang, und auf der richtigen Seite der Verbote stehen. Aber das war nicht alles.
Gott sei Dank bemerkte der Großvater diesmal ihre Schwäche nicht, weil er mit seiner eigenen Schwäche beschäftigt war. Der Verlust des Richteramts schmerzte ihn immer noch, und vielleicht quälte ihn der Gedanke, dass Thirza an ihm vorbeiziehen könne. Also begann er pädagogisch zu argumentieren: Sie könne doch Anwältin werden und ihr weiches Herz der Verteidigung jugendlicher Delinquenten widmen, solchen wie jenem Schuppenbewohner, Name vergessen … oder Notarin. Oder in die Verwaltung gehen! Verwaltung, das sei verantwortungsvoll und konstruktiv. Vor Gericht erlebe man nur die dunkle Seite der Menschheit, Verbrechen, Wortbruch, Zwist und Zorn, man könne nichts gestalten, nur Urteile sprechen, da das Kind schon im Brunnen liege, wenn der Konflikt verhandelt wird.
Thirza hörte höflich zu und schwieg, denn es stand ja keine Entscheidung an; zuerst mal musste man das Studium schaffen. Andererseits bedeutete Großvaters leidenschaftliches Plädoyer, dass er ihr Staatsämter zutraute. Die Staatsnote war also das erste Ziel, und das zweite Ziel stand außer Frage: Recht sprechen! Denn Thirza wollte für Gerechtigkeit sorgen.
Die Arbeit
Thirza wurde Richterin am Landgericht München I. im Justizpalast. Vierzig Jahre später lebte sie immer noch in Pasing, im Haus ihrer Kindheit. An diesem Sonntagnachmittag schrieb sie dort ein Urteil.
Unten im Garten blühten Schneeglöckchen, vom blattlosen Nussbaum hingen Kätzchen wie vergilbte Vorhangfransen, der Himmel wurde von dahinschießenden dunkel- und hellgrauen Wolken zerteilt. Für Februar war es viel zu warm, ein Frühling vor der Zeit mit Bildern, die nicht mehr zu Thirza passten: die erwartungsvolle nackte Haselskulptur, Frühlingsstürme, ein verwirrter Himmel.
Das Urteil war Routine, übersichtlich, nicht aufreibend, in mancher Hinsicht sogar befriedigend. Der Freistaat Bayern hatte einen Musikveranstalter namens Rock-Buam GmbH verklagt. Rock-Buam hatte seit dreizehn Jahren jeweils im Juli vom Freistaat ein Gelände für ein Rock-Open-Air gemietet, immer unterstützt von der Brauerei St. Stephan, welche die Konzerte sponserte und im Gegenzug dort ihr Bier ausschenkte. Ab dem Jahr 2009 verlangte der Freistaat im Mietvertrag von der Rock-Buam GmbH, eine andere Brauerei mit der Bewirtung zu beauftragen. Eigentümer dieser anderen Brauerei, Starkbier Strobl, war der Freistaat selbst.
St. Stephan zog sich, da sie ihr Bier auf der Veranstaltung nicht mehr ausschenken durfte, als Sponsorin zurück, worauf der Veranstalter seine Konzerte nicht mehr finanzieren konnte und alle Termine stornierte. Der Freistaat als Kläger beantragte vor Gericht die Zahlung einer Ausfallentschädigung von insgesamt 9.817 € nebst Zinsen sowie 1,80 € vorgerichtliche Auslagen und 15,- € vorgerichtliche Mahngebühr.
Thirzas Kammer hatte beschlossen, die Klage abzuweisen. Die Begründung schrieb Thirza selbst, nachdem der zuständige junge Berichterstatter sich eine Woche vor der Urteilsverkündung krankgemeldet hatte. Dieser junge Kollege Gregor hatte Rock-Buam verurteilen wollen und war von Thirza und dem dritten Kammerkollegen Karl überstimmt worden. Gregor schlug sich instinktiv auf die Seite des Einflussreicheren, und im vorliegenden Fall hätte er sich gern dem Staat als intelligenter Diener präsentiert, unterstellte Thirza. Gregor selbst sprach natürlich von richterlicher Unabhängigkeit und anderer Rechtsmeinung. Jedenfalls war er erkrankt, und Thirza hatte den von ihr selbst diktierten Urteilsentwurf nahezu unverarbeitet zurückerhalten, beheftet nur mit einem Stapel BGH-Urteile, die Gregor gern seitenweise zitierte.
Tragende Gründe der Klageabweisung: Der Kläger hatte seine marktbeherrschende Stellung missbraucht und durch sein Verbot, auf der Veranstaltung das St.-Stephans-Bier auszuschenken, den Beklagten unbillig behindert. Zwar hatte der Beklagte die Termine zu spät storniert, so dass der Kläger das Gelände nicht mehr anderweitig vermieten konnte; der hierdurch entstandene Ausfallschaden wäre dem Kläger zu ersetzen gewesen, der Anspruch war aber durch Aufrechnung mit einem kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch des Beklagten gem. § 33 Abs. 3 Satz 1 GWB erloschen.
Weitere Aspekte, die bei der Gerichtsverhandlung vor drei Monaten erörtert worden waren: Galt das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (§ 130 Abs. 1 Satz 1 GWB) auch für Unternehmen, die ganz oder teilweise im Eigentum der öffentlichen Hand standen? Ja. (Begründung.) Wurde der Mietvertrag zwischen Freistaat und Rock-Buam GmbH insgesamt unwirksam, weil die Vertragsklausel, wonach Starkbier Strobl mit der Bewirtung zu beauftragen war, gegen Kartellrecht verstieß? Nein. (Begründung.) Weiter: Wie waren die jeweiligen Geschäftsinteressen der Parteien gegeneinander aufzuwiegen? Beide wollten Gewinn machen, der Veranstalter privatwirtschaftlich, der Kläger, indem er seine eigene Brauerei begünstigte, gewissermaßen im Interesse des Staatshaushalts. Standen insofern nicht die Gewinninteressen des Klägers im Vordergrund? Nein: Eine derartige Begünstigung eigener Unternehmen war mit den Zielsetzungen des Kartellrechts nicht vereinbar. Der Beklagte musste seine Events frei ausgestalten können, ohne durch unerlaubtes machtbedingtes Verhalten des Vermieters beeinträchtigt zu werden.
Das war saubere juristische Mathematik, gerecht, grundsätzlich, dabei ohne Tragik. Kartellrecht richtet sich gegen Marktmonopole und dient der Wettbewerbsfairness. Moralisch gesprochen schützt es die Kleinen gegen die Großen. Der konkrete Fall hatte zudem einen schönen demokratischen und rechtsstaatlichen Aspekt, indem die Justiz des Freistaats selbst den Staat, dem sie diente, am Machtmissbrauch hinderte (Gewaltenteilung). Ohne Tragik aber meint: Entscheidungen wie diese taten den Monopolisten nicht wirklich weh, während sie der schwächeren Partei effektiv halfen.
Kurz: Es war viel befriedigender, als etwa nach der Tabelle von Sanden-Küppersbusch auszurechnen, ob der Geschädigte eines Verkehrsunfalls für seinen Mietwagen am Tag 34 oder 65 Euro bekommt, während in Afrika jede Minute ein Kind hungers stirbt.
Andererseits, da wir schon von Gerechtigkeit reden: Das Kind pro Minute stirbt ebenso. Und die Richter setzten ihre Energie und ihr Fachwissen ein, um die Rechte von Leuten zu klären, denen alle Schwächeren mutmaßlich egal waren. Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass jener Verwaltungsbeamte, der, wohl gemäß einer politischen Weisung, den Rock-Unternehmer unter Druck setzte und seine Veranstaltung zerstörte, über nennenswertes Mitgefühl verfügte. Woraus sich nicht ergab, dass der Rock-Bube mitfühlender gewesen wäre. Der Rock-Bube wollte Geld machen, indem er Remmidemmi verkaufte. Natürlich hätte keiner der Beteiligten das so gesagt. Man weiß nie, inwiefern einer seine Motive überhaupt kennt, und über Motive wurde auch nicht verhandelt. Thirza verhandelte hier innerhalb eines Schemas objektiver Berechtigungen (Geldforderung) einen gänzlich überflüssigen, destruktiven Vorgang.
Als Richterin hast du immer nur mit dem zu tun, was vorgestern schiefgelaufen ist. Glückliche Menschen ziehen nicht vor Gericht. Die, die zu uns kommen, sind unglücklich, unzufrieden oder rücksichtslos, oder sie werden von unglücklichen, unzufriedenen Menschen vor Gericht gezerrt und werden dadurch ebenso unglücklich. Etwas ist schiefgelaufen und wurde nie geklärt; einer speist sein Selbstgefühl aus der Schädigung anderer; ein weiterer verrechnet sich und kann nicht zurück; und Fehler einzugestehen ist sowieso wenigen gegeben. Kurz: alles fruchtloses Zeug von gestern. Wir sind die Müllabfuhr der Gesellschaft.
Tja. Urteil fertigschreiben.
Nachmittägliche Dämmerung.
Jener Verwaltungsbeamte, der – in Urteil oder Verhandlung dürfte man das so nicht aussprechen, um nicht für befangen zu gelten, doch zu Hause am Sonntagsschreibtisch darf man’s: Jener Bürokrat also, der hier ganz nebenbei die Rock-Buam plattmachte, war beim Prozess nicht persönlich erschienen, sondern hatte für den Freistaat dessen Rechtsanwalt sprechen lassen, der bereits angekündigt hatte, dass man gegebenenfalls Rechtsmittel einlegen werde. Fast alle wollten sämtliche Rechtsmittel ausschöpfen, die Anwälte leckten sich bereits die Finger, weil mit jeder Instanz die Kostennote steigt. Das war keine Besonderheit dieses Falls, sondern ein Kummerthema am Landgericht: Wir sind nur Durchlauferhitzer.
Und nebenbei hatte man noch seine Lebensabschnittsaufgaben zu lösen: Verantwortung übernehmen, sein Leben erwirtschaften, ja, aber auch sich freuen und ausruhen. Ohne Scham in den Spiegel blicken. Vielleicht lieben. Wenn Max noch lebte, wäre es einfach: Er wäre zu dieser Stunde hinaufgekommen und hätte gefragt, ob er Thirzas Burgundertopf vom letzten Sonntag auftauen solle.
Thirza fröstelte. Sie heizte ihr Büro nicht, weil sie sich einbildete, mit kühlem Kopf besser denken zu können. Sie trug Pulswärmer und einen flauschigen Umhang aus Alpaka und balancierte auf einem Fitnesshocker ohne Lehne. Max also hätte sich mit seiner warmen Brust an ihren Rücken gepresst, die Arme um ihre Schultern verschränkt: »Meine ausgekühlte Durchlauferhitzerin!« Sie hätte bis hier herauf das Knistern des Kaminfeuers gehört und sich eingebildet, die aromatische Buchenholzwärme zu spüren. Unter uns: Es gibt Schlimmeres, als Durchlauferhitzer im Justizpalast zu sein.
Im Namen des Volkes
In dem Rechtsstreit Freistaat Bayern – Kläger – gegen Rock Buam GmbH – Beklagte – hat die 44. Zivilkammer des Landgerichts M. durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Zorniger sowie die Richter am Landgericht Eppinger und Lenz für Recht erkannt:
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger zu tragen.
III. Das Urteil ist gegen eine Sicherheitsleistung von 1.800 € vorläufig vollstreckbar.
Thirza schaltete den Computer aus, ging hinunter ins Wohnzimmer, zog die Vorhänge zu und schaltete das Licht ein. Was jetzt – Kamin anzünden? Allein? Und was tun? Max war ein starker, anspruchsvoller Leser gewesen. Thirza hätte sich auf dem Sofa an ihn gekuschelt, und er hätte ihr vorgelesen. Wenn sie einnickte, hätte er stumm weitergelesen, bis sie erwachte, die Arme um ihn schlang und rief: »Ach, Schatz! Du bist so süß!«
Thirza wickelte sich in die Daunendecke und las allein. Seit Max’ Tod war sie auch literarisch verwaist, doch hatte sie etwas für ihre einsamen Abende gefunden: Rosamunde Pilcher, na und? Mühelos zu genießen und schnell wirkend wie eine leichte, schaumige Medizin. Leiden, und Reetdach, und Schneesturm, und Heilung.
*
Thirzas Sitzungstag war der Mittwoch. Morgens um zehn war die Urteilsverkündung zum Rock-Buam-Urteil angesetzt. Thirza schloss pünktlich den Sitzungssaal auf und war erleichtert, dass er leer blieb. Die Anwälte hatten die verkündete Entscheidung per Fax erbeten und sparten sich den Weg zum Gericht. Die Öffentlichkeit, die ein Recht darauf hatte, Urteile zu hören, war nicht erschienen. Zehn Minuten später traf Thirza in der riesigen Zentralhalle unter der Bronzestatue des Prinzregenten Luitpold ihre Kollegin Berni, die, ebenfalls in Robe und mit Urteilen unterm Arm, nach einem Verkündungstermin ohne Publikum auf dem Rückweg ins Büro war.
Obwohl beide mittwochs verhandelten, trafen sie selten aufeinander, denn ihre Säle lagen weit auseinander, und wenn sie nicht verhandelten, kauten sie Akten in verschiedenen Flügeln des Palasts. Heute hatte Thirza etwas Zeit, weil wegen Gregors Erkrankung zwei Kammersitzungen abgesagt worden waren, und Berni blieb zumindest eine Viertelstunde, die die beiden jetzt gewissermaßen atemlos nutzten. Berni vermutete, dass zwei ihrer drei heute verkündeten Urteile angefochten würden, worauf man von Robe zu Robe rasch das Klagelied der unteren Instanzen anstimmte (Wir sind nur Durchlauferhitzer), um im tröstlichen Einklang zur zweiten Strophe überzuleiten: Wir werden verheizt. In Bernis Bankenkammer war seit der Finanzkrise die Hölle los. Die Geschäftsstelle brach unter den Akten zusammen, die Registerführerin kriegte Zustände, die Regale reichten nicht, man legte die Akten auf die Fensterbank und stapelte sie in den Ecken, und ins Register wurde dann eingetragen: Standort der Akte Fensterbank links, Ecke links neben Fenster, blauer Stuhl, hinter der Tür. Das alles, weil Leute, bloß um Steuern zu sparen, riskante Anlagen getätigt hatten und jetzt vom Staat, dem sie keine Steuern zahlen wollten, Hilfe verlangten. Berni musste in Prospekten, die vorn auf Hochglanzseiten 7 % Rendite versprachen, um auf Seite 60 kleingedruckt alle Risiken auf den Anleger abzuwälzen, Fehler suchen, die die Anleger nicht gefunden hatten, weil sie im Rausch der Steuerersparnis versäumt hatten, das Kleingedruckte zu le- Huch, ich muss weiter, sag mal, wo wir schon, sollen wir nicht mal wieder zum Mittagessen in die OFD? Jetzt mussten sie lachen, die Oberfinanzdirektion hieß seit Jahren Landesamt für Finanzen, doch sie aßen dort so selten, dass sie sich an den neuen Namen nicht gewöhnt hatten, also wir müssen wirklich wieder und wann, wenn nicht heute? Thirza hatte ab 14 Uhr zwei Einzelrichtersachen, Berni noch eine Kammersitzung am Vormittag, falls also ihr sehr gründlicher Vorsitzender nicht überzog, könnten sie – ja, machen wir! Wann, 12:30 Uhr?
Bis dahin waren es zwei Stunden. Thirza überflog noch mal kurz die Akten zu den Nachmittagsverhandlungen, zwei leichten Fällen aus dem Bürgerlichen Recht: einmal ein Geschwisterstreit, recht klares Bild, der andere eine Schadensersatzklage nach sexueller Nötigung, die strafrechtliche Seite längst abgeschlossen, ebenfalls klar. Gibt für heute zwei Erledigungen :)
Allerdings türmten sich auf dem Tisch zwei neue Aktenstapel. Thirza blätterte sie an, Klage, Sachverhalt, wie groß der Aufwand, wer wird Berichterstatter? Warum klappt das jetzt nicht mit dem Einzelrichterübertragungsbeschluss? Ah, hab ihn im Computer versehentlich nach den Termin gesetzt, er muss aber vorher kommen, neues System, nichts als Ärger. Früher hatte Thirza zwei Formulare aus dem Stapel gezogen, auf einem den Einzelrichterbeschluss mit Namen und Datum eingesetzt plus Unterschrift, auf dem zweiten den Termin handschriftlich eingetragen und angekreuzt: Parteien laden, Klageerwiderungsfrist drei Wochen – und das alles auf einmal in den Auslauf gepfeffert. Das war eine Arbeit von drei Minuten plus die drei Minuten, um im Computer den Termin rauszusuchen mit dem Kammerkalender. Aber forumSTAR – du liebe Güte, was für eine Zumutung! Während Thirza mit der Software rang, fiel ihr ein anderes PC-Drama ein, das vor einigen Wochen zum Streit mit Berni geführt hatte, das Berni ihr aber Gott sei Dank nicht nachzutragen schien. Es ging um Power-Sohle, eine Aktion der Beamten-Krankenkasse. Man sollte mit dem Schrittzähler 10.000 Schritte pro Woche gehen, möglichst im Team; als Anreiz wurde ein Wellness-Wochenende verlost. Thirza hatte sich von Berni anstiften lassen (beide kämpften mit ihrem Gewicht), doch sogar diese Teilnahme war online einzutragen auf irgendeiner Plattform mit Kennwort und PIN, und Thirza weigerte sich. Berni sagte, dann müsse Thirza das Teilnahmeformular eben schriftlich anfordern, während Thirza meinte, Berni sei schließlich die Organisatorin. Es wurde dann nichts daraus, sie hätten eh keine Zeit gehabt, aber heute beim Mittagessen werde ich Berni sagen, dass sie recht hatte. Thirza freute sich jetzt sogar außerordentlich auf dieses Mittagessen. Da brachte der Bote neue Post.
Eine Eilsache. Nach dem Geschäftsverteilungsplan ginge sie an den kranken Gregor, den Thirza vertrat. Eine markenrechtliche Streitigkeit.
Die globale Modefirma Käutner wollte dem Premium-Kinderwagen-Hersteller Karriere dessen Logo verbieten, weil es dem Käutner-Logo zu sehr ähnle. Karrieres Logo war ein verzogenes K in einem angeschrägt elliptischen Kreis. Käutners Logo war ebenfalls ein K, allerdings ein gerade stehendes, nur in der Buchstabenfüllung schräg anmutendes K, in einem runden Kreis. Firma Käutner, die in den letzten Jahren erfolgreich in das Marktsegment hochpreisige Babykleidung expandierte, sah ihre Markenrechte verletzt und beantragte eine einstweilige Verbotsverfügung, Streitwert 100.000 Euro.
Firma Karriere wehrte sich gegen die Verfügung per Schutzschrift: Erstens entfalle das Kriterium der Warenidentität, zweitens bestehe zwischen den beiden Logos nicht die für ein Unterlassungsgebot nach dem Markengesetz erforderliche Verwechslungsgefahr.
Thirza hatte kürzlich ein ähnlich gelagertes Urteil gelesen, wo war das noch mal: Kennzeichnungskraft von Buchstaben, Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht, hm, Gregor würde der Kammer ohne weiteres vorschlagen, die einstweilige Verfügung zu erlassen. Karl, obwohl er es anders sah, vermutlich ebenfalls: Er war die juristische Akrobatik leid geworden und neigte angesichts vertrackter Fragestellungen neuerdings dazu, laut vom Ruhestand zu träumen. Gehe ich jetzt den Weg des geringsten Widerstandes oder weise ich den Antrag per Beschluss zurück, was zusätzliche Arbeit erfordert?
Thirza rief in Bernis Geschäftsstelle an, das OFD-Mittagessen müsse leider ausfallen, und holte sich ein Müsli aus der Kantine.
*
Die Verhandlungen am Nachmittag verhießen danach fast eine Art Erholung: mindere Fälle, wie gesagt. Also, erster Akt, 14 Uhr. Thirza in Robe schloss den Gerichtssaal auf, ließ die Parteien ein, nahm auf dem Podium Platz, grüßte und sprach fürs Protokoll die Namen der Beteiligten auf Band. Klarissa Klimowetz, Klägerin und Widerbeklagte, mit Anwältin Anna Soukup. Konstantin Klimowetz, Beklagter und Widerkläger, mit Anwalt Rudolf Funke.
Klarissa und Konstantin waren Geschwister sudetendeutscher Herkunft, sie war siebzig, er sechsundsiebzig Jahre alt. Beide unverheiratet und kinderlos. Sie war am Tag, an dem sie volljährig wurde, aus dem Elternhaus ausgezogen und hatte ein eigenes Leben geführt. Er war zu Hause geblieben und vermietete nach dem Tod der Eltern das von ihnen hinterlassene Geschäftshaus, ohne die Einnahmen mit der Schwester zu teilen. Sie forderte 80.000 Euro; da es kein Testament gebe und deshalb die gesetzliche Erbfolge gelten müsse, stehe ihr vom elterlichen Nachlass die Hälfte zu. Über diesen Hauptantrag hinaus hatte sie noch eine Handvoll weiterer Anträge stellen lassen, die weniger gewichtig waren und ziemlich chaotisch in Wortlaut und Begründung. Ein seltsamer Punkt betraf ein von Konstantin genutztes Zimmer in Klarissas Haus. Sie wollte ihn da raushaben, da sie sich kontrolliert und belästigt fühlte. Er machte Gewohnheitsrecht geltend. Einen schriftlichen Vertrag gab es nicht, dennoch traute sie sich nicht, das Schloss auszuwechseln, weil sie nicht wusste, wie er reagieren würde. Andererseits hatte sie den Prozess angestrengt, auf den er eigentlich noch härter reagieren musste. Offensichtlich ein Fall am Ende des Rechts.
Konstantin sah sich als einziger und wahrer Erbe und forderte im Gegenzug eine halbe Million Euro (Widerklage), da Klarissa ihr eigenes Haus nur deswegen habe erarbeiten können, weil er ihr die Sorge um die Eltern abnahm: Er habe sich für Klarissas Freiheit geopfert.
Beide Geschwister redeten für sich selbst, die Anwälte saßen stumm und ergeben dabei. Konstantin, massig, grau, krumm, knurrte vor sich hin. Klarissa, schlank, aufgerichtet, mit Glitzerschmuck und helmartiger Dauerwelle, sprach scharf und verächtlich. Sie hielt ihn für willensschwach und verkommen. Von Opfer könne keine Rede sein. Er sei nur deshalb nicht ausgezogen, weil ihm der Pep fehlte.
Er nuschelte: Er habe keine Wahl gehabt. Die kranken Eltern. Klarissa, die immer wegwollte. Er habe fünfzig Jahre lang über all seine Handlungen für die Eltern Buch geführt. Er trat an den Richtertisch und zeigte Thirza die Kladden: wirklich tausende Eintragungen, die er offenbar schon damals als Munition gesammelt hatte, oder als Gutschrift für ein Glück, das er später glaubte eintreiben zu können, freilich von wem? Man kriegte es nicht heraus, da er immer dasselbe sagte, in immer denselben Worten: Er habe keine Wahl gehabt. Die kranken Eltern. Klarissa, die immer wegwollte, und so fort, wie ein Mantra. Seine Kleidung war verschossen, die Weste fleckig. Ein trauriger, verbissener Mann.
Seine Sache war aussichtslos. Die 80.000 Euro würde er zahlen müssen. Was die gegenseitigen Hilfsanträge betraf, wollte Thirza ihn zu einem Vergleich bringen, damit er zumindest mit dem Gefühl hinausging, ein bisschen Recht erkämpft zu haben.
»Weshalb bestehen Sie auf dem Zimmer bei Ihrer Schwester? Im Elternhaus ist doch genug Platz?«
»Es ist vermüllt«, flüsterte die Schwester auf der Klägerbank vernehmlich. »Er braucht einen Psychiater, kein Zimmer.«
Man möchte sie nun als Schwester auch nicht haben.
»Du Flittchen!«, rief er. »Du hast uns alle im Stich gelassen, schon die Eltern wussten, auf dich ist kein Verlass!«
Er hatte sein eigenes Leben versäumt. Jetzt bohrte er sich in das seiner Schwester, um an irgendeinem Leben teilzuhaben. Ließe er von der Schwester ab, würde er wohl aus innerer Leere und Einsamkeit sterben. Dabei könnte er vom Erlös des Hauses bis an sein Lebensende im Vier-Sterne-Hotel wohnen und jeden Abend in die Oper gehen.
»Bedenken Sie, was dieser Streit schon jetzt gekostet hat und wie viele Nerven Sie sparen, wenn Sie Ihrer Schwester entgegenkommen. Das Gericht wird Ihre Wünsche nicht befriedigen können.«
»Dann geh ich in die nächste Instanz!«, brauste er auf.
Thirza versuchte es im Scherzton. »Sie machen sich keine Vorstellung, wie lang solche Verfahren dauern! Sie müssten Gutachten zum aktuellen Wert der beiden Häuser einholen. Außerdem zum Wert der erbrachten Leistungen weitere Gutachten, die vermutlich bestritten werden. Nehmen wir an, dass Sie nach zehn Jahren, was höchst unwahrscheinlich wäre, in der übernächsten Instanz den Prozess gewinnen: Sie wären dann sechsundachtzig. Was hätten Sie davon?«
Er schrie: »Gerechtigkeit!«
*
Der zweite Fall erschien weniger tragisch: eine Schadensersatzklage nach sexueller Belästigung. Die Klägerin, Frau Ilse Ittlinger, hatte über einen Zeitraum von anderthalb Jahren anonyme Anrufe bekommen, bis sie sich zur Wehr setzte. Die Fangschaltung führte zum Handy ihres Chefs. Es stellte sich heraus: Der Anrufer war dessen jetzt zweiundzwanzigjähriger Sohn. Er gestand und wurde verurteilt; nach Jugendstrafrecht, weil man ihm, der beim geschiedenen Vater lebte, eine Reifeverzögerung zugutehielt. Die Strafe – zwei Wochen Dauerarrest in Stadelheim – galt als hart. Man begründete sie damit, dass der junge Mann schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten war: fahrlässige Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Sachbeschädigung, eine Schlägerei vor der Disco.
Der Vater, ein Dr. Freiherr von Holtz, leitete die Controlling-Abteilung eines Konzerns. Der Sohn aber hatte schlecht funktioniert: Gymnasium abgebrochen, Internat verlassen, mit Mühe die Realschule geschafft. Bei Kindern aus solchen Kreisen spricht man nicht von Verwahrlosung, man nennt sie vernachlässigt. Immerhin schien der Knabe sich zu fangen und machte eine Lehre als Koch.
Die Klägerin war fünfzig Jahre alt, alleinstehend, geschieden. Von Beruf Betriebswirtin, hatte sie als Controllerin unter dem Holtz-Vater gearbeitet. Sie forderte vom Beklagten 5.500 Euro, aufgeschlüsselt nach: a) Schmerzensgeld, b) Anwaltskosten c) Behandlungskosten für eine psychotherapeutische Krisenintervention. Die Arztrechnung lag der Klageschrift bei.
Der Anwalt des jungen Mannes wies alle Ansprüche zurück. Sein Mandant habe schließlich nur die letzten vier Anrufe verschuldet, und nur im Laufe von zwei Wochen. Es sei nicht plausibel, dass die Klägerin wegen dieser vier Anrufe depressiv geworden sei. Ihre Anwaltskosten für die Nebenklage seien erstattet worden. Da die Zivilklage gegenstandslos sei, könne man seinen Mandanten dafür auch nicht belasten.
So weit die Akten.
Die Parteien warteten schon vor dem Saal. Thirza schloss auf. Es war spannend, wenn Akten Gesichter bekamen. Zum Beispiel standen hier zwei Frauen, eine wirkte rasant und bitter, die andere unauffällig und nachdenklich. Thirza hielt spontan die Erste für die Klägerin. Sie ging jedoch durch die hintere Tür in den Zuschauerbereich, der durch eine holzgetäfelte Barriere vom Saal abgetrennt war. Die unauffällige Frau folgte ihrem ergrauten Anwalt zur Klägerbank.
Der Beklagte war ein hübscher Kerl, breites Kreuz, juvenile Ausstrahlung, dichter Schopf, aus feuchten braunen Augen ein etwas weinerlicher Blick. Zierliche Koteletten. Freizeitkleidung, saubere Jeans mit Designer-Rissen, enger Wollpulli mit Querstreifen. Auch sein Anwalt war hübsch: ebenfalls dunkelhaarig, gegelter Mecki, italienische Schuhe, Krawatte unter der Robe, Siegelring.
Thirza erteilte der Klägerin das Wort.
Die Klägerin schilderte ihre Leidensgeschichte: Anrufe immer nachts zwischen eins und halb fünf, meistens Festnetz, doch auf Dienstreisen auch auf dem Handy. Immer derselbe Anrufer, ganz sicher. Mit verstellter Stimme zwar, irgendwie gequetscht, aber immer gleich. Sie habe ihn gebeten aufzuhören, aber dann habe er nur noch gestöhnt, und sie habe aufgelegt. Ein, zwei Stunden später der nächste Anruf. Sie habe das Telefon nicht ausgeschaltet, weil sie für ihren hinfälligen Vater erreichbar sein wollte. Natürlich habe sie erwogen, die Nummern zu wechseln, doch ein Polizist habe ihr gesagt, dass solche Anrufe zu neunzig Prozent aus dem Bekanntenkreis kämen, so dass es auch mit der neuen Nummer bald wieder losgegangen wäre. Frau Ittlinger begann ihre männlichen Bekannten zu verdächtigen, habe sich zurückgezogen, verfolgt gefühlt, immer schlechter geschlafen. Es sei eine Katastrophe, wenn man nicht wisse, woran man sei. Sie bekam Angstanfälle.
Der Knabe drückte sich in die Lehne, möglichst weit weg von der Klägerin.
»Herr von Holtz, möchten Sie etwas dazu sagen?«
»Na ja …« Er räusperte sich. »Also zuerst mal bestreite ich natürlich, dass es eine schwere Beeinträchtigung war.«
»Haben Sie Frau Ittlinger zugehört?«
»Schon. Aber das war ja jemand anderes. Ich war’s nur die letzten vier Mal.«
»Nur die letzten vier Mal war die Fangschaltung eingerichtet. Aber Frau Ittlinger ist überzeugt, dass es immer derselbe Anrufer war. Und er hat auch immer dieselben Sachen gesagt.«
»Doch nur gestöhnt …« Er grinste unbeholfen. Sein Anwalt wandte sich ihm zu. Der Knabe richtete sich auf und seufzte. »Also, es tut mir echt leid«, sprach er zum Richtertisch hin. »Ich hab ja schon gesagt: Ich kann’s mir nicht erklären. Meine Eltern haben sich getrennt. Man malt sich natürlich aus, wie es dazu kommen konnte. Und da bin ich – ausgerastet. Ich dachte, dass die … also ich dachte, sie hat vielleicht was damit zu tun.«
Die Klägerin schüttelte verständnislos den Kopf.
»Wer?« Thirza wollte, dass er den Namen der Frau aussprach, die er so ausgiebig bestöhnt hatte.
»Na, sie …« Er deutete mit dem Handrücken zur gegenüberliegenden Bank, ohne Frau Ittlinger anzusehen.