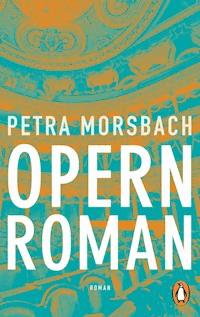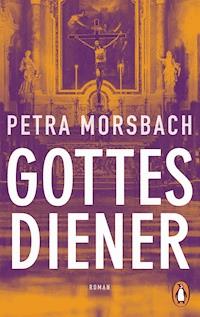2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die faszinierende Geschichte einer russischen Mutter Courage
Ljusja wird 1926 in St. Petersburg als Tochter eines von Stalin verfolgten Popen geboren. In Kriegszeiten aufgewachsen, ohne Ausbildung und Perspektive, doch von großem Charme und Temperament, sucht sie ihr Glück in der Liebe und ist doch – vielleicht gerade deswegen – meist auf sich allein gestellt. Sie zappelt in den Maschen eines absurden, rigiden Systems und gerät in die Mühlen der Ideologie, derer sie sich freilich ebenso unbefangen wie unbedenklich zu bedienen versucht. »Plötzlich ist es Abend« ist das Protokoll eines beschwerlichen Lebens, aber auch eine Geschichte von unermüdlichem Kampfgeist, Mut und Witz, Liebe und Freundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 918
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Petra Morsbach, geboren 1956, studierte in München und St. Petersburg. Ihr erster Roman »Plötzlich ist es Abend« schöpft aus den russischen Erfahrungen. »Mein Gaststudienjahr an der Leningrader Theaterakademie 1981/82 brachte außer Kursen und Seminaren auch private Erfahrungen und Freundschaften. Die Kontakte aus jener Zeit habe ich gehalten. Was mich bewegte an Geschichten und Sinnfälligem, habe ich notiert. Ich hatte immer das Gefühl, es sei ein großer und wichtiger Stoff. Ich bedauerte, dass ich nicht imstande war, ihn zu gestalten. Schließlich habe ich es doch versucht, weil ich fand, es wäre schade, wenn er vergessen würde.«
Petra Morsbach in der Presse:
»Morsbachs ausgreifender, doch stets kontrollierter, pointierter Erzählstil erinnert an die großen Russen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.«DIE ZEIT
Außerdem von Petra Morsbach lieferbar:
Petra Morsbach, Gottesdiener Petra Morsbach, Opernroman Petra Morsbach, Justizpalast
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Petra Morsbach
PLÖTZLICH IST ES ABEND
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2018 by Petra Morsbach Durchgesehene und genehmigte Taschenbuchneuausgabe im Penguin Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Der Titel erschien erstmals 1995 im Eichborn Verlag, Frankfurt/Main. Umschlag: Bürosüd Umschlagmotiv: Gettyimages/tato tururap ISBN 978-3-641-24691-4V002
www.penguin-verlag.de
Jeder steht allein auf dem Herzen der Erde, durchdrungen von einem Strahl Sonne, und plötzlich ist es Abend.
Salvatore Quasimodo
Inhaltsverzeichnis
I.
Anfänge
1
Ljusja ist vierundzwanzig Jahre alt, hat ein uneheliches Kind und arbeitet in der Kugellagerfabrik »Fortschritt«; das heißt, in diesem Augenblick sitzt sie in ihrem Zimmerchen in einer kommunalen Wohnung auf der Petrograder Seite und träumt von der Liebe. Wir sind in Leningrad, im Februar des Jahres neunzehnhundertfünfzig.
Es klingelt.
Ein gewisser Petja, ein Leutnant, der mit Ljusjas Freundin Marina verlobt ist, steht im Treppenhaus. Als Ljusja ihn nicht hereinbittet, schlägt er vor: »Holen wir Marinuschka von der Arbeit ab, und dann trinken wir zu dritt ein Fläschchen!« Sie fahren im Bus ins Zentrum, zu der Garküche, die Marina leitet. Marina steht im Arbeitskittel auf der Straße, schimpft mit einem Lieferanten und stampft vor Kälte mit den Füßen; sie kann noch nicht weg, sie muß Überstunden machen, die beiden sollen in zwei Stunden wiederkommen. Ljusja bemerkt, daß Petja mit diesem Vorschlag sehr zufrieden ist. Ohne einzugreifen, schaut er zu, wie Marina sich gegen die schwere Holztür stemmt, um wieder ins Haus zu gelangen, und schnalzt unternehmungslustig mit der Zunge. Als Marina verschwunden ist, sagt er: »Weißt du was, ich lade dich solang ins ›Kaukasus‹ ein.« Er betrachtet Ljusja mit Wohlgefallen und faßt sie am Arm.
»Ich geh nur mit, wenn du mir versprichst: Kein Wein, kein Tanz!« entgegnet Ljusja. Er willigt ein. Er flirtet. Im »Kaukasus« quasselt er ununterbrochen: Wie schön es jetzt wäre, Schlittschuh zu laufen, und wie schön es ist, daß er Ljusja wiedergetroffen hat. »Dabei hatte ich dich schon ganz aus dem Horizont verloren! Eines Tages sag ich zu Marinuschka: Bring doch ’ne kleine Freundin mit, zu mehreren ist’s lustiger, und mein Freund Borja ... War ich vielleicht platt, als ich dich erkannte. Da hab ich Borja gleich zum Teufel geschickt.« Weil Ljusja nicht reagiert, wechselt er das Thema und spricht von seiner Arbeit. Welcher Soldat was gesagt hat und was er darauf erwiderte. Dem hat er aber gesteckt, daß. Fehlte gerade noch, daß die Soldaten. Sein Oberst meinte anerkennend: Pjotr Wassilytsch, das ist fast schon einen Stern wert. »Schau mich an: Wie sähe ich aus mit noch einem Stern?« Genauso doof, denkt Ljusja.
Was ist das für ein Kavalier? Kein Kellner beachtet ihn. Er redet Blödsinn. Ihre Gedanken schweifen ab. Sie blickt an ihm vorbei auf die holzgetäfelten Wände, die Kristallüster und die geschäftigen Kellner in kaukasischer Tracht und bemerkt nicht, wie ein weiterer Mann an ihren Tisch gesetzt wird. Sie nimmt ihn erst wahr, als eine Flasche Wein auf den Tisch gestellt wird – für ihn. Sie sieht ihn an und denkt: Für diesen Mann würdest du durch Wasser und Feuer gehen und bis ans Ende der Welt.
Seine Augen sind blau und ernst; das rechte hat oberhalb der Pupille einen hellen Fleck. Er trägt eine feine Metallbrille mit ovalen Gläsern. Sein Haar ist schwarz mit silbernen Fäden darin, halblang, gewellt. Er hat exotisch hohe Wangenknochen; dabei feine Gesichtszüge, die ihn städtisch und kultiviert erscheinen lassen. Er mustert seine Tischnachbarn mit einem unnachahmlich verantwortungsvollen, ja besorgten Ausdruck. Ist es Einbildung, daß er, als er Ljusjas Blick begegnet, für eine Sekunde innehält und die bereits zum Sprechen geöffneten Lippen wieder schließt? Natürlich einzigartige Lippen: edel, beherrscht aufeinandergelegt; ein Traum von einem Mund, ein Traum von einem Mann.
Hat er gesprochen? Seine Stimme ist leicht und etwas belegt, nicht eben klangvoll. Aber was hat er gesagt? Da auch Petja nicht reagiert – offenbar hat er nicht damit gerechnet, daß man ihn anreden könnte –, wiederholt der Fremde ohne Ungeduld seine Worte.
»Warum haben Sie nichts auf dem Tisch? Bedient man Sie nicht?«
»Nein«, antwortet Petja verlegen, »meine Begleitung hat mir sogar schon ein Ultimatum gestellt.«
Der Gast sieht sich um, schon kommt ein Kellner. »Darf ich Sie zu einem Wein einladen?«
»Nein«, sagt Petja, »meine Tischdame hat mich nur unter der Bedingung begleitet, daß wir keinen Wein trinken.«
»Doch, doch!« ruft Ljusja. »Natürlich trinke ich Wein!«
Sie prosten einander zu. Eine Tanzkapelle spielt. »Erlauben Sie, daß ich Ihre Dame zu einem Tanz entführe?« fragt der Mann Petja.
Petja räuspert sich. »Eigentlich, äh, ist sie nur unter der Bedingung mitgekommen, daß sie nicht tanzen muß, sozusagen.« Ljusja ist bereits aufgesprungen: »Natürlich tanze ich, ich tanze gern!«
Der Mann führt Ljusja auf die Tanzfläche. Er ist groß, Ljusja sehr klein. Er lacht, als sie fragend und hilflos zu ihm hochsieht, da senkt sie den Kopf und starrt auf seine blaurot gemusterte Seidenkrawatte. Sie tanzen; ist das Wirklichkeit? Was für eine Krawatte; und was für ein Hals!
»Sagen Sie bitte –« Er spricht mit ihr! Er deutet mit seinem Kinn in Petjas Richtung und fragt: »Wer ist das für Sie?«
»Niemand! Niemand!«
»Also könnten wir im Prinzip gehen?«
»Sofort! Sofort! Ich hole gleich meinen Mantel!«
»Nein, das wäre nicht fein. Machen wir es so: Nach diesem Tanz werde ich bezahlen und gehen. Sie erklären ihm die Lage und kommen nach. Ich erwarte Sie an der Ecke Newskij/Plechanowa.«
Als sie von der Tanzfläche zurückkehren, glühen Ljusjas Wangen. Der Fremde verabschiedet sich mit einer leichten Verbeugung, auch in Richtung Petjas, und geht hinaus, ohne sich umzusehen. »Warum setzt du dich nicht hin, Ljusenitschka?« fragt Petja. »Schau, wir haben fast die ganze Flasche Wein übrig.«
»Idiot! Ich habe dir doch gesagt, keinen Wein!«
Petja macht ein verdattertes Gesicht. »Aber Ljusja! Erklär mir doch ...«
»Trink ihn alleine aus, deinen Wein, dann hast du mehr davon! Und wehe, du wagst es, mir zu folgen!« Petja sinkt auf seinen Stuhl zurück und greift nach der Flasche.
Der Garderobier erwartet Ljusja bereits; das muß der geheimnisvolle Kavalier angeordnet haben. Ljusja rennt mit offenem Mantel, das Kopftuch in der Hand, auf die Straße. Die eisige Luft nimmt ihr den Atem.
Obwohl es dunkel und neblig geworden ist, erkennt sie den Fremden schon von weitem. Er trägt einen Mantel mit breitem Biberpelzkragen und eine Samtmütze mit Biberaufschlägen; er sieht aus wie ein Zar. Er lächelt: »Sie haben sicher Hunger. Gehen wir ins ›Europa‹.«
Als sie über eine Fußgängerbrücke den Gribojedow-Kanal überqueren, ist Ljusjas Mut plötzlich wie fortgeblasen. Tatsächlich: Sie betrat die Brücke erwartungsvoll und verläßt sie vernichtet. Der Umschwung kam durch eine Einsicht: Sie hat sich betragen wie ein Flittchen. Was kann sie für diesen Herrn bedeuten? Sie hatte eine Chance, weil sie hübsch, jung und lebhaft ist, und hat sie vertan, weil sie sich benahm, als käme sie aus der Gosse. Ganz klar: Er ist der bestaussehende, kultivierteste, interessanteste Mann von Leningrad, und sie hat sich an ihm festgekrallt wie eine Katze. Nun geht er schweigend neben ihr her. Sicher ist er enttäuscht.
Ljusja bemerkt, wie routiniert er ihr an der Garderobe des »Europa« den Mantel von den hängenden Armen schält. Ihr fällt auch auf, wie schwungvoll er wenig später seine Jacke über die Stuhllehne wirft und wie munter er dabei lacht. Er redet ziemlich viel, und alles klingt weltmännisch und klug. Aber er bestreitet die Unterhaltung allein.
»Was haben Sie?« fragt er schließlich. »Warum sind Sie auf einmal so traurig?«
Ljusja bringt kein Wort heraus.
»Wie heißen Sie?«
»Ljusja«, flüstert sie.
»Sehr erfreut. Ich bin Damir. Ljusja, Ich sage Ihnen, was los ist. Sie schämen sich Ihres Betragens und analysieren Ihre Fehler. Aber das Leben ist so kurz und unübersichtlich, wo kämen wir hin, wenn wir alles Unvorhergesehene analysieren und uns jedes Fehlers schämen würden? Essen Sie, trinken Sie, freuen Sie sich! Ich freue mich auch.«
Ljusjas Stimmung bessert sich nicht. Er bringt sie nach Hause, niedergeschlagen läuft sie hinter ihm her. Natürlich kommen sie erst nach zehn Uhr abends an, und das eiserne Tor im Haupteingang ist schon verschlossen. Sie müssen an das Fenster der Hausmeisterin klopfen, die sicher schon geschlafen hat. »Guten Abend, Nadjeshda Wladimirowna«, flüstert Ljusja beschwörend der krummen Gestalt zu, die ihnen durch den Torbogen entgegenwankt. Nadjeshda Wladimirowna knurrt: »Sieh mal an, du kleine Nutte. Mit einem Offizier ist sie fortgegangen, mit einem Biber kommt sie zurück!« Das Blut schießt Ljusja zu Kopf, sie stürmt an Nadjeshda und Damir vorbei, durch den Hinterhof in ihren Block. Sie hört Damir sagen: »Sie sollten etwas besser hinsehen, wen Sie vor sich haben«, und leider auch Nadjeshda Wladimirownas Antwort: »Hör mal, Biber, das ist mir scheißegal. Ich habe das Tor zu schließen und Schnee zu schaufeln. Verschwinde! Je schneller, desto besser!«
2
Am nächsten Tag kurz vor neun kommt Ljusja in die Fabrik. Sie geht ins Büro, wirft ihren Mantel über einen Stuhl, stellt die nassen Winterschuhe auf eine Zeitung, zieht die Filzpantöffelchen an, umkreist einmal den Samowar, setzt sich an ihren Tisch und bricht in Tränen aus.
»Aber Ljudmilotschka, was haben Sie denn?« ruft Antonina Romanowna erschrocken.
»Ich bin verliebt!« schluchzt Ljusja. »Es ist so furchtbar! Ich habe mich so danebenbenommen! Ich schäme mich ja so!«
»Immer mit der Ruhe. Kommen Sie, trinken Sie ein Täßchen Tee. Sagen Sie, wie heißt er denn?«
»Damir!«
»Und weiter?«
»Ich weiß es nicht. Nicht mal den Vatersnamen!« schluchzt Ljusja. Antonina Romanowna setzt sich zu ihr, legt ihren Schal um sie und streichelt zaghaft ihre Schultern.
Ljusja erzählt ihr alles.
Antonina Romanowna ist Ljusjas Vorgesetzte. Sie leitet die Beschwerdeabteilung und gilt eigentlich als streng. Ljusja wurde vor zwei Jahren zu ihr strafversetzt, weil sie in allen anderen Abteilungen versagt hatte: Sie war unfähig, hundert Metallkügelchen zusammenzuzählen, ruinierte an einem Tag durch Fahrlässigkeit zwei Fließbänder und kam auf ihren Botengängen regelmäßig abhanden. Inzwischen hat sogar Antonina Romanowna es aufgegeben, Ljusja erziehen zu wollen. Ljusja ist vierundzwanzig, aber sie sieht aus wie sechzehn. Sie hat nicht einmal das siebte Schuljahr beendet, weil sie die Kriegsjahre in der deutschen Besatzungszone verbrachte, und hat auch sonst wenig gelernt. Ihr einziges Kapital ist ihre Munterkeit: Niemand kann ihr was übelnehmen. Die wütendsten Beschwerdeführer beruhigen sich in ihrer Gegenwart. Ljusja weiß das. Auch Antonina weiß es. »Ihr Hauptverdienst, Ljudmilotschka, ist atmosphärischer Natur!« sagt sie, wenn sie ohne zu seufzen Ljusjas Kontrollbücher überprüft, mit anderen Worten: Ljusjas Arbeit tut.
Heute allerdings ist mit Ljusja rein gar nichts anzufangen. Ständig steht ihr das Wasser in den Augen. Sie zittert. Um drei Uhr nachmittags bringt Antonina Ljusjas Mantel. »Ljudmilotschka, besser Sie gehen jetzt nach Hause und legen sich ein bißchen hin, damit Sie munter sind, wenn Ihr Galan kommt.«
»Aber verstehen Sie doch, er kommt nicht wieder! Ich bin ihm nachgelaufen wie ein Flittchen, und dann mußte er sich wegen mir auch noch beleidigen lassen!«
Antonina gefallen die Requisiten dieser Geschichte: Champagner, Seidenkrawatte und Biberkragen. »Sie werden sehen, er kommt. Vornehme Menschen spüren Vornehmheit auch bei anderen. Er läßt sich nicht täuschen durch eine betrunkene Hausmeisterin.«
3
Am Abend des nächsten Tages schaut überraschend Wassja herein, ein alter Verehrer, den Ljusja seit der Besatzungszeit kennt. Alle halbe Jahre besucht er sie, um ihr Herz und Hand anzutragen, und immer behandelt sie ihn schlecht, aber diesmal ist sie so glücklich über seinen Besuch, daß sie ihn wie einen Bräutigam empfängt. Er weiß nicht, wie ihm geschieht, und stammelt: »Aber Ljusenitschka, aber Ljusenitschka ...«
Wassja hat sein erstes Glas noch nicht geleert, da steht der Fremde in der Tür. Ljusja hatte das Klingeln absichtlich überhört, ein Mitbewohner ließ ihn herein. Und plötzlich steht er da, im Bibermantel, die Mütze in der Hand. Er sieht Wassja an dem winzigen Tisch, der vollgestellt ist mit Wodka und allen gastronomischen Schätzen, die Ljusja zu bieten hat, und sagt: »Ah. Ich komme wohl nicht nach Stundenplan.« Er dreht sich um und geht. Im Flur holt sie ihn ein. »Das ist ein Irrtum! Der da bedeutet mir gar nichts! Er kam nur zufällig vorbei!«
»Wie lange gedenkt er zu bleiben?«
»Höchstens eine Viertelstunde!«
Damir sieht auf die Uhr. »Es ist jetzt 17 Uhr 15. Ich habe noch eine Besorgung zu machen. Um 17 Uhr 45 bin ich zurück.«
Ljusja rennt in ihr Zimmerchen, räumt die Speisen vom Tisch und schreit Wassja an: »Geh, sofort! Verschwinde! Verschwinde!«
4
Diesmal führt Damir Ljusja ins »Astoria«. Er ist galant, kommt aber noch vor dem Hauptgericht zur Sache. Er heiße Damir Mirsaidowitsch Bojarow, sei achtunddreißig Jahre alt und von Beruf Schriftsteller und Aktivist. »Ich sage das, weil ich Ihnen gegenüber offen sein möchte, bitte Sie aber, es für sich zu behalten.« Er sei verheiratet und habe einen dreizehnjährigen Sohn. Seine Familie werde er niemals verlassen, was etwas mit Verantwortungsgefühl und Ehre zu tun habe. »Wir beachten die Etikette.« Er hoffe, daß sie das versteht, sagt er und bestellt eine zweite Flasche Champagner. Nun tanzt er mit ihr. Als sie seine Lippen an ihrer Stirn spürt, wird ihr schwindlig. Sie stellt ihm eine Frage und bemerkt erleichtert, daß ihre Stimme noch anspricht: »Woher kommen Sie – eigentlich?« Wieder blickt sie zu ihm empor wie vor zwei Tagen, und er lächelt auf sie herab und sagt: »Ich bin Tatar.« Einfach so sagt er das. Petja, der Dummkopf, der Bauernsohn aus dem Ural, hätte gesagt: »Ich bin Hauptstädter«, nur weil er eine Leningrader Zulassung hat. Aber dieser hier, ein Schriftsteller, ein Künstler, sagt ganz einfach mit seiner zärtlichen Stimme: Ich bin Tatar. Es klingt wie: Ich bin Zar.
Jetzt beginnt er, ihr Fragen zu stellen. Sie ist wohl auch nicht von hier? Geboren in Sibirien, so. Und seit wann hier? Sie ist vierundzwanzig, so, und hat schon, aha, einen fünfjährigen Sohn. Aber hat sie nicht gesagt, sie lebe allein? So, der Sohn lebt bei der Oma? Und der Vater des Sohnes? Aha, soso. Ihre eigenen Eltern? Die Mutter lebt in einem Vorort, der Vater ist tot. Gefallen? Nein, zugrunde gegangen in Sibirien, weil – ach ja. Hier folgt keine weitere Frage.
Sie gehen zum Tisch zurück. Das Hauptgericht wird aufgetragen. Ljusja beobachtet das blinkende Besteck in Bojarows feinen, kräftigen Händen. Sie errötet, als Bojarow sie anspricht. Was kann sie erklären? Bei sich zu Hause hantiert sie mit stumpfen Messern und verbogenen Blechgabeln. Solches Fleisch hat sie seit Monaten nicht gesehen, und solche Hände überhaupt noch nie.
Bojarow erlöst sie aus ihrer Verwirrung, indem er neue Fragen stellt. »Was arbeiten Sie? Seit wann? Wie ergeht es Ihnen da?« Ljusja erzählt von der Fabrik, von ihren Schwierigkeiten, bis hundert zu zählen, und ihrem Wechsel in die Beschwerdeabteilung, den sie als rettendes Wunder bezeichnet. Wunder? Rettung? Wieder kommt sie sich lächerlich vor. »Kugellager«, hilft Bojarow nach. »Das Kabinett von Antonina Rurikowna.«
»Romanowna«, verbessert Ljusja, und schon hat sie sich gefangen. »Antonina Romanowna! Stellen Sie sich vor, sie hat einen dunklen Fleck in ihrer Biographie. Sie ist nämlich aristokratischer Abstammung. Sie hat auf Bällen getanzt und ist Quadrille geritten, im Smolnyj wurde sie erzogen. Deswegen wird sie auch nicht befördert. Dabei arbeitet sie für drei. Für zwei in ihrer eigenen Funktion, und zusätzlich für mich. Und sie schimpft nie! Wissen Sie, was sie zu mir immer sagt? In der Zarenzeit hätte ich überhaupt nicht arbeiten müssen!« Hier erschrickt Ljusja, denn das ist nichts für fremde Ohren, man könnte es als Konterrevolution auslegen. Aber Bojarow lacht nur. Der Champagner beginnt zu wirken. Immer temperamentvoller erzählt Ljusja vom Alltag im Büro, von Leuten, die Antonina Lieferverzögerungen vorwerfen und über verlorene Zeit klagen, sich dann aber zum Teetrinken niedersetzen und eine Stunde lang über den Bau ihrer Datscha oder den neusten Sketch von Rajkin berichten. Als Ljusja kokett den vorletzten Tag schildert: wie sie litt, beinahe den Samowar umwarf und sich hinter dem Ofen versteckte, lacht Bojarow so sehr, daß sie die Goldplomben seiner Backenzähne sieht.
Im Taxi bringt er sie nach Hause, und wie selbstverständlich schickt er das Taxi weg. Ljusja macht eine vage Geste zur Rettung ihrer Ehre. »Die Nachbarn ... die Arbeit ...«
»Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Nachbarn, Ljusja. Und vor allem grämen Sie sich nicht wegen Ihrer Arbeit. Antonina Romanowna wird Sie verstehen.«
»Und wenn man mich rausschmeißt, wovon soll ich dann leben, Damir Mirsaidowitsch?«
»Von mir.«
5
»Stell dir vor, ein richtiger Schriftsteller hat mich gestern zum Essen eingeladen. Natürlich ins Astoria«, erzählt Ljusja am nächsten Tag aufgeregt ihrer Freundin Rita, »und nicht nur das. Ein wahnsinnig gutaussehender Mann, ein blauäugiger Tatar. Er heißt – aber behalt es bitte für dich, denn er beachtet die Etikette – …«
6
»Du läßt dich von einem verheirateten Mann aushalten«, sagt Pelageja Ilarionowna. »Das ist furchtbar, Ljusja.«
»Ich lasse mich ja gar nicht aushalten, Mama. Ich hab immer noch meine Arbeit, und er lädt mich nur ab und zu zum Essen ein.«
»Er ist verheiratet, Ljusja. Ganz abgesehen von deiner eigenen Lage solltest du daran denken, daß er sein Geld für seine Familie braucht.«
»Ach, Mamotschka, er ist so reich! In Restaurants würde er auch ohne mich gehen. Und die paar Rubel, die mein Essen zusätzlich kostet, das ist für so einen gerade soviel, als würden wir uns ein – Vögelchen kaufen.«
»Trotzdem ist es Sünde.«
7
Ljusja sieht das anders. Natürlich hat sie für das mit der Ehre Verständnis. Borja Sepuchin, der Vater ihres Söhnchens Jurik, hatte ihr damals nicht gesagt, daß er verheiratet war. Als er hörte, daß sie schwanger sei, wurde er plötzlich nach Kaliningrad versetzt. »Verbotene Zone, Ljusja; da kann ich dich leider nicht mitnehmen. Und ablehnen kann ich auch nicht, wenn das Vaterland ruft.« Am Tag nach dieser Erklärung fuhr sie zu seiner Kaserne, um ihm alle Schande zu sagen, und erfuhr dort, er sei bereits mit seiner Familie abgereist.
Mit einundzwanzig Jahren heiratete sie einen kräftigen Mann mit dicken Lippen, der ihr eine grandiose Zukunft versprach. Er hieß Wolodja; mit ihm hat sie viel gelacht. Der zweijährige Jurik hat ihn geliebt. Aber Wolodja verlor beim Kartenspiel. Einen Tag fuhr man im Taxi, am nächsten war kein Essen auf dem Tisch. Wolodja sagte zu Ljusja: »Das kommt von den unnützen Ausgaben. Warum sollen wir Geld für zwei Zimmer bezahlen? Ganz einfache Arithmetik!« Er kritzelte große Zahlen auf ein Stück Pappe, um Ljusja zu beweisen, was das für eine einfache Arithmetik sei, und zog zu ihr. Während Ljusja wochenlang versuchte, seine Gläubiger abzuwimmeln, saß Wolodja in ihrem Zimmerchen, drehte sich Zigaretten aus Zeitungspapier und bohrte mit einem Stück Draht in seinem Ohr. Er erzählte von seinen Projekten, und warum sie sich im nächsten Jahr sogar eine Villa würden leisten können, mindestens aber eine Dreizimmerwohnung. Schon bald hielt sich Ljusja bei dem Wort »Arithmetik« die Ohren zu. Sie eröffnete ihrer Mutter Pelageja Ilarionowna, daß sie sich von Wolodja scheiden lassen wolle. Pelageja Ilarionowna sagte: »Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.« Ljusja lachte darüber. Was hatten diese »einfache Arithmetik« und ein Bündel falscher Versprechungen mit Gott zu tun? »Hat nicht Papa selbst gesagt, bei Männern kommt es nicht darauf an, was einer sagt, sondern was einer tut?« – »Nicht nur bei Männern, bei allen Menschen ist es so.« – »Aber bei Männern besonders.« – »Ljusja! Du bist kein Kind mehr! Du bist zweiundzwanzig Jahre alt und hast ein Söhnchen, dem du ein Zuhause bieten mußt! Du bist verheiratet! Arbeite, versuch deine Lage zu verbessern, anstatt immer davonzulaufen.«
In der gleichen Woche schlug Ljusja Wolodja zum ersten Mal die Scheidung vor. Er lachte sie aus. »Du kannst sagen, was du willst, ich sehe dir an, daß du mich liebst.« (In der Liebe hielt er sich für sehr versiert. Er war es auch, aber was nützt das?) Bei ihrem nächsten Vorstoß wurde er sehr aufgeregt, schleuderte sie zu Boden, malte ein ganzes Schulheft voll Zahlen und beschwor eine »obereinfache Arithmetik«. »Wolodja!« rief Ljusja. »Die Arithmetik ist nicht einfach! Um Geld zu verdienen, muß man nicht rechnen, sondern arbeiten!« Der kleine Jurik versteckte sich unter dem Bett. Es begann eine schwere Zeit. Wenn Ljusja von der Arbeit nach Hause kam, wußte sie nie, ob Wolodja sie mit Zärtlichkeit oder mit Vorwürfen empfangen würde. Ljusja nahm zusätzliche Arbeit als Näherin an, was zu neuen Vorwürfen führte, sie weiche ihm aus. Trotzdem war oft nichts zu essen da. Wolodja sagte höhnisch: »Ich weiß, du willst mich loswerden. Aber hier bringst du mich nicht raus. Du weißt ja selbst, daß ein Mann ohne Arbeit nirgends ein Zimmer findet.« Ljusja fiel plötzlich auf, wie häßlich seine Augen waren, und sie wunderte sich darüber, daß sie sich einmal für ihn hatte begeistern können. Wie heißt es im Sprichwort? Die Liebe ist böse, du verliebst dich auch in einen Ziegenbock. Als Ljusja Wolodja kennenlernte, sagte er: »Bei mir hat noch jede Frau am nächsten Morgen gesungen«, und tatsächlich sang Ljusja in der ersten Zeit jeden Morgen. Jetzt aber war sie bedrückt und gedemütigt und wußte keinen Ausweg: Dreiundzwanzig Jahre alt, und schon ein verpfuschtes Leben.
Die Lösung kam von unerwarteter Seite: Die Miliz holte Wolodja ab. Er wurde auf einer Gerichtsverhandlung, der Ljusja fernblieb, für eine Serie kleinkrimineller Unternehmungen, von denen sie nichts wissen wollte, zu fünf Jahren Lager verurteilt. Als Ljusja die Scheidungspapiere erhielt, hat sie den ganzen Tag aus Freude darüber, daß sie Wolodja los war, gesungen; ebenso, wie sie vor zwei Jahren aus Freude gesungen hatte, weil er bei ihr war. Der kleine Jurik aber kam kaum mehr unter dem Tisch hervor und nahm drei Kilo ab.
Anderthalb Jahre lang hatte Ljusja dann von der Liebe genug. Der Schreck saß ihr in den Knochen. Verehrer gab es natürlich. Aber warum soll sie sich wieder in die Hände eines Lügners wie Borja begeben, eines Taugenichts wie Wolodja oder eines Einfaltspinsels wie Petja?
Wie anders ist Bojarow: Vollendete Manieren. Bedeutende Worte. Eleganz und Autorität. Ernste Augen, in denen manchmal, wenn er sich unbeobachtet fühlt, Leidenschaft glimmt, das ist natürlich das Allerbeste. Schon ein einziger Tag mit einem solchen Mann ist ein Geschenk des Himmels, ein Beweis, daß es auf der Erde noch andere Dinge gibt als Dummheit, Haltlosigkeit, Betrug und Gier, ein Zeichen, daß es sich gelohnt hat, seinen Stolz zu bewahren und die Hoffnung nicht aufzugeben.
8
Bojarow kommt jetzt täglich. Ljusja fürchtet sich davor, selbst die Tür zu öffnen. Sie meint, sie müßte vor Enttäuschung in Ohnmacht fallen, wenn er es nicht ist. Aber mit hämmerndem Herzen erkennt sie seinen Schritt im Korridor.
Ljusjas Einrichtung besteht aus einem eisernen Bettgestell, einer Kommode, die Ljusjas Habseligkeiten enthält, einem Hocker und einem gußeisernen Öfchen, das mit Holz geheizt wird. Die einzige Möglichkeit, hier etwas zu veredeln, besteht darin, den Parkettboden möglichst blank zu putzen. Also scheuert Ljusja das rohe Parkett, bis es hellgrau wird und die Holzstruktur erkennen läßt. Die Truhe bedeckt sie mit einem sauberen, gebügelten Leinenfetzen. In dem Zimmerchen duftet es nach Seife, nach gescheuertem Parkett, nach dem im Ofen brennenden Fichtenholz, nach Jugend, Hoffnung und Glück. Bojarow läuft in seinem Bibermantel durch den engen Korridor, klopft einmal kurz und zieht sofort die Tür auf, als befürchte er etwas oder als könne er nicht erwarten, Ljusja zu sehen. Jetzt steht er in der Tür, vornehm, interessant, und ruft mit einer Stimme, als breite er die Arme aus: »Wie gemütlich!« Er ist ein zurückhaltender Mensch, niemals spricht er von Gefühlen oder gar von Liebe, aber dieser Hauch von Dankbarkeit auf seinem strengen Gesicht belohnt Ljusja für alle Mühsal des Tages, für alle Stunden der Sehnsucht und für alle Zweifel, die von ihr Besitz ergreifen, wenn Bojarow nicht da ist.
Oft bleibt Bojarow über Nacht, aber er läßt sich nie bewirten, er nimmt nicht einmal eine Tasse Tee. Er führt Ljusja aus: in teure Restaurants, manchmal auch ins Theater. Er kommentiert die Theaterstücke, die Inszenierungen, das Essen, die Neuigkeiten in der Zeitung, das Weltgeschehen mit so sicheren und gesetzten Worten, daß Ljusja, auch wenn sie ihn nicht versteht, vor Ehrfurcht ganz aufgeregt wird. Manchmal sagt auch Ljusja eine Art Meinung. Dann hört Bojarow aufmerksam zu und antwortet so behutsam, daß Ljusjas Worte nachträglich einen Sinn ergeben. In solchen Augenblicken ist Ljusjas Freude grenzenlos.
An den Abenden, an denen Bojarow nicht da ist, liest Ljusja Liebesgedichte. Sie ahnt, daß sie an einem Mysterium teilhat, und weint vor Glück. Manchmal allerdings überfällt sie die Einsicht, daß sie nichts ist als die Gespielin eines älteren verheirateten Mannes, daß sie kein Recht auf ihn hat, daß er sie ohne Zweifel bald satt sein wird, ja vielleicht schon ist, daß er sicherlich nie mehr wiederkommt, und dann weint sie vor Schreck.
9
»Nein, es ist kein Geheimnis, woher ich komme«, sagt Bojarow. »Ich habe mich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet; und vieles verdanke ich übrigens der Sowjetmacht. Aufgewachsen bin ich in einem Dorf an der Kasanka. Weil mein Vater Lehrer war, habe ich früh angefangen, Bücher zu lesen, und eine brauchbare Bildung erhalten. Mit siebzehn trat ich der Partei bei und arbeitete als Aktivist für die Kollektivierung. Mit achtzehn wurde ich Kommandant meines Dorfes und Vorsitzender des Ortssowjets. Mit neunzehn bekam ich ein Stipendium an der Moskauer Universität. Bereits in meiner Schulzeit hatte ich Gedichte und journalistische Arbeiten veröffentlicht, und bald fand ich bei der Zeitschrift ›Junge Garde‹ ein gutes Auskommen als Redakteur. Gleich mein erstes Buch mit Geschichten aus der Kollektivierungszeit erhielt einen Preis. Im Auftrag der Zeitung bereiste ich meine tatarische Heimat, die Ukraine und Weißrußland, um über die Erfolge des sozialistischen Aufbaus zu berichten. Letztlich tue ich das immer noch; auch wenn zum Schreiben immer weniger Zeit bleibt. Zum Beispiel bin ich Berater beim Aufbau des tatarischen Schulsystems und Gründungsmitglied verschiedener Bibliotheken. Ich fördere den literarischen Nachwuchs in meiner Heimat. Hm. Wenn es mir darauf angekommen wäre, hätte ich dieses Jahr mein fünfundzwanzigjähriges Autorenjubiläum feiern können.«
Seine Bescheidenheit entzückt Ljusja. So eine ideale Biographie! Und wie er sie vorträgt – wie gedruckt! Wenn Ljusja an ihr eigenes Schicksal denkt, fällt ihr nichts als Chaos ein: Angst, Flucht, Illegalität, Krieg, dazwischen ein paar unbegreiflich fröhliche Stunden. Aber nichts Bedeutendes, vor allem gar keine Entwicklung. Sie lebt, weil sie geboren wurde. Na und?
»Was denkst du?«
»Ach, Damir, du bist so – bedeutend«, druckst Ljusja, »und ich so – gar nichts. Eine sibirische Feldmaus.«
»Wir sind nicht in Sibirien. Du bist keine Maus. Du bist ...«
»Ja?«
Er lächelt und wechselt das Thema. »Wie bist du eigentlich aus Sibirien fortgekommen?«
»Geflohen. Mein Vater war Priester. Er wurde im Jahr achtundzwanzig verhaftet.«
»Ah.«
»Wir sind alle rechtgläubig.«
»So.«
»Unser Haus ist vor unseren Augen verbrannt worden. Mama, Oma und wir sechs Kinder wußten nicht wohin. Niemand durfte uns aufnehmen, weil doch auf ›Mitleid‹ zehn Jahre standen. Ein Bauer hat sich erbarmt und uns in seinem Windfang schlafen lassen, weil die Nächte so kalt waren. Aber vor dem Morgengrauen setzte er uns wieder raus. Mama sagte: ›Ein Land, in dem Mitleid bestraft wird, ist verflucht.‹ Und Oma: ›Diese Macht kommt aus der Hölle und bringt Finsternis. Sie ist so stark, daß niemand sie besiegen kann, aber eines Tages wird sie sich selbst vernichten. Es wird viel Geld geben, aber man wird sich nichts kaufen können.‹«
An dieser Stelle sieht Bojarow sich rasch um, bezahlt die Rechnung und führt Ljusja aus dem Restaurant. Sie stehen auf der Straße, geblendet vom hellen Sonnenlicht. Schmelzwasser tropft von den Dächern. Der Winter lockert seinen Griff. Bojarow führt Ljusja über die nasse, schwarze Straße vom Hafen weg. »Kennst du den Smolensker Friedhof?«
»Nein.«
»Gehen wir dorthin ... Ein bißchen spazieren.«
Auf dem Friedhof fragt er: »Und wie seid ihr nach Leningrad gekommen?«
»Zu Fuß!« prahlt Ljusja, die sein unausgesprochenes Erstaunen spürt. »Das heißt, ich bin natürlich getragen worden, ich war ja erst zwei Jahre alt. Aber ich erinnere mich genau. Anderthalb Jahre waren wir unterwegs. Überall Wirrwarr, eine Art Bürgerkrieg.«
Bojarow räuspert sich. »Nun ja, es war eine große, schmerzhafte – heroische Umwälzung.« Er spricht jedes Wort sehr deutlich aus.
»Wir haben auf den Feldern und in Scheunen geschlafen. Einmal, als Mama zusammenbrach, hat uns ein Bauer in einem Handwagen dreißig Kilometer weit gezogen. Solche unbekannten Menschen haben uns gerettet. Einer gab uns ein Stück Brot, ein anderer eine Jacke ...«
»Ich glaube nicht, daß du dich an all das erinnerst.«
»Dann hat man’s mir eben so oft erzählt, daß ich’s genau weiß«, sagt Ljusja friedfertig. »Doch! An eins erinnere ich mich bestimmt. Da haben mutige Leute uns Kinder auf dem steinernen Ofen schlafen lassen, weil die Nächte so kalt waren. Und Mama hat immer am Vorabend mit so einem besorgten Summen Holzspäne und faules Stroh zusammengescharrt. Das streute sie unter uns auf dem Ofen aus, denn wir hatten vor Angst Durchfall, wir alle, jede Nacht.«
»Sechs Kinder und eine Oma.«
»Fünf Kinder, Mama und Oma. Oma ist aber nicht durchgekommen. Sie war ja schon neunundneunzig. In der Nähe von Perm starb sie am Wegrand. Sie erklärte, sie hätte jetzt genug.«
»Wieso nur fünf Kinder und nicht sechs?«
»Meine älteste Schwester Ljuba war nach Leningrad vorausgefahren, noch von Nowosibirsk aus. Ein Hauptmann vom Enteignungskomitee hatte ein Auge auf sie geworfen. Sie war aber erst neunzehn. Wir haben unser ganzes Geld zusammengekratzt und sie in einen Zug nach Leningrad gesetzt. Papa hatte in Leningrad Verwandte, bei denen sollte sie unterkommen und auf uns warten.«
»Und so kamt ihr wieder zusammen.«
»So einfach war es nicht. Also, Ljuba ist tatsächlich in Leningrad gelandet, aber sie ist sehr – romantisch. Vom Bahnhof aus rannte sie gleich hinaus auf den Newskij Prospekt, weil sie über den so viel gelesen hatte; eine Mitreisende wollte auf ihren Koffer aufpassen. Aber als Ljuba zurückkam, war die Mitreisende weg, und der Koffer auch. Im Koffer war das Adreßbuch gewesen und das ganze Geld. Da wußte Ljuba natürlich nicht, wohin. Sie schlief in den Parks. Am zweiten Tag ging sie in eine Bäckerei, um den Duft von frischem Brot einzuatmen, und fiel in Ohnmacht. Am dritten Tag stellte sie sich in einen steinernen Hof und fing an zu singen. So hat sie ein paar Kopeken verdient. Und da ist ein Wunder passiert: Eine fremde Frau hat Ljuba auf ihre schöne Stimme angesprochen. Die Frau war Pianistin im Kleinen Opernhaus. Sie brachte Ljuba zuerst bei sich daheim unter und dann im Wohnheim vom Konservatorium. Von da aus hat Ljuba die Verwandten ausfindig gemacht. Sie klapperte einfach den ganzen Ligowskij Prospekt ab, Wohnung für Wohnung. Dafür brauchte sie Monate, und als sie endlich, endlich, ins richtige Haus kam, stieß sie auf uns – auf der Treppe. Wir waren gerade angekommen, ganz zerlumpt, halb verhungert. Lauter Wunder, oder nicht?«
»Ich glaube nicht an Wunder.«
Das hat Bojarow ziemlich schroff gesagt.
Die Sonne ist verschwunden, blaue Dämmerung breitet sich zwischen den Bäumen aus, unter den Füßen gefriert der Matsch. Bojarow zündet sich eine dünne Zigarre an. Ljusja mustert ängstlich sein Gesicht im flackernden Streichholzlicht, da wendet er sich ab. (Um Gottes willen, er ist beleidigt! Warum nur, was habe ich falsch gemacht? Alles aus.) Ljusjas Blick streift die obeliskförmigen Grabsteine und die kahlen, müden Bäume. Tränen kitzeln in der Nase.
»Und wie ging es weiter?« (Er fragt! Er nimmt den Faden wieder auf! Er interessiert sich für mich. Gerettet.)
»Schrecklich, schrecklich schwer war’s. Wir hatten ja keine Aufenthaltserlaubnis und waren die Familie eines Volksfeindes. Wir haben uns hinter Schränken und in Kellern versteckt, alle sieben: Mama, die Brüder Wowa und Innokentij, und wir vier Schwestern. Nadja – die jüngste vor mir, sie war gerade sieben – ist zwar im ersten Leningrader Sommer verunglückt. Sie rannte auf die Straße, da riß ihr ein Laster mit seiner Auslegeschaufel den halben Kopf ab, und sie stürzte blutüberströmt zu Boden, vor Mamas Augen. Und Mama durfte sich nicht zu erkennen geben und rannte davon, aber seitdem ist ihr Haar grau.«
»Und wie kamt ihr schließlich zu eurer Aufenthaltserlaubnis?« fragt Bojarow nach einer Pause.
»Die hat uns Isaak Abramowitsch Babizkij beschafft. Unser erster Helfer mit einem Namen. Er brachte uns in seiner eigenen Wohnung unter, in der Speisekammer, und besorgte uns allen Papiere. Das war auch so ein Rätsel. Wie hat er das gemacht? Warum? Viel Geld konnte er an uns nicht verdienen. Als Mama ihm unter Tränen dankte, machte er ein paar komplizierte Witze, die keiner verstand. Und seitdem sind wir Leningrader.«
10
Bojarow, der sich sorgsam aus Ljusjas Familienangelegenheiten heraushält, der jede persönliche Bekanntschaft mit einem weiteren Gwosdikow kategorisch verweigert, wird nicht müde, Ljusja über alle auszufragen. Zum Beispiel über Jurik, Ljusjas Sohn (ein besonders schmerzliches Thema). Wie geht es ihm, wie zieht man so einen auf? Ljusja kann hier gar nichts Erfreuliches berichten, doch Bojarow lächelt sein verständnisvolles Literatenlächeln, und schon gibt sie alles preis.
Jurik war ein Unfall. Geboren ist er kurz nach Kriegsende. Gezeugt wurde er in Lettland. Ljusja, die fast die ganze Kriegszeit bei ihren Eltern auf dem Dorf Dubowka im besetzten Pskower Gebiet verbrachte, ist im letzten Kriegswinter nach Lettland geflohen und hat dort in der Nähe einer Kaserne gelebt, die erst deutsch, dann russisch kommandiert war. Dort hat sie auch diesen Borja Sepuchin kennengelernt, der Juriks Vater wurde. Dieser Sepuchin hat sie reingelegt. Er hat zwar nächtelang an ihrer Tür gekratzt ... »Das wollen wir nicht so genau wissen«, unterbricht Bojarow mit einer eleganten Handbewegung. »Jetzt ist Jurik eben da.«
Ja, und mit Jurik gab es immer Probleme. Schon die Geburt: Ljusja war bei ihrer Mutter auf dem Dorf Dubowka. Nach zwei Tagen Wehen rief Pelageja Ilarionowna eine Ärztin, und es kam eine sehr junge, ängstliche Ärztin. Ljusja erinnert sich, daß die Mutter sagte, die Fruchtblase sei noch nicht geplatzt. Die junge Frau reagierte, indem sie mit dem Fingernagel die Fruchtblase aufriß. Alles ergoß sich auf die alte Roßhaarmatratze, Jurik selbst schoß heraus. Er war schon tot. Mit Mühe belebte ihn die Ärztin wieder, aber einen Gehirnschaden hat er zurückbehalten. Im übrigen gab es keine Zeit, darüber nachzudenken: Ljusja war hochschwanger aus Lettland zurückgekehrt, hier in Dubowka drohte ihr die Verhaftung wegen Kollaboration, zwei Tage nach der Geburt floh sie mit Jurik nach Leningrad.
Bald zeichnete sich eine neue Krise ab. Jurik wog bei der Geburt dreitausendfünfhundert Gramm. Aber er konnte keine Nahrung bei sich behalten, nach fünf Minuten erbrach er, und zwar so exakt und in so hohem Bogen, daß er in der Universitätsklinik den Studenten vorgeführt wurde. Die Arzte redeten von Darmverschluß. Nach vier Wochen wog Jurik nur noch 3000 Gramm, nach vier Monaten zweieinviertel Kilo. Er sah grau und runzlig aus wie ein Greis. Der Chefarzt sagte zu Ljusja: »Eine Operation wird er nicht überleben. Lassen Sie ihn sterben, Sie sind jung, Sie können noch viele gesunde Kinder gebären.« Ljusja flehte ihn an, trotzdem zu operieren: »Wenn er dann stirbt, werde ich mir sagen können, daß ich alles versucht habe. Aber ich kann ihn doch nicht einfach so verhungern lassen!« Jurik wurde operiert und überlebte. Vier Wochen aß er sehr viel, dann fing er an zu schreien, als müsse er die Monate des Dämmerns wettmachen. Er schrie Tag und Nacht. Inzwischen lebte auch Ljusjas Mutter im Leningrader Gebiet: In dem Ort Wyriza hatte sie ein kleines Blockhaus erworben. Dorthin brachte Ljusja den Kleinen, und dort beruhigte er sich allmählich und begann zu wachsen.
Jurik wohnt auch jetzt wieder bei Pelageja Ilarionowna, denn in der Kommunalwohnung ging es nicht. Er war mürrisch und jähzornig, sagte kaum ein freundliches Wort, aß aus der kommunalen Speisekammer die Vorräte der Nachbarn und randalierte, wenn sie ihn zur Rede stellten. Auf der Straße suchte er die Gesellschaft der wildesten Jungen. Aber auf dem Land langweilt er sich. Er verbringt die Tage damit, Käfern die Flügel und Fröschen die Beine auszureißen, und hat einmal fast das Haus angezündet, als er in einem Wutanfall eine brennende Zeitung auf den Boden warf. Pelageja Ilarionowna hat sich nie beklagt, aber sie bekreuzigte sich, als Ljusja sagte, im nächsten Herbst, zur Einschulung, werde sie Jurik in einem Kinderheim unterbringen. »Was ist nur mit ihm«, seufzte Pelageja Ilarionowna, »haben wir an ihm gesündigt?«
Ljusja hat gesündigt. Sie interessierte sich viel mehr für ihre Verehrer als für Jurik. Eine Zeitlang nannte er jeden fremden Mann, der sie besuchte, Papa. Die fremden Männer bestachen ihn mit Schokolade und Spielzeug, damit er das Zimmer verließ, während Ljusja ihn bei sich haben wollte, damit die Männer sich beherrschten.
11
»Natürlich ist es ohne Jurik leichter«, sagt Ljusja. »Ein Zimmer für mich allein, das ist ein unerhörter Luxus. Du mußt dir vorstellen, am Anfang, in den dreißiger Jahren, haben wir zu sechst hier gehaust.« Ljusja vergißt selten, ihre Armut zu erwähnen, weil sie herausgefunden hat, daß das auf Bojarow Eindruck macht.
»Und nach dem Krieg hat mein ältester Bruder Wowa sechs Monate bei mir gelebt. Er war wie meine anderen Geschwister während der Blockade evakuiert worden, aber die anderen drei kamen zurück, und er hatte das Pech, daß seine ganze Fabrik in den Ural verlegt wurde. Er war da Ingenieur, sie hielten ihn fest. Da flehte er mich an, ich soll ihm eine Einladung schicken. Kurz: ohne mich säße er noch immer im Ural. Aber er hat es mir schlecht gedankt. Ich teilte mit ihm meine Lebensmittelmarken, weil er meinte, wir sollten gemeinsame Kasse machen. Aber kaum waren meine Marken aufgebraucht, sagte er: ›So, und jetzt machen wir wieder getrennte Kasse.‹ Zu dem Zeitpunkt hatte er eine neue Arbeit und ein eigenes Zimmer gefunden, und ich konnte mich nicht mal rächen. Ganz komisch, zwei von meinen Geschwistern sind üble Egoisten, die anderen zwei die reinen Engel. Die schädlichen sind leider tüchtig. Wowa ist schon wieder zum leitenden Ingenieur befördert worden, und meine zweitälteste Schwester Lera ist Administratorin in einer Druckerei. Außerdem hat sie zwei Söhne und einen fleißigen Ehemann. Sie bauen schon eine Datscha. Ein knüppelhartes Weib. Die netten sind meine älteste Schwester Ljuba und mein Bruder Innokentij. Gott sei Dank hat Ljuba einen sehr guten Mann gefunden, einen Chemiker. Aber Innokentij ist zu bedauern. Der hatte eine so feine Seele, daß er im Krieg ein Magengeschwür bekam, obwohl er nur in der Etappe eingesetzt wurde. Im Lazarett ist er dann von einer Krankenschwester geheiratet worden. Alle haben ihn deswegen ausgelacht. Die Krankenschwester war schon durch sämtliche Betten gewandert, hieß es. Aber er sagte: ›Irgendwer mußte sich ihrer schließlich annehmen.‹ Ernsthaft, so redet der. Jetzt lebt er mit seiner Krankenschwester in Gatschina, natürlich arbeitet sie nicht mehr, und sie rührt auch im Haushalt keinen Finger. Sie macht Szenen, wenn er unsere Mutter besuchen will, und fährt nur noch Taxi. ›Mein Mann‹, sagt sie, ›ist ja schließlich Inscheniör.‹«
12
»Viel hast du zu erzählen. Nur alles etwas konfus.«
»Du fragst konfus!« verteidigte sich Ljusja.
»Macht ja nichts. Alles ist interessant. Seifenblasen … Seifenblasen.«
»Seifenblasen?«
»Seifenblasen. Das große, bunte Leben.«
Ljusja geht das Lächeln nicht aus dem Kopf, mit dem Bojarow das sagte. Es war ein … darf man sagen entrücktes? … Lächeln. Geredet hat er danach wie immer schulmeisterlich.
Natürlich hat Ljusja diese Beobachtung sofort mit ihrer Freundin Rita diskutiert. »Ganz einfach«, sagte Rita. »Das ist eben wie in Tausendundeiner Nacht. Solang du was zu erzählen hast, bleibt er bei dir.«
Ljusja wurde rot vor Glück. (Wenn das so ist, kommt er mir nicht mehr aus. Sollte der Stoff knapp werden, würde ich mir sogar was ausdenken, nur um ihn zu fesseln, aber bisher ist das ja gar nicht nötig, denn das Leben ist, solange es dauert, unerschöpflich.)
13
»Ich habe ja so viel Glück gehabt, Damir. Überhaupt, daß ich heil durchgekommen bin! Dabei kam alles immer ganz anders, als ich wollte, aber nur weil es anders kam, habe ich überlebt.
Das fing damit an, daß kurz vor dem Krieg mein Vater wieder auftauchte. Er war nach dreizehn Jahren aus dem Lager entlassen worden, durfte sich aber nicht in Leningrad aufhalten. Er hatte eine Stelle als Imker in Dubowka zugewiesen bekommen, das ist ein Kaff im Pskower Gebiet, jenseits der 300-Kilometer-Grenze. Nach Leningrad kam er heimlich, um uns wiederzusehen, für zwei Tage. Vor Angst haben meine Eltern die ganzen zwei Tage nur geflüstert und nie Licht gemacht, Gott sei Dank waren die Nächte schon ziemlich hell, es war im Mai. Also, sie verabredeten, daß Mama mit Papa nach Dubowka fährt, und ich soll zu meinem Bruder Wowa ziehen und die Schule beenden. Ich machte natürlich einen Skandal, weil ich nicht zu Wowa wollte – den konnte ich schon damals nicht leiden. Ich war ja schon fünfzehn, ich wollte lieber allein leben. Ich bin erst still geworden, als Papa sich an den Hals griff. Dann reisten sie ab, ich stritt mich vier Wochen lang mit Wowa herum, und eines Abends komme ich nach Hause, und Wowa erwartet mich und sagt: ›Es ist Krieg. Ich habe ein Bündel für dich gepackt, du fährst sofort zu den Eltern.‹ Da machte ich den nächsten Skandal. Was sollte ich in Dubowka? Außerdem hat mir mein Vater nicht gefallen. Wiedererkannt habe ich ihn sowieso nicht, aber außerdem gefiel er mir nicht. Ich hatte ihn mir immer als Helden vorgestellt, und statt dessen war er alt, krumm und gelb, hatte einen räudigen Schädel und roch streng. Seine Hände waren geschwollen, weil er im Lager so viel Steine geklopft hat. Er hat den Weißmeerkanal gebaut und nur überlebt, weil ein Sympathisant ihm einen Löffel Fischfett pro Tag zusteckte. Also, im Prinzip tat er mir natürlich leid, aber ich fand ihn auch gräßlich. Ich zanke also mit Wowa, da packt der mich plötzlich am Genick und zerrt mich zum Witebsker Bahnhof, dort ist Chaos und Panik, alle wollen fliehen, aber Wowas Freundin hatte die Karte schon besorgt, und Wowa schiebt mich in den überfüllten Zug und sagt: ›Wenn du zurückkommst, bring ich dich um.‹ Da bin ich halt gefahren. Und vielleicht hat mich das gerettet, denn was während der Blockade hier los war, weißt du ja.
In Dubowka war ich gerade ein paar Tage, da marschierten die Deutschen ein. Und blieben drei Jahre. Uns ging es in der Zeit relativ gut, weil Papa ja Priester war, also für die ein Antikommunist. Die Deutschen sperrten die Kirche wieder auf, und Papa erholte sich und hat noch mal drei glückliche Jahre verlebt. Dann lockerte sich die Besatzung, immer wieder bedrohten uns Partisanen, und Papa schickte mich nach Lettland. Er selbst aber blieb in Dubowka. Sofort nach Kriegsende wurde er von unseren Organen als Kollaborateur verhaftet, und wir haben ihn nicht wiedergesehen. Mein armer Papa!« Es fließen ein paar Tränen. »Und ich, so nichtsnutzig wie ich war, kam durch! Die Flucht nach Lettland war meine Rettung, und beinahe hätte ich noch alles vermasselt, weil ich nach Dubowka zurückkehrte. In Lettland nämlich bin ich von diesem Borja Sepuchin geschwängert worden und verlor den Mut, und anstatt nach Westen zu flüchten, kam ich zurück, zu meinem Glück genau einen Tag, nachdem Papa verhaftet worden war. Die Henker waren schon wieder weg. Also, ich brachte Jurik zur Welt und floh sofort weiter nach Leningrad. Und dort schon wieder ein riesiges Glück: Obwohl ich keine Papiere mehr habe, gelingt es mir, bei der Wohnungs-Nutzungs-Behörde einen neuen Wohnberechtigungsschein für unser altes Pionierstraßenzimmer zu bekommen. Offiziell waren wir ja nie ausgezogen, auch unsere Möbel standen noch dort, aber natürlich wohnte jetzt jemand anderes in dem Zimmer, eine alte Frau, die mich nicht kannte. Als ich ihr meine Bescheinigung unter die Nase hielt, brach sie in Tränen aus. Es stellte sich heraus, sie war Flüchtling, eine Jüdin aus Mogiljow, sie erzählte fürchterliche Sachen. Die Deutschen hatten ihre ganze Familie in einem Ofen verbrannt. Da stehe ich mit Jurik auf dem Arm, Jurik schreit, die Frau weint, mir zittern die Knie vor Erschöpfung, und dann beschließen wir, es zu dritt zu versuchen.«
»Wie lange ging das gut?«
»Bis zuletzt. Sie war sehr nett und gescheit. In Mogiljow war sie von Beruf Heiratsvermittlerin gewesen, und plötzlich kam sie auf die Idee, das auch in Leningrad zu versuchen. Was soll ich dir sagen, das Geschäft blühte. Meistens wandten sich natürlich mittelalte oder jüngere Leute an sie, aber einmal kam ein siebzigjähriger Mann, der gar nicht schlecht aussah und auch Rücklagen hatte. Zu dem sagte sie: ›Nehmen Sie doch mich!‹ Dann zog sie zu ihm, und beide sind sehr vergnügt und lachen den ganzen Tag. Sie bäckt gern, ab und zu lädt sie mich zu Kuchen ein.«
»Wie lang habt ihr zusammen gewohnt?«
»Ein halbes Jahr.«
»Hier?«
»Ja, und ohne Streit. Nur mit dem Essen gab es manchmal Probleme, das mußte unbedingt koscher sein. Wir mußten zusammen kochen, aber ich konnte mir die Regeln nicht merken. Sie war sehr religiös. Zum Ausgehen setzte sie eine häßliche Perücke auf. Samstags rührte sie keinen Finger. Übrigens hatte sie nichts gegen meine Religion, sie meinte nur, jeder muß seinem Glauben treu sein. Konvertiten konnte sie nicht leiden. Der schlimmste Tag im Jahr war für sie Christi Auferstehung.«
»Und dann tauchte dein Bruder Wowa auf.«
»Nein, zuerst kam noch jemand anderes: Raissa aus Dubowka. Oh, das ist eine tolle Geschichte. Schade, daß du Raissa nicht kennengelernt hast, also die hatte vielleicht ein Mundwerk. Raissa kannte ich noch aus der Pskower Besatzungszone. Sie war die Tochter des Dubowkaer Ortssowjetvorsitzenden gewesen, mein Vater hat ihr einmal das Leben gerettet. Danach floh sie hinter die Front, ins unbesetzte Rußland, schlug sich mühsam durch und landete im Knast. Direkt von dort, nach ihrer Entlassung, kam sie zu mir: kahlgeschoren, Wollmütze auf dem Kopf, ohne Gepäck. Nur ein Bündel hatte sie bei sich, einen Gegenstand, den sie in Zeitungspapier gewickelt unter dem Arm trug. ›Ljusik, Täubchen, hilf mir, damit das Werk von deinem Papa nicht umsonst gewesen ist …‹ Sie meinte die Lebensrettung. Na ja, da konnte ich sie schlecht wegschicken, aber schwierig war es. Rachel, die Frau aus Mogiljow, hatte irgendwelche Verbindungen zu Marktleuten gehabt oder wurde in Naturalien bezahlt, jedenfalls gab es, solang sie da war, meistens genug zu essen. Aber ohne sie … Du weißt ja, das Jahr sechsundvierzig ... Für ein halbes Kilo Grütze standen wir einen Tag Schlange. Immerhin bekam ich Lebensmittelkarten, die versuchten wir zu teilen, aber für Raissa war’s nicht genug, sie war einen Kopf größer als ich und kräftig gebaut, und sie hatte seit Jahren gehungert, sie war einfach rasend. Also eines Abends – halt, ich muß noch erzählen, daß auch ich gerade geschoren worden war, weil ich hartnäckige Läuse hatte, und so saßen wir einander gegenüber, zwei kahle Frauen mit Mützen auf dem Kopf, und schoben Kohldampf, und Jurik schrie. Also, an diesem Abend steht sie plötzlich auf und sagt mit schmerzerfüllter Stimme: ›Ich gehe jetzt zum ›Europa‹!‹ Du weißt schon, wo die Nutten stehen. – ›Glaubst du wirklich, daß einer dich so nimmt?‹ – ›Ganz egal, irgendwas muß ich versuchen, ich halt’s nicht aus!‹ Sie geht und bleibt tatsächlich die Nacht fort. Am nächsten Mittag kehrt sie zurück und sagt atemlos: ›Stell dir vor, ich bin so gut wie verheiratet.‹ Ich falle ihr um den Hals und gratuliere, will sie fragen, ob er ihr nicht die Mütze abgenommen hat, aber da muß ich weinen. Sie erzählt: ›Er dient bei der Armee. Heute abend fährt er mit mir nach Tallinn, und dann nach Kaliningrad, wo er in besonderen Angelegenheiten stationiert ist, irgendwas mit Bernstein. In Tallinn wollen wir uns registrieren. Er hat gesagt, ich soll meine Sachen packen und mit meinen Leuten um acht zum Bahnhof kommen.‹ Dann setzt sie sich hin und weint ebenfalls. ›Aber ich habe doch weder Sachen noch Leute!‹ – ›Und das Bündel?‹ – ›Ach, das war doch nur eine einzelne Galosche.‹ – ›Wie, du schleppst eine einzelne Galosche mit dir rum?‹ – Sie weint noch stärker. ›Ja, was anderes hatte ich doch nicht mehr!‹ Also, ich machte mich sofort auf die Socken und trommelte eine echte Großfamilie zusammen, und am Abend begleiteten wir Raissa zum Bahnhof, küßten sie ab, umarmten den Bräutigam, sangen Lieder, ließen eine Flasche kreisen und bemerkten dann angeblich entsetzt, daß in dem Trubel ihre Koffer gestohlen worden seien. Er – Tigran hieß er – war da schon zu sehr in Stimmung, um Verdacht zu schöpfen, kurzum, er nahm sie mit. Übrigens war er Armenier, vierzig Jahre alt, sehr edel. Zwei Jahre später schickte sie mir eine Postkarte aus Eriwan, in der nur von Auberginen und Hammelfleisch die Rede war.«
»Und dann kam dein Bruder Wowa.«
»Genau. Während der ganzen Zeit war natürlich auch Jurik da.«
»Und dann hattest du Ruhe?«
»Fast. Nur einmal noch wohnte für vier Wochen eine Chinesin bei mir, ebenfalls ein Flüchtling. Aber das war schon ein Jahr später. Sie war nicht eingewiesen, nur zu Gast. Unser Nachbar Adam hatte ihr eine Unterkunft versprochen, aber in sein Zimmer wollte sie nicht. Bei ihr war das Problem folgendes: Sie war die Tochter eines Russen, im Grenzgebiet geboren, und sprach einigermaßen Russisch, konnte es aber nicht lesen. Deswegen fuhr sie nie Metro. Sie hätte sich verirrt. Sie suchte ihren Vater, der angeblich Leningrader war. Am Anfang begleitete ich sie immer zu den Behörden, aber dann mußte ich ja selbst wieder zur Arbeit, und von da an machte sie alles zu Fuß. Abends lag sie stöhnend mit geschwollenen Füßen auf dem Bett und schimpfte auf die kyrillischen Buchstaben. Schließlich ging sie gar nicht mehr aus. Sie legte nasse Lappen auf den Boden, um die Luft anzufeuchten, und kochte. Ich kaufte ein, sie kochte. Chinesisch.«
»Da gab es keine komplizierten Regeln?«
»Ich war in der Küche nicht zugelassen. Aber es war lecker. Wichtig ist, man darf mit denen nicht diskutieren. Zum Beispiel zerreißen sie die Kohlblätter mit den Fingern, anstatt sie mit dem Messer zu schneiden, weil sie überzeugt sind, daß es so besser schmeckt.«
»Hat sie ihren Vater schließlich gefunden?«
»Natürlich nicht. Wie sollte sie, vom Bett aus?«
»Und wie endete die Geschichte?«
»Mein Nachbar Adam hat sie rausgeschmissen, als ich nicht da war.«
Bojarow hat die ganze Zeit ungläubig vor sich hin gelacht und sein schönes Haupt geschüttelt.
Ljusja strahlt. »Und jetzt sag selbst, Damir: Bin ich nicht ein unglaublicher Glückspilz?«
14
Bojarow hat, weil er oft auswärts ißt, gute Beziehungen zur Gastronomiebranche. Und weil er es nicht mag, wenn Ljusja zu Zeiten, da er sie treffen möchte, nach Lebensmitteln Schlange steht, vermittelt er ihr eine neue Arbeit in einem kleinen, soliden Restaurant. Von dort trägt sie wie alle ihre Kollegen Essen nach Hause.
Eigentlich ist sie als Kontrolleurin angestellt. Sie sitzt auf einem Hocker in einem engen, gekachelten Flur zwischen Eßsaal und Küche und notiert die Speisen, die bestellt und hinausgetragen werden, damit alles seine Ordnung hat. Die Lehrzeit ist kurz. Eingewiesen wird Ljusja von ihrem Vorgänger, der zum Oberkellner befördert wurde. Schon nach einer Woche führt sie zwei Bücher: außer dem großen Registrierbuch, das aufgeschlagen auf einem roten Tischchen liegt und dazu dient, daß nichts gestohlen wird, eine geheime Kladde, in der vermerkt wird, was jeder stiehlt. Der Sinn der Kladde ist, daß demokratisch und angemessen gestohlen wird. Ein spezieller, besonders liebevoll erklärter Notationsschlüssel verhindert dabei, daß die Demokratie zu weit geht: Die wichtigen Leute bekommen mehr. Und alle geben einen Teil ihrer Beute an Ljusja ab.
Für Ljusja, die in der Kugellagerfabrik unter der Obhut von Antonina Romanowna gelernt hat, daß man seriös arbeiten oder es zumindest versuchen soll, auch wenn man es nicht kann, sind das hochinteressante Erfahrungen. Staunend berichtet sie alles Bojarow. Zum Beispiel von der ersten gesundheitsärztlichen Kontrolle, deren Termin aus irgendeinem Grund schon vorher bekannt war. Herd, Lagerraum und Auslage wurden zu diesem Anlaß gründlich geputzt und aufgeräumt. Die Kontrolleurin, eine blonde schmuckbehängte Dame, betrat die Küche wie ein Feldherr und erschauerte kurz darauf, sich die Nase haltend, wie eine Prinzessin. Ein blasser Gehilfe mit zarten Öhrchen und Lippen, die so weich waren, daß sie sich bei jeder Silbe verformten, hauchte: »Ja, Genossin – ja ... ja ...« und schrieb alle Anmerkungen in ein Notizbuch. Die Blonde fuhr mit dem Finger in die Suppe, leckte: Grimasse. Sie biß in ein Kotelett: Abscheu. Sie zog ein Salatblatt aus der Schüssel, über das eine schleimige Spur lief, und diktierte mit plötzlich erhobener, furchterregender Stimme: »Schnecken!« Die Belegschaft stand stramm. Ljusja war den Tränen nahe. Was würde passieren, wenn der Laden dicht machte? Würde Antonina Romanowna sie noch einmal nehmen?
Die Kontrolle war beendet. Die Blonde und das Zartohr waren mit grimmigem Nicken dem Chef in sein Kabinett gefolgt, die anderen nahmen ihre Arbeit wieder auf. Ljusja arbeitete so korrekt wie nie. Sie schickte sogar die Kollegin Tonja zurück, die auf eine Bestellung zwei Portionen Braten hinaustragen wollte. »He, du hast sie wohl nicht alle?« beschwerte sich Tonja. Kurz darauf überreichte der Administrator Janytsch Ljusja drei gut verschnürte Pakete und zeigte mit seiner Zigarette aufs Chefbüro: »Hinbringen. Vorher klopfen.«
Im Chefbüro aber saß in entspannter Haltung die Blonde und trank Kaffee aus einer kleinen dicken Tasse. Der Gehilfe nahm selbstvergessen lächelnd von einem übervollen Teller Konfekt. Als der Chef einen Witz erzählte, lachten alle drei im gleichen Tonfall.
»Ich habe natürlich nicht lockergelassen, bis ich das Gutachten der Hygienekommission zu lesen bekam«, prahlt Ljusja gegenüber Bojarow.
»Ich glaube es.«
»Errätst du, was drin stand?«
»Ich nehme an, alles in Ordnung.«
»Nicht nur das. Phänomenal. Musterbetrieb. Beispielhaftes Kollektiv. Erstklassige Hygiene. Gastronomische Spitzenqualität. Vorzügliche sozialistische Leistung. Prämierungswürdig.«
15
»Na, wie weit bist du?« fragt Rita beiläufig.
»Womit?«
»Du willst doch den Literaten von seiner Familie loshebeln, oder?«
»Na hör mal! Er beachtet doch die Etikette!«
»Liebe ist stärker als Etikette, wenn du’s richtig anfängst.«
Aber da läßt Ljusja nicht mit sich reden, nein, diesen Gedanken weist sie ziemlich weit von sich.
Sie ist nämlich zu einer erstaunlichen Einsicht gekommen: Selbst wenn Bojarow morgen verschwände, müßte sie ihm ewig dankbar sein. Er hat ihr, außer der Liebe, sozusagen das Leben neu eröffnet. Dadurch, daß er sich für ihre Erlebnisse interessierte, gab er ihnen Wert. Ljusja selbst hatte das meiste eher als störend empfunden, als lästiges Provisorium, mit dem man sich nebenbei plagt, während das Eigentliche noch bevorsteht.
Aber das unvollkommene Leben ist schon das Eigentliche! Denn es vergeht, und für Vergangenes gibt es keinen Ersatz. Man muß die Bedeutung des Augenblicks im Augenblick selbst erkennen; wenn man das kann, offenbaren sich – Schätze. So hat das Ljusja verstanden. Das Leben ist ein Wunder. Sie selbst, Ljusja, ist ein Wunder. Sogar das lästige kommunale Wohnen scheint plötzlich herrlich und spannend. Gelegentliche Reibereien zählen nicht. Ljusja ist überzeugt, alle mögen sie und freuen sich an ihrem Glück.
16
Das Glück sieht so aus.
Von ihrem Fenster im dritten Stock des Pionierstraßen-Mietshauses aus blickt sie auf eine Backsteinbrandmauer. Im Winter fällt kein Sonnenstrahl darauf, aber im Frühling und Herbst erkennt Ljusja auf der Mauer morgens die Schatten der Tauben, die über den First des eigenen Hauses spazieren. Sie lacht, wenn sie im Schattenspiel das Balzen der Tauber erkennt und kurze Zweikämpfe, bei denen plötzlich Federn durch die Luft wirbeln und als schwarze Flocken auf die aufgeregten Vögel niedersinken. Der helle Tag vervielfältigt die Wunder der Natur und wirft ihre Zeichen sogar in dieses dunkle, kleine Zimmer.
Im Juni beginnen, so schön und klar wie nie, die weißen Nächte. Jetzt scheint an den Nachmittagen die Sonne direkt in Ljusjas Zimmerchen, dessen Wände im Licht erglühen wie die Mauern eines kristallenen Palasts. Auch die Mitbewohner genießen den Sommer. Alle bleiben lange auf, die Kinder sind immer auf der Straße, die Erwachsenen gehen unvermittelt noch am Abend aus und spazieren andächtig an den Uferstraßen entlang, auf den Gesichtern den Widerschein des durchsichtigen, orangefarbenen Himmels.
In der Kommunalka wohnen außer Ljusja in vier weiteren Zimmern vier Parteien. Das erste und größte Zimmer, direkt neben der Küche, gehört der Familie Bogdanow. Der alte Bogdanow ist dick und bewegt sich schwankend, weil ihm im Krieg die Zehen erfroren sind. Früher war er ein schöner Mann und hat angeblich alle Frauen des Viertels beglückt. Eine von ihnen heiratete er, und sie gebar ihm vier Kinder. Aber während der Blockade, als die Stadt hungerte, aß sie selbst alles Brot, das es für die Lebensmittelkarten gab, und die Kinder starben. Dann kehrte Bogdanow aus dem Krieg zurück. Er wollte seine Frau umbringen, aber da er schlecht laufen konnte, entkam sie. Er heiratete wieder, eine ergebene junge Frau, die im Krieg zwei Bräutigame verloren hatte, und wurde Vater von zwei Söhnen, den Zwillingen Kolja und Tolja. Kolja und Tolja sind inzwischen fünf und äußerst albern. Sie folgen ihrem Vater, der dem Alter nach ihr Großvater sein könnte, auf Schritt und Tritt und weiden sich an dem Effekt, den er macht. Läuft er die Straße entlang, tuscheln die Frauen, vielleicht im Gedenken alter Tage: »Da geht Bogdanow«, und die Zwillinge geben das Echo: »Bogdanow geht, seht, da geht Bogdanow!« Die jungen Männer machen sich über Bogdanow lustig. »Seht, da geht ein Samowar!« sagte einer letzte Woche, auf Bogdanows dicken Bauch anspielend, und Bogdanow antwortete mit dem ihm eigenen Humor, der, wie nicht anders zu erwarten, der eines alten Schweines ist: »Und wenn ich jetzt mein Kränchen öffne, wirst du trinken?« Die Zwillinge hüpfen vor Vergnügen und künden von dieser brillanten Parade lauthals im ganzen Block.