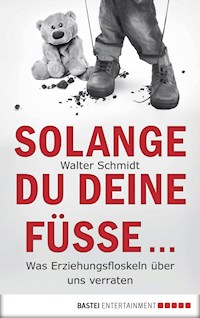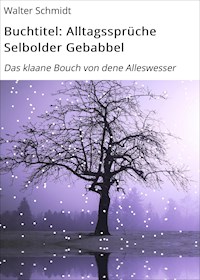7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Eine heitere Einführung in die Psychosomatik
- Entlarvend und überraschend: Dieses Buch bringt uns dazu, den eigenen Körper mit anderen Augen zu sehen
- Amüsant und mit einem Augenzwinkern geschrieben, von medizinischen Fachleuten geprüft und für gut befunden
- Ein gewinnbringendes und lesenswertes Buch und ein wunderbares Geschenk für die beste Freundin
Er hat nicht Medizin studiert, plappert munter drauf los, haut manchmal daneben, liegt aber erstaunlich oft richtig: der Volksmund. Tag für Tag wagt er Urteile, die Ärzte erst nach gründlicher Untersuchung fällen würden.
Klar ist: Wird die Seele missachtet, leidet der Körper. Darüber legt die Alltagssprache seit vielen hundert Jahren beredtes Zeugnis ab: Wenn uns etwas unter die Haut oder an die Nieren geht, die Sprache verschlägt oder uns das Herz in die Hose rutscht – hinter solchen Metaphern verbergen sich erstaunlich oft physiologische Vorgänge.
Wo der Volksmund Recht hat und wo er irrt, das ergründet Walter Schmidt in seinem unterhaltsamen Buch am Beispiel zahlreicher Redensarten. Dass die Wahrheit meist irgendwo dazwischen liegt, macht es umso spannender, sich ihr zu nähern. Und werden Redensarten über Körper und Seele mal ganz wörtlich genommen, kommt etwas völlig Unerwartetes zum Vorschein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Ähnliche
Buch
Er hat nicht Medizin studiert, plappert munter drauf los, haut manchmal daneben, liegt aber erstaunlich oft richtig: der Volksmund. Tag für Tag wagt er Urteile, die Ärzte erst nach gründlicher Untersuchung fällen würden. Klar ist: Wird die Seele missachtet, leidet der Körper. Darüber legt die Alltagssprache seit Jahr und Tag beredtes Zeugnis ab: Wenn uns etwas unter die Haut oder an die Nieren geht, die Sprache verschlägt oder uns das Herz in die Hose rutscht – hinter solchen Metaphern verbergen sich erstaunlich oft physiologische Vorgänge.
Wo der Volksmund recht hat und wo er irrt, das ergründet Walter Schmidt in seinem unterhaltsamen Buch »Dicker Hals und kalte Füße« am Beispiel zahlreicher Redensarten – unterstützt von etlichen, eigens befragten Medizinern, Psychologen und anderen Fachleuten.
Autor
Walter Schmidt, geboren 1965 in Saarbrücken, hat Physische Geographie in Saarbrücken und Vancouver (Kanada ) studiert; danach Ausbildung an der Hamburger Henri-Nannen-Journalistenschule; 1994/95: Umweltredakteur beim Heinrich-Bauer-Verlag in Hamburg. 1998 veröffentlichte er die Erzählung »Die kalten Füße der Frauen«; 1996 bis 1999 Pressesprecher des Umweltverbandes BUND in Bonn; dort lebt und arbeitet er seit Ende 1999 als freier Journalist, Autor und Schreibtrainer. 2012 erschien von ihm das Sachbuch »Morgenstund ist ungesund. Unsere Sprichwörter auf dem Prüfstand«. Sein Buch »Dicker Hals und kalte Füße« wurde im Mai 2012 mit dem Publizistik-Preis der Stiftung Gesundheit, Hamburg, ausgezeichnet.
Der Autor im Netz: www.schmidt-walter.de.
Für Amelie, mein Tochterherz
Inhaltsverzeichnis
»Immer wenn ich diesen Quatsch mit der Psychosomatik höre, dreht sich mir der Magen um ...«
(ein Arzt auf einem Mediziner-Kongress zu seinem Kollegen)1
Vorsprechen bei Doktor Volksmund
Er hat keine Medizin studiert, plappert munter drauf los, haut manchmal daneben, liegt aber erstaunlich oft richtig: Der Volksmund wagt sich Tag für Tag an Diagnosen, die Ärzte allenfalls nach gründlicher Untersuchung fällen würden: Da läuft die Galle über, zerreißt ein Herz, stockt das Blut in den Adern und macht sich ein garstiger Kloß im Magen breit, obwohl man gar keinen gegessen hat.
Viele dieser Redensarten sind seit Generationen gebräuchlich – einige seit dem Mittelalter. So manche Wendung ist allerdings wissenschaftlich überholt, hatte nie einen medizinischen Hintersinn oder diente seit jeher bloß dazu, Gefühle anschaulich zu umschreiben. Vorgänge im Körper, die den Sprachbildern entsprechen, sind zwar häufig zu finden, aber längst nicht immer.
Hat zum Beispiel jemand ein Brett vorm Kopf, dann ist nicht etwa seine Sicht vernagelt. Der seltsame Ausdruck stammt vermutlich aus althergebrachter Viehwirtschaft. »Störrischen Ochsen wurde früher ein Brett vor die Augen gehängt, um ihr Blickfeld einzuengen«, findet sich als Erklärung im »Lexikon der Redensarten« 2. Und Zugochsen gelten nun mal – zu Recht oder Unrecht – als eher dumpfe Tiere.
Andere Körperbilder haben technische Vorgänge zum Vorbild. So leitet sich das Ansinnen, endlich einmal Dampf abzulassen , offensichtlich von der Dampfmaschine her. Dahinter steckt der Wunsch, inneren Druck loswerden, mithin angestaute Handlungsenergie, die sich in Taten austoben will.
Körper-Sprachbilder des Volksmundes dürfen also nicht wörtlich genommen werden; schon gar nicht beweisen sie die nahegelegten seelisch-physiologischen Zusammenhänge. Keineswegs etwa gefriert uns das Blut in den Adern, wenn wir erschrecken. Hier entlehnt der Volksmund ein Bild aus der Natur und vergleicht die Schockstarre des Körpers mit dem Zufrieren eines Flusses. Aber stocken kann das Blut eines Geängstigten sehr wohl in den Gefäßen, wie noch zu sehen sein wird.
Wird die Seele missachtet, leidet der Körper
Werden lustvolle oder aggressive Handlungsimpulse ständig unterdrückt und die Seele folglich ausgebremst, kann das den Körper erkranken oder zumindest schmerzen lassen. Je nach Studie leiden etwa 10 bis 15 Prozent der Bundesbürger, also etwa jeder achte, an Gesundheitsstörungen, für welche Mediziner keine körperliche Ursache finden. Das ist schon deshalb unbefriedigend, weil jeder dritte oder vierte Besucher einer Arztpraxis über solche unklaren, vermutlich seelisch verursachten oder zumindest beeinflussten Störungen seiner Körperfunktionen klagt.
Fachleute nennen diese Erscheinungen psychosomatisch – die Seele (Psyche) und den Körper (Soma) betreffend. Dazu kommt es, »wenn sich ein innerer Konflikt in einen körperlichen Ausdruck verwandelt und sich sozusagen in dem Symptom symbolisch zeigt«, sagt Kurt Fritzsche, Oberarzt an der Freiburger Uni-Klinik für psychosomatische Medizin. Ein simples, aber sehr verbreitetes Beispiel hierfür ist stressbedingter Rückenschmerz.
Noch immer drohen Menschen, deren Körper – und dies nicht selten chronisch – unter seelischen Konflikten leidet, als Simulanten gebrandmarkt zu werden. Ihre Beschwerden mögen erst einmal rätselhaft wirken, aber sie zwicken, piesacken oder quälen die Betroffenen in aller Regel wirklich. »Psychosomatische Störungen sind keine eingebildeten, sondern reale Erkrankungen mit vielen, zum Teil gravierenden Beschwerden, die ernst zu nehmen sind«, urteilt der Internist und Psychotherapeut Burghard Klapp, Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik der Charité in Berlin.3
Körper-Seele-Reaktionen sind seit jeher derart typisch für die Menschennatur, dass die Alltagsprache seit Jahrhunderten beredtes Zeugnis davon ablegt. Allerdings würden Wendungen wie ehrliche Haut, geknickter Mensch oder starrsinniger Kerl »selten reflektiert«, urteilt die Germanistin und Kulturwissenschaftlerin Claudia Benthien von der Universität Hamburg.5 Dabei wussten Gelehrte schon in der Antike, wie eng die Seele und der Körper zusammengehören und dass Wohlbefinden nur möglich ist, solange beide im Einklang miteinander sind. Nur die moderne Apparatemedizin tut noch häufig so, als gelte dies nicht, und schraubt einseitig am Körper herum.
Dieses Buch ergründet anhand vieler Beispiele, wo der Volksmund recht hat – und wo er irrt. Dass die Wahrheit meist irgendwo dazwischen liegt, macht es nicht weniger spannend, sich ihr zu nähern. Dabei werden Redensarten über Körper und Seele auch mal ganz wörtlich genommen, sodass – hoffentlich – Unerwartetes zur Sprache kommt. Die einzelnen Haupt- und Unterkapitel müssen nicht in der angebotenen Reihenfolge gelesen werden: Springen Sie ruhig dorthinein, wohin Ihr größtes Interesse Sie zunächst verlockt.
Dank
Etliche Mediziner, Forscher und Psychologen haben mir bei diesem Buch geholfen und geduldig immer wieder Nachfragen beantwortet – darunter durchaus sonderbare, zumindest aus Sicht der Befragten. Schade, dass ich das Stirnrunzeln und die skeptischen Blicke meiner Gesprächspartner durchs Telefon nicht sehen konnte ...
Nicht alle Ärztinnen und Ärzte, die meisten von ihnen in Leitungsfunktion an Universitäts- und Privatkliniken, kann ich hier erwähnen. Aber mit allen, die sich in diesem Buch ohne Quellenangabe finden, habe ich persönlich sprechen oder mich schriftlich austauschen dürfen – darunter sogar der Veterinär der Stuttgarter Wilhelma, der mir von den überraschenden Eigenschaften der Elefantenhaut berichtet hat. Ihnen allen sei von Herzen gedankt!
Einige besonders beanspruchte Fachleute möchte ich namentlich erwähnen, und zwar mit ihrem für mich wichtigsten Zuständigkeitsbereich: Ich danke also sehr herzlich Uwe Gieler (Hautmedizin), Wolf-Jürgen Maurer (Psychosomatik), Hedwig Josefine Kaiser (Augenheilkunde), Georg Titscher (Psychokardiologie), Robert Perneczky (Demenzforschung), Manfred Stelzig (Psychosomatik), Walter H. Hörl (Nierenheilkunde), und Gerald Hüther (Neurobiologie). Dasselbe gilt für Helmut Schatz (Diabetologie), Roland Laszig (HNO-Medizin), Jochen Jordan (Psychokardiologie), Gabriele Moser (Gastroenterologie), Dirk Eichelberg (Haut- und Haarmedizin), Roland Reinehr (Gastroenterologie), Hartmut Göbel (Schmerzkunde) und Ludwig Thierfelder (Augen und Psyche). Zu Dank verpflichtet bin ich auch Klaus-Michael Taube (Hautmedizin), Thomas Hummel (Riechen und Schmecken), Wolfgang Harth (Hautmedizin), Christian Peschel (Hämatologie), Roland von Känel (Psychosomatik /Innere Medizin), Claus-Martin Muth (Anästhesie), Emeran Mayer (Gastroenterologie), Christian Schyma (Rechtsmedizin) und Ludger Tebartz van Elst (Neuropsychiatrie). Ohne diese hilfsbereiten Fachleute wäre mein Buch niemals entstanden.
Ganz besonders danke ich dem Arzt und Neurobiologen Joachim Bauer von der Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Uni-Klinik Freiburg. Er hat sich – neben anderem – die Mühe gemacht, das Manuskript kurz vor dessen Abschluss gegenzulesen, wofür ich ihm sehr verbunden bin.
Walter Schmidt Bonn, im Herbst 2010
Kein zweites Organ unseres Körpers erscheint uns so lebenswichtig wie unser Herz. Dabei wären wir auch ohne Leber, Magen oder Nieren verloren – nur nicht ganz so schlagartig. Zudem endet unser Leben genau genommen mit dem Tod des Hirns, nicht mit der letzten Regung jenes Hohlmuskels, der zeitlebens im linken Brustkasten pocht. Wer 75 Jahre alt geworden ist und durchschnittlich einen Puls von 85 hatte, dessen Pumpe hat sich bis zum letzten Herzschlag über drei Milliarden Mal zusammengezogen und wieder entspannt, und das in der Regel wartungsfrei – ein Wunderwerk.
Mit keinem anderen Organ verbinden wir obendrein derart viele Gefühle wie mit dem Herzen. Es teilt sämtliche Freude und Trauer, alles Glück und alles Ungemach mit uns. Die Sprache weiß darüber mehr als mancher Arzt.
Wenn im Körper irgendwo die Liebe und die Freude sitzen, dann im Herzen – zumindest sprachlich. Haben wir ein Ohr für die Nöte unserer Mitmenschen und helfen ihnen aus vollem Herzen, dann verfügen wir über ein großes Herz. Solche Barmherzigkeit (althochdeutsch: armherzi; ein Herz für die Armen) gilt unter Christen zu Recht als Tugend. Uns lacht das Herz, wenn wir uns glücklich fühlen. Verliebt sich ein Mensch schon nach wenigen Augenblicken in uns, dann haben wir sein Herz im Sturm erobert. Und wird aus dieser Liebelei sogar Liebe, sind die beiden Beteiligten hoffentlich auf dem besten Weg, ein Herz und eine Seele zu werden.
Wen wir sehr mögen, den haben wir ins Herz geschlossen – wohl der einzige angenehme Kerker. Als BILD 1978 die Aktion »Ein Herz für Kinder« startete – eine Idee des Verlegers Axel Springer –, wollte das Boulevard-Blatt nicht zur Organspende aufrufen, sondern appellierte an die Mitmenschlichkeit der Autofahrer. Denn seinerzeit töteten diese jährlich ungewollt etwa 1.500 Kinder im Straßenverkehr.
Wissen wir nicht recht, ob wir uns einem Menschen hingeben sollten, dann rät man uns: »Hör auf dein Herz!« Gesteht uns ein Mensch seine Liebe, wird es uns ganz warm ums Herz – vorausgesetzt, wir erwidern die Zuneigung und haben den anderen herzlich gerne. Dann lieben wir es auch, ihn oder sie zu herzen. Denn unser Herz fliegt dem geliebten Menschen zu, und selbst ein dürres Witzchen, das dieser zum Besten gibt, finden wir herzerfrischend. Obendrein bemühen wir uns, für unsere Herzallerliebste alles zu tun, was ihr Herz begehrt – wenigstens eine Zeit lang. Schließlich bringen wir sogar das Kunststück fertig, dem geliebten Menschen unser Herz zu schenken, obwohl wir ihn oder sie noch immer im Herzen tragen – das soll ein Unverliebter uns mal nachmachen.
Werden wir selbst hingegen zurückgewiesen, zerreißt es uns das Herz, was auch kein Wunder ist, war die oder der Geliebte uns doch fest ans Herz gewachsen. Dann klagen wir guten Freunden unser Herzeleid – einen Schmerz, vor dem sich Liebende bewahren sollten. Und wenn es ganz übel kommt, leidet jemand an einem gebrochenen Herzen – oder stirbt bisweilen tatsächlich daran.
Der muskulöse Umschlagplatz für unser Blut steht jedoch auch für unerotische Liebe und Freundlichkeit. Spricht eine Frau aus, was sie denkt, ist sie offenherzig und macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Bei anderen Menschen hilft manchmal die Aufforderung »Jetzt mal Hand aufs Herz!«, um auch die bislang verschwiegenen Teile einer Geschichte zu hören.
Halten uns Freunde den Spiegel vor und konfrontieren uns mit unbequemen Wahrheiten (oder was sie gerade dafür halten), dann schicken sie ihren Schilderungen nicht selten den doppelbödigen Rat hinterher, uns das jetzt aber wirklich mal zu Herzen zu nehmen.
Manchmal führen die freundlichen Empfehlungen leider in die Irre und bereiten uns Kummer. Dann können wir einem hoffentlich Vertrauten unser Herz ausschütten. Was nicht wieder gutzumachen ist, bedauern wir aus tiefstem Herzen. Eine gütige Frau ist herzensgut oder ein Herz von Mensch, und darf sie sich außerdem noch ehrlich, gewissenhaft und aufrichtig nennen, regt sich in ihr ein reines Herz. Wer ohne Arg ist, dem ist auch Treuherzigkeit eigen. Fehlt jemandem hingegen sämtliches Mitgefühl, ist er ein herzloser Geselle. Es dürfte dann wenig geben, was so ein Mensch nicht übers Herz bringt. Wie man sieht, ist das Herz in aller Munde.
Mein Herz ist so eng
Dass sich Herz auf Schmerz so gut reimt wie auf kaum ein anderes Wort, ist purer Zufall – aus psychosomatischer Sicht jedoch fügt es sich trefflich. Wenn sich das Herz oder der linke Brustbereich schlagartig eng anfühlt und sehr wehtut, lässt dies an eine Angina pectoris (»Brustenge«) denken. Das als Herzattacke auftretende Leiden vermittelt einem Betroffenen das beklemmende Gefühl, der Brustkasten werde plötzlich und brutal zusammengedrückt. Ursache ist eine Störung des Blutflusses in einem Herzkranzgefäß. Meist geht dieser Blutstau mit größter Unruhe und typischer Herzangst einher.
Aber auch Geängstigte, deren Herz gesund ist, fühlen sich oft beklommen oder eingeschnürt in der Brust. »Angst macht eng«, sagt Georg Titscher, Oberarzt am Wiener Hanusch-Krankenhaus, der als Kardiologe und Psychotherapeut ein Spezialist für Herz und Seele ist. »Enge und Angst haben nicht umsonst denselben Wortstamm, haben aber auch symbolisch viel miteinander zu tun, denn es gibt nichts Einengenderes als Angst.« Denn wenn wir uns fürchten, schütten Drüsen im Körper vermehrt Stresshormone ins Blut aus, um unsere Muskeln besonders kampf- oder fluchtbereit zu machen – nicht umsonst stammt der Begriff Stress vom lateinischen Verb »stringere« für anspannen. Eine stärker als üblich gespannte Muskulatur fühlen wir bei Angst an vielen Stellen im Körper, ob an den Waden oder im Rücken.
So auch im Brustkorb. Dort sorgen die Atemmuskeln (Rippen-, Zwerchfell- und Brustmuskulatur) normalerweise dafür, dass sich der Brustkasten unbeschwert heben und die Verdauungsorgane nach unten ausweichen können. Da die Lunge über das Lungenfell am Brustfell sozusagen festklebt, folgt sie diesen Bewegungen des Brustkorbs, indem sie sich im Wechsel füllt und wieder leert – zumindest bis auf einen stets dort verbleibenden Rest von etwa 1,5 Litern Luft.
Eine verspannte Atemmuskulatur erschwert das Luftholen allerdings, der Atem wird flacher – eine Schrecksekunde lang halten wir den Atem mitunter sogar an. Oft sind das auch jene Momente, in denen uns das Herz stehen bleibt – was meist zum Glück nicht stimmt: Doch stolpern kann es schon, indem ein Schlag ausfällt und der Herzrhythmus für kurze Zeit durcheinander gerät.
»Das Engegefühl in der Brust ist die körperliche Folge eines seelischen Vorgangs«, sagt Jochen Jordan, der die Klinik für Psychokardiologie in Bad Nauheim leitet. Betroffen davon ist auch der Blutkreislauf. Das bei Angststress ins Blut ausgeschüttete Adrenalin bewirke zum Beispiel, dass sich herznahe Arterien verengen, damit das Blut schneller fließt. Dazu muss das Herz kräftiger schlagen, so dass der Blutdruck steigt. »Das kann man als Engegefühl spüren, und zwar sehr schnell, innerhalb von einer oder wenigen Sekunden«, fügt der Psychologe hinzu.
Das passiert zum Beispiel, wenn ein Düsenjet unvermittelt dicht übers Haus donnert. Nicht umsonst hat eine Umwelt-Zeitschrift ihren Artikel über Stress durch Fluglärm mit der Zeile »Flugkrach geht aufs Herz« überschrieben.4
Wenn Stress uns das Herz bricht
Manchmal wird die Enge sogar direkt am Herzen sichtbar. Die Stress-Myokardiopathie, das sogenannte Syndrom des gebrochenen Herzens, ist erst Ende des 20. Jahrhunderts wissenschaftlich beschrieben worden, zunächst in Japan, wo das Phänomen Tako-Tsubo-Syndrom heißt.
Es fühlt sich an, als ob einem irgendetwas das Herz abdrückt. »Auf Röntgenbildern kann man sehen, dass sich der ganze Herzmuskel verkrampft und sich im oberen Teil wie durch einen umgeschnallten Gürtel einschnürt«, sagt der Psychokardiologe Jordan. Der Herzkrampf gehe allein auf große Mengen ausgeschütteten Adrenalins zurück, etwa infolge »plötzlicher massiver oder anhaltend erheblicher Belastung der Seele«.
Will man das Märchen der Gebrüder Grimm vom Froschkönig und dem Eisernen Heinrich medizinisch deuten, wäre die Stress-Myokardiopathie ein heißer Favorit auf die plausibelste Erklärung. In der Geschichte wird der verwunschene Königssohn von einer Prinzessin aus seinem glitschigen Dasein ausgerechnet dadurch befreit, dass sie den Frosch angewidert gegen die Zimmerwand schmeißt.
Anschließend werden Prinz und Prinzessin – plötzlich beiderseits voneinander angetan – von Heinrich, dem Diener des Königssohns, in einer Kutsche ins väterliche Reich gefahren. Der treue Helfer freut sich derart über die Erlösung seines Dienstherrn, dass ihm unterwegs förmlich das Herz aufgeht – und wie: Krachend zerspringen nämlich jene drei eisernen Bande, die er sich aus Trauer um seine Pumpe hatte schmieden lassen, als der Prinz zum Frosch geworden war.
Das Froschkönig-Märchen hat bloß einen Schönheitsfehler. Die Krankheit betrifft in neun von zehn Fällen Frauen – und das meist im höheren Alter. »Mehr als 90 Prozent aller Patientinnen sind über 60 Jahre alt«, befindet der mit dem Leiden seit Jahren immer wieder befasste Psychokardiologe Rainer Schubmann von der kardiologischen Abteilung der Dr.-Becker-Klinik-Möhnesee. 5 Eine betagte »treue Henriette« wäre also realistischer gewesen.
Nicht nur Kummer, auch panische Angst kann das Herz einschnüren. Japanische Wissenschaftler um Hiroshi Watanabe haben ermittelt, dass schockierende Ereignisse bei deutlich mehr Menschen Herzbruch-Attacken auslösen können als zu normalen Zeiten üblich. Dazu untersuchten die Forscher die medizinischen Folgen dreier Erdbeben sowie von etwa 90 schweren Nachbeben, die sich am 23. Oktober 2004 beziehungsweise in den sieben Tagen danach in der zentraljapanischen Präfektur Niigata ereignet hatten.6 Die Erdstöße erreichten in der Spitze die Stärke 6,8 auf der Richterskala; nach Angaben des Auswärtigen Amtes starben dabei 35 Menschen, hinzu kamen einige Tausend Verletzte.
Was aber passiert mit dem Herzen, wenn Menschen sich erschrecken? Nach einem schwerwiegenden psychischen Schock machen die Betroffenen »so etwas Ähnliches wie einen Herzinfarkt durch«, sagt der Kardiologe Georg Titscher. »Von den Anzeichen her und beim EKG ist das Syndrom nicht vom Infarkt zu unterscheiden, nur wenn man dann die Herzkranzgefäße röntgt, sieht man, dass diese ganz normal sind.« In knapp zehn Prozent der Fälle treten in den ersten Stunden lebensbedrohliche Komplikationen auf – so etwa Herzkammerflimmern oder ein kardiogener Schock, bei dem die haarfeinen Kapillargefäße des Herzmuskels verengt und die Sauerstoffzufuhr beträchtlich vermindert sind. Nach einer überstandenen Akutphase erholen sich die Patientinnen jedoch meist rasch; die Sterblichkeit liegt mehreren Studien zufolge nur bei ein bis drei Prozent, wobei natürlich nur korrekt diagnostizierte Fälle zu Buche geschlagen sind.
Dass die allermeisten Patientinnen den Herzanfall gut überstehen, zeigte sich auch in einer 2005 veröffentlichten Studie an der Johns Hopkins University in Baltimore, USA. Dort hatten Mediziner um den Kardiologen Ilan Wittstein 19 verzeichnete Fälle von Stress-Myokardiopathie (darunter nur ein Mann) intensiv ausgewertet. Zur Überraschung der Forscher hatten sich alle 19 Herzen innerhalb weniger Tage nach der infarktähnlichen Attacke auffallend rasch erholt: Ihre Pumpleistung steigerte sich viel schneller als nach einem Infarkt, und den im Grunde herzgesunden Betroffenen ging es schon zwei Wochen nach ihrem Anfall wieder so gut wie ehedem.7
Obwohl das »Brechen« des Herzens bei allen Patientinnen zunächst auf einen Infarkt hingedeutet hatte, konnte Wittsteins Team bei genauerem Hinsehen doch deutliche Unterschiede in der Symptomatik zwischen beiden Leiden feststellen: Erstens erwiesen sich bei den »zerbrochenen« Herzen die Arterien als durchlässig, mithin nicht verstopft. Zweitens ergaben Bluttests keine Anhaltspunkte dafür, dass der jeweilige Herzmuskel geschädigt war – sonst wären nämlich nach der Attacke spezielle Herzmarker (darunter Enzyme wie Troponin and Kreatinphosphokinase) vermehrt aus dem Herzgewebe ins Blut ausgeschüttet worden. Myoglobin zum Beispiel tritt aus beschädigten Herzmuskelzellen aus und zeigt so an, dass diese abgestorben sind. Solche Schäden sind typisch für einen Infarkt, nicht aber für das Herzbruch-Syndrom.
Dessen wahrscheinliche Ursache ist Georg Titscher zufolge, »dass der Herzmuskel durch den Schock mit Stresshormonen überschüttet wird und kurze Zeit gelähmt ist – und dann reagiert wie bei einem Herzinfarkt«. Besagte Hormone können Adrenalin und Noradrenalin, aber auch andere Katecholamine sein. Die US-Forscher an der Johns Hopkins University konnten ermitteln, dass im Blut der Patientinnen mit Stress-Myokardiopathie zwei- bis dreimal so viele Katecholamine nachweisbar waren wie bei Vergleichspatienten mit einem klassischen Herzinfarkt und sogar bis zu 34-mal so viele wie bei Gesunden – eine wahre Flut biochemisch vermittelten Stresses.
Eine Studie des Londoner Imperial College an Ratten aus dem Jahr 2012 liefert eine völlig andere Erklärung für das zusammengeschnürte Herz. Danach lässt die Adrenalinflut im Blut unsere Pumpe verkrampfen, um nicht übermäßig stimuliert zu werden. Das Stresshormon würde das Herz in diesem Fall also nicht ankurbeln, sondern vorsorglich vorübergehend versagen lassen
Davon unabhängig wagt Jochen Jordan sogar eine kleine Spekulation: »Weshalb soll es in dieser Richtung nicht noch mehr Phänomene geben, leichtere Formen von Herzkrämpfen, die man gar nicht auf dem Röntgenbild sehen könnte.« Beim treuen Heinrich aus dem Märchen hingegen wäre die Aufnahme äußerst eindrucksvoll gewesen.
Das Herz so schwer
Wer etwas auf dem Herzen hat, möchte ihm Luft machen. Entweder drängt es einen solchen Menschen, etwas Belastendes loszuwerden, oder der Betreffende möchte endlich mit einem Herzenswunsch herausrücken in der Hoffnung, dieser werde bald erfüllt. Wenn die Sache gut ausgeht, fällt ihm – oder ihr – scheinbar ein Stein vom Herzen.
Das Phänomen des ach so schweren Herzens ist oft bedichtet und besungen worden, so etwa vom österreichischen Sänger Wolfgang Ambros: »I hob a so a schweres Herz, es kummt ma vor, als wär es aus Beton.«
Nun wiegt ein durchschnittlich großes Herz meist nicht mehr als 350 Gramm. Schon wenn bloß seine 0,75 Liter fassenden Kammern mit Beton ausgefüllt wären, wögen sie bei einem durchschnittlichen Mann deutlich mehr als ein Drittel Kilo, nämlich fünf- bis sechsmal so viel (1,8 Kilogramm). Bei einem gut trainierten Langstreckenläufer oder Radrennfahrer (etwa ein Liter Herzvolumen) brächte die betongefüllte Pumpe sogar rund 2,4 Kilo auf die Waage.
Doch Wolfgang Ambros ist Sänger, kein Materialwissenschaftler – man sehe ihm seine Übertreibung also nach. Und schwer kann sich ein Herz in der Tat auch dann anfühlen, wenn es bloß Blut enthält. Aber wieso?
Hier kommen Gefühle ins Spiel – genauer gesagt: Trauer und Schwermut (!) bis hin zu erheblicher Niedergedrücktheit im Sinne eines ernsten Leidens. »Zwischen Depressionen und Herzleiden besteht ein großer Zusammenhang – beides kann man nicht getrennt sehen«, sagt Georg Titscher. Depressive klagten vor allem über herzbezogene Körperbeschwerden, zum Beispiel ein drückendes Schweregefühl im Brustkorb. Außerdem seien Depressionen »ein unabhängiger Risikofaktor für die koronare Herzkrankheit« – nicht nur das häufigste Herzleiden in westlich geprägten Industrieländern, sondern auch jene Krankheit, welche dort die meisten Menschen dahinrafft.
Entscheidender Wirkfaktor der koronaren Herzkrankheit sind mehr oder minder verstopfte (»verkalkte«) Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel nicht mehr ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgen können. Auch geht dieses Herzleiden über Jahre hinweg mit einem deutlich zu hohen Blutdruck einher. Zudem schlägt das Herz häufig etwas schneller als bei Gesunden. Schuld daran ist der Sympathikotonus – salopp gesagt: ein überaktives Alarmsystem im Körper, das Betroffene ohne äußeren Grund erregt sein lässt.
Und das kommt so: Sympathikus und Parasympathikus sind Teile des sogenannten vegetativen Nervensystems und stehen als Gegenspieler in einem komplizierten Verhältnis zueinander. Das vegetative Nervensystem vermittelt von selbst ablaufende Regulationsvorgänge im Körper, arbeitet also automatisch – anders als Nerven, die wir über Hirnbefehle nach Belieben erregen können, wenn sich beispielsweise unsere Arme heben sollen. Bei Menschen mit einem ständig erhöhten Sympathikotonus »ist das vegetative Nervensystem zu sehr auf der Sympathikus-Seite, also nicht mehr im Gleichgewicht«, erläutert Titscher das Problem.
Während der beruhigende Parasympathikus für Erholung und Entspannung sorgt, kurbelt der aktivierende Sympathikus auf Stressreize hin alle Notfallfunktionen des Körpers an, sodass der Organismus sämtliche Kräfte mobilisiert, um Angriffe abzuwehren oder sich aus dem Staub zu machen. Dazu steigen Puls und Blutdruck. »Bei depressiven Menschen überwiegt ebenfalls die Sympathikus-Seite; Depressionen bedeuten Stress für den Organismus«, fügt Titscher hinzu. In der Brust mache sich das als Schweregefühl bemerkbar, das wegen der Nähe zum Herzen »dorthin projiziert« werde – »natürlich auch, weil das Herz als Ort der Gefühle gilt«. Auch verspannte Atemmuskeln können hier eine Rolle spielen.
Wenn das rund ein Drittel Kilo schwere Herz eines – eher untrainierten – Mannes durchschnittlich 80-mal pro Minute schlägt, pumpt es dabei sämtliche sechs Liter Blut einmal komplett durch die Blutgefäße, 75 Milliliter pro Schlag. Jeden Tag wälzt dieses Herz etwa 8.640 Liter um, im Jahr also 3,15 Millionen Liter – genug, um ein 40 Meter langes, 20 Meter breites und 4 Meter tiefes Schwimmbecken fast komplett zu füllen. Die tatsächliche Menge schwankt von Mensch zu Mensch, und auch bei demselben Menschen hängt sie von mehreren Einflussgrößen ab – etwa der körperlichen Betätigung am betreffenden Tag.
Bei Druckgefühlen in der Brust gilt es in jedem Fall sauber zu unterscheiden: »Wer wirklich eine koronare Herzkrankheit hat, der spürt bei Engegefühlen oder Stichen in der Brust tatsächlich eine Sauerstoff-Mangelversorgung im Herzen«, betont der Herz-Experte Jochen Jordan. Bei einem Herzgesunden rührten die Beschwerden jedoch eher von nervös bedingten Reaktionen der Rippenmuskulatur her, die Empfindungen würden lediglich in die Herzgegend verlegt. Der Herzmuskel selbst melde sich nämlich nur mit Schmerzen, wenn er deutlich zu wenig Sauerstoff bekommt. Denn während die Herzadern keine Nerven besitzen, ist der Herzmuskel über solche mit seinem Umfeld verbunden.
Deshalb können Träger eines eingepflanzten Herzens einen etwaigen späteren Infarkt gar nicht spüren. Falls sie ihn überleben, entdecken Ärzte ihn nur zufällig bei einer späteren Kontrolluntersuchung. Sehr wohl aber beschleunigt sich auch bei freudig erregten Menschen mit fremdem Herzen der Puls, weil Auslöser dafür Hormone sind, die über den Blutstrom herangeführt werden.
Depressive Menschen erkranken nicht nur häufiger an der koronaren Herzkrankheit, sondern erleiden auch deutlich öfter einen Herzinfarkt – und sie sterben mit größerer Wahrscheinlichkeit daran: Ihr Risiko, die ersten 12 bis 18 Monate nach dem Infarkt nicht zu überleben, ist gegenüber Herzpatienten ohne Depression – je nach Studie – zwei- bis viermal so hoch, wobei Männer gefährdeter erscheinen als Frauen. Bloß warum?
Nach Meinung des Freiburger Internisten und Psychiaters Joachim Bauer »offenbaren Männer beim Auftreten einer Depression ihre emotionale Qual deutlich seltener gegenüber Angehörigen oder Ärzten und holen sich aufgrund dessen auch weniger zwischenmenschliche Unterstützung« – obwohl dies die Depression mildern könne. Und noch etwas hat der Leiter der psychosomatischen Ambulanz an der Freiburger Uni-Klinik über Jahre hinweg erfahren müssen: »wie sehr Männer eine depressive Stimmung als Makel oder Schande empfanden«. Vor allem jene, »denen man als Knaben beigebracht hat, ›zäh wie Leder‹, ›flink wie ein Windhund‹ und ›hart wie Kruppstahl‹ zu sein, ertragen ihre Depression eher bis zum Suizid – oder eben bis zum Herztod –, als dass sie sich einem Arzt offenbaren und von einem Psychotherapeuten helfen lassen würden«.8 Dass es bald aus natürlichen Gründen keine solchen Männer mehr geben wird, oder zumindest keine aus der düsteren Kruppstahl- und Windhund-Zeit, ist kein rechter Trost.
Wenn es einem das Herz zerreißt
Joseph von Eichendorff (1788–1857) hat es selbst erleben müssen: Nachdem er seine Jugendliebe untergehakt am Arm eines »schönen Herrn« – vermutlich eines Herzensbrechers – hatte sehen müssen, reimte er voller Trauer: »Und es endet Tag und Scherzen, durch die Gassen pfeift der Wind – keiner weiß, wie unsre Herzen tief von Schmerz zerrissen sind.«
Der Arme war tief ins Herz getroffen, überlebte den herzzerreißenden Anblick aber immerhin. Das ist auch kein allzu großes Wunder, denn aus pathologischer Sicht hatte der Dichter stark übertrieben – ein klarer Fall von poetischer Freiheit. Doch so weit hergeholt ist das Bild des zerstörten Herzens nun auch wieder nicht. Denn manchmal nimmt unser liebster Muskel wirklich ernsten Schaden durch Seelenpein.
Joachim Bauer erinnert sich besonders an den Fall eines Herzinfarkt-Patienten, der »auf sehr demütigende Weise« erfuhr, dass er einen Nebenbuhler hatte. »Schmerz, Enttäuschung und Ärger konnten ihm wirklich das Herz brechen«, sagt Bauer. Er trennte sich später von seiner Frau, doch auf den Tag genau ein Jahr, nachdem er von dem Liebhaber erfahren hatte, erlitt der Mann einen Hinterwand-Infarkt. Obwohl der Patient schon länger mit einigen weiteren Infarkt-Risiken lebte, sei dies »kein Zufall gewesen«, urteilt der Spezialist für psychosomatische Leiden. Allerdings könne die Seele einen solchen Infarkt nicht von alleine verursachen.
Und natürlich ist das Bild des brechenden Herzens schief. Infarkte zerreißen das Herz schließlich nicht, sie lassen eher Teile davon absterben, weil verstopfte Gefäße den Herzmuskel nicht mehr ausreichend ernähren können. Doch auch Entzündungen dort, wo ein Herzgefäß durch abgelagerte Stoffe verengt ist, können einen Infarkt auslösen.
Ihnen kann ausgerechnet Cortisol entgegenwirken. Gebildet wird das Stresshormon in der Nebennierenrinde – auf Kommando von ganz oben. Unter Stress schüttet nämlich der Hypothalamus, die Steuerzentrale des vegetativen Nervensystems im Zwischenhirn, vermehrt den Signalstoff ACTH (Adrenokortikotropes Hormon) aus, der vom Blut an die Nebennierenrinde geschwemmt wird und diese veranlasst, ihrerseits verstärkt Cortisol ins Blut abzugeben – vorwiegend am Ende der Nacht, kurz vor dem Aufwachen. Sofort herrscht Aufruhr im Organismus.
Zwar kann Cortisol Gefäßentzündungen im Herzen lindern oder gar unterdrücken, solange ein Mensch noch gegen eine Belastung anzukämpfen vermag. Doch wenn lange anhaltender Stress uns schließlich erschöpft, fällt der Cortisol-Spiegel im Blut, woraufhin niedergehaltene Entzündungen neu aufzulodern drohen.
Das Zerreißen des Herzens darf man also in der Tat nicht allzu wörtlich nehmen – vermutlich ist damit eher die große Angst Trauernder oder von Liebeskummer Geplagter zu verstehen, das Herz drohe demnächst zu zerreißen.
Sie hat ein Herz aus Stein
Dass ein Herz sich schwer wie Stein oder Beton anfühlen kann, haben wir bereits erfahren – weiter oben wie auch vermutlich im Leben. Doch kann ein Herz »aus Stein sein«? Oder hart wie angeblich bei hartherzigen Menschen – im Gegensatz zu solchen mit weichem Herz?
Hier sieht Georg Titscher sehr wohl eine körperliche Parallele. Denn die koronare Herzkrankheit sei »im eigentlichen Sinne eine Herzverhärtung, zumindest eine der Gefäße, nämlich durch Verkalkung«. Freilich verengen sich die Herzkranzgefäße allenfalls unwesentlich durch Kalk (Kalziumcarbonat), sondern hauptsächlich durch Ablagerungen aus diversen Salzen, Fettbestandteilen, Eiweißstoffen und winzigen Blutgerinnseln an der Innenwand der Gefäße. Dadurch büßen diese an Elastizität ein, werden also starrer als gesunde Adern – gewissermaßen härter.
»Menschen, die nicht auf ihre Gefühle achten oder diese nicht zulassen, neigen eher als Gefühlsmenschen zu einem Herz aus Stein, also einer koronaren Herzkrankheit«, befindet Titscher, was freilich »sehr plakativ und vereinfacht ausgedrückt« sei.
Aber falsch ist es ganz und gar nicht: Ein seelischer Hauptfaktor für viele Herzleiden sei nun mal »Stress in jeder Form«, urteilt der Psychokardiologe Jochen Jordan. Unter den Oberbegriff fassen könne man, »wenn jemand grundsätzlich sehr ehrgeizig ist, sich über Jahre hin überfordert, an der Leistungsgrenze arbeitet und in der Freizeit noch einem Verein vorsteht. Oder auch, wenn jemand perfektionistisch ist und alles selbst machen möchte, weil er – oder sie – anderen Menschen nichts zutraut.« Nicht umsonst nennt Michael Wirsching, Leiter der Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Freiburger Uni-Klinik, als besonders bedeutsame Wirkfaktoren eines psychosomatisch mitverursachten Herzleidens »Hetze, Ungeduld und aggressives Rivalisieren«.9
Wie sehr gerade eine feindselige Einstellung und tiefwurzelndes Misstrauen aufs Herz schlagen können, ist in medizinischen Untersuchungen eindrucksvoll gezeigt worden. Eine dänische Studie im Jahr 1995 mit 730 Teilnehmern ergab, dass feindselig eingestellte Testpersonen eher zu einem Herzinfarkt neigen und früher sterben als freundlicher gesonnene. Diese Tendenz konnte auch eine 2001 veröffentlichte Analyse aus der ostfinnischen Stadt Kuopio und ihrem Umland bestätigen, wo vergleichsweise viele Menschen an Herzleiden erkranken. Dort verfolgten Mediziner die Geschicke von 2.682 Männern, die während der Datenerhebung (1984–1989) als gesund gelten durften und seinerzeit 42 bis 60 Jahre alt waren. In den darauffolgenden Jahren jedoch zeigte sich, dass die Testteilnehmer mit einer ausgesprochen feindseligen Lebenseinstellung doppelt so oft an einer Herzkrankheit starben wie meist freundliche Probanden.
Diesen Zusammenhang haben später weitere Untersuchungen bestätigen können, so etwa die US-Studie »Multiple Risk Factor Intervention Trial« im Jahr 200410 sowie eine 2010 veröffentliche Untersuchung an über 5.600 Dorfbewohnern der italienischen Insel Sardinien. Ihr zufolge neigen aggressive, aufbrausende Männer und Frauen um 40 Prozent häufiger zu verengten Halsarterien als umgängliche Zeitgenossen: »Menschen, die mit anderen konkurrieren und oft nur für ihre eigenen Interessen kämpfen, haben verdickte Gefäßwände und damit ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Leiden«, sagt die Studienleiterin Angelina Sutin vom Nationalen Alternsforschungsinstitut der USA (NIA).11
Dass der Umgang mit Ärger ein wesentlicher psychischer Faktor für Herzprobleme ist, wusste schon der schottische Chirurg und Anatom John Hunter (1728–1793), laut einer Aufschrift auf seinem Grabstein der »Begründer der wissenschaftlichen Chirurgie«. Er regte sich selbst leicht auf und stellte fest, dass seine Herzanfälle oft auf seine Wutausbrüche folgten. »Mein Leben hängt von der Gnade des erstbesten Schufts ab, der sich entschließt, mich zu verärgern«, sagte Hunter sich selbst bissig voraus. Und so kam es auch bald: Sekunden nach einem Streit im Londoner St. George’s Hospital, wo Hunter an einer Sitzung teilgenommen hatte, brach der Arzt tot zusammen.
Menschen, die sich selbst in eher unwichtigen Situationen immer wieder aufregen, tun ihrem Herzen also nichts Gutes. Denn jedes Mal wird bei Ärger viel Adrenalin ins Blut ausgeschüttet, »das aber nicht abgebaut wird – es sei denn, man würde viel Sport treiben oder sich direkt nach der Ärger-Attacke körperlich anstrengen, etwa durch das sprichwörtliche Holzhacken«, sagt der Bad Nauheimer Psychologe Jordan.