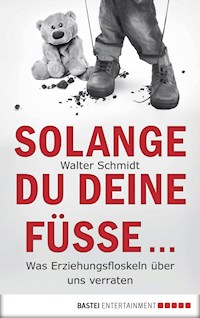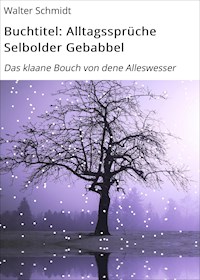21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Geldpolitik scheint an ihre Grenzen zu stoßen. Die Verschuldung der Staaten, Unternehmen und Banken hat abenteuerliche Dimensionen erreicht. Selbst der Privatsektor ist davon in starkem Maße betroffen. Die Zentralbanken werden der Situation nicht mehr gerecht. Das führt zur Verunsicherung, die längst den Alltag erreicht hat. Sparer erzielen kaum noch Zinserträge - im Gegenteil: Das Gespenst der Negativzinsen geht um. An den Börsen führt die Nervosität zu großen Schwankungen, wobei die Kursentwicklung per Saldo seit 2014 kaum vorangekommen ist. Auch die Kreditvergabe steigt nur langsam. Ist das Geld am Ende? Wohl eher nein. Am Ende dagegen erscheint die Art, wie Geld bisher erklärt und gehandhabt wurde. Es braucht eine neue Art: einfach und simpel und wirksam. Im privaten wie im geschäftlichen Alltag und in der Alltags-Kultur.
Genau diesem Anliegen widmet sich das Buch von Walter Schmidt. Wir müssen lernen, Geld und Preis wieder anders zu denken, um den Kopf frei zu machen für ein anderes Handeln. Schmidt will durch eine gezielte Analyse den Blick weiten für neue Fragestellungen. Es werden in seinem Buch Anregungen für andere Sichten und Handlungsoptionen vermittelt, die sowohl im individuellen als auch im unternehmerischen und politischen Alltag von Bedeutung sein können. Wenn man Geld nicht länger als Tauschobjekt betrachtet, sondern als autorisiertes und akzeptiertes Dokument zur Besiegelung von Kaufverträgen - dann gehören Preis und Geld zum selben Prozess. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Mit dem Preis wird die Vertragsverhandlung eröffnet. Und mit dem Geld der Kaufvertrag signiert. Getrennt voneinander sind Preis und Geld theoretische Konstrukte ohne praktische Spannung. Deshalb fällt auch die Bewertung von Produkten so schwer, wenn man sie nicht zum Verkauf anbietet. Das Geld bezieht seinen Wert aus den Gütern, die man sich dafür kauft. Nicht aus sich selbst.
Walter Schmidts Buch ist in einfach verständlicher Sprache geschrieben. Viele Erzählungen und Geschichten erleichtern das Lesen.
Am Schluss gibt es einen Ausblick zu Möglichkeiten und Grenzen der Geld- und Preispolitik, die sich aus der veränderten Sicht ergeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Deckblatt
Titelseite
Impressum
Vorwort
Prolog: Von moralfreiem Geld und verantwortungslosen Fakten
1. Akt: Wie das Geld »moralfrei« wurde
2. Akt: Wie die Fakten verantwortungslos wurden
Teil I: PreisGeld – zwei Seiten einer Medaille
1. Die Geld-Illusion
2. Die Wert-Illusion
3. Die Besitz-Illusion
4. Die Vermögens-Dimension
5. Die Schulden-Dimension
6. Die Macht-Dimension
Teil II: Ein neues Geldbewusstsein praktizieren
7. Wie wollen wir leben?
8. Zu welchen Geschäften sind wir bereit?
9. Was soll der »Einsatz« sein?
10. Top – die Wette gilt
11. Die Grenzen des Spiels
Teil III: Die Kultur des Geldes – im Alltag ankommen
12. Ideen
13. Beziehungen
14. Prozesse
15. Symbole
16. Helden
17. Rituale
18. Werte
19. Bewusstseinsstrukturen
20. Denkstrukturen
Ein kurzer Epilog – nichts als Fragen?
Anhang
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Guide
Cover
Table of Contents
Begin Reading
Pages
C1
3
4
5
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
239
240
241
e1
Walter Schmidt
Das neue Geld-Bewusstsein
Warum wir einen anderen Umgang mit Geld und Preis lernen müssen
WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
1. Auflage 2018
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2018 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlaggestaltung: bauer-design, Mannheim
Umschlagfoto: vege - fotolia.com
Satz: Lumina Datamatics
Print ISBN: 978-3-527-50933-1
ePub ISBN: 978-3-527-81763-4
mobi ISBN: 978-3-527-81764-1
»Das eigentliche Mysterium der Welt ist das Sichtbare, nicht das Unsichtbare.«
Oscar Wilde
Vorwort
Am 06. Januar 2017 meldete das Handelsblatt unter der Überschrift »Starke Selbstkritik von Andrew Haldane, Chefvolkswirt der Bank of England«: »Der Top-Ökonom hat eingeräumt, dass seine Spezies in Verruf sei, weil sie nicht vor dem Crash 2008 gewarnt und auch die Wachstumseinbußen durch den Brexit überbetont habe. Die Modelle der Wirtschaftswissenschaftler würden nun mal ›irrationales Verhalten‹ nicht berücksichtigen. Haldane: Die Wetterprognosen seien inzwischen verbessert, die Vorhersagen der Ökonomen aber nicht.«
Es ist ein tiefes Misstrauen gegenüber den Wirtschaftswissenschaften entstanden. Gegenüber der Art und Weise, wie wir mit dem Geld umgehen. Das hat wie immer viele Ursachen. Aber es liegt wohl auch an den Strukturen unseres Denkens. An den grundlegenden Ideen, die wir mit Geld verbinden. Manchmal sehen wir ja das Offensichtliche nicht, weil wir von Glaubenssätzen ausgehen, die wie Filter wirken. Das kennt wohl jeder, der schon einmal verliebt war und sich später wieder »entliebte«. Mit einem Mal sieht er am Partner Eigenschaften, die er vorher durch seine »rosarote Brille« nicht bemerkte. Die er ausgeblendet hatte.
Beim Geld ist es nicht anders. Es gilt als ein objektives Maß für den Wert einer Sache. Als ein Tauschmittel von Dingen. Von Objekten. Deshalb erscheinen Geldbeziehungen auch als objektiv. Sie unterliegen sogenannten Sachzwängen. Und die lassen sich mithilfe der Mathematik tiefer ergründen. Auf diesen und ähnlichen Denkstrukturen beruhen die »Liebesbeziehungen« der meisten heutigen Ökonomen zum Geld.
Es ist eine leidvolle Liebesbeziehung. Denn sie stürzt uns immer wieder in Krisen. Wir ahnen inzwischen, dass es so nicht weitergehen kann. Aber wie soll es dann weitergehen?
Vielleicht versuchen wir es einmal damit, uns zu »entlieben«. Indem wir die rosarote Brille alter Glaubenssätze ablegen. Vielleicht gelingt es uns dann zu erkennen, dass es für die Denkstrukturen der Ökonomen keinen einzigen Beweis gibt. Alle historischen Befunde zeigen uns anderes. Zum Beispiel, dass Geld schon vor mehr als zehntausend Jahren nicht als Tauschmittel, sondern als ein autorisiertes Dokument zum Besiegeln von Kaufverträgen entstanden ist. Dass Geld nicht Dinge den Besitzer wechseln lässt, sondern in erster Linie dazu dient, die Zusammenarbeit von Menschen auf vertraglicher Grundlage zu gestalten. Sowohl bei der Erzeugung von Gütern, als auch beim Kaufen und Verkaufen. Denn immer müssen wenigstens zwei Menschen aufeinander zugehen, wenn Geld im Spiel ist. Sie müssen sich auf einen Vertrag verständigen. Der Preis eröffnet dabei die Verhandlung, und das Geld besiegelt die Einigung. Das kann mündlich erfolgen wie beim Kauf eines Brotes. Oder schriftlich wie beim Verkauf eines Teils unserer Lebenszeit als Arbeitszeit. Aber die Kooperation geht dem Vertrag immer voraus. Und jedem Vertrag folgt erneute Kooperation, wenn Geld im Spiel bleibt.
Vielleicht können wir mit dieser anderen Sicht eine Reihe verhängnisvoller Illusionen ablegen. Vielleicht erschließen sich uns dann auch konkrete Ideen für Maßnahmen, um die gegenwärtige Fragilität und Gefährlichkeit zu beseitigen oder wenigstens einzudämmen.
Indem wir die Mystifizierung des Geldes als »Objekt« überwinden und die Kooperation von Menschen an die Stelle des Tausches von Dingen setzen. Indem wir die sachliche Sicht auf das Geld ersetzen durch die menschliche. Eine menschliche Sicht aber schließt Moral und Verantwortung ein.
Darum dieses Buch. Um den Einstieg zu erleichtern, sollen kurz einige mir wichtige Begriffe erläutert werden:
Güterproblem:
Durch die Kombination von Arbeitsteilung und abgrenzendem Eigentum entsteht ein Problem. Wir stellen nicht mehr alle Güter unseres Bedarfes selbst her. Sie befinden sich dann in den Händen anderer. Wenn wir sie benötigen, um unseren Bedarf zu decken, müssen wir in den Besitz jener Güter gelangen. Das kann durch Raub geschehen. Oder durch familiäre bzw. herrschaftliche Umverteilung. Oder auf der Basis vertraglicher Vereinbarungen.
Neutralität des Geldes:
Die heute herrschende Geldtheorie trennt die Wirtschaft gedanklich in einen realen und einen monetären Sektor. Sie unterstellt, dass das Geld im Prinzip als neutraler und objektiver Vermittler beim Tausch der Objekte wirkt. Und daher die Gleichgewichtsbedingungen der realen Wirtschaft zumindest langfristig nicht beeinflusst.
Kapitalvermögen und Wettvermögen:
Ich unterscheide in diesem Buch zwischen Einkommen erzeugendem Kapitalvermögen und Einkommen umverteilendem Wettvermögen.
Das Kapitalvermögen erzeugt die Grundlagen für das Leben der allermeisten Menschen dieser Welt. Es basiert auf der Kooperation von Menschen. Die einen Teil ihrer Lebenszeit als Arbeitszeit einsetzen. Die einen Teil ihres Geldvermögens in produktive Aktivitäten investieren. Die Produkte und immaterielle Leistungen zur Verfügung stellen. Die Möglichkeiten der sozialen Infrastruktur und der natürlichen Umwelt nutzen.
Demgegenüber dient das Wettvermögen ausschließlich der Spekulation. Dem Wetteinsatz zum eigenen Vorteil zulasten anderer.
Kredite und Darlehen:
Kredite und Darlehen werden im allgemeinen Verständnis oft synonym gebraucht. Sie sind jedoch nicht dasselbe.
Mit Krediten wird sogenanntes Buchgeld geschaffen. Das Geld wird auf ein Konto gebucht, ohne es einer anderen Einlage zu entnehmen. Ein Kredit erweitert die Summe der Einlagen. Er erzeugt neues Geld. Um Kredite vergeben zu dürfen, bedarf es daher einer Banklizenz. Darlehen hingegen verleihen vorhandenes Geldvermögen. Zum Beispiel, indem Vermögensverwalter oder Fonds Geld einsammeln und anschließend als Darlehen weiterreichen.
Gewinn und Profit:
Auch Gewinn und Profit werden zumeist synonym verstanden.
Es ist aber hilfreich, zwischen beiden zu unterscheiden. Dabei geht es um den Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben eines Unternehmens, sofern es wirtschaftlich erfolgreich arbeitet.
Dieser Überschuss kann im Unternehmen verbleiben. Dann ist das ein Gewinn für das Unternehmen. Den es beispielsweise für Innovationen einsetzen kann. Um auch zukünftig erfolgreich zu wirtschaften. Dieser Überschuss kann aber auch ausgeschüttet werden. Dann verlässt er das Unternehmen und wird zum Profit für die Eigentümer.
Ökonomische Rente:
Dieser Begriff wurde im 18. Jahrhundert geprägt in der Auseinandersetzung um das »leistungslose Einkommen« aus den Privilegien des Adels. In der aktuellen Auseinandersetzung mit der Finanzindustrie wird der Begriff oft verwendet für jene Überschüsse wirtschaftlicher Tätigkeit, die dem Kapitalvermögen in Form von Zinsen und Profiten entzogen werden.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Dazu kommen ein Prolog sowie ein kurzer Epilog.
Der Prolog gibt einen knappen historischen Abriss, wie das Geld »moralfrei« und die den Preisen zugrundeliegenden Fakten »verantwortungslos« wurden. Und wie sich beides verschränkt hat. Außerdem versuche ich zu zeigen, dass Geld nicht aus dem Tausch, sondern als autorisiertes Dokument für die Besiegelung von Kaufverträgen entstanden ist. Und ich versuche anzudeuten, welche Rolle Kredit und Darlehen dabei gespielt haben.
Teil I befasst sich mit den Illusionen, die das klassische Geldbewusstsein hervorgerufen hat im Zusammenhang mit Geld, Wert und Besitz. Um anschließend zu zeigen, zu welchen problematischen Dimensionen diese Illusionen führen. In Bezug auf Vermögen, Schulden und Macht.
Teil II versucht, eine Strategie zu skizzieren, wie wir ein neues Geldbewusstsein entwickeln und praktisch umsetzen können. Durch eine neue Form der Marktwirtschaft. Eine demokratische Marktwirtschaft. Eine Strategie, die auf ein konkretes Aktionsprogramm hinausläuft, das in sieben Punkte gegliedert ist:
die Staaten vollkommen entschulden,
den Staatshaushalt stabilisieren,
den Menschen helfen, ihren Platz zu finden,
die Erzeugung von Einkommen fördern,
soziale Verantwortung durchsetzen,
die Geldschöpfung auf die Entwicklung von Einkommen und die Einhegung von Risiken fokussieren,
dem Wettvermögen Grenzen setzen.
Teil III schaut auf den Alltag. Wie das Geld die Selbstverständlichkeiten unseres Lebens, unsere Kultur beeinflusst. Welche Verwerfungen wir beobachten können. Und welche Chancen entstehen, wenn wir uns auf ein neues Geldbewusstsein einlassen.
Der Epilog schließlich rundet die Reise ab. Um doch nur darauf zu verweisen, dass dieses Buch nicht mehr als ein Anfang sein kann. Der Diskussionen anregen soll. Wie wir die Zerbrechlichkeit unserer heutigen Geld- und Währungssysteme überwinden können.
Zur besseren Lesbarkeit habe ich auf Fußnoten verzichtet. Dafür erläutere ich im Anhang, auf welche Autoren sich meine Aussagen insbesondere stützen. Dabei ist mir bewusst, dass ich Ihnen nur eine subjektive Auswahl vorstellen kann, da die Einflüsse, die meine Positionen geprägt haben, sich aus weit mehr Quellen speisen: aus den vielen Begegnungen mit Unternehmern, Führungskräften, Controllern, Kommunikatoren, Technikern, Bankern, Wirtschaftsprüfern, Natur- und Geisteswissenschaftlern. Ich hatte in meinem Leben das Glück, mit diesen so interessanten Menschen mit so unterschiedlichen Sichtweisen diskutieren und oft auch streiten zu dürfen. Vielfalt ist ein großer Reichtum, wenn man sich respektiert. Drei Freunde möchte ich hervorheben: Herwig Friedag, Christopher Storck und Rainer Vieregge, die mir Impulse und Anregungen gegeben und mich vor manchen Irrwegen bewahrt haben. Ein großer Rückhalt waren und sind mir meine Familie, meine Frau Barbara und meine Kinder Anne und Gregor. Ohne ihre Geduld und Rücksichtnahme, ohne die vielen Diskussionen mit ihnen hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. Und ich möchte meine Eltern erwähnen. Sie haben mich zu Neugier erzogen und mir eine Erkenntnis mit auf den Weg gegeben, die Sokrates zugeschrieben wird: Stehe zu deiner Wahrheit im Bewusstsein, dass es nicht die Wahrheit der anderen ist.
Zum Schluss hoffe ich, Ihnen bei der Lektüre auch ein wenig Vergnügen zu bereiten. Es ist ein Gedankenspiel. Und ich würde mich freuen, wenn es Sie reizt.
Prolog: Von moralfreiem Geld und verantwortungslosen Fakten
1. Akt: Wie das Geld »moralfrei« wurde
Es war dunkel, und es war kalt in jenem späten Herbst des Jahres 1695. Nebel lag über London. Wenige Wochen zuvor hatte ein schwerer Sturm 70 Kohleschiffe stranden lassen. Und London war noch gezeichnet von den angerichteten Verwüstungen. Gut also für jeden, der sich in ein warmes und trockenes Haus zurückziehen konnte. So auch John Locke, der nach vielen Anfeindungen erst 1689 durch Wilhelm von Oranien rehabilitiert und aus seinem holländischen Exil nach London zurückgekehrt war. Inzwischen genoss er hohes Ansehen. Er hatte mit seinen philosophischen und staatsrechtlichen Ideen – insbesondere zur Gewaltenteilung, zur Liberalität, zu den natürlichen Rechten des Menschen und zu seinen Freiheitsrechten – maßgeblich zum Sieg der protestantisch-bürgerlichen Partei im 40 Jahre währenden englischen Machtkonflikt beigetragen.
John Locke also saß in seinem Arbeitszimmer und überlegte, was er dem kurz zuvor zum englischen Schatzkanzler ernannten William Lowndes erwidern konnte. Es ging um den Wert der Silbermünzen. Die Nachfrage für gehandelte Güter überstieg schon längere Zeit das Angebot. Die davon ausgelösten Preissteigerungen hatten die Kaufkraft der Silbermünzen verringert. Sie war unter den Preis für metallisches Silber gefallen. Dadurch war es günstiger, die Münzen einzuschmelzen und als Silber zu verkaufen. Oder man knapste etwas von der Münze ab, handelte mit den reduzierten »Kipper-Münzen« weiter und verkaufte den abgeknapsten Teil als Silber. So entstand eine Münzknappheit bzw. die noch umlaufenden Münzen entsprachen in ihrem Silbergehalt nicht mehr dem aufgeprägten Nennwert.
Lowndes schlug vor, dieser Marktentwicklung nachzukommen, indem der Silbergehalt einer amtlichen Münze verringert wird. Aus seiner praktischen Erfahrung heraus ging er davon aus, dass der Wert des Geldes vom Herrscher festgelegt und durch dessen Autorität garantiert wird. Wenn die Kräfte des Marktes Anpassungen erforderten, war es besser, dem von Zeit zu Zeit durch Korrekturen zu entsprechen, als durch Münzknappheit die Entwicklung von Wirtschaft und Gewerbe zu behindern. Das entsprach auch den überlieferten Ideen der Antike und des Mittelalters, die im Geld ein soziales Phänomen sahen.
Nun hatte das Parlament Locke gebeten, zum Vorschlag von Lowndes eine Stellungnahme zu erarbeiten. Das war nicht ganz einfach. Denn Lowndes hatte seinen Vorschlag gut begründet. Und das Parlament war geneigt, ihm zu folgen. Doch Locke war schon der gedankliche Ansatz zuwider. Er hatte schließlich dafür gekämpft, dass die Rechte des Menschen von Natur gegeben waren. Sie sollten nie mehr der »Genehmigung durch den Herrscher« unterliegen. Und so wollte er auch das Geld aus den Händen der Herrscher befreien. Wie sollte er vorgehen? Da kam Locke eine Idee. Er stellte die These auf, dass – wie die Rechte des Menschen – der Wert des Geldes von Natur gegeben sei. Silber sei Geld. Und der Wert des Geldes richte sich nach dem natürlichen Maß – dem Metallgewicht. Die Idee des natürlichen Geldstandards war geboren.
Das stellte die bis dahin geltende Theorie auf den Kopf. Aber Locke argumentierte, dass die Herrscher ihr angemaßtes Recht immer wieder missbraucht hätten, um das Volk auszupressen und sich durch willkürliche Wertanpassungen Vorteile zu verschaffen. Das durfte nicht weitergehen. 40 Jahre hatten die Engländer für eine freiheitliche politische Ordnung gekämpft und gesiegt. Nun musste auch das Geld der herrschaftlichen Willkür entrissen werden.
Locke setzte sich durch. Das Parlament entschied in seinem Sinne. Es spielte keine Rolle, dass er seine These aus der Praxis heraus nicht begründet hatte und auch gar nicht begründen konnte. Es spielte auch keine Rolle, dass die Umsetzung seiner Idee zu enormen Verlusten führte. Ein Großteil der Münzen war aus dem Verkehr gezogen und nach Umprägung in geringerem Umfang und zu einem festen Nennwert wieder in Umlauf gebracht worden. Da in der Folge weniger Münzen verfügbar waren, geriet die Zahlungsfähigkeit der Pächter, Händler und Handwerker in Gefahr. Insolvenzen verknappten das Güterangebot. Dadurch wurde der Abstand zwischen dem Metallwert des Silbers und dem realen Tauschwert der Münzen noch größer. Also floss noch mehr Silber in Form von Barren ins Ausland. England ging durch eine tiefe Krise.
Aber wie in jeder Krise gebar die Schwäche der einen neue Chancen für andere. Nach drei Jahrzehnten war so viel Silber abgeflossen, dass Gold als Standard an seine Stelle trat. Und die Bedeutung der Münzen als führende Geldeinheit wurde geringer. So dass sich die Banknoten – das Kreditgeld der Banken – nach vorne schoben und in kurzer Zeit zum bestimmenden Zahlungsmittel avancierten.
Doch Lockes Idee hatte triumphiert. Er war zwar schon 1704 gestorben. Aber seine Idee war zum Gründungskern der Nationalökonomie geworden. Wenn Geld einen natürlichen, inneren Wert besitzt, konnte dieser wissenschaftlich – also vor allem auch quantitativ, das heißt mit mathematischen Methoden – untersucht und begründet werden. Das entsprach einem gesellschaftlichen Trend, der etwa 50 Jahre zuvor von René Descartes, einem französischen Mathematiker und Philosophen, begründet wurde und sich gerade auf seinem beginnenden Siegeszug befand: dem Rationalismus – wir werden uns im zweiten Akt damit beschäftigen. Die Moral als mathematisch nicht zu fassendes soziales Maß stand dem Siegeszug jedenfalls nicht mehr im Wege. Locke hatte das Geld in seiner idealen Vorstellung von der Moral getrennt.
70 Jahre nach Lockes Tod veröffentlichte Adam Smith sein berühmtes Werk Der Wohlstand der Nationen. Darin präzisierte er Lockes Ansatz in drei Punkten:
Zum einen setzte er die menschliche Arbeit als Quelle und Maß für den Wert von Gütern an die Stelle der Natur. Der objektive Bezugspunkt für den Austausch werthaltiger Güter sei die in ihnen enthaltene Arbeitsmenge. Zum zweiten postulierte er in diesem Zusammenhang, dass sich aus dem Naturaltausch heraus die edlen Metalle als zweckmäßigstes Äquivalent erwiesen hätten. In einem historischen Prozess entfaltete sich der in diesen Metallen schon immer schlummernde Kern allmählich zum allgemeinen Zahlungsmittel, das wir seit der Antike Geld nennen. Und zum dritten erfand er die »unsichtbare Hand des Marktes«. Sie sorge dafür, dass das allgemeine, gesellschaftliche Glück maximiert werde, indem jedes Individuum im Rahmen seiner gesellschaftlichen Grenzen versuche, sein eigenes persönliches Glück zu finden und auszubauen.
Obwohl Smith als Moralphilosoph gilt, hat er damit die Ökonomie noch weiter von der Moral getrennt. Mit der Arbeitswert-Theorie wurde die Ökonomie endgültig für die wertfreie Mathematik zugänglich. Und die »unsichtbare Hand« verfügte nicht nur über den Vorteil, unsichtbar zu sein. Sie nahm auch die moralische Verantwortung aus den Händen der wirtschaftlichen Akteure. Denn die ging ja nun über in die Verantwortung des Marktes, der mangels eines handelnden Gesamt-Subjekts keine Verantwortung trägt.
Locke und Smith folgten eine Vielzahl berühmter Nationalökonomen wie Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Karl Marx, Eugen Böhm von Bawerk, Walter Bagehot oder Léon Walras. Der Arbeitswert-Theorie trat die Grenznutzen-Schule entgegen. Die Ökonometrie wurde entwickelt und ausgebaut. Doch trotz aller Gegensätze und erbittert geführter Auseinandersetzungen: Alle Beteiligten gingen von den Prämissen aus, die Locke und Smith gesetzt hatten. Das Geld habe sich aus dem Naturaltausch heraus als allgemeines Äquivalent durchgesetzt und verfüge über einen objektiven Wert, der sich über die Marktmechanismen Geltung verschaffe. Ohne es auszuführen, wird dabei vorausgesetzt, dass »objektiv« schon vom Begriff her außerhalb der Moral steht. Die Moral sei zwar wichtig. Aber als ein zusätzliches Element. Geld ist objektiv. Es stinkt nicht!
Denn objektive Dinge sind gegeben. Man kann sie analysieren und versuchen, ihr inneres Wesen zu begreifen. Und man kann mathematische Modelle erarbeiten, die der komplexen Vielfalt der objektiven Wesensfaktoren gerecht werden sollen. Die Praxis per se sei kein Argument.
Dass die Urgründe der modernen Geldtheorie auf tönernen Füßen stehen, wird hinter einem dichten Nebel abstrakter, mathematisch legitimierter Konstruktionen verborgen. Denn die Thesen von Locke und Smith sind über all die Jahre Glaubenssätze geblieben. Alle historischen Befunde belegen eine ganz andere Genealogie des Geldes. Allein der Glaube ist ungebrochen. Es wird Zeit, das zu ändern.
Erstes Zwischenspiel: Von profanen Gütern und sakralen Metallen
Schauen wir uns also einmal kurz die Befunde an, die eine akribische Archäologie zutage gefördert hat. Sofern wir den dokumentierten Quellen folgen wollen, erscheint die Geschichte des Geldes als eine Jahrtausende umfassende sukzessive Profanisierung sakraler Kulte. Mit einer allmählichen Herausbildung des Geldes aus dem Naturaltausch und einer Bevorzugung der Edelmetalle Silber und Gold aufgrund ihrer natürlichen Eigenschaften hat das ebenso wenig zu tun wie mit der Menge an menschlicher Arbeit, die in den Tauschgütern investiert ist.
Was also zeigen die Befunde:
Vor etwa acht- bis zwölftausend Jahren, im frühen Neolithikum, begann der Übergang nomadisierender Wildbeuter zu sesshaften Ackerbauern und Viehzüchtern. Nicht auf einen Schlag und überall. Vielleicht eher zufällig, in dafür begünstigten Gebieten. Wir wissen nicht genau, in welcher Weise sich diese Veränderung in den verschiedenen Weltgegenden vollzog. Und viertausend Jahre deuten an, dass sich die Entwicklung nicht auf einen Schlag vollzog.
Doch unabhängig vom konkreten Wo und Wann und Wie bewirkten die Veränderungen eine Gemeinsamkeit: Die Menschen lernten nicht nur, ihre Arbeit weiter zu spezialisieren, sondern, die Bedingungen und Produkte ihrer Arbeit in »Mein« und »Dein« zu unterscheiden. Ackerbau erfordert die Bearbeitung konkreter Landstücke und Viehzucht die spezielle Betreuung ausgewählter Tiere. Mit der produktionsbedingten Abgrenzung veränderte sich daher auch das Gefühl für das Eigene. Der Begriff des »Eigentums« mag sehr viel später entstanden sein. Aber das Gefühl war nicht neu. Nur dass es sich jetzt nicht mehr auf zufällig erbeutetes Fleisch, gefangene Fische oder gesammelte Früchte bezog. Oder auf ein unbestimmt empfundenes »Revier«. Sondern auf konkrete Felder, selbst gezähmtes Vieh und die daraus gewonnenen Produkte.
Damit entstand eine vorher nicht in diesem Ausmaß bekannte Schwierigkeit – das sogenannte »Güterproblem «: Nicht jeder erzeugt all jene Dinge, die er für sein Leben braucht oder gerne hätte. Und durch die Abgrenzung von Mein und Dein kommt er auch nicht ohne Weiteres an diese Güter heran. Auch wenn das anfangs wohl eher ein sporadisches Problem war. Über die Jahrtausende hat es immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens erfasst. Es besteht bis heute und wird nach heutigem Ermessen noch für eine lange Zeit bestehen bleiben.
Die beiden ältesten Formen, jenes »profane Problem« zu lösen, waren den Menschen zu dieser Zeit bereits bekannt: Lieferbeziehungen und Raub.
Lieferbeziehungen bestanden schon zehntausende Jahre vor dem Neolithikum. Das legen zum Beispiel Funde von Speerspitzen nahe, die aus Obsidian gefertigt wurden. Vorkommen dieser Gesteine gibt es nur in bestimmten Gegenden. Ihre Verwendung in davon weit entfernten Gebieten setzten demzufolge in irgendeiner Weise organisierte Lieferungen voraus. Das Güterproblem und seine Lösung durch Lieferbeziehungen kannten die Menschen im Ansatz also schon. Mit Ackerbau und Viehzucht bekamen sie »nur« ein anderes, den Alltag viel stärker durchdringendes Gewicht.
Auch mit Raub kannten sich die Menschen schon aus. Zunächst wohl nur gelegentlich, so wie frühere Revierkämpfe auch. Doch die neuen Produktionsformen hatten die Lebensbedingungen der Menschen verbessert. Sie konnten mehr Vorräte anlegen als vorher. Und sie konnten Siedlungen begründen und ihren Lebensraum erweitern. Dabei kam es ab und an zu Kollisionen verschiedener Siedlungsgruppen untereinander. Aber auch mit weiterhin nomadisierenden Gruppen. Manchmal deswegen, weil sich ausdehnende Siedlungsgebiete mit Wanderungsräumen oder anderen Siedlungsgebieten überlappten. Manchmal wahrscheinlich einfach auch, weil die angelegten Vorräte Begehrlichkeiten weckten. Wie viele Kämpfe es gab, ist nicht bekannt. Aber offensichtlich reichten die Übergriffe aus, um die Angst vor ihnen tief in den Menschen zu verankern.
Um sich vor Überfällen und Raub zu schützen, entstanden Produktions- und Verteilungsformen, die im wehrhaften Rahmen von Familien- bzw. Sippen- oder herrschaftlichen Strukturen organisiert waren. Dabei sind nicht nur Spuren von Kämpfen und Verteidigungsanlagen überliefert. Die Quellen weisen auch auf ein anderes Phänomen hin: die Entwicklung einer Kultur gegenseitiger Geschenke zwischen verschiedenen Gruppen. Sie erweiterten die Lieferbeziehungen und sollten wohl aufgeflammte Streitigkeiten befrieden oder ihnen vorbeugen. Als Geschenke wurden vor allem junge Frauen, Tiere und Nahrungsmittel verwendet sowie Silber, Gold und Kupfer. Junge Frauen waren für die Fortpflanzung wichtig, Tiere und Nahrungsmittel für das tägliche Überleben. Aber wieso Silber, Gold und Kupfer?
Das basierte zum Teil auf uralten Tempel-Kulturen. Sie hatten das über Jahrtausende tradierte Menschenopfer um die Hingabe von Tieren und »sakralen Metallen« ergänzt und mitunter völlig ersetzt. Nicht überall und nicht auf einen Schlag. Aber die Kultur war da. Und mit ihr die ritualisierten Kulte in Bezug auf Silber, Gold und Kupfer. Silber wurde mit dem Schein des Mondes verbunden. Und da ein Mondumlauf in etwa dem weiblichen Menstruationszyklus entspricht, galt er als Symbol der Fruchtbarkeit des weiblichen Leibes. Auf dem der Fortbestand einer Gruppe maßgeblich beruhte. Das verlieh dem Silber magische Kraft. Das Gold glänzte wie die Sonne am Himmel. Es verkörperte das Licht des Tages und seine belebende Wirkung auf die Natur. In diesem Sinne stand es für die männliche Zeugungskraft und die ihr zugeschriebene Magie. Das Kupfer schließlich changierte wie der Morgen- und Abendstern, der Nacht und Tag, Mond und Sonne voneinander schied. Das verlieh ihm die Magie der Verknüpfung von Scheiden und Übergang. Von weiblich und männlich. Von Fruchtbarkeit und Zeugung.
Die magischen Verklärungen waren völlig unabhängig von den sonstigen Eigenschaften der Metalle. Ihre besondere Bedeutung ergab sich erst aus dieser sakralen Veredlung. Eben deshalb wurden sie zu einem wichtigen Bestandteil der Geschenke. Und im Übrigen auch in wachsendem Maße zu Grabbeigaben für die »Edlen« einer Siedlungsgemeinschaft.
Aber Geld? Abgesehen davon, dass der Begriff des Geldes erst im letzten Jahrtausend vor Christus entstanden war, verlieh der sakrale Glanz den edlen Metallen zunächst nur den Status von Kultobjekten, besonders ehrenhaften Geschenken und würdevollen Grabbeigaben. Dieser Status war eingebrannt im Bewusstsein der Menschen. So konnte er andere Anwendungsfelder finden. Doch davon später.
Zweites Zwischenspiel: Die Dokumentation von Transaktionen
Dass wir einiges darüber vermuten können, wie diese Entwicklung zustande gekommen ist, verdanken wir zwei einfachen Umständen: Die Menschen hatten schon vor bzw. in dieser Übergangszeit gelernt, Steine und Ton zu bearbeiten und mit Zeichen zu versehen. Die Funde so bearbeiteter Steine ermöglichen uns ein gewisses Verständnis sehr alter Tempel- und Wehranlagen aus Zeiten weit vor den ersten Pyramiden. Und bearbeiteter Ton hat uns Dokumente überliefert, wie die Menschen ihr Zusammenleben und ihre Arbeit organisierten. Denn Ton hat den Vorteil, in Bränden auszuhärten und an der Oberfläche wie im Boden nicht zu verwittern. Er kann zerbrechen. Aber Tonscherben lassen sich bei ausreichender Geduld wieder zusammenfügen.
Und so erzählen uns die Funde Geschichten über die Ausbreitung einzelner Siedlungsgebiete und das Entstehen erster größerer urbaner Zentren. Das Zusammenleben mehrerer Tausend Menschen erforderte eine neuartige Form der Nahrungsproduktion. Das konnte über längere Zeiten nur deshalb bewältigt werden, weil die Menschen gelernt hatten, umfangreiche Landflächen verbunden mit künstlicher Bewässerung zu bewirtschaften. Gleichzeitig mussten die Menschen lernen, ausreichende Vorräte anzulegen und deren Schutz gegen Überfälle zu organisieren. Auf diese Weise entstanden aus den wachsenden Siedlungen mitunter auch mächtige Verteidigungs- und Herrschaftsgebiete.
Die Funde erzählen uns noch andere Geschichten. Zum Beispiel über die Entwicklung der qualitativen und quantitativen Dokumentation von Lieferbeziehungen. Ausgrabungen haben mehr als zehntausend Jahre alte, aus Ton gefertigte, gemusterte Zählsteine (Tokens) zutage gebracht. Sie wurden in ebenfalls aus Ton gefertigten Behältern (Bullae) transportiert, deren Muster auf die in ihnen enthaltenen Tokens abgestimmt war. Tokens und Bullae dienten als Dokumente, die ihre Besitzer beglaubigten – also mit dem Recht ausstatteten, bestimmte Transaktionen durchzuführen und abzurechnen.
Solche Transaktionen bestanden zum Beispiel in Lieferungen an Tempel im Rahmen sakraler Verpflichtungen. Die Errichtung und Unterhaltung großer kultischer Anlagen war nicht ohne die Zusammenführung und Versorgung Hunderter, vielleicht sogar Tausender Menschen realisierbar. Dazu mussten Material und Versorgungsgüter zum Teil aus weit entfernten Gebieten herangebracht werden. Dem lagen wie auch immer entstandene Verpflichtungen zugrunde, deren Erfüllung mit Hilfe der Zählsteine dokumentiert wurden. Und die Zählsteine verliehen den Verpflichtungen zugleich ein abrechenbares Maß.
Ein weiterer Vorteil ergab sich aus der Möglichkeit, dass dieses Maß transportabel war. Der Tempel konnte einem Karawanenführer – meist der Führer einer bewaffneten Gruppe – die Dokumente mitgeben und ihn bevollmächtigen, dem Verpflichteten mittels der Zählsteine Qualität und Quantität seiner »Liefer-Schuld« mitzuteilen. Im Gegenzug übergab der Schuldner die geforderten Güter an die Karawane und belegte mit entsprechenden in Bullae eingeschlossenen Tokens, dass er seine Schuld beglichen hatte.
Die Zählsteine fungierten also für die Tempelherren, Karawanenführer und Verpflichteten als eine Art Mittler von Geschäften. Nicht im Sinne von Kauf und Verkauf, sondern im Sinne von Begründung und Begleichung einer sakralen Schuld. Und nicht im Sinne von Geld in unserem heutigen Verständnis. Aber mit einer Grundeigenschaft, die das moderne Geld noch immer prägt: Sie dokumentierten das Recht ihres Besitzers, Transaktionen durchzuführen. Die Formen haben über die Jahrtausende gewechselt. Und es sind nicht mehr die Tempel, die kraft göttlicher Ermächtigung den Dokumenten ihre Gültigkeit verleihen. Aber die damals entstandene Funktion verkörpert das heutige Geld noch immer. Ob als Bargeld oder in elektronischer Form, dokumentiert es gegenüber einem Verkäufer, dass wir über das Recht verfügen, in einem bestimmten Maße Güter zu erwerben.
Sie sind ein autorisiertes Dokument zur Besiegelung von Kaufverträgen.
Dem entspricht auch die gültige Rechtauffassung. Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung von 1984 Geld als »jedes vom Staat oder einer durch ihn ermächtigten Stelle als Wertträger beglaubigte, zum Umlauf im öffentlichen Verkehr bestimmtes Zahlungsmittel ohne Rücksicht auf einen allgemeinen Annahmezwang« definiert.
Diese Grundeigenschaft des Geldes ist offensichtlich nicht aus Tauschhandlungen entstanden, sondern aus sakral begründeten Herrschaftsbeziehungen, die eher als Tribute, Steuern oder Abgaben bezeichnet werden können. Und bereits im 8. Jahrtausend vor Christus verfügten die Menschen über Erfahrungen göttlich/herrschaftlich begründeter Lieferverpflichtungen, an die sie in der weiteren Entwicklung anknüpfen konnten.
Die Dokumentation von Transaktionen wurden gravierend verbessert durch die Entwicklung der Schrift etwa fünftausend Jahre später. Aus den Abdrücken von Zählsteinen in weichen Tontafeln entstand in Mesopotamien über verschiedene Zwischenschritte die Keilschrift. Auf ihrer Basis sind erste Formen der Buchführung über die Koordination und Kontrolle des Zusammenwirkens von Menschen im Rahmen organisierter Arbeit überliefert. Ähnliche Entwicklungen führten in Ägypten zur Herausbildung einer Bilderschrift (Hieroglyphen). Im Unterschied zu Mesopotamien wurden sie nicht in Tontafeln, sondern in Steine geprägt. Vielleicht wurde auch schon sehr früh Papyrus für schriftliche Aufzeichnungen genutzt. Doch Steine sind haltbarer als Papyrus. Deshalb wurden bisher aus dieser frühen Zeit keine Belege dafür ausgegraben. Falls es sie gegeben haben sollte, sind sie längst verwittert.
Die gefundenen schriftlichen Dokumente zeigen in viel detaillierterer Form als die Zählsteine, dass sowohl die koordinierte Bearbeitung größerer Landflächen als auch die Fähigkeiten zur kurzfristigen Mobilisierung militärischer Kräfte auf einer starken Zentralisation von Versorgungsgütern beruhten. Das war im Grunde schon bei den fünftausend Jahre älteren Tempelbauten ähnlich gewesen. Nur die Dimensionen hatten sich erheblich erweitert. Neben der Organisation von Feldzügen und der Aneignung daraus gewonnener Raubgüter bildeten verpflichtende Dienste für die Götter der Tempel bzw. die gottgleichen Herrscher sowie dekretierte Abgaben und Lieferungen die Grundlage dieser Zentralisation.
Die Abgaben erfolgten in der Form von Tributen unterworfener Siedlungsgebiete sowie von Steuern aus dem eigenen Herrschaftsbereich. Im Grunde waren sie nichts anderes als die oben beschriebenen Lieferungen an die Tempel, über die uns die Zählsteine erzählten. Sie beruhten also auf einer uralten Tradition. Und als Dokumente wurden nun nicht mehr Zählsteine, sondern Tontafeln verwandt – wobei die Übergangszeit mehrere Jahrhunderte umfasste.
Drittes Zwischenspiel: Die edlen Metalle bekommen neue Funktionen
Bei Steuern und Tributen tauchten die edlen Metalle wieder auf. Neben ihrer direkten Abgabemöglichkeit – oft in Form »verpflichtender Geschenke« – wurden sie als Vergleichsmaß für zu liefernde Güter wie Sklaven, Vieh oder Getreide genutzt. So entstanden die ersten »Preise«. Nicht aus Tauschprozessen, sondern aus herrschaftlichem Ermessen über das Maß von Tributen und Steuern. Davon kündet zum Beispiel die berühmte Stele des babylonischen Herrschers Hammurabi. Vorstellungen von irgendwelchen inhärenten Wertmaßstäben werden in keiner der bisher gefunden Quellen auch nur angedeutet.
Stattdessen finden wir willkürliche Festsetzungen, die interessanterweise noch eng mit den sakralen Ursprüngen der Veredlung von Silber und Gold verknüpft waren: Aus den Aufzeichnungen des als »Vater der Geschichtsschreibung« geehrten Griechen Herodot von Halikarnass geht hervor, dass die Wertrelationen von Silber zu Gold im Verhältnis von 1:13 festgelegt waren. Das entspricht in etwa dem Verhältnis der Zyklen von Mond und Sonne. Aber es entspricht weder ihrem natürlichen Gewichtsverhältnis noch den Relationen des Arbeitsaufwandes für ihre Herstellung.
Und bis in die Neuzeit reicht die Spur des aus sakralem Ursprung durch herrschaftlichen Erlass festgelegten Tauschverhältnisses zwischen Silber und Gold. Abgesehen von Schwankungen im Mittelalter blieb es über die Jahrtausende weitgehend stabil. Die letzte bekannte Festschreibung erfolgte mit der 1865 gegründeten lateinischen Münzunion – die formal bis 1926 bestand, aber faktisch bereits mit dem 1. Weltkrieg beendet wurde. Sie bestimmte ein Umtauschverhältnis von 1:15,5.
Silber- und Goldstandard sind Geschichte. Sicher, ein kleiner Rest des magischen Zaubers ist noch geblieben; insbesondere in Bezug auf Gold. Aber die sakrale Aufladung ist verflogen. Silber und Gold bilden nicht mehr den Orientierungspunkt der Preisbildung, sondern sind selbst zum profanen Gegenstand floatender Preisbildungen an den Börsen geworden.
Dennoch hat die Mär des objektiven Wertmaßstabes und des Preises als »Geldausdruck des Wertes« in den ökonomischen Theorien sowie an den Universitäten und Hochschulen dieser Welt bis auf den heutigen Tag überlebt. Die historischen Quellen werden einfach nicht zur Kenntnis genommen. Denn sie besagen: Wie beim Geld war die Praxis der Preisbildung schon über Tausende Jahre im Denken und in den Ritualen der Menschen verankert, ehe der Begriff des »Preises« und die Theorien seiner Deutung entstanden. Sein Ursprung liegt in der Festsetzung von Tributen und Steuern – nicht im Tausch. Und die Autorität der edlen Metalle rührte aus ihrer sakralen Aufladung – nicht aus irgendwelchen natürlichen Eigenschaften oder differenzierten Förder- und Verbreitungsbedingungen. Aber theoretische Dogmen besitzen eine hohe Halbwertszeit, wenn sie sich erst einmal in den Denk-Strukturen verankert haben. Albert Einstein hat dieses Phänomen in treffende Worte gefasst: »Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.«
Eine weitere Geschichte lässt sich aus den überlieferten Quellen erschließen: Manche Herrscher begannen Regeln zu setzen für die Abgrenzung von Mein und Dein. Bisher hatte es vor allem rituelle Regeln der Gottesverehrung gegeben. Nun entstanden Urformen des formalen Rechts. Sofern die Herrscher ihre Regeln durchsetzen konnten, traten sie neben das Gewaltprinzip des Stärkeren. Vordem konnte man sich der Gewalt nur im Rahmen familiärer Umverteilung oder herrschaftlicher Gnade entziehen. Nun entstand zum ersten Mal die Möglichkeit, das Güterproblem auf vertraglicher Grundlage zu lösen. Indem die beteiligten Seiten in friedlicher Weise aufeinander zugingen, sich einigten und ihre Einigung in Dokumenten fixierten – meist unter Bezeugung eines Tempeldieners.
Das bot enorme Vorteile. Weil auf diese Weise ein Raum entstand für ein gleichberechtigtes Umgehen miteinander. Zumindest in dem Rahmen, den das geltende Recht gewährleisten konnte. Die frühesten bisher entdeckten Quellen dokumentieren vor allem Kaufverträge über Ländereien samt des dazugehörigen Inventars aus Menschen, Gebäuden und Vieh. Und der Preis wurde in jenen Maßen ausgedrückt, die den Menschen sowohl aus den Tempeln als auch aus Geschenken, Tributen und Steuern bereits geläufig waren: Silber, Kupfer und Gold. Sie dienten als autorisierte Dokumente, um einen Kaufvertrag zu besiegeln. Praktischerweise standen sie dann den Verkäufern neben der Nutzung für eigene Zwecke auch für die von ihnen zu begleichenden Abgaben zur Verfügung und waren entsprechend begehrt.
Damit lernten die Menschen eine neue Alternative zur Lösung des Güterproblems kennen: Die Kooperation und Einigung der beteiligten Seiten auf vertraglicher Grundlage. Darin besteht das Charakteristikum jeden Marktes. Wobei auch dieser Begriff erst Tausende Jahre später geprägt wurde. Doch praktisch entstanden rechtlich geregelte Räume für Kauf und Verkauf lange vorher. Je nach Beständigkeit des formalen Rechts konnten die vielfältigsten Güter durch Kaufverträge ihren Besitzer wechseln. Zwar waren Herrschaftsgebiete sehr oft instabil. Aber wir wissen zum Beispiel aus Ägypten oder Mesopotamien oder China von frühen Reichen, die viele Jahrhunderte bestanden. Genug, um die Möglichkeit einer rechtlich basierten Lösung des Güterproblems tief im Bewusstsein der Menschen zu verankern.
Lokalen Austausch von Gütern hat es auch gegeben. Innerhalb von und zwischen Familien, Sippen und Stämmen kleinerer Siedlungsgebiete. Aber dieser Austausch basierte nicht auf formalem Recht, sondern auf tradierten Sitten und Gebräuchen. Dabei gab es bevorzugte Austauschgüter des alltäglichen Lebens wie Vieh, Getreide, Salz etc. Es gab auch Umverteilungen im Rahmen von Herrschaftsbeziehungen. Die Tempel und Herrschaftshäuser versorgten ihre Bediensteten aus den Gütern, die sie aus den Verpflichtungen der Beherrschten erhalten hatten. Das hatte mit den formal geregelten Märkten ebenso wenig zu tun wie die familiäre Umverteilung. Im lokalen Umfeld kannte man sich und benötigte weder Dokumente noch formale Regeln für die Berechtigung zu Transaktionen.
Das war bei Fernbeziehungen anders. Beim Austausch zwischen entfernteren Siedlungsgebieten begannen auch Dokumente eine Rolle zu spielen, die den Beteiligten das Recht für ihre Transaktionen verliehen. Als Materialien wurden neben den schon beschriebenen Tokens auch andere Gegenstände gefunden, zum Beispiel Muscheln oder Steine. Von anderen, leichter zerfallenden Materialien wie Holz oder Felle wissen wir nichts, weil sie sich über die Jahrtausende nicht erhalten haben.
Besonderheiten ergaben sich bei Lieferungen über sehr weite Strecken. Dann mussten die Karawanen mitunter mehrere Zwischenstationen einlegen. Dabei spielte das Netz der Tempelanlagen eine hilfreiche Rolle. Für ihre Leistungen erhielten die Tempel einen Ausgleich. Dabei spielten Silber, Gold und Kupfer – die sakral veredelten Metalle – eine wichtige Rolle. Sie bildeten fast überall die Grundlage für den Tempelschatz und waren entsprechend begehrt.
Mit der Zeit erweiterte sich diese Praxis. Edle Metalle wurden auch als Mittel der ehrenvollen Belohnung von Handwerkern, Karawanenführern, herausgehobenen Palastdienern oder Militärführern eingesetzt. Infolgedessen verbreiterte sich der Kreis derjenigen, die über solche Metalle verfügten. Dadurch standen sie für die entstehenden vertraglichen Regelungen zum Kauf von Gütern als autorisierende Dokumente zur Verfügung. Und so entwickelten sich in den großen urbanen Zentren erste Erfahrungen mit Kaufverträgen, die unabhängig waren von familiären oder herrschaftlichen Zwängen. Zum einen, weil die Vertrautheit kleiner Siedlungsgebiete in den Städten fehlte. Zum anderen aber – und das erscheint mir als das Wesentliche: Sie beruhten auf formalem Recht.
Viertes Zwischenspiel: Darlehen und Kredit, das »ökonomische Feuer«
Die Anzahl der Menschen, die über edle Metalle verfügten, war zu dieser Zeit eng begrenzt. Die meisten Menschen waren damit beschäftigt, ihren Alltag zu bewältigen. Sie kamen zeit ihres Lebens nicht in den Genuss von Belohnungen der Tempel oder Herrschaftshäuser.
Aber sie hatten mit einem anderen Problem zu kämpfen. Die Produktionsweise von Ackerbau und Viehzucht ist mit natürlichen Verzögerungen verbunden. Man musste erst einmal sähen und Jungtiere aufziehen, ehe man ernten oder melken bzw. schlachten konnte. Sammler und Jäger nahmen das, was die Natur ihnen bot. Nun galt es zu investieren, um nehmen zu können. Wer über genug eigene Mittel verfügte, konnte seine Investitionen daraus speisen. Aber die Umstände waren nicht immer günstig. Widrige Witterungsverläufe oder kriegerische Auseinandersetzungen zehrten so manche Vorräte auf. Allerdings nicht gleichmäßig. So kam es vor, dass manche Familien noch Überschüsse besaßen, während andere vollkommen ausgeblutet waren. Inwieweit und in welchem Umfang in der Praxis wechselseitige Hilfe zwischen den Familien organisiert wurde, ist nicht dokumentiert bzw. derartige Dokumente sind nicht erhalten geblieben. Wir können darüber nur spekulieren.
Eines aber ist tatsächlich nachweisbar: Über die Ausleihungen der Tempel und Herrscherhäuser existieren in Form erhaltener Tontafeln akribische Auflistungen, deren Entstehung auf mehr als fünftausend Jahre zurückdatiert wird. Das führte im dritten Jahrtausend vor Christus zu einer weiteren, im guten wie im schlechten Sinne revolutionären Entwicklung: den Geldschulden in Form von Krediten und Darlehen. Wieder nicht als Begriff. Aber als praktische Überbrückung zeitlicher Engpässe.
Die Geldschulden und ihre Tilgung wurden auf Tontafeln dokumentiert. Doch es blieb nicht bei der einfachen Dokumentation. Offensichtlich waren einige Tempel und Herrscherhäuser auch dazu übergegangen, nicht mehr die eingelagerten Güter zu verleihen, sondern Ansprüche auf deren Herausgabe an den Inhaber entsprechender Tontafeln zu zertifizieren. Und nachweisbar ist auch, dass diese Zertifikate zur Begleichung von Steuerschulden herangezogen wurden. Vielleicht war es einfach so, dass mit den Zertifikaten – solange die Garantie des Ausstellers glaubwürdig war – die Überbrückungsleistung auf andere, auf vielfältigere Leistungen übertragen werden konnte. Indem der Inhaber der Tontafeln diese zum Erwerb von Gütern seines Bedarfs einsetzte. Für steuerpflichtige Besitzer nachgefragter Güter waren zumindest Anreize gegeben, diese Tontafeln als Kaufdokument zu akzeptieren und zum Fälligkeitstermin den Steuerbeamten auszuhändigen. Und die Buchhalter der Kreditgeber konnten ihre Vorräte in den Speichern belassen. Mit den Steuern kam ja ein Teil der Ansprüche zu ihnen zurück. Das bot einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Das Risiko des Verlustes konkreter Güter wurde verlagert auf das Risiko des Verlustes von Tontafeln, sofern die Steuern nicht eintreibbar waren.
Der Vorteil war noch größer. Die Zertifikate entsprangen ja aus Schulden, die gesondert dokumentiert wurden. Nur dass der Schuldner nun keine Güter, sondern jene Zertifikate bekam, für die er entsprechende Güter erwerben konnte. Die Schulden waren mit einem Fälligkeitsdatum versehen. Spätestens dann musste der Schuldner bezahlen. Die verleihenden Tempel und Herrschaftshäuser waren auf diese Weise doppelt abgesichert.
Doch die Absicherung war dreifach. Der Schuldner musste Sicherheiten hinterlegen. Das konnte durch die Verpfändung von Kaufdokumenten über erworbenes Eigentum geschehen. Doch die meisten verfügten nicht in nennenswertem Umfang über solche Sicherheiten. Sie mussten auf andere Möglichketen ausweichen. So verzeichnen die historischen Funde auch die potenzielle Schuldknechtschaft oder die Verpfändung von Familienmitgliedern, meist der jungen Töchter. Zwar musste der Schuldner sein Eigentum nicht gleich hergeben. Aber es stand zur Pfändung an, falls er den Kredit nicht begleichen konnte. Damit es nicht so weit kam, musste er rechtzeitig vor dem Fälligkeitstermin selbst geeignete Güter an Inhaber von Tontafel-Zertifikaten verkaufen, um diese danach für die Tilgung seiner Schulden einzusetzen. Auf diese Weise wirkten sie als ein Anstoß für die sich neben dem Fernhandel und gelegentlichen Landverkäufen entwickelnden Urformen regionaler Märkte.