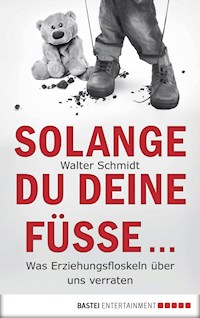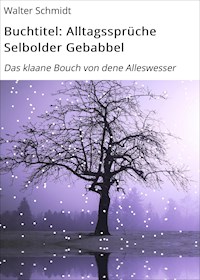4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wenn wir unser Büro einrichten oder einen Parkplatz suchen, wenn wir wandern oder vor einem Feuer im vollbesetzten Kino fliehen, wenn uns auf einer Party Fremde ansprechen oder wir Aufzug fahren, dann kommt immer unser Raumerleben ins Spiel, unsere Orientierung und unser Sinn für Grenzen und Distanzen. Wir fühlen uns wohl oder unbehaglich, nicht selten entsteht Streit. Walter Schmidt klärt die populärsten Fragen der räumlichen Psychologie und zeigt: Wir verhalten uns oft noch so, als lebten wir in der Steinzeit. Sogar unser Bett platzieren wir, als fürchteten wir uns noch immer vor einem Bären, der unsere Höhle für sich haben will ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Walter Schmidt
Warum Männer nicht nebeneinander pinkeln können
und andere Rätsel der räumlichen Psychologie
Über dieses Buch
Wenn wir unser Büro einrichten oder einen Parkplatz suchen, wenn wir wandern oder vor einem Feuer im vollbesetzten Kino fliehen, wenn uns auf einer Party Fremde ansprechen oder wir Aufzug fahren, dann kommt immer unser Raumerleben ins Spiel, unsere Orientierung und unser Sinn für Grenzen und Distanzen. Wir fühlen uns wohl oder unbehaglich, nicht selten entsteht Streit. Walter Schmidt klärt die populärsten Fragen der räumlichen Psychologie und zeigt: Wir verhalten uns oft noch so, als lebten wir in der Steinzeit. Sogar unser Bett platzieren wir, als fürchteten wir uns noch immer vor einem Bären, der unsere Höhle für sich haben will ...
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2013
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Illustrationen im Innenteil Oliver Weiss
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
(Abbildung: FinePic, München)
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream Inc.
ISBN 978-3-644-49401-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Unterwegs im Raum
Ein sicherer Platz zum Leben
Wem soll ich bloß danken?
2. Wie wir unser Revier verteidigen
Warum wir nicht runter zum Chef müssen
In luftiger Höhe
Weshalb der Boss so schwer erreichbar ist
Langer Anmarsch
Wie wir unseren Platz markieren
Ungeliebte Zellbüros
Warum Frauen sich im Job abgrenzen sollten
Wie wir mit zu großer Nähe umgehen
Je älter, desto distanzierter
Bedrohliche Schritte
Bedrängend nah
Warum wir im Sitzen mehr Abstand brauchen
Wie Sex und Küsse Seitensprünge erschweren
Warum wir Sitzplätze reservieren
Was uns am Stammtisch reizt
Warum wir auf unserem Stuhl beharren
Weshalb wir uns mit Nachbarn streiten
Mein Auto, mein Vorgarten
3. Wie wir uns zurechtfinden
Warum die Herren vorangehen
Wie Frauen und Männer sich orientieren
Landmarken und Wegefolgen
Erziehung oder Gene?
Wieso wir im Kreis umherirren
Was uns vom rechten Weg abbringt
Wodurch Gebäude uns verwirren
Wieso wir kein «südliches Ohr» haben
Warum wir in Kirchen schleichen und flüstern
4. Wie wir Gefahren begegnen
Weshalb wir in Panik der Masse folgen
Gefräßiges Hirn
Wie man Flüchtende lenkt
Wieso wir um Bettler einen Bogen machen
Träge Helfer
Warum Kranke sich zu Hause verkriechen
Nähe-Wunsch bei Angst
Wo unser Bett am sichersten steht
Weshalb wir Anschluss an die Gruppe halten
Wieso wir nachts schneller laufen
Warum Jugendliche im Dunkeln lärmen
Was uns an Städten ängstigt
5. Weshalb wir so bequem sind
Warum wir auf Rolltreppen Wurzeln schlagen
Fleißige Schrittmacher
Wieso wir Trampelpfade treten
Warum Auto-Städte uns das Laufen verleiden
Schönes zum Anschauen
Weshalb wir selbst im Gehen essen
Lob des Kochens
Wieso wir mit anderen bei Rot loslaufen
Warum Partygäste Küchen lieben
Weshalb unsere Kultur uns Beine macht
6. Wo wir uns wohl fühlen
Weshalb wir es lieben, am Fenster zu sitzen
Immer im Takt
Warum Parks und Wälder gut für uns sind
Natur statt Pillen
Wodurch uns Landschaften gefallen
Heimat prägt
Heikle Wildnis
Wüste im Kopf
Wieso es uns ans Wasser zieht
Ans Wasser, marsch!
Warum Männer lieber alleine pinkeln
Keine Reviermarke
Verstört seit der Kindheit
Wieso die Wand im Rücken uns beruhigt
Warum Ruhebänke am Waldrand stehen
Was uns auf Gipfel lockt
Rufende Berge
Lohn der Mühe
7. Wonach wir uns richten können
Warum wir Stau-Hinweise ignorieren können
Wie man Warteschlangen den Giftzahn zieht
Lohnendes Warten
Wo wir uns platzieren – und warum
Wieso wir im eigenen Revier souveräner sind
Einsatz für die Heimat
Teure Habe
Warum uns Raumwechsel vergesslich machen
Weshalb man Bummler lieber nicht überholt
Warum wir beim Nachdenken gehen sollten
Kreativer Gang
Reger Geist
8. Schlussendlich: Weshalb es uns in die Ferne zieht …
Für Paula, Peter und Franz
in großer Dankbarkeit, dass es euch damals gab.
1. Unterwegs im Raum
Kennen Sie das? Sie sind zu Gast auf einer Party bei flüchtigen Bekannten, gerade frisch eingetroffen und haben am langen Esstisch einen der wenigen noch freien Sitzplätze ergattert. Sogar Ihr gefülltes Weinglas haben Sie schon an Ihren Platz gestellt, vorsorglich natürlich, denn man weiß ja nie. Doch kaum sind Sie für zwei Minuten ans kalte Buffet entschwunden, um sich den Teller zu füllen, hat ein Fremder Ihren Platz eingenommen, Ihr Weinglas achtlos zur Seite geschoben und plaudert so vergnügt wie weltvergessen mit Ihrem bisherigen Tischnachbarn. Wie reagieren Sie? – Ach so, Sie schmunzeln nur, nehmen kommentarlos Ihr Glas und machen sich erneut auf die Suche nach einem freien Stuhl. Dann sind Sie erstaunlich souverän, Hut ab und Kompliment! Wir anderen aber sind irritiert und angesäuert. Das war doch unser Platz! Schließlich stand dort gut erkennbar unser Glas. Hat dieser Schwadroneur denn keine Augen in der Birne? Mag sein, doch was ist es wirklich, das uns da so sehr verstimmt?
Wo immer wir laufen oder stehen, liegen oder sitzen, beanspruchen wir Raum. In vielen Fällen welchen, der uns vertraut ist, denken wir nur an unser Büro oder unseren Stammplatz in der Kneipe. Manchmal aber auch Raum, den wir uns erst noch schaffen müssen, mitunter auch erobern. Wir sichern uns Fensterplätze im Gasthaus, reservieren Sitze in der Bahn oder besetzen mit Handtüchern gut platzierte Sauna-Liegen. Wir errichten Zäune oder montieren ein Namensschild an unser frisch erworbenes Haus, damit alle wissen, wer hier wohnt. Selbst unseren Arbeitsplatz gestalten wir so, dass wir uns dort heimisch fühlen – und bitte schön niemand sonst!
Wann immer wir uns Lebensraum aneignen, geschieht das zudem nicht zufällig am ausgewählten Ort. Wir bewegen uns dorthin, wo wir uns behaglich fühlen, und meiden Orte der Gefahr und des Unwohlseins, wie übrigens alle Tiere auch. Über unser Verhalten regulieren wir zudem den Abstand zu anderen Menschen, laden sie zum Näherkommen ein oder halten sie auf Distanz. Wann immer wir das (oder vieles andere) tun, haben wir gute Gründe dafür, auch wenn sie uns meistens nicht bewusst sind. Wir machen all das jedenfalls nicht einfach so. Was wir tun, ist pure Psychologie. Und Biologie natürlich auch, denn unsere Vorfahren – nennen wir sie stark vereinfacht: die Steinzeitmenschen – stecken uns noch immer gehörig in den Knochen. Und wohl oder wehe auch im Gehirn.
Unsere Altvordern führten ein hartes Leben. Tagtäglich hatten sie mit Angriffen wilder Tiere zu rechnen, mit schlimmen Verletzungen beim Jagen oder beim Fällen von Bäumen. Nahrungsmangel, Krankheiten und harsche Kälte konnten das Aus für sie bedeuten. Auch der Kontakt zu fremden Menschengruppen endete bisweilen tödlich, mit dem Verlust wertvoller Güter oder dem Raub von Frauen, wie beim «Massaker von Talheim» vor 7000 Jahren, als nahe dem heutigen Heilbronn mindestens 34 Menschen getötet wurden, darunter 16 Kinder.[1] Auch im 21. Jahrhundert verhalten wir uns in vielem so, als lebten wir noch damals, obwohl wir das natürlich gerne von uns weisen. Auch unsere Sinne arbeiten im Wesentlichen noch so wie jene der Steinzeitmenschen. Sie brauchen ein Beispiel? Aber gerne.
Ein sicherer Platz zum Leben
Versetzen wir uns kurz an einen Strand, einen hübschen aus feinem Sand an der Küste der Nordsee. Es ist Sommer, ein warmer Tag beginnt, und unser Traumstrand füllt sich allmählich. Auch mit Ihnen übrigens, denn Sie und Ihre Familie sind jetzt in den Ferien und wollen heute baden. Sofort stellt sich für Sie die Frage: Wo breiten Sie Ihre Badematten und Handtücher aus, welches ist die beste Stelle, wenigstens aber eine gute, die Ihnen und Ihren Lieben gefällt? Noch ist der Strand nicht überfüllt, doch Sie wissen, das wird sich schnell ändern. Zu nah ans Meer dürfen Sie nicht, denn später wird die Flut heranrauschen (Sie sorgen also vor). Zu weit weg vom schwappenden Wasser wollen Sie allerdings auch nicht liegen, weil Sie dann Ihre Kinder nicht mehr im Blick haben, wenn diese matschen wollen oder in die Wellen hüpfen (Sie sorgen sich also um Ihre Nachkommen, damit Ihre Gene weiterleben). Sich irgendwie in der Mitte zwischen Dünen und Brandung zu platzieren, klingt nach einer guten Idee, aber dort werden bald die meisten Badegäste liegen, folglich wird es eng (Sie wollen sich Konkurrenz vom Leib halten). Und allzu weit zum Kiosk laufen möchten Sie nachher auch nicht, wenn Sie Lust auf ein Eis haben oder Ihre Kinder eine Limo begehren (Sie möchten also mit Ihren Kräften haushalten).
Endlich entdecken Sie eine saubere und noch dazu windgeschützte Stelle (Sie beugen demnach Krankheiten vor), aber dort lagern bereits drei finstere Gesellen mit geöffneten Bierflaschen, denen Sie nicht so recht über den Weg trauen (Sie gehen riskanten und überflüssigen Konflikten aus dem Weg). Und Ihren Wagen mit den Wertsachen, drüben an der Strandpromenade, würden Sie auch gerne im Blick behalten (Sie möchten Ihre Ressourcen schützen, für die Sie hart gearbeitet haben). Wo also, bitte schön, rammen Sie denn nun Ihren Sonnenschirm in den Sand (und schaffen so einen behaglichen Lagerplatz)? Ihre Kinder quengeln schon, und Sie wägen das Für und Wider noch immer ab. Bis Sie dann schließlich doch einen vertretbaren Kompromiss finden. Sie greifen zur Schaufel und graben eine Sandburg, die ebenfalls den Wind abschirmt und andere Badende auf Abstand hält. Auch wenn Ihnen das jetzt nicht bewusst gewesen ist, hatten bis dahin all Ihre Überlegungen damit zu tun, dass schon Ihre Vorfahren möglichst sicher überleben wollten.[1]
Nicht jeder Tag ist zum Baden geeignet, doch tagtäglich müssen wir raumpsychologische Entscheidungen treffen: Laufen wir mit anderen Menschen bei Rot über die Straße? Welchen Weg schlagen wir ein? Wie nähern wir uns Fremden? Sollen wir beim Chef unseren Wunsch nach einem Eckbüro anmelden, weil doch der andere Abteilungsleiter sich längst auch eines gesichert hat? Welche Botschaft würde unser Verzicht darauf aussenden – und welche das ersehnte Büro mit seinen vier großen Fenstern? «Alle unsere Sinneswerkzeuge, unser letztes Körperorgan, alle Funktionen der Organismen sind auf Raumnutzung eingestellt», schrieb der Schweizer Bergführer Charles Widmer vor fast hundert Jahren.[2] Und er hatte recht damit, denn wir sind Wesen der räumlichen Bewegung, oder genauer: Wir sollten welche sein. Mit einem Körper, der zum Gehen und Laufen wie geschaffen ist, verbringen wir heute etwa neun Zehntel unserer Lebenszeit in Gebäuden, und das auch noch meistens sitzend oder liegend.[3] Unsere Sprache verrät noch, dass dies einmal anders war: Da ist vom Lebensweg die Rede, der sich auf dem Sofa oder im Bett kaum bewältigen lässt. Da erkundigen wir uns nach dem Ergehen anderer Menschen und schlagen eine berufliche Laufbahn ein. Wir geraten auf die schiefe Bahn oder kommen vom rechten Weg ab. Und nicht selten werden wir im Leben auch in die Irre geführt. Schade eigentlich, dass wir solche Stubenhocker geworden sind. Für unsere Gedankengänge ist das gar nicht gut, wie wir noch sehen werden, und für Körper und Seele schon gar nicht.
Durch dieses Buch jedenfalls können Sie nach Lust und Laune streifen. Beginnen Sie vorne oder in der Mitte oder wo auch immer Sie wollen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf dem weiten Feld der räumlichen Psychologie. Sie werden höchstwahrscheinlich sich selbst, Verwandte oder Freunde wiedererkennen in manchem, was Sie dort finden. Ein aus der Zeit gefallener Steinzeitmensch sind Sie deshalb noch lange nicht.
Wem soll ich bloß danken?
Am besten all jenen, die meine vielen Fragen beantwortet haben und deren Bücher, Artikel und Studien ich lesen durfte. Wer immer in diesem Buch mit einem Zitat auftaucht, das nicht durch eine Quelle belegt ist, hat mit mir gesprochen oder meine Fragen schriftlich beantwortet. Hervorheben möchte ich die Evolutionspsychologen Harald Euler und Benjamin Lange sowie den Natursoziologen Rainer Brämer. Ihrer Geduld und ihrer Bereitschaft, mir Auskünfte zu gewähren, gebührt mein besonders herzlicher Dank. Erwähnt sei auch der Psychologe und Bergführer Martin Schwiersch, den meine Frage, was uns auf Berge treibt, dazu angestiftet hat, einen eigenen kleinen Aufsatz über das Gipfelgefühl zu verfassen. Das hat mich sehr gefreut.
Walter Schmidt
Bonn, im April 2013
2. Wie wir unser Revier verteidigen
Am 4. Juli 2012 wurde es einer Herde Mutterkühe auf dem Weissenstein, einem knapp 1400 Meter hohen Berg im Schweizer Kanton Solothurn, entschieden zu bunt. Eine 69-jährige Frau, unterwegs mit ihren zwei Enkeln und einem angeleinten Hund, war den Rindern beim Spaziergang offenbar zu nahe gekommen. Der Wanderweg, den die kleine Gruppe nutzte, kreuzte die Weide und damit das Revier der Kühe. Diese fühlten sich bedroht, griffen an und verletzten die Frau so schwer, dass ein Helikopter sie wenig später in ein Krankenhaus fliegen musste. Seine Kühe hätten wohl «Angst um ihre Kälber» gehabt, sagte der Bauer Franz Niederberger gegenüber einem TV-Team.[1] Immerhin blieben die Enkelkinder unversehrt. Man darf annehmen, dass sie Kuhweiden künftig nur noch mit klopfenden Herzen queren werden.
So schmerzhaft endet es zum Glück nicht immer, wenn wir ein fremdes Revier verletzen, sei es nun das eines Tieres oder eines anderen Menschen. Doch die Sache kann auch tödlich ausgehen, so wie im Juli 2007 im hessischen Steinbach nordwestlich von Frankfurt. Dort gerieten fünf Männer aus Afghanistan im Alter von 19 bis 44 Jahren in einen heftigen Streit, weil einer von ihnen sein Auto auf einem Firmenstellplatz geparkt hatte, der von einem anderen Afghanen angemietet war. Das erzürnte diesen und seinen Begleiter derart, dass die beiden Männer mit Messern auf die Falschparker losgingen. Beim nachfolgenden Kampf wurde ein 36-Jähriger erstochen, die anderen vier Männer trugen teils lebensgefährliche Stich- und Schnittverletzungen davon.[2] Rangeleien um den Parkplatz enden immer wieder tragisch. Im schwedischen Landskrona verlor Ende März 2010 eine Frau ihr Leben, als sie sich in den Kampf zwischen ihrem Mann und einem jungen Sportwagenfahrer einmischte. Die zwei Raufbolde stritten um einen Parkplatz vor einem Supermarkt, den der jüngere der beiden mit seinem roten Flitzer blockierte. Der 71-Jährige hatte seinen Rivalen angehupt, woraufhin dieser meinte, auf den alten Mann einschlagen zu müssen. Als die Frau ihrem Gatten helfen wollte, hieb der junge Mann ihr ins Gesicht, sodass die 78-Jährige hinfiel und mit dem Kopf so unglücklich aufschlug, dass sie an ihren Schädelverletzungen starb.[3]
Was war da bloß los? Von unheilvollen Begleitumständen einmal abgesehen, nichts anderes als dies: Wir beanspruchen für unsere Bedürfnisse Raum und wollen uns von Konkurrenten klar abgrenzen. Wer uns trotzdem zu nahe kommt oder unsere Kreise stört, muss mit Sanktionen rechnen. Das hat nichts mit menschlicher Schlechtigkeit oder gar einem düsteren Aggressionstrieb zu tun, von dem Sigmund Freud fälschlicherweise ausging. Vielmehr zielen wir von Natur aus darauf, mit anderen Menschen möglichst friedlich zusammenzuarbeiten. «Unsere evolutionären Vorfahren waren weder blutrünstige Jäger noch Mörder, sondern überwiegend vegetarisch lebende Wesen», urteilt der Freiburger Mediziner und Neurobiologe Joachim Bauer.[4] Sie hätten sich auf Dauer behaupten können, da sie erstens eine überlegene Intelligenz entwickelten, zweitens und vor allem aber deshalb, weil sie es mit der Zeit immer besser schafften, zusammenzuarbeiten und einander beizustehen. Nur wenn eine fremde Gruppe oder auch böswillige Mitglieder der eigenen uns daran hindern wollen, unsere Bedürfnisse auszuleben, reagieren wir ungehalten und schlimmstenfalls auch mit Gewalt. Denn natürlich liegt Bauer auch hiermit richtig: Ohne Aggression, die als biologisches Programm der Wehrhaftigkeit in uns verankert ist, hätte unsere Art nicht überleben können. «Wer sich der Schmerzgrenze eines Lebewesens nähert, wird Aggression ernten.»[5] Das Problem ist leider, dass die Schmerzgrenzen mancher Menschen durch meist früheste Fehlprägungen und spätere Schicksalsschläge mit Langzeitfolgen sehr eng gezogen sind. Bei den Parkplatz-Streithähnen wird das wohl so gewesen sein.
Im Alltag geht es zum Glück nur selten darum, das eigene Revier mit Fäusten, Messern oder gar Schusswaffen zu verteidigen. Doch Grenzen setzen müssen wir ständig. «Die Fähigkeit, sich abzugrenzen, bildet einen wesentlichen Gesundheitsfaktor», schreibt der Salzburger Psychiater Manfred Stelzig.[6] «Ohne Grenze gibt es keine Begegnung zwischen dem Ich und dem Du», aber auch «keine Liebe, keine Auseinandersetzung und keinen Austausch». Um auf Dauer nicht krank zu werden, müssten wir es immer wieder schaffen, schädliche Grenzübertritte anderer zu erkennen und angemessen abzuwehren. Jeder Mensch habe darauf zu achten, «was hereingelassen werden soll und was vor der Türe bleiben muss». Dummerweise hört sich das sehr viel einfacher an, als es im wahren Leben ist.
Warum wir nicht runter zum Chef müssen
Das Telefon klingelt, Herr Schulze geht ran. In der Leitung ist die Sekretärin des Chefs. Auweia, denkt der Versicherungskaufmann, ein Anruf von ganz oben. Ihm schwant nichts Gutes. Und tatsächlich bittet ihn die Vorzimmerdame unheilvoll: «Kommen Sie am besten sofort mal rauf zu Herrn Dr. Obenauf!» Schulze soll hoch und fühlt sich irgendwie ganz unten. Und im Keller war auch die Zahl seiner Vertragsabschlüsse zuletzt.
Die Sprache ist verräterisch: Wer sich nicht Chef nennen kann, ist Untergebener. Will er das ändern, muss er die Karriereleiter erklimmen und in der Hierarchie aufsteigen. Nicht umsonst hieß Hans Falladas später verfilmter Roman aus dem Jahr 1953 «Ein Mann will nach oben». Die Höhe ist ja auch wirklich erstrebenswert: Mensch und Tier blicken auf zum Alphatier. Untergeordnete signalisieren ihre schwächere Stellung, indem sie sich erniedrigen. Duckmäuser senken den Kopf, in manchen Kulturen ist heute noch der Bückling üblich, auch Diener genannt: Um den Ranghöheren zu besänftigen, versichert man ihn seiner gehobenen Position auch körperlich bei jeder Begegnung, indem man den Oberkörper beugt – bis hin zum Arschkriecher, bei dem die dafür günstigste Haltung längst Programm ist. Beim Gruß nur mit dem Kopf zu nicken, ist ein gnädiges Überbleibsel davon.
«In allen Kulturen ist die erhöhte Position ein Zeichen von Dominanz», befindet der Evolutionspsychologe Harald Euler, bis 2009 Professor an der Universität Kassel. «Will ein Mann einer Gruppe von Personen, besonders anderen Männern, Befehle erteilen oder Anweisungen geben, dann ist es zweckmäßig, sich erhöht zu stellen.» Profi-Fotografen wissen, dass sie einen Politiker dominant erscheinen lassen können, wenn sie ihn von unten ablichten, und schwach, wenn sie das Foto von schräg oben schießen. Das ist pure Psychologie, was natürlich auch die Redner wissen und nutzen. «Wer oben ist, will sich nicht auf dem Kopf herumtanzen lassen; er will sich vielmehr über die anderen erheben, herausstechen, andere überragen – im übertragenen wie auch im wahrsten Sinne des Wortes», sagt der Hamburger Organisationspsychologe Jörg Felfe. Wer ganz oben ist, habe «die Kontrolle und die Übersicht, einen freien Blick». Man denke nur an den Feldherrnhügel, von dem Napoleon oder Wellington ihre Truppen lenkten. Oben kann man zudem strahlen wie der «Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis», wie es in der Bibel (Jakobus 1,17) an jener Stelle heißt, auf die eine bekannte Redensart zurückgeht: «Alles Gute kommt von oben.» So hat schon das Neue Testament das Oben zum Ort der Sehnsucht verklärt. Und dem Teufel bleibt nur die Hölle.
Allerdings hat erst der mit Dampfkraft und später elektrisch betriebene Lift vor über 150 Jahren einen so deutlichen Unterschied zwischen dem Oben und dem Unten bei Gebäuden möglich gemacht. Insofern ist Elisha Graves Otis (1811–1861), Gründer des Weltmarktführers bei Aufzügen, schuld daran, dass so viele Mitarbeiter weit nach oben zum Chef müssen. «Vor der Erfindung des Liftes wurde nicht so hoch hinaus gebaut, und bei Bürgerhäusern war die Beletage, das schönste Geschoss, im ersten Stock oder im Hochparterre», sagt Felfe. Ganz oben war sie schon deshalb nicht, «weil die Herrschaften sich nicht so viele Treppenstufen hinaufmühen wollten». Das sollte auch den Gästen des Hauses erspart bleiben. Heute hingegen, in modernen Konzernzentralen, sausen auch hohe Besucher mit schnellen Liften aufwärts, und stolz kann der Chef ihnen vorführen, wie toll die Aussicht von hier oben ist und wie erhaben seine Position, wie groß seine Macht.
Wem das affig vorkommt, den bestätigt ein Erlebnis Benjamin Langes. Im Leipziger Zoo hat der Göttinger Evolutionspsychologe vor einigen Jahren einen dominanten Gorilla-Silberrücken dabei beobachtet, wie dieser die ganze Zeit «auf einem Stein saß und die anderen Männchen im Auge behielt». Von da oben hatte er die Konkurrenz im Blick. Eine Einzelbeobachtung, und man sollte sich davor hüten zu verallgemeinern, schon gar nicht in Hinsicht auf andere Affenarten. Denn schon die ranghohen Tiere unter den neunzig Mantelpavianen im Kölner Zoo verhalten sich anders. Dabei wäre der imposante, 1914 erbaute Affenfelsen wunderbar dazu geeignet, die Pavianhorde zu überwachen. Doch das führende Alpha-Männchen hockt dort keineswegs die meiste Zeit über auf dem hohlen Kunstfelsen, den nur ein Wassergraben von den Zoobesuchern trennt. Auch die renommierte Affenforscherin Julia Fischer vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen weiß von keinen «klar belastbaren Daten» als Belege dafür, dass sich ranghohe Paviane in der afrikanischen Savanne oder in Halbwüsten auf den Schlaffelsen ihrer Horde die höchste Position sichern.
In Köln jedenfalls verfolgt der Pavianboss eine andere Strategie. «Unser dominanter Pavian-Mann bevorzugt eher eine Stelle unter einem Überhang des Felsens, der regen- und windgeschützt ist», sagt der Zoologe Alexander Sliwa. Dies sei «eine Stelle auf dem Niveau des umlaufenden Ringes um den Felsen, also nicht erhöht». Der Oberaffe hält also lieber Wache an einem überaus belebten Boulevard. Dort kommt, bei irrwitzig schnellen Verfolgungsjagden und anderen Kunststücken, jeder Pavian irgendwann einmal vorbei. Für den Ranghöchsten ist das vielleicht ja die wirksamere Form der Kontrolle.
In luftiger Höhe
Wie aber halten es nun die deutschen Wirtschaftsbosse? Wer in Bonn, dem Sitz zweier DAX-Unternehmen, Bücher schreibt, sollte wenigstens bei ihnen nachfragen, ob es vielleicht ganz andere Gründe für die Etagenwahl beim Planen von Chefbüros gibt. Bei der Deutschen Telekom etwa geht es auch um die Sicherheit des Vorstands, genauer: um «Einbruchschutz, Personenschutz, Abhörschutz und Informationsschutz», sagt Unternehmenssprecher Christian Fischer. Als die Telekom-Zentrale vor etwa zwanzig Jahren geplant wurde, sei die «architektonische Wahl für die Vorstandsbüros entsprechend auf die oberste, die fünfte Etage» gefallen, und zwar ausdrücklich auch, «weil der Zeitgeist geprägt war von zahlreichen Terrorismusanschlägen gegen Vertreter aus Politik und Wirtschaft».
Betont luftig hingegen residieren Frank Appel und die übrige Führungsriege der Deutschen Post. Im schicken Post-Turm, mit seinen 41 Stockwerken das höchste deutsche Gebäude außerhalb von Frankfurt am Main, sitzt der Konzernvorstand «in den Etagen 39 und 40», teilt Christof Ehrhart mit, der die Konzernkommunikation leitet. Darüber befinden sich nur noch eine Art Penthouse für Vorstandstreffen und ein Dachgarten. Der Grund für die hochgelegenen Chefbüros sei, «dass der Vorstand auf diesem Wege in unmittelbarer Nähe zu den entsprechenden Sitzungsräumen und anderen relevanten Infrastrukturen beheimatet ist». So hätten es die renommierten Architekten des über 160 Meter hohen Bauwerks geplant. Immerhin dürften sie die Vorlieben von Konzernlenkern gekannt haben.
Grämen sollte sich jedoch nicht, wer in seinem Arbeitsleben einfach nicht über die dritte von zwanzig Etagen hinauskommt oder sogar im Erdgeschoss ein düsteres Dasein als Büro-Lemur fristen muss. Denn eine 2012 veröffentlichte australische Studie gelangt zu dem Fazit: «Beruflicher Aufstieg macht nicht glücklich.»[1] Die Forscher David Johnston und Wang-Sheng Lee untersuchten rund 2000 Beförderungen von Vollzeitbeschäftigten im Alter von 18 bis 64 Jahren und verfolgten deren Entwicklung über einen Zeitraum von zehn Jahren. Ihr Fazit: «Beförderungen am Arbeitsplatz schaden auf Dauer der psychischen Verfassung, ohne positive Auswirkungen auf körperliche Gesundheit und Lebenszufriedenheit zu entfalten.» Obwohl das Einkommen mit jedem Karriereschritt stieg und der soziale Status zunahm, überwögen langfristig die «negativen Effekte von vermehrtem Stress und längeren Arbeitszeiten». Spätestens nach drei Jahren war die Freude über den Aufstieg verflogen, und der höhere Lohn wurde nicht mehr als fair bezeichnet, wie es noch unmittelbar nach der Beförderung der Fall gewesen war. Hingegen hatten ängstliche Unruhe und Nervosität zugenommen und blieben auf Dauer unangenehm. Vielleicht können sich die befragten Australier aber wenigstens noch über den weiteren Blick aus ihren höher gelegenen Bürofenstern freuen – sofern der Aufstieg denn auch ein räumlicher war.
Weshalb der Boss so schwer erreichbar ist
Dass Vorgesetzte möglichst zugänglich sein sollen, ist seit jeher der Wunsch ihrer Mitarbeiter. Nicht umsonst schätzt man einen kurzen Draht nach oben, und mancher, der ihn hat, bildet sich mächtig etwas darauf ein. Doch ebenfalls seit Menschengedenken haben Staatenlenker, Firmenbosse oder andere Machthaber Wert darauf gelegt, sich abzuschotten, den Zugang zu sich zu erschweren und mit geschickt gewährten Ausnahmen von dieser Regel Günstlinge zu erhöhen und loyal an sich zu binden. «Willst was gelten, mach dich selten», lautet ein bekannter Spruch, auch wenn er eher die Häufigkeit als die Leichtigkeit des Kontakts anspricht. Dass Professoren, die ihre Bürotür offen lassen, bei Studierenden beliebter sind als ihre sichtbar verschlossenen Kollegen, passt hierzu gut – leider auch der Umstand, dass den zugänglicheren Dozenten nicht schon dadurch mehr Respekt erwiesen wird.
Ein bewährtes Mittel, um Macht zu inszenieren, ist seit jeher Architektur. Schon in der etwa 1700 Jahre alten Konstantin-Basilika in Trier mussten Besucher des römischen Kaisers lange Wege in Kauf nehmen, bis sie untertänigst vor dem Herrscher niederknien durften. Der Prunksaal, auch Palastaula genannt, ist der größte aus der Antike noch erhaltene; er misst in der Länge stolze 67 Meter, ist rund 27 Meter breit und 33 Meter hoch. «Er hat keine Säulen, die Decke ist also freitragend, und als jemand, der nach vorne zum Kaiser wollte, konnte man sich in diesem großen Raum schon ein wenig allein und isoliert vorkommen», sagt Robert Noll von der Trierer Touristeninformation. Nach der Audienz musste der Gast oder Bittsteller sich rückwärts vom Kaiser entfernen, durfte dem Potentaten also nicht den Rücken zuwenden – pures Machtgehabe, das zusätzlich einschüchtern sollte. Seit über 150 Jahren dient der Thronsaal nun als evangelische Kirche und damit einem anderen, für manche noch mächtigeren Herrn.
Auch die von Albert Speer entworfene und bis 1943 erbaute Neue Reichskanzlei für Adolf Hitler sollte Staatsgäste, Untergebene und Bittsteller beeindrucken – ach was: erschaudern lassen. Die Front des Gebäudes war 421 Meter lang. Vom Ehrenhof betrat man über eine Freitreppe mit Portikus (Säulengang) eine Vorhalle und danach den gut 46 Meter langen Mosaiksaal, der komplett zu durchschreiten war. Anschließend erreichte der Besucher einen runden Saal, der als architektonisches Gelenk diente, um möglichst unauffällig die Gehrichtung zu ändern. Dann war man noch immer nicht beim größten Verführer aller Zeiten, sondern betrat erst einmal die 146 Meter lange Marmorgalerie, die immerhin nur halb zu durchlaufen war, bis man endlich Hitlers Büro erreichte – und vermutlich nicht schlecht staunte: denn es maß fast 400 Quadratmeter und war, wie die anderen Räume auch, nahezu 10 Meter hoch. «All das war ganz klar eine Machtdemonstration und diente der Einschüchterung», sagt die Kunsthistorikerin Angela Schönberger, die 1978 ihre Doktorarbeit über das Bauwerk und die ideologisch gewollte Raumwirkung geschrieben hat.[1] «Speer wollte bei der Konzeption der Repräsentationsräume der Neuen Reichskanzlei bewusst an barocke Schlossarchitektur erinnern.» Der lange Weg zu Hitler war Teil des baupsychologischen Konzepts. Im Krieg nur leicht beschädigt, wurde die Neue Reichskanzlei von 1949 bis 1953 auf Geheiß der Sowjetverwaltung Ost-Berlins gesprengt.
Der Anmarschweg von Besuchern ist aber nur ein Aspekt. Nicht nur Vorgesetzte, sondern auch viele Angestellte bevorzugen nach Ansicht der Hamburger Psychologin Antje Flade ein eigenes Büro, «weil es einen höheren Status signalisiert»[2]. Wer sich mit zwei Kollegen einen Raum, mithin ein Revier, teilt, von dem nehmen unbefangene Besucher an, dass er das nicht freiwillig tut. Wer alleine arbeitet, so lautet die stille Botschaft, erledigt Wichtigeres, weil er sich öfter konzentrieren muss und nicht alle sehen sollen, was da an Wegweisendem entsteht. Auch das Arbeitsgefühl im geteilten oder gar Großraumbüro ist laut Flade ein anderes. Den Blicken anderer ausgesetzt zu sein, mache unzufrieden und mindere das Wohlbefinden. Chefs haben es da besser. Sie müssen sich den neugierigen oder auch nur gelangweilten Blicken von Untergebenen gar nicht erst aussetzen. Und sogar in Details zeigen ihre Büros, wer hier das Sagen hat. Um den Raum möglichst groß wirken zu lassen, steht der Schreibtisch von Entscheidern häufig möglichst weit von der Tür entfernt. Wer ein Anliegen hat, muss also buchstäblich weit auf den Vorgesetzten zukommen – eine subtile Form des Sichandienens.
Langer Anmarsch
Der Hamburger Managementtrainer Tom Schmitt kann dazu eine schöne Anekdote aus seiner Zeit als Angestellter eines mittelständischen Industrieunternehmens beisteuern. «Ich habe mir erlaubt, im Bereich EDV einen Verbesserungsvorschlag zu machen. Den hatte ich dem technischen Direktor vorgelegt. Wenig später hat er mich gebeten, nach dem Mittagessen mal in sein Büro zu kommen.» Schon daraus lasse sich eine übliche Statusregel ableiten: «Wer den höheren Status hat, bestimmt Zeit und Raum, zum Beispiel eines Treffens.» Schmitt hat ihr seinerzeit natürlich entsprochen und trat nach dem Anklopfen und dem «Herein» seines Vorgesetzten ein. «Da stand dann der Eichen-Schreibtisch des Direktors etwa acht bis zehn Meter entfernt ganz in der anderen Ecke des Büros, und dahinter saß er und las in seinen Unterlagen. Da geht man natürlich nicht einfach weiter auf ihn zu, sondern wartet erst mal, bis er aufschaut.» Das tat der Direktor dann auch und sagte, Schmitt solle doch mal zu ihm herkommen. «Bis ich dann vor seinem Schreibtisch ankam, war ich schon vorgeführt worden.»
Überhaupt der Schreibtisch: Ein großer wirkt als Barriere und erscheint nicht zufällig so, als wolle sich jemand dahinter verschanzen, zumindest solange die Arbeitsplatte nicht aus Glas ist. Wer noch weniger zugänglich erscheinen möchte, kann den Schreibtisch obendrein «so hinstellen, dass er andere symbolisch abwehrt»[3]. Will man Bittsteller vor dem eigenen Schalt- und Walt-Pult zusätzlich verunsichern, stellt man keinen Besuchersessel bereit oder bietet ein Stühlchen an, auf dem in Augenhöhe zu sitzen allenfalls zwei Meter großen Gästen gelingen würde. Antje Flades Fazit: «Die Macht einer Person spiegelt sich in dem Raum, in dem sie wirkt, sichtbar wider.»[4]
Menschen sind eben merkwürdige Leute. Wo immer sie aufeinandertreffen, tauschen sie stumme Statusbotschaften aus. «Neben der Möglichkeit, über die eigene Ausstrahlung den Status zu heben, gibt es natürlich auch Statusheber wie teure Handtaschen, Luxusautos oder eben das Büro – also alles das, wofür wir bereit sind, viel Geld auszugeben, um uns dafür Status zu erkaufen», sagt Tom Schmitt, der auch Koautor eines Buchs über «Status-Spiele» ist.[5] Entscheidend sei der erkennbare Unterschied zwischen dem Chef und seinen Mitarbeitern. «Wenn nämlich alle im Unternehmen ein Einzelbüro hätten, würde es den angestrebten Unterschied machen, wenn der Oberboss von sich sagen könnte: ‹Ihr alle müsst in euren Einzelbüros hocken, ich aber darf im Viererbüro sitzen.› Das würde dann auch funktionieren.» Doch nicht jeder Chef besteht auf Statusunterschieden, zumindest nicht auf große. «Vor einiger Zeit habe ich Michael Otto vorbeifahren sehen, er saß in einem ganz normalen VW Golf», berichtet Schmitt. «Das ist einfach ein ganz bescheidener Mensch.» Dabei belegt die Familie des früheren Chefs der Otto-Versandhandelsgruppe auf der Forbes-Liste unter den deutschen Milliardären den dritten Platz und Platz 34 weltweit.[6] «Er hat es offenbar nicht mehr nötig, seinen Status zu dokumentieren. Was seinerseits schon wieder statusträchtig sein könnte.»
Darin, wie man den Zugang zu sich erschwert, braucht Tom Schmitt seine Kunden nicht zu beraten. «Das wissen die schon von alleine. Denn das sind ganz gängige Statusspiele, so wie man früher einen bösen Brief geschrieben hat mit der Unterzeile: Nach Diktat verreist.» Soll heißen: Für dich bin ich nicht erreichbar, zumindest vorerst nicht, du musst also warten. Zum Beispiel gehöre es «zum allgemeinen Herrschaftswissen, dass man einem Mitarbeiter, dem man weh tun will, die Abmahnung freitags zustellen lässt». Das Wochenende verhindert sofortigen Widerspruch. Auch Ämter verführen so, wenn sie Zahlungsbescheide oder Mahnungen verschickten. Montags, wenn man sich frühestens beschweren oder auch nur Verständnisfragen stellen könnte, sei «der Ärger oft schon halb verraucht, weil man am Wochenende Zeit hatte, über den Vorgang mal in Ruhe nachzudenken». Auch der für Schüler nicht immer zugängliche Hausmeister oder ein Busfahrer, der Fahrgäste bei verschlossenen Türen unnötig lange vor dem Bus warten lässt, «baut über das verteidigte Territorium Status auf». Manchmal wirkt es lächerlich auf jene, die das Theater durchschauen. Und letztlich ist es das ja auch.
Wie wir unseren Platz markieren
Es mutet albern an, ist aber zutiefst menschlich. Ob in der Volkshochschule, im Hörsaal oder im Besprechungsraum der Firma: Belegt unser Sitznachbar nicht nur seine, sondern auch die Tischfläche vor uns mit seinen Unterlagen oder Schreibgeräten, schieben wir die frech in unser Revier ragenden Eindringlinge sachte dorthin zurück, wo sie unserer Ansicht nach hingehören. Auch Menschen dürfen uns nicht zu nahe treten. Denn mit unserem Distanzbedürfnis verhält es sich so ähnlich wie mit dem der frierenden Stachelschweine, über die Arthur Schopenhauer 1851 ein sehr anschauliches Gleichnis veröffentlichte. Die kleine Geschichte beginnt so:
«Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich, an einem kalten Wintertage, recht nah zusammen, um, durch die gegenseitige Wärme, sich vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln; welches sie dann wieder von einander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so daß sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung von einander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten.»[1]
Der kauzige Schopenhauer wäre nicht der hoffnungslose Pessimist gewesen, als den man ihn kennt, wenn er hinter den bildhaften Stacheln nicht die «vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler» der Menschen gesehen hätte. Gerade noch erträglich sei das Leben durch «Höflichkeit und feine Sitte» – in der Fabel versinnbildlicht durch die «mäßige», soll heißen: mittlere Entfernung zueinander, die vernünftige Menschen einhalten sollten, um von ihren Artgenossen nicht derart gereizt zu werden, dass man einander bald die Schädel einschlägt. Vom nötigen Abstand, bei welchem «ein Beisammensein bestehen kann», schreibt der Philosoph dann weiter: «Dem, der sich nicht in dieser Entfernung hält, ruft man in England zu: keep your distance!» Hier haben wir es also aus berufenem Mund: unser Bedürfnis nach geziemendem Abstand. Und also errichten wir Mauern und Wälle, zimmern Zäune und ziehen Grenzen um unsere Länder. Wir grenzen uns ab und erwarten von unseren Mitmenschen dasselbe. Und wehe, ein Unbefugter hält sich nicht daran!
Unser Wunsch nach einem Revier, das von anderen beachtet wird, treibt sonderbare Blüten. Der Psychologe und Verhaltensforscher Graham Brown unterscheidet drei Arten von Reviermarkierungen, mit denen wir anderen Menschen unsere Raumansprüche verdeutlichen: erstens Identitätsmarken («Hier will ich ich sein!»), zweitens Kontrollmarken («Hier ist besetzt!») und drittens Verteidigungsmarken («Finger weg, das gehört mir!»). Als solche können Passwörter im Computer, verriegelte Kellertüren im Mehrparteienhaus oder Vorhängeschlösser an einem Schrank oder Spind gelten.[2] Verteidigungsmarken sind auch verriegelte Bad- oder WC-Türen, wie sie keineswegs überall üblich sind: In manchen Familien schließt man beim Gang ins Bad grundsätzlich die Tür hinter sich ab, in anderen bleibt diese auch dann offen oder zumindest unverschlossen, wenn man zur Toilette geht oder duscht. Hier spielt mehr oder minder große Scham die entscheidende Rolle.
Identitätsmarken als Signale unserer Besonderheit setzen wir zum Beispiel dort ein, wo wir einen uns völlig fremden Raum in Besitz nehmen und uns mit ihm vertraut machen müssen. Das kann ein neues Einzelbüro, aber auch eine Gefängniszelle sein. Wir bedienen uns solcher Marken auch, wo wir auf engem Raum mit Kollegen arbeiten, zum Beispiel in Großraumbüros, die mit ihren einförmigen Tischen oder Arbeitsnischen meist sehr unpersönlich wirken. Um unsere Unverwechselbarkeit zu unterstreichen, hängen wir Urlaubsfotos, Bilder unserer Lebenspartner oder Zeichnungen unserer Kinder auf. Oder wir verzieren unsere Arbeitsbox mit Cartoons und Aufklebern, die wir witzig finden.
Mit Kontrollmarken wiederum versuchen wir unser Revier als solches gegen mögliche Eindringlinge abzugrenzen und fremde Ansprüche abzuwehren. Im Zugabteil oder auch nur auf einem Zweiersitz im Intercity legen manche Fahrgäste äußerst effektvoll Zeitungen aus, auf dass sich niemand zu ihnen setzen möge. Noch abschreckender wirken die Füße auf dem gegenüberliegenden Sitz. Erstaunlich, wie viele Menschen das klaglos hinnehmen, zumindest solange noch andere Plätze im Waggon frei sind: Die Frage, ob der erkennbar nicht besetzte, aber doch markierte Platz noch frei sei, scheint vielen Reisenden entweder zu aufwendig oder zu peinlich zu sein.
Aus psychologischer Sicht gehen Unternehmen ein Risiko ein, indem sie zunehmend feste, persönlich zugeordnete Büroschreibtische abschaffen und ihre Angestellten damit am Arbeitsplatz heimatlos machen. Stattdessen finden sich immer wieder neu zusammengesetzte Projektteams zusammen, die sich in kleinen Konferenzräumen oder dergleichen treffen. Das spart Platz, wirkt innovativ und ermöglicht es, räumlich bedarfsgerecht zusammenzuarbeiten. Zeigen muss sich aber noch, ob die Beschäftigten eine vertraute, persönlich gestaltete Arbeitsumgebung auf Dauer nicht schmerzlich vermissen werden. Die Unternehmensgruppe Freudenberg in Weinheim hat in ihrem Innovationscenter offenbar gute Erfahrungen mit dem Auflösen fester Arbeitsplätze gemacht. Seither nehmen dort die Angestellten morgens ihren Rollcontainer mit ihren persönlichen Arbeitsmaterialien und setzen sich zu den Kollegen, mit denen sie gerade zusammenarbeiten. Das soll den Austausch von Ideen fördern und produktiveres Arbeiten ermöglichen. Wer in aller Ruhe nachdenken muss, kann sich nach wie vor ins Einzelbüro zurückziehen.[3]
Ungeliebte Zellbüros
Die vor allem in den USA weit verbreiteten Großraumbüros mit abgetrennten Arbeitsplätzen (im Englischen cubicles genannt) sind in Deutschland eher unbeliebt. Viele Menschen fühlen sich in solchen Bürozellen kontrolliert, sind genervt von lauten Telefonaten ringsum sowie abgelenkt durch das Gewusel umherlaufender Kollegen. Deshalb legen die Angestellten gerade in Großraumbüros Wert auf einen Rest von Privatsphäre und Abgeschiedenheit. Beides hängt entscheidend davon ab, wie hoch die Trennwände zwischen den Zellen sind: Einer Studie zufolge haben sich 1,40 Meter hohe Wände als besonders günstig erwiesen, denn sie schirmen einen sitzenden Mitarbeiter gut von seinen Nachbarn ab, erlauben im Stehen aber leicht den Kontakt zueinander.[4]