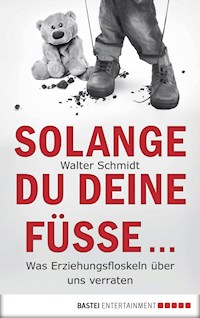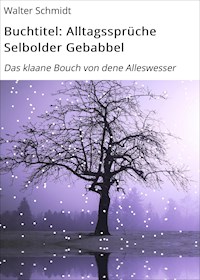8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ob wir sie mögen oder nicht: Viele Sprichwörter haben sich uns derart eingeprägt, dass wir bei jeder passenden Gelegenheit automatisch an sie denken müssen. Und das, obwohl sie oft genug ein wenig altbacken klingen. Walter Schmidt klopft einige der bekanntesten Lebensweisheiten auf ihren sachlichen Gehalt ab und denkt darüber nach, ob sie uns noch Orientierung bieten können. Die Zeit heilt alle Wunden? Mediziner und Psychologen können bestätigen, dass dies längst nicht immer der Fall ist. Jeder ist seines Glückes Schmied? Die soziale Mobilität in unserer Gesellschaft spricht eine andere Sprache. Warum ist aller Anfang schwer? Dazu können Motivationspsychologen Erhellendes sagen. Gelegenheit macht Diebe? Das wissen Polizei und Rechtsexperten am besten. Morgenstund hat Gold im Mund? Schlafforscher sind sich da nicht so sicher. Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter? Auf unser Immunsystem trifft das nur bedingt zu. «Walter Schmidts Analysen eröffnen einen neuen Zugang zur Welt der alltäglichen Sprichwörter.» Frankfurter Rundschau «Ebenso fachkundig wie kurzweilig.» Märkische Allgemeine «Die unterhaltsame Lektüre birgt so überraschende wie lehrreiche und lebensnahe Einsichten.» Deutschlandfunk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Ähnliche
Walter Schmidt
Morgenstund ist ungesund
Unsere Sprichwörter auf dem Prüfstand
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für Rose
Wie Sprüche auf uns wirken
Aller Anfang sei schwer, sagt ein Sprichwort. Womit also beginnen? Vielleicht ja damit, dass uns Spruchweisheiten wie die vom ach so schwierigen Beginn durchs ganze Leben verfolgen, bisweilen einleuchten, gelegentlich erheitern, aber manchmal auch gehörig nerven. Schon als wir Kinder waren, wurden sie uns vorgehalten – von Erwachsenen, die vermutlich froh waren über Stegreifsprüche, die als unabweisbar gelten. Schaden konnten die bewährten Lebensregeln ja schließlich nicht. Dachte man zumindest …
Mein Vater zum Beispiel behalf sich bisweilen mit der Trostformel «Ein Indianer kennt keinen Schmerz», wenn ich mir beim Sturz auf dem Bolzplatz mal wieder ein Knie aufgeschürft hatte und in schlimmeren Fällen deswegen auch Tränen vergoss. Was man als «richtiger Mann» ja angeblich bis heute nicht tut – und als echtes Männlein mit Ambitionen auf mehr am besten auch nicht. Die angeblich schmerzunempfindlichen Indianer haben mich jedenfalls sehr beeindruckt – wirklich tolle Hechte, diese Kerle! Seltsam nur, dass die Wildwest-Filme sie ganz anders zeigten: Wenn die Gewehrkugeln der Kavallerie die mit ihren Tomahawks und Flitzebögen chancenlosen Rothäute trafen, fielen diese sehr wohl mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Pferd. Aber das waren ja nur Filme. Auf die angeblich von aller Pein befreiten Ur-Amerikaner werden wir noch zurückkommen, ebenso auf den heiklen Anfang einer Sache.
Lebensregeln und Sprichwörter müssen nur oft genug wiederholt werden, um sich ins Hirn zu brennen, ähnlich wie Reklame: Wer süffige Slogans drechselt und neue Namen für nicht immer ganz neue Produkte ersinnt, besetzt die Gedanken und öffnet die Geldbörsen. Dann will man kein beliebiges Musikabspielgerät mehr haben, sondern nur noch einen iPod.
Auch populäre Spruchweisheiten entfalten mit der Zeit eine unterschwellige Wirkung, der man sich nur schwer entziehen kann. Wenn einem die Mutter oder Oma zigmal zugeraunt hat, man solle «bloß den Tag nicht vor dem Abend loben», läuft man Gefahr, ein misstrauischer Geselle zu werden – mithin jemand, der sich lieber nicht zu früh freut. «Bewusst oder unbewusst verinnerlichen wir die Weisheit von oft gehörten und wiederholten Sprichwörtern, die dann unser Denken und Handeln beeinflussen», sagt Wolfgang Mieder von der Universität Burlington in Vermont/USA, ein ausgewiesener Fachmann für traditionelle deutsche Spruchweisheiten. Keineswegs zufällig seien diese nicht nur ähnlich sinnfällig, sondern auch in etwa so lang wie Werbesprüche; sie umfassten «selten mehr als sieben Wörter». Nach Mieders Ansicht kann man sich «keinen Slogan ausdenken, wenn man nicht eine gute Sprichwörtersammlung auf dem Schreibtisch hat».[1]
Geläufige Sprichwörter gingen vor allem auf die Antike, die Bibel oder das lateinisch geprägte Mittelalter zurück. Auch wenn die genaue Herkunft meist im Dunkeln liegt, sei der Urheber einer Spruchweisheit stets ein einzelner Mensch und keineswegs die Volksseele. Dass genau dies gelegentlich behauptet werde, «ist natürlich Unsinn», findet der Professor für deutsche Sprache und Folklore.[2] Auch seien die Sprüche «keine Universalweisheiten». Sie widersprächen einander manchmal sogar «wie das Leben selbst» und begründeten insofern «kein logisches System». Eine «ganz primitive Definition» des typischen Sprichworts lautet in Mieders Worten denn auch so: «eine kurze Aussage, die eine angebliche Wahrheit beinhaltet und in gewissen Kreisen der Bevölkerung gängig ist».[3]
Das alles eröffnet die famose Chance, mit Spruchweisheiten nahezu alles zu untermauern, was nach einem guten Fundament verlangt. Wer das für sich zu nutzen versteht, wählt stets dasjenige Sprichwort aus, das einen beim Handeln, Begründen oder Überlegen gerade «am besten unterstützt», sagt der Sprachforscher. Insofern seien die Sprüche «strategisch eingesetztes, vorformuliertes Weisheitsgut, das sich zu verschiedenen Gelegenheiten oder Situationen anwenden lässt». Beispielsweise benutze man Spruchweisheiten auch in Selbstgesprächen, «um sich zu gewissen Handlungen zu motivieren». Das gilt zumindest für Erwachsene.
Selbstverständlich können Kinder die Botschaft eines Sprichworts anfangs kaum verstehen; dazu reicht ihr kulturelles Vorwissen nicht aus. Und dennoch prägen sich die Sprüche im kindlichen Hirn allmählich ein. «Wegen ihrer guten Merkbarkeit werden sie dort nämlich vernetzt mit bestimmten Situationen, die das Kind gerade erlebt, wenn es ein Sprichwort vernimmt», sagt die Kulturwissenschaftlerin Eva Kimminich von der Universität Potsdam. Geraten die Kinder später, nachdem sie verständiger geworden sind, in ähnliche Situationen, erinnerten sie sich blitzartig auch wieder an die abgespeicherten Sprichwörter. Und dann erschließe sich ihnen der bis dahin noch verborgene Sinn der Ausdrücke.
Dass es Redensarten und Spruchweisheiten in den meisten, wenn nicht allen Kulturen gibt, verrät den großen Bedarf an Merksätzen. Deren Hauptaufgabe sei es, «Komplexes zu vereinfachen», sagt Dagmar Schmauks von der Technischen Universität (TU) Berlin, die sich als Fachfrau für Zeichentheorie intensiv auch mit Redensarten beschäftigt. Das sei ganz ähnlich wie bei althergebrachten Bauernregeln, die «ja auch von Generation zu Generation mündlich überliefert worden sind und sich mehr oder minder bewährt haben» – wenn auch bloß in jenen Landschaften, wo sie einst entstanden sind. In einer kaum überschaubaren, verwirrenden Welt sind sprachliche Faustregeln jedenfalls «sehr hilfreich, um seine persönliche Umwelt besser in den Griff zu kriegen». Aus demselben Grund neigten Menschen generell «zur Schwarz-Weiß-Malerei» und unterschieden – stark vereinfachend – «die guten von den bösen Leuten».
Zudem entfalten Sprichwörter moralische Kraft. Möglichst bildhaft sollen sie Regeln für erwünschtes Verhalten vermitteln. Bevor man lang und breit über die Folgen mangelnder Wahrhaftigkeit ausholt, sagt man halt lieber: «Lügen haben kurze Beine.» Gerade kleinere Kinder, auch sie mit kleinen Schritten unterwegs, können sich das Gemeinte dann lebhaft vorstellen: Irgendwann holt die offenbar flinkere Wahrheit jede Lüge ein, weshalb man lieber ehrlich bleibt.
Unterstützt wird diese Wirkung durch den Umstand, dass Spruchweisheiten aus gutem Grund sehr kurz und alltagssprachlich formuliert sind. Sie kommen ohne Fachwörter aus und enthalten häufig einen Reim – zwei weitere Gründe, weshalb man sie so leicht behalten und mündlich an die nächste Generation überliefern kann. Mit der Zeit gehören sie zum Wissensschatz von Kulturen. Inwiefern sie ihn freilich auch bereichern, versucht dieses Buch zu klären.
Zwar leben Sprichwörter meist recht lange, doch unsterblich sind sie nicht. Mit der Zeit können sie rätselhaft werden, «wenn der fürs Verständnis nötige Wissenshintergrund verloren geht», sagt Dagmar Schmauks und verdeutlicht es am Beispiel «Spinnen am Morgen bringt Kummer und Sorgen; Spinnen am Abend erquickend und labend». Da heutzutage kaum noch jemand am Spinnrad sitzt, sähen manche Menschen bei diesem Spruch «inzwischen das Krabbeltier vor sich, das aber natürlich nicht gemeint ist».
Vielmehr sollten die Bauern früher mit der Feldarbeit schon zeitig am Morgen beginnen und nicht etwa Handarbeiten erledigen. «Spinnen war ja keine richtige Arbeit, das machte man am Feierabend, um sich zu erholen, während man damit gleichzeitig etwas Nützliches tat.» Damen aus besseren Kreisen wiederum drehten das Spinnrad beim abendlichen Geplauder. Außerdem war zum Spinnen das für Bauern unbedingt auszunutzende Tageslicht nicht nötig, weshalb es auch in der Dämmerung oder beim dürftigen Schein eines Talglichts geschehen konnte – und das meist für den Eigenbedarf. Wer jedoch schon morgens spann, musste dies in der Regel tun, um das gesponnene Garn zu verkaufen und so seinen Lebensunterhalt aufzubessern. Das war weder erquickend noch labend, sondern verriet «größte Armut».[4]
Sprichwörter beeinflussen unser Denken zwar, doch schleift sich ihre moralische Wucht allmählich ab. Fachleute bezeichnen sie nämlich als Phraseologismen. Solche sprachlichen Fertigbausteine sind im Hirn als Ganzes abgespeichert, sodass es «keiner geistigen Anstrengung mehr bedarf, sie zu verarbeiten», sagt die Sprachwissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesel von der TU Berlin. Je weniger aber unser Geist beansprucht werde bei einer Lern- oder Erinnerungsaufgabe, umso schwächere Spuren hinterlasse sie im Gehirn. Über Altbekanntes denken wir eben nicht mehr groß nach, zum Beispiel über hundertmal gedroschene Phrasen, die nichts mehr hergeben außer fruchtlosem Stroh.
Infolgedessen sei die Wirkung oft gehörter Lebensregeln grundsätzlich «geringer als zum Beispiel die von innovativen Metaphern». Auch deshalb war der 2003 auf die Menschheit losgelassene Reklameschrei «Geiz ist geil» eines großen Elektronikhändlers ein so gewaltiger Aufreger. «Es wäre natürlich empirisch zu überprüfen, inwieweit Sprichwörter unbewusst wirken und zum Beispiel im Gehirn bestimmte Bereiche aktivieren», fügt Schwarz-Friesel hinzu. «In jedem Fall lösen sie – wie alle sprachlichen Äußerungen – niemals nur geistige Prozesse aus», sondern setzen auch Gefühle frei.
Das hat die Berliner Linguistin unlängst selber ermitteln können, als sie unter Studierenden und Mitarbeitern ihres Instituts die Wirkungen mehrerer Sprüche testete. «Bei vielen Hörern lösen sie oft Langeweile, teils aber auch Ärger aus.» Zum Beispiel lautete ein Kommentar: «Schon wieder so ein dämlicher Spruch.» Und einige Spruchweisheiten wurden auch «als empörend und zynisch bewertet», so zum Beispiel das Sprichwort «Kein Schaden ohne Nutzen». Häufig empfanden die Befragten die Sprüche als veraltet und belehrend – vielleicht auch deshalb, weil es Eltern und Lehrer waren, von denen sie die Spruchweisheiten erstmals gehört hatten.
Angesichts von nur 66, weit überwiegend weiblichen und zudem an der Universität tätigen Testteilnehmern ist die kleine Berliner Umfrage zwar nicht sonderlich belastbar und keineswegs repräsentativ.[5] Dennoch deutet sie an, wie Sprichwörter wirken. Immerhin 54 von 66 Befragten gaben an, Spruchweisheiten selber zu nutzen, 20 davon sogar im Freundeskreis. Lediglich vier Teilnehmer machen sprachlich einen Bogen um die vorgestanzten Aussagen. Doch wer kann sich mit Blick auf die vielen Hundert mehr oder minder gebräuchlichen Wendungen wirklich sicher sein, nie welche zu benutzen! Vielleicht das spannendste Ergebnis: Nur zwei von 66 Testpersonen schätzen Sprichwörter noch als «zeitgemäß» ein. Ein überraschend negatives Urteil – und vor allem kein zutreffendes. Denn was immer jemand von Spruchweisheiten hält: In Kontakt kommen wir alle damit – und zwar häufiger, als uns bewusst ist.
Doch sehen Sie selbst und beginnen Sie Ihre Lektüre getrost bei jenem Sprichwort, das Sie am meisten interessiert – ganz im Gegensatz zur strengen Maxime «Erst die Arbeit, dann das Vergnügen». Und wenn Sie ein komplettes Kapitel gar nicht reizt, dann überspringen Sie es eben. Das hält fit und munter, denn: Wer rastet, der rostet!
Zu überprüfen, was dran ist an den ollen Sprüchen, wäre mir nicht einmal ansatzweise gelungen ohne die Kompetenz etlicher Fachleute und ihre Bereitschaft, geduldig meine Fragen zu beantworten – vor allem die Nachfragen. Ebenso herzlich danken möchte ich all diesen hilfsbereiten Frauen und Männern dafür, dass sie sich obendrein die Zeit genommen haben, ihre Aussagen gegenzulesen.
Sie hier alle namentlich aufzuführen, würde wenig bringen; ihre Namen tauchen ohnehin im Buch immer wieder auf. Wo immer ich keine Quelle für eine Aussage genannt habe, geht das betreffende Zitat auf ein persönliches Telefonat oder eine Auskunft per E-Mail zurück. Herzlich danke ich auch meinem Lektor Christof Blome, der mir wertvolle Hinweise zum Straffen des Manuskripts geliefert hat – und zweifellos eine schöne Stelle aus Wolfram von Eschenbachs «Parzival».
Walter Schmidt
Bonn, im März 2012
Weisheit und Klugheit
«Durch Schaden wird man klug.»
Eine Zweijährige, die einen heißen Grillrost anfasst, wird ihre Hand ruckartig zurückziehen, noch ehe sie den Schmerz wahrnimmt und «Aua!» schreit. Denn die Hand erhält vom Rückenmark blitzartig den Befehl, sich vom Rost zu heben, um Schlimmeres als gerötete Haut oder ein Brandbläschen zu verhindern. Mediziner nennen diese noch unbewusste erste Stufe der Reaktion nicht umsonst Schutzreflex. Denn kein Mensch muss das, was vor sich geht, bereits genau verstehen, während seine Finger gerade verkokeln.
Klüger aus dem Schaden kann das Kind erst im Gehirn werden. Dort erreicht der Schmerzreiz über Nervenbahnen des Rückenmarks den Thalamus, der den größten Teil des Zwischenhirns einnimmt. Er gilt als Tor oder Pförtner zum Bewusstsein und entscheidet darüber, ob ein Warnsignal für den Organismus bedeutsam ist. Kein Mensch will ständig von Drucksensoren in den Füßen darüber informiert werden, dass er Schuhe trägt. Falls der Thalamus den Schmerzreiz für wichtig hält, wird dieser im nahe gelegenen limbischen System emotional bewertet – im Falle des glühenden Grillrostes als gesundheitsschädlich und künftig zu meiden. Erst die eng mit dem Thalamus verbundene Großhirnrinde macht uns den Schmerz bewusst und erfasst, wo und wie er entstanden ist: nämlich an der Handfläche beziehungsweise durch Anfassen der heißen Metallstäbe.
Das Beispiel mit dem heißen Grill und dem verbrannten Finger erweckt den Eindruck, als sei es sehr simpel, aus einem Schaden die richtigen Schlüsse zu ziehen und den begangenen Fehler künftig zu vermeiden. Doch dazu müssen wir Ursache und Wirkung durchschauen können, und das ist nicht immer leicht. Nehmen wir nur die schleichenden Gefahren – womit keine Raubkatzen gemeint sind, sondern Unheil, das unmerklich eintritt. Zum Beispiel wandelt sich die durchschnittliche Temperatur der Erdatmosphäre für uns nicht wahrnehmbar in Hundertstel-Grad-Schrittchen über Jahre hinweg, und weltweit gehen ähnlich unspektakulär fruchtbare Ackerböden und Wälder verloren oder sterben Tier- und Pflanzenarten aus. Für solche Vorgänge sind unsere Sinne nicht gemacht. Wer Artenschwund und Klimawandel glauben und dann selber dagegen angehen will, muss deshalb Fachleuten und ihren Messdaten vertrauen. Und nicht nur das: Der Betreffende muss außerdem seine Lebensweise verändern, ohne rasche (oder überhaupt) Erfolge zu sehen. Entsprechend schwer fällt es uns, aus all den alarmierenden Berichten über die Umweltfolgen unseres Lebens und Wirtschaftens etwas zu lernen.
Darüber hinaus wird unser Lernerfolg aus erlittenem Schaden dadurch behindert, dass wir das Ungemach leugnen können, solange es geht. Oder wir machen andere Ursachen dafür verantwortlich. Glücksspieler zum Beispiel schieben die Schuld für ihre Verluste am Roulettetisch gerne auf ein «ungünstiges Horoskop» oder hatten «halt einfach Pech». Zum Schaden gesellt sich demnach mangelnde Einsicht, verschärft durch eingefleischte Gewohnheiten oder gar Süchte. Herzkranke etwa, deren Infarkte oder Gefäßengpässe durch Rauchen zumindest mitverursacht worden sind, tun sich oft schwer damit, ihren Lebenswandel zu ändern. «Von den Rauchern unter den Herzpatienten werden 45 Prozent klug und geben das Rauchen dauerhaft auf», sagt der Psychologe Jochen Jordan, der die Abteilung für Psychokardiologie an der Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim leitet. Das bedeutet aber auch: Mehr als die Hälfte ändert ihr schädliches Verhalten nicht. Seit es keine Raucherzimmer in Krankenhäusern mehr gebe, stünden die Unbelehrbaren am Eingang von Rehakliniken «wie ein rauchendes Begrüßungskomitee in Sporthosen und Bademänteln».
Generell blieben die Erfolge von Rehabilitationsplänen «auf lange Sicht leider eher bescheiden», ganz gleich, ob es um gesündere Ernährung, mehr Bewegung oder um das Einüben von Entspannungstechniken geht. Jordan findet das «im Grunde paradox: Die Leute haben Todesangst und beschäftigen sich intensiv damit, aber Lebensstil-Änderungen sind extrem schwer durchzusetzen.» Unheilvoll wirken können hier Angehörige oder Freunde, die den zunächst veränderungswilligen Kranken nicht unterstützen oder sogar dazu verführen, erneut zum Glimmstängel zu greifen. Ähnlich ungesund sind Arbeitswütige in der Firma, die jeden Kollegen als «Minderleister» verhöhnen, der am Geburtstag der kleinen Tochter die Schippe weglegt oder den Rechner im Büro zwei Stunden früher ausschaltet.
Das erschwert es gerade Menschen mit koronarer Herzkrankheit, also verengten Herzkranzgefäßen, ein paar Gänge herunterzuschalten. Sie seien nämlich «häufig stark leistungsorientiert», sagt Georg Titscher, leitender Psychokardiologe am Wiener Hanusch-Krankenhaus. Oftmals unbewusst wollen sie über ihren Leistungswillen «ihr Selbstwertgefühl steigern». Doch gerade dieses werde durch die Herzkrankheit – und ganz besonders durch einen Infarkt – zusätzlich geschwächt, bedauert der Mediziner. Dadurch fällt es den Betroffenen jetzt noch schwerer, das angestrebte Ziel zu erreichen – zumal da ihre Leistungskraft zumindest eine ganze Zeit lang vermindert ist. Nicht wenige Patienten treibt dieses Dilemma in eine Depression, und diese belastet das Herz neuerlich, wie man heute weiß.
Sich im Job zurückzunehmen, ein Stück weit loszulassen, ist doppelt schwer in einer Zeit mit zunehmender Arbeitsverdichtung, höheren Erwartungen der Arbeitgeber und wachsender Job-Unsicherheit gerade für ältere Beschäftigte. Jochen Jordans Fazit: «Innere Unvernunft und äußere Erwartungen und Zwänge machen es Herzkranken wirklich sehr schwer, aus Schaden klug zu werden und dementsprechend weiterzuleben.»
Dass wir uns gegen lehrreiche Erkenntnisse viel öfter sperren, als uns lieb und bewusst ist, mag verwundern, wo doch das Lernen aus Fehlern im Grunde einfach sein könnte. Doch erscheint der vermeintlich simple Vorgang «weniger selbstverständlich, wenn man an Sigmund Freuds Beobachtung denkt, dass Patienten mit psychosomatischen, stressabhängigen Symptomen wie Kopfschmerzen, Zwängen oder einer Depression oft denselben Fehler wiederholen», sagt der Persönlichkeitsforscher Julius Kuhl von der Universität Osnabrück. Freud nannte dieses Phänomen «Wiederholungszwang».
Bis heute erleben es Psychoanalytiker (und streben es im Sinne des Therapieerfolgs auch an), dass viele ihrer Patienten sie unbewusst dazu benutzen, alten seelischen Verletzungen immer wieder eine aktuelle Bühne zu bieten – wie einem Theaterstück, das komplett in eine andere Zeit zu gehören scheint. So könnte der Patient sich kontrolliert fühlen und dies beklagen, nur weil der Therapeut immer wieder darauf pocht, dass die Sitzung zur vollen Stunde beginnt und nicht erst zehn Minuten später, von 20 ganz zu schweigen. Doch gemeint mit dem Protest ist in Wahrheit nicht der Analytiker, sondern vielleicht der überstrenge, inzwischen längst verstorbene Lehrer, der vor 25 Jahren jede Minute zu späten Erscheinens dazu missbrauchte, seinen abgehetzten Schüler vor der Klasse genüsslich zu demütigen.
Im wahren Leben macht sich ein Wiederholungszwang beispielsweise bemerkbar, wenn eine Frau immer wieder Männer als Liebespartner wählt, die sie schlagen oder in anderer Form übel behandeln und ihr gar nicht guttun können – ganz so, als wolle sie in Gestalt dieser selbst neurotischen Unholde ihren früher ständig prügelnden Vater doch noch für sich einnehmen, oder vielmehr: endlich von ihm geliebt werden.
Doch wieso lernen wir aus manchen Fehlern, während wir für andere offenbar blind sind und sie munter weiter begehen? «Dieses Paradox wird verständlich, wenn man versteht, dass wir Fehler nur dann in Zukunft verhindern können, wenn unsere Selbstwahrnehmung intakt ist», erklärt Kuhl den nur scheinbaren Widersinn. «Unser Selbst ist unsere gesammelte Lebenserfahrung», ein ausgedehntes, unbewusstes Netzwerk an Erlebnissen. Doch bei Stress werde der Zugang zu diesem Schatz an Erkenntnissen gehemmt. «Deshalb wird die Fehlerwahrnehmung nicht in die Erfahrungsnetzwerke des Selbst eingespeist», sagt der Psychologe. Und dann «wird man durch Schaden eben nicht klug».
Weiser kann die Frau mit den falschen Männern mithin nur werden, wenn sie – in Ruhe und verständnisvoll begleitet – zu verstehen lernt, warum die bisher bevorzugten Partner ihr letztlich schaden und worin die verborgene Botschaft ihrer Wiederholungen liegt. Das gilt vom Prinzip her auch für Zwangsneurotiker, die sich zum Beispiel unentwegt die Hände waschen oder prüfen, ob die Haustür auch wirklich verschlossen ist. «Wie genau eine Zwangserkrankung entsteht, ist bislang noch unklar», heißt es bei der Deutschen Gesellschaft für Zwangserkrankungen. Diskutiert werden genetische sowie erlernte und lebensgeschichtliche Faktoren, die allesamt die Biochemie des Hirns und dessen neuronale Aktivität verändern.[6] Übrigens sind auch Verliebte in diesem Sinne zwanghaft: Der für den Gefühlshaushalt so wichtige Nervenbotenstoff Serotonin ist bei ihnen auf einen krankhaft niedrigen Pegel gefallen – was sich mit der Zeit freilich wieder günstiger einregelt.
Aus psychoanalytischer Sicht halten Betroffene durch ihre Zwänge lediglich eine Handlungslust in Schach, die eigentlich das verpönte Gegenteil erreichen möchte – zum Beispiel endlich mal nach Herzenslust im Dreck herumzumatschen oder Chaos in der sonst penibel aufgeräumten Wohnung zu stiften. «Mit Hilfe seiner ritualisierten Verhaltensweisen versucht der Zwangserkrankte, die verbotenen Impulse auszulöschen und damit ungeschehen zu machen.»[7]
Verhaltenstherapeuten hingegen erklären Zwangsneurosen eher damit, dass die Betroffenen ihr auf Ängsten gründendes Handeln erlernt haben; danach wären sie klassisch konditioniert worden, beispielsweise durch neurotisch besorgte Eltern. Angst wird halbwegs erträglich, wenn man sie kontrolliert. Frischverliebte beispielsweise versuchen ihre Verlustangst zu besänftigen, indem sie alle paar Stunden Liebesbeweise erbitten oder – deutlich geschickter – eigene an den Mann oder die Frau bringen. Und Privatanleger bekämpfen bei abstürzenden Börsen ihre Verarmungsangst dadurch, dass sie alle halbe Stunde im Internet die Aktienstände überprüfen, so als könnten sie den Kursrutsch auf diese Weise aufhalten. Ob sie nachher, sollte der Schaden wirklich eingetreten sein, aus ihm klug werden, steht auf einem anderen Blatt. Wie sagen doch die Briten: «Kostspielig ist die Weisheit, die wir uns durch Erfahrung erkaufen.»[8] Wenn es gutgeht, haben die Anleger genug Geld, um sich die teure Lehre auch leisten zu können.
Wer aus Schaden selten klug wird, kann sich damit trösten, dass es den Menschen in früheren Jahrhunderten auch nicht anders ging. So schrieb schon der französische Philosoph Claude Adrien Helvétius (1715–1771): «Eine vergangene Torheit klärt die Menschen nur selten über ihre gegenwärtige auf.»[9] Wäre es nur anders.
«Der Klügere gibt nach.»
Noch heute ziehen Eltern ihre Kinder aus dem Sandkasten, wenn ihr – natürlich ungemein schlauer und frühbegabter – Vierjähriger im Streit um den rechtmäßigen Besitz einer roten Plastikschaufel bei einem hartnäckigen Altersgenossen den Kürzeren zieht. Sie denken: Dieser stumpfsinnige Tölpel sieht es halt nicht ein, dass mein Kind die Schippe zuerst gefunden hat, aber bevor sie noch aufeinander eindreschen und mein Zuckerjüngelchen eins aufs Mützchen bekommt, hole ich es da lieber raus. Und das tun sie dann auch und trösten ihren greinenden Nobelpreis-Anwärter mit den Worten: «Lass ihm doch die blöde Schaufel, der Klügere gibt sowieso nach!»
Muttis und Papis ahnen nicht einmal, wie demütigend solche Rettungsaktionen sein können. Denn das Kind denkt bei sich, wenn auch in schlichterer Sprache: «Was nützt es mir denn jetzt, der Klügere zu sein, wenn dieser Depp die Schippe bekommt und also auch noch belohnt wird für seine Sturheit?» Dumme gibt es genug auf dieser Welt. Soll man also jedes Mal nachgeben, nur um Streit zu vermeiden? Was lernt ein Kind, wenn es dazu erzogen wird? Gut möglich, dass es im heutigen Jugend-Slang schnell als «Opfer» dastünde.
Vielleicht sollte das vielbemühte Sprichwort ohnehin besser lauten: «Der Bequemere gibt nach.» Oder auch: «Der Konfliktscheuere …». Denn wenn in der Tat stets der Klügere nachgäbe und sich dabei womöglich noch moralisch erhaben fühlte, dann würde es schlecht um die Menschheit stehen. Schon die Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) hat die Verhaltensmaßregel einmal als eine «traurige Wahrheit» bezeichnet, welche die «Weltherrschaft der Dummheit» begründe.[10] Damit liegt sie weniger falsch, als ihr plakativer Ausspruch nahelegen mag.
Der US-Psychologe Irving Janis (1918–1990), der an den berühmten Universitäten Yale und Berkeley forschte und lehrte, hat das Verschweigen – zumindest anscheinend – besserer Lösungen beim Diskutieren mit Vorgesetzten und Kollegen als Gruppendenken («groupthink») bezeichnet. Dieses führe bisweilen zu fatalen Ergebnissen. Der besser Informierte oder Kompetentere ziehe nämlich aus der oft nur zur Schau getragenen Einhelligkeit aller anderen in der Diskussionsrunde den falschen Schluss: «Wenn alle anderen einer Meinung sind, muss meine abweichende Meinung falsch sein.» So beschreibt der Schweizer Schriftsteller und Unternehmer Rolf Dobelli die «Illusion der Einstimmigkeit» in einer Kolumne über die Tücken der «Konsensfalle». Man wolle bloß «kein Spielverderber sein, der die Einmütigkeit zerstören könnte». Schließlich sei man froh, zur Gruppe zu gehören, und ein veröffentlichter Vorbehalt könne nun mal «den Ausschluss … bedeuten».[11]
Diesem allzu menschlichen Verhalten huldigen auch Börsenanalysten, die sich lieber mit heftigen Zweifeln oder gar wider besseres Wissen den Einschätzungen ihrer Kollegen anschließen, als mutig eine begründete Außenseiterposition zu beziehen. Wenn sie dann am Ende tatsächlich mit ihrem Urteil falsch lagen, waren sie wenigstens in guter Gesellschaft. Zudem folgt auch ein Börsen-Crash einer inneren Logik, die nicht dumm ist, zumindest eine Zeitlang. Denn Aktien gegen den Markt zu kaufen, also ins fallende Messer zu greifen, wie es dann heißt, ist nur am Ende des Zusammenbruchs klug; dann nämlich, wenn der Boden fast erreicht ist und es bald wieder aufwärts mit den Kursen geht. Es mögen also Dumme sein, die Aktien tüchtiger Firmen unter Wert verkaufen. Doch wenn es viele von ihnen tun, dann sollten auch die Klugen erst mal nachgeben und später zu niedrigeren Preisen in das betreffende Wertpapier wieder einsteigen.
Nicht nur in Deutschland bekommen Kinder wie Erwachsene deshalb den wohlmeinenden Rat, nicht sinnlos gegen übermächtige Widerstände anzurennen. Vernünftiger sei es dann, klein beizugeben, wie ein Kartenspieler, der sich den Trümpfen seines Gegners beugt.[12] Das aber erlaubt eine völlig andere Deutung unseres Sprichworts, bei der auch die Klügeren viel besser wegkommen: Der geistig Bewegliche erreicht mehr als der Sture.
Das wissen auch Fuhrleute, die mit Zugpferden unterwegs sind. Volker Ladenthin von der Universität Bonn nimmt sogar an, das Sprichwort könne auf Kutscher zurückgehen. Der in Münster geborene Pädagoge verbindet damit Beobachtungen aus seiner Kindheit, als er den Bauern manchmal beim Abfahren der Ernte von den Feldern zusah. «Da wurden die Erntewagen von Knechten gelenkt, die saßen oben auf dem Wagen», erinnert er sich. «Wenn die Pferde zu sehr in eine Richtung gingen und die hochbeladenen Wagen umzukippen drohten, riefen die Bauern: ‹Gib nach, gib nach.› Dann zogen die Pferde wieder gerade.»
Hier also wäre der Kutscher der Klügere. «Das Pferd geht auf Spannung, der Fuhrmann lässt sich nicht auf den Kampf ein und gibt erst einmal nach; dann aber lenkt er das Pferd doch dahin, wohin er es haben will», erklärt es der Erziehungswissenschaftler. «Nachgeben heißt demnach: Dem anderen Raum geben, Spannung wegnehmen, etwas nicht erzwingen.» Und damit sind wir bei Lehrern und ihrer vornehmsten Aufgabe. Denn aus pädagogischer Sicht muss der Klügere sogar nachgeben, falls er anderen zum Klugsein verhelfen möchte – seinen Schülern zum Beispiel. «Der Kluge gibt nach, weil er bemerkt hat, dass der andere noch nicht zur Einsicht bereit ist», erläutert Ladenthin diesen Ansatz. Denn man könne «nur lehren, wenn der andere fähig ist, das Gelehrte zu begreifen, es einzusehen. Ist er das nicht, geht man einen Schritt zurück, gibt Raum, gibt die ziehenden, die erziehenden Zügel nach.» Dadurch könne der noch nicht so Kluge erst einmal «Luft holen, Kraft schöpfen, denn gleich geht es wieder zur Sache».
Für den Hochschullehrer ist der nachgiebige Kluge also keineswegs der Dumme. Er sei ja geistig deshalb weiter, «weil er dem anderen die Gelegenheit zur Selbsterkenntnis gibt, er gewährt ihm die Freiheit, etwas aus eigener Einsicht zu verstehen». Daraus beziehe der Klügere auch die Geduld, auf Lernfortschritte des Schülers zu warten. «Im Gegensatz zur Macht hat die Klugheit Zeit. Die Macht will sich immer sofort durchsetzen, weil sie sich immer gefährdet sieht – sie muss sich behaupten.» Die Klugheit hingegen habe «unendliche Zeit, weil sie die Macht immer überleben wird: Was wahr ist, setzt sich auf lange Sicht gesehen durch.»
Das ist eine sehr hoffnungsvolle, humanistisch geprägte Sicht der Dinge. Im Feld des Politischen kann jedoch sehr viel zerstört sein, bis das Gute, Vernünftige siegt. Und nicht selten findet die Feier inmitten von Asche und zerschlagenem Porzellan statt – wenn es denn noch etwas zu feiern gibt. Womöglich sollte man sich an dem Mediziner Jürgen Brater orientieren, der als Lebensregel vorschlägt: «Der Klügere gibt nach, solange er dadurch nicht am Ende selbst der Dumme ist!»[13] Auch im Hörsaal oder Klassenraum ist das keine blöde Maxime.
«Kleinvieh macht auch Mist.»
Als die Oma dem Enkel fürs Putzen ihrer Küche 1,50 Mark zusteckte, bekam der Zwölfjährige erst mal große Augen. Beim Nachrechnen entfuhr ihm dann doch ein Seufzer: Bis zum Kauf der ersehnten Diesel-Lok fehlten immer noch 71,50 Mark! Doch die Großmutter mahnte zur Geduld: «Kleinvieh macht auch Mist.» Was trösten sollte, aber letztlich nichts anderes hieß, als dass noch weitere 48 Kleinviecher nötig waren, bis der kleine Modellbahner sich zum Spielzeugladen aufmachen konnte.
Viehhalter verstehen unter Kleinvieh naturgemäß etwas ganz anderes, nämlich Hühner, Enten, Gänse und vielleicht noch Kaninchen. Hingegen gelten Schweine, Schafe und Ziegen als Mittelvieh, während Rind und Pferd – zumindest in Deutschland – das landwirtschaftliche Großvieh bilden. Als solches machen Stiere, Ochsen und Kühe sowie Hengste und Stuten jenen Menschen viel Arbeit, die ihre Ställe entmisten müssen. Aber auch Hühner lassen ordentlich unter sich. Ein Brathähnchen (Broiler), dessen Laufbahn nach der sogenannten Broilerkurzmast notgedrungen endet, bringt jeden Tag gut ein Kilo Mist (Kot plus Einstreu) zustande. Eine moderne Legehenne stößt Tag für Tag nicht nur etwa 0,8 Eier aus, sondern nach Angaben Klaus Dammes von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft auch etwa 175 Gramm Frischkot. Hochgerechnet aufs ganze Jahr sind das rund 290 Eier beziehungsweise 64 Kilogramm an ungetrocknetem Kot.
Kleinvieh macht also sehr wohl auch Mist, vor allem wenn man bedenkt, dass in Deutschland Ende 2010 fast 30 Millionen Legehennen die Eierproduktion vorantrieben – und zwar allein in Großbetrieben, die mehr als 3000 Hennen halten können.[14] Schon deren Jahr für Jahr angehäufter Kot wöge stolze 480000 Tonnen. Und dabei sind die stickstoffreichen Hinterlassenschaften von 590 Millionen Jungmasthühnern, fast 27 Millionen Enten, 38 Millionen Truthühnern und über einer halben Million Gänsen noch gar nicht mitgezählt.[15] Schöner Mist!
Zudem einer, der sehr viel übler müffelt als ein Haufen Geld. Nach Ansicht des römischen Kaisers Vespasian (9–79 n. Chr.) sonderten Münzen ohnehin keinerlei üblen Gerüche ab («Pecunia non olet»); zumindest dann nicht, wenn es sich um Steuergelder handelte, die Gerber entrichten mussten – nämlich dafür, dass sie an belebten Straßen in Amphoren den zum Ledergerben sehr nützlichen Urin von Passanten sammelten. Sinnigerweise starb Vespasian alles andere als geruchsneutral an heftigem Durchfall.
Jedenfalls wirft Geld auf der Bank mehr oder minder hohe Zinsen ab, was schon Kinder wissen sollten. Allerdings sind jene schlappen 1,5 Prozent, die so manche Bank 2011 für Tagesgeldkonten gewährte, fraglos ein mickriger Zins, der zurzeit nicht einmal die Geldentwertung wettmacht. Wer 10000 Euro zu solchen Konditionen anlegt, hat nach einem Jahr gerade einmal 150 Euro mehr auf der hohen Kante.
Auf die Dauer aber zeigt das monetäre Kleinvieh, was in ihm steckt: Sofern man sein Grundkapital nicht antastet, erhält man im fünften Jahr der Geldanlage bereits 159,20 Euro. Klingt immer noch recht dürftig. Nach zehn Jahren sind es aber schon über 171 Euro, die einem die Bank gewährt, und ließe man das angesammelte Kapital gar 100 Jahre lang auf dem Konto stehen, betrüge der Zins im letzten davon stolze 655 Euro. Kleinvieh macht in der Tat Mist.
Freilich ist das kein Vergleich zum Schuldzins, den dieselbe Bank berechnen würde. Nach Angaben der Zeitschrift Finanztest waren im Jahr 2010 für einen Dispo-Kredit in Deutschland «11 Prozent und mehr» an Zinsen üblich – und 14 Prozent alles andere als eine Seltenheit. Noch im Frühjahr 2011, nach kleineren Änderungen mancher Geldhäuser, konnte Finanztest bemängeln, «dass die Banken in einer Zeit, in der sie selbst kaum Zinsen zahlen müssen, mit den Dispozinsen Millionen Euro an ihren Kunden verdienen».[16] Mit elf Prozent Dispo-Zins sähe die Rechnung schon ganz anders aus: Für 10000 Euro Kredit liefen dann nämlich innerhalb eines Jahres 1100 Euro an Schuldzinsen auf. Nach zehn Jahren hätte der Schuldner seiner Bank bereits fast 18400 Euro an Leihgebühren zu blechen, nach 100 Jahren sogar fast 34 Millionen.
Wie stark der Zinseszins-Effekt sich auswirken kann, sieht man aber vielleicht am ehesten hieran: Nach 67 Jahren wäre beim Stand der aufgelaufenen Schuldzinsen die Marke von einer Million Euro überschritten. Für die nächste Million aber braucht es dann bloß weitere sechs Jahre. Auf die am Ende immer noch ausstehende Rückzahlung der geliehenen 10000 Euro käme es dann gar nicht mehr an. Großvieh macht eben doch viel mehr Mist als Enten, Hühner, Kaninchen oder auch die Guthabenzinsen von Kleinsparern.
«Aller guten Dinge sind drei.»
Fällt Ihnen etwas auf? «Einigkeit und Recht und Freiheit.» Oder: «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.» Oder auch: «Friede, Freude, Eierkuchen.» Stets sind es drei Wörter. Wie auch dann, wenn wir in einem Satz konkrete Beispiele für eine Aussage wählen: «Sie mochte Obst, vor allem Äpfel, Birnen und Orangen.» In allen Fällen reicht es also buchstäblich, wenn man bisdreizählen kann – ganz wie in der Redensart, die auf diese Weise Klugheit von der Dummheit scheidet. Und wie klänge auch ein Satz wie dieser? «Peter schwärmte für Barockmusik, zum Beispiel für solche von Telemann, Händel, Corelli, Manfredini, Scarlatti, Vivaldi, Purcell, Buxtehude und Johann Sebastian Bach.» Ein wenig unübersichtlich, könnte man sagen. Und gar nicht beispielhaft.
Die Drei sei eine «magische Zahl», sagt Dagmar Schmauks vom Institut für Sprache und Kommunikation an der TU Berlin und nennt als Beispiel die Heilige Dreifaltigkeit von Gottvater, Gottessohn und Heiligem Geist. Und andere Kulturen? Schon die alten Römer verehrten drei Hauptgötter, nämlich Jupiter, Juno und Minerva, und der Hinduismus kennt die Dreiheit der großen Götter Vishnu, Brahma und Shiva. Doch damit nicht genug. Ein Kind ist ein Dreikäsehoch und in Frankreich so hochgewachsen wie drei Äpfel («haut comme trois pommes»), nicht etwa wie fünf. Auch geflucht wird bisweilen noch heute «in Drei Teufels Namen», zum Beispiel in Satans, Luzifers und Beelzebubs. Noch mehr Dreierlei gefällig? Exzellente Köche tragen an der Mütze drei Sterne, und die gute Fee im Märchen verkündet: «Du hast drei Wünsche frei» – fünf davon klängen maßlos, zwei ein wenig knauserig. Selbst wenn wir unser Kind auffordern, einer Behauptung im Schulaufsatz Argumente folgen zu lassen, legen wir ihm nahe: «Hier schreib gleich hin, warum das so ist: erstens, zweitens, drittens!»
Warum aber sind nun aller guten Dinge drei – und nicht vier oder sechs? Zunächst einmal lässt sich die Vorliebe für die Drei historisch herleiten: Im Englischen heißt das Ding noch heute «thing». Und so war es auch einmal gemeint, wenn auf dem Thing, der germanischen Gerichtsversammlung im Mittelalter, eine Sache behandelt wurde – nämlich eine Rechtssache, ein Gerichtsding. Dazu musste der Angeklagte erst einmal gefasst, also dingfest gemacht werden. Ganz ähnlich heißt übrigens im Französischen das, was vor dem Richter verhandelt wird, eine chose, nach dem lateinischen Wort causa.[17]
Schon beim Thing spielte die Drei eine große Rolle: «Dreimal im Jahr wurde Gericht … gehalten, zu jeder Weisung waren mindestens drei Urteiler nötig, der Gerichtsplatz wurde oft durch drei Bäume gekennzeichnet und danach bezeichnet.»[18] Als Beispiel erwähnt der verstorbene Sprachwissenschaftler und Volkskundler Lutz Röhrich «Dreieichen», einen in Deutschland noch immer häufig zu findenden Orts-, Flur- oder Wegnamen.
Nun lässt sich natürlich fragen, warum beim Thing gerade drei und nicht etwa neun Entscheider anwesend sein mussten. Hier fällt die Antwort noch leicht, denn drei sind leichter herbeizurufen als neun und reichen auch schon, um eine Mehrheitsentscheidung zu fällen. Doch warum pflanzten die Germanen außerdem genau drei Eichen oder Linden am Gerichtsplatz, wenn fünf doch besser gegen Regen geschützt hätten? Und sollte es auch dafür irgendwo erklärende kulturgeschichtliche Hinweise geben, stünde erneut die Frage im Raum: warum drei? Warum zum Beispiel hat Albrecht Dürer sein berühmtes Werk aus dem Jahr 1513 «Ritter, Tod und Teufel» genannt? Platz für einen vierten Gesellen hätte sich sicher schaffen lassen auf dem Kunstwerk, das zu Dürers Meisterstichen zählt. Und davon gab es genau drei. Ein Zufall?