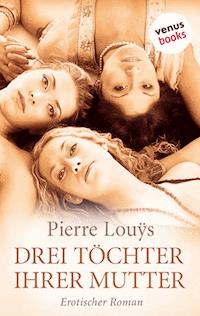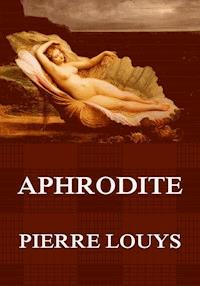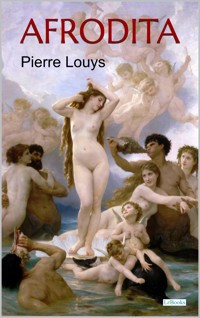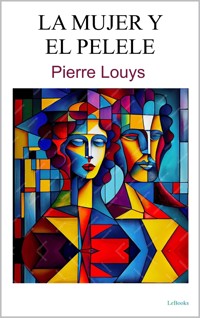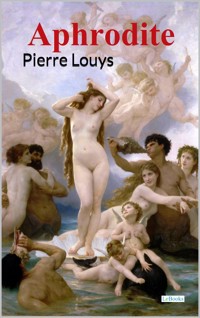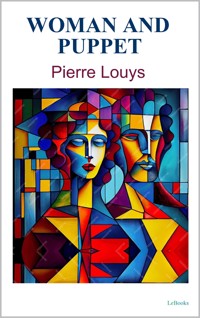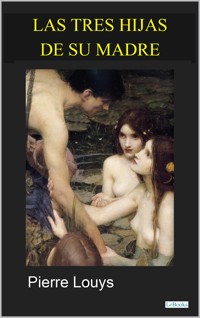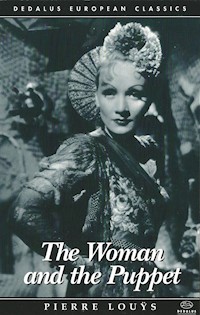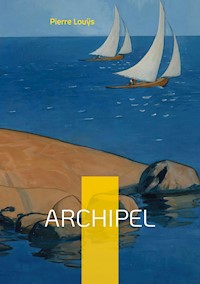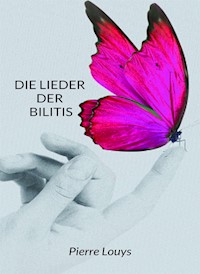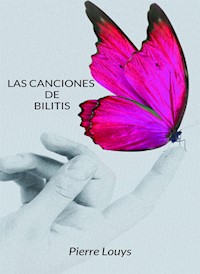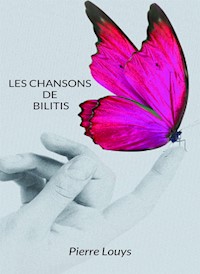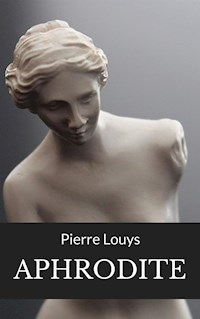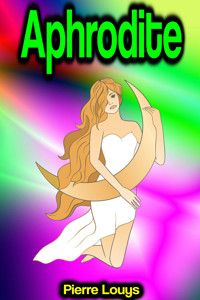Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
König Pausole - Ein Klassiker der erotischen Satire in neuer Übersetzung! Über ein Jahrhundert nach der ersten deutschen Übersetzung erscheint die unvergängliche Geschichte des sagenhaften Königreichs Tryphème wieder in deutscher Sprache. Einer Welt, in der Freiheit und Selbstbestimmung herrschen - und der König vor allem seine Ruhe will. Pierre Louÿs berühmtester Roman, erstmals 1901 erschienen, ist eine zeitlose Satire auf Gesellschaft, Politik und Moral, voller Witz, Ironie und subtilem Charme. In einem fiktiven Land um 1900, in dem die Freiheit des Einzelnen das höchste Gut ist, regiert König Pausole mit nur zwei Gesetzen: "Schade niemandem" und "Tue, was dir gefällt". Doch wie lässt sich Freiheit regieren, wenn sie sich nicht begrenzen lassen muss? Als seine Tochter rebelliert und davonläuft, beginnt ein Abenteuer, das Pausole aus seiner trägen Lethargie reißt - und ihn auf humorvolle Weise die Folgen seiner Philosophie vor Augen hält, von der er sich auch selbst nicht ausnehmen darf. Diese neue deutsche Ausgabe, liebevoll bearbeitet, illustriert und annotiert, präsentiert den Klassiker in zeitgemäßer Form und erinnert daran, dass die individuelle Freiheit stets ein Balanceakt bleibt - zwischen den Ansprüchen des Einzelnen und der Zurückhaltung derer, die sie gewähren. Ein funkelndes Meisterwerk, das auch im 21. Jahrhundert nichts von seiner Aktualität verloren hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
König Pausole – Ein Klassiker der erotischen Satire in neuer Übersetzung!
Über ein Jahrhundert nach der ersten deutschen Übersetzung erscheint die unvergängliche Geschichte des sagenhaften Königreichs Tryphème wieder in deutscher Sprache. Einer Welt, in der Freiheit und Selbstbestimmung herrschen – und der König vor allem seine Ruhe will. Pierre Louÿs berühmtester Roman, erstmals 1901 erschienen, ist eine zeitlose Satire auf Gesellschaft, Politik und Moral, voller Witz, Ironie und subtilem Charme.
In einem fiktiven Land um 1900, in dem die Freiheit des Einzelnen das höchste Gut ist, re - giert König Pausole mit nur zwei Gesetzen: „Schade niemandem“ und „Tu, was dir gefällt“. Doch wie lässt sich Freiheit regieren, wenn sie sich nicht begrenzen lassen muss? Als seine Tochter rebelliert und davonläuft, beginnt ein Abenteuer, das Pausole aus seiner trägen Lethargie reißt – und ihn auf humorvolle Weise die Folgen seiner Philosophie vor Augen hält, von der er sich auch selbst nicht ausnehmen darf.
Diese neue deutsche Ausgabe, liebevoll bearbeitet, illustriert und annotiert, präsentiert den Klassiker in zeitgemäßer Form und erinnert daran, dass die individuelle Freiheit stets ein Balanceakt bleibt – zwischen den Ansprüchen des Einzelnen und der Zurückhaltung derer, die sie gewähren. Ein funkelndes Meisterwerk, das auch im 21. Jahrhundert nichts von seiner Aktualität verloren hat.
Unter dem Pseudonym Agnostos Hermeneutes ist die Herausgabe weiterer deutscher Übertragungen gemeinfreier Werke der Weltliteratur geplant.
Für Jean de Tinan1
der die Zusage für diese schlichte Widmung mitgenommen hat
P.L. September 1898
Das Gesetzbuch von Tryphême
Artikel 1: Schade Deinem Nächsten nicht. Artikel 2: Tu, was dir gefällt.
König Pausole
Widmung des Übersetzers
Wer dieses Buch in der Absicht erworben hat, sich darüber zu empören, wird gut bedient werden. Gleiches gilt für den, der sich daran zu erfreuen gedenkt.
A.H.
1 Ein Französischer Schriftsteller (1874 – 1898) und Freund des Autors. Diese Widmung ist aus dem französischen Original übernommen
Henri Bataille: Porträt von Pierre Louÿs, in: Têtes et Pensées; 1901, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal
Inhalt
Personenverzeichnis
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Viertes Buch
Nachwort des Übersetzers
Personenverzeichnis
Der König Pausole
Blanche Aline, Tochter des Königs Mirabelle Die Königin Diane, genannt „Diane à la Houppe“ Die Königin Françoise Die Königin Gisèle Die Königin Alberte Die Königin Denyse Die kleine Königin Fannette Das Porträt der Königin Christiane Macarie, das Maultier des Königs Madame Perchuque, Erste Dame des Hofes Galatée, eine junge Frau Philis, ihre jüngere Schwester Madame Lebirbe Nicole Thierette, ein Milchmädchen Rosine, Hüterin der Himbeersträucher Die Vorleserin des Königs Die Schwester des kleinen Bauern Eine Wäscherin Eine Marktfrau Ein ausgezeichnetes junges Mädchen Ein bedrängtes junges Mädchen Eine Hoteldirektorin Erste Kammerfrau des Königs Zweite Kammerfrau des Königs
Monsieur Taxis, Groß-Eunuch Giglio, Page des Königs Monsieur Lebirbe Kosmon Himère Der Küchenmeister Monsieur Palestre, Minister der öffentlichen Spiele Der Direktor der Sicherheitspolizei Der Direktor der „Sauvetage de l'Enfance“ Drei Redner Ein Pächter Ein katalanischer Seemann Ein kleiner Bauer Ein Vater Ein Kamel
366 Königinnen – Stallmeister – Damen des Hofes – Pagen – Gärtner – Wächter – Bedienstete des Palastes – Tänzerinnen – Polizisten – Bauernmädchen – Gäste – Hotelangestellte – Bauern – Bäuerinnen – Das Volk.
Erstes Buch
Erstes Kapitel
in dem König Pausole zum ersten Mal die Widrigkeiten des Lebens kennenlernt
Man sieht, dass in Nationen, wo die Gesetze des Anstands seltener und lockerer sind, die ursprünglichen Gesetze der allgemeinen Vernunft besser beachtet werden. Montaigne2, III, 5.
König Pausole hielt Gericht. Er hatte es sich unter einem Kirschbaum bequem gemacht. „Dieser Baum spendet genauso viel Schatten wie jeder andere“, sagte er gern, „aber im Sommer trägt er köstliche Früchte. Und das kann keine ehrwürdige Eiche von sich behaupten.“
Der König hielt an der traditionellen Hoftracht fest – weite Gewänder, deren Faltenwurf seiner königlichen Würde schmeichelte. Doch er war für Verbesserungen offen, solange sie den Müßiggang nicht störten. „Man muss mit der Zeit gehen“, erklärte er. Seine Krone, auf den ersten Blick prächtig, war in Wahrheit aus leichtem Aluminium gefertigt und lediglich mit einer dünnen Goldschicht überzogen. Das machte sie weitaus angenehmer als den Zylinderhut seines Vetters, des Königs von Griechenland, worüber er sich oft amüsierte.
Natürlich bemerkten scharfsichtige Beobachter, dass die Krone nur vergoldet war. Doch, so der König: „Wer solche Details aus der Ferne erkennt, lässt sich von einer Krone ohnehin nicht beeindrucken – selbst wenn sie aus purem Gold wäre. Warum sich also den Kopf schwerer machen als nötig?“
König Pausole regierte uneingeschränkt über Tryphême, ein bemerkenswertes Land. Dessen Fehlen auf politischen Atlanten lässt sich vielleicht so erklären: Wie glückliche Völker keine Geschichte haben, so haben blühende Länder keine Geographie. Auf modernen Karten gibt es immer noch weiße Flecken – unbekannte Gegenden, die von der Welt vergessen wurden. Tryphême hingegen ist ein blauer Fleck, mitten im Mittelmeer. Und das erscheint völlig natürlich.
Doch nein, das ist nicht der Grund für diese merkwürdige Lücke. Dass der Name Tryphême aus allen Enzyklopädien gestrichen wurde, dass man die Karte Europas verfälscht und diese grüne Halbinsel von unseren Küsten entfernt hat, liegt an einer verschwörerischen Stille, die man über sie verhängt hat. Man kennt dieses Schweigen – es ist dasselbe, das unter Literaturkritikern herrscht, wenn ein großartiges Werk entsteht. Ein Schweigen, das ein junges Talent erstickt, bevor es sein erstes Lächeln wagen kann. Wissenschaftler und Geographen, ebenso niederträchtig, bedienen sich derselben Methode: Sie halten Touristen von einem Land fern, das sie selbst für ein Paradies halten. Aber lassen wir diese armseligen Machenschaften beiseite.
Tryphême ist eine Halbinsel, die die Pyrenäen in Richtung der Balearen verlängert. Sie grenzt an Katalonien und das französische Département Roussillon, heute bekannt als Pyrénées-Orientales. Ich spreche davon, weil ich dort gewesen bin. Der Leser möge sich nicht einbilden, dass die wahre und zeitgenössische Geschichte, die ich seit fünf Minuten für ihn aufschreibe, nur ein Hirngespinst sei.
Es war im zwanzigsten Jahr seiner Regentschaft, als König Pausole – nach so vielen stillen Jahren – die Last einer unruhigen Seele und die Herausforderungen des Lebens zu spüren begann. An diesem Junimorgen war er lange nach Sonnenaufgang aufgestanden und hatte sich, sanft schaukelnd auf seinem Maultier Macarie, zu seinem Gerichtsstuhl tragen lassen. Zahlreiche Diener begleiteten ihn: Einer trug seine Zigaretten, ein anderer den Sonnenschirm, die meisten taten nichts.
Keiner dieser Diener war bewaffnet. Der König zog es vor, geliebt zu werden, statt gefürchtet. „Furcht“, sagte er, „ist nicht von Dauer und kaum auszuhalten. Die Liebe des Volkes dagegen ist ein einzigartiges Gefühl: Sie lebt von Erinnerungen, sieht selbst die kleinsten Gesten als Wohltaten – und verlangt nichts anderes, als geschätzt zu werden.“
Die Gerechtigkeit, die König Pausole jeden Tag unter einem Kirschbaum in seinen Gärten walten ließ, war so angesehen, dass sich jeder bereitwillig seinen Urteilen fügte. Das Buch der Sitten und Gebräuche, das ihm seine Vorfahren hinterlassen hatten, hatte er radikal vereinfacht. Sein Gesetzbuch bestand nur noch aus zwei Artikeln – ein seltenes Werk, das sein Volk tatsächlich verstand.
Artikel 1: Schade Deinem Nächsten nicht. Artikel 2: Tu, was dir gefällt.
Es erübrigt sich zu sagen, dass der zweite Artikel in keinem zivilisierten Land anwendbar ist. Doch diesem Volk lag sehr viel daran.
Die Bewohner von Tryphême wechselten – anders als die Menschen in anderen Ländern – nicht von der Vormundschaft des Vaters direkt in die des Staates. Mit der Volljährigkeit wurden sie frei und folgten ihren eigenen Launen, nicht den Vorgaben des Gesetzgebers.
Der König gönnte sich täglich das Vergnügen, durch seine Urteile ein Stück persönlicher Freiheit zu retten. Es war keine besonders anstrengende Arbeit: König Pausole hätte keine mühselige Tätigkeit akzeptiert. Seine eigene Freiheit war ihm heilig, und er folgte mit größter Hingabe den Launen, die ihm zur Faulheit rieten.
An diesem Morgen warteten ein Dutzend Kläger und eine große, reglose Menge auf dem schattigen Rasen, als der König unter den Zweigen seines Kirschbaums erschien. Ein Murmeln voller Bewunderung, Neugier und leiser Sympathie begrüßte ihn. Er erwiderte die Begrüßung, indem er seine weiche, elegante Hand wie ein Tuch grüßend vor seinem Gesicht bewegte. Mit wenigen Schritten bestieg er die drei Stufen seines Gerichtsstuhls und erhob sich damit über die Menge.
Der erste Kläger trat vor. Es war ein Fremder, ein katalanischer Matrose mit hochgekrempelten Ärmeln und fast schwarzen Armen. „Sire!“, rief er. „Gerechtigkeit gegen meine Frau! Sie ist mit einem anderen durchgebrannt!“
„Oh, oh!“, sagte der König und pflückte eine Kirsche. Während er sie mit den Zähnen schälte und das Fruchtfleisch genüsslich auslutschte, fügte er hinzu: „Und was soll ich da tun?“
„Aber, Sire, wir waren vor dem Bürgermeister und dem Priester verheiratet. Sie hat auf die Bibel geschworen!“
„Und wenn sie Euch geschworen hätte, vor ihrem dreißigsten Geburtstag nicht zu sterben – würdet ihr sie dann ins Gefängnis werfen, wenn sie die Pest bekäme? Ihr sagt, sie hat geschworen? Das ist die einzige Schuld, die ich ihr anrechne. Und selbst das war, nach den Gesetzen eures sonderbaren Landes, der nichtigste aller erzwungenen Schwüre. Ihr habt doch gerade den Beweis erhalten, dass sie ihn nicht halten konnte.
Wenn sie Euch wenigstens getäuscht hätte! Wenn sie nur so getan hätte, als würde sie Eure Gesellschaft genießen, um nicht davongejagt zu werden – dann könnte ich euren Zorn verstehen. Aber sie hat Euch nicht getäuscht, denn sie ist gegangen. Ihre Offenheit ist tadellos.
Und warum ist sie gegangen? Wahrscheinlich, weil sie jemanden gefunden hat, der Euch überlegen ist: an Jugend, an Schönheit, an Charakter – oder, wer weiß, vielleicht sogar an Vermögen. Würdet ihr widersprechen, dass ein junges Mädchen am Tag ihrer Hochzeit das Recht hat, all diese Gründe abzuwägen? Umso mehr darf sie es tun, wenn sie eine Frau geworden ist und die Erfahrung sie berät.“
„Aber es steht doch im Gesetzbuch: ‚Schade Deinem Nächsten nicht.‘“
„Ganz genau. Deshalb verbiete ich Euch, Euren Nachfolger zu verfolgen.“
Er drehte sich zur Menge: „Kommen wir zur zweiten Angelegenheit.“ „Majestät“, dröhnte eine tiefe Stimme, „ein Bettler, ein Ziegenhirt hat mein einziges Kind entehrt3.“
„Oh, oh!“, protestierte der König. „Man sollte nicht vorschnell von Widerstand sprechen. Ich wäre gespannt, das Opfer selbst zu sehen.“ Die Tochter wurde vorgeführt. Sie trug die bevorzugte Kleidung der jungen Frauen von Tryphême: ein sonnengelbes Tuch auf dem Kopf, mondhelle Pantöffelchen an den Füßen – und sonst nichts.
Pausole war zwar der Ansicht, dass der Anblick einer hässlichen, alten oder gebrechlichen Person für manche eine Zumutung sei, und betrachtete es als unerwünscht, wenn körperlich unvollkommene Gestalten oder groteske Gesichter unbedeckt erschienen. Doch da der Anblick eines jungen Mädchens oder eines kräftigen Mannes nur die gesündesten und tugendhaftesten Gedanken wecke, hatte er klargestellt, dass die menschliche Schönheit – dieses ebenso kostbare wie flüchtige Geschenk – so oft wie möglich unverhüllt zu bewundern sei. Nur in den wenigen Winterwochen, die auch die Mittelmeerküste kennt, machte er eine Ausnahme.
„Mein Freund“, sagte der König, während er sich zu einem Diener hinüberbeugte, „die übrigen Kirschen hängen zu hoch, um sie ohne Mühe zu pflücken. Ich werde keinen anderen Baum wählen – ich bin an diesen hier gewöhnt. Hängt morgen ein Dutzend ausgewählter Kirschen an die unteren Zweige.“
Dann wandte er sich der jungen Frau zu, die ihn mit mehr Hoffnung als Verlegenheit ansah. „Nun?“, sagte er. „Beschwert Ihr Euch etwa auch? Ich höre nur auf Euren Vater, wenn er in Eurem Namen spricht.“
„Oh, Sire, redet Ihr selbst mit ihm, damit er mich nicht schlägt. Ich bin zu aufgewühlt, um zwei Tage hintereinander zu schweigen, und ich schäme mich vor Euch nicht – Ihr seid so gerecht. Gestern Abend ging ich in die Berge zu meiner Schwester, mit einem Krug Milch für ihr Kind. Sie hat mir von den Freuden erzählt, die ihr Leben verschönern – Freuden, die mir in meinen langen Nächten so schmerzlich fehlen. Auf dem Rückweg, unter den Weidenbäumen, begegnete ich einem Ziegenhirten in meinem Alter.
Sire, er war gerade aus dem Wasser gestiegen, und er war so hübsch, so sauber, so anmutig, dass er in meinen Augen sehen musste, wie sehr ich ihn mochte. Männer glauben immer, sie würden uns erobern; dabei nähern sie sich nur denen, die sie längst erwählt haben. Und wenn sie es wagen, uns zu nehmen, dann nur, wenn sie davon überzeugt sind, dass wir nichts dagegen haben. Oh, Sire, ich schwöre Euch, ich habe ihn nicht absichtlich ermutigt! Ich wollte erst nicht, dass er mich berührte – oder zumindest glaubte ich, es nicht zu wollen.
Aber als ich ihn ansah, in dem Moment, als ich ihn am meisten bewunderte, ergriff er meine Hand. Ja, Sire, mein Vater hat Euch die Wahrheit gesagt: Ich habe erst mit aller Kraft versucht, zu widerstehen. Aber kein Laut kam über meine Lippen. Ich hätte um nichts in der Welt jemanden zu Hilfe gerufen – denn ich war sicher, dass ich allein mit der Situation klarkommen würde.
Ich habe lange dagegen angekämpft, vom Sonnenuntergang bis in die Nacht. Doch als ich sah, dass es zu spät war, um nach Hause zu gehen, gab ich meinen Widerstand auf. Bis zum nächsten Morgen habe ich es immer wieder geschehen lassen. Und ich bin entschlossen, gegen eine so starke Versuchung nicht mehr länger anzukämpfen. Man hat Euch gerade gebeten, meine Schwäche vor neuen Übergriffen zu schützen. Aber die einzige Gewalt, die ich fürchte, ist die meines Vaters. Mit dem anderen komme ich gut zurecht.“
Der König hatte ihre Rede schweigend angehört. Als sie endete, erklärte er: „Dieses Mädchen ist ihrem Vater weit überlegen – an Verstand, Initiative und Lebenssinn. Ich werde sie von der väterlichen Gewalt befreien. Mit welchem Recht sollte ich eine solche Autorität über einen so klugen Kopf bestehen lassen? Geh, Kind, Du bist frei! Tue nichts Böses und lebe nach Deinem Willen, so wie es das Gesetzbuch von Tryphême vorschreibt. Der nächste Kläger!“
So kam es, dass die dritte Angelegenheit nicht die war, die der König erwartet hatte. Während das Mädchen noch sprach, erschien plötzlich eine alte Frau in der Magnolienallee, die zum Palast führte. Sie hatte ihre Röcke hochgeschürzt und bewegte sich mit einer eiligen, unkoordinierten Hast, die an das Hüpfen einer Heuschrecke erinnerte. Aus der Ferne war ihr keuchendes Atmen zu hören. Schließlich stolperte sie bis zum Gerichtsstuhl, klammerte sich an einen Ast – sei es, um nicht zu stürzen oder um den Sturz zumindest hinauszuzögern – und hauchte: „Sire! …“
Doch ihre Stimme war so schwach, dass man einen Moment lang glaubte, sie sei tot. „Das ist eine Alte aus dem Palast“, bemerkte ein Diener. „Die Aufseherin der königlichen Gemächer“, ergänzte ein anderer.
Da die Hofetikette angesichts der Gutmütigkeit des Königs eher lax gehandhabt wurde, gab die Dienerschaft ihrer Neugier Ausdruck: „Es muss etwas passiert sein!“
Der König erhob sich. „Was gibt es?“, fragte er.
„Sire … Blanche Aline … Ach, Sire … Eure Tochter … die Prinzessin …“
„Nun?“
„Ach!“ Und die Alte fiel in Ohnmacht.
Im selben Moment näherte sich eine zweite Hofdame, gemessener und mit einem Brief in der Hand. Sie senkte ihren gelben Sonnenschirm und sprach: „Mit großem Bedauern, Sire, muss ich Euch mitteilen, dass Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Aline, den Palast auf mysteriöse Weise verlassen hat. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge um ihre Gesundheit.
Die Hofdame, die Ihre Königliche Hoheit zu wecken und ihre Träume zu deuten pflegt, fand auf ihr gewohntes Klopfen hin vier Stunden lang keine Antwort. Besorgt wagte sie es schließlich, einzutreten – ein Schritt, wie Ihr sicher versteht, der nur in äußerster Not unternommen wird. Doch Ihre Königliche Hoheit war nicht da. Das Bett war unberührt, als hätte es die Nacht leer gestanden.
Es scheint, dass Prinzessin Aline den Palast ohne jede Ankündigung und ohne Gepäck verlassen hat – abgesehen von einer Puderbüchse, einem Schminktiegel, einer Geldbörse und einem weiteren Toilettenartikel, dessen genaue Bezeichnung ich nicht zu nennen wage. Niemand weiß, wann sie aufgebrochen ist oder welchen Weg sie genommen hat. Es wird vermutet, dass sie das Zimmer durch das Fenster verlassen hat. Bei unseren Nachforschungen stießen wir schließlich auf ihrem Schminktisch auf ein Briefchen mit der Aufschrift ‚Für Papa‘. Sire, hier ist es.“
Der König konnte es nicht begreifen. Vergeblich erzählte die Hofdame alles im hellen Tageslicht – für ihn blieb es ein verwirrendes Traumgespinst. „Meine Liebe, Ihr redet wirres Zeug“, sagte er. „Ich höre nur Worte ohne Zusammenhang. Ihr seid verrückt, das springt ins Auge. Warum sollte meine Tochter mich verlassen? Wo könnte es ihr besser gehen als im Palast, an meiner Seite? Und wie soll ich glauben, dass sie gegangen ist, ohne sich von mir zu verabschieden? Das sind Träume, sage ich Euch. Sie hat wegen der Hitze vielleicht nicht in ihrem Zimmer geschlafen. Bestimmt liegt sie auf den Terrassen, in ihrer Hängematte. Daran habt Ihr nicht gedacht. Geht, sucht sie dort, anstatt mich mit Euren Verwirrungen zu belästigen.“
Doch dann fiel sein Blick auf das Briefchen in seiner Hand. Auf dem far - bigen Umschlag standen diese Worte, in einer phantasievollen, ungleichmäßigen Handschrift: „Für Papa“. Darunter verlief eine Linie, die horizontal hätte sein sollen, sich aber mit einem kleinen Sprung nach oben wölbte.
Mit einem zögerlichen Ruck öffnete er den Umschlag und entfaltete den Brief:
„Papa, wenn ich glauben müsste, dass Du darunter leiden würdest, hätte ich niemals den Mut, fortzugehen – so wie ich es jetzt tue. Aber Du kannst nicht traurig sein, denn ich bin glücklich. Du hast doch immer gesagt, dass Du nur mein Glück willst.
In sieben Monaten, wenn ich volljährig bin, komme ich zurück. Warte ohne Sorge auf mich. Ich gehe mit jemandem fort, der sehr hübsch ist und gut auf mich achten wird – fast so gut wie Du.
Ich küsse Dich, wenn Du nicht böse bist.
Deine Line“
Die Menge hatte sich inzwischen genähert. Ohne zu wissen, was vor sich ging, aber neugierig, beobachtete sie die Aufregung des Königs – ein seltenes Ereignis. Einige Kläger wurden bereits ungeduldig. Das junge Mädchen, das zuvor freigesprochen worden war, fürchtete, dass ihr Freispruch durch die neue Entwicklung widerrufen werden könnte. „Bin ich also frei, Sire? Möge Eure Majestät das meinem Vater noch einmal bestätigen.“
Der König machte eine ungeduldige Geste. „Zum Teufel mit den noch offenen Angelegenheiten! Diener, bringt mein Maultier! Das darf nicht so enden. Sie ist verrückt geworden! Wir müssen sie so schnell wie möglich einholen. Ein solches Unglück hat es noch nie gegeben. Knechte! Ihr einfältigen Knechte! Geht mir voraus!“
Auf seinem treuen Maultier Macarie, das zum ersten Mal in seinem friedlichen Leben galoppierte, preschte König Pausole davon, eine weiße Staubwolke hinterlassend. Der Wind blies ihm bei diesem wilden Ritt die leichte Krone vom Haupt, und sie blieb ausgerechnet an einem Myrtenzweig hängen.
2 Michel de Montaigne (1533–1592), ein französische Essayist und Denker der Renaissance.
3 Der Vater führt in Wahrheit keine Klage gegen den Ziegenhirten, sondern gegen seine eigene Tochter, da er wohl ihr Verhalten als Schande für seine eigene Ehre empfindet. Der Ziegenhirt ist im Verfahren nicht einmal anwesend.
Kapitel II
in dem der König Pausole, sein Harem, sein Groß-Eunuch und der Regierungspalast vorgestellt werden
Doch in meiner extremen Wankelmütigkeit, die kommt und geht wie Ebbe und Flut, habe ich kaum gesagt, dass ich liebe, da fühle ich schon, dass ich nicht mehr liebe. Saint-Amant4
An dem Tag, an dem Pausole die nötige Reife erreicht hatte – lange vor der Geburt von Blanche Aline – stellte er drei Gewohnheiten und einen charakterlichen Makel an sich fest. Die Gewohnheiten, nach ihrer Bedeutung geordnet, waren: Trägheit, Vergnügen und Wohltätigkeit. An erster Stelle suchte er nach Ruhe, dann nach Genuss, und schließlich danach, anderen Gutes zu tun.
Sein Makel, der in dieser Geschichte eine entscheidende Rolle spielt, war eine beispielhafte und nahezu universelle Unentschlossenheit. Er beklagte sich nie darüber – im Gegenteil. Gerade sie verlieh seinen Faulenzereien eine überlegene Sinnlichkeit, die er sehr schätzte.
Das Schließen eines Fensters fühlte sich für ihn an wie eine unwiderrufliche Entscheidung. Die Wahl einer Frucht, einer Frau oder einer Krawatte stürzte ihn in eine Verwirrung, die beinahe Angst war. Nie zerriss er ein Blatt Papier, nicht einmal einen Umschlag, aus Angst, er könne eine übereilte Entscheidung später bereuen. Sobald er einen Wunsch äußerte oder einen Befehl gab, hielt er die Ausführenden meist sofort zurück: „Wartet! Noch nicht!“, „Das hat Zeit!“, oder: „Wir verschieben das.“ So hielt er sein Leben in vorsichtiger Schwebe und vermied alles, was endgültig war.
Doch diese Furcht vor dem Endgültigen galt nur für ihn selbst. Anderen gegenüber war er im Gegenteil oft überraschend entschlossen. Er sprach Urteile mit bemerkenswerter Bestimmtheit, was seiner Justiz den Ruf von Unfehlbarkeit einbrachte. Denn persönliches Vertrauen überträgt sich leicht auf die Entscheidungen einer Führungsperson – und nichts wirkt auf andere gefährlicher, als zu lange zu zögern.
Unter seinem Kirschbaum dachte Pausole nie lange nach – es sei denn, es ging darum, sich zwischen zwei Kirschen zu entscheiden, rot wie die Wangen eines schüchternen Mädchens.
Nachdem Pausole diese Eigenschaften an sich erkannt hatte, bemühte er sich nicht darum, sich zu ändern. Stattdessen versuchte er, seine Schwächen so zu lenken, dass sie seinem Komfort und dem Wohl seiner Umgebung dienten.
Nach langer Erfahrung erkannte er, dass es klüger war, auf die tägliche Wahl einer Gefährtin aus seinem Harem zu verzichten. Diese Entscheidung fiel ihm immer schwer und führte oft dazu, dass er sich von der Kühnsten verführen ließ, anstatt seinen geheimen Vorlieben zu folgen. Fast immer bereute er es, die Schönste übersehen zu haben.
Eines Tages legte er deshalb eine dauerhafte Regel fest, die ihn von dieser Mühe befreite: Er reduzierte die Zahl seiner Frauen auf genau 365. Eine der Frauen, die nach diesem Dekret in ihre Heimat zurückkehren sollte, brach jedoch so herzzerreißend in Tränen aus, dass der König, stets barmherzig, einwilligte, sie als Gefährtin für die Schaltjahre zu behalten.
Von da an war die Einteilung seiner Nächte genau geregelt – und es lag nicht mehr in seiner Hand, den Plan zu ändern. Jeden Abend brachte ein anderes, doch vertrautes Gesicht die Erinnerung an Wangen zurück, die nach einem Jahr des Wartens umso kostbarer erschienen. Befreit von der Sorge, wen er als Nächstes wählen sollte, genoss Pausole diese einfachen Freuden mit umso größerer Hingabe.
Die Gemächer der Königinnen nahmen, wie könnte es anders sein, fast den gesamten Königspalast ein. Sie waren nach den vier Jahreszeiten geordnet und erstreckten sich in einem langen, bunten Gebäude, dessen tausend Fensterläden in der Sonne flatterten wie Festdekoration. Zwei Pavillons, die jeweils ein Stockwerk höher ragten, flankierten dieses prächtige Bauwerk.
Im einen wohnte der König selbst, im anderen tagte der Ministerrat. Doch um die Regierungsgeschäfte zu leiten, war Pausole gezwungen, durch den Harem zu schreiten – ein Weg, der seine festen Vorsätze regelmäßig ins Wanken brachte. Denn um es ohne Umschweife zu sagen: Wenn er den südlichen Pavillon verließ, erreichte er den nördlichen so gut wie nie.
Diese Anordnung war kein Zufall. Der König selbst hatte sie entworfen – mit klarem Blick auf die Konsequenzen. „Da die besten Monarchen stets im Luxus lebten und sich um die Amtsstuben wenig scherten“, pflegte er zu sagen, „werde ich durch diese geschickte Architektur jede Neigung vermeiden, mich über Gebühr in öffentliche Angelegenheiten einzumischen.“
Und tatsächlich lief alles wie geschmiert. Das Volk war zufrieden – und der König erst recht. Selbst die wenigen Unzufriedenen wagten es nicht, ihre Missgunst auf den Monarchen zu richten, sondern machten, wie es der Brauch ist, „die Ministerien“ verantwortlich. Diese anonymen Amtsstuben hingegen genossen ihre ungestörte Arbeit in aller Ruhe und bedankten sich innerlich bei der Vorsehung für das königliche Laissezfaire5.
Pausole hatte seinen Hang zur Zurückhaltung so weit perfektioniert, dass er nicht einmal über seinen Harem herrschte. An der Spitze dieses kleinen Imperiums, in einer Doppelrolle als Groß-Eunuch und Marschall des Palastes, verwaltete eine eigenwillige Persönlichkeit die Angelegenheiten im Namen des Königs: Das war der Moralist6 Taxis.
Schmächtig, pedantisch, mit eingefallenen Gesichtszügen und hinterhältigem Blick – Taxis war ausgestattet mit einer unnachgiebigen und selbstgerechten Seele. Er wird im weiteren Verlauf dieser Erzählung (um es vorwegzunehmen) die unvermeidliche Rolle des unsympathischen Charakters spielen. Doch Pausole hatte ihn ausgewählt, und niemand konnte daran zweifeln, dass der König seinem Funktionär eine Mischung aus Achtung, Vertrauen und, ja, fast Bewunderung entgegenbrachte.
Dieser ehemalige Algebrist7, später Professor der protestantischen Theologie, dann mit Erfolg in verschiedenen polizeilichen Missionen tätig, war schließlich zum Groß-Eunuchen befördert worden. Er besaß einen Ordnungssinn und eine Prinzipientreue, die weit über bloße Pedanterie hinausgingen. In ihm erkannte man universelle Talente für die Ämter, die der Staat zu vergeben hatte, und Taxis wusste sich unverzichtbar zu machen – wenn schon nicht bei seinen Untergebenen, so doch bei seinen Vorgesetzten.
Ein einziges Beispiel genügt: Nur acht Tage nach seiner Ernennung herrschte im Harem Frieden – ein Zustand, den Pausole inmitten seiner träumerischen Phantasien nie für möglich gehalten hätte.
Es wäre heikel, näher auf die Qualifikationen einzugehen, die Taxis für das Amt des Ober-Eunuchen ins Feld führte – heikel und, um ehrlich zu sein, wenig reizvoll. Taxis schien von Natur aus für diese Position berufen. Der Himmel hatte ihn von den Begierden des Fleisches verschont und, in einem Anfall von Übermaß, auch in keiner Frau solches Verlangen nach ihm geschaffen. Die Vorsehung wollte offenbar verhindern, dass jemand, der selbst von Verlangen unberührt blieb, dennoch die Qual verursachen könnte, Begierde in anderen zu wecken. Taxis war weder Opfer noch Anlass zur Sünde8.
Allerdings musste er sich damit abfinden, unter seinen jungen Schutzbefohlenen keine Bewunderer oder Verbündeten zu finden – etwas, das er ohnehin kaum als Verlust empfand. Er hielt sich streng an seine Pflichten.
Der König, ein erklärter Feind jeder Art von Krieg, verabscheute auch Religionskriege. Als Freund aller Freiheiten ließ er seinen Untertanen Gewissensfreiheit, sei es in jesuitischen oder freimaurerischen Spielarten. Innerhalb des Harems, wie auch auf seinem gesamten Territorium, tolerierte Pausole tausend Kulte und praktizierte selbst mehrere davon – in der Überzeugung, so die verschiedenen Paradiese in all ihrer Vielfalt erleben zu können.
Sein bevorzugter Altar befand sich in einem kleinen Tempel im Park, der Demeter und Persephone9 geweiht war. Diese Göttinnen, die auf Erden keine Verehrer mehr hatten, hörten wohlwollend auf den König, der sich ihrer erinnerte. Von der einen erbat er gute Ernten für sein Volk; von der anderen die Gnade, ihr erst so spät wie möglich vorgestellt zu werden.
Das sind also Pausole, seine Frauen, sein Groß-Eunuch und sein Palast. Sobald wir später erklärt haben werden, wer Blanche Aline ist, können wir die beschreibenden Kapitel beenden – das heißt, wir geben dem Leser weniger Gelegenheit, große Abschnitte auf einmal zu überspringen.
4 Marc-Antoine Girard de Saint-Amant, 1594–1661) war ein französischer Dichter und Vertreter der Barockliteratur
5 Gewährenlassen, Nichteinmischung
6 Im Original: Hugenotte
7 Hier wohl Rechenlehrer der grundlegenden Algebra
8 Normalerweise bezeichnet „Eunuch“ einen kastrierten Mann. Bei Taxis ist Pausole wohl davon ausgegangen, dass die Natur ausreichend vorgesorgt hat.
9 Antike griechische Göttinnen: Demeter ist die Göttin der Fruchtbarkeit, Persephone die Totengöttin.
Kapitel III
in dem Blanche Aline von Kopf bis Fuß beschrieben wird, damit der Leser ihre Flucht beklagen und gleichzeitig verzeihen kann
Wenn die Maler Akte gemalt haben, ist die Sünde groß, denn sie können diese Aufgabe nicht gut erfüllen, ohne die Natur zu betrachten. Examen général des conditions, etc., 1676
Blanche Aline war die Tochter einer Holländerin und – allem Anschein nach – auch des Königs Pausole. Zumindest gab es niemanden, der daran zweifelte.
Ihr Haar war hellblond, ihre Haut von zarter Blässe, die leicht zu erröten schien. Ihre Nasenflügel waren fein geschwungen, ihre Lippen strahlten eine natürliche Heiterkeit aus.
Ich weiß, es mag unüblich sein, das Porträt einer jungen Dame so weit auszuführen, doch ändern sich die Zeiten, und mit ihnen die Konventionen. Vielleicht wird man sich eines Tages weniger von Tabus leiten lassen. Aus Liebe zur Kunst und zum Detail lasse ich mich jedenfalls nicht von heutigen Regeln einengen.
Blanche Aline, sieben Monate vor ihrer Volljährigkeit, zeigte reges Interesse daran, die Verwandlungen ihrer Erscheinung zu studieren. Es ist nur natürlich, dass wir sie dabei begleiten – aus respektvoller Distanz, versteht sich – wenn sie morgens mit aufmerksamer Neugierde vor ihrem Spiegel verweilte.
Kaum erwacht, sprang sie aus dem Bett, ließ ihr langes Nachthemd achtlos zurück und trat, nur mit ihrem geflochtenen Haar bekleidet, an den Spiegel. Die Begegnung mit ihrem Spiegelbild war von jugendlicher Unbekümmertheit und einer Spur Selbstverliebtheit geprägt.
Es begann mit einem Lächeln, das dem Bild im Glas galt. Dann folgten ein paar spielerische Gesten und Küsse, als würde sie eine alte Freundin begrüßen. Anfangs war es reine Sympathie für sich selbst, die aus ihrem Blick sprach – eine stille Zweisprache, erfüllt von Zärtlichkeit und einer Art stiller Freundschaft. Doch nach und nach wandelte sich diese Wärme in neugierige Bewunderung.
Sie hatte erst vor Kurzem die Schwelle zur Jugend überschritten und entdeckte nun, was es bedeutete, heranzuwachsen. Ihre Figur, die sich noch im steten Wandel befand, erschien ihr wie ein Spielplatz voller Möglichkeiten. Die weichen Rundungen, die ihre Erscheinung zierten, schienen ihr wie kleine Wunder: Neugierig tastete sie sich voran, begutachtete hier die zarte Form einer Hüfte, dort die geschmeidige Linie ihres Beins – mit einer Faszination, die so rein war wie das Lächeln auf ihren Lippen.
Und wen hätte sie sonst lieben sollen, wenn nicht ihr eigenes, vertrautes Bild im Spiegel? Ihr Vater hatte ihr nie eine Freundin gegeben, und mit ihrer abgeschiedenen Erziehung war ihr Spiegelbild der einzige vertraute Gegenüber.
Man kann es bereits ahnen: Pausole, der gegenüber den Sitten seines Volkes so tolerant war, zeigte sich in Bezug auf seine Tochter überraschend streng. Während er es schätzte, den Schönheiten seines Reiches zu begegnen, frei und unbekümmert unter dem südlichen Himmel, bestand er darauf, dass Blanche Aline vor der Sonne geschützt blieb. Nicht aus moralischen Bedenken, sondern aus Rücksicht auf ihren Teint. Die Sonne des Südens, so pflegte er zu sagen, war nicht gnädig zu blonden Schönheiten wie ihr. Ein ungeschützter Aufenthalt im Freien hätte ihren zarten Glanz in einen Ton verwandelt, der an gekochten Hummer erinnerte – und das, so befand er, hätte sie ihrer einzigartigen Ausstrahlung beraubt. Deshalb zwang man sie, Kleidung zu tragen und stets einen Sonnenschirm mitzunehmen, wann immer sie die schattigen Gemächer verließ.
Von väterlicher Zärtlichkeit inspiriert, hielt Pausole es für richtig, seine vertrauten Theorien zur Kindererziehung bei seiner eigenen Tochter nicht anzuwenden. Moralisten scheuen sich selten, widersprüchlich zu handeln. Sie sind überzeugt, dass es genügt, das richtige Wort zu predigen, und dass ihr persönliches Beispiel für die Wirkung ihrer Ideen entbehrlich ist.
„Natürlich“, dachte der König, „bin ich der Meinung, dass Kinder mit größtmöglicher Freiheit erzogen werden sollten – man muss sie ihren Instinkten überlassen, damit sie die ersten Freuden ihres kleinen, armseligen Daseins entdecken. Aber meine Tochter ist ein Sonderfall. Ihr Wohl verlangt eine besondere Behandlung. Keine Regel gilt für alle.“ Kurz gesagt: Er sperrte das unglückliche Kind ein.
Blanche Aline wusste wohl, dass das Schicksal ihr 366 Stiefmütter beschert hatte, von denen viele wegen ihres Geistes oder ihrer Schönheit herausragten. Doch der Zugang zum Harem blieb ihr Tag und Nacht verwehrt. Ihre Mutter war schon lange tot, Schwestern oder Freundinnen hatte sie nicht. Selbst die Hofdamen hatten strikte Anweisung, nur dann mit der Prinzessin zu sprechen, wenn es ihrer literarischen Bildung diente. Und doch blieb Blanche Aline fröhlich, denn da sie keine bessere Welt kannte, vermisste sie nichts.
Am Morgen gehörte ihr der ganze Park. Es war die Stunde, in der der König und die Königinnen noch schliefen. Sie spielte allein, mit einer Freude und Lebhaftigkeit, als wäre eine Schar Kinder um sie. Die Bäume waren ihre Gefährten, versteckte Winkel des Parks ihre Vertrauten. Atmungslos kehrte sie zurück, nachdem sie mit einer grünen Eidechse Verstecken oder mit einem rosafarbenen Kaninchen Wettrennen gespielt hatte.
Doch eines Morgens – ganz plötzlich – erschien es ihr interessanter, mit ihren Träumereien Federball zu spielen und mit ihrem Spiegelbild Menuett zu tanzen. Und nicht allzu lange danach erfuhr Pausole durch ihren Brief, dass sie den Palast verlassen hatte – mit „jemandem sehr Netten“, der versprach, gut auf sie aufzupassen.
So fand Blanche Aline, selbst in der Einsamkeit, in die ihr Vater sie eingeschlossen hatte, ohne Rat und ohne Vorbilder, durch die Kraft ihrer jugendlichen Phantasie genau die Gefährten, die sie in ihrem Alter der Verwandlung brauchte.
Kapitel IV
in dem König Pausole in seinen Palast zurückkehrt und entscheidet, was als Nächstes zu tun ist
Ich sitze auf dem Holz, die Pfeife in der Hand, den Kopf gestützt am Stein, das Herz von Gram umfangen, der Blick gesenkt, die Seele trotzig und befangen, und fluche meinem Los, dem harten Lebensband. Saint-Amant
Vor den Stufen des Portikus hielt das Maultier Macarie auf seinen zitternden Beinen inne, tief verletzt durch die Zumutung eines wilden Galopps – etwas, das weder zu seinem Alter, noch zu seinen Gewohnheiten, geschweige denn zu seinem Wesen passte.
König Pausole trat unter die Gewölbe, ohne Krone, mit wirrem Haar, staubiger Robe und hilflos erhobenen Händen. Er nieste, Tränen stiegen ihm in die Augen. Er war erschöpft, niedergeschlagen, schweißgebadet, außer Atem und puterrot vor Anstrengung.
Niemand schien bereit, ihm die ersten Erklärungen zu geben. Die Korridore, leerer als die Galerien eines Museums, führten in verlassene Zimmer. Die Wachen hatten ihre Hellebarden zurückgelassen, die Hofdamen ihre Stickarbeiten hastig mit einer Nadel gesichert. Pausole stieß mit dem Fuß gegen einen verlassenen Phonographen, der ihm unvermittelt Mephistos Serenade vorspielte.
Der König kam zu dem Schluss, dass auch der gesamte Hof aufgebrochen sei, um der Prinzessin zu folgen – nicht aus Pflichtgefühl, sondern als Hommage an ihr charmantes Beispiel. Einzig in einer Fensternische fand sich eine Wäscherin, die offenbar in ihrer Arbeit gestört worden war. Pausole wollte sie fragen: „Ist das wahr?“ Doch seine Kehle brachte keinen Laut hervor, und die erschrockene Haltung der Magd zeigte ihm, wie sinnlos eine solche Frage gewesen wäre.
Er setzte seinen Weg durch die stillen Gemächer fort, vorbei an fünfzehn Salons, in denen die Sessel wie eingefroren in vertrauten Positionen verharrten. Keiner war besetzt. Im Saal der Porträts hielt er inne und blieb vor einem Bildnis stehen, das in seiner verblassenden Erinnerung noch ein wenig der überaus anmutigen Königin Christiane ähnelte – der Mutter von Prinzessin Aline.
Er flüsterte: „Unglückliche! Ist das etwa Dein Blut? Deine Abstammung?“ Doch Königin Christiane, die der Maler als Danaë10 dargestellt hatte, lächelte weiterhin unverändert. Ihre Knie blieben geöffnet, und kein Hauch von Scham legte sich auf ihre makellose Stirn.
Schließlich betrat der König den stillen Harem. Es war die Stunde der Siesta. Der große Saal atmete im trägen Rhythmus von dreihundert Träumen. Alle Frauen lagen dort, wo der Schlaf sie übermannt hatte. Einige ruhten auf kühlen Matten aus Schilfrohr, andere hatten sich auf die Stoffe ausgestreckt, während wieder andere mit ihren entspannten Körpern die weitmaschigen Hängematten füllten. Pausole konnte weder einen Schritt tun, noch sich setzen oder den Kopf heben, ohne auf eine nackte Schlafende zu stoßen.
Auf einem einzigen Diwan lagen fünfzehn Frauen nebeneinander. Ein gespanntes Netz hielt zwei von ihnen eng beieinander und drückte ihre Körper sanft aneinander. Diejenigen, die der Hitze zu entkommen suchten, hatten Zuflucht im flachen Becken gefunden. Mit den Köpfen auf dem kühlen Marmorrand gestützt, ließen sie ihre Beine unter Wasser ausgestreckt bis hin zur Statue einer Sirene, die in der Mitte des Beckens thronte. Diese bildete den Stempel einer geöffneten Tulpe, deren strahlenförmig angeordnete Körper die Frauen umgaben.
Inmitten dieser großen Stille begann auch Pausole sich zu beruhigen. Frieden, ebenso wie Unruhe, hat etwas Ansteckendes. Die ruhige, gedämpfte Atmosphäre des Harems legte sich wie ein wohltuender Schleier auf sein Gemüt. Als er einen Blick auf seine Kleidung warf, sah er, dass sie in einem erbärmlichen Zustand war. Nach und nach kehrte die Klarheit in seinen Geist zurück, und sie riet ihm, sich umzuziehen. Das tat er – jedoch nicht ohne Schwierigkeiten.
Die Wäscherin, die er zuvor getroffen hatte, hatte bereits im ganzen Palast das Gerücht verbreitet, der König sei ohne Krone, ohne Stimme und ohne Verstand zurückgekehrt, habe sie beinahe erwürgt – und sie sei dadurch zwei Tage früher als sonst unwohl geworden.
So wagte es der erste Diener, der auf Pausoles Ruf hin erschien, nur zögernd, die Spalte eines gerafften Vorhangs zu durchqueren – getrieben gleichermaßen von Neugier wie von einer gewissen Todesverachtung. Doch er erstarrte vor Überraschung, als er den König in seiner wohlbekannten, freundlichen Stimme sagen hörte: „Meine türkische Hausrobe und mein Zigarettenetui, bitte.“
Der Herrscher von Tryphême, der sich so rasch wieder gefasst hatte, begann über die Situation nachzudenken. Es war nichts damit gewonnen, einfach anzuordnen, dass man Blanche Aline verfolgen solle. Selbst diese Entscheidung durfte nicht leichtfertig getroffen werden. Angenommen, man entschloss sich zu diesem Extrem – wie sollte man eine Suche planen, die so heikel war? Wen könnte man mit der Durchführung beauftragen?
Und selbst wenn all diese Fragen gelöst würden – welche Anweisungen sollte man dem Beauftragten für den Fall geben, der nur allzu leicht vorherzusehen war? Was, wenn die Prinzessin sich weigerte, den Bitten, den eindringlichen Appellen oder gar den respektvollen Aufforderungen Folge zu leisten, die man ihr zweifellos überbringen müsste?
Offensichtlich ließen sich all diese Probleme nicht in fünf Minuten lösen. Außerdem drängte nichts. Welchen Zweck hätte es, die Dinge zu überstürzen? Alles deutete darauf hin, dass es bereits zu spät war, um Blanche Aline vor dem schlimmsten denkbaren Risiko zu schützen.
Aber sie in den Palast zurückzubringen, dafür war später auch noch Zeit. Da die vollendeten Tatsachen – wenngleich offenkundig und skandalös – nicht zu ändern waren, entschied Pausole, in aller Ruhe über die Folgen nachzudenken und eine Lösung zu suchen. Nachdem er sich so entschlossen hatte, vorerst keine Entscheidung zu treffen, nahm er ein Bad, rauchte zwei Zigaretten und aß einige Kekse, die er in alten Portwein tunkte.
Doch ein Bild ließ ihn nicht los: Wider Willen stellte er sich vor, wie sei - ne Tochter in genau diesem Moment einen wichtigen Schritt ihrer Entwicklung vollzog. Er sah sie – in einer Haltung, die sich leider nur allzu leicht ausmalen ließ – und alle Phasen der erahnten Szene spielten sich mit schmerzhafter Deutlichkeit in seinem Kopf ab.
Besonders störte es ihn, dass er keinerlei Informationen über die zweite Person hatte, die an diesem Abenteuer beteiligt war. Sein Leben war gestört, seine innere Ruhe erheblich verletzt – und er wusste nicht einmal, auf wen er wütend sein sollte!
Ein solches Ereignis hätte nicht geschehen dürfen, ohne dass er zumindest in beratender Funktion einbezogen worden wäre. Jede Art von Bildung erfordert schließlich einen Spezialisten, dessen Eignung und Kompetenz die Schülerin selbst kaum beurteilen kann. Pausole konnte nicht begreifen, wie seine Tochter ausgerechnet an dem Tag, an dem sie sich erstmals einem so klassischen Fach widmete, einen Lehrer ihrer Wahl bestimmt hatte – ohne vorher sicherzustellen, ob dieser überhaupt qualifiziert war, ihr Unterricht zu erteilen.
Ja, das war zweifellos ein Fehler. Aber ein Fehler, den man nicht mehr rückgängig machen konnte. Also blieb nichts anderes übrig, als ihn mit Gelassenheit hinzunehmen. Es bringt nichts, das Unabänderliche zu kritisieren – man verschwendet nur seine Zeit.
Der König erinnerte sich an diese Lebensweisheit und an mehrere andere, die ebenso tröstlich waren. Zeit zu verlieren – „sich zu pausolisieren“, wie er selbst gern sagte – war ihm an jedem anderen Tag leichtgefallen. Doch an diesem Abend fühlten sich selbst seine Träumereien unangenehm an. Und so kehrte er in den Harem zurück.
10 Danaë (altgriechisch Δανάη Danáē) war in der griechischen Mythologie die Tochter des Akrisios, Geliebte des Zeus und durch ihn Mutter des Heroen Perseus.
Kapitel V
in dem König Pausole sich mit den Frauen seines Harems berät und eine kluge Wahl unter ihren Ratschlägen trifft
Warum sind die Damen so zufrieden, wenn man ihnen sagt, dass andere Damen die Liebe so handhaben wie sie? – Weil ihre eigene Schuld dadurch kleiner erscheint. Questions diverses et responces d'icelles, 161711
Während Pausole nachdachte, schlugen alle Uhren vier. Noch bevor der letzte Glockenschlag verklang, durchschritt Taxis, eine kleine Glocke in der Hand, bereits mit methodischen, entschlossenen Schritten den großen Saal.
Die Frauen erwachten widerwillig. Einige seufzten mürrisch, drehten sich um und versuchten, ihren unterbrochenen Traum wieder aufzunehmen – jedoch ohne große Hoffnung, dass man es ihnen erlauben würde. „Meine Damen“, sagte der Groß-Eunuch, „die Zeit des Schlafens ist vorüber. Aufstehen! Aufstehen!“
„Ach nein … bitte …“, flehten einige Stimmen.
„Es hat keinen Sinn, gegen die Ordnung zu kämpfen“, erklärte Taxis. „Die Schrift lehrt uns: ‚Alles hat seine Zeit unter dem Himmel: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen.‘ Es gibt eine Zeit zum Träumen und eine Zeit zum Leben. Aufstehen!“ (Prediger 3, 1–3)
Er hielt inne und ließ seinen strengen Blick über eine Ecke des Saals schweifen, die über und über mit lang ausgestreckten, erschöpften Körpern bedeckt war. „Ah!“, rief er gereizt. „Hier herrscht ein skandalöser Zustand! Ab heute Abend werde ich jeder von Euch einen festen, unveränderlichen Platz zuweisen, den sie zur Siesta nicht verlassen darf.“
Ein leises Gemurmel erhob sich, doch ein drohender Blick brachte es sofort zum Verstummen. „Ruhe!“, rief Taxis. „Meine Worte sind inspiriert von Rücksicht auf Hygiene, Ordnung und Anstand. Doch selbst wenn dem nicht so wäre, bliebe ihre Weisheit unbestreitbar. Denn es steht geschrieben: ‚Du sollst durch Gesetze und Vorschriften leben.‘ Was der Laune entspringt, ist verwerflich. Was durch Autorität bestimmt wird, ist vernünftig. So spricht eine gesunde, strenge und geradlinige Stimme.“ (3. Mose 18, 5)
Ein junges Mädchen wagte vorsichtig einzuwenden: „Verzeihung, Monsieur, warum lasst Ihr uns nicht selbst wählen? Ich schlafe lieber auf einer Matte, und meine Schwester mag Teppiche. Wenn Ihr uns zwingt, das Gegenteil zu tun, wird niemand zufrieden sein, und wir werden unglücklich.“
„Das spielt keine Rolle. Ihr wisst nicht, was gut für Euch ist. Die Autorität weiß es – für Euch, ohne Euer Wissen, trotz Eurer selbst. Das ist ihre Aufgabe.“
„Auch wenn niemand sie verlangt?“
„Die Autorität wird ausgeübt. Sie fragt nicht. Sie allein entscheidet über ihr Recht, ihre Grenzen und ihre Handlungen.“
„Im Namen von wem?“
„Im Namen der Prinzipien.“