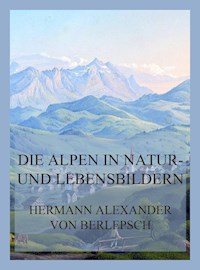
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Hermann Alexander von Berlepsch war ein Schweizer Schriftsteller und Publizist. Sein Mitte der 1860er Jahre erschienenes Werk "Die Alpen in Natur- und Lebensbildern" beschreibt in vielen Skizzen eindrucksvoll die Wunder seiner gebirgigen Heimat. Er kennt Land and Leute und bringt deshalb keine Stubenskizzen, sondern Bilder aus dem Leben, keine Phantasiesstücke in französischer Manier, aufgeputzt wie zu einem Theaterspiel. Seine Darstellungen sind phantasievoll und erschöpfend. Sein Zweck ist es zunächst, dem größeren Teil der Reisenden ein Buch in die Hand zu geben, das sie in einer geistreichen Erzählweise vorbereitet für die Reise selbst oder umgekehrt ein herrliches Erinnerungsblatt bildet an den Besuch der Alpenwelt . Den sonst trockenen geologischen Stoff hat der Verfasser mit viel Geschick auch dem Laien zugänglich gemacht und besonders in seinen Vergleichen interessant gestaltet. Am anziehendsten und auch gelungensten bleibt jedoch jener Teil des Werkes, der Naturschilderungen enthält. Hier ist Berlepschs eigentliches Feld, worin ihn seine fleißigen, jahrelangen Beobachtungen, seine großen Gebirgsreisen und seine vortreffliche Gabe zu erzählen, besonders unterstützen. Er sucht im Gebirge interessante Punkte im Natur- und Menschenleben auf und besonders bei den meistenteils zurückhaltenden Gebirgsvölkchen brachte ihn sein zutrauliches Wesen in engere Verbindung und machte es ihm möglich, in ihre eigentümlichen Lebensverhältnisse, Sitten und Meinungen einzudringen. Diese Neuausgabe wurde sprachlich so überarbeitet, dass die wichtigsten Wörter und Begriffe der heute gültigen Rechtschreibung entsprechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Alpen in Natur- und Lebensbildern
HERMANN ALEXANDER VON BERLEPSCH
Die Alpen in Natur- und Lebensbildern, H. A. von Berlepsch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662301
Druck: Bookwire GmbH, Voltastr. 1, 60486 Frankfurt/M.
Quelle: Berlepsch, Hermann Alexander: Die Alpen in Natur- und Lebensbildern. Leipzig, 1871. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/berlepsch_alpen_1861>, abgerufen am 23.05.2022. Der Originaltext aus o.a. Quelle wurde so weit angepasst, dass wichtige Begriffe und Wörter der Rechtschreibung des Jahres 2022 entsprechen.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Das Alpengebäude.2
Granit.15
Erratische Blöcke.21
Karrenfelder .25
Nagelfluh.29
Der Goldauer Bergsturz. 33
Der Bannwald.47
Die Wettertanne.58
Legföhren.64
Die Alpenrose.70
Südliche Alpentäler.76
Kastanienwald.81
Eine Nebel-Novelle.87
Nebelbilder .95
Wetterschießen.98
Hochgewitter.101
Der Wasserfall.107
Der Schneesturm im Gebirge.119
Roter Schnee .127
Die Rüfe.131
Die Lawine.139
Der Gletscher.152
Alpenglühen.170
Alpenspitzen.176
Gebirgspässe und Alpenstraßen.204
Die Hospizien.223
Sennenleben in den Alpen.234
Das Alphorn.250
Der Geißbub.255
Der Wildheuer.263
Alpstubete oder Älplerfest.271
Holzschläger und Flößer.279
Auf der Jagd.287
Dorfleben im Gebirge.297
Und habe ich ein Lied gemacht
Das voller klingt und freier, —
Es klingt von Eurer Glut entfacht
Ihr Alpen, Euch zur Feier.
Und ist es arm und reizentblößt,
Ists, wie Ihr selbst, noch nicht erlöst't: —
Ich sang, wie mir's der Gott beschied,
Der überm Schnee sein heis'res Lied
Dem Adler gab und Geier.
L. Seeger.
Das Alpengebäude.
Die Natur
Vermag nicht unter ähnlicher Gestalt
Den Fortgenuss der Dinge zu gewähren.
Sie wechselt ihre Formen, und sie lässt
Des Einen Bild in andre übergehen,
Doch mit Verschiedenheit von Geist und Kraft.
So wächst der unermessne Reichtum auf,
Und ewig zeigt sich eine andere,
Und doch dieselbe Welt.
Knebel.
Die Alpen sind einer der großartigsten Beweise von der Majestät der Schöpfungsgewalt.
Staunt der denkende Mensch schon alle die Wunder und erhabenen Zeugnisse der erschaffenden, erhaltenden und auflösenden Kraft in der Natur an, welche täglich, stündlich vor seinem sehenden Auge, nach einem großen gemeinsamen Organisationsgesetze Neues gestaltet, Existierendes bewegt und belebt, Verbrauchtes, Vollendetes wieder dem Urquell der Materie oder einer neuen Bestimmung im großen Kreislaufe der Schöpfung zuführt und ihm einen Maßstab für die nimmer rastende, Alles ergreifende, Alles umfassende Tätigkeit des wollenden, ordnenden, Alles durchdringenden und vollbringenden großen Geistes im Universum gibt, — dann wird er tief ergriffen, erschüttert vor jenem imposanten Riesenbau der Alpen stehen, der von Gewalten emporgerichtet wurde, für deren materielles Entstehen und Wirken die Naturwissenschaften zwar allgemeine, aus den Erscheinungen gewonnene Normen aufstellen und ihr Verhältnis zu anderen Naturgesetzen nachweisen, deren ganze Aufgabe, Ausdehnung und Grenzen im Weltall das menschliche Ergründen und Erkennen aber nur zu ahnen vermag.
Nur wenige Menschen kennen die wirkliche und volle Majestät des Alpengebäudes. Sie entschleiert sich da am allerwenigsten, wo die breiten Heerstraßen über Joche und Bergsättel laufen, oder wo das kleinliche Treiben des alltäglichen Verkehrslebens an die Fußschemel dieses Schöpfungswunders sich herangewagt hat. In die Geheimnisse der verborgenen Gebirgswelt musst Du hineindringen, in die Einsamkeit der scheinbar verschlossenen Schluchten und Taltiefen, wo der Kulturtrieb des Menschen ohnmächtig ermattet, weil er die Schwäche seines Strebens gegenüber der Erhabenheit der Alpennatur erkennt, — über Urwelt-Getrümmer musst Du klimmen, durch Gletscherlabyrinthe und Eiswüsten in das Tempelheiligtum eingehen, welches sich dort vor Deinem erbangenden Blicke frei und kühn in den Äther emporwölbt. Da wird sie Dir entgegentreten die unbeschreiblich hohe Pracht der Alpenwelt in ihrer ganzen Herrlichkeit und Größe, da wirds mit Geisterstimmen Dich mächtig umrauschen, und überwältiget wirst Du niedersinken vor diesen verkörperten Gottesgedanken. Und hast Du Dich dann aufgerafft von dem ersten gewaltigen Eindrucke, — hast Du im Anschauen der gigantischen Massen das Herz Dir ausgeweitet und empfänglich gemacht für noch größere und herrlichere Offenbarungen, dann richte kühn eine Frage an jene Mausoleen urvordenklicher Zeiten, dann forsche, welche Hand sie emporgehoben hat aus der Tiefe ewiger Nacht in das Reich des Lichtes, — dann schlage die Geschichte ihrer Schöpfungstage in den Felsenblättern dieser versteinerten Weltchronik nach und erforsche ihren Existenzzweck; — und die großen toten Massen werden sich beleben, es wird sich Dir ein Blick erschließen in den unendlichen Kreislauf der Ewigkeit.
Gedankenvoll, verstandvoll ist die Schöpfung,
Ein großes Herz, das Wärm' in alle Adern,
In alle Nerven Glut der Fühlung gießt
Und sich in Allem fühlet.
Herder.
In weit gestrecktem Halbbogen durchziehen die Alpen das südliche Europa, ein Glied jenes kolossalen Erdrippen-Baues, der den, ins mittelländische Meer hinausragenden Landzungen der Iberischen, Italienischen und Osmanisch-Hellenischen Halbinseln als Pyrenäen, Apennin, Tschar-Dagh und Hämus ihren inneren Halt gibt. Sie sind Resultate und Gebilde viel hunderttausendjähriger Kristallisationen und Niederschläge aus einstigen Urmeeren. In verschiedenen Epochen erfolgten dann Hebungen und Senkungen, abermalige Überflutungen und neue Ablagerungen, und endlich durchbrachen feuerflüssige Produkte aus den Schmelzöfen des Erdinneren diese vielfach übereinander lagernden Schichten,
Wer Zeuge jener Umwälzungen und Ausbrüche hätte sein können, als in den Zentral-Alpen der eigentlichste, innere Kern des riesigen Berggebäudes, die Granite, Gneise und kristallinischen Schiefer aus den Tiefen der Erdrinde emporgedrängt, von den strahlend aufschießenden Massen der hornblendartigen Gestein durchbohrt und in Fächerform aufgerichtet wurden? Wie ohne mächtig möchten die Momente des wildesten Natur-Aufruhrs die wir kennen, — wie unbedeutend Erdbeben und Meeressturm, Vulkan-Ausbruch und Felsensturz der Jetztzeit gegen jene Katastrophen erscheinen, welche dem Alpengebäude seine gegenwärtige Gestalt gaben? Wie hat unser Verstand so ganz und gar keinen Anhaltspunkt, um einen nur einigermaßen entsprechenden Begriff für jene welterschütternden Epochen zu bilden? Vertausendfachten wir den furchtbarsten Aufruhr des wildesten Gewitters, welches die gesteigerte Phantasie auszumalen im Stande ist, — dächten wir uns alle Feuerschlünde der zur Kriegsführung der Völker auf Erden existierenden Geschütze auf einer Stelle versammelt, auf ein Kommandowort losgebrannt — wie nichtig würden sie immerhin noch im Verhältnis zu jenen Momenten sein, in welchen die noch Milliarden und abermals Milliarden von Kubikklaftern fester Gesteine der Zentral-Alpen aus ihren Fugen gerissen zerbarsten, und zersprengt, himmelhoch aufgerichtet oder übereinander geworfen wurden?
— — zur Zeit, als noch ein Flammenbrand
Gen Himmel lohte aus der Berge Kuppen,
Als sich in Schmerz die Erde kreisend wand.
Formlos geballt lag sie in wilden Gruppen;
In Flutendrang und durch der Flamme Kraft
Sollt' sie verklärt, ein Phönix, sich entpuppen.
Und Alles, was sie schuf, war riesenhaft.
Es hat die größte Wahrscheinlichkeit für sich, dass die meisten der erdgestaltenden Vorgänge langsam, sehr langsam sich entwickelt haben mögen. Denn zuverlässig ist der Härtezustand der Gesteine während der großen Revolutionsperioden ein viel minder spröder, weniger erfesteter gewesen, als heute, so dass die beiden, jedenfalls am bedeutsamsten bei der Erdgestaltung beteiligten Faktoren: die Zentrifugal- (oder mechanische, durch den Erdumschwung bedingte Anziehungs-Kraft und die Expansion (Ausdehnung) durch Gase, Dämpfe, Wasserdruck aus dem Erdinnern, — leichter und stetiger auf die Gestaltung einwirken konnten. Aber ebenso sicher ist es auch, dass andere physikalische Gesetze, wie von Anbeginn der Materie bestanden, — wie z. B. das Gesetz der Schwere, — aktive Augenblicke in der äußeren Bildungsgeschichte des Alpenbaues herbeigeführt haben müssen, die, energisch in ihren Wirkungen, zu dem Furchtbarsten gehören, was der menschliche Gedanke nur zu erfassen vermag. Tausend Merkmale bezeugen dies bei näherer Betrachtung des Gebirgsreliefs, namentlich die noch heute an pittoresken Formen reichen, scharfkantigen Linien und Brüche der Dolomit-Gebirge, die sich weder abrunden, noch verwitternd zerbröckeln, — die abenteuerlichen Zickzack-Ornamente und wunderbar phantastischen Formenspiele in den Kalkalpen, soweit diese nicht durch Firn-Einlagerungen oder Überdeckung mittelst jüngerer Felsgebilde dem Auge entzogen werden, — dies bezeugen die großen Talrisse und Schluchten, wie die in der Via-Mala, im Taminatale, in der Trientschlucht, die schlundähnlichen Mündungen der meisten südlichen Walliser und Engadiner Seitentäler, deren beide Tal- oder Schluchtwände heute noch die ineinander passenden Bruchflächen (mitunter bis in die kleinsten Details erhalten) zeigen, — das bestätigen die kahlen, im Material-Profil sich präsentierenden Felsenköpfe, die, senkrecht absinkend, alle übereinander liegenden Schichten dem Blicke preisgeben, während der Pendent, der abgebrochene, einst gegenüberstehende, nunmehr fehlende, massige Gegen- Part in die Tiefen versunken ist, wie z. B. am Wallensee die Wände der Churfirstenkette, die Felsenfronten des Fronalpstockes und Axen am Vierwaldstätter-See u. a. m.
Betrachten wir dann weiter jene majestätischen Strebemassen, die gleich gigantischen Obelisken frei und kühn in die Wolken emporsteigen, Zinken wie das unerklimmbare, schneenackte, 13850 Fuß hohe Matterhorn, die blendende Firnpyramide der fast ebenso hohen Dent blanche, das neunzinkige Gipfeldiadem des Monte Rosa (von 14200 Fuß Höhe), welche unmöglich in ihrer Pfeiler- Gestalt, wie wir sie jetzt sehen, durch die Erdkruste aus der Tiefe hervorgestoßen sein können, sondern nichts als vereinzelt stehengebliebene Ruinen-Reste des ehemaligen alten Berggebäudes sind, — was für grässliche Zertrümmerungs-Akte müssen es gewesen sein, die jene dazwischen nun fehlenden Glieder lostrennten und wahrscheinlich in die Tiefen, aus denen sie emporgestiegen waren, zurücksinken ließen? denn, dass allmählige Verwitterung diese Felsentürme so abgenagt und modelliert habe, dagegen sprechen eine Menge von Gründen.
In keinem anderen Gebirge Europas liegen Entstehung, Zerstörung und Neugestaltung so unmittelbar und in so markigen Zügen nebeneinander, wie in den Alpen; an Großartigkeit der Formen, an Mannigfaltigkeit der Zerklüftung und Verwerfung der Schichten werden sie von keinem anderen unseres Kontinentes übertroffen.
Es ragt die heilige Urschöpfungszeit,
Von Felsenzacken eine Riesenwelt,
Ein wildes Urgebirge weit und breit,
In starrer Pracht zum blauen Himmelszelt. (K. Beck.)
Aber kein anderes Berggebäude unseres Erdteiles vermag auch einen solchen Mineralreichtum, eine so instruktive Skala des Erdbildungsprozesses aufzuweisen, wie die Alpen. Freilich werfen Umbiegungen oder gänzlich abnormer Wechsel der Schichten, eingelagerte Sedimentstreifen in den kristallinischen Gesteinen und widerstreitende Stratifikationen dem Geologen oft fast unlösbare Rätsel in den Weg und öffnen ihm Tor und Tür zu den abenteuerlichsten Hypothesen.
Um sich ein annähernd richtiges Bild von der inneren Konstruktion, von dem Material-Bau, von der geognostischen Aufeinanderfolge der Gesteinsarten in den Alpen zu machen, denke man sich, dass ein einstiges Urmeer durch unbestimmbar lange Schöpfungs- und Erdgestaltungs-Perioden hindurch Schlammschichten ablagerte, wie wir einen ähnlichen Prozess im Kleinen heute noch an den Ufern der Flüsse und nach Überschwemmungen wahrnehmen können. Jede dieser Perioden verschlang ganz oder teilweise die damals auf den emporgetauchten Inseln oder Kontinenten, oder in den Gewässern zur lebensvollen Entwickelung gelangten Tiere und Pflanzen und begrub dieselben in ihren Ablagerungsschichten. Ganze Generationen von Organismen, die in unseren Zeiten nicht mehr existieren, gingen mit ihnen unter. Diese eingeschlossenen Zeugen der verschiedenen Epochen organischen Lebens (jetzt als Versteinerungen oder Petrefakten und Pflanzenabdrücke in den Gebirgsschichten gefunden) wurden die Erkennungszeichen und Merkmale, nach denen die Wissenschaft der Geologie die Blätter ihrer Schöpfungsgeschichte ordnet. Die Reihenfolge derselben ist, wo sie nicht gewaltsam gestört wurde, übers ganze Erdenrund die gleiche. Es müssen also die älteren und ältesten Ablagerungen oder „Sediment-Gebilde“ zuunterst und die je später erfolgten jederzeit darüber liegen. Also stellt es sich auch im Alpenlande und in seiner Umgebung dar.
Eine Wanderung bergwärts von Süddeutschland aus führt uns durch die geologischen Gebiete aller Hauptepochen und ist am besten geeignet, die Entwickelungselemente und deren Gliederung vorzuführen. Die große bayerische Ackerbau-Ebene zwischen Donau und Inn, die Flächen von Nürnberg, Ulm, Augsburg, München bis in die Nähe von Passau, gehören den jüngsten Ablagerungen oder Alluvial-Gebilden an; überall, wo man durch die fortdauernden Humus-Bildungen einen Spatenstich ins Erdreich tut, kommt man auf Kiesgruben, Schuttablagerungen oder torfähnliche Unterlagen. Unter diesen zeigen sich Diluvial-Gebilde, teils geschichtete, teils ungeschichtete Lager von Blöcken, namentlich auch sogenannte erratische Schichten. Steinbrüche sind so selten, dass man in den Dorffluren mancher Gegenden hölzerne Grenzsteine setzt. — Ein Schritt weiter südwärts bringt uns in bergiges Terrain, ins Bayerische Hochland, ins Allgäu, an den Bodensee und in das größte und breiteste Tal Europas, in das Schweizerische Mittelland (zwischen Jura und Alpen), in welchem Zürich, Bern, Freiburg und Lausanne liegen. Wiese und Wald wechselt mit agrikolen Distrikten, die Gegend wird farbiger, formiger, Bäche und Flüsse nehmen einen beschleunigteren Lauf an und sammeln sich in tief ausgespülten Seebecken an der Vorberge Fuß. Noch bekränzen die rundlich weichschwellenden Formen der Laubhölzer Anhöhe und Niederung; weithin sind die Halden mit zerstreuten Wohnungen übersäet; Dörfer und Städte bergen rasch pulsierendes, hastig drängendes, nach Erwerb ringendes Leben. Es ist das Gebiet der Molasse-Gebilde, die nach den eingeschlossenen Muscheln sich teils als Niederschläge aus salzigen Meeresgewässern, teils als solche aus süßen Wassern ausweisen und meist als blaugraue Sandsteine, Mergel- und Lettenschichten, Süßwasserkalk, Muschelsandstein und große Konglomerat-Bänke — Nagelfluh genannt — darstellen. Die Berge dieser Zone zeigen nur rundliche, hügelhafte Formen; in der Schweiz wachsen diese bei etwas entschiedeneren Linien bis zu einer Hebung von 6000 Fuß an (Speer, Rigi, Napf).
Abermals ein Schritt weiter dem Gebirge zu und in dasselbe schon eintretend, gelangen wir nach Salzburg, Sonthofen, in das österreichische Vorarlberg, in die Kantone Appenzell, St. Gallen, Glarus, Schwyz, nach Sarnen im Kanton Unterwalden, an den schönen Thuner-See. Der Ackerbau verlässt uns immer mehr, die Landschaft wird entschieden alpenhaft, der Laubwald zieht sich zurück und Nadelholzforste treten an dessen Stelle; Viehzucht beginnt die vorherrschende Beschäftigung des Volkes zu werden. Die leuchtend grellen Farben roter Ziegeldächer und weißbetünchter Häuser verschwinden allgemach; silbergrau auf grün, gebleichte Schindeldächer auf den Holzhäusern in Mitte schwellender Matten treten als charakteristische Momente hervor. Die Molasse-Gesteine verschwinden; ein anderes Gebilde schiebt sich unter denselben hervor, das also älter ist und sich durch das ganze mittägige Europa, tief nach Afrika und Asien hinein verbreitet zeigt. Es ist das der Eozän-Bildungen, welche, in Flysch- und Nummuliten-Gesteine unterschieden, bald als Schiefer und Sandstein, bald als kalkartige Gesteine in respektablen Gebirgsketten und schroff abgerissenen Felsen-Fassaden auftreten. Begreiflich besteht nicht die ganze Aufgipfelung eines solchen Gebirgs-Individuums lediglich aus diesem Gestein, sondern dasselbe ist entweder nur das vorherrschende, wie in der stolzen Bergpyramide des Niesen (7280 Fuß) am Thunersee, wo die Flyschlager eine Durchschnitts-Dicke von 4500 Fuß erreichen, — oder, es ist das zuoberst aufliegende, in schwindelnde Höhe mit emporgehobene Gestein wie an der Schrattenfluh im Emmental oder an den zackig-gebrochenen, scheinbar in sich selbst zusammengesunkenen Ralligstöcken und auf dem Niederhorn im Justital (Thuner-See), wo Nummulitenkalk die obersten Kämme bildet. Auch der Gipfel des sommerlichen Touristenzieles, das berühmte Faulhorn, ist rauer sandiger Schiefer der Flyschzeit und das „verfaulende“ Gestein verlieh dem Berge seinen Namen. Noch weiter hinauf bis zu 10 und 11 Tausend Fuß, wurde Flysch- und Nummuliten-Sand nur auf die äußersten Kuppen der Glariden und des Tödi gehoben; dort bedeckt es wie aufgestülpte Hauskäppchen die Silberscheitel dieser Berggreise, deren gewaltige Körpermasse aus, kristallischen Felsarten (Gneis) besteht.
Aber es bedarf durchaus nicht der Wanderung auf solche Höhen, um das Gestein kennen zu lernen; auch das Tal birgt es. Jene schwarzen immer feuchten Felsenwände der Tamina-Schlucht, in welcher der heiße Sprudel der Pfäferser Heilquelle liegt, das zerbröckelnde Gestein um Bad Fidris im Prätigau, die nächste Umgebung des Stachelberger Bades im Glarner Tale sind Flysch-Gesteine. Hier stehen wir an der Grenze einer der großen Schöpfungsepochen unseres Erdkörpers; denn mit den Eozän- Gebilden schließt sich die große Hauptgruppe der jüngsten Ablagerungen, welche der Geologe die „Tertiär-Formationen“ nennt. Alles, was unter ihnen liegt, alle Berge, die alpenwärts vor unserm Blick sich erheben, sind älter, gehören früheren Zeiten an. Die Wissenschaft rubriziert sie als Gebilde der „Sekundär-Formation.“ Das ganze Terrain, in welchem diese Gesteine sich zeigen, muss damals, als die Molasse-Gebilde abgelagert wurden, schon als Festland existiert und über das s. g. „Urmeer“ herausgeragt haben. Es war viel größer, dieser Kontinent, als es sich heute zeigt; die darunter liegende große Gruppe der Kreide- Gebilde hat bei der Hebung der Alpen die Flysch-Decke an vielen Stellen durchbrochen und zur Seite geworfen. Am Auffallendsten sieht man es in den Vorarlberger Alpen, ganz besonders in der Säntis- und Churfirsten-Kette, dann in den Schwyzer Alpen, wo namentlich die Mythenstöcke bei Schwyz wie durchs Fleisch hervorgestoßene Zähne dastehen, in den Nidwaldner Alpen, am zerzackten Pilatus, an der Schafmatt, am Scheibengütsch, am Brienzer Rothorn und an anderen Bergen des Berner Oberlandes. — Unter der Bezeichnung „Kreide-Formation“ denke man sich indessen keineswegs Felsen von weißer Schreibe-Kreide; die Geologen haben auch hier wieder alle Gesteinsarten, welche die gleichen Versteinerungen und organischen Überreste wie die weiße Schreibe-Kreide einschließen, also der gleichen großen Niederschlagsepoche angehören, als eine Formation zusammengefasst und nach der Kreide benannt. Sie ist eins der am weitesten auf der Erdoberfläche verbreiteten Gebilde und nimmt z. B. in Nordamerika eine Fläche von 120 Meilen Breite und 300 Meilen Länge ein.
Die Fluhen und Kämme dieses Gesteines sind schroffer emporgerichtet, kühner, markierter in den Linien als die des Flysch, — malerisch-zackige Felsen-Fassaden oft in überraschend schöner Detailzeichnung. Alle jene großartigen Uferdekorationen am wilden Wallensee, am Vierwaldstätter- und Brienzer-See mit ihren Pfeilerarkaden und Winkelvorsprüngen, ihren Nischen und Ecksäulen, deren Gruppierung und Gegenwirkung eine landschaftlich so bezaubernd schöne ist, gehören der Kreide-Formation an. Da zeigen sich schon ausgeprägte Alpenformen in grotesken Massen, gleichsam vorgeschobene Posten der imposanten Gipfel-Armee, welche im Rücken derselben ihr Lager aufgeschlagen hat. Selten erreichen die Kreidefelsen die Höhe der Schneegrenze, also 7000 bis 8000 Fuß. Aber auch in dieser Formation unterscheidet die Wissenschaft in den Alpen wieder vier Gesteinsarten. Die unterste derselben ist der Spatangenkalk oder Neocomien, so genannt von Neocomum oder Neuchâtel, in welcher Gegend er hauptsächlich entwickelt ist; — auf ihm lagert der Rudisten- oder Caprotinenkalk, von dem in der Schilderung der „Karrenfelder“ Weiteres zu finden ist; — über diesem wieder der Gault, ein an Versteinerungen sehr reicher Sandstein, — und obenauf endlich als jüngstes Gebilde der Seewerkalk.
In einer großen Strecke der Berner Alpen, namentlich zwischen Rhône und Aar, ist die Kreideformation gänzlich verschwunden und ein noch älteres Gestein, der an Petrefakten sehr reiche Jurakalk, ersetzt deren Stelle. Hier treten wir ins Hochgebirge ein; wir stehen auf der untersten Stufe der treppenförmig ansteigenden großen Alpentäler. Durch jede Lücke der erhabenen Strebemassen leuchten Firnfelder und überschneite Hochkulme hernieder, — von ihnen brausen jäh über die Felsenwände die zu Schaumflocken zerstäubenden Wasserfälle herab, die bald in geschlossenen, vollen, breiten Garben zu Tal stürzen wie die Fälle des Reichenbaches und Giesbaches, oder in funkelnden Wasserstaub aufgelöst, wehenden Schleiern gleich herniederwallen wie der Oltschibach, Staubbach und alle die anderen des Lauterbrunner-Tales. Das Volksleben entfaltet sich nicht mehr in reichen Dörfergruppen weit zerstreut über Halde und Höhe, — hinunter ins Talbett, an die Ufer der Ströme, da wo Weg und Steg Kommunikation bieten und die Wohnung geschützt ist gegen klimatische Unbilden, hat es sich geflüchtet, und nur im Sommer wandern die Bewohner mit ihrem Vieh nomadisch auf die Hochweiden der Alpen. Die Gebirge-aufrichtenden, Alpen-gestaltenden Kräfte haben hier gewaltig und energisch gewirkt; man sieht es, dass man den zentralen Erhebungskratern sich nähert. Wie ein Ringgebirge mit schroffem, innerem Absturz den zentralen vulkanischen Herd umgibt, so kehrt die erste, zuweilen auch eine zweite, dritte Kalkkette dem Granitgebirge steile, oft hoch in die Schneeregion aufsteigende Felsenwände zu. Stets fallen die Schichten der Kalkalpen nach außen zu, ein Beweis, wie diese Decke gewaltsam bei der Bildung der Alpen von den aus der Erdtiefe aufgestiegenen Granitmassen zersprengt und in schiefe Richtung gebracht wurde.
Als diese Gebirge noch nicht in ihren heutigen wilden, kühnen Formen dastanden, als die Kalkfelsen nur flache, zerstreut aus dem vorweltlichen Meer hervorragende Eilande bildeten, da muss eine Riesenvegetation auf denselben gewuchert haben, und gräuliche Ungeheuer belebten die Tiefen.
Im Grund begraben wird hier, — dort gefunden
Vergangner Pflanzen steingewordne Spur;
Gebein von Tierart, die vorlängst entschwunden,
Die abgelegten Kleider der Natur.
Und wollt ihr dann in staunenden Gedanken
Die Gliedermassen euch zusammenfügen,
Sind‘s Riesen, überragend alle Schranken,
Ihr schaut Urwelt in großen Schreckenszügen. (Lenau.)
Es ist die einstige Heimat der Ichthyosaurier und Plesiosauriern, jener 50 Fuß langen, zwitterhaften, Ungetüme, halb Krokodil, halb Fisch; es ist die Fundstätte der riesigen Petrefakten, die wir als Ammonshörner und Nautilus kennen. — Viele Gipfel der Kalklagen gehen weit über die Schneelinie hinaus; das Oldenhorn erreicht 9617 Fuß, das Weißhorn 9272 Fuß, der Urirotstock 9027, die Altels 11,187, die Windgelle 9818 und das Scherhorn 10,147 Fuß.
In den östlichen Alpen, wo in der äußeren Konfiguration des Gebirges mehr die Plateaubildung vorherrscht, vertreten die noch älteren Trias-Dolomite und Keuper, so wie die Lias-Gesteine die Stelle der Jura-Kalke.
Wir sind an der Grenzlinie der neptunischen Niederschläge angelangt; wir treten in das Gebiet der, wahrscheinlich zu den ältesten Rindengesteinen der Erde gehörenden Schichten, in die Schiefer-Alpen, welche die, aus dem Erd-Innern aufgestiegenen, granitischen Kernmassen umkleiden oder teilweise ganz in dieselben übergehen. Da überrascht den vom Norden kommenden Alpenwanderer eine auffallende Erscheinung. Bisher nahm er wahr, dass alle Felsenschichten, deren Lagerungsprofile er in den Talwänden oft sehr deutlich erkennen konnte, meist schräg gegen das Flachland hin, abfallen, — unverkennbar so: als ob sie durch die Alpen emporgehoben und in diese schiefe Lage gebracht worden seien. Jetzt mit einem Mal zeigt sich die entgegengesetzte Erscheinung. Unter den ungeheuren Kalk-Kolossen, deren schräg gen Norden oder Nordwest einsinkende Schichten sich bis in die Wolken erheben, wachsen plötzlich Strebepfeiler empor, welche im rechten Winkel jene zu stützen scheinen. Das sehen wir, wenn wir vom Genfersee durchs Rhône-Tal ins Wallis einwandern, an dem zackigen Kalk-Dome der Dent du Midi bei Evionaz, — oder wenn wir vom freundlichen Brienz durchs Haslital nach dem Grimsel-Hospiz aufsteigen, dort, hinter dem Quer-Riegel des „Kirchet“, in der malerischen Tal-Mulde „Im Grund“, wo das Urbach- und Mühle-Tal münden, — oder noch auffallender auf der Gotthards-Straße, hinter Altorf bei der „Klus“, und weiter nach Amsteg zu, wo deutlich die nach Norden abfallenden Kalkschichten auf dem steil gen Süden einsinkenden Gneismassen lagern. Hier also begegnen wir den ersten sichtbaren Spuren jener furchtbaren Hebel, welche das ganze große, herrliche Alpengebäude mittel- oder unmittelbar aufrichteten. Die Schieferdecke ist auf ungeheure Strecken hin zersprengt, zerrissen, verworfen, mit emporgehoben, umgebogen oder durch die Feuereinwirkungen in ihren Grundstoffen verwandelt. Nur in Savoyen in einem Teil des Arve-Tales, in Piemont in den Talgebieten der oberen Isère und der Dora-Baltea, im südlichen Wallis und in vielen Teilen der Graubündner Alpen, besonders auch im Unter-Engadin, haben die als graue, grüne und Belemniten-Schiefer bekannten Gesteinskörper noch Zusammenhang behalten und bilden riesige Gebirgsketten. Wo aber die kristallinischen Zentralmassen als: Alpengranit, Protogin, Gneis und Glimmerschiefer durchgebrochen sind und alles vorhanden Gewesene zur Seite geworfen haben, da streben sie in senkrechter Stellung wie Glieder kolossaler Fächer empor.
Es sind die weithin sichtbaren Oberhäupter des stillen, erhabenen Alpenreiches, die in ernster Majestät ganz Zentral-Europa beherrschend überschauen, — von deren Giganten-Schultern der firnstrahlende Regenten-Mantel mit den Gletscher-Schleppen herabwallt; — es sind die riesigen Gipfel des wie aus der Ewigkeit stammenden Montblanc (14,800 Fuß), des mit neunzinkiger Krone geschmückten Monte Rosa (14,284 F.), der noch unerstiegenen großartigsten Gebirgspyramide des Matterhornes (13,900 F.), der wilden Mischabelhörner (14,032 F.), des in unvergleichlicher Pracht aufragenden Weißhornes (13,900 F.), der kühn dräuenden Felsen- Lanzen eines Finsteraarhornes (13,160 F.), und der jähen Schreckhörner (12,568 F.), des einsamen Adula- oder Vogelberges (10,454 F.), des gletscherumpanzerten Piz Bernina (12,475 F.), der Silvretta (10,516 F.), der Ortles-Spitz (12,030 F.) und des Groß-Glockners in Tirol (12,185 F.).
O, du bist schön, erhabner Riesendom,
Wenn dich der Himmel freudig überblaut,
Der Sonnenaufgang einen Strahlenstrom
Auf deine starren Augenlider taut. K. Beck.
„Alle von der Phantasie erschaffene Größe muss im Vergleich mit den Alpen klein erscheinen“ sagt Bonstetten. Und in der Tat, es kann auf dem europäischen Kontinent wohl kaum einen gewaltigeren, erschütternderen Anblick geben als den, von geeignetem Standpunkte in der Berner Alpenkette aus (z. B. von der Höhe der Gemmi, oder vom Torrentorn ob Leuk, oder beim Wildhorn am Rawyl-Pass), auf die südlich gegenüberliegenden Walliser- Alpen. Es ist ein Panorama von unbeschreiblicher Erhabenheit, von fast grauenhafter Pracht. Die großen gespaltenen Seitentäler des Wallis erscheinen so schreckhaft ernst und dräuend, sie tauchen in ihrer, durch die schwarzgrünen Nadelwälder gestimmten finsteren Färbung so urtümlich und sagenhaft-düster im Mittelgrunde auf und kontrastieren so schaurig gegen die sie überragenden, blendend weißen Firn-Fassaden, dass mancher entschlossene Berggänger nach diesem Eindruck sich besinnen würde dieselben zu betreten. Und doch ist gerade in ihren Tiefen das großartigste Naturschauspiel verborgen. Der Hintergrund des Zermatter- oder Nicolaitales und des Einfischtals werden von keinem anderen Alptal an Majestät übertroffen, selbst nicht von dem berühmten Chamonix.
Die granitischen Zentralmassen sind aber durch spätere Erschütterungen und Katastrophen wieder so entsetzlich zerspalten und umgestaltet, in neue Gruppen getrennt und in ihrer ganzen Konfiguration verändert worden, dass nur der ordnende Scharfblick des Geologen deren einstigen wahrscheinlichen Zusammenhang wiederherzustellen vermag. Unberechenbare chemische Umwandelungen einzelner Partien, namentlich in den Schiefergebirgen, haben stattgefunden. Hitze-Einwirkung, Dämpfe, Gas- und Säure-Durchdringung, Zertrümmerung und durch Mischung entstandene Neubildung haben meilengroße Alpen-Parzellen in neue Gesteine verwandelt, wohin namentlich die Verrucano-Gebilde gehören. Mächtige Gipsadern durchziehen, als spätere chemische Verbindungen, die kristallinischen Massen, — und hornblendartige Gesteine steigen als Eruptiv-Garben, wie Schlote aus der Unterwelt, im innersten Kern der zentralen Stöcke auf, in den höchsten Spitzen derselben zu Tage tretend. Dieses chemisch-zersetzende, allmählig auflösende, neue Prozesse vorbereitende Laboratorium im Erd-Innern, als deren Sicherheits-Ventile Alexander v. Humboldt die Vulkane bezeichnet, arbeitet auch unter dem Alpen-Massiv noch immer fort. Beweise dafür liefern die zahlreichen kohlensauren Gasquellen, die vielen Sauerbrunnen, die, giftige und stickstoffhaltige Dünste ausatmenden, gefährlichen Mofetten im Engadin und manche anderen Erscheinungen.
Nicht durch den ganzen von Südwest gen Nordost laufenden Alpenwall zeigt sich an der nördlichen Abdachung die gleiche, vom jüngeren zum älteren Gebilde regelmäßig fortschreitende Gesteinsfolge, wie wir sie auf den letzten Seiten skizzierten; gar häufig erscheint dieselbe unterbrochen oder gar auf den Kopf gestellt. Dies ist namentlich der Fall in dem großen, wie es scheint nach Innen eingestürzten, jetzt von den Schienen der Eisenbahn durchschnittenen Alpenkessel zwischen dem Glärnisch, den Churfirsten und dem Kalanda; dort zeigen sich die älteren Schichten den jüngeren aufgelagert, so dass hier eine der größten Umwälzungen stattgefunden haben mag. Ringsum an den genannten Bergen bestätigen die abgebrochenen Schichtenköpfe die Annahme eines umfangreichen Einsturzes der Gebirge; die Verrucano-Massen treten hier als schöne rote Melser Konglomerate und Sernf-Schiefer dicht an die Eisenbahn heran.
Ganz anders gestaltet sich das Alpenbild von einem südlichen Standpunkte aus. Der Absturz der Massen ist viel schroffer, unvermittelter, als vom Norden gesehen. Die Bergfronten zeigen sich einerseits durch ihre gen Mittag gekehrte Lage und durch die kräftigere Insolation viel weiter hinauf schneefrei, bloß das kahle, nackte Felsen-Skelett darbietend, — anderseits fehlen vielfach die bunt belebten Mittelgründe, die abgestuften, farbenheiteren Vorberge. Oben ists eintöniger in Linie und Kolorit. Der geologische Schichtenwechsel und die durch diese indirekt herbeigeführte Mannigfaltigkeit und landschaftliche Beweglichkeit mangelt. Den Nordabhang umfängt längs der ganzen Kalkalpen, vom Jura bis nach Ungarn hinein, ein Gürtel lachender, blauer Binnenseen; am Südhang drängen sich deren nur wenige im Gebiet der See-Alpen zusammen. Die Grajischen, Cottischen und Meeralpen im Westen und die Tiroler, Carnischen und Norischen Alpen im Osten, entbehren, mit Ausnahme einiger sehr kleiner Wasserbecken, gänzlich dieses belebenden Schmuckes. Der Grund dieser auffallenden Verschiedenheit liegt auch hier wieder in der Gesteinsart des Bodens. An die kristallinischen und Schiefer-Gebilde der Westlichen Alpen grenzt unmittelbar die jüngste Alluvial-Anschwemmung Sardiniens und der Lombardei. Erst in Venetien treten wieder Kalk-Berge als Mittelglieder zwischen den beiden genannten Formationen auf.
Die Erhebung, des Alpengebäudes und des mittelbar durch dieses zugleich mitgehobenen Jura war ferner zugleich eine Notwendigkeit für die Kulturentwickelung Zentral-Europas. Ohne diese Gebirgsmassen würden die meteorologischen und alle davon abhängigen Zustände unseres Erdteiles wesentlich andere sein. Ohne Alpen wären zunächst Deutschland und die Niederlande den austrocknenden, zerstörenden Einflüssen heißer, aus den afrikanischen Wüsten herüberwehender Winde bloßgelegt. Der Föhn, eine Fortsetzung des südlichen Scirocco, der in den Hochalpentälern mit furchtbarer Raserei tobt, würde unaufgehalten, ungebrochen und ungeschwächt in seiner hohen Temperatur über Deutschland einherbrausen und die Agrikultur ganz anderen als den jetzt herrschenden Bedingungen unterstellen. Umgekehrt dagegen würde die, nur unter den Einflüssen milder Lüfte gedeihende südliche Vegetation der reichgesegneten Po-Ebene durch eindringende, jetzt von den Alpen aufgehaltene, winterliche Nordstürme zur Unmöglichkeit werden. Es würde somit der klimatische Wechsel bezüglich der herrschenden Temperaturverhältnisse schon ein bedeutend anderer sein.
Hiermit gestaltete sich aber auch die Tätigkeit der Wolkenbildungen und dadurch zugleich die Summe der atmosphärischen Niederschläge anders. Das Alpengebiet, in welchem relativ die jährlich größte Regen- und Schneemenge in Europa niederfällt, ist der unversiegbare Wasserlieferant für die Rhein-, Donau-, Rhône- und Po-Länder; ohne die reichhaltigen Schneemagazine im Hochgebirge würden diese Ströme mit ihren tausendfach verzweigten Quellensystemen zu unbedeutenden Wasseradern herabsinken. Alle jene natürlichen Verkehrsstraßen, welche die Flüsse Jahrtausende lang bildeten, ehe der Schienenweg sie überflügelte, würden nicht zu ihrer historischen Bedeutung für Handel und Gewerbe gelangt sein.
Das Alpengebäude schließt einen unerschöpflichen Reichtum von Naturwundern ein. Kein anderes Gebirge Europas umfasst so wie die Alpen die Flora dreier Zonen: die nordisch-arktische und gemäßigte reichen der tropischen die Hand und wir finden Repräsentanten der Vegetation von mehr als dreißig geographischen Breitegraden auf kleinem Raume. In keinem anderen Gebirge unseres Erdteils tritt das Walten der atmosphärischen Tätigkeit in so furchtbarer Größe und unter so gewaltigen Kraftäußerungen auf; und in keinem zeigt sich die Summe der Gegensätze im Leben seiner Bewohner so auffallend als im Alpenlande. Einzelne Bilder von allen diesen Berührungspunkten zu geben, sei Aufgabe nachstehender Blätter.
Granit.
Was uranfänglich ist, das ist auch unanfänglich
Und Unanfängliches notwendig unvergänglich.
Was irgendwo und wann hat selber angefangen.
Kann nicht der Anfang sein und muss ein End' erlangen.
Der Anfang nur allein kann nie zu Ende geh‘n,
Weil er aus Nichts entstand, Nichts ohn' ihn kann entsteh‘n.
Rückert.
Granit ist eine symbolische Größe, — in Gemeinschaft mit dem Marmor der historische Stein. Wie im Tierreich der Löwe, ein Repräsentant edler Eigenschaften, physischer Kraft, als König in herrschender Macht dasteht, — in der Pflanzenwelt die Eiche ein Bild der Festigkeit und Ausdauer, des stolzen Trotzes gegen Sturm und Wetter abgibt, — so gilt der Granit als das Unüberwindliche, Unveränderliche im Reiche der toten, anorganischen Gesteine, — nach beschränktem materiellen Begriff: als ein Körper der beinahe ewigen Existenz. Jahrtausende scheinen spurlos an ihm vorüberzurauschen und die zerstörenden Gewalten der Zeit ohnmächtig an seinen Massen abzugleiten. Wo Werke für die fernsten Menschengeschlechter, sichtbare Denksäulen für die Annalen der Geschichte errichtet werden sollten, — wo ägyptische Dynasten ihre kolossalen Königsgräber in jenen Pyramiden auftürmten, die, an dem Felsenufer der Wüste hinlaufend, noch heute als die riesigsten Arbeiten menschlicher Kraft angestaunt werden, — da griff der kühne Bauherr zum granitischen Gestein und glaubte der zeitlichen Hinfälligkeit alles von Menschenhand Geschaffenen ein Schnippchen geschlagen zu haben. Ja, die früheren Forscher in den Naturwissenschaften konstruierten vom Granit aus das Fundament unseres Erdballes, sahen in ihm den Urgroßpapa, den Ahnherrn des gesamten Mineralreiches und nannten ihn naiverweise „Urgestein“. Und doch ist auch er nur ein Interpunktionszeichen in den Weltschöpfungsperioden, ein unbedeutender Sekundenstrich auf dem Zifferblatt der Ewigkeit, etwas „Gewordenes“, das einst wieder ebenso in das All aufgelöst wird, wie es aus demselben hervorging.
Granit ist im Touristenverkehr, im Munde begeisterter Alpenschwärmer ein großes, viel umfassendes Wort, ein unbewusst gebrauchtes Nomen collectivum, unter dem der Laie alles zusammenfasst, was ihm so scheint, als müsse es das berühmte Gestein der Ehrensäulen und Triumphbogen sein. Es gibt viel intelligente Leute, die, wenn sie in den Alpen schwarz und weiß gesprenkelte Felsen sehen, diese rundweg für Granit halten; und doch kommt in den Alpen verhältnismäßig wenig eigentlicher massiger Granit vor, — wohl aber sehr viel granitisches Gestein. Werden wir also zunächst klar darüber, was eigentlich Granit (von granum, das Korn) sei, und lernen wir deshalb die Natur und die Bestandteile desselben ein wenig genauer kennen.
Granit und Gneis ist im Grunde genommen ein und dasselbe Kompositum, ein aus den 3 Mineralspezies: Feldspat, Quarz und Glimmer zusammengesetztes Gestein. Ist dasselbe körnig, massig gemengt, so wird es „Granit“ genannt; ists dagegen schieferig, gestreift, lässt sich eine gewisse Schichtung darin erkennen, so heißt es „Gneis“.
Der Granit ist kein Konglomerat, kein durch mechanische Bindemittel zusammengeleimtes Produkt ursprünglich verschiedenartiger Mineralsubstanzen; er ist ein selbsteigenes Gebilde, welches die einst, im flüssigen Zustande gemischten, verschiedenartigen mineralischen Spezies durch Kristallisation nebeneinander ausschied. Ein zwar nicht ganz treffendes, aber doch annähernd erläuterndes Beispiel von dem wahrscheinlichen Kristallisationsprozess des Granits lässt sich aus der Chemie geben. Jedermann kann dies kleine Experiment probieren. Kochsalz und Salpeter gemeinschaftlich in Wasser, bis zur Sättigung, aufgelöst, so dass beide Salze völlig vermischt erscheinen, kristallisieren, wenn die Flüssigkeit allmählich verdunstet, sich ausscheidend wieder selbstständig: das Kochsalz in rechtwinkeligen Würfeln, der Salpeter in langen sechsseitigen Säulchen, so dass jedes der beiden Salze wieder die demselben ausschließlichen Eigenschaften zeigt.
Feldspat, meist milchweiß oder gräulich, auch rötlich, stellt die Hauptmasse, beinahe die Hälfte des eigentlichen massiven Granits dar, zwischen welchem weiße, seltener gelblich oder grünlich gefärbte kristallinische, glasartig durchsichtige Quarzkörnchen die Grundmasse bilden und dünne, glänzende Glimmerplättchen eingelagert sind. Diese normale Zusammensetzung weicht aber an den verschiedenen Fundorten sehr voneinander ab. Wer eine Badekur zu St. Moriz im Ober-Engadin macht, kann bei jedem Spaziergange gleich einige Varietäten am Wege sammeln; denn der Bernina-Granit ist grün, serpentinhaltig, während der vom gegenüberliegenden Piz Languard roten Feldspat mit milchweißem Quarz enthält. Noch auffallender ist der Farbenunterschied des Granits am Lago Maggiore; der von Baveno, gegenüber den Borromäischen Inseln, ist schön pfirsichblütenrot, während der berühmte s. g. Miarolo bianco aus den Brüchen des ganz nahe dabei liegenden Monte Orfano weiß ist und wie ein gänzlich anderes Gestein aussieht. Der Letztgenannte gab das Baumaterial zu vielen der schönsten Kirchen Nord-Italiens ab; namentlich sind auch die herrlichen Säulen am Eingange des Mailänder Domes aus diesem Gestein gearbeitet. Fehlt der charakteristische glitzernde Glimmer in der Masse und ist derselbe durch schwarze oder schwärzlich-grüne Hornblende vertreten, dann heißt das Gestein nicht mehr Granit, sondern „Syenit“. Es ist über alle Teile der Erde weit verbreitet, erhielt seinen Namen von der Stadt Syene in Ober-Ägypten (wo es in Menge vorkommt) und wird seiner Festigkeit halber als vortreffliches, politurfähiges Baumaterial sehr geschätzt. Die Pyramiden und Obelisken bestehen meist aus Syenit. In unseren Alpen kommt er vorherrschend auf der Südseite vor, z. B. im Val Pellina (in welches der Col de Collon aus dem Walliser Val d'Hérins führt), bei Migiandone an der Simplon-Straße, in der Umgebung von St. Moriz und Campfér im Ober-Engadin.
Aber der normale Granit kommt auch mit Zusätzen vor, die seinen Charakter ganz ändern; dahin gehört der vom Montblanc. Bei ihm ist der Quarz glasig-grau, der Feldspat weiß, der Glimmer dunkelgrün ohne Glanz in Prismen kristallisiert und beigemischte perlmutter-ähnlich glänzende, lebhaft grüne Talk-Blättchen geben ihm eine charakteristische Färbung. De Saussure, einer der geistvollen Begründer der Alpen-Geologie, glaubte — als er den Montblanc zuerst umwanderte und bestieg, vor dem ältesten Gebirge der Erde zu stehen und nannte deshalb das Gestein „Protogin“, d. h. Erstgeborener. Seit jener Zeit ist, obgleich uneigentlich, der Name für den Talkgranit beibehalten worden.
Das meiste, was in den Zentral-Alpen für Granit gehalten wird, ist granitischer Gneis, im Volksmunde „Gaisberger“ genannt, weil die höchsten Berge, auf welche die Gaisen (Ziegen) steigen, aus diesem Gestein bestehen. Er ists, an dem die Atmosphärilien jene phantastisch aufragenden Felsentürme aussägen und bildnerisch Ornamente improvisieren, welche, im Chamonix-Tal in scharfe Spitzen auslaufend, sehr bezeichnend „Aiguilles“ genannt werden; — aus seinem s. g. „Urmaterial“ formen sich die wundersamen Steinstacheln, welche die Aufgipfelung großer Bergindividuen garnieren, oder wie ausgestellte Wachtposten hie und da aus den umfangreichen Firnwüsten hervorragen. Wir würden solcher schlanker Felsennadeln noch weit mehr erblicken, wenn nicht eine große Zahl derselben im perennierenden Schnee versteckt wäre. Hier verrät sich uns die verwundbare Achillesferse der für unzerstörbar gehaltenen „Urgesteine“. Der Gneis ist, wie schon bemerkt, schiefriger, tafelförmiger Struktur. Bei der Alpenerhebung wurden auch die Gneisstraten gehoben und als nächste Umhüllung der zentralen Granitmassen oft senkrecht auf die Bruchkante gestellt. Die Masse muss nun an verschiedenen Stellen von verschiedener Härte gewesen sein, — genug, während einzelne Teile wie unangetastet den verwitternden Einwirkungen widerstanden, wurden andere von den Atmosphärilien dermaßen zersetzt, ausgenagt und zerstört, dass sie gänzlich verschwanden und nur jene isolierten Zacken zurückblieben. Beispiele im Großen liefern die Aiguille verte, die schlanke Aig. de Dru, die Aig. du Moine, die ungemein zersplitterten Aiguilles de Charmoz, die Aig. Rouges — alle zu beiden Seiten des Chamonixtals, die Schreckhörner und Grindelwalder Viescherhörner in den Berner Alpen, — die ganze südliche Talwand des Graubündnerischen Bergell u. a. m.
Aber noch eine andere Art der Verwitterung granitischen Gesteines zieht in den Alpen unsere Aufmerksamkeit auf sich und zwar in höchst sonderbarer Weise und an Orten, wo man sich die Erscheinung nicht gleich erklären kann. Diese zeigt sich in den s. g. „Teufelsmühlen“ oder „Felsenmeeren“ auf den äußersten Gipfeln vieler isolierter Berge. Ein Beispiel möge erläuternd für viele gelten. Zu den besuchtesten Aussichtspunkten des Berner Oberlandes gehört das Sidelhorn nächst dem Grimselpaß. Vom Hospiz aus besteigt man es bequem in 2 bis 2½ Stunden. Je mehr man sich dem Kulm nähert, desto mehr häufen sich große, unordentlich übereinander geworfene Felsentrümmer, bis endlich die äußerste Höhe ganz mit solch einem Chaos von lose geschichteten granitischen Gneisblöcken übersäet ist. Bisweilen scheinen sie eine gewissermaßen gegliederte Lagerung einzunehmen, etwa so wie ineinander gestellte Teller; dann wieder an anderen Stellen zeigt sich ein ziemlich geordneter treppenähnlicher Aufbau; meist aber liegen sie ohne erkennbare Anordnung durcheinander. Diese auf Gipfeln jedenfalls auffallende Erscheinung ist gleicherweise ein Resultat der Granit-Verwitterung, aber solcher Massen, in denen mehr oder minder die Schalen-Struktur einst vorwaltete. Die Gebrüder Schlagintweit bilden im Atlas zu ihren „Neuen Untersuchungen über die physikalische Geographie und Geologie der Alpen“ solche ausgewaschene Gneisschalen ab. — Wenn der phantasiereiche Jean Paul sich des schönen Bildes bedient: „Die Gräber seien die Bergspitzen einer fernen neuen Welt,“ so sind hier in Wirklichkeit die Bergspitzen die Gräber einer fernen vergangenen. (G. Studer.)
Die großartigsten und imposantesten Kolosse granitischer Gesteine finden wir nur in den Zentralmassen der Alpen. Dort übergipfeln sie oft in so furchtbarer Erhabenheit, als senkrecht aufsteigende Felsenpaläste, die tiefen Talkessel, dass man vor ihrer Größe zurückschreckt. Wer noch nie die düsterprächtige Pyramide des Finsteraarhorns vom „Abschwung am Aargletscher“ aus erblickte, wie sie in kaltem Ernst nackt aus den Firnlagern in die Wolken steigt, — wer den Montblanc noch nicht auf der Süd-Ostseite umwanderte und die volle, prächtige Kernform seines Massivs vom Gramont aus, — oder vom Zinalgletscher (in der Tiefe des Einfischtales) die riesigen Felsenstirnen des Grand Cornier, der Dent blanche und des Weißhornes rund um sich her mit einem Blick übersah, der wird schwerlich einen richtigen idealen Maßstab für die wahrhaft kolossalen Verhältnisse sich konstruieren können. Und dennoch werden alle diese granitischen Giganten dem Eindrucke nach, welchen sie auf das starr-staunende Auge machen, weit übertroffen von jenem jähen Absturz, welchen der Monte Rosa im Talschluss von Macugnaga zeigt. Es ist die erste vertikale Größe des Europäischen Kontinentes. Die Matadoren der Kalkzone wie die Diablerets, das Dolden- und Gspaltenhorn, Blümlisalp u. a. zeigen gewaltige Felsenfronten; aber sie schwinden jenen Granitkörpern gegenüber zu Massen zweiten Ranges zusammen.
Wir nannten den Granit den historischen Stein der Erde; für die Alpen ist er es in mehr als einer Beziehung. Seine ernsten Felsenwände wurden oft Denksäulen großer Taten, welche den erhabensten Momenten des klassischen Altertums gleichzustellen sind. Jener unerschrockene Russe Suworoff, ein moderner Epaminondas, welcher sich eher zwischen den Klüften begraben lassen wollte, als von der Stelle weichen, ließ, als seine Gardekolonnen am 25. Sept. 1799 die Franzosen unter Gaudin im engen Val Tremola zurückgeschlagen hatten, mit lakonischer Kürze in die Granitwand die Worte „Suwarow Victor“ zu ewigem Gedächtnis eingraben; am nächsten Tage waren die Gneisschroffen dort, wo die Teufelsbrücke in kühnem Bogen die Sturzwellen der Reuß überbaut, Zeugen ebenso kühner Heldentaten. Über die granitischen Einöden des großen Sankt Bernhard führte Bonaparte, im Mai 1800, seine Armee zum Sieg von Marengo, und als die, auf sein Geheiß, durchbrochene Simplon-Straße, der erste große Alpenweg, fertig war, ließ er, stolz auf sein Werk, in eine Lichtöffnung der Galerie von Gondo einmeißeln: „Aere Italo MDCCCV. Nap. Imp.“ — Auf Granitboden wurde Andreas Hofer, der Sandwirt von Passeyr, geboren, und zwischen Granitfelsen schlug er seine glorreichen Schlachten zur Befreiung Tirols. Aber auch weiter zurückgehend in ältere Zeiten begegnen wir Großtaten, ebenso körnig und fest wie das Gestein, auf dem sie geschahen. Benedikt Fontana hauchte auf den Gneiskristallen der Malserhaide seine Heldenseele mit den freudigen Worten aus: „Nur wacker dran, o Bundesgenossen! lasst Euch durch mein Fallen nicht irren! Ists doch nur um einen Mann zu tun. Heute mögt Ihr freies Vaterland und freie Bünde retten. Werdet Ihr sieglos, bleibt den Kindern ewiges Joch!“ Das sind Worte wie Granit und Urgestein; es ist, als ob von dem Charakter der Felsart etwas ins Blut des Volkes übergegangen wäre. — Und dann die gewaltige Dezemberschlacht von 1478 im Livinental bei Giornico, wo ein Hirtenhäuflein die zehnfach überlegenen Mailänder unter dem Grafen Borelli aufrieb, dass ihr Blut den Schnee bis Bellinzona rot färbte; dann die Heldengräber der 3000 Eidgenossen bei Arbedo, die in dem Verzweiflungskampfe von 1422 der Übermacht von 24,000 Lombarden erlagen; — der Walliser doppelte Bluttaufe bei Ulrichen und auf der Grimsel um 1419, und viele andere Zeugnisse männlichen Mutes und kühner Tat, — sind es nicht Erinnerungen, die sich ihr Denkmal mit Flammenlettern für Menschengedenken auf die Felsentafeln dieser granitischen Kolosse niederschrieben?
Ist die Zeit auch hingeflogen,
Die Erinn'rung weichet nie;
Als ein lichter Regenbogen
Steht auf trüben Wolken sie.
Uhland.
Aber noch mehr erzählt uns der stumme Stein, von noch weiter zurückliegenden Zeiten, von einer Epoche, in welcher die Alpen schon, wie wir sie heute sehen, aufgerichtet dastanden, in welcher aber das menschliche Geschlecht noch nicht existierte. Diese Gedächtnissteine sind die „Erratischen Blöcke.“
Erratische Blöcke.
Da ist ein Blühen rings, ein Duften, Klingen,
Das um die Wette sprießt und rauscht und keimt,
Als gält' es jetzt, geschäftig einzubringen,
Was starr im Schlaf Jahrtausende versäumt.
Das ist ein Glänzen rings, ein Funkeln, Schimmern
Der Städt' im Tal, der Häuser auf den Höh'n!
Kein Ahnen, dass ihr Fundament auf Trümmern,
Kein leiser Traum des Grabs, auf dem sie stehn! —
Anastasius Grün.
Ja! sie stehen auf Trümmern, viele Städte des Alpenlandes, auf Blockwällen und Felsenfragmenten, die aus den Zentralketten des Gebirges stammen. Freilich liegt diese Trümmer-Basis nicht allenthalben offen zu Tage; der Arbeiter, der das Fundament zu einem Neubau aussticht, oder der Bergmann, der nach einer frischen Brunnenquelle gräbt, findet sie erst in einiger Tiefe der obersten Bodenschicht. Aber nicht bloß versteckt im Erdreich, sondern frei und offen, auf dem Felde und im Walde des Hügellandes, ja sogar droben auf den Vorbergen der Alpen und am Jura, bis zu einer Höhe von 5000 Fuß, findet man Felsenblöcke, die der Natur ihres Gesteines nach, 20 bis sogar 45 Schweizerstunden (über 28 deutsche Meilen) weiter drinnen in den Zentral-Alpen heimatberechtigt sind. Man nannte sie deshalb „Findlinge oder Irrblöcke“. Sie zeigen teils abgerundete Flächen, wie Rollsteine und Flusskies, teils frische scharfkantige Bruchlinien, als ob sie eben erst vom Mutterfelsen abgesprengt wären, — in allen Größen, vom Umfange einer Kegelkugel bis zu solchen kubischen Körpern, dass aus dem Material eines einzigen, bei Zürich im Felde gelegenen s. g. „roten Ackersteines“ anno 1674 in Höngg ein respektables, zweistöckiges, massives Haus gebaut werden konnte, welches folgende Inschrift trägt:
Ein großer roter Ackerstein
In manches Stück zerbrochen klein
Durch Menschenhänd und Pulversg'walt
Macht jezund dieses Hauses G'stalt.
Vor Unglück und Zerbrechlichkeit
Bewahr es Gottes Gütigkeit.
Früher hat es einmal dem Grafen Benzel-Sternau gehört. Der Block aber, aus dessen Gestein das Haus erbaut wurde, stammt aus der Tiefe der Glarner Gebirge, etwa vom Freiberge oder aus dem Sernf-Tale.
Das „Woher?“ hat der Wissenschaft wenig Mühe gemacht; aus der Struktur, Farbe und mineralischen Mischung der Granit-, Gneis-, Glimmer-, Verrucano- und Schiefer-Findlinge, so wie aus der Lage des Fundortes zu den Talsystemen der Alpen, konnte man bald entziffern, zu welcher Zentralmasse sie gehörten. Aber das „Wie?“ des Transportes machte den Naturforschern der letzten fünfzig Jahre viel zu schaffen. Die einen vermuteten, es habe einst, bei den letzten Gebirgshebungen, ein extraordinärgroßartiges, vulkanisches Natur-Bomben-Werfen stattgefunden, bei welchem die Alpen diese Fragmente ausgespien und meilenweit über Berg und Tal geschleudert hätten. Diese kühne Phantasie wurde aber bald zerstört durch die tatsächliche Nachweisung einerseits der Regelmäßigkeit, mit welcher viele dieser Blöcke wie in einer Linie an den Bergeshalden abgelagert wurden, anderseits des Innehaltens bestimmter Verbreitungsbezirke zu den Stammgebieten. Andere ließen den Transport durch enorme Überschwemmungen besorgen, die jene, oft hunderttausende von Zentnern wiegenden Lasten aus den Alpen herniedergewälzt haben sollten; allein auch diese Hypothese wurde rasch durch physikalische Beweise in ihrer Unhaltbarkeit zurückgewiesen. Erst als die Theorie über Natur und Bewegung der Gletscher (welchen ein späterer Abschnitt dieses Buches gewidmet ist), angeregt durch den Walliser Ingenieur Venetz, fortgeführt und ausgebildet durch Agassiz und Forbes, eine Menge der seltsamsten Erscheinungen in den Alpen beleuchtete und erklärte, gelangte man auch zu dem Schluss: dass die erratischen Blöcke durch einstige ungeheuer große Eisgletscher, welche bis in das Schweizerische Mittelland hinausgereicht haben müssen, an ihre dermalige Lagerstätte befördert worden seien. Wie in dem späteren Abschnitt nachgewiesen werden soll, bewegen sich die Gletscher von der Höhe der Gebirge langsam dem Tale zu und transportieren auf ihrem Rücken die von den zur Seite stehenden Felsen abgebröckelten Gesteine bis zu der Stelle, an welcher die Gletscher, in Folge warmer Temperatur, abschmelzen und ihre Felsenlasten abladen. Diese Gesteinswälle, welche sich an dem Ende oder der Stirn eines Gletschers anhäufen, werden Frontmoränen genannt.
Das Vorhandensein solcher hufeisenartig aufgebauter hoher Findlingswälle oder einstiger Frontmoränen im Schweizerischen Mittellande, z. B. bei Bern, Surfee, Bremgarten, Zürich, Rapperswyl u. s. w., gab den ersten Beweismoment für den Gletschertransport der Irrblöcke ab. In Zürich sind der Promenadenhügel, die Anhöhen, auf denen der Großmünster, die Kirche von Neumünster, der Lindenhof u. s. w. stehen, Reste einer solchen ehemaligen großen Frontmoräne. — Ein zweites Beweismittel wurde darin gefunden, dass die Findlingsblöcke, selbst wenn sie aus dem härtesten Gestein bestehen, ebensolche eingeritzte Furchen und Linien zeigen wie das Felsenbett, über welches die Gletscher der Jetztzeit sich hinwegbewegen. Vermöge des Druckes der ungeheuren Eislast ritzt diese nämlich bei ihrem Fortrutschen über den Gesteinsboden mit kleinen, sehr harten, scharfen Quarzkristallen Linien ein, die wie mit dem Glaser-Diamant geschnitten aussehen. Geröll- Blöcke, die von den wilden Alpenströmen heruntergeschwemmt wurden, tragen diese Kennzeichen nicht. Die erratischen Blöcke tragen somit, in Folge dieser von der Natur ihnen selbst aufgedrückten Schriftzüge, gleichsam den Reisepass ihrer zurückgelegten Wandertour bei sich, mit der Visa jeder Talschaft versehen, durch welche sie ihre Wege nahmen. — Das dritte und bedeutendste Argument für die Annahme, dass die Findlinge durch Gletscher transportiert wurden, fand man in den s. g. Rundhöckern (Roches mutonnées). In den meisten Alpentälern, deren himmelanstrebende Wände aus schwer verwitterndem Gestein, aus granitischen Massen, bestehen, erblickt man nämlich bis in gewisse Höhen (oft bis zu tausend Fuß über der jetzigen Talsohle) Abrundungen, regelmäßige Streifungen und geglättete Partien, deren Schliff oft so fein ausgeführt ist, dass er im Sonnenschein spiegelblank glänzt. Beim Niedersteigen vom Totensee auf der Passhöhe der Grimsel nach dem Hospiz, dann weiter drunten bei der s. g. Hählen-Platte, — auf dem Trümmerfeld nächst dem Gotthards-Hospiz, und an hundert anderen Stellen der Schweiz kann man solche „Rundhöcker“ besehen, befühlen und, — wo sie nicht mit der schwefelgelben Flechte Lecidea geographica überzogen sind, deren Politur bewundern. Dieses gleiche Phänomen zeigt sich uns aber auch unmittelbar neben dem Gletscher, neben einem Gorner-, Viescher-, Aletsch-, Findelen- und Zinal-Gletscher; wir können es verfolgen von dem Gestein an, welches unter dem Eis hervorragt, bis weit hinauf an die Talwand, — wir können es verfolgen in horizontaler Linie, stundenweit talauswärts, ohne Unterbrechung, gleichviel ob die Gesteinslagerungen und Gesteinsarten vielmals wechseln. Nach solchen Dokumenten wird die Vermutung zur unbezweifelbaren Tatsache, dass diese Taltiefen, welche jetzt zum Teil mit uralten Waldungen überwachsen sind, einst von riesenhaften Gletschern ausgefüllt wurden. Es zeigt sich aber in der Regelmäßigkeit der Ablagerung erratischer Gesteine endlich noch ein Beweismittel, welches die anderen wesentlich unterstützt und ergänzt. Hierunter ist nicht nur jene, schon erwähnte, egale Ablagerung „der Linie und gleichen Höhe nach“ erfolgte zu verstehen, wie sie sich an den Anhängen niederer gehügelter Berge der Voralpen, des Mittellandes und des Jura-Gebirges zeigt, sondern die regelmäßige Gruppierung der Irrblöcke nach Farbe, Stoff und Qualität ihres Gesteines. Man wird z. B. an den beiden Seiten eines breiten Tales, dessen Tiefe wieder droben im Gebirge sich in mehre Seiten und Nebentäler verästelt, nie bunt durcheinander, herüben und drüben die gleichen grünen, roten, weißen, braunen, grob- und feinkörnigen, faserigen oder blätterigen Granit-, Diorit-, Gneis-, Schiefer- oder Kalk-Brocken finden, sondern sie werden verschieden sein. Verdeutlichen wir uns diesen Umstand ein wenig näher. Denken wir uns den Gletscher als einen Hauptstrom, der aus dem Zusammenfluss mehrerer Gebirgsflüsse entsteht, so wie jeder dieser Gebirgsflüsse wieder aus der Einmündung von Nebenflüssen sein Wasserquantum erhält, — denken wir uns ferner, dass nun jeder dieser Nebenflüsse von seinen ihn eingrenzenden Felsen-Ufern Gesteinsfragmente aus dem Gebirge mit herunterbringt, so würden diese, weil das Wasser in seinem Laufe sich vermischt, wahrscheinlich die mitgebrachten Steine auch untereinander mengen. Die Gletscher aber, als feste Eiskörper (wenn wir das Bild eines Strom-Systems festhalten) vermischen sich nicht, wenn sie im breiten Gletscher-Haupttale zusammenkommen, wie das bewegliche, flüssige Wasser, sondern setzen ihren Weg nebeneinander, wenn auch scheinbar als vereinigte große Eismasse fort, und die auf denselben liegenden, langen Trümmergesteins-Linien (die Moränen) zeigen weithin an, aus wie viel Seiten- und Nebengletschern der Hauptgletscher zusammengesetzt ist. Darum bleiben auch die, aus den verschiedenen Tälern stammenden Gesteine geschieden. Und darum wurden von den einstigen Riesengletschern die, durch diese beförderten, erratischen Blöcke je nur auf derjenigen Talseite abgelagert, welche mit den tiefer im Gebirge liegenden Seitentälern korrespondiert. Der bekannte schweizerische Geologe Escher von der Linth hat eine, auf langjährige Untersuchungen gegründete, Karte der Verbreitungsbezirke aller nördlich von den Alpen in der Schweiz gefundenen Irrblöcke herausgegeben. Wir finden solche erratischen Gesteine aber auch an der Südseite der Alpen. Die Lombardischen Binnengewässer des Lago Maggiore, des Comer- und Gardasees sind an ihren Ausflussenden von ganz ähnlichen Blockwällen geschlossen wie der Züricher-Sempacher- und Baldegger-See in der Schweiz. Außerdem zeigt sich das erratische Phänomen auch in dem Gebiet anderer Gebirge; die Pyrenäen, das schottische Hochland, die schwedischen Kjölen, die Vogesen, die Kordilleren Amerikas haben eben so gut ihre Wanderblöcke wie die Alpen.
Diese auf beiden Hemisphären auftretende Erscheinung zusammengefasst, führt demnach zu der Annahme, dass einst eine Periode allgemeiner Erkältung und Vereisung existiert haben muss, die wohl das jüngste Ereignis im Bildungsprozesse unseres Erdkörpers war. Denn wo man auch solche Irrblöcke findet, immer zeigen sie sich als das letzte Ablagerungsmaterial, das erst dann an seinen gegenwärtigen Standort gelangte, als das Alpengebäude mit seinen Tälern und Schluchten, Flussbetten und Seebecken schon, wie wir es heute sehen, bestand.
Karrenfelder .
Wer ergründet der Schöpfung heilige Kraft,
Die in ihren ewigen, weiten Kreisen
Durch Zerstörung wieder Neues schafft.
Maltitz.
Auf jene verlassenen, vegetations-entblößten Gegenden der tropischen Zone, auf die unübersehbaren Sandfelder Afrikas und Asiens, übertrug der Sprachgebrauch ausschließlich die Schilderung Moses‘ vom Aussehen der Erde am ersten Schöpfungstag und nannte diese unheimlichen glutdurchwehten Flächen vorzugsweise „Wüsten“. Auch die Alpen haben ihre Wüsten, ihre Reviere des scheinbar vollendeten Naturtodes, wo die Tributkraft der ewigen Gebärerin erstirbt; aber sie stellen sich in ganz anderer Form, unter anderen Umständen, mit wesentlich anderem Material dar als die Sahara. Gewöhnlich sucht man sie droben über der Schneelinie, in den unversiegbaren Firnmulden und auf den Gletscherhängen, wo die durchdringende Kälte jede organische Entwickelung im Keim zu zerstören droht. Wie aber eine spätere Schilderung unseres Buches zeigen wird, sieht es da droben in den Eismagazinen keineswegs so verstorben aus; im Gegenteil, die Lebenspulse der Erde durchzittern auch diese Einöden in regelmäßigen Schlägen, und ein still geschäftiges Treiben arbeitet, kaum erkennbar, aber stetig, im Dienste des großen wunderbaren Naturhaushaltes, um die diesem Teile gewordene Aufgabe zu erfüllen und zur Erhaltung des Ganzen beizutragen. Hier also werden wir das Analogon nicht zu suchen haben. Und in der Tat, es gibt noch ödere, noch weit abgestorbenere Gegenden im Gebirge als die Schneewüsten, — große, weit ausgedehnte Strecken in unbetretenen Wildnissen, die, von jeder Vegetation entblößt, in ewig starrer Resignation daliegen; dies sind die Schratten- oder Karrenfelder, von den Romanen „Lapiaz“ genannt.
Droben im Gebirge, seitwärts der begangenen Pässe und belebten Alpweiden, im Gebiet der Kalkzone bei einer Höhe von 4000 bis 6000 Fuß, liegen kahle, nackte Steinflächen, oft stundenlang, fast horizontal ausgebreitet, die so zerfurcht und von tief ausgewaschenen Hohlkehlen durchkreuzt sind, dass sie aussehen, als ob ein wogendes Meer mit seinen Wellenhügeln plötzlich hier versteinert wäre und ein unentwirrbares Netz aufgegipfelter Wogen zurückgelassen hätte. Mitunter sind sie so schreckhaft zerklüftet und von klaftertiefen Rinnsalen ausgefressen, dass es unter allen Umständen unmöglich ist, über dieselben hinweg, sei es im Sprung, durch Klettern oder im Balancierschritt, einen Weg ausfindig zu machen. Denn die zwischen diesen Vertiefungen stehen gebliebenen Gesteinsreste laufen wie schmale Dämme, scharf, wie die Schneide eines Messers, nebeneinander her, brechen plötzlich ab und werden von breiten Querkanälen durchschnitten; bald wieder sehen sie aus wie Kämme, deren einzelne Zinken in den verschiedensten Höhen abgebrochen sind, eine wie von riesigen Instrumenten nach allen Richtungen zerhackte, hohlgeschabte, durchsägte, ausgemeißelte Fläche, ein steinernes Splitter- und Zacken-Meer voll der bizarrsten Formen, die nicht selten an die Gletschernadeln erinnern. Dazwischen tiefen sich Löcher ab, trichterförmig, ähnlich den Kratern der Vulkane, oder sie versinken wie schief ins Innere sich verlierende Kanäle; — dann wieder öffnet sich ein mehre Klaftern breiter, ausgehöhlter Kessel, dessen Boden wie der eines Siebes durchlöchert ist. An anderen Stellen scheint in diesem Chaos wieder ein gewisses Formengesetz bei der Erosion gewaltet zu haben, denn die Trümmermassen gewinnen beinahe das Ansehen des Zellenbaues in den Honigtafeln der Bienenstöcke, weshalb der Hirt sie auch bezeichnend „Steinwaben“ nennt. Summa, es ist ein Urbild der schrecklichsten Zerstörung im Kleinen.
Dies alles ist ein Resultat der Verwitterung, des unmerklichen aber erfolgreichen Ausschleifens durch Gletscher-, Schnee- und Regenwasser, der ausdörrenden, spröde machenden Sonnenhitze und der zerspaltenden, auseinander treibenden, absprengenden Kälte, der vollsten ununterbrochenen Einwirkung der Atmosphärilien auf den Gesteinskörper. Und weil gerade an diesem Kalk sich mehr als an jedem anderen die Verwitterung zeigt, und weil selbst die in demselben enthaltenen Muscheln nur fragmentarisch, zertrümmert vorkommen, so haben die Geologen denselben vorzugsweise „Rudistenkalk“, oder nach den organischen Einschlüssen (Caprotina ammonia und gryphoides d'Orb.) auch „Caprotinenkalk“ genannt. Außerdem führt er auch noch die volkstümliche Bezeichnung „Schrattenkalk“, weil Schratten beim Älpler so viel wie „Bergrisse und Spalten“ bezeichnen, — vielleicht durch Versetzung des „r“ aus dem schrift-deutschen Worte „Scharte“ (engl. Shard, Scherbe) entstanden. Weil endlich, an den kahlen, nackten Felsenflächen, besonders im Kanton Unterwalden, die Rudisten auffallend hervortreten und sonderbare, ungewöhnliche Figuren auf dem Fond des Gesteines formieren, so nannte man dasselbe auch „Hieroglyphenkalk“.
Offenbar ist die Auflöslichkeit dieses Kalkes eine sehr verschiedene, wodurch die Zerfurchung entstanden ist. Da nun auf diesen morschen Felsenknochen, die im Sommer unerträgliche Hitze rückstrahlen, auch nicht ein Stäubchen fruchtbarer Erde haftet, — da ferner das im Frühjahr, während der großen Schneeschmelze, in der subalpinen Region entstehende oder nach Regengüssen sich sammelnde Wasser durch die ausgewühlten Rinnen und Löcher sofort spurlos in die Eingeweide der Berge hinabeilt, um am Fuße derselben als Quelle hervorzusprudeln, so ist es erklärlich, dass diesen Flächen jede Bedingung fehlt, um Pflanzen, und wären es die genügsamsten, zu ernähren. Soweit das Auge über die trostlose, bleiche, einsame Felsenfläche schweift, sieht es traurig, erstorben aus. Wo aber keine Blume blüht und ihre Honigkelche öffnet, da summt auch kein Insekt, da gaukelt kein Falter, schwirrt kein Käfer, — wo kein Kräutchen, kein Grashalm sich in die Felsenspalte einzuklammern vermag, selbst nicht einmal Moose ihr mageres Leben fristen können, da rastet auch nicht das kleinste Höhlentierchen, — und wo Weg und Steg so zerstört sind wie in diesen Karrenfeldern, da verirrt sich kein Grattier hin. Sogar die Vögel scheinen diese Stätte der Verwilderung zu fliehen, denn nie sieht man Schneekrähen oder Bergdohlen, Steinhühner oder Flühlerchen, Falken oder Adler auf dieselben sich niederlassen. Somit dürfen die Schrattenfelder sehr füglich die Wüsten der Alpen genannt werden. — Wo dagegen die Karrenfelder an die Weiden angrenzen, wo also angeschwemmte Erde in den Vertiefungen sich abgelagert hat, da entwickelt sich auch die üppigste Vegetation, die man in den Alpen finden kann. Solche Stellen dienen oft den Wurzelgräbern als beste Fundgrube ihres gefährlichen Erwerbes.
Wie überall, wo Düsteres, Unerklärliches, Außerordentliches sich zeigt, der Volksglaube die Einwirkung übernatürlicher Kräfte voraussetzt, so nimmt auch hier die Erklärung ihre Zuflucht zu bösen Geistern und infernalischen Mächten. Zwerge und Erdgnomen, vom Volke „Schrättli“ genannt, sind‘s, die die Steine so ausbohren und durchbrechen; ihnen ist der feste Erdkörper ein „Nichts“, durch welches sie wie die Schärmäuse sich durchwühlen. Eine andere Überlieferung erzählt: die Schrattenfluh im Entlebuch (Luzern) sei ehedem eine der schönsten Alpenweiden im Lande gewesen und habe zwei Brüdern gehört, welche dieselbe gemeinschaftlich verwalteten. Als darauf einer von beiden blind geworden sei, da habe man Teilung des Gutes beschlossen und die Ausführung dem Gesunden übertragen. Dieser aber habe den blinden Bruder übervorteilt, die Marchsteine falsch gesetzt und sich den größten und schönsten Teil der Alp angeeignet. Wie solche Kunde dem Blinden überbracht worden sei, habe dieser seinen Bruder darüber zur Rede gestellt. Der Ungerechte aber habe sich verheißen und verschworen: „Der Teufel solle ihn holen und die Weide zerreißen, wenn er nicht ganz ehrlich geteilt habe.“ Da sei denn ein furchtbares Wetter entstanden, der Berg habe gebebt, Satanas sei erschienen und der Schwur in Erfüllung gegangen. Der Teufel habe allen Rasen und nutzbares Erdreich vom Berge abgestreift, und zwar so begierig und eifrig, dass man noch heutigen Tages die Spuren seiner Krallen im Gestein als jene Rinnen erblicke. Während die Weide des Blinden unversehrt blieb, verfiel der Andere der Hölle.
Es liegt, lassen wir das Motiv der Erzählung außer Spiel, tiefer und wahrer Sinn dieser Sage zu Grunde. Die unverständige Menschenhand, welche die Berge ihrer Wälder so beraubte, dass der Boden kahl, den Zerstörungen durchs Wetter preisgegeben wurde, war die Teufelsfaust, welche den Berg verwüstete;
Gestorben ist der Fichtenwald,
Verwittert sind die Zinken;
Nur grau Gestein, so alt und kalt
Liegt da, mir graus zu winken.
Witte.
Man suchte die Karrenfelder als Resultate der einstigen großen Gletscher-Erosion darzustellen, zumal sie oft mit anderen unverkennbaren Gletscherspuren in Verbindung auftreten. Genauere Untersuchungen haben jedoch die Unhaltbarkeit dieser Hypothese zur Genüge nachgewiesen. Der Gletscherschliff, dessen im Abschnitt: „Granit“ schon Erwähnung geschah, hat gerade die Eigentümlichkeit einer gleichmäßigen Abnutzung und Abrundung der Gesteine, während ein echtes Schrattenfeld die Unregelmäßigkeit und Ungleichheit selbst ist. Die bedeutendsten, größten und ausgeprägtesten Karrenfelder liegen in den Kantonen Appenzell, St. Gallen, Glarus und Schwyz; das renommierteste und besuchenswerteste ist das auf der Silberen. Von dem idyllischen Klöntaler See (jetzt seit Eröffnung der Eisenbahn nach Glarus, der Wallfahrtsort aller Touristen) erreicht man dasselbe, den Weg über den Pragel fast bis auf die Passhöhe verfolgend und dann links abbiegend, in 2½ bis 3 Stunden. Die Kalkfläche des Karrenfeldes auf der Silberen ist so weiß, dass man dieselbe, von Weitem gesehen, für ein Schneefeld hält. Andere Schratten sind am Nordhang der Chursirste am Scherenberg unweit des Leistkammes, die ausnahmsweise an manchen Stellen fast ganz mit Alpenrosen überwuchert sind, — dann am Messmer auf der Westseite der Säntiskette der Silberplatte entlang, — ferner am Kerenzerberg (leicht mittelst der Eisenbahn am Wallensee zu erreichen), — an den Bergen des Wäggitales, am Fluhbrig, Fronalpstock, am Bauen (Vierwaldstätter See), am Sättelistock, auf dem Brünigpass, am Kaiserstock, an den Pässen des Rawyl und Sanetsch, Tour d'Ay, Tour de Mayen und vielen anderen Orten.
Nagelfluh.
Geheimnisvoll am lichten Tag
Lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag.
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.
Goethe.
Wenn Du, lieber Leser, auf deiner sommerlichen Schweizerreise, oder Du, lieber Schweizer, aus dem deutschen Reich über den Bodensee kommend bergwärts wanderst, durchs fröhliche Appenzeller Ländchen, oder durch das industrielle freundliche Toggenburg, oder noch mehr westwärts durchs behäbige Emmental und Entlibuch, — oder wenn Du in dem reizend, in parkartiger Umgebung gelegenen Hôtel Bellevue bei Thun eine Körper, Herz und Geist stärkende Villegiatur machst, und der freundliche Besitzer, Herr Knechtenhofer, Dich an der englischen Kapelle vorüber zum Pavillon Saint Jacques hinaufführt, von wo aus man einen prächtigen Niederblick auf ein reiches Bild hat, auf das stolze, in altertümlichem Geschmacke mit einem Kostenaufwande von 1½ Millionen Franken durch Herrn von Rougemont erbaute Schloss, auf die Karthause und den Thuner-See, auf den Niesen, die Stockhornkette und im vollen Rundblick auf die riesigen Firndome der Jungfrau, des Mönch, Eiger und vieler anderer, — oder wenn Du auf den Rigi steigst, — oder sogar nur auf den Freudenberg ob St. Gallen, — dann fällt Dein Blick oft auf Felsenwände, die dem üblichen Begriff nach nicht eigentlich Felsen sind, weil sie wie Frontwände großer Kiesgruben aussehen. Betrachte dieses konglomerierte Gestein doch ein wenig näher, verweile einige Augenblicke bei ihm; Dein Zeitverlust wird, bist Du anders dilettierender Freund der Naturwissenschaften, reichlich belohnt werden.
Dieses sonderbare Gebilde ist „Nagelfluh“, ein tertiäres Anschwemmungs-Produkt, ein aus Geschiebe und Rollsteinen komponierter Natur-Füllbau, in die Periode der Molassezeit gehörend; also eines der jüngsten Schuttgesteine, die wir kennen. Die Nagelfluh kommt in mächtigen Massen und stundenweit verbreiteten Flächen bloß an der nördlichen Abdachung der Alpen vor und gestaltet hier die ersten Anhöhen und Berge. Am und im Jura ist ihr Auftreten nur sporadisch, wie z. B. um Pruntrut, Delsperg, an dem berühmten Felsentor der Pierre pertuis, in der kühlen Einsiedler-Schlucht St. Verena bei Solothurn, um Aarburg und Aarau und im Teufelskeller bei Baden. Außerdem zeigt sich die Nagelfluh nur noch in Vorderindien.
Dieses den sogenannten Puddingsteinen verwandte Konglomerat besteht aus mächtigen, oft sogar bis zu mehreren tausend Fuß Dicke anwachsenden Schichten abgelagerter Rollsteine, die mittelst eines kalkhaltigen, unter Säuren aufbrausenden Zementes miteinander verbunden sind, — mitunter so außerordentlich fest, dass beide Teile eine gleichmäßig harte Masse bilden und beim Sprengen in glatter Fläche spalten, so dass der Bruch ebenmäßig durch Zement und Rollsteine geht. Diese Festigkeit ist so bedeutend, dass man die Nagelfluh einiger Gegenden, wie z. B. die unter dem Namen des Degersheimer und Solothurner Marmors bekannten Arten, zu Werken der Bildhauerei, zu großen Brunnenbecken und monumentalen Arbeiten, ja sogar zu Mühlsteinen benutzt hat. Die Größe der in den Zement eingebackenen Rollsteine variiert außerordentlich; man findet deren, die wie winzige Hirsekörnchen nebeneinander liegen und somit der Schicht das Ansehen eines grobkörnigen Sandsteinlagers geben, — und wiederum solche von dem Umfange großer klafterhaltiger Blöcke.
Dies alles würde aber die Nagelfluh noch zu keinem besonders interessanten Naturprodukt machen, wenn nicht ein Paar Umstände dabei noch vorwalteten, die bisher noch keine genügende Aufklärung fanden. Die Nagelfluh besteht nämlich, wie eine jede Kiesgrube, aus den verschiedenartigsten, kugelig, oblong oder flach-rundlich abgeschliffenen Gesteins-Fragmenten. Je nach ihrer Farbe und qualitativen Zusammensetzung hat man sie in die beiden Hauptgruppen der bunten- und der Kalk-Nagelfluh abgeteilt. Zur bunten Nagelfluh gehören jene Konglomerate, welche, wie der Name schon sagt, in reicher Farben-Mosaik prangen. Da finden wir feurigrote Porphyrkugeln neben hellleuchtenden saftig-apfelgrünen Granit-Rollsteinen, warm violett gefärbte Split-Zylinder neben schwarzgrün getigerten Serpentin-Ovalen, goldockerfarbige, abgerundete Kalkstein-Gerölle neben fleischfarbig geaderten Feldspat-Sphäroiden, — ein schönes, reiches Bild bunter Gruppierung der verschiedenfarbigsten Gesteine. Minder brillant sieht die Kalk-Nagelfluh aus. Bei ihr sind gebrochene graue, blaue und schwärzliche Töne vorherrschend; doch gibt es auch solche, die davon abweicht, wie z. B. die Nagelfluh am Fuße des Speers bei Wesen am Wallensee, welche fast das Ansehen von Rotwurst oder Gothaer Presskopf hat. Denn in dem dunkelroten eisenhaltigen Zement sind weiße Feldspat-Geschiebe eingebacken, die wie fette Speckwürfel aussehen, und wieder andere kalkhaltige Gesteine, die man ohne sonderliche Anstrengung der Phantasie für Schweineschwarte und Kesselfleisch halten kann. Unmittelbar hinter dem Bahnhof in Wesen kann der Kuriositätenfreund sich Bruchstücke dieses Naturspieles auflesen.
Der eine bis jetzt noch unerklärt gebliebene Umstand beruht nun dann, dass man Geschiebe von Felsarten (und zwar in Menge) darin findet, welche entweder in den Alpen gar nicht — oder doch nur in den südlichen Tälern derselben vorkommen (d. h. deren heutige Flussgebiete gegen Süden auslaufen, wie das der Rhône, des Ticino und Inn), — oder dass Geschiebe von Gesteinsarten wieder gänzlich in der Nagelfluh fehlen, die man in großer Menge darin erwarten sollte, weil sie in den Alpen außerordentlich reichlich vorhanden sind. Es bleibt somit nichts Anderes übrig, als anzunehmen: dass die Rollsteine der Nagelfluh von Gebirgen herrühren, die bei einer der großen Erdumwälzungen gänzlich zertrümmert, dann durch die Friktion in den Flutungen des Urmeeres abgeschliffen und gerundet, hierauf in gewaltigen Schichten abgelagert, von Zementschlamm umhüllt und endlich bei der Hebung der Alpen mit aus den Meerestiefen emporgehoben wurden.
Eine zweite noch interessantere, aber auch noch minder erklärliche Erscheinung ist die der Impressionen. Sucht man nur einige Augenblicke an bloßgelegten Nagelfluh-Felsen, namentlich an solchen, deren Bindemittel nicht zu hart ist, so dass man die Rollsteine leicht aus ihnen herauslösen kann, so wird man von letzteren Exemplare finden, welche tiefe, muldenförmige Eindrücke von ihren unmittelbaren Nachbarn erhalten haben, etwa so, als wenn man in frisches, geknetetes Brot irgend einen beliebigen harten Gegenstand eindrücken würde. Nun sind aber beide Steine in der Regel von gleich harter Masse, und der Stein Nummer Zwei, welcher die Impression in dem von Nummer Eins hervorbrachte, erhält an einer anderen Stelle von einem dritten Nachbar selbst wieder ganz ähnliche Quetschungen oder Vertiefungen. Da man nun doch annehmen muss, dass die Rollsteine, ehe sie rundlich abgeschliffen wurden, bereits hart und spröde waren, so ist es schwer erklärlich, wie sie von gleich harten Nebenkörpern solche Eindrücke empfangen konnten.





























