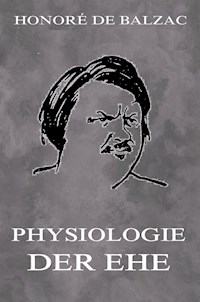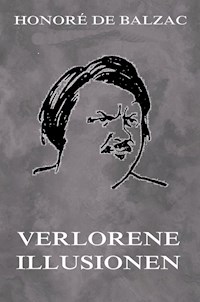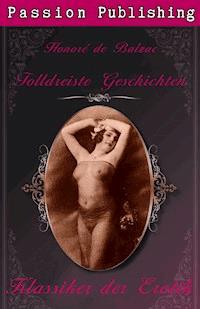0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Die alte Jungfer" von Honoré de Balzac handelt es sich um die Geschichte einer älteren Frau namens Elisabeth Fischer, die ihr ganzes Leben lang unverheiratet geblieben ist. Das Buch zeigt sowohl die gesellschaftlichen Konventionen der damaligen Zeit als auch die inneren Kämpfe und Sehnsüchte der Protagonistin. Balzacs literarischer Stil zeichnet sich durch seine detaillierten Beschreibungen und psychologischen Einblicke aus, die eine tiefe emotionale Verbindung zum Charakter herstellen. Das Werk gehört zur literarischen Bewegung des Realismus, die den Fokus auf die Darstellung des alltäglichen Lebens legt und soziale Probleme aufzeigt. Balzac verwendet eine klare Sprache und ein subtilen Humor, um die Härte des Lebens einer alleinstehenden Frau im 19. Jahrhundert darzustellen. Honoré de Balzac war ein französischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, der für seine realistischen Darstellungen des sozialen Lebens bekannt ist. Als Beobachter der Gesellschaft reflektierte er in seinen Werken die Veränderungen und Konflikte der Zeit. Balzac selbst war vom Schicksal unverheirateter Frauen fasziniert und porträtierte sie mit Einfühlungsvermögen und Sensibilität. Durch seine detaillierten Beschreibungen und feinen Charakterstudien schuf er ein lebendiges Bild der Zeit und ihrer Herausforderungen. "Die alte Jungfer" ist ein fesselndes Werk, das die Leser nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken über die sozialen Normen und die Einsamkeit anregen wird. Ein Buch, das sowohl literarisch anspruchsvoll als auch emotional berührend ist und einen Einblick in das Leben einer ungewöhnlichen Frau des 19. Jahrhunderts bietet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die alte Jungfer
Books
Inhaltsverzeichnis
Die alte Jungfer
Für Monsieur Eugene-Auguste-Georges-Louis Midy de la Greneraye Surville
Ingenieur beim Königlichen Amt für Straßen- und Brückenbau
Als ein Zeugnis der Zuneigung seines Schwagers
De Balzac
Gewiß sind viele Leute in bestimmten Provinzen Frankreichs einigen Chevaliers de Valois begegnet, denn es gab einen in der Normandie, ein anderer lebte in Bourges, ein dritter erfreute sich ums Jahr 1816 in der Stadt Alençon bester Gesundheit, und im Süden des Landes ließe sich vielleicht auch noch einer finden. Aber die Aufzählung dieses Stammes der Valois ist hier ohne Bedeutung. Alle diese Chevaliers, unter denen es sicher welche gab, die so Valois waren, wie Ludwig XIV. Bourbone war, kannten sich so wenig, daß es überflüssig gewesen wäre, ihnen voneinander zu erzählen. Im übrigen ließen sie alle Bourbonen vollkommen unbehelligt auf dem Throne Frankreichs, denn es ist nur allzusehr erwiesen, daß Heinrich IV. König wurde, weil es in der älteren, Valois genannten Linie der Orléans keinen männlichen Erben gab. Wenn es Abkömmlinge der Valois gibt, so stammen sie alle von Charles de Valois, Duc d'Angoulême, Sohn Karls IX. und der Marie Touchet, dessen männliche Nachkommenschaft, bis zum gegenteiligen Beweis, in der Person des Abbé de Rothelin erloschen ist; die Valois-Saint-Remy, die von Heinrich II. abstammen, haben gleichfalls bei der berüchtigten Lamothe-Valois, die in die Halsbandaffäre verwickelt war, aufgehört zu bestehen.
Jeder dieser Chevaliers war, wenn die Berichte zutreffend sind, wie der von Alençon, ein alter, langer, dürrer Edelmann ohne Vermögen. Der von Bourges hatte in der Emigration gelebt, der aus der Touraine hatte sich versteckt, der von Alençon hatte in der Vendée Krieg geführt und sich ein bißchen als Chouan aufgespielt. Der überwiegende Teil der Jugend dieses letzteren hatte sich in Paris abgespielt, wo ihn die Revolution inmitten seiner Eroberungen im Alter von dreißig Jahren überrascht hatte. Da der Chevalier de Valois aus Alençon bei der hohen Aristokratie der Provinz als echter Valois galt, so tat er sich, gleich seinen Namensvettern, durch ausgezeichnete Manieren hervor und trat als Mann der oberen Gesellschaft auf. Er dinierte alle Tage auswärts und spielte alle Abende Karten. Dank einem seiner Fehler, welcher darin bestand, eine Menge Anekdoten über die Regierung Ludwigs XV. und die Anfänge der Revolution zu erzählen, hielt man ihn für einen sehr geistreichen Menschen. Wenn man diese Histörchen zum erstenmal hörte, fand man, daß sie sehr gut vorgetragen waren. Der Chevalier de Valois hatte überdies die Tugend, niemals seine eigenen Bonmots zu wiederholen und niemals von seinen Liebesangelegenheiten zu reden; doch sein Schöntun und Lächeln begingen hierbei entzückende Indiskretionen. Dieser biedere Herr machte sich das Vorrecht der alten Voltairianer zunutze, niemals in die Messe zu gehen, welche Irreligiosität man ihm wegen seiner großen Hingebung an die Partei des Königs nachsah. Eine der auffälligsten seiner anmutigen Gesten war die, wahrscheinlich bei Mole abgeschaute Art, aus einer alten goldenen Tabaksdose zu schnupfen, die mit dem Porträt der Fürstin Goritza geschmückt war, einer reizenden Ungarin, die zu Ende der Regierung Ludwigs XV. wegen ihrer Schönheit berühmt gewesen war. Er war in seiner Jugend mit dieser berühmten Ausländerin sehr verbunden gewesen und sprach stets mit Rührung von ihr; auch hatte er sich um ihretwillen mit Monsieur de Lauzun geschlagen.
Um jene Zeit zählte er etwa achtundfünfzig Jahre, doch gab er nur fünfzig an, und er konnte sich diese harmlose Unterschlagung erlauben, denn von den Vorzügen, die mageren blonden Menschen häufig zufallen, erfreute er sich einer noch jugendlichen Gestalt, die sowohl Männern wie Frauen das Aussehen des Alters erspart. Ja, wisset, das ganze Leben oder vielmehr die ganze geschmeidige Haltung, die der Ausdruck des Lebens ist, hat ihren Sitz in der Gestalt. Zu den Eigentümlichkeiten des Chevaliers muß man die gewaltige Nase rechnen, mit der ihn die Natur ausgestattet hatte. Diese Nase teilte sein blasses Gesicht nachdrücklich in zwei Partien, die einander nicht zu kennen schienen und von denen sich die eine während der Verdauung stark rötete. Dieser Umstand ist erwähnenswert in einer Zeit, in der sich die Physiologie so sehr mit dem menschlichen Herzen beschäftigt. Dieses Erglühen ging auf der linken Seite vor sich. Obwohl die langen und dünnen Beine, der schmächtige Körper und der fahle Teint des Monsieur de Valois keine robuste Gesundheit verrieten, so aß er nichtsdestoweniger wie ein Menschenfresser und behauptete, wahrscheinlich um seinen ungeheuren Appetit zu entschuldigen, an einer Krankheit zu leiden, die man in der Provinz mit dem Namen »hitzige Leber« bezeichnet. Die flammende Röte bestätigte solche Behauptungen; allein, wo die Mahlzeiten aus dreißig oder vierzig Gerichten bestehen und vier Stunden dauern, muß man den Magen des Chevaliers als eine Wohltat betrachten, mit der die Vorsehung diese gute Stadt begnadet hatte. Nach der Meinung einiger Ärzte deutete die linksseitige Röte auf ein zu weites Herz.
Das galante Leben des Chevaliers machte diese wissenschaftlichen Feststellungen, für die sich der Historiker zum Glück nicht sonderlich verantwortlich fühlt, sehr wahrscheinlich. Trotz dieser Symptome war Monsieur de Valois von nerviger, infolgedessen äußerst lebhafter Natur. Wenn seine Leber hitzig war, so brannte sein Herz nicht weniger stark, um eine alte Redewendung zu gebrauchen. Wenn sein Gesicht einige Runzeln aufwies und seine Haare mit Silberfäden durchzogen waren, so erkannte ein kundiger Beobachter darin die Merkmale der Leidenschaft und die Spuren des Vergnügens. In der Tat waren die Krähenfüße und Stirnrunzeln von der eleganten Art, die am Hofe der Cythera so geschätzt wird. Alles ließ bei dem koketten Chevalier auf den Frauenhelden, den »ladies man«, wie die Engländer sagen, schließen: er wusch sich so sorgfältig, daß es ein Vergnügen war, seine Wangen anzuschauen; sie schienen mit einem wunderkräftigen Wasser abgerieben zu sein. Der Teil des Kopfes, den die Haare nicht mehr bedecken wollten, glänzte wie Elfenbein. Seine Brauen wie seine Haare täuschten durch die Regelmäßigkeit, die ihnen der Kamm verliehen hatte, die Jugend vor. Seine Haut, die schon von Natur so weiß war, schien durch irgendein Geheimmittel noch, weißer geworden zu sein. Ohne daß der Chevalier von Parfüm Gebrauch gemacht hätte, strömte er einen erfrischenden Duft von Jugendlichkeit aus. Seine Hände waren gepflegt wie die einer Modepuppe und zogen den Blick durch die Form ihrer rosigen Nägel auf sich. Kurz, ohne seine überragende, an Größe unvergleichliche Nase, hätte man ihn zierlich nennen können.
Doch kann man nicht umhin, dieses Porträt durch das Eingeständnis einer Schwäche zu beeinträchtigen: der Chevalier stopfte Watte in seine Ohren und trug überdies zwei kleine, sehr kunstvoll gearbeitete Ohrringe, die in Diamant gefaßte Negerköpfe darstellten; doch legte er so großen Wert darauf, daß er dieses eigentümliche Anhängsel mit der Behauptung rechtfertigte, seitdem seine Ohrläppchen durchstochen seien, habe er keine Migräne mehr; er hatte also an Migräne gelitten. Wir geben den Chevalier also keineswegs für das Idealbild eines Mannes aus; im übrigen, muß man nicht den alten Junggesellen, denen soviel Blut vom Herzen ins Gesicht schießt, ein paar solche entzückend lächerliche Absonderlichkeiten, die vielleicht auf zarten Geheimnissen beruhen, nach sehen?
Der Chevalier de Valois machte übrigens diese Negerköpfe durch so viele andere Vorzüge wieder wett, daß die Gesellschaft sich dafür genügend entschädigt finden sollte. Er gab sich wirklich große Mühe, seine Jahre zu verbergen und seinen Bekannten zu gefallen. Da war in erster Linie die außerordentliche Sorgfalt, die er auf seine Wäsche verwandte, dieses einzige Mittel, mit dem sich heutzutage Leute von guter Lebensart in ihrer Kleidung auszeichnen können! Die des Chevaliers war stets von aristokratischer Feinheit und Weiße. Was seinen Rock anging, so war er zwar immer abgetragen, aber von bemerkenswerter Sauberkeit, ohne Flecken und Falten, Die Konservierung seiner Kleidungsstücke grenzte sogar ans Wunderbare für diejenigen, die die saloppe Gleichgültigkeit des Chevaliers für diese Seite der Mode bemerkten; er ging zwar nicht so weit, sie mit einem Stück Glas abzuschaben, ein Verfahren, das vom Prinzen von Wales erfunden worden ist; immerhin setzte Monsieur de Valois seine ihm eigene Geckenhaftigkeit darein, die Grundelemente hoher englischer Eleganz nachzuahmen, was von den Leuten von Alençon wohl kaum gebührend gewürdigt werden konnte. Ist die Welt nicht denen Achtung schuldig, die sich ihretwegen so sehr in Unkosten stürzen? Handeln solche Leute nicht nach jener schwierigsten Vorschrift des Evangeliums, die befiehlt, Böses mit Gutem zu vergelten? Dieses frische, gepflegte Äußere paßte gut zu den blauen Augen, den blendend weißen Zähnen, der blonden Erscheinung des Chevaliers. Nur hatte dieser Adonis im Ruhestand nichts Männliches in seinem Auftreten, und die Künste der Toilette mußten ihm dazu dienen, die im Kriegsdienst der Galanterie erworbenen Schäden zu verdecken. Um nichts ungesagt zu lassen: die Stimme stand im Widerspruch zu der blonden Zartheit des Chevaliers. Ohne der Meinung einiger Kenner des menschlichen Herzens beizupflichten, welche sagten, die Stimme des Chevaliers entspräche seiner Nase, mußte man sich doch über den Umfang und die Tragkraft seines Organs wundern. Die Stimme besaß zwar nicht das Volumen eines mächtigen Basses, gefiel aber durch eine hübsche Mittellage, war ausdauernd und zart, durchdringend und doch samtweich wie der Klang des Englischhorns. Der Chevalier hatte die lächerliche Tracht, die einige monarchisch gesinnte Männer beibehalten hatten, abgelegt und sich offen der herrschenden Mode angeschlossen; er trug stets einen kastanienbraunen, mit goldenen Knöpfen besetzten Rock, leicht anliegende Kniehosen aus einem festen, seidenartigen Stoff mit goldenen Schnallen, eine weiße Weste ohne Stickerei und als letztes Überbleibsel der vormaligen französischen Mode eine geknotete Krawatte ohne Hemdkragen, auf die er um so weniger hatte verzichten können, als sie ihm gestattete, den Hals eines weltlichen Abbé zu zeigen. Seinen Schuhen gereichten viereckige, bei der gegenwärtigen Generation in Vergessenheit geratene goldene Schnallen zur Zierde, die sich vom lackierten schwarzen Leder abhoben. Gleichfalls eine Reminiszenz an die Mode des achtzehnten Jahrhunderts, das die »Incroyables« unter dem Direktorium nicht mißachteten, war die Gepflogenheit des Chevaliers, zwei Uhrketten zu tragen, die zu beiden Seiten aus seinen Westentäschchen heraushingen. Dieses Übergangskostüm, das zwei Jahrhunderte miteinander verband, trug der Chevalier mit jener Grazie eines echten Marquis, deren Geheimnis an dem Tage verlorenging, als Fleury, der letzte Schüler Molés, von der französischen Bühne abtrat. Das Privatleben dieses alten Junggesellen lag dem Anschein nach vor aller Augen offen da, war aber in Wirklichkeit sehr geheimnisvoll. Er bewohnte ein bescheidenes Logis – taktvoll ausgedrückt –, das in der Rue du Cours im zweiten Stock eines Hauses gelegen war, das Madame Lardot, der meistbeschäftigten Feinwäscherin der Stadt, gehörte. Das erklärte die auserlesene Feinheit seiner Wäsche. Das Unglück wollte, daß Alençon eines Tages Grund hatte anzunehmen, der Chevalier habe sich nicht immer so aufgeführt, wie es sich für einen Edelmann ziemt, und habe in seinen alten Tagen eine gewisse Césarine, die Mutter eines Kindes, das die Frechheit gehabt hatte, ungerufen zur Welt zu kommen, geheiratet.
»Er hatte«, sagte ein gewisser Monsieur du Bousquier, »derjenigen seine Hand gereicht, die so lange das Eisen für ihn heiß gemacht hat.«
Diese abscheuliche Verleumdung trübte die alten Tage des zarten Edelmannes um so mehr, als ihm dadurch, wie diese Geschichte zeigen wird, eine lang gehegte Hoffnung, der er manches Opfer gebracht hatte, vereitelt wurde. Madame Lardot vermietete an den Chevalier de Valois zwei Zimmer im zweiten Stock ihres Hauses für den mäßigen Preis von hundert Francs im Jahr. Der würdige Edelmann, der alle Tage auswärts speiste, kam nur zum Schlafengehen nach Hause. Seine einzige Ausgabe war daher sein Frühstück, das unabänderlich aus einer Tasse Schokolade bestand, der Butter und Obst, je nach der Jahreszeit, beigegeben waren. Er ließ nur im strengsten Winter heizen und dann auch nur zum Aufstehen. Zwischen elf und vier Uhr ging er spazieren, las die Zeitungen und machte Besuche. Gleich bei seiner Niederlassung in Alençon hatte er seine Armut hochherzig eingestanden und gesagt, daß ihm als einziger Überrest seines ehemaligen Reichtums eine Leibrente von sechshundert Livres geblieben sei, die ihm sein früherer Geschäftsführer, bei dem die Papiere lagen, in vierteljährlichen Raten übermitteln ließ. In der Tat händigte ihm ein Bankier der Stadt alle drei Monate hundertfünfzig Livres aus, die von einem gewissen Bordin in Paris, dem letzten Prokurator des Châtelet, abgeschickt waren. Jeder wußte diese Einzelheiten, dank der tiefen Verschwiegenheit, um die der Chevalier die erste Person, die sein Vertrauen empfing, gebeten hatte. Monsieur de Valois erntete die Früchte seines Mißgeschicks: man deckte ihm den Tisch in den ersten Häusern Alençons und lud ihn zu allen Abendgesellschaften ein. Seine Talente als Spieler, Erzähler, liebenswürdiger und guter Gesellschafter waren so geschätzt, daß alles verfehlt schien, wenn er nicht zugegen war. Die Hausherren und die Damen konnten seine gutheißende Kennermiene nicht missen. Wenn der alte Chevalier zu einer jungen Frau auf einem Balle sagte: »Sie sind zum Entzücken gekleidet!«, so beglückte dieses Lob sie mehr als der Neid ihrer Rivalin. Monsieur de Valois war der einzige, der gewisse Wendungen der alten Zeit in der richtigen Weise aussprechen konnte. Die Worte ›mein Herz, mein Juwel, mein liebes Kind, meine Königin‹, alle die verliebten Kosenamen der Jahre um 1770, gewannen in seinem Munde einen unwiderstehlichen Reiz; kurz, er hatte das Vorrecht der Superlative. Seine Komplimente, mit denen er übrigens geizte, verschafften ihm die Gunst der alten Damen; sie schmeichelten aller Welt, selbst den Herren der Verwaltung, die er nicht brauchte. Sein Betragen beim Spiel war von einer Vornehmheit, die man überall anerkannt hatte. Er beklagte sich nie, er lobte seine Gegner, wenn sie verloren; er unternahm niemals, seine Partner zu erziehen, indem er ihnen zeigte, wie sie ihre Trümpfe hätten ausspielen sollen. Wenn sich beim Kartenmischen langatmige, abstoßende Auseinandersetzungen entspannen, zog der Chevalier mit einer Gebärde, die Molés würdig gewesen wäre, seine Tabaksdose hervor, betrachtete die Fürstin Goritza, öffnete würdevoll den Deckel, nahm seine Prise zwischen die Finger, hob sie in die Höhe, rieb sie, formte sie zu Klümpchen; wenn dann die Karten ausgegeben waren, hatte er die Höhlen seiner Nase vollgestopft und die Fürstin, immer zur Linken, in seine Westentasche gesteckt. Nur ein Edelmann des ›guten‹ Zeitalters – im Gegensatz zum ›großen‹ Zeitalter – konnte dieses Mittelding zwischen einem geringschätzigen Stillschweigen und einer boshaften Bemerkung, die nicht verstanden worden wäre, zuwege bringen. Er nahm mit den Stümpern fürlieb und wußte seinen Vorteil aus ihnen zu ziehen. Sein entzückender Gleichmut entlockte vielen die Äußerung: »Ich bewundere den Chevalier de Valois!« Seine Unterhaltung, seine Manieren, alles an ihm schien, wie seine Person, blond zu sein. Er bemühte sich, weder bei Herren noch Damen Anstoß zu erregen. Gleicherweise nachsichtig gegen organische Fehler wie geistige Defekte, hörte er mit Hilfe der Fürstin Goritza geduldig die Leute an, die ihm ihre kleinen Leiden des Provinzlebens vortrugen: das schlecht gekochte Frühstücksei, die sauer gewordene Salme im Kaffee, possierliche Einzelheiten, die die Gesundheit betrafen, das plötzliche Auffahren aus dem Schlaf, die Träume, die Besuche. Der Chevalier verfügte über einen schmachtenden Blick, ein klassisches Mienenspiel, um Mitleid zu fingieren, so daß er ein köstlicher Zuhörer war. Er konnte ein ›Ach!‹, ein ›Was!‹, ein ›Wie ging das zu?‹ im richtigen Moment verblüffend vorbringen. Er starb, ohne daß jemand auf den Verdacht gekommen wäre, daß er, während er diese albernen Ergüsse über sich ergehen ließ, sich die glühendsten Kapitel seines Romans mit der Fürstin Goritza ins Gedächtnis zurückrief. Hat man jemals bedacht, welche Dienste ein erloschenes Gefühl der Gesellschaft leisten kann, in welchem Maße die Liebe der Gesellschaft zugute kommt und ihr nützlich ist? Dies kann zur Erklärung dienen, warum der Chevalier, trotz seiner beständigen Gewinne, der Liebling der Stadt blieb, denn er verließ niemals einen Salon, ohne ungefähr sechs Livres gewonnen zu haben. Daß er verlor, kam sehr selten vor, und dann machte er immer viel Aufhebens davon. Alle, die ihn gekannt haben, gestehen ein, daß sie nirgends, selbst nicht im Ägyptischen Museum in Turin, eine so nette Mumie gesehen hätten. In keinem Lande der Welt nimmt das Schmarotzertum so angenehme Formen an. Nie hat sich der konzentrierteste Egoismus dienstfertiger, weniger verletzend gezeigt als bei diesem Edelmann; er war so viel wert wie eine aufopfernde Freundschaft. Wenn jemand Monsieur de Valois um eine kleine Gefälligkeit bat, die diesen Mühe gekostet hätte, so verließ dieser Jemand den guten Chevalier niemals, ohne von ihm entzückt zu sein, in keinem Fall aber ohne die Überzeugung, daß er in der Sache nichts tun könne oder sie durch seine Einmischung verdorben hätte.
Um die problematische Existenz des Chevaliers zu erklären, muß der Chronist, dem die Wahrheit, diese grausame Geliebte, das Messer an die Kehle setzt, bekennen, daß Alençon unlängst nach den ruhmreich traurigen Julitagen erfahren mußte, daß die Summe, die Monsieur de Valois beim Spiel zu gewinnen pflegte, sich vierteljährlich auf ungefähr einhundertfünfzig Taler belief und daß der geistreiche Chevalier den Mut gehabt hatte, sich selbst seine Leibrente zuzuschicken, um in einem Lande, wo man das Habet liebt, nicht ohne Hilfsquellen zu erscheinen. Viele seiner Freunde – man beachte, daß er schon tot war – bestritten diese Behauptung steif und fest, hielten sie für eine Fabel und blieben dabei, daß der Chevalier ein achtbarer, würdiger Edelmann gewesen sei, den die Liberalen verleumdeten. Zum Glück für diese durchtriebenen Spieler gibt es in der Galerie immer Leute, die ihnen Beistand leisten. Sie leugnen hartnäckig ein Unrecht, weil sie sich schämen, ihm Vorschub geleistet zu haben; man betrachte dies nicht als Eigensinn, die Leute wissen, was sie ihrer Würde schuldig sind. Die Regierungen gehen ihnen mit gutem Beispiel in dieser Tugend voran, welche darin besteht, ihre Toten bei Nacht und Nebel zu begraben, ohne das ›Tedeum‹ ihrer Niederlagen zu singen. Wenn sich der Chevalier also wirklich diesen gerissenen Streich erlaubt haben sollte, der ihm übrigens sicherlich die Achtung des Chevaliers de Grammont, ein Lächeln des Barons de Faeneste, einen Händedruck des Marquis de Monçada eingetragen hätte, war er darum weniger der liebenswürdige Gast, der geistreiche Mann, der unverwüstliche Spieler, der reizende Erzähler, der das Entzücken von Alençon ausmachte? Inwiefern ist überhaupt diese Handlungsweise, die unter dem Gesetz des freien Willens steht, mit den eleganten Sitten eines Edelmanns unvereinbar? Wenn soundso viele Leute genötigt sind, andern Renten auszuzahlen, was ist natürlicher, als daß man seinem besten Freunde freiwillig eine zukommen läßt? Aber Laios ist tot... Nach etwa fünfzehn Jahren einer solchen Lebensweise hatte der Chevalier zehntausend und einige hundert Francs zusammengebracht. Bei der Wiederkehr der Bourbonen hatte ihm ein alter Freund, der Marquis de Pombreton, ehemaliger Leutnant bei den schwarzen Musketieren, wie man sagt, zwölfhundert Pistolen, die der Chevalier ihm geborgt hatte, damit er emigrieren könne, zurückgegeben. Dieses Ereignis erregte Aufsehen; es wurde späterhin den vom ›Constitutionel‹ erfundenen Spöttereien über die Art, wie manche Emigranten ihre Schulden bezahlten, entgegengehalten. Wenn jemand diesen edlen Zug des Marquis de Pombreton gegen den Chevalier erwähnte, errötete dieser bis zu seiner rechten Seite. Jedermann freute sich damals für Monsieur de Valois, welcher zu den Geldleuten ging und sich mit ihnen darüber beriet, wie er diesen Rest seines Vermögens verwenden solle. Er setzte seine Hoffnung auf die Restauration und legte das Geld in Staatspapieren an zu einer Zeit, da die Renten sechsundfünfzig Francs fünfundzwanzig Centimes betragen. Die Messieurs de Lenoncourt, de Navarreins, de Verneuil, de Fontaine und de La Billardière, mit denen er, wie er sagte, bekannt war, verschafften ihm eine Pension von hundert Talern aus der Schatulle des Königs und schickten ihm das Kreuz des heiligen Ludwig. Niemals erfuhr man, auf welche Weise der alte Chevalier zu dieser Auszeichnung gekommen war; aber es steht fest, daß das Patent des Kreuzes des heiligen Ludwig ihn befugte, sich auf Grund seiner in den katholischen Armeen des Westens geleisteten Dienste den Titel eines Oberst a.D. beizulegen. Außer seiner fingierten Leibrente, um die sich niemand mehr kümmerte, hatte der Chevalier also verbürgtermaßen tausend Francs Einkünfte. Trotz dieser Verbesserung seiner Lage änderte er in nichts seine Lebensweise oder seine Manieren; nur daß das rote Band sich prachtvoll auf seinem kastanienbraunen Rock ausnahm und sozusagen die Physiognomie des Edelmanns vervollständigte. Vom Jahre 1802 an verschloß der Chevalier seine Briefe mit einem sehr alten goldenen Siegel, das schlecht graviert war, aber auf dem die Castéran, die d'Esgrignon, die Troisville sehen konnten, daß sein Wappen in zwei Hälften geteilt war und auf der einen den Balkenstreifen in rotem Felde, auf der andern fünf goldene durchbrochene Rauten, die zu einem Kreuz zusammengefügt waren, führte; das Wappenbild hatte ein schwarzes Haupt mit silbernem Kreuz und war bekrönt mit dem Ritterhelm. Die Devise war: Valeo. Mit diesem edlen Wappen durfte und konnte der Bastard der Valois alle königlichen Karossen der Welt besteigen. Viele Leute haben die behagliche Existenz dieses alten Junggesellen, die an gutgespielten Boston-, Tricktrack-, Reversi-, Whist- und Pikettpartien, an gut verdauten Diners, anmutig geschnupften Tabakprisen und angenehmen Spaziergängen reich war, beneidet. Fast ganz Alençon glaubte, daß dieses Leben frei von Ehrgeiz und ernsteren Interessen gewesen sei; aber kein Mensch hat ein so ruhiges Leben, wie es die Neider hinstellen. Man wird in den weltvergessensten Winkeln menschliche Mollusken, anscheinend tote Rädertierchen finden, die eine Leidenschaft für Schmetterlinge oder Muscheltiere haben und sich unendlichen Leiden aussetzen, um irgendeinen Falter oder die Concha veneris zu erlangen. Der Chevalier führte nicht nur sein zurückgezogenes Muscheldasein, sondern er nährte auch einen ehrgeizigen Wunsch, den er mit einer Beharrlichkeit verfolgte, die des Papstes Sixtus V. würdig gewesen wäre: et wollte sich mit einer reichen alten Jungfer verheiraten, ohne Zweifel in der Absicht, sich auf diese Weise Zutritt zu den höheren Sphären des Hofes zu verschaffen. Dies war das Geheimnis seiner königlichen Haltung und seines Aufenthaltes in Alençon.
An einem Mittwoch zu sehr früher Stunde, gegen Mitte des Frühlings anno 16 – dies war seine Art zu reden –, hörte der Chevalier im Augenblick, als er seinen Schlafrock aus grüngeblümtem alten Damast anzog, trotz der Watte in seinen Ohren, den leichten Schritt eines jungen Mädchens, das die Treppe heraufkam. Drei sanfte Schläge ertönten an seiner Tür; dann glitt eine junge Schöne, ohne eine Antwort abzuwarten, wie ein Aal in das Zimmer des alten Junggesellen.
»Ach, du bist es, Suzanne!« sagte der Chevalier de Valois, ohne sich in seinem Geschäft, das darin bestand, daß er die Klinge seines Rasiermessers an einem Riemen abzog, zu unterbrechen. »Was willst du hier, kleiner süßer Schelm?«
»Ich komme, um Ihnen etwas zu sagen, was Ihnen vielleicht ebensoviel Vergnügen als Kummer machen wird.«
»Handelt es sich um Cesarine?«
»Ich kümmere mich viel um Ihre Cesarine!« versetzte sie mit einer Miene, die schmollend, ernst und sorglos zugleich war.
Diese reizende Suzanne, deren komisches Abenteuer einen so großen Einfluß auf das Schicksal der Hauptpersonen dieser Geschichte üben sollte, war eine Arbeiterin von Madame Lardot.