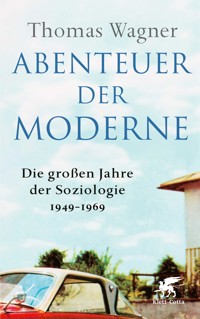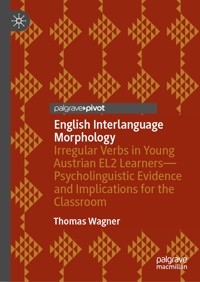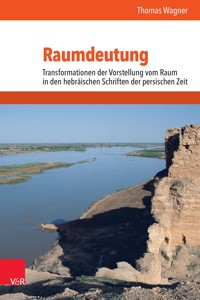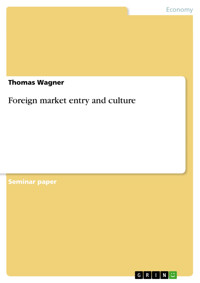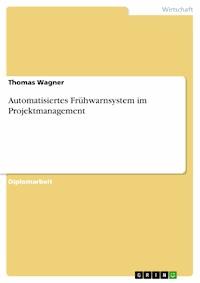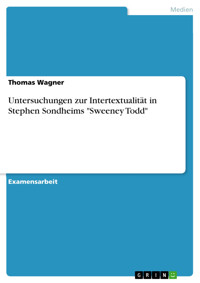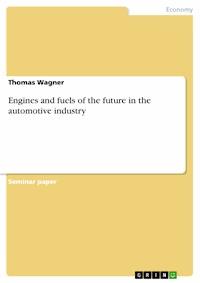14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer sind die Neuen Rechten? Eine Innenansicht. Mit dem Aufkommen der AfD droht die Neue Rechte breite bürgerliche Schichten zu erfassen. Wer sind ihre Ideengeber, und worin haben sie ihre Wurzeln? Thomas Wagner stellt erstmalig heraus, wie wichtig »1968« für das rechte Lager war, weil es einen Bruch in der Geschichte des radikalrechten politischen Spektrums markiert, der bis heute nachwirkt. Das zeigen unter anderem die Gespräche, die Wagner mit den Protagonisten und Beobachtern der Szene geführt hat, darunter Götz Kubitschek, Ellen Kositza, Martin Sellner, der inzwischen verstorbene Henning Eichberg, Alain de Benoist, Falk Richter und Frank Böckelmann. Wagners Buch liefert eine spannende Übersicht über die Kräfte und Strömungen der Neuen Rechten und ihre Ursprünge. „Nur wer begreift, wie die Akteure wirklich denken, ist in der Lage, angemessen auf ihre Provokationen zu reagieren. Fest steht: »1968« ist nicht nur die Geburtsstunde einer neuen Linken jenseits der Sozialdemokratie, sondern auch die einer Neuen Rechten. Dieses Buch erzählt, wie es dazu gekommen ist.“ (aus der Einleitung).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Thomas Wagner
Thomas Wagner, geboren 1967 in Rheinberg, studierte in Aachen Soziologie, lehrte und forschte in Dresden und promovierte in Münster. Er arbeitete als freier Autor u. a. für Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, junge Welt, Woz, Falter und Der Freitag. Publikationen u. a.: Die Mitmachfalle (2013), Robokratie (2015).
Informationen zum Buch
Wer sind die Neuen Rechten? Eine hochbrisante Innenansicht
Mit dem Aufkommen der AfD droht die Neue Rechte breite bürgerliche Schichten zu erfassen. Wer sind ihre Ideengeber, und worin haben sie ihre Wurzeln? Thomas Wagner stellt erstmalig heraus, wie wichtig »1968« für das rechte Lager war, weil es einen Bruch in der Geschichte des radikalrechten politischen Spektrums markiert, der bis heute nachwirkt. Das zeigen unter anderem die Gespräche, die Wagner mit den Protagonisten und Beobachtern der Szene geführt hat, darunter Götz Kubitschek, Ellen Kositza, Martin Sellner, der inzwischen verstorbene Henning Eichberg, Alain de Benoist, Falk Richter und Frank Böckelmann. Wagners Buch liefert eine spannende Übersicht über die Kräfte und Strömungen der Neuen Rechten und ihre Ursprünge.
»Nur wer begreift, wie die Akteure wirklich denken, ist in der Lage, angemessen auf ihre Provokationen zu reagieren. Fest steht: ›1968‹ ist nicht nur die Geburtsstunde einer neuen Linken jenseits der Sozialdemokratie, sondern auch die einer Neuen Rechten. Dieses Buch erzählt, wie es dazu gekommen ist.« (aus der Einleitung)
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Thomas Wagner
Die Angstmacher
1968 und die Neuen Rechten
Inhaltsübersicht
Über Thomas Wagner
Informationen zum Buch
Newsletter
Einleitung: Wer sind hier eigentlich die Nazis?
Was 1968 war
Kampf um Deutungshoheit
Das Pendel schlägt zurück
Konservatismus in der Defensive: Arnold Gehlen
Gegen die »Hypermoral«
Politische Resignation
Ein neuer Anfang: Die Rebellion der Nationalisten
Für die deutsche Einheit
Die schwarze Fahne empor
Wider den Status quo
Nationalrevolutionäre Zirkel
Nur bedingt praxistauglich
Die Faszination des Eurofaschismus
Krawall und Rock ’n’ Roll
Französische Vorbilder: Mabire, Benoist, Venner
Das Situationistische Manifest
Eine andere Kulturrevolution
Vom Marxismus lernen: Gramsci und die Metapolitik
Flaneur des Pariser Mai
Der Sound der Linken
Abkehr von den Altnazis
Antiimperialismus von rechts
Befreiungsnationalismus
Kritik an der Entwicklungshilfe
Ein politischer Kampfbegriff
Lob der Differenz
Exkurs: Ein Gespräch über den Ethnopluralismus
Tipps in Basisdemokratie: Der Anarchist und die »Sache des Volkes«
Nationalrevolutionäre Umweltschützer
Eine ungewöhnliche Debatte
Mit Faschisten redet man nicht
Nationalkonservative Graswurzelbewegung: Die Junge Freiheit
Immer noch: die deutsche Frage
Moeller van den Bruck und die Moderne
Jungkonservative Ideen
Exkurs: Armin Mohler und der faschistische Stil
Die Neunundachtziger: Rechter Aufbruch im Wende-Deutschland
Mit Ernst Jünger auf der Loveparade
68 auf den Kopf gestellt
Ein Historiker wittert Morgenluft
Pop-Linke gründen Wohlfahrtsausschüsse
Neofolk: Sehnsucht nach dem anderen Europa
Der Vatikan im Achtundsechziger-Rausch
Der Reaktionär Martin Mosebach erhält den Georg-Büchner-Preis
Die Kunst der politischen Provokation
Ein konservativer Sponti
Münchner Untergrund
Theorie und Praxis
Revolutionäre Selbstveränderung
Spiel mit dem Feuer
Die Achtundsechziger als Lehrmeister
Antibürgerliche Gemeinsamkeit
Die Türöffner: Thilo Sarrazin und Peter Sloterdijk
Das Untergangsszenario
Die SPD wird neoliberal
Der Geist ist aus der Flasche
Die dunkle Seite des Liberalismus
Der bürgerliche Widerstand formiert sich
Kritik am Merkel-Kurs
Ein liberaler Strippenzieher
Die rechten Alternativen: AfD und Pegida
Demokratie von unten
Dresden und die Retter des Abendlandes
Böckelmanns langer Weg nach rechts
Der Skandal um Tumult
Halbdistanz zur Obrigkeit
Stagnationserscheinungen
Identitärer Kulturkampf: Die Pop-Rechte in Aktion
Aufstehen gegen das System: Mishima und die Linke
Kriegserklärung an die Achtundsechziger
Vorbilder in Italien und Frankreich
Humor als Waffe
Die Strategie der Gewaltfreiheit
Geistiger Bruch: vom Neonazi zum Identitären
Ein Gespräch über Mohler und den Begriff der Nation
Der eigene Weg
Der Ritt auf dem Tiger
Sorel und der politische Mythos
Der »große Austausch«: Die Konstruktion eines Feindbilds
Die Zornbatterie wird aufgeladen
Invasion der Habenichtse
Erhöhte Wehrbereitschaft
Sloterdijks Schüler
In vorderster Reihe: Die Frauen der Neuen Rechten
Die Silvesternacht 2015
Ein Gespräch über den alten und den neuen Feminismus
Karl Marx und der »Faschismus des 21.Jahrhunderts«
Getrennte Wege: Kubitschek und Weißmann
Und wieder: Eurofaschismus
Linke Sozialwissenschaft
Exkurs: Ein Gespräch mit Kubitschek und Kositza über die Gewalt
Dem Bösen keine Bühne: Das Theater schafft sich ab
Verordnungsliberalismus
»Einreisestopp« im Maxim Gorki
Falk Richter und die AfD
Alte und neue Identitäten
Schluss: Das uneingelöste Versprechen von 1968
Zu Besuch in Odense
Der Front National und die soziale Frage
Die Rückkehr der »höfischen Sprache«
Die alten Fragen sind die neuen Fragen
Danksagung
Anhang
Anmerkungen
Literatur
Personenregister
Impressum
Einleitung: Wer sind hier eigentlich die Nazis?
Herbst 2015. Eine Kundgebung in Berlin. Im Osten der Hauptstadt. Nicht weit vom Roten Rathaus. Die Straße Unter den Linden ist gesperrt. Demonstranten verteilen Blumen. Ergraute Langhaarige sind darunter, Rentner-Ehepaare, Männer in Motorradkluft, auch ein paar St.-Pauli-Fans. »Keine Gewalt«, tönt es von der Rednertribüne. Die Demokratie sei gefährdet, hört man hier und da. Die Frau werde im Islam unterdrückt. Und immer wieder: Merkel muss weg. Hinter der Polizeiabsperrung eine in Schwarz gekleidete Menge, junge Gesichter, manche vermummt. Drohgebärden in Richtung der Blumenkinder in fortgeschrittenem Alter. Die setzen sich zur Wehr, bilden Sprechchöre. »Nazis raus! Nazis raus!«, rufen sie den Gegendemonstranten zu. Aber wer sind hier eigentlich die Nazis? Wer die Guten, wer die Bösen? Die Touristen vor der Filiale der Coffee-to-go-Kette, in der ich gerade mein Frühstück verzehrt habe, sind irritiert. Man klärt sie auf: Die militanten Jungen sind von der Antifa, also Linke. Die Alten mit den Blumen von der AfD, also Rechte. Die Verwirrung hat einen Grund: Die politische Rechte greift auf Sprüche und Aktionsformen zurück, die man seit den Tagen der Achtundsechziger-Studentenrevolte vor allem mit der Linken in Verbindung bringt.
Besonders beliebt sind gezielte Provokationen. Sie gehörten zur Strategie der Antiautoritären. Das dahintersteckende Kalkül: Der verunsicherte Staat reagiert über und entlarvt sich dadurch selbst als ein repressives Regime. Je mehr Wirbel dabei entsteht, desto mehr potenzielle Anhänger werden über die Massenmedien erreicht. Die Selbstinszenierung als Bürgerschreck gehörte für Rudi Dutschke und die Akteure der Außerparlamentarischen Opposition (APO) dazu.
Heute sind es rechte Gruppierungen, wie die Identitäre Bewegung, die sich in ihren Fußstapfen bewegen. Ob sie den Zugang zur CDU-Bundeszentrale vorübergehend mit einer Sitzblockade versperren, das Brandenburger Tor erklimmen oder Veranstaltungen in renommierten Theatern stören: Die Aktionen der Identitären schockieren viele Zeitgenossen. Und wieder kommt es zu den erwünschten Überreaktionen der etablierten Institutionen. Es ist wie ein Déjà-vu. Nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Heute sind es nicht mehr elitäre Kulturkonservative, sondern egalitär gesinnte Linksliberale, die auf den alten Sponti-Trick hereinfallen. Nehmen wir das Maxim Gorki Theater in Berlin. Nach einer Störaktion durch eine Gruppe Identitärer, bei der es weder zu Sach- noch zu Personenschäden kam, eröffnete die Intendanz im Herbst 2016 seinen potentiellen Besuchern aus »der rechtsextremen Szene« mittels einer Banneraufschrift, man behalte sich vor, sie auf der Grundlage des »Hausrechts« hinauszukomplimentieren. Ein wenig klingt das wie: »Rasen betreten verboten.«
Das Theater, kritisierte Michael Wolf auf dem Kulturportal Nachtkritik, agiere wie ein »Stammtisch bürgerlicher Selbstvergewisserung«, von dem die »Schmuddelkinder« ausgeschlossen bleiben.1 Letztere dürften sich ins Fäustchen gelacht haben. »Den 68ern schmeckt ihre eigene Medizin offenbar überhaupt nicht«, wurde in einem Video der Identitären Bewegung Österreich die öffentliche Empörung über eine andere ihrer »ästhetischen Interventionen«2 kommentiert. Je mehr sich die dem eigenen Anspruch nach plurale Öffentlichkeit nach rechts hin schließt, desto effektiver scheinen die von den Achtundsechzigern und ihren Adepten erprobten Methoden der Spaßguerilla und der Provokation zu greifen. »Überraschend viele Techniken der politischen Auseinandersetzung entstammen dem Repertoire der Achtundsechziger-Bewegung: der Tabu- und Konventionsbruch, die Aggressivität in der Auseinandersetzung, die Unbedingtheit in der Position, die eigene Publizistik mit eigenen Verbreitungswegen«,3 schreibt Matthias Drobinski in der Süddeutschen Zeitung: »Nur dass der Pflasterstrand jetzt Compact heißt und seine Leser nicht in der Szenekneipe findet, sondern im Internet – und nicht mehr Fritz Teufel vor dem Richter erst mal sitzen bleibt, sondern Björn Höcke in der Talkrunde seine Deutschlandfahne über die Sessellehne hängt. Und aus dem Kampfbegriff ›faschistisch‹ ist der Kampfbegriff ›links-rot-grün-versifft‹ geworden, den der AfD-Vize Jörg Meuthen im baden-württembergischen Wahlkampf mit großem Erfolg verwendet hat.« Gestandene rechtskonservative Politiker und Professoren rennen gegen das Establishment an. 50 Jahre zuvor waren es noch linke Studenten.
Was 1968 war
Am Sonntag, dem 18.Februar 1968, machten sich etwa 12 000 Gegner des Vietnamkriegs auf den Weg zur Deutschen Oper in Berlin. Sie hakten sich in Ketten unter. Rhythmische Sprechchöre skandierten »Hồ-Hồ-Hồ Chí Minh«. Einzelne Blocks stürmten im Laufschritt voran.4 Tags zuvor hatte im Audimax der Technischen Universität der Internationale Vietnam-Kongress getagt. Den circa 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ging es dabei nicht um die Erörterung theoretischer Fragen, sondern um die Demonstration einer aktiven politischen Solidarität mit dem Kampf der Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams – dem Vietcong – gegen die Truppen der USA. Am Ende verabschiedeten sie ein Aktionsprogramm, in dem zur Zerschlagung der NATO, zur materiellen Unterstützung der Befreiungsbewegung, zur Desertion US-amerikanischer Armeeangehöriger sowie zu Sabotageaktionen gegen den militärischen Nachschub aufgerufen wurde. Zu den Rednern des Kongresses zählen der britische Autor und Filmemacher Tariq Ali, der italienische Verleger Giangiacomo Feltrinelli, der trotzkistische Wirtschaftswissenschaftler Ernest Mandel, die Schriftsteller Bahman Nirumand, Gaston Salvatore sowie Erich Fried und Peter Weiss.
Prominente europäische Intellektuelle von Michelangelo Antonioni über Herbert Marcuse, Pier Paolo Pasolini, Ernst Bloch, Hans Magnus Enzensberger, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre bis zu Luchino Visconti erklärten sich mit den Zielen der Veranstalter solidarisch.5 Es ging gegen den Imperialismus, dessen aggressive Natur in den Studien von Wladimir Iljitsch Lenin, Rosa Luxemburg und Nikolai Iwanowitsch Bucharin offengelegt worden war. Die angepasste und karriereorientierte Jugend der Nachkriegszeit6 war durch eine Generation abgelöst worden, die sich dem politischen Protest verschrieben zu haben schien. Was aber bewegte die studentische Jugend von 1968?
An erster Stelle stand die Solidarität mit den Befreiungsbewegungen ehemaliger westlicher Kolonien. Was in Kuba, Vietnam, Algerien, im Trikont geschah, erschien vielen als Auftakt der erhofften Weltrevolution. Schüler, Lehrlinge und Studenten begehrten auf gegen Autoritäten in Betrieb, Schule und Behörden, gegen eine rigide Sexualmoral und Erziehungsmethoden, die damals vielerorts noch mit körperlicher Züchtigung verbunden waren. Die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde gefordert. Frauen, Schwule und Lesben begannen für ihre Interessen zu kämpfen. Studenten setzten sich ein für Hochschulreformen, die eine größere Beteiligung des akademischen Nachwuchses an der Selbstverwaltung der Universitäten und der Gestaltung der Lehrinhalte ermöglichen sollten. Der Leitspruch hieß: »Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren«. Hinzu kam die Auseinandersetzung mit den Verbrechen, die vom Naziregime begangen wurden. Die Angehörigen der Elterngeneration, die sich zumeist über ihre eigene Rolle im Faschismus ausschwiegen, wurden mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Die Studenten machten Schluss mit der Sprachlosigkeit, die unter den Angehörigen der Kriegsgeneration hinsichtlich des Dritten Reichs herrschte. Da jeder von dem Dreck wusste, den der andere am Stecken hatte, hatte man sich über die Naziherrschaft ausgeschwiegen. »Die Verdrängungen der Vergangenheit wurden öffentlich gemacht, die Leichen der NS-Zeit aus dem Keller der neuen Republik geholt. Erst mit den 68ern brach ein gesellschaftlicher Graben auf, der bis heute nicht zugeschüttet wurde«,7 meint der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Ein wichtiger Faktor für die Mobilisierung von Unterstützern war die weitverbreitete Ablehnung der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD unter der Kanzlerschaft des ehemaligen NSDAP-Mitglieds Kurt Georg Kiesinger. Es ging gegen die Einschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses durch die Notstandsgesetze, den geplanten Einsatz der Bundeswehr im Inneren und einen Kapitalismus, der die globale Ungleichheit verschärfte und immer mehr Lebensbereiche dem Diktat der Kommerzialisierung auszusetzen drohte.
Die Linken antworteten darauf mit der Forderung, die Wirtschaft zu demokratisieren. Privates Eigentum sollte öffentlich werden, die ökonomische Planung sich nicht mehr am Eigennutz, sondern am Gemeinwohl orientieren. Eine wirkliche Partizipation breiter gesellschaftlicher Schichten, so glaubte man, ließe sich nur in einer sozialistischen Gesellschaft verwirklichen. Die allerdings sollte anders aussehen als in der DDR: basisdemokratisch, ohne Gängelung durch eine Partei, die im Zweifel immer recht hatte. Die Saat hierfür glaubte man schon im Hier und Jetzt pflanzen zu können. Kinderläden und Kommunen entstanden. Eine beachtliche Gegenkultur bildete sich heraus. Ein Netzwerk linker Verlage, Buchhandlungen, Kneipen, Bands, Kinos usw.
Man gab sich nonkonform. Die sogenannten guten Manieren, Pünktlichkeit und fraglose Arbeitsdisziplin gerieten in Misskredit. Das Unkonventionelle in Kleidung und Lebensgewohnheiten, die Suche nach dem Echten und Ursprünglichen sowie die Überwindung künstlicher Grenzen wurde betont. Was nach bürgerlichen Maßstäben verurteilt wurde, galt als chic.8 Mit dem sprunghaften Anstieg der Studentenzahl, die auf das Bedürfnis der zunehmend technisierten Wirtschaft nach wissenschaftlich ausgebildeten Arbeitskräften zurückzuführen ist, hatte der Nonkonformismus die Chance, in breitere Schichten hinein zu wirken.9 Lebensmodelle, die zuvor in den Nischen der bürgerlichen Gesellschaft von kleinen Avantgarde-Bewegungen erprobt worden waren, wurden auf diese Weise populär. Das Leben in einer Wohngemeinschaft – heute als praktischer Behelf und als Lebensmodell weithin akzeptiert – war anfangs ein Skandal.
Von den Achtundsechzigern war zu dieser Zeit allerdings noch nicht die Rede. Das Wort existierte weder als Eigen- noch als Fremdbezeichnung. Die Akteure sahen sich nicht als Generationsgemeinschaft. Sie wollten ihren politischen Aufbruch nicht als Jugendrevolte gegen die ältere Generation, sondern als ersten Schritt in Richtung einer wirklichen Revolution verstanden wissen. Die Bezeichnung Achtundsechziger geht auf einen Kursbuch-Artikel von Klaus Hartung vom Dezember 1978 zurück10 und wurde alsbald von Freund und Feind aufgegriffen. Seit dieser Zeit war jeder Kampf um die politisch-kulturelle Hegemonie in Deutschland aufs engste mit 1968 verknüpft.11 Der Kölner Schriftsteller Erasmus Schöfer hat in seinem rund 2000 Seiten starken Roman-Vierteiler »Die Kinder des Sisyfos« die Kämpfe und die Entwicklung dieser Generation von 1968 bis 1990 auf eine beeindruckende Weise nachgezeichnet. Er begleitet seine Hauptfiguren – einen Reporter, einen Historiker, eine Gewandmeisterin und einen Werkzeugmacher – auf den wichtigsten Stationen dieses Kampfes für mehr Demokratie und eine solidarische Gesellschaft: vom Protest gegen den Vietnamkrieg über die Anti-AKW-Bewegung, die Massenproteste der Friedensbewegung gegen die atomare Aufrüstung, den Kampf der Gewerkschaften für die 35-Stunden-Woche bis hin zu Widerstand der Stahlarbeiter gegen die Schließung der Stahlhütte in Rheinhausen.12 Der Mordanschlag auf Rudi Dutschke am 11.4.1968 wurde zum zündenden Funken der Revolte der aufgebrachten städtischen Jugend. Eine Schlüsselszene des ersten Bandes – »Ein Frühling irrer Hoffnung« – schildert eine unangemeldete Protestdemonstration vor dem Druckhaus des Verlags Axel Springer in München, die Ostern 1968 stattfand. Die Studenten skandierten »Heute Rudi, morgen wir«. Sie gaben der Berichterstattung von Zeitungen aus diesem Hause eine Mitschuld am Hass gegen die Linke, der sich in der brutalen Gewalttat entlud.
Kampf um Deutungshoheit
Es war auf dem Höhepunkt der »Enteignet Springer!«-Kampagne, als sich einige Angehörige des Rings Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) in die Mensa der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität setzten und dort demonstrativ die Bild-Zeitung lasen. Einer von ihnen war Peter Gauweiler. Der spätere bayerische Minister und stellvertretende CSU-Vize war damals Jurastudent und Vorsitzender des RCDS. »Gauweiler, das geht entschieden zu weit!«, schimpften seine Gegner vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) damals. »So was freut einen natürlich«,13 erinnert sich der Politikveteran, der sich selbstironisch schon mal als »alten reaktionären Knochen« bezeichnet.14 Seinen politischen Kontrahenten von damals will er im Nachhinein jedoch einen gewissen Respekt nicht verwehren. »Ihre Unverschämtheiten waren immer auch Transportmittel der Wahrheit«,15 bekannte er im Rückblick. Manch demonstrativer Verstoß gegen die Tanzstunden-Etikette von damals habe auch etwas Erfrischendes gehabt. Man sei ab und zu gemeinsam im Mutti-Bräu in Schwabing ein Bier oder im Hahnhof einen billigen Rotwein trinken gegangen. Mit Fritz Teufel habe ihn eine lustige Gegen-Kameradschaft verbunden, ohne dass es in politischer Hinsicht einen Kuschelkurs gab. Gauweilers altersmilder Rückblick ist nicht unbedingt typisch für die Sicht des rechtskonservativen Lagers auf die Studentenbewegung. Man warf den Achtundsechzigern von Anfang an vor, für alles verantwortlich zu sein, was in der gegenwärtigen Gesellschaft schiefläuft. Sie hätten den Nachgeborenen eine »wertelose Gesellschaft« hinterlassen.16 Hierher rührten Kriminalität, Schwangerschaftsabbrüche, Ehescheidungen, Kriegsdienstverweigerungen, Kirchenaustritte, das Aufkommen von Psycho-Sekten, Drogenmissbrauch, Linksterrorismus, Leistungsverweigerung und die Bildungsmisere.17
Der »von nahezu religiösen Hoffnungen getragene emanzipatorische Aufbruch der Studentenbewegung und weiter Teile der Jugend« sei gescheitert, bilanzierte der katholische Philosoph Günter Rohrmoser18 gut 15 Jahre nach der Revolte. Linke Intellektuelle, schrieb der konservative Soziologe Helmut Schelsky schon Mitte der siebziger Jahre, zerstörten durch das ständige und schrankenlose In-Frage-Stellen von allem und jedem altbewährte Institutionen, ohne neue Bindungen zu schaffen, die über die Einrichtung einer Dauerreflexion hinausreichten. Er warf den kritischen Intellektuellen im Gefolge der Frankfurter Schule vor, als Meinungsbildner in den Medien eine neue Form der Priesterherrschaft auszuüben. Die eigentlichen Machthaber seien nicht mehr Kapitalisten aus dem Hause Krupp, Thyssen oder Flick, sondern Schriftsteller wie Heinrich Böll und Günter Grass oder Wissenschaftler wie Herbert Marcuse, Alexander und Margarete Mitscherlich.19 Das war zwar hanebüchener Unsinn, bestätigte jedoch das Unbehagen, das viele Konservative verspürten, wenn sie zu dieser Zeit vermehrt gesellschaftskritische Töne aus Funkhäusern und Redaktionen vernahmen. Als die Protestbewegung der Studenten, Schüler und Lehrlinge an den Grundfesten der bundesrepublikanischen Gesellschaft zu rütteln begann, waren Schelsky und viele seiner Kollegen in hohem Grade alarmiert. In der studentischen Presse, den Diskussionen und auch in der Begegnung von Professoren und Studenten breitete sich ein Ton aus, »den man kaum anders als aggressiv, rüde, erbittert bis zur Bosheit, herrisch, in extremen Fällen als vulgär und bedrohlich bezeichnen muss«,20 klagte der Soziologe Wilhelm Hennis, Jahrgang 1923. »Erschüttert über das blindwütig Emotionale jener Radikalen«21 zeigte sich der 1908 geborene protestantische Theologe Helmut Thielicke in seiner 1969 veröffentlichten »Kulturkritik der studentischen Rebellion«. Er »habe sie nur im Kollektiv, gleichsam in Sprechchören, erlebt, kaum als einzelne«.22 Eine »Vergewaltigung des Mitmenschen aus Gesinnung« warf Erwin K.Scheuch den Studenten vor. Er charakterisierte den Protest 1968 als eine von den Massenmedien unterstützte Erweckungsbewegung.23 Der Religionshistoriker Hans-Joachim Schoeps sprach gar von »bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen an den Universitäten«.24 1933 hatte er national gesinnte Juden mit Hilfe des von ihm gegründeten Vereins Der deutsche Vortrupp in das Naziregime integrieren wollen,25 nun mobilisierte er zum Kampf gegen »die rote Spielart des Faschismus«.26 Wenn die Bundesrepublik vor einer Politik der Härte gegenüber der jungen studentischen Generation zurückscheue, werde »in Deutschland noch viel Blut fließen«.27 Um das Hereinbrechen des Chaos zu verhindern, wollte er »die Reste bestehender Ordnung mit allen Mitteln« verteidigen.28
Deutlich weniger militant gab sich der Soziologe Helmut Schelsky, der in jungen Jahren – ebenso wie Schoeps und Arnold Gehlen – mit der faschistischen Ordnung sympathisiert hatte. Er gehörte zu jenen Professoren, die zur Zielscheibe eines studentischen Protests wurden. Er und seine Familie hätten mehrere Jahre lang unter anonymen Telefonanrufen und Beschimpfungen übelster Art gelitten, erinnert sich der Hochschullehrer.29
Auch unter den ehemaligen Protagonisten der »deutschen« Kulturrevolution gab es – mit größerem Abstand zum historischen Geschehen – einige, die im Rückblick kaum noch ein gutes Haar am Aufbruch der linken Jugend lassen wollten. Die Revolte sei der Beginn eines »roten Jahrzehnts« gewesen,30 so Gerd Koenen. Dieses, so glaubte manch ein Beobachter, mündete mit beinahe unausweichlichen Konsequenzen in den RAF-Terror des Jahres 1977.31 Dabei war es die Staatsgewalt, die dem Bedürfnis der studentischen Bewegung nach gesellschaftlichem Engagement und demokratischer Partizipation zunächst mit massiver Gewalt begegnete. Ein Schlüsselereignis war die Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg während einer Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien am 2.Juni 1967 durch den Polizisten Karl-Heinz Kurras.
Der Historiker Götz Aly bewertete die Studentenrevolte in einem insgesamt wenig überzeugenden, allerdings erfrischend polemisch verfassten Essay als »Spätausläufer des Totalitarismus«32 mit einer ganzen Reihe brauner Flecken. Hierzu zählte er den Bewegungscharakter, die Ablehnung von Pluralismus und Parlamentarismus sowie den Antiamerikanismus. Hinter der damals weitverbreiteten Hoffnung auf mehr Partizipation durch eine Rätedemokratie witterte er das »Bedürfnis nach zukunftsängstlicher Regression« in die »Kuhwärme« überschaubarer Gemeinschaften.33 Koenen und Aly, beide selbst ehemals Protagonisten der linksradikalen Kulturrevolution, setzten ihre Lesart von 1968 gegen ein Narrativ, das sich nach 1988, dem zweiten großen Jubiläum, durchgesetzt hatte.
Viele Achtundsechziger waren zu diesem Zeitpunkt bereits in der bürgerlichen Gesellschaft angekommen. Sie hatten gut bezahlte Jobs, bekleideten leitende Positionen in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur. Von der Idee einer sozialistischen Revolution hatten sich die meisten längst verabschiedet. Sie betrachteten sich aber nicht als gescheitert, sondern verbuchten die nicht zu bestreitende »Fundamentalliberalisierung« der bundesrepublikanischen Gesellschaft auf ihr Konto. 1968 stand nun für den Beginn eines breiten gesellschaftlichen Demokratisierungsprozesses, aus der Frauen-, Friedens- und Umweltbewegungen hervorgegangen waren. »Im bürgerlichen Feuilleton, das immer mehr durch Angehörige der 68er-Generation besetzt wurde, war ›68‹ zum Synonym für die kulturelle Verwestlichung geworden, für die Übernahme demokratischer Spielregeln und deren Ausübung. Erst die Revolte schien aus dem vormals autoritär-hierarchischen Obrigkeitsstaat eine moderne, zivilisierte Demokratie gemacht zu haben.«34 Die Achtundsechziger, meint Albrecht von Lucke, machten sich die Bundesrepublik in einem Akt der politischen Selbstermächtigung zu eigen. Insofern könne man ihr Tun tatsächlich als zivilgesellschaftliche Um- oder Neugründung der Bundesrepublik bezeichnen.
Im Hinblick auf den Kapitalismus, den sie ja überwinden wollten, erreichten sie jedoch das genaue Gegenteil. Sie trugen zu seiner Modernisierung bei. Ein Unvermögen, die bestehenden Machtverhältnisse tatsächlich grundlegend verändern zu können, wurde der aufmüpfigen studentischen Jugend bereits 1968 von Caspar von Schrenck-Notzing attestiert. Ausstaffiert mit dem reichen symbolischen und ideologischen Fundus vergangener Klassenkämpfe, erschöpfe sich der Schulterschluss mit dem Proletariat im revolutionären Rollenspiel. »Wer die rote Fahne schwingt, wird dadurch so wenig zum Proletarier wie zum Sadhu wird, wer ein Krishna-Poster an die Wand hängt«,35 urteilte der Schriftsteller, der in den sechziger Jahren für Nation Europa, die National-Zeitung, aber auch für den Bayernkurier, also die Parteizeitung der CSU, schrieb. Die Träger der studentischen Revolte begriff er als eine nach Macht strebende Schickeria, als »schicke Linke«,36 deren ökonomische Grundlage und ideologische Hauptbetätigung im kulturellen Dienstleistungssektor, in Funk und Fernsehen, zu suchen sei. Die von ihr gemeinte Revolution sei »eine Art Lockerungsübung«,37 die Solidarität mit der »Dritten Welt« allenfalls dazu geeignet, die Bartmoden umzuwälzen.38
Ganz ähnlich sah es der griechische Philosoph Panajotis Kondylis. Wer 1968 nach unmittelbarer Selbstverwirklichung strebte, so lautet sein Argument, mag sozialistische Ideen im Kopf gehabt haben. In Wirklichkeit hätten die rebellierenden Studenten gerade dadurch die Durchsetzung einer restlos kommerzialisierten Gesellschaft unterstützt. Deren erstes Gebot lautet, dass »hier und jetzt konsumiert werden kann und soll«.39
Der Wunsch, jederzeit alle Bedürfnisse verwirklichen zu können, korrespondiert mit einer Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. Die ist bequem für die Konsumenten, verlangt aber von den abhängig Beschäftigten eine zunehmende Flexibilität, die oft alles andere als selbstbestimmt ist. Der Kommunismus der Freien, wie er der Protestbewegung 1968 vorgeschwebt haben mag, verwandelte sich in eine Freiheit ohne Kommunismus. Der Absatz von Stereoanlagen, Motorrädern und Fernreisen wuchs dabei stetig, der Niedriglohnsektor auch. Selbst die Verweigerung gegenüber dem Leistungsprinzip fand ihren Niederschlag in der Verwertungsmaschinerie, indem die Arbeitsprozesse »humaner« und »kreativer« gestaltet wurden. »Das Team duzt den Chef und verteilt die Aufgaben autonom, aber die Arbeitszeit wächst unaufhaltsam«,40 schloss sich der Achtundsechziger Frank Böckelmann der Deutung von Kondylis an. Insofern die Veteranen von 1968 und ihre Adepten diesen Prozess beschleunigten, »können sie heute von sich sagen, auf ihrer Laufbahn durch die Institutionen die gesellschaftliche Hegemonie errungen zu haben. Aber eben nicht als Revolutionäre und nicht als Linke.«41
Klar ist, dass Forderungen, die mit der Überwindung oder auch nur mit der wirksamen Einhegung des Kapitalismus in Verbindung standen, auf der Strecke blieben. Weder ist die im Zuge der Bildungsexpansion der siebziger und achtziger Jahre erhoffte offene Gesellschaft mit Aufstiegschancen für alle entstanden,42 noch haben sich die Einkommensverhältnisse angeglichen. Und während die Achtundsechziger in jungen Jahren gegen imperialistische Kriege demonstrierten, ließen sie als Politiker der SPD-Grünen-Regierung im Jahre 1999 die jugoslawische Hauptstadt Belgrad bombardieren und schickten die Bundeswehr nach den Anschlägen vom 11.September 2001 nach Afghanistan. Das ständig neue Ungleichheit produzierende System kapitalistischer Herrschaft sitzt fest im Sattel. Von einem demokratischen Sozialismus scheint die Bundesrepublik 50 Jahre danach weiter entfernt als je zuvor.
Das Pendel schlägt zurück
Das ist der Hintergrund, vor dem sich derzeit erneut eine Kulturrevolution abzeichnet. Wieder geht es gegen das liberale Establishment. Diesmal kommt der Impuls jedoch nicht von links, sondern von rechts. »Das Anti-1968 ist da«, verkündete Wolfram Weimer, der Verleger des Magazins The European, in einem Artikel über die gegenwärtige konservative Revolte. »Das große Pendel der Geistesgeschichte schlägt schlichtweg zurück – eine Bruchlinie wie 1968, nur eben nicht von links, sondern von rechts tut sich auf. Die Tiefe dieser Bruchlinie erkennt man daran, dass sie alle westlichen Staaten gleichermaßen erfasst, dass sie zum Achsbruch herkömmlicher Volksparteien führt, dass sie alle kulturellen Bereiche erfasst – bis hin zum Retro-Trend unserer Konsumwelten.«43 Die heutigen Rechten, schreibt Matthias Drobinski, seien »kompatibel mit dem Internetzeitalter«44 und könnten »den Vorwurf schnell widerlegen, sie wollten Adolf Hitler zurück«. Auch haben sie die Ideen von 1968 nicht unberührt gelassen. Wer heute nach mehr direkter Demokratie ruft, auf die Meinungsmacht von Presse, Funk und Fernsehen schimpft, die Kriege des Westens verurteilt, das politische Establishment verdammt, sich religionskritisch äußert (gegenüber dem Islam) oder die Durchsetzung von Frauenrechten fordert, gibt sich nicht selten als Anhänger von Pegida oder AfD zu erkennen. Auch die Gestalt des engagierten Schriftstellers, die vom Feuilleton – zu Unrecht – für gänzlich tot erklärt worden war,45 wurde von rechts vereinnahmt. Seine Kollegen sollten künftig gegen die Political Correctness kämpfen und für die Freiheit eintreten, »die Dinge anders zu sehen«,46 forderte der Schriftsteller Thor Kunkel bereits 2009.
Wer sich politisch rechts verortete, stilisierte sich zum Nonkonformisten. Was für die radikalen Studenten die »Springer-Presse« war, dass seien die »Mainstream-Medien« für die Wutbürger von Dresden und anderswo, kommentierte Alan Posener am 17.1.2015 in der Welt. Ein halbes Jahrhundert später wird deutlich, dass 1968 auch für das konservative Lager einen Bruch bedeutete, der bis heute nachwirkt. Ein rechter Historiker wertet die Kulturrevolution sogar als »Hauptaktivator« für sein Milieu. In der Zeit vor 1968 habe dieses sich kaum entfalten können, »weil der konservativ-autoritäre Regierungsstil Konrad Adenauers einen politischen und gesellschaftlichen Rahmen schuf, der derartigen Bestrebungen den Wind aus den Segeln nahm«, schreibt Sebastian Maaß. »Es ist deshalb nicht falsch, die Studentenrevolte als Geburtsstunde einer nun öffentlich wahrnehmbaren Neuen Rechten zu interpretieren.«47
Als die Neue Linke ihren Marsch durch die Institutionen begann, wollte man ihr etwas Vergleichbares entgegensetzen.48 Dass von Seiten der AfD Bezüge auf die Achtundsechziger stärker sind, als es die demonstrative Abwehr durch die Parteiführung zunächst Glauben macht, meint der Historiker Michael Wildt.49 Er macht darauf aufmerksam, dass die vom APO-Theoretiker Johannes Agnoli in seiner 1967 gemeinsam mit Peter Brückner publizierten Schrift »Die Transformation der Demokratie« formulierte Kritik am Repräsentationsprinzip des Parlamentarismus viel mit dem in der Rechten breit rezipierten Schrift »Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus« (Carl Schmitt) aus dem Jahr 1923 gemeinsam hat. Zum Erstaunen vieler Linker, so Wildt, lautet die Antwort der AfD auf die Krise der Repräsentation: mehr direkte Demokratie. Dass die Parallelen der linken Bewegung von 1968 und die heutige Revolte von rechts mit ähnlichen Strukturen der politischen Landschaft zusammenhängen könnten, macht der Politikwissenschaftler David Bebnowski plausibel. Jeweils formierte sich die oppositionelle Bewegung gegen eine Große Koalition in der Bundesregierung. In den sechziger Jahren war es die SPD, die sich von einer Arbeiterpartei in eine Volkspartei verwandelt und in diesem Zuge linkes Terrain freigegeben hatte. Heute ist es die CDU, die spätestens mit der Kanzlerschaft Angela Merkels vielen Konservativen keine Heimat mehr bietet und Raum für die Entstehung einer Partei rechts von ihr gelassen hat.50 Auch der linke Historiker Volker Weiß sieht Parallelen, die eine Interpretation der Neuen Rechten als ein »68 von rechts« nahelegen. Der linke Zeitgeist habe sich besonders in der nationalrevolutionären Strömung niedergeschlagen, die von den gleichen Geburtsjahrgängen getragen wurde.
Allerdings betont er, dass es »immer auch inhaltliche und personelle Brücken zur alten Rechten und insbesondere zum Kanon der Zwischenkriegszeit«51 gab. Das stimmt. Fehl geht er jedoch, wenn er behauptet, die These von der Neuen Rechten als einem »68 von rechts« könne bestenfalls »den jugendlichen Elan und einige Veränderungen im Auftreten erklären«, sonst aber »keine tiefere Erkenntnis«52 liefern. Das Gegenteil ist der Fall. Auf das veränderte Auftreten kommt es gerade an. Denn das sorgt dafür, dass bewährte Kampfmittel »gegen rechts« zunehmend ins Leere laufen. Leute, die sich als Nazi-Gegner darzustellen wissen und nach mehr Bürgerbeteiligung rufen, lassen sich schwerlich als Anhänger einer faschistischen Diktatur stigmatisieren. Wer das versucht, beschädigt die eigene Glaubwürdigkeit. Umgekehrt verfügen die Rechten mittlerweile über eine Reihe von intelligenten, taktisch versierten und strategisch klugen Köpfen, die das politische Instrumentarium der Linken zu bedienen verstehen, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Selbst ein bieder auftretender AfD-Politiker wie der Berliner Landesvorsitzende Georg Pazderski scheut nicht davor zurück, seiner Partei Provokationen und Tabubrüche als probate Wahlkampfmittel zu empfehlen. Die anderen Parteien sollten dadurch zu nervösen und unfairen Reaktionen verleitet werden. »Die AfD muss – selbstverständlich im Rahmen und unter Betonung der freiheitlich demokratischen Grundordnung unseres Landes – ganz bewusst und ganz gezielt immer wieder politisch inkorrekt sein, zu klaren Worten greifen und auch vor sorgfältig geplanten Provokationen nicht zurückschrecken«, zitierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 24.1.2017 aus dem 33-seitigen »AfD Manifest 2017«, das unter Pazderkis Federführung entstand.
Im Verlaufe meiner Recherche zu diesem Buch habe ich exklusive Gespräche mit Vertretern verschiedener Generationen der Neuen Rechten geführt. Darunter sind der am 22. April 2017 verstorbene Kultursoziologe Henning Eichberg, der Verleger Götz Kubitschek, die Publizistin Ellen Kositza, der Wiener Identitären-Sprecher Martin Sellner sowie der französische Vordenker Alain de Benoist. Ich unterhielt mich mit dem Schriftsteller und früheren APO-Aktivisten Frank Böckelmann über seinen Weg von links nach rechts. Darüber hinaus sprach ich mit Künstlern und Wissenschaftlern über ihre Erfahrungen und Strategien im Umgang mit der Neuen Rechten. Deren Aktivisten bedienen sich theatralischer Mittel, um Aufmerksamkeit für sich und ihre Anliegen zu erzeugen. Sie sehen sich als Protagonisten einer Kulturrevolution von rechts. Aufschlussreich sind daher Überlegungen, die Theaterleute wie der Dramaturg Bernd Stegemann und der Dramatiker Falk Richter im Gespräch mit mir entfalteten. Dabei stellte ich mir die Frage, ob es tatsächlich eine gute Idee sei, rechte Intellektuelle vom politischen Diskurs auszuschließen, wie es immer wieder geschieht. Ist der offen geführte Streit nicht der viel bessere Weg, mit ihnen umzugehen? Diejenigen, die eine solche Auseinandersetzung in der Vergangenheit suchten, wurden dafür von links meist scharf kritisiert. So erging es dem Anarchisten und Umweltaktivisten Horst Blume, als er in den achtziger Jahren einen Gedankenaustausch mit Vertretern des nationalrevolutionären Zweigs der Neuen Rechten begann.
Im Zuge meiner Arbeit kristallisierte sich immer mehr heraus, wie wichtig 1968 für das sich aus vielen ideologischen Strömungen zusammensetzende rechte Lager tatsächlich war. Das historische Datum markiert den Beginn eines in sich widersprüchlichen Erneuerungsprozesses, der bis heute anhält. Die Revolte der linken Studenten löste eine tiefe Erschütterung aus, auf die das rechte Milieu auf zweifache Weise reagierte. Zum einen liegen hier die Wurzeln des heute in der AfD gepflegten Feindbilds des »links-grün-versifften Gutmenschen« oder des »Achtundsechzigers«. Zum anderen begannen junge Rechtsintellektuelle von den Aktionsformen und Themen der Neuen Linken zu lernen. Auch in ihren Reihen gab es nun antiautoritäre Positionen, begann man sich – in unterschiedlicher Intensität und Ernsthaftigkeit – für marxistische Analysen und antiimperialistische Strategien zu interessieren und sich ihrer zu bedienen. Einige ihrer Vertreter verstehen es heute, eine im neoliberalen Geist gefangene Sozialdemokratie mit linken Argumenten zu kritisieren.
Ohne Kenntnis dieses widersprüchlichen Verhältnisses der Rechten zur Studentenbewegung und ihren gesellschaftlichen Folgen lässt sich das Denken und das Handeln der heute in der Identitären Bewegung oder im Umfeld der AfD wirkenden Vertreter der Neuen Rechten nicht adäquat verstehen. Nur wer begreift, wie die Akteure wirklich denken, ist in der Lage, angemessen auf ihre Provokationen zu reagieren. Fest steht: 1968 ist nicht nur die Geburtsstunde einer neuen Linken jenseits der Sozialdemokratie, sondern auch die einer Neuen Rechten. Dieses Buch erzählt, wie es dazu gekommen ist.
Konservatismus in der Defensive: Arnold Gehlen
In der Kaiserstadt Aachen kam der Studentenprotest erst spät an. Es war schon 1969, als sich fünf junge Leute, drei Männer und zwei Frauen, in das Seminar des Soziologen Arnold Gehlen begaben. Die Räumlichkeiten befanden sich gegenüber dem Hauptgebäude der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH), im fünften Stock. Sie setzten sich auf die freien Plätze der vorderen Tischreihe. In dem Moment, als der Professor ansetzte, mit seinen Ausführungen zu beginnen, meldeten sie sich zu Wort. Sie kämen aus Frankfurt am Main und wollten über Gehlens Buch »Der Mensch« sprechen. Genauer: über die erste Auflage der Schrift, die als Standardwerk der Philosophischen Anthropologie in der Wissenschaft noch heute hoch gehandelt wird.
Das Buch war 1940 bei Junker und Dünnhaupt erschienen, einem Verlag, der 1945 aufgrund seiner Nähe zum Naziregime von den Alliierten verboten wurde. Sein Autor war NSDAP-Mitglied seit dem 1.Mai 1933. Begeistert vom nationalistischen Aufbruch – aber auch aus Karrieregründen – betätigte er sich in Parteigliederungen und beabsichtigte sogar eine Philosophie des Nationalsozialismus zu schreiben. In einem Bericht des NS-Sicherheitsdienstes wurde Gehlen, wie auch sein Freund und Schüler Helmut Schelsky, als einer der wenigen überzeugten Nationalsozialisten geführt. Die Loyalität zum Regime hielt bei ihm bis zum Kriegsende an. Das werden die angereisten jungen Leute im Detail nicht gewusst haben. Dennoch waren sie gut vorbereitet. Sie referierten jene Passagen, in denen Gehlen der Diktion des rassenideologischen Nazi-Vordenkers Alfred Rosenberg (1893 bis 1946) folgte. Es fielen Begriffe wie »Zuchtbild«, von der »Durchsetzung germanischer Charakterwerte«53 war die Rede, von »obersten Führungssystemen«. Gehlen hörte sich den Vortrag dem Augenschein nach ungerührt an.
Als er sein Buch überarbeitete, er tat es mehrfach, entfernte er solche Stellen stillschweigend. »Die Grundformel von Gehlens Ordnungstheorie war ganz eindeutig an das damals herrschende System adressiert gewesen«, erläutert mir Karl-Siegbert Rehberg.54 Ich sitze mit dem Herausgeber der Gehlen-Gesamtausgabe an einem mit Büchern und Schreibmaterialien beladenen Tisch in seinem Büro an der Technischen Universität Dresden. Damals gehörte der heutige Seniorprofessor für Soziologie zu den Aachener Studenten, die atemlos lauschten, als ihre engagierten Kommilitonen den konservativen Hochschullehrer mit seiner faschistischen Vergangenheit konfrontierten.
Rehberg, der sich zu dieser Zeit vor allem für die Schriften von Karl Marx und Theodor W.Adorno begeisterte, war zugleich von der geistigen Substanz Gehlens fasziniert. »So hatte ich mir einen Professor vorgestellt, so scharfsinnig, vor einem solchen Bildungshintergrund. Politisch war ich aber von Anfang an ganz entsetzt von dem Mann«, erläutert er. Er habe gedacht: »Wie kann der solche Meinungen haben, wenn er doch so scharfsinnig ist.«
In »Der Mensch« stellt Gehlen die grundlegende Frage nach der Stellung des Menschen in der Welt. Die Kurzfassung lautet: Arm an Instinkten, ist der Mensch von Geburt an auf Institutionen angewiesen, die ihm dabei helfen, die chaotisch auf ihn einströmende Flut von Eindrücken und Anforderungen zu ordnen. Sie entlasten ihn von der Aufgabe, immer wieder neue, reflektierte Entscheidungen treffen zu müssen. Der in der DDR ansässige Philosoph Wolfgang Harich war begeistert. Er hoffte, Gehlens Theorie in den Marxismus integrieren zu können. Ihn verband über die ideologischen Grenzen hinweg viele Jahre lang eine Art Brieffreundschaft mit Gehlen.55
Der Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein hielt den Konservativen »für den interessantesten Demokratieverächter in Deutschland.« (Der Spiegel 16/2016, S. 118) Sein Versuch, mit Gehlen ein Gespräch für sein Magazin zu führen, schlug aber fehl. Auch einen Essay wollte der Hochschullehrer nicht beisteuern. »Mein Einwand gegen die Spiegel-Linie überhaupt lässt sich in die Worte fassen: Ferment der Dekomposition«,56 brachte er seine Ablehnung gegen das zu dieser Zeit außerordentlich einflussreiche Blatt zum Ausdruck. Legendär sind die Streitgespräche, die Gehlen mit Adorno führte. Dieser ging immer wieder auf Gehlen zu, der nicht viel, und wenn, dann eher abschätzig von Adorno geredet habe. In seinen Seminaren kam er nicht vor. Er habe seinen linken Opponenten privat gelesen und das auch nicht besonders gründlich, erinnert sich Rehberg. Im Grunde habe er dessen Theorie nur oberflächlich gekannt. »Was er über Adorno sagte, war ohne Verständnis für dessen Werk. Gehlen kannte die wichtigen Arbeiten Adornos gar nicht richtig. Umgekehrt war es genauso. Die Sensibilität und Ängstlichkeit von Adorno, auch seine Hinterhältigkeit und Intriganz – dieser hatte die Berufung des rechten Hochschullehrers auf eine Professur in Heidelberg hintertrieben – sind Gehlen vollständig verschlossen geblieben.« Verbunden habe die beiden »ihr Hochmut gegenüber den Massen, den Angepassten in einer vom Sinnverlust geprägten, nur noch funktionalen Gesichtspunkten folgenden, verwalteten Welt«, so Rehberg. Dass er zuletzt auf Distanz zu seinem linken Kontrahenten ging, habe sicher mit der Studentenbewegung zu tun gehabt, von der Gehlen abgestoßen war. Er führte sie auf das Wirken Adornos und seinen Kollegen von der Frankfurter Schule zurück.
Nun erreichte der Aufruhr also auch die Aachener Provinz. Rehberg fand die Ausführungen seiner Frankfurter Kommilitonen über die nachträglichen Eingriffe seines Professors in sein Hauptwerk hochspannend. Er sei sich zuvor gar nicht darüber im Klaren gewesen, dass wissenschaftliche Bücher mehrere, inhaltlich voneinander abweichende Auflagen haben können, erinnert er sich. Als die Studenten zum Ende ihrer Ausführungen gekommen waren, stand eine Frage im Raum: Was würde Gehlen nun tun? Weggehen? Die Gruppe hinausschmeißen? Die Polizei rufen? Oder mit ihnen einen moralischen Diskurs führen? All das wäre denkbar gewesen, meint Rehberg. Gehlen aber tat etwas anderes. »Er schaute aus dem Fenster in Richtung des Lousberges und hüstelte. In einem kurzen, scharfen, militärischen Ton, der typisch für ihn war. Dann richtete er sich an die Vortragenden: ›Meine Herren. Das würde ich heute nicht mehr erfinden.‹ Daraufhin waren sie so platt, dass sie nichts mehr erwiderten. Das hatten sie offenbar nicht erwartet. Sie schlugen ihre Bücher zu und gingen. Gehlen setzte das Seminar fort, ohne mit einem einzigen Wort auf das gerade Geschehene einzugehen. Und alle machten mit.« Ihm selbst sei damals auch nicht mehr dazu eingefallen.
Gegen die »Hypermoral«
Die Achtundsechziger und Arnold Gehlen: Da stießen zwei Welten aufeinander. Befreiungseuphorie traf auf ein Pathos des Dienens, das noch aus einer vordemokratischen Zeit stammte. Der konservative Philosoph antwortete der Studentenbewegung 1969 mit einem Buch. »Moral und Hypermoral«. Menschliches Handeln, so lautet die Hauptthese, lasse sich nicht auf ein einziges moralisches Prinzip zurückführen. Vielmehr gründe es in vier verschiedenen Ethosformen: dem Prinzip der Gegenseitigkeit, instinktiven Regulationen (etwa das Kindchenschema), einer familienbezogenen Moral, die auf größere Gruppen erweitert werden könne, sowie einem Ethos der Institutionen. Verbunden ist die systematische Betrachtung moralischer Handlungsimpulse und -gründe mit einer ressentimentgeladenen Polemik gegen die Erscheinungen der sich vor Gehlens Augen abspielenden Kulturrevolution. Da durch sie alle traditionellen Institutionen in Frage gestellt würden, verlören die nun auf ihre ungerichteten Triebimpulse zurückgeworfenen Menschen die Orientierung und ihren Halt in einer unübersichtlichen Welt. Zugleich überdehnten sie moralische Grundsätze und Verhaltensregeln, die aus dem privaten Nahbereich stammten, indem sie sie auf die Sphäre des staatlichen Handelns projizierten. Was meint Gehlen damit? Vereinfacht gesagt: Es kann geboten erscheinen, sein Stück Brot mit dem Nächsten zu teilen. Wer nun aber sein Handeln von dem Glauben leiten lässt, eine ganze hungernde Stadt ließe sich auf diese Weise ernähren, kann das Problem trotz guten Willens nicht lösen. Er riskiert, dass alle Beteiligten zugrunde gehen. Gehlen verurteilte die Ausrichtung staatlichen Handelns an Maßstäben, die im Rahmen von Familien und Kleingemeinschaften gültig blieben, als »Hypermoral«.
Grundsätzlich sah er die Normalsterblichen von den ethischen Forderungen, die die moderne Welt an sie stellte, gänzlich überfordert. Seine Antwort auf das Dilemma lautete: Dienst, Pflichterfüllung und fragloser Gehorsam. Solange »Hierarchien als selbstverständlich bejaht wurden und leistungsfähig arbeiteten«, war Gehlen überzeugt, hätten sie »zweifellos zur inneren Befriedigung« beigetragen.57 Der »jedermann zugängliche Weg zur Würde sei, sich von den Institutionen konsumieren zu lassen«.58 Das war das genaue Gegenteil von dem, was die gegen bürgerliche Konventionen revoltierenden Jungakademiker im Sinn hatten. Der Satz »begegnete, vor Studenten geäußert, der blanken Verständnislosigkeit«, hielt der offensichtlich enttäuschte Gehlen seine Erfahrung im Lehrbetrieb fest. Während die Studenten damals bei jeder Gelegenheit die Notwendigkeit der Herrschaftskritik betonten, polemisierte der elitäre Professor, schon die Herausbildung privater Meinungen sei ein »Laster«, das den gesellschaftlichen Zerfall nach sich ziehe. Mit ihrer Hilfe würden »angebbare Kreise die Auflösung der Institutionen legitimieren, um die Gesellschaft in eine Masse von Particüliers zu verwandeln«59. Kritik bezeichnete er als »die unterste Eskalationsstufe der Aggression«.60
Dabei hatte er gegen Gewalt nichts einzuwenden, sofern sie dem Erhalt der gesellschaftlichen Ordnung zu dienen schien. Als sowjetische Truppen im August 1968 den Prager Frühling niederschlugen, wurde der Antikommunist zum Zyniker. Er begrüßte den Einmarsch als Maßnahme einer Regierung, die hier womöglich als die »letzte Ordnungsmacht« gegen den Nihilismus auftrete. »Moral und Hypermoral«, so Rehberg, war getragen von einem Hass auf die Studentenrevolte und die sozialliberale Koalition. Er fand das Buch von Anfang an misslungen. »Es hat einen sehr interessanten anthropologischen Kern, nämlich die These von der Pluralität der Ethiken. Der wird aber von seinen politischen Intentionen verschluckt«, so der Soziologe. Die Gewaltsamkeit des Staates komme zu kurz. Als er diese Kritik im Rahmen eines Oberseminars von Horst Jürgen Helle vortrug, an dem Gehlen als Gast teilnahm, erwiderte der mittlerweile emeritierte Professor: Herr Rehberg habe nicht unrecht. Da das aber heute jeder mache, müsse er es nicht auch noch tun. Er wolle auf ganz andere Gefahren hinweisen. Gehlen meinte die Auflösung der Halt gebenden Institutionen.
Politische Resignation
Mit seiner Rolle als Wissenschaftler im Rahmen der Nazi-Herrschaft setzte sich Gehlen nicht auseinander. Über seine Parteimitgliedschaft habe er nie gesprochen oder geschrieben, sagt Rehberg. Auch ihm gegenüber nicht. Mit einer Ausnahme. Einmal seien sie zusammen im Auto gefahren. Plötzlich habe Gehlen zu erzählen angefangen: »Mir hat heute jemand geschrieben aus Frankreich. Was ich im Dritten Reich gemacht hätte. Der Mann ist wohl verrückt geworden.« Rehberg widersprach: »Das finde ich nicht. Jemand wie Sie, mit Ihrer intellektuellen Schärfe, sollte sich zumindest selbst erklären, was das Faszinosum für ihn war.« Gehlen ging darauf nicht ein. Er schwieg einen Augenblick und sagte stattdessen: »Ach, die Partei. Die haben mir einen Spitzel ins Institut gesetzt. Den habe ich gemeldet. Der wurde eingezogen.« Nach einer weiteren Pause sagte er ganz befriedigt: »Und er ist dann auch gefallen.« Rehberg war schockiert. Die »Todesstrafe« für so eine Spitzeltätigkeit: Das sei ihm dann doch ein wenig hart vorgekommen.
Gehlen gehörte zu jener Sorte Rechtsintellektueller, die den verlorenen Krieg nicht als eine gewöhnliche Niederlage empfanden, sondern als eine, die Deutschland in seiner Substanz beschädigt hätte. Was die unter den »exotischen Flaggen von Mao oder Guevara« revoltierenden Studenten »für einen übermächtigen Staat (…) oder für eine Gesellschaft von Unterdrückern« hielten – die Bundesrepublik –, war in seinen Augen eine Gesellschaft »von Eingeschüchterten«.61 Gehlen hat das Deutschland der Nachkriegszeit als »Nichtstaat« oder »Nachstaat« verabscheut, erläutert Rehberg. Diesen Zustand habe er mit Würde ertragen wollen. Dazu gehörte, sich nicht mit der eigenen Biographie, dem eigenen Scheitern in Beziehung zu setzen und sich schon gar nicht neu zu positionieren. Das hätte er als Anbiederung an die verhassten Verhältnisse empfunden. Er gehörte mit Carl Schmitt und Hans Freyer zu jenen Gestalten des intellektuellen Konservatismus, die in den zwanziger und dreißiger Jahren um politischen Einfluss bemüht waren, nach der Niederlage des Faschismus aber darauf verzichteten, weiterhin in dieser Richtung wirksam zu sein. Er glaubte nicht mehr an die Möglichkeit einer konservativen Doktrin. Ein gewisser Halt, so dachten er und Schelsky, sei allenfalls von der Stabilisierung der wissenschaftlich-technischen Struktur der industriellen Gesellschaft zu erwarten, die den Menschen in technische Sachzwänge einbinde.
Andere Konservative stemmten sich gegen den Zeitgeist. Die von von Schrenck-Notzing 1970 gegründete Zeitschrift Criticon, war der Versuch, eine konservative Gegenstimme zur Kulturrevolution der Achtundsechziger zu etablieren. Das Publikationsorgan wurde zum wichtigsten Forum der intellektuellen Rechten. Einige Jahre später entstand in Baden-Württemberg, ebenfalls als Reaktion auf die Studentenrevolte, eine konservative Denkfabrik. »Das Studienzentrum Weikersheim (SZW) wurde 1979 gegründet, um die geistige Auseinandersetzung mit der Kulturrevolution von ›1968‹ zu führen und zu bündeln und im Sinne eines freiheitlichen, christlich fundierten Konservatismus auf die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates zu verweisen«, so beginnt die Selbstbeschreibung auf der Homepage der Bildungseinrichtung.62 Gehlen hingegen war in seinen späten Jahren so resigniert, dass er auf den Konservatismus als politische Kraft nicht mehr setzte. »Es gibt nur eine konservative Haltung mit konkreten Ausdrucksformen, z.B. nicht im Spiegel zu schreiben, Distanzierung von den Massenmedien usw. – und das ohne Schielen nach Erfolg«,63 schrieb er am 9.2.1974 an den Autor Armin Mohler. Als ihn die Redaktion der rechten Zeitschrift Student darum bat, sich anlässlich der 100.Wiederkehr der Gründung des Deutschen Reiches zu äußern, antwortete er am 7.12.1970: »Ihr Brief hat mich sehr bewegt, ich (…) kann aber nur wiederholen, dass ich unfähig bin, jungen Menschen etwas Wegweisendes zu sagen. (…) Der 18. Januar weckt in mir nur bitterste und hoffnungslose Gedanken.«64 Er sah sich nicht als Impulsgeber, sondern eher als einen »Kommentator des Ruins«, wie er dem Soziologen Hanjo Kesting 1971 in einem Brief mitteilte.65 Das hielt Armin Mohler nicht davon ab, Gehlen in seinem in der Tageszeitung Die Welt (2.2.1976) erschienenen Nachruf den »Denkmeister der Konservativen« zu nennen. Der Aufbruch fand jedoch woanders statt.
Ein neuer Anfang: Die Rebellion der Nationalisten
Flugblätter wirbelten in der Luft, laute Sprechchöre und verzerrtes Megaphon-Geschrei gaben die Geräuschkulisse. Die Stimmung war explosiv, als sich der kugelsichere Mercedes 600, begleitet von einer Polizei-Eskorte aus sieben Motorradfahrern, am Vormittag des 21.Mai 1970, einem Donnerstag, seinen Weg durch das Spalier dicht gedrängter Menschen auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel bahnte.66 Auf der linken Straßenseite versammelten sich Anhänger der 1964 gegründeten National-demokratischen Partei Deutschlands (NPD), DDR-Flüchtlinge, die Mitglieder von Verbänden der Heimatvertriebenen. Sie skandierten: »Volksverräter Hand in Hand – Willi Stoph und Willy Brandt« und »Gebt dem Willi Stoph den Rest, denkt an Prag und Budapest«.
Es herrschte der Ausnahmezustand in der Documenta-Stadt. Fahnen waren zu sehen: viele rote, auch einige schwarze. Dazu mit Trauerflor versehene Bundesflaggen. Auf einem mitgebrachten Plakat hieß es: »Mauer weg – ein Deutschland«. Auf der rechten Straßenseite hielten linke Demonstranten von der APO und der 1968 gegründeten Deutschen Kommunisten Partei (DKP) ihre Transparente hoch. »Nazis raus«, war darauf zu lesen, und: »Mit und ohne Willy Brandt: die DDR wird anerkannt«. Dazu riefen sie: »Nazischweine an die Leine« und »Fortschritt heißt in unserm Land: die DDR wird anerkannt«.
Die meisten Polizisten, die den Straßenrand säumten, hatten den Demonstranten den Rücken zugewandt. Ein junger Mann nutzte die Gelegenheit, überwand die Absperrungen, warf sich auf die Kühlerhaube der Regierungslimousine, wurde aber bereits Augenblicke später von der Polizei weggezerrt. Während des kurzen Halts explodierten Knallkörper. Dann fuhr die Fahrzeugkolonne mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Hinter ihr schlug die Woge der Protestierenden zusammen. Zu einem ernsten Zwischenfall kam es nicht.
Die hochgestellten Insassen werden trotzdem froh gewesen sein, als ihre Wagenkolonne endlich den Sperrbezirk erreichte, den die Sicherheitskräfte rund um das Schlosshotel der kurhessischen Residenzstadt eingerichtet hatten. Hier wartete eine Meute von Journalisten aus aller Herren Länder bereits auf ihre Ankunft.
Gegen 9:30 Uhr war die Delegation aus der DDR auf dem Bahnhof Wilhelmshöhe eingetroffen. Die Lautsprecher der Bundesbahn verkündeten die Ankunft des »Diplomatensonderzugs aus Berlin«. Bundeskanzler Willy Brandt begrüßte DDR-Ministerpräsident Willi Stoph an Gleis 3. Fast wortlos schritten die Politiker über den roten Kokosläufer. Sie trafen sich nach kurzer Zeit bereits zum zweiten Mal. Es gab Wichtiges zu besprechen: die Normalisierung der deutsch-deutschen Beziehungen. Die nach dem Bau der Berliner Mauer verhärtete Stimmung sollte gelockert, der Weg für einen regulären diplomatischen Verkehr geebnet werden. Stoph hoffte, dass Bonn die DDR am Ende der Verhandlungen als souveränen Staat anerkennen würde.
Für die deutsche Einheit
Genau dies war den nationalistischen Demonstranten ein Ärgernis, die auf dem Ziel der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten beharrten. Willy Brandt war in ihren Augen ein »Vaterlandsverräter«. Vor allem deshalb, weil die von ihm seit einem halben Jahr als Kanzler geführte sozialliberale Koalition aus SPD und FDP eine neue Ostpolitik eingeleitet hatte, die den harten Konfrontationskurs des Kalten Krieges ablöste. »Wandel durch Annäherung« hieß die neue Devise.
Sie steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Veränderungen in den Beziehungen zwischen den USA und der UdSSR. Nach der Kubakrise, die 1962 beinahe in einen Dritten Weltkrieg und damit in die nukleare Katastrophe geführt hätte, setzte man in Washington und Moskau auf einen diplomatischeren Politikstil. Die Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch die Regierung der Bundesrepublik sowie das in Reden immer wieder betonte Wiedervereinigungsgebot drohten ein Störfaktor im sich anbahnenden Tauwetter zwischen Ost und West zu werden. Schon die von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU) geführte Große Koalition war 1966 daher bestrebt, »Anschluss an die internationale Entspannungspolitik zu finden und eine drohende Isolation der Bundesrepublik zu vermeiden«.67
Dem stand jedoch der Alleinvertretungsanspruch der Bundesregierung für die entlang der innerdeutschen Grenze geteilte Nation entgegen. Kanzler Konrad Adenauer (CDU) hatte diesen anlässlich des Inkrafttretens der Verfassung der DDR am 21.Oktober 1949 vor dem Deutschen Bundestag zur Richtlinie seiner Politik erklärt. Als die Bundesrepublik 1954 in die NATO aufgenommen wurde, machten sich die Verbündeten diese Auffassung zu eigen. Im selben Jahr proklamierte die Sowjetunion, die DDR sei ein souveräner Staat. Bonn hingegen verfuhr außenpolitisch nach der »Hallstein-Doktrin«,68 der zufolge die Aufnahme diplomatischer Beziehungen von Drittstaaten zur DDR als »unfreundlicher Akt« gegenüber der Bundesrepublik zu werten sei und mit nicht genau festgelegten Sanktionen beantwortet werden konnte. Man wollte den sozialistisch regierten Nachbarn außenpolitisch isolieren. Bis Mitte der sechziger Jahre kam es vor, dass DDR-Sportlern die Einreise zu internationalen Wettkämpfen in NATO-Mitgliedsstaaten verweigert wurde. Die deutsch-deutschen Beziehungen waren also mehr als angespannt.
Als Kiesinger und der Ministerratsvorsitzende Willi Stoph einen offiziellen Briefwechsel begannen, wurde das von der NPD als erster Schritt zur staatlichen Anerkennung der DDR scharf verurteilt. Nachdem Willy Brandt im Jahr 1969 zum Regierungschef gewählt wurde, verschärfte sich die Tonlage der rechten Agitation. Der Kanzler hatte in seiner Regierungserklärung die Bereitschaft signalisiert, den bis dahin von allen Bundesregierungen vertretenen Alleinvertretungsanspruch aufzugeben. Die von der NPD als »Verzichtspolitik« gegeißelte Gesprächsbereitschaft überzeugte die Staats- und Parteiführung des sozialistischen Nachbarstaates, einem ersten Gipfeltreffen zwischen dem Bundeskanzler und dem Ministerpräsidenten der DDR zuzustimmen. Zwei Monate, nachdem dieses am 19.März 1970 in Erfurt stattgefunden hatte, sollten die schwierigen Verhandlungen in Kassel fortgeführt werden. Eine ruhige und entspannte Gesprächsatmosphäre kam dabei nicht auf.
Brandt hatte mit seinem Eröffnungsvortrag kaum begonnen, als er von seinem Gegenüber Stoph unterbrochen wurde. Die Bürger der DDR dürften nicht länger von den Gesetzen und Urteilen der BRD-Gerichtsbarkeit behelligt werden. Er beklagte sich über »neonazistische Mordhetze«. Was die National-Zeitung schreibe, sei unerträglich. Dann wurde ihm von seinem Außenminister Otto Winzer ein Zettel zugesteckt. Demnach hätten drei als Journalisten getarnte Rechtsextremisten aus Schleswig-Holstein in den Sperrbereich vor dem Schlosshotel eindringen und die DDR-Flagge vom Mast holen können. Ein Mitglied des Nationaldemokratischen Hochschulbundes namens Dietrich Murswiek – heute ein angesehener Staatsrechtsprofessor69 – hatte sie dann öffentlich zerrissen.70 Der Bundeskanzler bat seinen Gast um Entschuldigung. Aber damit waren die Störmanöver nicht beendet.
Nach der Mittagspause gab es einen Zwischenfall, der beinahe zum frühzeitigen Abbruch des Treffens geführt hätte. Der Polizeipräsident von Kassel vermeldete, dass es an verschiedenen Orten in der Stadt, vor allem aber vor dem Mahnmal für die Opfer des Faschismus im Fürstengarten am Weinberg, heftige Schlägereien zwischen rechten und linken Demonstranten gebe. Dort wollte Stoph einen Kranz niederlegen. Lange Zeit schien es, als ob die Polizei den Aufruhr nicht in den Griff bekommen würde. Es kam beinahe zum Eklat. Die DDR-Delegation sagte die geplante offizielle Ehrung ab. Ihre Begründung: Die Behörden der BRD seien nicht in der Lage, die Sicherheit des Ministerpräsidenten zu gewährleisten.
Am Abend, als sich die Lage wieder beruhigt hatte, konnte der Kranz schließlich doch noch niedergelegt werden. Die DDR-Delegation verließ Kassel gegen 22:00 Uhr. Am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass die Schleifen ihres Kranzes in der Nacht entwendet worden waren. Weder in Erfurt noch in Kassel brachten die Verhandlungen handfeste Ergebnisse. Doch die Gespräche wirkten als vertrauensbildende Maßnahme. Sie waren das Fundament, auf dem 1972 ein Grundlagenvertrag geschlossen und Ständige Vertretungen der beiden Staaten eingerichtet werden konnten.
Die schwarze Fahne empor
Wäre es nach der NPD-Führung gegangen, hätte es die geschilderten Störungen nicht gegeben. Die sechs Jahre zuvor gegründete Partei schickte sich an, eine relevante Größe in der deutschen Politik zu werden. Zwischen 1966 und 1968 war die NPD in sieben von damals elf Landesparlamenten vertreten. »Sie stellte 61 Abgeordnete, 22 Delegierte für die Bundesversammlung und etwa 600 Vertreter in Kreis- und Gemeindevertretungen.«71 Bei der Bundestagswahl 1969 waren die Neofaschisten knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert. Ihre aus dem gesamten Bundesgebiet angereisten Anhänger hätten Kassel unmittelbar nach der für Mittwoch anberaumten Protestkundgebung wieder verlassen und auf eine weitere Demonstration verzichten sollen. Man wollte gewaltsame Ausschreitungen, die das Image der unter dem Vorsitz von Adolf von Thadden um einen biederen Anstrich bemühten Partei in den Monaten zuvor ernsthaft beschädigt hatten, um jeden Preis vermeiden.72 Doch der Plan ging nicht auf. Viele der NPD nahestehende junge Rechte hielten sich nicht an die Anweisungen der Parteioberen und protestierten auch am Donnerstag. Federführend war die Gesamtdeutsche Aktion. Dabei handelte es sich um ein Zweckbündnis verschiedener rechter Jugendgruppen, das von Alfred E.Manke und dem Herausgeber der damals NPD-nahen Zeitschrift Mut, Bernhard C.Wintzek, initiiert worden war. Aus ihren Reihen kamen die etwa 2000 bis 2500 teils militanten Demonstranten, die Willi Stoph stundenlang daran hinderten, einen Kranz am Ehrenmal der Opfer des Faschismus niederzulegen. Die Aktionen richteten sich gegen Brandt, gegen die DDR, aber auch gegen eine NPD, der man vorwarf, zu harmlos zu agieren. Das war der Gründungsmoment einer rechten APO.
Zum ersten Mal trat dabei eine politische Strömung ans Licht der Öffentlichkeit, deren Aktivisten sich als Neue Rechte, junge Nationalisten oder Nationalrevolutionäre bezeichneten und sich jenseits der Strukturen einer Partei in autonomen, aber miteinander vernetzten Gruppen organisierten. »Für die Rechte bedeutet Kassel das, was für die Linke einmal die Ostermärsche oder die Antinotstandskampagne waren: der lange gesuchte Anlass sich zu formieren«,73 befand der nationalistische Deutsche Studenten-Anzeiger (Nr.48, Juli 1970, S.1) im Rückblick.
Die Bochumer Basisgruppe Neuer Nationalismus hatte eine schwarze Fahne mitgebracht.74 Hinter dieser Idee steckte Henning Eichberg, der bedeutendste theoretische Kopf dieser Szene,75 der seine politischen Texte – wie viele seiner Mitstreiter – damals fast ausschließlich unter Pseudonym veröffentlichte. Der 1942 im niederschlesischen Schweidnitz geborene Student hatte die Gruppe mitgegründet.76 Bei der schwarzen Fahne handelt es sich um ein politisch mehrfach codiertes Symbol, das im Verlauf der Geschichte von Gruppen ganz unterschiedlicher ideologischer Orientierung für sich in Anspruch genommen wurde. Sie stand für die Anarchisten, für die Bauernkriege des späten Mittelalters. Schwarz waren aber auch die Uniformen faschistischer Gruppierungen einschließlich jener der SS.77