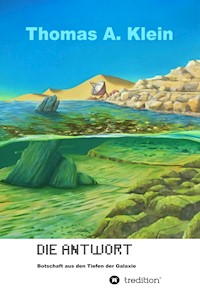
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Nachrichten der Menschheit aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts werden von einer weit entfernten Zivilisation empfangen. Diese tut sich mit der Dechiffrierung zunächst sehr schwer. Doch nach und nach gibt das Signal sein Geheimnis preis und es enthüllt eine fremde Welt, die voller Widersprüche ist. Die Dechiffrierung der Nachricht stößt dabei nicht nur auf Interesse. Und obwohl sie es schafft, die Elaborä für kurze Zeit gefangen zu nehmen, werden schon bald die Stimmen der Kritiker lauter. Die Erkenntnisse über die Menschheit scheinen diesen auch bald recht zu geben. So wird der wissenschaftliche Stab um den Mathematiker Walg auch bald mit Argusaugen bewacht und das Projekt steht mehr als einmal vor dem Aus. Nach Jahren der unermüdlichen Forschung bleiben dennoch viele Fragen offen. Sind die Menschen wirklich jene friedlichen Wesen, als die sich selbst in jener Nachricht dargestellt haben? Ist ein weiterer Kontakt mit ihnen möglich? Doch die Wahrheit ist noch weit komplexer und enthüllt Schritt für Schritt ihr abscheuliches Gesicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für alle, die einen Blick über den Tellerrand der eigenen Spezies wagen wollen.
Thomas A. Klein
Die Antwort
-
Botschaft aus den Tiefen der Galaxie
Eine Zukunftsvision
©2021 Thomas A. Klein
Umschlaggestaltung: Thomas A. Klein
Lektorat: Timo Hassakas
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
978-3-7497-5553-0 (Paperback)
978-3-7497-5554-7 (Hardcover)
978-3-7497-5555-4 (e-Book)
Druck und Verlag: tredition GmbH, Halenreie 42, 22359 Hamburg
Mehr über Buch und Autor: http://thomas-a-klein-romane.eu
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
In den Jahren 1971 und ´72 versah ein Team von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Idealisten die Raumsonden Pioneer 10 und 11 mit je einer vergoldeten Aluminiumplatte. Mit diesen Platten verband man eine verwegene Hoffnung. Im sehr unwahrscheinlichen Fall einer Bergung einer dieser Sonden, durch eine technisch weit fortgeschrittene außerirdische Zivilisation, sollten die Platten Zeugnis über die Erbauer der Raumschiffe geben.
Gut zwei Jahre später, am 16. November 1974, gab es einen weiteren, nicht minder kühnen, Versuch einer Kontaktaufnahme. Man sendete vom Arecibo-Observatorium auf Puerto Rico eine Nachricht mittels eines Radioteleskopes in Richtung des Kugelsternhaufens Messier 13. Auch diese Nachricht soll eventuelle außerirdische Intelligenzen von unserer Existenz unterrichten.
Weitere drei Jahre später wagte man einen erneuten Anlauf. An Bord der Raumsonden Voyager I & II packte man je eine goldene Bild-Tonschallplatte, die noch weit ausführlichere Informationen über uns Menschen bereit halten.
Die Platten auf den Pioneer Kapseln, sowie die Golden Records der Voyager-Mission, sind mit vergleichsweise gemächlichem Tempo unterwegs. Die Geschwindigkeit, mit der sie durch die Weiten des Raums rasen, beträgt gut 18 Kilometer pro Sekunde. Dies ist allerdings eine Geschwindigkeit, die bis zu diesem Zeitpunkt kein von Menschen gefertigtes Objekt jemals erreicht hatte. Zum Vergleich: Eine Gewehrkugel bringt es nicht einmal auf 1 Kilometer pro Sekunde. Die Arecibo-Botschaft dagegen ist mit Lichtgeschwindigkeit, knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde, unterwegs. Verglichen mit der Radioübertragung bewegen sich die Botschaften auf den Raumkapseln mit der Geschwindigkeit einer Weinbergschnecke in Relation zu einem sehr schnellen Auto. Doch auch bei der sehr viel schnelleren „Kontaktaufnahme“ per Radiobotschaft ist mit keiner frühen Antwort zu rechnen. Die Arecibo-Botschaft ist seit gut 45 Jahren in den Weiten unserer Galaxie unterwegs. In jeder einzelnen seither vergangenen Sekunde legte, und legt die Botschaft noch immer, eine Strecke zurück, die mehr als das Siebenfache des Umfanges unseres Planeten beträgt. Sie hat für menschliche Maßstäbe unglaubliche Distanzen überwunden. Und doch, sie steht erst am Anfang ihrer langen Reise. Bis sie ihr Ziel, den Kugelsternhaufen Messier 13, erreicht hat vergehen gut 25.000 Jahre. Mit einer Antwort können wir demnach frühestens in rund 50.000 Jahren „rechnen“. Ein Zeitraum von dem nicht gewiss ist, ob ihn die Menschheit überhaupt er- bzw. überlebt? Beträgt er doch gut die zehnfache Zeitspanne, die uns von den ersten schriftlichen Dokumenten und damit von der historischen Bewusstseinswerdung der frühen Menschheit trennt. Doch selbst wenn Menschen dann noch existieren, so stellt sich die Frage: Kann sich noch jemand an eine Botschaft erinnern, die vor 50.000 Jahren gesendet wurde?
Auf der Empfängerseite ist ein Erfolg noch um ein Vielfaches ungewisser, ja unwahrscheinlicher. Die Sendedauer der Botschaft beträgt nicht einmal drei Minuten. Es müssen also in rund 25.000 Jahren Wesen, von denen wir nicht im Entferntesten wissen ob es sie überhaupt gibt, in den genau richtigen drei Minuten ihren Himmel nach Signalen absuchen, die zu empfangen nicht gerade wahrscheinlich sind. Entwickelt sich ihre Zivilisation nur um wenige Jahre, Monate, oder auch nur um Sekunden zu spät, so wird unsere Nachricht über sie unbemerkt hinwegfegen und für sie für alle Zeiten unerreichbar sein. Nun kann man vielleicht denken, dass ja auch noch hinter dieser angenommenen ersten Zivilisation eine weitere unsere Botschaft empfangen kann, doch ist in dem schmalen Korridor, in dem wir gesendet haben, das Auftreten von nur einer einzigen, technisch hoch entwickelten Lebensform schon sehr unwahrscheinlich.
Bei all diesen Überlegungen bewegen wir uns gedanklich nur innerhalb unserer Milchstraße, wenn Sie so wollen, innerhalb unserer „Stadt“. Doch da draußen gibt es noch weitere, gibt es noch Milliarden anderer Galaxien, von denen sicher mehr als eine Leben beheimaten dürfte. Die Dimensionen des Universums sind so gewaltig, dass jeder Versuch sie mit unserem menschlichen Geist zu erfassen zwangsweise zum Scheitern verurteilt ist. Wir können das All mathematisch beschreiben, seine Dimensionen verstehen können wir aber nicht. Unser Geist ist auf unsere Erfahrungswelt fixiert und hat uns in unserer Entwicklung die Möglichkeit gegeben Distanzen zu begreifen, die wir an einem Tag zu Fuß zurücklegen können.
Eine besondere Eigenschaft des Menschen ist indes, wider all dieser Fakten, wider besseren Wissens, die Hoffnung nicht aufzugeben, das unmöglich Scheinende zu wagen und sich darüber hinaus die Fragen zu stellen: Was werden die Außerirdischen mit unseren Nachrichten anfangen? Werden sie sie verstehen? Werden sie uns antworten?
Bei alle dem ist es vielleicht nicht einmal die Frage, was fremde Zivilisationen über uns erfahren, sondern vielmehr, was wir über uns selbst herausfinden. Vielleicht hilft das Senden von Informationen an fremdartige Lebensformen uns weiter, uns über uns selbst bewusst zu werden? Vielleicht lässt es uns erkennen, in welch privilegierter Position wir uns befinden und lässt uns behutsamer mit uns und unserer Umwelt umgehen?
Vielleicht ist auch das nur ein Traum eines Wesens, das von seiner Heimat, dem Universum, in dem es lebt, noch weniger versteht, als ein weniger Tage alter Säugling, von der Welt in die er geboren wurde?
Das Senden der Botschaften hat indes einige Kritiker auf den Plan gerufen. Wie könne man Außerirdischen, von denen man nicht wisse, ob sie uns friedlich gesinnt sind, nur unsere genaue Position verraten? Ist diese Angst gerechtfertigt? Wer kann es schon mit Gewissheit sagen? Doch wenn tatsächlich eine außerirdische Intelligenz unsere Botschaft empfängt, so hat sie mit ihrer Existenz doch bewiesen, dass sie ihre eigenen Aggressionen, zumindest soweit im Griff hat, dass sie sich nicht selbst vernichtet hat. Es bleibt dabei die Hoffnung, dass sie auch jede andere Form von Leben akzeptiert. Ein Umstand, der uns Menschen nicht immer auszeichnet und dessen Bedeutung erst neuerdings in das kollektive Bewusstsein der Menschheit gelangt.
Aber auch wenn sie uns in technischen Belangen um Jahrtausende voraus sein sollten und dabei trotzdem aggressiv wären, so schützten uns doch Physik und Biologie und ihre überall geltenden Gesetze. Ganz egal wie Leben auf anderen Planeten auch aussehen mag, wenn es fortgeschritten sein soll, so muss es endlich sein. Denn je länger eine Generation braucht, um einer neuen Platz zu machen, desto langsamer wird ihre evolutionäre Entwicklung vonstattengehen. Sie werden also wie wir eine relativ kurze Lebensspanne aufweisen und wie wir dazu verurteilt sein, ihr Leben auf dem Planeten zu fristen, auf dem sie geboren wurden. Allenfalls die Möglichkeit eines zweiten bewohnbaren Planeten in unmittelbarer Nähe, wäre dabei im Bereich des Möglichen. Eine physische Reise über interstellare Dimensionen dagegen so gut wie ausgeschlossen. Zumindest nach allem, was wir bis heute wissen. Die Dinge, wovor wir uns fürchten sollten, liegen weit näher. Und einen Großteil dieser Gefahren können wir selbst beeinflussen und abwenden.
Die Antwort
Was bleibt, wenn die Endlichkeit der Ewigkeit anheimfällt?
Wenn alle Kultur von der Natur verschlungen wird?
Wenn Erkenntnis in der Dämmerung des Gleichmuts ertrinkt?
Was bleibt, wenn alles Leben zu einem Ende kommt
und nochmals von vorne beginnt?
Bleiben Spuren?
Wird es ein Erinnern geben?
Wird all unser Schaffen letzten Endes vergebens sein?
Oder wird ein Licht die Dunkelheit überdauern?
Wird sich jemand unserer erinnern?
Wird jemand sagen: Da gab es schon einmal ein Bewusstsein?
Oder werden wir in unserem Wahn alles tilgen,
sodass keine Erinnerung mehr bleibt
und kein Zeugnis mehr von unserer Existenz kündet?
Kapitel 1
Das Nass umspülte seine müden Glieder. Den ganzen Tag hatte er sich die Berührung des Wassers herbei gesehnt, war unstet in seinen Arbeitsräumen auf und ab gegangen, hatte nach Luft gerungen und konnte sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Zwar waren die meisten Räume des Labors mit Wasser geflutet, doch musste er sich auch immer wieder im Trockenen aufhalten. Je älter er wurde, desto schwerer fielen ihm die harten Stunden der Arbeit an Land. Das Atmen in der trockenen Luft war für ihn eine Tortur, sein Körper fühlte sich trocken, steif und zu nichts zu gebrauchen an; so kam es einer Erlösung gleich, wenn er des Abends in die Fluten steigen und endlich wieder frei durchatmen konnte.
Doch die Arbeit musste gemacht werden. Vorbei die Zeit, in der sich die Wissenschaft im Meer, im natürlichen Lebensraum der Elaborä, entwickeln konnte. Nur an Land waren tiefere Einsichten zu erwarten. Das Meer verbarg zu viele der Einsichten, die die Elaborä nur hier, nur ohne die schützende, lebensfreundliche Schicht des Wassers, den Tiefen des Raumes entreißen konnten. Die Sterne und Planeten, ja selbst der Mond, waren vom Meer aus so gut wie nicht zu beobachten.
So blieb nur die Möglichkeit dem Wasser den Rücken zu kehren und den angestammten Lebensraum zu verlassen, um in einer feindlichen Umwelt diesen Geheimnissen auf die Spur zu gehen. Hier fand man die Antworten, die sich schon Generationen herbeigesehnt hatten.
Denn schon seit Jahrhunderten hatten die Bewohner des Planeten auf diesen Tag gewartet. Was Generationen von Wissenschaftlern erhofft und erwartet hatten, war gerade noch in seinen zitternden Gliedern gelegen. Die Computeranalyse war eindeutig. Warum gerade er? Wie sollte ausgerechnet er mit dieser Erkenntnis umgehen? Wie sollte er sie formulieren? Wie sie publik machen?
Dabei hatte ihn die Nachricht nicht unvorbereitet getroffen. Seit Monaten arbeitete er an der Dechiffrierung des Signals. Zuerst hatte er widerwillig und nur sporadisch die Arbeit aufgenommen. Der Auftrag, den Marschall Traul ihm gegeben hatte, war ihm sogar zuwider gewesen. Vielleicht hatte der Militär ihn ja gerade auch deshalb ausgesucht. Denn auch ihm schien die ganze Sache mehr als lästig zu sein. Walg hätte viel lieber seine eigentliche Arbeit, die mathematische Forschung, fortgeführt. Doch nun war er in diesem Projekt gefangen und konnte den anderen so wichtigen Fragen seines beruflichen Lebens nicht nachgehen. Erst viel später war er von dem Projekt, und der Nachricht, die es zu dechiffrieren galt, gefangen genommen worden. Die Faszination, die von den gewonnenen Erkenntnissen ausging, ließ ihn nun nicht mehr los. Dennoch hatte seine Skepsis, dem ganzen Projekt gegenüber, ihn bis zum heutigen Tag einen gebührenden Abstand bewahren lassen. Er konnte nicht einmal sagen, wieso ihn gerade heute, die Fakten letztendlich doch überzeugt hatten. Mit jeder Stunde, die er sich mit den Daten vertraut gemacht hatte, hatte sich eine mächtige Wand über ihm aufgebaut; so groß, so gewaltig, dass ihre Existenz zu leugnen, irgendwann sinnlos wurde. Eine Wand aus Wasser, die rasend auf ihn zueilte. Gleich einer unwiderstehlichen Woge, die auf ihrem Weg aufs trockene Land alles mit sich riss. Und nun war sie über ihm zusammengebrochen, hatte auch den letzten Zweifel hinweg gespült wie Treibgut an einem einsamen Strand. Doch was nun? Wie sollte er nun vorgehen, da in ihm Gewissheit geworden war, woran er so lange gezweifelt hatte?
Inzwischen war er sich sicher, dass gerade er als Projektleiter erwählt worden war, war kein Zufall. Wer wäre besser geeignet, etwas zu bestätigen, wovon er doch selbst so wenig überzeugt war? Seine Kollegen waren schon viel früher überzeugt, ja geradezu euphorisch gewesen, und ließen keinen Zweifel daran, dass sie glaubten einen Kontakt hergestellt zu haben. Einen Kontakt, den er selbst niemals für möglich gehalten hätte. Zwar glaubte auch er, dass der Planet, auf dem sie lebten, nicht der einzig bewohnte in der Galaxie sein konnte, doch dass es jemals einen Kontakt zu jenen anderen Wesen geben sollte, hielt er für absolut ausgeschlossen. Viel zu gewaltig waren die Dimensionen, die es zu überwinden galt. Da half kein Hoffen; die Physik und mit ihr die Gesetze der Mathematik, sprachen mit großer Sicherheit gegen eine solche Kontaktaufnahme.
Und nun war es an ihm, die vorliegenden Daten auszuwerten. Auf der anderen Seite: Was sollten sie schon zeigen? Konnten die Reihen an Zahlen, die er vor sich liegen hatte, mehr offenbaren als nur die Tatsache, dass es dort draußen noch jemanden gab? Konnten sie mehr über eine fremde Welt erzählen? Konnte man wirklich von einem Kontakt sprechen?
Und doch, es war eine Nachricht. Eine Nachricht aus den Weiten des Alls. Alle gewonnen Daten deuteten darauf hin. Sie waren nicht allein. In den unendlich erscheinenden Weiten des Universums gab es noch weiteres Leben. Leben, das weit genug fortgeschritten war, um mit ihnen in Kontakt zu treten.
So unglaublich dies alles auch scheinen mochte, nun musste er doch eingestehen, dass es wahr war. Zunächst hatte er noch nach allen anderen denkbaren Möglichkeiten, die die Struktur des Signales hätten erklären können, gesucht. Ein außergewöhnlicher Pulsar vielleicht? Die immer wiederkehrenden Strukturen des Signals deuteten auch darauf hin. Wie oft schon war man, seit man das Projekt gestartet hatte, ähnlichen Quellen nachgegangen, und hatte am Ende doch immer wieder feststellen müssen, dass die Ursache für die Radioquelle eine natürliche war.
So war er in der sicheren Annahme an die Arbeit gegangen, auch dieses Signal würde seine wahre, seine natürliche Quelle schon bald offenbaren. Doch so sehr er auch suchte, solange er forschte, er fand keine natürliche Erklärung für die Struktur des Signals. Die Frequenz, die immer wiederkehrenden Muster mussten einen künstlichen, einen bewusst erstellten Ursprung haben. Wieder und wieder hatte er sich die Zahlen vorgenommen, hatte sie in seinem Rechner hoch und runter laufen lassen, hatte versucht und verworfen. Doch so sehr er sich auch mühte, so sehr er versuchte, seine Zweifel zu beweisen, so sehr war in ihm immer mehr zur Gewissheit geworden, was er niemals für möglich gehalten hätte. Traul würde nicht begeistert sein, wenn er ihm davon berichtete.
Seit man das Projekt vor Jahrhunderten gestartet hatte, waren Generationen von Forschern gekommen und gegangen. Waren über ihre unermüdliche Arbeit alt geworden, um schließlich zu sterben. Auch der nächsten Generation sollte es nicht anders ergehen. Wieder und wieder erschienen hoffnungsvolle Forscher auf der Bildfläche; nur um am Ende eines langen, eines arbeitsreichen Lebens ernüchtert zu erkennen, dass sie nichts erreicht, dass sie nicht die kleinste Spur von dem gefunden hatten, wonach sie schon so lange gesucht hatten. Und dennoch einte sie alle, dass sie der festen Überzeugung waren, ihr Werk würde eines Tages gelingen. Alles Hoffen indes blieb über Jahrhunderte vergebens; früher oder später mussten sie alle ihr Sehnen fallen und davon treiben lassen. Wieso man nicht längst aufgegeben hatte, war Walg ein Rätsel. Nichts rechtfertigte den ungeheuren Aufwand und die Bereitstellung so vieler Mittel, die man an anderer Stelle doch so viel nötiger hätte verwenden können. Nichts, außer vielleicht den Ergebnissen, die ausgerechnet er nun in Händen hielt.
War dem so? War die Erkenntnis, dass sie nicht alleine waren, dies alles wert? Er war sich noch immer nicht sicher, doch seine Gehirne begannen langsam, die Sache von einer anderen Seite zu betrachten.
-
„Saug den Schlamm hier drüben ab!“ Die Anweisungen Professor Guils waren eindeutig. Jarg machte sich an die Arbeit, doch sie fiel ihm schwer. Der Gesichtssinn war nicht gerade der stärkste, nicht der ausgeprägteste Sinn der Elaborä. Viel lieber hätte er mit seinem Gehör die feine Struktur wahrgenommen. Doch die Überreste der längst verendeten Lebewesen hoben sich viel zu schwach von der glatten Steinoberfläche ab, als dass er sie hätte erhören können. So musste er sich auf seine vier Augen verlassen, die ihm sonst doch nur zur Kommunikation dienten. Vorsichtig, mit zusammengekniffenen Augendeckeln, begann er das aufgewirbelte Sediment wegzusaugen. Konzentriert folgte der Schüler den geübten Bewegungen des Professors, der sich ganz offensichtlich weit mehr auf seinen Gesichtssinn verlassen konnte. Die jahrelange Arbeit an Land hatte die Augen des Älteren geschult; wie kaum ein anderer konnte er sie einsetzen und Dinge erkennen, die andere Elaborä niemals wahrnehmen würden.
Konzentriert auf die immer deutlicher hervortretende Gesteinsschicht fiel es Jarg schwer, mit zwei seiner Augen den Ausführungen des Professors zu folgen. In schillernden Farben, gerade in leuchtendem Gelb, schmückte der Ältere seine Erkenntnisse aus: „Hier, siehst du das?“
Jarg kam näher. Sein von den umherwabernden Sedimenten getrübter Blick konnte nur zögerlich erkennen, was der Professor meinte. Doch als er es endlich sah, färbte sich auch seine Haut in einem kräftigen gelblichen Ton.
Ein Augenpaar auf ihren Fund gerichtet, das andere auf den Professor, sah er den Gelehrten sagen: „Ein Zeugnis längst vergangener Zeiten.“
„Was ist das?“, wollte Jarg wissen.
„Das müssen wir im Labor genauer untersuchen.“, befand Guil, mit einem mehr ins Bläuliche driftenden Ton. „Aber es sieht nach einem Krebstier aus, das wohl vor langer, langer Zeit hier gelebt hat. Auf alle Fälle ist es ein sehr gut erhaltenes Fossil. So etwas findet man nur äußerst selten. Es gibt zwar unzählige Fossilien, doch die meisten sind klein; oder man findet nur Bruchstücke von komplexeren Lebensformen. Doch so ein großes, zusammenhängendes und dazu hoch entwickeltes Lebewesen, kommt nur sehr selten ans Licht.“
„Kann es ein Vorfahr von uns sein?“
„Vielleicht. Wer weiß?“
„Wie alt ist es?“
„Das kann ich so, nicht genau sagen. Der Gesteinsschicht nach, in der wir es gefunden haben, auf alle Fälle aber sehr alt.“
„Stammt es gar aus der Zeit, vor dem großen Sterben?“
„Nein.“, erläuterte Guil leicht amüsiert, „Das nun auch wieder nicht. Es dürfte, grob geschätzt so circa hundert Millionen Jahre alt sein. Das große Sterben dagegen ereignete sich vor gut drei Komma zwei Milliarden Jahren.“
Jargs Hautfarbe wich einem kräftigen Grünton.
„Was ist?“, wollte der Professor wissen.
„Ach, nichts! Mich verunsichern nur diese ungeheuren Zeitspannen.“
„Nun ja, die können einen schon verunsichern. Aber du hast keinen Grund dazu. Betrachte sie einfach nur mit Ehrfurcht.“
„Ich werde es versuchen. Doch leicht fällt mir das nicht.“
Professor Guil schmunzelte aufmunternd, ehe Jarg nachhakte: „Wie kam es zu dem großen Sterben?“
„Das weiß man nicht wirklich. Es gibt dazu verschiedenen Theorien.“
„Was für Theorien?“
„Die eine besagt, dass ein riesiger Meteorit alles Leben zerstört habe. Nach einer anderen haben sich einfach die klimatischen Bedingungen dramatisch geändert. Noch eine andere geht davon aus, dass das Leben sich selbst seiner Grundlagen beraubt hat.“
„Wie meinen Sie das?“
„Nun, der Theorie zufolge gab es wohl eine Spezies, die etwas zu erfolgreich gewesen war, die dem ökologischen System zu viel abverlangt hat, sodass alles aus dem Gleichgewicht geriet. Aber wenn du mich fragst, so ist diese Theorie die mit Abstand unwahrscheinlichste.“
„Wieso?“
„Weil sich das Leben immer in einem Gleichgewicht einpendelt. Auch wenn es durch äußere Einflüsse in einen Zustand des Ungleichgewichtes gerät, so pendelt es sich doch meist sehr schnell wieder in einen stabilen Zustand ein. Und eine zu erfolgreiche Art, wird so ganz automatisch in ihrem Erfolg gebremst.“
„Aber Tatsache ist doch, dass das Leben damals diesen Zustand nicht wieder erreicht hat.“
„Das stimmt so nicht ganz!“
„Wieso? Damals ist doch alles Leben ausgestorben.“
„Nicht alles. Nur beinahe!“
„Aber es gibt doch über einen langen Zeitraum keinerlei Nachweis irgendwelchen Lebens.“
„Auch das stimmt nicht!“
„Wie meinen Sie das?“, fragte Jarg abermals unsicher. Sein Panzer wurde dabei immer grüner und tat seine Unsicherheit kund.
„Dass wir keine Fossilien aus einer gewissen geschichtlichen Epoche des Planeten finden, heißt noch lange nicht, dass es kein Leben gab. Sicher kein „höheres“, noch nicht einmal vielzelliges Leben. Doch einige wenige Einzeller haben die große Katastrophe, welcher Natur sie auch immer war, wohl überlebt. Wir können heute dicke Flöze mit ihren Stoffwechselprodukten nachweisen. Der Planet hat sehr schnell wieder über eine nicht unbedeutende Biomasse verfügt. Und wenn es auch nicht viele Arten gab, so quoll er doch geradezu vor Leben über.“
„Sie wollen sagen, aus diesen wenigen Mikroben, ist dann alles um uns herum entstanden?“
Professor Guil bestätigte die Frage, indem er gleichzeitig das Fossil aus seinem Bett hob.
Jarg schaute ehrfurchtsvoll von dem Fossil zu der sie umgebenden Landschaft. All die Pflanzen, all die Tiere, die um sie herum gediehen und in dem natürlichen Element der Elaborä um ihre Köpfe schwammen, entstanden aus nur wenigen Arten Einzellern? Was für ein unglaublicher, aber auch was für ein erhabener Gedanke.
Doch bei all der Faszination, die von diesen Überlegungen ausging, beschäftigte ihn eines noch mehr: „Kann es wieder passieren?“
„Was meinst du?“, erkundigte sich nun der Gelehrte.
„Kann abermals alles Leben vernichtet werden?“
Skeptisch blickte Guil drein: „Das kann man wohl leider nicht gänzlich ausschließen.“
„Aber immerhin können wir ja gegensteuern.“
Der Professor hob fragend einen Augendeckel.
„Wir haben ja auch schon solche Krisen gehabt!“, erklärte Jarg und fügte hinzu: „Und haben sie erfolgreich gemeistert.“
„Was meinst du?“
„Damals, als wir vor einigen Jahrhunderten, nachdem wir alle unsere Feinde nahezu ausgerottet hatten, viel zu viele wurden, haben wir selbst unsere Zahl drastisch reduziert.“
„Ja, da hast du recht. Sieht so aus, als könnten wir vieles beherrschen.“
Guil zwinkerte seinem Studenten zu, doch irgendwie blieb da ein Hauch von Skepsis in seinem Blick.
-
Tief hörte er in die Schlucht hinab, die sich zu seinen Füßen in die scheinbar unendlich Weite erstreckte. Er musste aufpassen. Niemand sollte sehen, dass er hier alleine war und alle anderen beobachtete. Zwar war es nicht verboten alleine zu sein, verdächtig machte man sich damit aber allemal. Doch er konnte nicht anders, er brauchte immer wieder Zeit für sich. Wie sonst sollte er seiner Passion nachgehen?
Die Spalte durchbrach die Plateaus, die sich links und rechts davon erhoben. Weit konnte er in den Grat hinab hören, in jene Tiefen, in denen Wesen, die sich eher optisch orientierten, gänzlich verloren waren. Doch auch wenn sich die Elaborä, die sich ja nur wenig auf ihre Augen verließen, ohne Licht oder bei schlechter Sicht mittels ihres Gehörs hervorragend orientieren konnten, mieden sie dennoch jene Abgründe und blieben in den eher flacheren Zonen des Ozeans. Wie eh und je waren sie von seinen Artgenossen bevölkert. Überall wuselte es, und alle Elaborä gingen ihrer Arbeit nach oder waren auf dem Weg dahin. Alle, bis auf ihn. Er hatte dem eintönigen Alltag noch nie etwas abgewinnen können. Das ständige Untertauchen in der Masse; niemals allein, niemals ein Moment der Ruhe. Wozu all die Mühe? Was sollte der Aufwand? Musste es nicht noch etwas anderes geben, als nur tagein, tagaus zu arbeiten?
Nicht zum ersten Mal musste er sich diese Fragen stellen: Was ist es, was die Elaborä vorantreibt? Woraus beziehen sie ihre Motivation?
Ihm selbst war das stetige Streben nach Fortschritt, das ewige Ringen um bessere technische Lösungen, zutiefst suspekt. Der Fortschritt sollte ihr aller Leben leichter, angenehmer machen. In Wahrheit machte der Druck seine Mitelaborä krank. Wieso konnte man sich nicht mit dem zufriedengeben, was man hatte? Oder zumindest die ganze Sache mit dem Fortschritt etwas ruhiger angehen? Das Leben musste doch noch mehr bereit halten. War es nicht so schon kurz genug?
So war er zufrieden mit seiner Aufgabe, sich immer wieder um einige heranwachsende Elaborä zu kümmern. Eine Aufgabe, die ihm genügend Zeit ließ, sich seiner eigentlichen Leidenschaft zu widmen. Nur selten musste er Seminare besuchen, musste sich in pädagogischen- und Rechtsfragen weiterbilden. Ansonsten hatte er, solange seine Schützlinge in der Schule waren, viel Zeit sich anderen Dingen zu widmen.
Mit seinen Ansichten und Wünschen stand er allerdings ziemlich alleine da. Niemand konnte seine Empfindungen teilen. Überhaupt, die anderen waren so ganz anders als er. Keiner hatte einen Sinn für all die Schönheit um sie herum. Niemand benutzte seine Augen in der Art, wie er es tat. Keiner sah, wie das sich fächernde Licht die obersten Wasserschichten durchbrach und unzählige Felsformationen aus dem Dunkel herausschälte. Die Bündel der Lichtstrahlen, die sanft, unzähligen Fingern gleich, das flüssige Medium erhellten. Mächtige, spitze Klippen, die sich unter und über Wasser vom hellen Himmel abhoben, wie die Luft vom flüssigen Element. All das nahm kaum einer wahr. Eigentlich war es auch nicht verwunderlich, denn der Gesichtssinn war hier unter Wasser meist von nur eingeschränktem Nutzen. Viel zu oft war das Element, für das sie geboren worden waren, zu trübe, als dass man sich auf seine vier Augen alleine hätte verlassen können. Auch die Tatsache, dass die Elaborä in ihrer gesamten Entwicklungsgeschichte immer wieder das trockene Land aufgesucht hatten, änderte daran nicht wirklich viel. Die Spezies war auf ein Leben unter Wasser geprägt. Die visuelle Wahrnehmung war bei ihnen allen vorhanden, doch sie spielte nur eine untergeordnete Rolle. Sicher würden die meisten der Elaborä von sich behaupten, sie sähen gut, doch die größte Bedeutung hatten ihrer aller Augen nur für die Kommunikation. Kaum jemand kam auf die Idee, dass man auch seine Umwelt mit den Augen erfassen konnte. Sicher sahen alle, wie es um sie herum aussah, doch kaum einer nahm es bewusst wahr; nahm die Schönheit um sie alle herum aktiv in sich auf. Schlimmer noch, es hatte für niemanden eine Bedeutung. Wie sollte so jemals Beachtung finden, was er schuf? Was er tat, tat er wohl einzig für sich allein. Oder sollte es unter den Milliarden gehetzten Elaborä andere geben, die genauso empfanden wie er? Andere, die die Schönheit zu schätzen wussten und sich nicht nur im Farbenspiel ihrer Unterredungen ergötzten? Wie wahrscheinlich war das? Das Auswählen der Embryonen verhinderte wohl das Aufkommen anderer Wahrnehmungen. So gesehen war er ein Unfall der technisierten Zuchtwahl.
Er nahm den Stift und zog eine Linie. Dunkel durchbrach sie den hellen Zeichengrund. Stark und mächtig einerseits und doch verloren in der Einöde des weißen Papiers. Nur eine Ahnung der Tiefe, ein Hauch der unergründlichen Gefahr, tat sich mit der Linie auf. Er musste noch viele Details einarbeiten, bis das Gefühl, das ihn nun durchdrang, auch im Anblick des Bildes wahrhaftig werden würde. Doch seine Werkzeuge waren nicht ideal. Sie waren für ganz andere Zwecke gemacht. Ja, er war nicht der Einzige, der zeichnete; doch die anderen taten dies ausschließlich um technische Entwürfe zu fertigen. Kurze Skizzen einer Idee zu einer neuen technischen Lösung. Ein neuer Motor, ein neues Boot, oder eine Rakete, mit der man nach den Sternen griff. Früher, vor Jahrhunderten, war das Zeichnen aus eigener Hand noch weit bedeutsamer gewesen. Heute übernahm diese Arbeit zumeist ein Computer. Selbst das Schreiben ging heutzutage kaum noch jemanden von der Hand. Dazu gab es mittlerweile Geräte, die erkennen konnten, was ihr Besitzer ausdrückte und was er niedergeschrieben haben wollte. Wann immer etwas wichtig genug war, kopierte die Maschine die Farben der Rede und speicherte sie ab. So war es für Bonar nicht einfach, die alten Werkzeuge, Papier, Stifte oder gar Farben zu besorgen. Nicht zum ersten Mal machte er sich Gedanken, seine Utensilien selbst herzustellen. Werkzeuge, mit denen er die Allmacht der Natur viel besser würde darstellen können. Doch vorerst musste er sich mit dem zufriedengeben, was er hatte.
Nun saß er da und wusste nicht, wie er die Szene einfangen sollte. Das Farbenspiel des einfallenden Lichtes fächerte Felsen und Pflanzen in einer ganz außergewöhnlichen Vielfalt vor ihm auf. Wenn auch die Farben lange nicht von der Überschwänglichkeit waren, wie dies auf dem trockenen Land der Fall war, so offenbarten sie dennoch eine ungeheure Pracht. Die Farben, die hier vorherrschten, boten einen krassen Kontrast zur Welt oberhalb des Wasserspiegels. Dort offenbarten kräftige Gelb- und Ockertöne, erdrückendes, scharf abgegrenztes Grau und Schwarz, eine feindliche, eine abstoßende Umwelt. Auch solche Szenen hatte er gemalt, übten sie doch, gerade ihrer Feindlichkeit wegen, eine kaum zu widerstehende Faszination aus; lieber waren ihm aber dennoch die lebendigen Unterwasserszenen. Dies war seine Heimat, hier waren er und seine Artgenossen zuhause. Er wollte festhalten, was er sah. Er wollte den Augenblick bewahren. Ja mehr noch, er wollte über das Visuelle hinaus, auch alle seine anderen Eindrücke festhalten. Die Reflexionen des Schalls von den harten schroffen Felswänden und dem weichen sandigen Boden genauso, wie den Geruch der Tiere, die um ihn herum schwammen, und den Pflanzen, die sich sanft in der Strömung wogen; den seichten Wasserdruck, verursacht durch die ständig wechselnde Strömung. Wie sollte dies alles auf einer zweidimensionalen Fläche gelingen? Es würde nicht einfach sein, doch er musste es versuchen.
„Wie kommen Sie voran?“
Erschrocken fuhr Walg, ob des unfreundlichen Farbtons der Frage, von seiner Arbeit hoch. Das Geräusch, das der Marschall beim Eintreten, allein um auf sich aufmerksam zu machen, gemacht hatte, noch immer in den Gliedern. Was sollte er sagen? Was sollte er Marschall Traul, dem obersten Leiter des Projektes, offenbaren? Noch hatte er nicht viel herausgefunden. Die Sprache der fremden Lebensform, behielt ihre Geheimnisse noch weitgehend für sich.
Trotz seiner Abgebrühtheit, zeichnete sich auf seinem Panzer eine leichte Grünfärbung ab, als er zu antworten begann: „Es ist nicht leicht.“
Traul blickte unzufrieden drein; die Hände, an deren Gliedern das überschüssige Fett unter den Platten hervorquoll, provokant in die Seiten gestützt. Ein Ausbund an Überheblichkeit. Und dennoch verursachte sein Anblick, bei einem jeden, der ihm gegenüber stand, ein kaum zu ertragendes Gefühl des Verlorenseins. So jämmerlich, ja krank, der Militär auch wirken mochte, die Macht, die von ihm ausging, vermochte es, einen jeden zu erdrücken. Nein, dieser Elabora wollte keine Ausflüchte sehen. Natürlich war es nicht leicht. Wie sollte es auch? Doch war ihm der Mathematiker nicht auch deshalb empfohlen worden? Wenn es jemanden gelingen würde, dann diesem Walg. Und wenn er scheiterte, so war das ganze Projekt der Mühe nicht wert. Und das wäre eine Option, die ihm alles andere als ungelegen käme. Er hatte Wichtigeres zu tun. Als oberstem Militär musste er für Ordnung und Sicherheit sorgen. Der Auftrag der Regierung war eindeutig: Er musste störende Elemente ausfindig machen und eliminieren. Zum Glück fügten sich die meisten der Elaborä in ihre Aufgaben; doch gab es auch welche, die aufwieglerisch, die gefährlich waren. Fand er solche, so zögerte er nicht; niemals sollte wieder jemand von diesen hören. Er hoffte nur, dass er mit diesem Wissenschaftler nicht in ähnlicher Weise verfahren musste. Eine Person, die derart im öffentlichen Interesse stand, konnte er nicht so leicht verschwinden lassen. Umso wichtiger war ihm, was der Mathematiker zu berichten hatte.





























