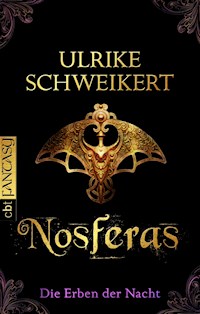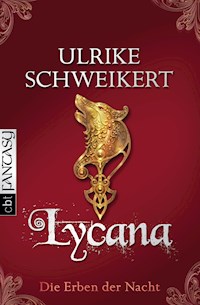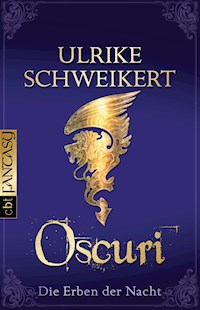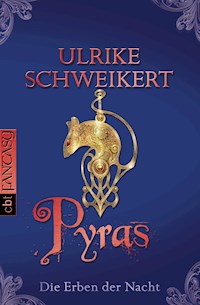5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In den Wirren des Krieges folgt sie dem Ruf ihres Herzens ...
Württemberg 1620. Der Dreißigjährige Krieg zieht über Europa auf und birgt einen tragischen Schicksalsschlag für die Hebamme Sibylla: Plündernde Landsknechte aus Flandern erschlagen ihren Mann und entführen ihre kleine Tochter Helena. Sibylla, die seit ihrer Kindheit die Gabe des zweiten Gesichts besitzt, begibt sich auf den Spuren der Söldner nach Süden. Sie spürt, dass ihre Tochter noch lebt. Als sie auf das Lager des Feldherrn Wallenstein trifft, gibt sie sich als Astrologin aus und willigt ein, ihm weiszusagen, wenn er ihr bei der Suche nach Helena hilft. Doch kann sie Wallenstein trauen? Wird er die schöne Sibylla wieder gehen lassen, wenn sie ihr Ziel erreicht hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 776
Ähnliche
Buch
Württemberg 1620. Der Dreißigjährige Krieg zieht über Europa auf und birgt einen tragischen Schicksalsschlag für die Hebamme Sibylla: Plündernde Landsknechte aus Flandern erschlagen ihren Mann und entführen ihre kleine Tochter Helena. Sibylla, die seit ihrer Kindheit die Gabe des zweiten Gesichts besitzt, begibt sich auf den Spuren der Söldner nach Süden. Sie spürt, dass ihre Tochter noch lebt. Als sie auf das Lager des Feldherrn Wallenstein trifft, gibt sie sich als Astrologin aus und willigt ein, ihm zu weissagen, wenn er ihr bei der Suche nach Helena hilft. Doch kann sie Wallenstein trauen? Wird er die schöne Sibylla wieder gehen lassen, wenn sie ihr Ziel erreicht hat?
Autorin
Ulrike Schweikert arbeitete nach einer Banklehre als Wertpapierhändlerin und studierte Geologie und Journalismus. Sie ist eine der erfolgreichsten und meistgelesenen deutschen Autorinnen historischer Romane. Ulrike Schweikert hat ein besonderes Talent dafür, faszinierende Frauenfiguren zum Leben zu erwecken, was sie in diesem Roman erneut unter Beweis stellt. Ulrike Schweikert lebt und schreibt in der Nähe von Stuttgart.
Von Ulrike Schweikert bereits erschienen:
Das Siegel des Templers · Die Dirne und der Bischof · Die Herrin der Burg · Das Kreidekreuz · Das Antlitz der Ehre · Das kastilische Erbe · Das Vermächtnis von Granada
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Ulrike Schweikert
Die Astrologin
Historischer Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2016 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotive: Arcangel Images/Svetlana Sewell; www.buerosued.de
Karte: Jürgen Speh
WR · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19992-0V002www.blanvalet.de
Prolog
Prag, Mai 1618
»Das Maß ist voll! Wir lassen uns das nicht länger bieten. Die Stände haben Ferdinand zum König von Böhmen gewählt und ihm ihr Vertrauen ausgesprochen – trotz großer Bedenken, das muss ich betonen. Auch ein König muss Verträge und Gesetze achten. Kaiser Rudolf hat in seinem Majestätsbrief von 1609 allen Protestanten Böhmens die Freiheit ihres Glaubens zugesichert. Daran hat sich Kaiser Matthias gehalten, und das muss nun auch König Ferdinand!«
Graf von Thurn schlug mit der Faust auf das Pult vor sich. Die versammelten Vertreter der protestantischen Stände applaudierten.
Heinrich Matthias von Thurn strich sich über seinen dichten, ergrauten Bart. Schweiß stand ihm auf der hohen Stirn, die von Falten zerfurcht wurde. Der Tag war gekommen. Heute würde Böhmen Geschichte schreiben: Niemals mehr würde Böhmen von den Habsburgern herumgeschubst werden und zum Objekt seiner papistischen Zukunftsträume gemacht. Sollten sie in Wien so viele Marienstatuen aufstellen, wie sie wollten, hier in Prag wehte der freie Wind des neuen Glaubens.
Der Graf ließ einige Augenblicke verstreichen, ehe er sich wieder Gehör verschaffte und weitersprach. »Die Zeit ist gekommen, dem König die Stirn zu bieten. Dieser Brief kommt einer Kriegserklärung gleich.« Er hob das Schreiben in die Höhe, das die Gemüter derart in Wallung gebracht hatte. »Wir nehmen es nicht länger hin, dass er Protestanten auf den königlichen Gütern unterdrückt und uns unsere Kirchen raubt. Und wir lassen uns auch unsere Protestantentage nicht verbieten. Weder von König Ferdinand noch von Kaiser Matthias oder wer auch immer diesen Brief im Namen des Kaisers verfasst hat.«
Wieder erhoben sich die Stimmen. Der Ton wurde rauer. Die Worte schärfer. Gut so. Die Menge war bereit, zum Hradschin zu ziehen, um den Statthaltern auf der Königsburg ihre Antwort zu überbringen. Eine Antwort, die mit Blut geschrieben sein würde. Pergament und Tinte waren genug verschwendet worden. Die heutige Tat der böhmischen Stände würde die Aufmerksamkeit des Königs Ferdinand erringen. Dieses Mal würde er sich nicht mit einem Achselzucken seinem Jagdvergnügen zuwenden und es seinen Statthaltern von Prag überlassen, den Ständen zu antworten.
»Auf die Burg!«, rief der Graf. Die Adels- und Kirchenmänner nahmen den Ruf auf.
Die Menge setzte sich in Bewegung und stürmte über die Brücke zur Prager Kleinseite hinüber. Ihr Zorn ließ sie die Steige zum Hradschin hinaufeilen, weiter an der St.-Georgs-Basilika vorbei zum alten Königspalast, wo neben dem großen Saal die Kanzleiräume der Statthalter zu finden waren. Die Männer drängten in den Sitzungssaal, wo nur vier der zehn Statthalter sie erwarteten, obgleich Graf Thurn ihr Kommen angekündigt hatte.
Er spürte, wie der Zorn sich in seiner Brust zusammenzog. Jede kleine Demütigung glich einem Stich in sein Herz. Nun gut, sie würden dennoch ihre Botschaft heute deutlich machen.
Graf von Thurn ließ den Blick über die Vertreter des Königs schweifen. Der Oberstburggraf Adam von Sternberg war da und der Burggraf von Karlstein, Jaroslav von Martinitz, Sternbergs Schwiegersohn, außerdem der Großprior des Malteserordens Diepold von Lobkowitz, ein guter Mann, ganz im Gegensatz zu dem Oberstlandrichter Wilhelm von Slavata. Von Thurn schürzte die Lippen. Im Hintergrund erkannte er noch einen der Sekretäre.
Der Streit war bereits in vollem Gange. Die Vertreter der Stände verlangten zu erfahren, wer wirklich für das Antwortschreiben des Kaisers verantwortlich sei. Die Statthalter aber verweigerten die Antwort und verschanzten sich hinter ihrem Eid, dass Verhandlungen der Geheimhaltung unterlägen.
Graf von Thurn erhob seine Stimme, die den Saal durchdrang. »Wir verlassen diesen Raum nicht, ehe wir erfahren, wem wir diesen ›Kaiserbrief‹ verdanken! Also: Ist einer von Euch hier dafür verantwortlich? Ja oder nein?«
Der Beifall der Ständevertreter auf seine harschen Worte artete in einen Tumult aus.
»Uns ist bewusst, dass Ihr nichts damit zu tun habt«, versicherte er dem Oberstburggrafen und dem Prior mit einer angedeuteten Verbeugung, um sich dann mit grimmiger Miene den anderen beiden Statthaltern zuzuwenden. Der Kreis um sie wurde enger. Die Luft schien zu vibrieren wie bei einem Gewitter, bevor der erste Blitz niederfuhr.
»Die beiden haben den Brief verfasst!«, sprach der böhmische Adelsmann Colonna von Fels endlich aus, was die aufgebrachte Menge längst zu wissen glaubte, und deutete auf Martinitz und Slavata, die keinen Ton herausbrachten. Vielleicht war ihnen bewusst, dass es zwecklos sein würde, jetzt noch zu leugnen. Der Stab war über ihnen gebrochen.
»Verlasst den Saal, ich bitte Euch«, forderte Graf von Thurn die Herren von Sternberg und Lobkowitz auf. »Es ist besser für Euch.«
Doch sie schüttelten halsstarrig den Kopf.
»Schafft sie raus, ehe ihnen etwas geschieht!«, befahl von Thurn.
Einige Männer packten die beiden und zerrten sie aus dem Saal. Die Tür schlug krachend zu.
»Und nun zu Euch, meine feinen Herrn!« Graf von Thurn sah Jaroslav von Martinitz und Wilhelm von Slavata voller Verachtung an. »Ihr wisst, wie wir so etwas in Böhmen handhaben?«
Martinitz stieß einen Schrei aus, doch da wurde er schon durch den Raum geschleift. Vergeblich wehrte er sich gegen die Übermacht. Sie hoben ihn hoch und warfen ihn durch das Fenster der Schreibstube.
Ein »Jesus Maria« entfuhr ihm noch, als er fast zwanzig Schritte tief in den steil abfallenden Graben stürzte, der die Südseite des Burgbergs umgab.
»Na, da wollen wir mal sehen, ob ihm seine Maria wirklich hilft«, spottete der Ritter Ulrich von Kinsky. Er beugte sich vor und stieß einen Ruf der Verblüffung aus. »Bei Gott, seine Maria hat ihm tatsächlich geholfen. Seht, er lebt noch und scheint nicht sonderlich schwer verletzt.«
Die Männer drängten sich an die Fenster, um das Wunder zu sehen. Graf von Thurn griff nach Wilhelm von Slavatas Handgelenk. »Ihr bleibt schön hier!«, raunte er ihm zu und sah mit Befriedigung, wie der Funke von Hoffnung, der in seinen Augen aufgeblitzt war, wieder erlosch.
»Edle Herren«, rief er laut, »hier habt Ihr den anderen!«
Und so zogen sie auch den Oberstlandrichter zum Fenster und beförderten ihn über die Brüstung. Slavata ergriff das Fensterkreuz und klammerte sich in seiner Verzweiflung fest, doch einer seiner Henker schlug mit einem Degengriff auf seinen Handrücken, bis er mit einem Aufschrei losließ.
Graf von Thurn beugte sich vor. Er sah, wie sich Slavata an einem der unteren Fenstersimse eine Wunde am Kopf zuzog, neben Martinitz im Graben landete und dann in den Morast hinabrollte. Auch der bedauernswerte Sekretär flog hinterher, obgleich der mit der Sache vermutlich nichts zu tun hatte.
Doch was war das? Graf von Thurn wollte seinen Augen nicht trauen. Nicht nur Martinitz schien einen Schutzengel an seiner Seite gehabt zu haben. Auch der Sekretär erhob sich nahezu unverletzt. Beide schlitterten zu Slavata hinunter, der sich stöhnend den blutigen Kopf hielt und sich wohl an der Hand verletzt hatte. Doch auch er schien mit dem Schrecken davongekommen zu sein.
Der Graf unterdrückte einen Fluch. Das durfte doch nicht wahr sein! Da musste der Teufel seine Hand im Spiel gehabt haben, oder waren ihre dicken Mäntel, die den Aufprall auf dem steil abfallenden Hang gedämpft hatten, ihre Rettung gewesen?
Er wusste es nicht, doch es stieß ihm sauer auf, dass sie die Rolle in dem von ihm so sorgfältig geplanten Stück nicht so spielten, wie sie ihnen zugedacht war. Egal, die Botschaft der protestantischen Stände an den König und den Kaiser war deutlich, und eine Antwort aus Wien würde sicher nicht lange auf sich warten lassen.
»Und wie geht es jetzt weiter?«, erkundigte sich Colonna von Fels, als die drei durch den Graben davonhumpelten.
»Schickt ihnen ein paar Kugeln hinterher, vielleicht erwischen wir sie noch, und dann wählen wir so schnell wie möglich unser Direktorium. Wir müssen uns darauf vorbereiten, was von Wien aus auf uns zukommen wird. Kaiser Matthias und König Ferdinand müssen nun unseren Forderungen nachkommen oder sich holen, was sie ihr Recht glauben.«
Von Fels wiegte den Kopf. »Wir sollten ein Heer aufstellen. Der König ist schwach, aber ich denke, er wird trotzdem nicht kampflos abdanken und es unserem Direktorium überlassen, die Wenzelskrone an einen anderen Kandidaten zu vergeben, der unsere Freiheiten respektiert.«
Graf von Thurn nickte. »Ja, das denke ich auch. Und wenn mich die Stände zu ihrem Generalleutnant wählen, dann will ich Euch als meinen Feldmarschall an meiner Seite.«
»Gern. Jedenfalls sollten wir uns schnell entscheiden und mit dem Werben beginnen. Soweit mir bekannt ist, haben die böhmischen Stände keinen einzigen Mann unter Waffen.«
»Ihr sagt es«, bestätigte Graf von Thurn mit einer Grimasse.
In Wien lag der Kaiser krank im Bett, als ihm seine Erzherzöge schonend von dem Versuch berichteten, seine Prager Minister zu beseitigen. Vor Zorn biss die Majestät in ihr Betttuch. Eine Woche lang schäumte Matthias vor Wut, doch dann beruhigte er sich wieder und überließ es seinem Cousin Ferdinand als König von Böhmen, sich um das Problem zu kümmern.
Der Obrist der mährischen Stände, Albrecht Wenzel von Waldstein, verzog höhnisch den Mund, als er von den Vorgängen in Prag erfuhr.
»Böhmische Toren«, murmelte er. »Sie können nicht einmal ihre Statthalter richtig über die Klinge springen lassen.«
Kapitel 1
Leonberg, Sommer 1620
Es war ein nasskalter Morgen. Nebelschwaden zogen durch die Gassen. Ein grauer Himmel drückte mit tief hängenden Wolken auf die Stadt. Fröstelnd griff Sibylla nach ihrem Wolltuch und schlang es sich um die Schultern.
»Man sollte nicht glauben, dass wir noch immer August haben«, brummte sie missmutig, als sie nach dem Schürhaken griff, um die über Nacht sorgsam gehütete Glut wieder anzufachen. Sie legte ein paar dünne Späne darüber, wartete, bis die ersten Flammen an ihnen emporzüngelten, und schob erst dann einen dicken Scheit in den Ofen. Mit einem Holzlöffel rührte sie den am Vorabend eingeweichten Getreidebrei durch, gab Butter und ein wenig Honig hinzu und rührte ihn weiter, bis er warm war.
Schritte näherten sich der Küche. Ein kalter Luftzug umwehte ihre Füße, als sich die Tür öffnete. Doch dann legten sich zwei wärmende Männerarme um ihre Taille.
»Ich wünsche dir einen guten Morgen, meine Liebste. Habe ich verschlafen? Das tut mir leid. Warum hast du mich nicht geweckt?«
Sie wandte sich um und erwiderte die Umarmung. Für einen Moment schloss Sibylla die Augen und atmete genießerisch den noch bettwarmen Geruch ihres Gatten ein.
»Ich wünsche dir auch einen guten Morgen, lieber Peter«, antwortete sie. »Und nein, du hast nicht verschlafen. Ich bin früh dran, um euch das Essen zuzubereiten. Aber wenn du schon auf bist, kannst du dich auch gleich zu mir an den Tisch setzen.«
Er vergrub sein Gesicht in ihr langes goldblondes Haar, das sie so früh am Morgen noch nicht aufgesteckt und unter einer Haube verborgen hatte. Im Schein des Herdfeuers schienen kleine Flammen über ihre Locken zu huschen. Ihrem Haar jedenfalls sah man die Jahre nicht an, die vergangen waren, seit sie mit Peter Berchtold nach Leonberg gekommen war. In ihrem Gesicht jedoch glaubte sie, die ersten Fältchen entdecken zu können, auch wenn ihr Mann das stets bestritt. Er wurde nicht müde, ihr zu versichern, dass sie mit ihrer schlanken Gestalt und dem seit der Geburt des Kindes etwas üppigeren Busen die schönste Frau war, die ihm jemals unter die Augen gekommen sei. Er liebe alles an ihr, sogar die kleinen Sommersprossen auf ihrer Nase.
Sie versicherte ihm mit einem warmen Lächeln, dass auch sie ihn liebe und dass sie glücklich sei, einen so gut aussehenden Mann geheiratet zu haben. Und das war er, groß und stattlich, das sandfarbene Haar stets sorgfältig geschnitten, der Bart sauber gestutzt. Seine Haltung hatte stets etwas Vornehmes, was ihm nicht von allen Seiten Sympathie eintrug, doch Sibylla mochte es. Sie verstand nicht, wie manche dazu kamen, ihm Hochmut vorzuwerfen. Dabei musste man nur einen Blick in seine braunen Augen werfen, um zu wissen, was für ein durch und durch guter Mensch er war.
Ein Geruch stieg ihr in die Nase.
»Oh nein!« Sibylla stieß einen Schrei aus, wand sich aus seinen Armen und begann hektisch den aufspritzenden Brei umzurühren. Mit einem Zipfel ihrer Schürze umfasste sie den heißen Griff des Kessels und zog ihn vom Herd.
»Jetzt wäre mir der gute Brei fast angebrannt!«, schimpfte sie und warf ihrem Mann einen strafenden Blick zu.
Peter runzelte die Stirn. »Willst du mir verbieten, mein eigenes Weib zu umarmen? Liebst du mich denn nicht mehr?«
»Natürlich liebe ich dich, du dummer Mann.« Sibyllas Ausdruck wurde weich. »Aber wenn das Frühstück verbrennt, haben wir nichts zu essen und müssen hungrig zur Arbeit gehen.«
»Oder schnell zum Bäcker laufen und uns ein paar Kreuzerwecken besorgen«, widersprach er.
»Ach ja? Und dann bereits nach der Hälfte des Monats ohne einen Heller dastehen?«
Sibylla sah, wie ein gequälter Ausdruck in seine Miene stieg, und sie hätte sich auf die Zunge gebissen, hätte sie den letzten Satz dadurch zurücknehmen können.
»Ich weiß, dass ich zu wenig verdiene«, sagte er leise.
»Ach was, es reicht doch«, widersprach sie schnell. »Und außerdem bringt meine Arbeit auch noch etwas ein. Es gibt auch heute wieder etwas zu tun. Deshalb bin ich so früh aufgestanden.«
Sie deutete auf ihre Hebammentasche, die fertig gepackt neben der Tür stand, doch die Miene ihres Mannes blieb unverändert. Er stellte drei Tonschalen auf den Tisch und legte neben jede einen Löffel, während Sibylla Pflaumenmus und eine Schüssel frische Himbeeren dazustellte. Als sie zwei der Schalen mit dem dicken Brei gefüllt hatte, nahm er sie noch einmal in seine Arme.
»Du solltest aber nicht arbeiten müssen. Es wäre meine Aufgabe, meine Familie zu ernähren, während du dich um unsere Kinderschar kümmerst.«
Sibylla küsste ihn auf die Nase, dann schob sie ihn energisch von sich, setzte sich auf die Bank und griff nach ihrem Löffel. »Ich arbeite aber gern. Wozu bin ich sonst so viele Jahre bei Ursula Benzlin in die Lehre gegangen? Und außerdem ist es vielleicht ein Segen, dass wir keine ganze Kinderschar durchfüttern müssen. Wir haben eine gesunde Tochter. Dafür sollten wir Gott danken.«
»Er will mich für meine Sünden strafen, und du musst dafür leiden.«
Sibylla machte eine wegwerfende Handbewegung. »Nicht jede schwere Geburt ist eine Strafe Gottes, und außerdem gibt es schlimmere Schicksale. Jedes Jahr ein Kind zu gebären und es dann wieder sterben zu sehen wie die Wiedeckerin, das ist eine Prüfung, an der man zugrunde gehen kann. Ich bin mit meinem Los zufrieden, und das solltest du auch sein.« Energisch tauchte sie den Löffel in ihre Schale und schob sich das süße Mus in den Mund.
»Dennoch hättest du Besseres verdient, als mit einem armen Schulmeister verheiratet zu sein«, beharrte er auf seinem Standpunkt.
Sibylla unterdrückte einen Seufzer. Sie liebte ihren Mann von Herzen, doch wenn er dieser trüben Stimmung verfiel, war es für sie schwer, ihn da wieder herauszuholen.
»Ich bin lieber die Gattin eines Schulmeisters als die heimliche Sünde eines Pfarrers!«
Peter Berchtold zuckte zusammen. Das waren offensichtlich nicht die richtigen Worte gewesen, ihn aufzuheitern, doch sie legte noch einmal nach.
»Wenn du dich endlich zu Luthers Lehre bekennen würdest, könntest du sicher sofort die Stelle als Kaplan bekommen, die schon so lange unbesetzt ist.«
Peter schüttelte energisch den Kopf. »Nein, du weißt, das kann ich nicht.«
»Weil wir in deinen Augen Ketzer sind?«, fuhr sie ihn schroffer an, als sie es vielleicht beabsichtigt hatte.
»Nein, du weißt, dass ich das nicht denke. Ich schätze die Menschen hier in Leonberg, die mir eine neue Heimat gegeben haben, und ich akzeptiere ihren Glauben. Aber ich wurde katholisch getauft und zum Priester geweiht. Ich kann meinem Gott nicht untreu werden.«
Sie unterdrückte die Frage, ob er das nicht längst getan hatte. »Glauben wir nicht an denselben Gott?«, fragte sie stattdessen.
»Ja, schon, und trotzdem …« Er hob hilflos die Schultern. An diesem Punkt kamen sie wie so oft einfach nicht weiter. Peter besuchte zwar wie alle anderen in Leonberg mit seiner Familie den lutherischen Gottesdienst, doch in seinem Innern war er noch immer katholisch.
»Würdest du lieber in Ellwangen leben?«, fragte Sibylla leise.
Allein der Name der Stadt ließ ihn zusammenzucken. »Nein!«, rief er. »Wie könnte ich, nach all dem, was dort geschehen ist. Nach all den Prozessen und den unschuldigen Opfern auf dem Scheiterhaufen? Nein, ich bin glücklich, mit dir hier eine neue Heimat gefunden zu haben.«
»In Leonberg sind wir in Sicherheit«, stimmte Sibylla ihm zu.
Er öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch er schloss ihn wieder, als sich die Tür öffnete und ein Mädchen von acht Jahren in einem langen weißen Nachthemd in die Küche trat. Verschlafen sah es sich um.
»Ist es schon so spät?«, erkundigte sich das Kind und zog einen Schmollmund. »Bekomme ich nichts?«
Sibylla sah, wie sich das Gesicht ihres Mannes aufhellte, als er seine Tochter sah.
»Mein Schatz, natürlich bekommst du etwas! Komm zu mir. Sieh, es gibt noch welche von den Himbeeren, die du gepflückt hast«, begrüßte er sie strahlend.
Die Himbeeren zauberten ein kurzes Lächeln auf ihr Gesicht, als sie neben ihrem Vater Platz nahm, doch dann wurde ihre Miene wieder mürrisch.
»Ich kann heute nicht zur Schule gehen«, behauptete sie.
»Nein? Warum nicht?«, erkundigte sich Sibylla.
»Mir ist nicht gut.«
»Was fehlt dir denn, mein Schatz?«, mischte sich ihr Vater mit echter Besorgnis in der Stimme ein, während Helena überlegte.
»Mein Bauch tut mir weh«, sagte sie schließlich.
»Sibylla? Du hast doch sicher einen Kräutersud, der ihr hilft?«
Sibylla schwankte zwischen Ärger und Belustigung, als sie das Entsetzen im Gesicht ihrer Tochter sah.
»Ich habe da durchaus etwas, das ganz schrecklich schmeckt, aber bestimmt hilft«, behauptete sie leichthin.
»Ich weiß nicht«, gab Helena gedehnt zurück. »Vielleicht ist es besser, wenn ich einfach wieder ins Bett gehe?«
Peter Berchtold sah seine Frau Hilfe suchend an. »Was hat sie nur immer? Mal ist es der Bauch, dann der Kopf und dann wieder ist ihr übel. Sie ist doch nicht ernsthaft krank?«
»Nein, Helena will nur nicht zur Schule gehen, nicht wahr?«
Das Kind lief rot an und senkte den Blick auf die Tischplatte.
»Das kann nicht sein!«, widersprach Peter entrüstet. »Die Kinder haben überhaupt keinen Grund, sich vor meinem Unterricht zu fürchten. Ich schlage sie nicht oder zwinge sie, meine Gunst mit Brennholz oder Essensgaben zu erkaufen.«
Sibylla legte beruhigend ihre Hand auf die seine. »Ich weiß. Es sind andere Zeiten eingezogen, seit du den Posten von Schulmeister Beutelspacher übernommen hast. Ich erinnere mich noch gut an die vielen Stockschläge, die Anna und ich damals einstecken mussten. Und wie wir im Winter Holz geschleppt haben, um nicht zu erfrieren, oder ihm den größten Teil unseres Mittagsmahls gegeben haben, um seinen schmierigen Tatzen zu entgehen.«
»Das gibt es bei mir nicht. Keiner meiner Schüler hat je mehr als eine Ohrfeige einstecken müssen. Und das auch nur die, die besonders frech und respektlos waren.«
»Ich weiß, mein Liebster. So einen Schulmeister wie dich hätten wir uns früher gewünscht«, versicherte ihm seine Frau.
»Und warum will Helena dann nicht in die Schule gehen und bekommt stattdessen Bauchschmerzen?«, verlangte er zu wissen.
»Die anderen behaupten, dass es mir besser ginge und ich von dir bevorzugt würde«, piepste Helena. »Ich könnte es mir gut gehen lassen, während sie hart rangenommen würden.«
»Das ist eine infame Lüge!«, brauste Peter auf. »Ich habe dich nie bevorzugt. Ja, ich denke gar, dass ich mehr von dir verlange als von den anderen Kindern. Du bist meine Tochter! Es ist mir wichtig, dass du eine tadellose Schülerin bist.«
Sibylla schenkte ihrem Mann einen milden Blick. »Das ist vermutlich das Problem. Sie hat Angst, sich und damit dich vor der Klasse zu blamieren, ist es nicht so?« Helena nickte. »Und vermutlich hat sie gestern mit ihren Freundinnen so viele Himbeeren gepflückt, dass sie die Rechenaufgaben nicht geübt hat, wie sie es hätte tun sollen.«
Der Blick, den Helena ihrem Vater zuwarf, sprach Bände und war dazu geeignet, auch den härtesten Mann zum Schmelzen zu bringen.
»Jedenfalls denke ich, dass wir auf den Kräutersud verzichten können und ihr beide das mit dem Rechnen schon hinbekommt«, schloss Sibylla, schob ihre leere Schale von sich und erhob sich.
»Ich muss jetzt gehen und nach der Tochter von Richter Mochel sehen. Die Wehen haben vor einer Stunde eingesetzt.« Sie trat zu Helena, küsste ihre Stirn und gab auch ihrem Mann einen Kuss. »Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Es ist das erste Kind. Es könnte sich also hinziehen. Macht euch etwas zu essen, wenn ich heute Mittag noch nicht da bin.«
»Sei vorsichtig«, riet Peter. »Ich bete darum, dass alles gut geht.«
Sibylla spürte seine Besorgnis und lächelte ihn beruhigend an. »Es wird schon gut gehen. Bislang verlief die Schwangerschaft ohne besondere Schwierigkeiten.«
»Und doch kommen immer wieder Kinder oder Mütter oder gar beide unerwartet bei der Niederkunft zu Tode«, erwiderte ihr Mann bedrückt.
»Ja, auch das gehört zum Leben. Das müsstest gerade du wissen.«
Er atmete tief aus. »Ich weiß, dass unser Leben in Gottes Hand liegt, aber ich weiß auch, dass die Leute nur allzu oft den Teufel mit ins Spiel bringen oder die Schuld ihren Mitmenschen in die Schuhe schieben. Dann geht das Gerede los, Verdächtigungen werden getuschelt und eilen wie ein Lauffeuer durch die Stadt.«
»War das nicht schon immer so? So sind die Menschen eben.«
»Ja, es war schon immer so, doch seit Lutherus Einhorn zum Vogt ernannt wurde, darf man das dumme Gerede nicht mehr mit einem Schulterzucken ignorieren. Der will gern noch die eine oder andere Hexe brennen sehen!«
Sibylla wandte sich noch einmal um und schlang ihre Arme um ihn. Für einen Moment waren sie beide in ihren schlimmen Erinnerungen von Kerkerhaft und Folter gefangen und von Menschen, die qualvoll bei lebendigem Leib im Feuer der Scheiterhaufen verbrannten.
»Ich will noch was essen!«
Helenas Stimme durchbrach die Finsternis und brachte sie in die Gegenwart zurück. Sibylla löste sich von ihrem Mann und griff nach ihrer Tasche. »Ich muss jetzt gehen. Lass dich von deinem Vater verwöhnen.«
Sie tätschelte ihr das Haar, das dem ihren so ähnlich war, und erlaubte sich für einen Moment, an ihre tote Zwillingsschwester zu denken, deren Name nun ihre Tochter trug. Dann wandte sie sich ab und verließ eilig das Haus.
Sibylla sollte recht behalten. Die Geburt zog sich über Stunden hin, doch am frühen Abend hielt die junge Mutter ihren ersten Sohn in den Armen, und der Richter konnte sich über einen gesunden Enkel freuen. Zufrieden packte Sibylla ihre Hebammentasche und ließ die junge Mutter mit ein paar guten Ratschlägen in der Obhut ihrer Familie zurück.
Beschwingt überquerte sie den Marktplatz und bog dann in eine stille Gasse ein. Aus der anderen Richtung eilte ein Mann mit gesenktem Kopf auf sie zu. Sibylla wich ihm aus, doch in diesem Moment wich auch er zur Seite, sodass sie gegeneinanderstießen. Die schwere Hebammentasche entglitt ihren Händen und polterte zu Boden.
»Verzeihung!«, rief der Mann, ohne sie recht anzusehen. Offensichtlich war er in seine eigenen Gedanken versunken. Die tiefen Falten auf seiner Stirn verrieten Sibylla, dass es keine heiteren sein konnten. Sie betrachtete den Mann neugierig. Mit seiner vornehmen schwarzen Kleidung und dem breiten, gefältelten Kragen passte er nicht recht nach Leonberg. Vielleicht ein Advokat des Herzogs?
»Verzeihung«, sagte er noch einmal, als er sich bückte und ihr ihre Tasche reichte.
»Danke. Es ist nichts passiert, werter Herr.«
Nun sah er sie aufmerksam an, so als versuche er, sich an etwas zu erinnern. Sein Blick wanderte noch einmal zu der Tasche in ihrer Hand. »Natürlich, Ihr seid die Wehmutter, die vor vielen Jahren als Findelkind nach Leonberg kam und bei Ursula Benzlin in die Lehre ging, nicht wahr? Meine Mutter hat mir von Euch erzählt. Ich denke, an Eurem Haar hätte ich Euch sofort erkannt, wenn Ihr es nicht so sorgsam unter Eurer Haube verstecken würdet.«
Sibylla blinzelte verwirrt, doch dann erkannte sie ihn. »Magister Johannes Kepler, oder soll ich Hochwürden sagen?«
Er winkte ein wenig müde ab.
»Ich hätte Euch in Prag vermutet oder in Wien. Der kaiserliche Mathematicus und Astrologe! Ihr habt es wahrlich weit gebracht. Ihr habt die Horoskope für Kaiser und Könige erstellt!«
Wieder wehrte Johannes Kepler ab. »Das habt Ihr von meiner Mutter, nicht wahr?«
»Ja, das ist richtig«, bestätigte Sibylla schmunzelnd. »Sie ließ keine Gelegenheit aus, von ihrem berühmten Sohn zu berichten.«
Kepler stöhnte. »Ich wünschte, sie hätte nur über die Familie geredet und sich nicht durch ihr Gerede über andere so viele Feinde gemacht.«
»Sie hat ein wenig geklatscht, wie alle Weiber in Leonberg«, wandte Sibylla ein. »Das Leben hat ihr sonst nicht viele Freuden geboten.«
»Ja, da habt Ihr recht«, nickte Kepler. »Das Schicksal ist nicht gerade sanft mit ihr umgesprungen. Mein Vater und mein Bruder haben ihr das Leben immer schwer gemacht, doch ich fürchte, ihre härteste Prüfung steht ihr noch bevor.«
Nun nickte auch Sibylla. Sie spürte, wie die Beklemmung nach ihrer Brust griff und ihr die Luft zum Atmen abschnürte. »Sie sitzt noch immer im Obertorturm ein, nicht wahr? Habt Ihr sie besucht?«
»Ja, und es geht ihr nicht gut. Sie wurde peinlich befragt. Der Vogt lässt nicht locker. Er will sie brennen sehen, aber das werde ich nicht zulassen. Ich besorge jedes Gutachten, das er sehen will. Sie ist keine Hexe, und ich werde das beweisen!«
Johannes Kepler ballte die Hände zu Fäusten. Sibylla sah die Verzweiflung in seiner Miene. Es war ein ungleicher Kampf, doch wenn es einer schaffen konnte, seine Mutter vor dem Scheiterhaufen zu retten, dann der Hofmathematiker des Kaisers!
»Ich wünsche Euch, dass Ihr es schafft«, stieß Sibylla voller Inbrunst aus. »Lutherus Einhorn ist ein verblendeter Fanatiker, der – wie so viele Ratsherren und Richter – denkt, die Hexerei mit Feuer ausrotten zu müssen. Und er hegt einen persönlichen Groll gegen Eure Mutter.«
»Ja, ich weiß«, stöhnte Kepler. »Sie hat sicher keine Gelegenheit ausgelassen, ihn zu verspotten.«
»Ja, sie hat ihn gehänselt wie andere auch, aber das dürfte meiner Meinung nach kein Grund sein, einen Menschen zu foltern und auf den Scheiterhaufen zu bringen!«
»Wenn es doch nur so wäre. In diesen Zeiten genügt es, das Misstrauen seiner Mitmenschen zu erregen, um der Hexerei verdächtigt zu werden. Und wehe, der Stein ist einmal ins Rollen gekommen.«
Sibylla schloss schaudernd die Augen. »Ich weiß, und dabei habe ich gehofft, mit den Mauern von Ellwangen ein für alle Mal diesen Wahnsinn hinter mir zu lassen. Ich dachte, im protestantischen Württemberg sei alles anders. Hier würden Recht und Ordnung herrschen und nicht Willkür und Wahn.«
»Das könnt Ihr nicht vergleichen«, wandte Johannes Kepler ein. »In Eichstätt, Ellwangen und anderen katholischen Bistümern herrscht tatsächlich reine Willkür. Dort sind keine Advokaten zugelassen, und es gibt keine Verteidigung für die Angeklagten. Hier in Württemberg dagegen zählt das Recht noch etwas.«
Sibylla hörte wohl das verzweifelte Hoffen, mit dem er sich an seine eigenen Worte klammern wollte. Unwillkürlich stellte sie ihre Tasche ab und ergriff die Hände des kaiserlichen Mathematicus. Er sah sie erstaunt an, doch Sibylla schloss die Augen und versank in ihr Inneres, das sie so oft mit schrecklichen Visionen quälte. So standen sie in der Gasse und waren dennoch in diesen Augenblicken nicht Teil dieser Welt.
Sie spürte seinen erwartungsvollen Blick auf sich ruhen, als sie die Lider langsam wieder hob.
»Eure Mutter wird nicht auf dem Scheiterhaufen sterben«, sagte sie schlicht, doch mit solcher Überzeugung, dass die Erleichterung wie eine Welle durch seinen Körper lief.
»Kämpft für sie! Es wird sich auszahlen, auch wenn ich fürchte, dass ihr kein sehr langes Leben beschert sein wird.«
Johannes Kepler starrte sie stumm an. Verwunderung machte sich in seinem Gesicht breit, dann so etwas wie Hochachtung. »Ich glaube Euch!«, stieß er hervor, sichtlich selbst verblüfft über seine Worte. »Aber sagt mir, wie macht Ihr das?«
Rasch entzog Sibylla ihm ihre Hände und wandte den Blick ab. »Ich weiß es nicht«, sagte sie leise. »Es ist einfach in mir, und es wird stärker. Ich versuche, es zu unterdrücken, doch es hat schon immer zu mir gehört.«
»Es ist eine gefährliche Gabe«, gab er ebenso leise zurück. »Ihr müsst sehr vorsichtig damit sein und Euch genau überlegen, wem Ihr Euer Vertrauen schenkt. Ihr könntet sonst nur allzu schnell die Zelle meiner Mutter teilen.«
Sibylla nickte. »Das ist mir bewusst. Meist sage ich nichts, obgleich mich das Wissen manches Mal fast zerreißt.«
»Das ist klug. Daran solltet Ihr Euch halten. Tut es zu Eurer eigenen Sicherheit. Die meisten Menschen wollen über ihr Schicksal gar nicht so genau Bescheid wissen.«
»Das ist nicht wahr!«, protestierte Sibylla. »Alle lechzen danach, welche Zukunft die Sterne für sie bereithält. Ihr müsstet das doch am besten wissen. Ihr habt Horoskope für den Kaiserhof erstellt!«
»Ja, die Sterne haben großen Einfluss«, lächelte Johannes Kepler. »Ihre Stellung zueinander im Augenblick unserer Geburt bestimmt unser ganzes Leben. Sie beeinflussen unsere Eigenschaften, ob wir ehrgeizig sind oder verzagt, ob wir Erfolg haben oder versagen, ob wir von den Menschen geliebt oder abgelehnt werden. Doch auch Krankheiten kann man aus dem Geburtshoroskop ablesen. Das ist eine hoch komplizierte Wissenschaft.«
»Das ganze Leben ist im Augenblick der Geburt vorherbestimmt?« Sibylla war nicht überzeugt. »Das kann ich nicht glauben. Wozu treffen wir dann Entscheidungen? Wozu strengen wir uns an, ein gottesfürchtiges Leben zu führen? Glaubt Ihr, in meinem Horoskop stand bereits, dass ich um Haaresbreite dem Feuer entgehe und nach Leonberg fliehen werde?«
»Nein, so konkret ist es nicht«, gab Kepler zurück. »Es sind nur Wahrscheinlichkeiten, die sich ergeben, wenn Ihr nicht selbst aktiv werdet. Wenn Ihr Euer Horoskop kennt, dann wisst Ihr, was auf Euch zukommt, oder worauf Ihr achten müsst, um dem Schicksal vielleicht doch eine andere Wendung zu geben. Der aktuelle Verlauf der Sterne, und vor allem die Stellung der Planeten zueinander, hat natürlich auch weiter Einfluss auf Euer Leben. So kann man für die nächsten Monate oder Jahre jeweils weitere Horoskope erstellen und diese dann in Bezug zu den Konstellationen der Geburtsstunde setzen. Wie ich schon sagte, eine komplizierte Wissenschaft.«
»Oder eine Frage des Glaubens«, sagte Sibylla mit einem Lachen.
»Das könnt Ihr sehen, wie Ihr wollt, doch ich gebe Euch einen Rat: Wenn es wieder einmal über Euch kommt und Ihr es nicht lassen wollt, einem Eurer Mitmenschen sein Schicksal zu verraten, dann sagt zumindest, Ihr hättet es in den Sternen gelesen. Sagt, Ihr wärt Astrologin, Ihr hättet die Wissenschaft der Sterne studiert. Das ist nicht so verdächtig wie Eure Gabe, die sich keiner erklären kann.«
Sibylla lächelte ihn an. »Ich, eine Astrologin, die die Wissenschaft studiert hat? Magister Kepler, das klingt für mich recht albern, aber gut, ich werde mir Eure Worte merken, falls mich mein Mund wieder einmal in Verlegenheit bringt.«
Sie verabschiedeten sich voneinander. Johannes Kepler eilte weiter, Sibylla sah ihm nach, bis er in Richtung Obertor ihren Blicken entschwand. Dann erst wandte sie sich ab und machte sich auf den Heimweg.
Kapitel 2
Leonberg, Sommer 1620
Sibylla schlief schlecht in dieser Nacht. Immer wieder fuhr sie schweißnass aus ihren Albträumen auf und starrte mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit.
»Was ist denn?«, murmelte ihr Mann noch halb im Schlaf und griff nach ihrer Hand.
»Ach nichts«, wiegelte sie ab. »Ich habe nur schlecht geträumt.«
Wirklich?
Sibylla versuchte, die düsteren Gedanken zu verscheuchen. Dieses Mal war nicht das Feuer zu ihr gekommen, um sie mit seiner sengenden Hitze zu verzehren. Es waren Bilder von Blut und Gewalt, die ihr Herz rasen ließen.
Es ist nur ein Traum!, sagte sie sich immer wieder, doch der Schlaf wollte nicht wieder kommen. Kalte Angst nahm ihr die Luft zum Atmen und quälte sie bis zum Morgen.
Zuletzt musste sie doch in einen unruhigen Schlummer gefallen sein, denn als sie wieder hochfuhr, war es bereits hell in der Kammer und Peter stand angezogen vor ihrem Bett.
»Ich wünsche dir einen guten Morgen, mein geliebtes Weib«, sagte er mit einem Lachen. »Willst du heute den Tag verschlafen?«
Sibylla sprang aus dem Bett. »Nein, natürlich nicht. Warum hast du mich nicht geweckt?«
»Ich dachte mir, du brauchst deinen Schlaf, nachdem du diese Woche wieder zwei Nächte am Lager einer Wöchnerin gewacht hast. Nein, du musst dich nicht beeilen. Ich hole heute zur Feier des Tages Wecken beim Bäcker.«
»Feier?« Sibylla runzelte die Stirn. »Was gibt es heute denn zu feiern?«
Peter hob die Schultern. »Es ist ein herrlicher Tag, ich habe noch Zeit, bis ich zur Schule muss. Haben wir nicht jeden Grund zu feiern? Wie leben, wir lieben uns, wir sind eine glückliche Familie, uns geht es gut.«
Sibylla spürte wieder den eisigen Schauder in ihrem Rücken, und es war ihr, als könne sie Blut förmlich riechen. Sie schüttelte sich und zwang sich zu einem Lächeln. »Das ist ein schöner Einfall, auch wenn ich dich als verschwenderisch rügen sollte. Ich gehe heute noch ins Backhaus, um unser Brot für die nächste Woche zu backen. Aber vielleicht hast du recht. Wir sollten unser Leben genießen, solange der Herrgott uns seine Gunst schenkt.«
Etwas in ihrem Ton ließ ihn aufschrecken. Er sah sie einige Augenblicke ernst an, sagte aber nichts und wandte sich dann ab. »Helena? Wo ist mein Sonnenschein? Kommst du mit zum Bäcker?«
»Oh ja! Bekomme ich dort einen Honigkringel?« Das Mädchen jauchzte.
Sibylla hörte die beiden die Treppe hinuntersteigen. Dann fiel die Tür hinter ihnen ins Schloss und ließ sie in der Stille des Morgens zurück. Sibylla ließ sich noch einmal auf das Bett sinken und versuchte, sich den Traum ins Gedächtnis zurückzurufen. Was hatte er zu bedeuten? Welche Gefahr konnte ihnen hier im friedlichen Leonberg drohen? Mit der Hexenverfolgung des Vogts hatten diese Bilder nichts zu tun, da war sie sich sicher. Nein, er hatte sein Augenmerk nicht auf die Hebamme und ihre Familie gerichtet. Ein wenig ruhiger erhob sie sich wieder, kleidete sich an und ging in die Küche, um das Feuer anzufachen.
Kurz darauf kehrten Helena und ihr Vater zurück. Helena strahlte mit ihren honigklebrigen Lippen. Peter brachte nicht nur zwei weiße Kreuzerwecken für jeden mit, es lag auch eines der Flugblätter gefaltet im Korb, die seit Monaten immer wieder in der Stadt aufgetaucht waren.
Sibylla stellte sich und Peter einen Becher warmen Met auf den Tisch und Helena Milch. Zu den Wecken gab es Griebenschmalz und weichen Käse, aber auch Pflaumenmus und eingekochte Quitten.
»Was ist in der Welt dort draußen geschehen?«, erkundigte sich Sibylla, nachdem sie das erste Brötchen verzehrt hatte und Peter noch immer unverwandt auf das Papier starrte, ohne sein Frühmahl anzurühren.
»Ich habe dir schon damals vor zwei Jahren prophezeit, dass der Fenstersturz von Prag schlimme Folgen haben wird«, sagte er, ohne von dem Flugblatt aufzusehen.
»Ja, das war eine schlimme Sache«, bestätigte Sibylla. »Die böhmischen Stände hatten sicher kein Recht dazu, die Vertreter des Kaisers so einfach aus dem Fenster zu werfen. Aber der Kaiser hatte auch kein Recht, die zugesagten Freiheiten ihres Glaubens einfach so unter den Tisch fallen zu lassen. Mit Zwang – wie in den österreichischen Erblanden – die katholische Lehre wieder einzuführen und protestantische Kirchen zu beschlagnahmen, das konnte nicht gut gehen.«
»Das hat er ja gar nicht getan«, widersprach Peter. »Es ging nur um ein paar Unstimmigkeiten, die einige Kirchen und ihre Güter betrafen.«
»Und um die Protestantentage, die er einfach verboten hat«, erinnerte Sibylla.
»Ja, weil die Stände diese Zusammenkunft dazu missbrauchten, gegen ihren Kaiser zu wettern!«
Sie schmunzelte. »Wie ich sehe, hat der Habsburgkaiser in Leonberg einen eifrigen Verteidiger gefunden.«
»Nein«, entgegnete Peter. »Ich bin nur der Meinung, die Stände haben kein Recht, sich so gegen ihren Kaiser aufzulehnen, Menschen aus Fenstern zu werfen und ein Heer gegen ihren Landesherrn zu schicken!«
»Aus Wiener Sicht gesehen nicht«, stimmte ihm Sibylla zu und nahm sich einen Löffel Pflaumenmus. »Ich nehme an, es hat dem Kaiser einen gehörigen Schreck versetzt, dass sich die Mähren dem Aufstand angeschlossen haben und – soweit ich gehört habe – auch die protestantischen Stände Oberösterreichs Forderungen nach mehr Freiheit stellen.«
»Ja«, ihr Mann nickte zur Bestätigung, »und noch mehr hat es ihn vermutlich erschreckt, dass das Heer von Graf Thurn die Kaiserlichen geschlagen und fast bis vor Wien gerückt ist, doch wenn hier die Wahrheit geschrieben steht, dann wendet sich das Blatt nun.«
Sibylla vergaß ihr Brötchen. »Was? Wie das? Es hieß doch, die Kaiserlichen hätten keine Chance.«
»Anscheinend hat der Kaiser nun einen fähigen Obristen, der ihm eine kampftaugliche Truppe aufgestellt hat. Albrecht Wenzel von Waldstein, ein böhmischer Magnat. Seine Kürassiere haben ganze Arbeit geleistet. Hier wird noch einmal die Schlacht bei Langenlois erwähnt, bei der die Aufständischen bereits im Februar große Verluste erlitten haben und Kommandant von Fels nur knapp entkommen konnte. Nun hat wohl der Feldherr des Kaisers, Graf von Bucquoy, die Aufständischen um Graf von Thurn bei Horns in eine Falle gelockt. Thurn selbst war wohl nicht dabei, aber viele seiner Männer sind gefallen, und auch Colonna von Fels wurde getötet. Die Aufständischen haben sich nach Böhmen zurückgezogen. Der Traum, Wien in die Knie zu zwingen, ist – zumindest vorläufig – ausgeträumt. Die Kaiserlichen werden ihnen folgen und sie immer weiter bedrängen, bis sie sie besiegt und den Aufstand niedergeschlagen haben. Ende des Kapitels!«
Sibylla hob die Brauen. »Ach ja? Und wie genau sieht deiner Meinung nach dieses Ende aus? Dass alle Böhmen und Mähren wieder brav zur Messe gehen und die katholischen Prälaten ihre Finger nach all den verloren gegangenen Gütern ausstrecken, nur weil irgendein katholischer Habsburger, der zufällig König geworden ist, das so will?«
Ihr Mann erwiderte ihren Blick. »Ja, so lautet die Vereinbarung, auf die sich alle beim Augsburger Religionsfrieden geeinigt haben: Der Reichsfürst ist berechtigt, die Religion für die Bewohner seines Landes zu bestimmen. Dafür steht es jedem frei, das Land zu verlassen, wenn ihm das nicht gefällt.«
»Oh ja, das ist eine großartige Freiheit«, spottete Sibylla. »Ich lasse einfach meinen Hof zurück und alles, was sich meine Familie vielleicht über Generationen erarbeitet hat. Ich kehre meiner Heimat den Rücken, um so beten zu dürfen, wie ich möchte, und dann, wenn ich mir etwas Neues aufgebaut habe, kommt wieder ein anderer Fürst daher, der mir seine Religion aufzwingen will. Aber ich kann ja wieder auswandern!«
Peter stöhnte. Vielleicht war er diese Streitgespräche über den rechten Glauben und die Freiheit der Religion leid. Vielleicht war sein eigener Widerstreit in seinem Innern bereits mehr, als er ertragen konnte.
Sibylla ahnte, wie sehr er mit sich haderte und wie schwer er sich noch immer mit seinem Gewissen im protestantischen Leonberg tat, doch heute wollte sie die Worte, die in ihr aufstiegen, nicht ungesagt herunterschlucken. Sie reckte sich ein Stück. Ihre Stimme bekam einen energischen Klang. »Es wird erst Frieden einkehren, wenn die Fürsten endlich begreifen, dass jeder Mensch das Recht hat zu glauben, was er will. Jeder Einzelne muss frei sein, so zu beten, wie er will!«
»Das würde uns zerstören«, widersprach ihr Mann. »Die Menschen sind wie Kinder, die die Hand der Eltern brauchen, um den rechten Weg zu finden und nicht im Dickicht der Irrlehren verloren zu gehen. Wenn jeder das tun und lassen könnte, was er will, würde das jeder Ketzerströmung Tür und Tor öffnen, und bald wäre die rechte Lehre gar nicht mehr zu erkennen. Wir bräuchten keine Kirchen mehr, keine Messe und keinen Gottesdienst. Jeder würde ja selbst zu wissen glauben, was für ihn richtig ist.«
»Ach ja?« Sibylla stemmte die Hände in die Hüften. Die warnenden Worte, die in ihr aufstiegen, unterdrückte sie. »Du meinst, wir brauchen unsere Pfarrer und Kirchenfürsten, um die Ketzer zu bekämpfen? Um die reine Lehre nicht zu beschmutzen? Oh ja, weg mit allen, die abtrünnig sind. Auf den Scheiterhaufen mit ihnen, mit den Ketzern und den Hexen!«
»Das habe ich nicht gesagt und auch nicht gemeint.« Peter erhob sich. Er sprach leise und beherrscht, doch die Qual in seinem Blick war schlimmer, als hätte er sie angeschrien. Sibylla öffnete den Mund, doch er hob die Hand. »Für heute ist es genug!« Damit wandte er sich um und verließ die Küche.
Helena starrte ihre Mutter fragend an. Sie verstand noch nicht, worum es ging, konnte aber sehr wohl die Spannung spüren.
»Iss dein Brötchen«, forderte Sibylla ihre Tochter auf. Ihr selbst war der Hunger vergangen. Sie fühlte sich plötzlich unendlich erschöpft, doch sie fürchtete sich davor, die Augen zu schließen und die Bilder wieder einzulassen, die sie in der Nacht gequält hatten.
Den ganzen Tag über versuchte Sibylla ihre düsteren Ahnungen zu verdrängen. Sie schleppte einen Korb mit Wäsche zum Waschhaus am Unteren Tor, doch die Arbeit beschäftigte nur ihre Hände, nicht ihren Geist. So bemühte sie sich, den Gesprächen der anderen Frauen zu folgen, aber der hohle Tratsch ging ihr bald auf die Nerven. Als die Reinboldin vorbeikam, ging es natürlich wieder um die Keplerin, die im Turm auf ihren Hexenprozess wartete. Die Frau des Glasers blieb stehen, stemmte die Hände in die Hüften und zählte mit ihrer klagenden Stimme all die Leiden auf, die sie angeblich durch den bitteren Trank, den die Keplerin ihr einst gegeben hatte, erdulden hatte müssen.
»Aber nun wird unser Vogt der Hexe das Handwerk legen«, fügte sie mit so viel Selbstzufriedenheit hinzu, dass Sibylla zum ersten Mal an diesem Tag ihre eigenen Sorgen vergaß.
»Du bist ein wenig voreilig«, mischte sie sich ein. »Das Gericht wird erst einmal klären, ob an den Beschuldigungen überhaupt etwas dran ist. Noch ist der Vorwurf der Hexerei lediglich eine Behauptung! Wenn die Advokaten, die ihr Sohn Johannes aus Stuttgart kommen lässt, ihre Unschuld beweisen, wird sie freigelassen, und wer weiß, vielleicht gibt es dann den einen oder anderen Prozess wegen böswilliger Verleumdung!«
»Ach ja? Meinst du etwa mich?«, keifte die Reinboldin. »Du solltest dich lieber um deine eigenen Angelegenheiten kümmern und zusehen, dass dir die Wöchnerinnen und ihre Kinder nicht wegsterben. Ist nicht erst letzte Woche das kleine Mädchen des Schusters aus der Schmalzgasse ganz unerwartet gestorben, und das, noch ehe es getauft wurde? Was würde wohl passieren, wenn der Verdacht aufkäme, eine gewisse Wehmutter habe seine Seele dem Teufel verkauft?«
Sibylla versuchte die Übelkeit zu unterdrücken, die in ihr aufstieg. So viele Jahre hatten sie hier in Leonberg in Frieden gelebt. Die Schrecken von Ellwangen waren langsam verblasst, doch nun schien es auch hier in Württemberg mit dem Frieden vorbei zu sein.
Sibylla schenkte der Reinboldin einen eisigen Blick. »Ich denke, wenn du so etwas behaupten würdest, würden alle an deinem Verstand zweifeln oder den Punkt zu der Liste der Verleumdungen hinzufügen, die den Richtern vorgelegt würde.«
Sie maßen sich mit Blicken, bis die Reinboldin sich mit einem Ruck abwandte und davonstürmte. Sibylla sah ihr nicht nach. Sie packte ihren Korb mit nasser Wäsche und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs holten sie wieder ihre Ängste ein. Sie beschleunigte ihre Schritte, sodass sie außer Atem das kleine Haus in der Kirchgasse erreichte, das sie mit Peter und Helena bewohnte.
Sibylla stieß die Tür auf. »Helena?«
Keine Antwort. Sie sah sich in der Küche und der Stube um, ging hinunter in den Keller und stieg dann zu den Kammern unter dem Dach hoch, wo neben den beiden Schlafkammern der winzige Verschlag zu finden war, den Peter sein Studierzimmer nannte. Als sie die Tür öffnete, saß er vor dem Fenster, ein aufgeschlagenes Buch auf dem wackligen Tisch, den er sich selbst zusammengezimmert hatte. An seinem Blick konnte sie ablesen, dass er ihre Auseinandersetzung noch nicht vergessen hatte.
»Was gibt es?«, erkundigte er sich steif.
»Wo ist Helena?«
»Sie wollte Himbeeren pflücken gehen.«
»Allein? Wo? Wo ist sie hingegangen?« Sibylla hörte selbst die Panik in ihrer Stimme.
Peter runzelte die Stirn. »Sie sagte, sie wolle eine Freundin fragen. Warte, ich glaube sie sprach von Maria, der Tochter von Bäcker Braun, die in der Bank neben ihr sitzt. Ist etwas geschehen?«
Sibylla ging nicht darauf ein. »Weißt du, wohin sie wollte?«, fragte sie stattdessen.
Wieder überlegte er. Vermutlich war er wieder einmal mit seinen Gedanken in seinen Büchern gewesen und hatte seiner Tochter nicht richtig zugehört. »Sie sagte, sie wolle zum Löschteich vor die Stadt, aber willst du mir nicht endlich sagen, was los ist?«
»Ich hatte einen schlechten Traum heute Nacht, der mich noch immer nicht loslassen will.«
Sie hätte erwartet, er würde ihre Sorgen beschwichtigen, doch seine Miene war ernst, als er sich erhob und den Arm um sie legte.
»Betraf es Helena? Weißt du etwas Genaues?«
Sie schüttelte den Kopf und wandte den Blick ab. »Nein, es ging nicht nur um Helena. Es war etwas Größeres, das unsere ganze Welt aus den Fugen gerissen und zerschmettert hat. Ich finde keine Ruhe mehr. Ich gehe sie suchen.« Schnell stürmte sie aus der Kammer und lief die Treppe hinunter.
»Warte!«
Ihr Mann eilte ihr hinterher. »Ich will deine Fähigkeiten nicht infrage stellen, aber was sollte ihr da draußen am Löschteich zustoßen? Die Mädchen spielen oft vor der Stadt, und die Leute dort in der Vorstadt haben ein Auge auf sie. Sie kennen Helena und wissen, wo sie hingehört. Du selbst hast immer großen Wert darauf gelegt, dass sie früh selbstständig wird. Willst du sie jetzt an dein Schürzenband fesseln?«
»Nein, Unsinn, aber ich muss nach ihr sehen.«
Peter wollte etwas erwidern, doch ein Klopfen an der Tür unterbrach ihn. »Ja?«, fragte er stattdessen.
Ein Mann mit gerötetem Gesicht kam hereingestürmt. »Sibylla, du musst kommen. Dem kleinen Sebastian geht es nicht gut. Er hat Fieber. Meine Lise weiß nicht, was sie tun soll, und ihr Vater macht uns alle ganz verrückt und bejammert schon den Verlust seines Enkels!«
»Ich komme gleich«, sagte Sibylla widerstrebend. »Ich denke, es wird nicht lange dauern, und dann hole ich Helena«, fügte sie an Peter gewandt hinzu.
»Nein!«, widersprach er bestimmt. »Geh du zu deinem fiebernden Schützling, und sieh zu, dass nicht noch ein Kind ungetauft stirbt. Ich werde derweil zum Löschteich rausgehen und nach den Mädchen sehen.«
Vor Erleichterung ließ Sibylla hörbar die Luft entweichen. Sie drückte Peter einen Kuss auf die Wange. »Danke«, sagte sie, dann griff sie nach ihrer Tasche und folgte dem jungen Vater zum Haus des Richters Mochel.
Es dauerte zwar länger, als Sibylla gedacht hatte, doch der Abend war noch nicht hereingebrochen, als sie das prächtige Haus am Marktplatz verließ. Dem Knaben ging es schon besser, und der alte Mochel hatte sich wieder beruhigt. Kaum war sie auf der Straße, entdeckte sie Maria, die in einem Korb Brot austrug. Sibylla lächelte das Mädchen an.
»Grüß Gott, Maria. Wie war eure Ausbeute an Himbeeren heute?«
Das Mädchen machte einen Schmollmund. »Ich durfte nicht mit. Mama hat es mir verboten. Sie sagt, ich sei frech gewesen und würde heute bis zum Abend helfen müssen.«
Sibylla starrte sie an. »Dann ist Helena allein gegangen?«
»Ja.« Maria nickte eifrig. »Dabei wollten wir heute hinter dem Friedhof bis zum Wäldchen gehen. Dort gibt es eine ganze Hecke voll von Beeren.«
Sibylla spürte, wie ihr kalt wurde. Die Furcht kehrte mit einem Schlag zurück und ließ sie taumeln. Sie verabschiedete sich nicht einmal von Maria, sondern lief einfach los. Sibylla rannte nach Hause, doch noch bevor sie die Tür aufgerissen und nach beiden gerufen hatte, wusste sie, dass sie keine Antwort erhalten würde.
Die Gefahr hing wie eine finstere Wolke über ihnen. Sibylla konnte sie spüren. Sie schmeckte Blut auf der Zunge. Mit einem Aufschrei ließ sie ihre Tasche fallen, wandte sich um und lief wieder los. Vielleicht war es noch nicht zu spät. Sie sah die Nachbarn nicht, die sie freundlich grüßten und ihr dann verwundert nachsahen. Die letzten Häuser von Leonberg huschten an ihr vorüber und verschwammen mit den schrecklichen Bildern, die sich nicht mehr vertreiben ließen. Ein unangenehmer Geruch stieg ihr in die Nase. Menschen, viele Männer, die lange unterwegs gewesen waren und deren Kleider nach altem Schweiß und dem Leben auf der Straße stanken.
»Sibylla!«
Sie glaubte, ihre Stimmen zu hören. Wilde, bärtige Gesichter tauchten vor ihrem Innern auf, mit Staub bedeckte Kleider, durchgelaufene Schuhe, doch der Stahl ihrer Messer und Spieße blitzte hell.
»Sibylla? He, wohin so eilig? So warte doch!«
Schnelle Schritte hinter ihr. Eine Hand griff nach ihrem Arm. Sibylla versuchte sich loszureißen, doch dann erkannte sie den Mann, der sie noch immer festhielt.
»Was ist denn los?«, erkundigte er sich besorgt. »Du siehst aus, als wärst du dem Teufel persönlich begegnet.«
»Ach, du bist es, Andreas«, begrüßte sie den Mauerwächter. »Lass mich los! Ich habe heute keine Zeit, mit dir zu plaudern. Ich bin in Eile.«
»Das habe ich gesehen, aber sag mir doch, wohin du willst. Du solltest heute lieber nicht aus der Vorstadt raus.«
»Warum? Was ist passiert?«, stieß Sibylla hervor.
Andreas hob die Schultern. »Ich weiß es nicht. Zwei Bauern haben von einer Horde Fremder erzählt, die ihnen ihr Schwein weggenommen haben. Sie sollen dort draußen irgendwo am Waldrand lagern. Jetzt hat mich der Billfinger losgeschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen.«
Sibylla spürte, wie sie blass wurde. »Helena ist irgendwo dort draußen. Sie wollte Himbeeren pflücken. Lass mich los, ich muss sie suchen!«
»Das ist gefährlich«, wandte Andreas ein, wich aber unter ihrem wilden Blick zurück. »Lass uns zusammen gehen«, schlug er stattdessen vor und reichte ihr seine Hand.
Sibylla drückte sie dankbar und sah, wie er errötete. Fast zehn Jahre waren seit ihrer kleinen Romanze vergangen, und Andreas hatte längst eine eigene Familie gegründet, war Vater zweier stolzer Knaben, doch noch immer musste er einen Teil seines Herzens für die Hebamme aus Ellwangen aufgespart haben.
»Ja, komm, wir müssen uns beeilen. Ich habe ein ganz schreckliches Gefühl. Peter ist vor Stunden losgezogen, nach ihr zu suchen, aber er ist noch nicht zurück.«
Andreas nickte nur und drückte noch einmal ihre Hand. »Das hat vielleicht nichts Schlimmes zu bedeuten. Wir werden sie sicher bald finden.«
Kapitel 3
Leonberg, Sommer 1620
Schweigend eilten sie nebeneinander her. Wie gern hätte Sibylla ihm geglaubt. Sie passierten das Untere Tor und liefen durch die Vorstadt zwischen Löschteich und dem Friedhof über die Wiese auf das nahe Wäldchen zu. Die Sonne stand bereits tief und ließ die Bäume lange Schatten werfen.
»Helena? Helena!«, rief Sibylla mit zunehmender Verzweiflung, doch nur das Rauschen des Windes antwortete ihr.
»Helena, Peter, wo seid ihr?«
Sie spürte, wie Tränen in ihr aufstiegen, und blinzelte heftig, um sie zu vertreiben.
»Wir werden sie finden«, beschwor Andreas. Er blieb stehen und sah sich ratlos um. Weder von den Vermissten noch von den Schweinedieben war etwas zu sehen oder zu hören.
»Sie sind wieder weg«, erklang unvermittelt eine knarzige Stimme aus einem Gebüsch. Sibylla und Andreas fuhren zusammen.
Ein Weiblein in zerlumpten Kleidern, das Sibylla öfter beim Betteln gesehen hatte, kroch aus einem Holunderbusch hervor und klopfte sich Erde und trockenes Gras von ihrem Rock.
»Wer ist weg? Sprich gefälligst, Weib!«, fuhr Andreas die Frau an. »Was hast du gesehen?«
»Die Männer. Viele fremde Männer, die hier nicht hergehören und die zum Glück weitergezogen sind.«
»Was waren das für Männer?«, forschte Andreas weiter. »Was wollten sie?«
Sie lachte ein wenig spöttisch. »Das waren Söldner, und so wie sie gesprochen haben, stammen sie nicht von hier. Mehr weiß ich nicht. Glaubst du, ich hätte sie gefragt, woher sie kommen und was sie hier treiben? Ich bin nicht verrückt und hänge an meinem armseligen Leben. Mir war es lieber, dass sie nur das Schwein aufgeschlitzt haben. Das Gequieke hat sich angehört, als würden sie einem Menschen die Seele rausschneiden.«
»Hast du ein Kind gesehen?«, unterbrach Sibylla. »Ein Mädchen, acht Jahre alt, mit rotblondem Haar? Ich suche meine Tochter Helena.«
»Ein Kind?« Das faltige Gesicht der Alten wirkte plötzlich noch eingefallener. »Ich glaube, ich habe die Stimme eines Mädchens gehört.« Sie verstummte und wandte den Blick ab. Andreas griff grob nach ihrem Arm und schüttelte sie. »Was ist passiert? Sag es uns!«
»Ich weiß es nicht, aber ich habe den Lehrer gesehen. Er kam den Weg entlang, und er hat mit den Männern gesprochen. Mutig, habe ich mir gedacht. Dass er sich in das Söldnerlager traut, denn das sind üble Burschen, die eine andere Vorstellung von Spaß haben als gottgefällige Menschen!«
Sibylla schluckte trocken. »Du hast meinen Mann gesehen? Wann war das?«
»Das war noch früh am Nachmittag, glaube ich«, überlegte die Alte. »Ich bin lieber in meinem Versteck geblieben. Dann muss ich wohl eingeschlafen sein, und jetzt sind alle weg.«
»Der Lehrer Berchtold ist nicht zurückgekommen? Und du hast das Mädchen auch wirklich nicht gesehen?«, hakte Andreas noch einmal nach.
Die Alte schüttelte den Kopf. »Ich habe doch schon gesagt, dass ich geschlafen habe«, behauptete sie. Jedenfalls war sie nicht bereit, mehr preiszugeben. Sie verschränkte trotzig die Arme vor ihrem schlaffen Busen. »Ist der Herr Stadtwächter nun mit seiner Befragung fertig? Kann ich gehen?«
Andreas zuckte hilflos mit den Schultern. »Ja, wenn du uns nicht helfen kannst.«
Sibylla sah, wie ein Anflug von Mitleid über das faltige Gesicht huschte. »Da kann niemand mehr helfen«, murmelte sie und eilte dann erstaunlich flink davon.
Sibylla wurde es für einen Moment schwarz vor den Augen, und ihre Knie gaben nach. Andreas konnte sie gerade noch auffangen.
»Ich habe es gesehen und nichts getan«, keuchte sie. »Ich habe sie in ihr Verderben laufen lassen. Oh, Andreas, ich kann mir das niemals vergeben.«
»Du weißt ja noch nicht einmal, ob ihnen wirklich etwas zugestoßen ist«, wiegelte er ab. »Vielleicht halten sie sich noch irgendwo im Wald versteckt?«
Für einen Moment fasste Sibylla neuen Mut. Sie löste sich aus Andreas’ Armen und raffte ihre Röcke. »Komm schnell«, forderte sie ihn auf. »Es wird bald dunkel. Vorher müssen wir sie finden!«
Er folgte ihr bis zum Waldrand. Sie riefen immer wieder Helenas und Peters Namen, doch erhielten keine Antwort. Nach einiger Zeit stieg Sibylla der Geruch eines schwelenden Feuers in die Nase, und dann sah sie eine dünne Rauchfahne hinter einigen Büschen aufsteigen. Auf einer kleinen Wiese unter den Obstbäumen hatten die Männer anscheinend Rast gemacht. Sibylla lief los, doch es war ihr, als hielten schwere Gewichte ihre Beine fest. Sie wollte so schnell wie möglich dorthin und fürchtete dennoch nichts mehr als das, was sie dort erwarten könnte. Zaghaft trat sie zwischen die letzten Büsche und ließ den Blick schweifen. Sie spürte, wie Andreas sich näherte und hinter ihr stehen blieb.
»Hier haben sie gelagert«, sprach er das Offensichtliche aus. An drei Stellen war das Gras verbrannt. Eines der Feuer schwelte noch. Reste ihrer Mahlzeit lagen verstreut im niedergedrückten Gras. Scherben eines Tonkrugs mischten sich mit der Asche. Der Schädel des geschlachteten Schweins starrte sie aus toten Augen an.
»Es müssen viele Männer gewesen sein. Mehrere Dutzend«, sagte Andreas.
Sibylla nickte nur. Sie konnte nicht sprechen. Sie hatte wieder den metallischen Geruch von Blut in der Nase. Sie versuchte sich einzureden, dass dieses von dem geraubten Schwein stammte, doch sie wusste es besser. Widerstrebend trat sie auf den Lagerplatz hinaus und sah sich um.
»Helena? Peter?« Ihre Stimme zitterte.
Ihre Füße trugen sie bis zum Feuer und führten sie dann zu einem Weißdornbusch. Da lag etwas. Etwas Großes. Ihr Herz erkannte ihn, noch ehe ihre Augen und ihr Geist seine Gestalt in der Dämmerung erfasst hatten.
Sibylla eilte zu ihm und ließ sich auf die Knie fallen. »Peter!«, stieß sie aus und griff nach seinen Schultern. Er rührte sich nicht. »Andreas!«, schrie sie.
Er hastete an ihre Seite und half ihr, den reglosen Peter umzudrehen. Sein Gesicht war, abgesehen vom Schmutz auf seinen Wangen, totenbleich, seine Augen geschlossen. Doch was Sibylla scharf die Luft einziehen ließ, war der nasse Fleck auf seiner Brust, der sein Hemd und das Wams dunkel färbte und sich weiter ausbreitete. Seine Hände aber krampften sich um seinen Unterleib.
»Heilige Jungfrau«, entfuhr es Sibylla unwillkürlich. Sie legte ihre Hände um die seinen. Dickes, dunkles Blut quoll zwischen ihren Fingern hervor, als sie seine Hände zur Seite schob. Vorsichtig hob sie das Wams an und schob das Hemd beiseite. Sie stöhnte, als sie die hässliche Wunde in seinem Bauch sah.
»Lebt er noch?«, erkundigte sich Andreas mit verzagter Stimme. Sibylla beugte sich vor. Sie legte ihr Ohr an sein Herz und ihre Hand an seinen Hals. Da entfuhr ihm ein Stöhnen, und Peters Körper zuckte zusammen.
»Er lebt!«, stieß Andreas erleichtert aus.
»Ja, aber wie lange noch, wenn er weiter so viel Blut verliert?«
Sibylla riss ein Stück aus ihrem Rock, drehte den Stoff zusammen und drückte ihn auf die Wunde. Dann legte sie Peters Hände darauf, ehe sie sich der Verletzung in seiner Brust zuwandte. Vorsichtig öffnete sie sein Hemd.
»Zwei Stichwunden«, sagte sie grimmig. »Diese Mörder!«
»Noch lebt er«, widersprach Andreas.
»Ja, die Klinge muss an seiner Rippe abgeglitten sein. Sonst wäre er vermutlich schon tot.«
Wieder stöhnte Peter und bewegte den Kopf. Dann öffnete er die Augen.
»Halte still!«, sagte Sibylla mit rauer Stimme. »Ich muss deine Wunden verbinden. Ach, wenn ich nur meine Tasche hier hätte.«
»Sibylla!«, flüsterten die aufgeplatzten Lippen.
»Ja, ich bin hier, aber was hast du nur gemacht? Wie konnte das passieren, und wo ist Helena? Hast du sie gefunden?«
Sie drückte einen weiteren Stoffknäuel auf die Wunde in seiner Brust und sah Peter eindringlich an.
Er runzelte die Stirn. Es schien ihm schwerzufallen, die Erinnerung in seinem Geist zu finden.
»Peter, wo ist Helena?«, drängte Sibylla auf eine Antwort.
»Ich weiß es nicht«, stöhnte er. »Diese Männer, Söldner aus den Spanischen Niederlanden, sie waren hier.«
»Ja, das weiß ich, aber sie sind weitergezogen. Hast du Helena gefunden?«
Seine Augen schlossen sich wieder, doch er atmete weiter. Sibylla stieß einen Schrei der Verzweiflung aus. »Peter, du musst wach bleiben. Sag mir, was mit Helena geschehen ist!«
»Ich werde weitersuchen«, bot Andreas an. »Hier kann ich dir nicht helfen. In diesem Zustand können wir ihn kaum in die Stadt zurückbringen, oder soll ich es trotzdem versuchen, ihn zu tragen?«
Sibylla schüttelte den Kopf. »Lauf in die Stadt, und hole ein paar Männer und einen Karren. Wir müssen den Wald durchsuchen, ehe es völlig finster ist. Und bring meine Tasche mit. Sie steht unten in der Diele. Ich versuche in der Zwischenzeit, die Blutung zu stillen.«
Zögernd erhob sich Andreas. »Kann ich dich hier allein lassen?«
»Ja. Nun lauf!«
Er wandte sich um und rannte los, während Sibylla sich mühte, Peters Geist zurückzuholen. Endlich öffnete er wieder die Augen. Zwei Tränen rannen ihm die Wangen hinunter und tropften ins Gras.
»Ach, Sibylla, es tut mir so leid«, flüsterte er. »Ich konnte deine Schwester nicht retten, und nun … unsere Tochter …«
»Wo ist sie?«
»Ich weiß es nicht. Sie war hier bei den Söldnern. Sie waren … grob mit … grob zu ihr.« Er konnte die Worte bei der Erinnerung an das Geschehene nur stammeln. »Ich habe alles versucht, glaub mir. Ich hatte kein Geld, sie zu bezahlen. Ich habe sie angefleht, doch sie lachten nur. Als ich ihnen mit Gottes Zorn drohte, da wurden sie wütend.« Peter keuchte. Seine Stimme schien ihm zu versagen. Sibylla beugte sich herab und sah ihn eindringlich an.
»Weiter! Was ist weiter geschehen?«