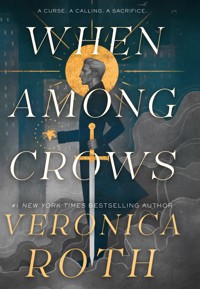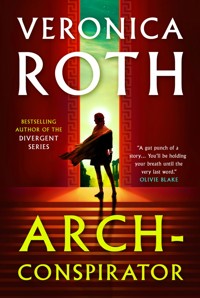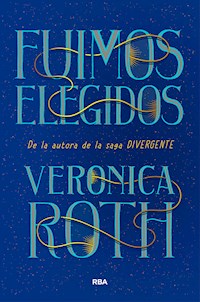9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Bestimmung-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Aufstand hat begonnen ...
In einer ungewissen Zukunft, in der die Fraktionen zerfallen, gibt es keine Sicherheiten mehr. Außer der einen: Wo auch immer ich hingehe – ich gehe dorthin, weil ich es will…
Drei Tage ist es her, seit die Ken mithilfe der ferngesteuerten Ferox-Soldaten unzählige Altruan umgebracht haben. Drei Tage, seit Tris' Eltern starben. Drei Tage, seit sie selbst ihren Freund Will erschossen hat – und aus Scham und Entsetzen darüber schweigt. Mit den überlebenden Altruan haben Tris und Tobias sich zu den Amite geflüchtet – doch dort sind sie nicht sicher, denn der Krieg zwischen den Fraktionen hat gerade erst begonnen. Wieder einmal muss Tris entscheiden, wo sie hingehört – selbst wenn es bedeutet, sich gegen die zu stellen, die sie am meisten liebt. Und wieder einmal kann es nur Tris in ihrer Rolle als Unbestimmte gelingen, die Katastrophe abzuwenden...
Die grandiose Trilogie "Die Bestimmung" von Veronica Roth ist eine unendlich spannende Zukunftsvision voller überraschender Wendungen, heftiger Emotionen und kraftvoller Einblicke in die menschliche Natur – fesselnd bis zur letzten Seite!
Alle Bücher der Die-Bestimmung-Reihe:
Band 1 – Die Bestimmung
Band 2 – Tödliche Wahrheit
Band 3 – Letzte Entscheidung
Fours Geschichte ("Die Bestimmung" aus Fours Pespektive)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Veronica Roth
Die Bestimmung
Tödliche Wahrheit
Aus dem Amerikanischen von Petra Koob-Pawis
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
cbt ist der Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2012 by Veronica Roth
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Insurgent« bei
Katherine Tegen Books, an imprint of Harper Collins Children’ Books,
New York
© 2012 für die deutschsprachige Ausgabe cbt Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück, 30287 Garbsen.
Aus dem Amerikanischen von Petra Koob-Pawis
Umschlagmotiv: Jacket art™ & © Veronica Roth, Jacket art and design by Joel Tippie
Umschlagkonzeption: basic-book-design, Karl Müller-Bussdorf
mg · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-08739-5V006
www.cbt-jugendbuch.de
www.die-bestimmung.de
Für Nelson, der jedes Risiko wert war
Die Wahrheit ist wie ein wildes Tier, sie ist zu mächtig, um eingesperrt zu bleiben.
Aus dem Manifest der Candor
1. Kapitel
Als ich aufwache, liegt mir sein Name auf der Zunge.
Will.
Bevor ich die Augen aufschlage, sehe ich ihn wieder auf dem Gehweg zusammensinken. Tot.
Ich habe ihn getötet.
Vor mir kauert Tobias, seine Hand liegt auf meiner linken Schulter. Der Zugwaggon holpert über die Gleise. An der Tür stehen Marcus, Peter und Caleb. Ich atme tief ein und halte die Luft an, versuche, den Druck zu lösen, der sich in meiner Brust anstaut.
Vor einer Stunde noch fühlte sich alles, was passiert ist, seltsam unwirklich an. Jetzt nicht mehr.
Ich atme aus, doch der Druck ist noch immer da.
»Komm, Tris«, sagt Tobias und sucht meinen Blick. »Wir müssen springen.«
Es ist zu dunkel, um zu erkennen, wo wir gerade sind, aber wenn wir jetzt abspringen, dann sind wir wahrscheinlich schon in der Nähe des Zauns. Tobias hilft mir auf und führt mich zur Tür.
Die anderen springen, einer nach dem anderen, erst Peter, dann Marcus, dann Caleb. Ich greife nach Tobias’ Hand. Der Wind nimmt zu, als wir uns an den Rand der Türöffnung stellen; wie eine Hand drückt er uns zurück in die Sicherheit des Waggons.
Aber wir lassen uns in die Dunkelheit fallen und landen unsanft auf dem Boden. Beim Aufprall schmerzt die Schusswunde in meiner Schulter. Ich beiße mir auf die Lippe, um nicht laut aufzuschreien, und blicke mich nach meinem Bruder um.
»Bist du okay?«, frage ich, als ich sehe, wie er ein paar Meter weiter im Gras sitzt und sich das Knie reibt.
Er nickt. Er schnieft, als würde er gegen Tränen ankämpfen, und ich wende mich rasch ab.
Wir sind auf einer Wiese neben dem Zaun gelandet, nur wenige Meter neben dem von mit Furchen durchzogenen Weg entfernt, auf dem die Trucks der Amite Lebensmittel in die Stadt transportieren, ganz nah bei dem Tor, das sie passieren müssen und das jetzt verschlossen ist. Wir sind eingesperrt. Über uns erhebt sich der Zaun, zu hoch und zu elastisch, um drüberzuklettern, und zu stabil, um ihn niederzureißen.
»Hier sollten eigentlich Wachen von den Ferox sein«, sagt Marcus. »Wo sind sie?«
»Wahrscheinlich waren sie in der Simulation gefangen«, antwortet Tobias, »und jetzt sind sie …« Er hält inne. »Jetzt sind sie wer weiß wo und tun wer weiß was.«
Wir haben die Simulation gestoppt – das Gewicht der Festplatte in meiner Hosentasche erinnert mich daran –, aber wir sind nicht lange genug geblieben, um ihre Auswirkungen zu sehen. Was ist aus unseren Freunden geworden, unseren Bekannten, unseren Anführern, unseren Fraktionen? Keiner von uns hat eine Antwort auf diese Fragen.
Tobias geht zu einer kleinen Metallbox neben dem Tor und öffnet sie. Ein Tastenfeld kommt zum Vorschein.
»Hoffentlich haben die Ken nicht daran gedacht, den Code zu ändern«, sagt er, während er eine Ziffernfolge eintippt. Nach der achten Ziffer hält er inne und das Tor springt auf.
»Woher weißt du die Zahlenkombination?«, fragt Caleb. Seine Stimme klingt so aufgewühlt, dass ich mich frage, wie er überhaupt ein Wort herausbringt.
»Ich habe im Überwachungsraum der Ferox gearbeitet. Ich war für das Sicherheitssystem zuständig. Wir ändern die Codewörter nur zweimal im Jahr«, antwortet Tobias.
»Was für ein Glück«, sagt Caleb. Er wirft Tobias einen misstrauischen Blick zu.
»Das hat nichts mit Glück zu tun«, erwidert Tobias. »Ich habe dort nur gearbeitet, um sicherzustellen, dass ich im Notfall rauskomme.«
Mich überläuft es kalt. Wenn er davon spricht rauszukommen, hört es sich an, als seien wir alle eingesperrt. Dieser Gedanke ist mir bisher noch nie gekommen, was mir jetzt ziemlich naiv erscheint.
Wir laufen dicht beieinander, Peter presst seinen blutenden Arm an die Brust – den Arm, auf den ich geschossen habe – und Marcus legt eine Hand auf Peters Schulter, um ihn zu stützen. Caleb wischt sich alle paar Sekunden über die Wange; mir ist klar, dass er weint, aber ich weiß nicht, wie ich ihn trösten soll – oder weshalb ich selbst nicht auch weine.
Stattdessen gehe ich voran. Tobias läuft schweigend neben mir her, und obwohl er mich nicht berührt, gibt er mir Halt.
Winzige Lichtpunkte zeigen uns, dass wir uns dem Hauptquartier der Amite nähern. Nach und nach erkennen wir hell schimmernde Quadrate, die sich als erleuchtete Fenster entpuppen. Eine Ansammlung von Holzhäusern und Gebäuden aus Glas taucht auf.
Doch zuerst müssen wir noch eine Obstplantage durchqueren. Meine Füße sinken ein, über mir verschränken sich die Äste ineinander und bilden eine Art Tunnel. Dunkle Früchte, die jeden Moment herabzufallen drohen, hängen zwischen den Blättern. Der süßsaure Geruch verfaulender Äpfel vermischt sich in meiner Nase mit dem Duft nasser Erde.
Als wir uns den Gebäuden nähern, verlässt Marcus seinen Platz an Peters Seite und geht voran. »Ich weiß, wo wir hinmüssen«, sagt er.
Er führt uns am ersten Haus vorbei zum zweiten Gebäude auf der linken Seite. Alle Gebäude, mit Ausnahme der Gewächshäuser, sind aus dem gleichen dunklen, rohen, naturbelassenen Holz. Durch ein offenes Fenster höre ich Gelächter. Der Kontrast zwischen diesem Lachen und der Totenstille in meinem Inneren könnte kaum schärfer sein.
Marcus öffnet eine der Türen. Wenn ich nicht wüsste, dass wir im Hauptquartier der Amite sind, wäre ich entsetzt über die fehlenden Sicherheitsvorkehrungen. Bei den Amite verlaufen die Grenzen zwischen blindem Vertrauen und purer Dummheit fließend.
Das einzige Geräusch ist jetzt das Quietschen unserer Schuhe. Ich höre Caleb nicht mehr weinen – aber andererseits hat er sich auch vorher schon lautlos seinem Kummer hingegeben.
Marcus bleibt vor einem Zimmer stehen, dessen Tür offen ist. Johanna Reyes, die Repräsentantin der Amite, sitzt vor einem Fenster und sieht hinaus. Ich erkenne sie auf den ersten Blick wieder. Es ist einfach unmöglich, Johanna zu vergessen, egal, ob man sie erst einmal oder schon tausendmal gesehen hat. Von ihrer rechten Augenbraue bis zu ihrer Lippe verläuft eine breite Narbe, weshalb sie auf einem Auge blind ist und beim Sprechen lispelt. Ich habe sie nur einmal sprechen hören, aber ich erinnere mich auch daran. Ohne diese Narbe wäre sie eine schöne Frau.
»Oh, Gott sei Dank.« Mit ausgebreiteten Armen geht sie auf Marcus zu. Aber statt ihn zu umarmen, berührt sie ihn nur leicht an der Schulter. Wahrscheinlich erinnert sie sich an die Abneigung der Altruan gegen jeden beiläufigen Körperkontakt.
»Die anderen aus deiner Gruppe sind schon vor ein paar Stunden angekommen, aber sie wussten nicht, ob auch ihr es geschafft habt.« Sie spricht von den Altruan, die zusammen mit meinem Vater und Marcus in dem geheimen Unterschlupf waren. Ich habe keinen Gedanken an sie verschwendet, geschweige denn mir Sorgen um sie gemacht.
Sie blickt über Marcus’ Schulter, zuerst auf Tobias und Caleb, dann auf mich, zuletzt auf Peter.
»Oje«, sagt sie, während ihr Blick an Peters blutdurchtränktem Hemd hängen bleibt. »Ich lasse sofort einen Arzt kommen. Ich kann euch allen erlauben, die Nacht hier zu verbringen, aber morgen muss unsere Gemeinschaft darüber abstimmen, ob ihr bleiben dürft. Und« – ihr Blick fällt auf Tobias und mich – »sie werden sicher nicht allzu erfreut darüber sein, Ferox in ihrer Mitte zu haben. Ich muss euch natürlich bitten, mir sämtliche Waffen auszuhändigen.«
Ich frage mich sofort, woher sie weiß, dass ich eine Ferox bin. Immerhin trage ich ein graues Hemd. Das Hemd meines Vaters.
In diesem Moment steigt mir sein Geruch in die Nase, eine Mischung aus Seife und Schweiß, und ich denke nur noch an ihn. Ich balle die Fäuste so fest, dass sich meine Fingernägel in die Handflächen graben. Nicht hier. Nicht hier.
Tobias gibt ihr seine Pistole, aber als ich hinter mich greife, um die Waffe, die ich dort verborgen habe, hervorzuziehen, fasst er nach meiner Hand und zieht sie wieder nach vorn. Dann verschränkt er seine Finger mit meinen, um seine Bewegung zu kaschieren.
Ich weiß, es ist klug, eine Waffe zurückzubehalten. Aber es wäre eine Erleichterung gewesen, sie abgeben zu können.
»Ich heiße Johanna Reyes«, sagt sie und streckt erst mir, dann Tobias die Hand hin. Die Begrüßung der Ferox. Ich bin beeindruckt, wie gut sie die Gewohnheiten anderer Fraktionen kennt. Ich vergesse immer, wie umsichtig und aufmerksam die Amite sind, bis ich es wieder mit meinen eigenen Augen sehe.
»Das ist T-«, setzt Marcus an, aber Tobias schneidet ihm das Wort ab.
»Ich heiße Four«, sagt er. »Und das sind Tris, Caleb und Peter.«
Vor ein paar Tagen noch war ich die einzige Ferox, die seinen wahren Namen kannte. Tobias. Dieser Name ist ein Teil seiner selbst, den er mir anvertraut hat. Erst jetzt, wo wir nicht mehr im Hauptquartier der Ferox sind, begreife ich, warum er seinen Namen in der Welt der Ferox geheim gehalten hat. Sein Name verbindet ihn mit Marcus.
»Willkommen auf dem Gelände der Amite.« Johannas Blick bleibt auf mir ruhen und sie setzt ein schiefes Lächeln auf. »Kommt, wir kümmern uns jetzt erst einmal um euch.«
Wir lassen uns von ihnen helfen. Eine Krankenschwester der Amite gibt mir eine spezielle Salbe für meine Schulter, die von den Ken entwickelt wurde, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Dann begleitet die Schwester Peter in eine Krankenstation, um seinen Arm zu behandeln. Johanna bringt uns zur Cafeteria, wo wir ein paar von den Altruan treffen, die zusammen mit Caleb und meinem Vater im Unterschlupf waren. Auch Susan ist da und ein paar von unseren früheren Nachbarn, sie sitzen an hölzernen Tischen, die sich in Reihen durch den ganzen Raum ziehen. Sie begrüßen uns – besonders Marcus – mit Tränen in den Augen und verhaltenem Lächeln.
Ich klammere mich an Tobias’ Arm. Beim Anblick all dieser Menschen aus der Fraktion meiner Eltern, die nur noch ihr nacktes Leben retten konnten und nichts mehr haben außer ihren Tränen, breche ich beinahe zusammen.
Ein Altruan hält mir eine Tasse dampfender Flüssigkeit unter die Nase.»Trink das. Es wird dir helfen, zu schlafen. Es hat schon manchen von uns in den Schlaf geholfen. Ohne Träume.«
Das Getränk schimmert hellrot, wie Erdbeeren. Ich nehme die Tasse und trinke hastig. Ein paar Augenblicke lang erfüllt mich die Hitze. Schon als ich die letzten Tropfen austrinke, fühle ich, wie ich mich entspanne. Jemand führt mich einen Gang entlang in ein Zimmer, in dem ein Bett steht. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann.
2. Kapitel
Voller Angst schlage ich die Augen auf und klammere mich an das Bettlaken. Aber ich hetze gar nicht durch die Straßen der Stadt oder durch die Korridore des Hauptquartiers der Ferox. Ich bin bei den Amite und liege in einem Bett. Der Geruch von Sägemehl hängt in der Luft.
Ich drehe mich auf die andere Seite und zucke zusammen, als etwas in meinen Rücken sticht. Ich greife hinter mich und meine Finger umschließen eine Pistole.
Einen Augenblick lang sehe ich Will vor mir stehen, wir beide haben unsere Waffen aufeinander gerichtet – seine Hand, ich hätte auf seine Hand schießen können, warum habe ich das nicht getan, warum? – und beinahe schreie ich seinen Namen laut heraus.
Dann ist er weg.
Ich stehe auf, hebe die Matratze mit einer Hand hoch und stütze sie mit meinem Knie ab. Dann schiebe ich die Pistole darunter und begrabe sie unter der Matratze. Sobald ich sie nicht mehr sehe und sie sich nicht länger in meine Haut bohrt, kann ich klarer denken.
Jetzt, wo der Adrenalinstoß von gestern verflogen ist und das Schlafmittel nicht mehr wirkt, spüre ich die Schmerzen und die Schusswunde in meiner Schulter umso heftiger. Ich trage noch dieselben Kleider wie am Vorabend. Die Festplatte lugt unter meinem Kissen hervor. Kurz vor dem Einschlafen hatte ich sie einfach darunter geschoben. Auf ihr sind die Daten der Simulation gespeichert, mit der die Ferox ferngesteuert wurden, und Aufzeichnungen von allem, was die Ken getan haben. Die Festplatte ist viel zu wertvoll, eigentlich dürfte ich sie überhaupt nicht anrühren, aber ich kann sie nicht einfach hier lassen, also nehme ich sie und klemme sie zwischen die Kommode und die Wand. Ich bin hin- und hergerissen, einerseits habe ich das Gefühl, dass es eine gute Idee wäre, sie zu zerstören, andererseits weiß ich, dass sie die einzige Aufzeichnung darüber enthält, wie meine Eltern gestorben sind. Ich beschließe, sie lieber zu verstecken.
Jemand klopft an meine Tür. Ich setze mich auf die Bettkante und versuche, mein Haar glatt zu streichen.
»Herein«, sage ich.
Die Tür geht auf und Tobias steckt den Kopf hindurch. Er trägt dieselbe Jeans wie gestern, aber statt des schwarzen T-Shirts hat er nun ein dunkelrotes an; wahrscheinlich hat er es sich von einem Amite geliehen. Es ist eine ungewohnte Farbe an ihm, viel zu grell, aber als er sich gegen den Türrahmen lehnt, bemerke ich, dass sie das Blau seiner Augen heller leuchten lässt.
»Die Amite treffen sich in einer halben Stunde.« Er zieht die Augenbrauen hoch und fügt mit einem Hauch von Drama in der Stimme hinzu: »Um über unser Schicksal zu entscheiden.«
Ich schüttle den Kopf. »Ich hätte nie gedacht, dass mein Schicksal einmal von ein paar Amite abhängen würde.«
»Ich auch nicht. Oh, ich habe dir was mitgebracht.« Er schraubt den Verschluss einer kleinen Flasche auf, die eine klare Flüssigkeit enthält, und reicht sie mir. »Schmerzmittel. Nimm alle sechs Stunden ein paar Tropfen.«
»Danke.« Ich lasse mir etwas davon in den Mund tropfen. Die Medizin schmeckt nach alten Zitronen.
Er hakt seinen Daumen in eine seiner Gürtelschlaufen. »Wie geht es dir, Beatrice?«, fragt er.
»Hast du mich eben Beatrice genannt?«
»Ich dachte, einen Versuch ist es wert.« Er lächelt. »Nicht gut?«
»Vielleicht zu besonderen Anlässen. »Am Tag der Initiation. Bei der Zeremonie der Bestimmung …« Ich stocke. Ich war drauf und dran, noch ein paar Feiertage herunterrasseln, die nur bei den Altruan gefeiert werden. Die Ferox haben ihre eigenen Feiertage, nehme ich an, aber die kenne ich nicht. Und überhaupt, die Vorstellung, dass wir gerade jetzt etwas zu feiern hätten, ist so lächerlich, dass ich nicht weiterrede.
»Abgemacht.« Sein Lächeln verschwindet. »Wie geht es dir, Tris?«
Nach allem, was wir hinter uns haben, ist das eine berechtigte Frage, aber als er sie stellt, verkrampft sich alles in mir vor lauter Angst, dass er irgendwie meine Gedanken lesen kann. Ich habe ihm noch nichts von Will erzählt. Schon beim Gedanken daran, es laut auszusprechen, senkt sich eine bleierne Schwere über mich, sodass ich im Boden versinken könnte.
»Ich …« Ich schüttle ein paar Mal den Kopf. »Ich weiß nicht, Four. Jedenfalls bin ich jetzt wach. Ich …« Ich kann einfach nicht aufhören, den Kopf zu schütteln. Er streicht über meine Wange und legt einen Finger hinter mein Ohr. Dann beugt er sich zu mir und küsst mich. Ein warmer Schauer durchläuft meinen Körper. Mit beiden Händen umfasse ich seine Arme und halte ihn fest, so lange ich kann. Wenn er mich berührt, spüre ich die Leere in meiner Brust und in meinem Bauch nicht ganz so stark.
Ich muss es ihm ja nicht sagen. Ich kann einfach versuchen, es zu vergessen – er kann mir helfen, es zu vergessen.
»Ich weiß«, sagt er. »Tut mir leid, ich hätte nicht fragen sollen.«
Einen Moment kann ich nichts anderes denken als Was weißt du denn schon? Aber sein Gesichtsausdruck erinnert mich daran, dass er sehr wohl eine Ahnung hat, was Verlust bedeutet. Als er jung war, hat er seine Mutter verloren. Ich weiß nicht mehr, wie sie gestorben ist, ich erinnere mich nur noch daran, dass wir auf ihrer Beerdigung waren.
Plötzlich fällt mir wieder ein, wie er sich an den Vorhängen in seinem Wohnzimmer festklammerte. Er muss ungefähr neun Jahre alt gewesen sein. Er trug graue Kleidung, seine dunklen Augen waren geschlossen. Aber das Bild in meiner Erinnerung ist verschwommen; vielleicht entspringt es nur meiner Einbildung und nicht meiner Erinnerung.
Er lässt mich los. »Ich gehe, damit du dich in Ruhe fertig machen kannst.«
Das Badezimmer für die Frauen ist zwei Türen weiter. Der Boden ist dunkelbraun gekachelt und jede Duschkabine ist mit Holzwänden und einem Plastikvorhang vom Mittelgang getrennt. An der rückwärtigen Wand hängt ein Schild mit der Aufschrift NICHTVERGESSEN: UMWASSERZUSPAREN, SCHALTENDIEDUSCHENNACHFÜNFMINUTENAB.
Das Wasser ist eiskalt, sodass ich gar nicht länger duschen will, selbst wenn ich könnte. Ich wasche mich rasch mit der linken Hand und lasse die rechte schlaff herabhängen. Das Schmerzmittel, das Tobias mir mitgebracht hat, wirkt schnell – der Schmerz in meiner Schulter ist nur noch ein dumpfes Pochen.
Als ich aus der Dusche komme, liegt ein Stapel Kleider auf meinem Bett. Die Sachen sind rot und gelb, die Farben der Amite, es sind aber auch ein paar graue Teile von den Altruan dabei. Farben, die man selten nebeneinander sieht. Wenn ich raten müsste, dann würde ich tippen, dass jemand von den Altruan den Stapel für mich bereitgelegt hat. An so was zu denken, sieht ihnen ähnlich.
Ich ziehe ein Paar dunkelrote Jeans an – sie sind so lang, dass ich sie dreimal umschlagen muss – und ein graues Altruan-Hemd, das mir viel zu groß ist. Die Ärmel reichen mir bis zu den Fingerspitzen, deshalb kremple ich sie ebenfalls hoch.
Es klopft an der Tür. »Beatrice?« Gedämpft höre ich Susans Stimme.
Ich öffne ihr die Tür. Sie trägt ein Tablett mit Essen, das sie auf meinem Bett abstellt. Ich suche in ihrer Miene nach einer Spur des Verlustes, den sie erlitten hat – ihr Vater, einer der Anführer der Altruan, hat den Angriff nicht überlebt –, aber ich sehe nur die stille Entschlossenheit, die meine alte Fraktion auszeichnet.
»Es tut mir leid, dass die Kleider nicht passen«, sagt sie. »Ich bin sicher, dass wir bessere auftreiben können, wenn die Amite uns erlauben, hierzubleiben.«
»Die Kleider sind völlig in Ordnung«, sage ich. »Vielen Dank.«
»Ich habe gehört, dass du angeschossen wurdest. Brauchst du meine Hilfe bei deinen Haaren? Oder bei den Schuhen?«
Ich will gerade dankend ablehnen, aber ich brauche tatsächlich Hilfe.
»Ja, vielen Dank.«
Ich setze mich auf einen Stuhl vor dem Spiegel; sie stellt sich hinter mich. Pflichtbewusst wie sie ist, konzentriert sie sich nur auf das, was sie gerade tut, ohne einen Blick auf ihr eigenes Spiegelbild zu werfen. Sie sieht nicht auf, nicht einmal für den Bruchteil einer Sekunde, während sie mit dem Kamm durch meine Haare fährt. Und sie fragt mich nicht nach meiner Schulter oder danach, wie ich angeschossen wurde oder was geschehen ist, als ich den Unterschlupf der Altruan verlassen habe, um die Simulation zu stoppen. Selbst wenn ich Susan mit einem Röntgenblick durchleuchten könnte, wäre sie auch im innersten Kern noch durch und durch eine Altruan.
»Hast du Robert schon gesehen?«, frage ich. Ihr Bruder Robert hat sich für die Amite entschieden, während ich zu den Ferox gegangen bin, also muss er hier irgendwo auf dem Gelände sein. Ich frage mich, ob ihr Wiedersehen auch so verlaufen ist wie das von Caleb und mir.
»Gestern Abend, aber nur kurz«, antwortet sie. »Ich habe ihn mit seiner Fraktion trauern lassen, so wie ich zusammen mit meiner getrauert habe. Aber es ist trotzdem schön, ihn wiederzusehen.«
In ihrer Stimme liegt eine Entschiedenheit, die mir sagt, dass das Thema erledigt ist.
»Es ist eine Schande, dass es gerade jetzt passiert ist«, sagt Susan. »Unsere Anführer waren drauf und dran, etwas Wunderbares zu tun.«
»Tatsächlich? Was denn?«
Susan errötet. »Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass etwas geplant war. Ich wollte nicht neugierig sein; mir sind nur ein paar Dinge aufgefallen.«
»Ich würde dir nie vorwerfen, neugierig zu sein, selbst wenn es so wäre.«
Sie nickt und kämmt weiter. Ich frage mich, was die Anführer der Altruan – zu denen auch mein Vater gehört hat – geplant haben.
Und ich wundere mich, dass Susan wie selbstverständlich davon ausgeht, dass diese Pläne wunderbar gewesen waren, ganz egal, worum es dabei ging. Ich wünschte, ich könnte je wieder so an die Menschen glauben.
Wenn ich es denn überhaupt je gekonnt habe.
»Die Ferox tragen die Haare offen, stimmt’s?« fragt sie.
»Manchmal«, antworte ich. »Kannst du einen Zopf flechten?«
Mit ihren flinken Fingern bindet sie meine Haarsträhnen zu einem Zopf, der mich am Rücken kitzelt. Ich starre konzentriert auf mein Spiegelbild, bis sie fertig ist. Dann bedanke ich mich bei ihr und sie geht mit einem leisen Lächeln und schließt die Tür hinter sich.
Ich starre weiter in den Spiegel, ohne mich zu sehen. Noch immer spüre ich ihre Finger, die über meinen Nacken streichen, ganz genauso wie die Finger meiner Mutter an jenem letzten Morgen, den ich mit ihr zusammen verbracht habe. Meine Augen füllen sich mit Tränen, und ich wiege mich auf meinem Stuhl hin und her und versuche, diese Erinnerung zu vertreiben. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr aufhören kann zu weinen, wenn ich erst einmal angefangen habe.
Auf der Kommode liegt Nähzeug, unter anderem Garn in zwei Farben, rot und gelb, und eine Schere.
Ich fühle mich ganz ruhig, als ich den Zopf wieder löse und mein Haar kämme. Ich teile meine Haare in der Mitte und achte darauf, dass sie auf beiden Seiten glatt herunterhängen. Dann schneide ich meine Haare auf Kinnlänge ab.
Wie kann ich noch so aussehen wie früher, wo sie doch gestorben ist und jetzt alles anders ist? Das geht einfach nicht.
Ich versuche, die Haare so gerade wie möglich abzuschneiden und orientiere mich dabei an meinem Kinn. Das Schwierigste sind die Haare hinten, die ich nicht richtig sehen, sondern nur fühlen kann. Blonde Haarlocken fallen im Halbkreis um mich herum zu Boden.
Ich verlasse das Zimmer, ohne noch einmal einen Blick in den Spiegel zu werfen.
Als Tobias und Caleb mich später holen kommen, starren sie mich an, als wäre ich eine Fremde.
»Du hast dir die Haare abgeschnitten«, stellt Caleb mit hochgezogenen Augenbrauen fest. Mitten in all dem Schrecken die Tatsachen festzustellen und sich an sie zu klammern, ist eine typische Eigenschaft der Ken. Auf der Seite, auf der er geschlafen hat, stehen ihm noch die Haare zu Berge und seine Augen sind blutunterlaufen.
»Ja«, sage ich. »Es ist … viel zu warm für lange Haare.«
»Ach so.«
Gemeinsam gehen wir den Korridor entlang. Der Holzboden knarzt unter unseren Füßen. Mir fehlt das hallende Echo meiner Schritte im Gebäude der Ferox; mir fehlt der kühle, unterirdische Luftstrom; aber am meisten vermisse ich die Ängste der vergangenen Wochen, die mir angesichts der Ängste, die ich jetzt ausstehe, ganz unbedeutend vorkommen.
Wir verlassen das Gebäude. Die Luft draußen liegt schwer auf mir, wie ein Kissen, das mir die Luft zum Atmen nimmt. Es riecht nach grüner Natur, wie ein zerriebenes Blatt.
»Ahnt jemand, dass du Marcus’ Sohn bist?«, fragt Caleb. »Einer von den Altruan, meine ich?«
»Soweit ich weiß nicht«, sagt Tobias und wirft Caleb einen Blick zu. »Und ich würde es sehr begrüßen, wenn du es nicht rumposaunen würdest.«
»Das brauche ich gar nicht, denn das sieht jeder, wenn er nicht gerade blind ist.« Caleb starrt ihn missmutig an. »Wie alt bist du überhaupt?«
»Achtzehn.«
»Und du meinst nicht, dass du zu alt bist, um mit meiner kleinen Schwester zusammen zu sein?«
Tobias lacht kurz auf. »Sie ist nicht deine kleine irgendwas.«
»Hört auf. Alle beide«, sage ich. Vor uns geht eine Gruppe gelb gekleideter Menschen auf ein geräumiges, flaches Gebäude zu, das ganz aus Glas erbaut ist. Das Sonnenlicht, das sich in den Scheiben spiegelt, blendet mich. Ich halte die Hand schützend vor meine Augen und gehe weiter.
Die Türen des Gebäudes vor uns stehen weit offen. Am Rand des runden Gewächshauses wachsen Pflanzen und Bäume in Trögen voller Wasser oder in kleinen Teichen. Dutzende von Ventilatoren wälzen lediglich die heiße Luft um, sodass ich jetzt schon schwitze. Aber daran verschwende ich keinen Gedanken mehr, als sich die Menschenmenge vor mir lichtet und ich den Rest des Raums sehe.
In seiner Mitte wächst ein riesiger Baum, dessen Äste den Großteil des Gewächshauses überspannen. Seine Wurzeln quellen aus dem Boden hervor und bilden ein dichtes Netz. Zwischen den Wurzeln sehe ich keine Erde, sondern Wasser und Metallstangen, die die Wurzeln an ihrem Platz halten. Ich dürfte eigentlich nicht überrascht sein, immerhin verbringen die Amite ihr gesamtes Leben damit, mithilfe von Ken-Technik solche Kunststücke bei der Pflanzenzucht zu bewirken.
Mitten zwischen den Wurzeln steht Johanna Reyes; ihr Haar fällt über die vernarbte Gesichtshälfte. Im Unterricht über die Geschichte der Fraktionen habe ich gelernt, dass die Amite keinen offiziellen Anführer haben – sie stimmen über alles ab, und jedes Mal so gut wie einstimmig. Sie alle sind Teile eines gemeinsamen Verstands und Johanna ist ihr Sprachrohr.
Die Amite setzen sich auf den Boden, die meisten mit überkreuzten Beinen, in Gruppen und kleinen Ansammlungen, die mich irgendwie an die Wurzeln des Baumes erinnern. Links von mir sitzen die Altruan in dicht gedrängten Reihen. Ich lasse den Blick über die Menge schweifen, bis mir klar wird, wonach ich Ausschau halte: nach meinen Eltern.
Ich schlucke heftig und versuche, nicht mehr daran zu denken. Tobias berührt mich am Rücken und führt mich an den Rand des Versammlungsplatzes, hinter die Altruan. Bevor wir uns setzen, flüstert er mir leise ins Ohr: »Mir gefällt dein Haar, so wie es jetzt ist.«
Ich bringe ein flüchtiges Lächeln zustande und lehne mich an ihn, als wir uns setzen, mein Arm an seinem.
Johanna hebt die Hand und senkt den Kopf. Noch ehe ich den nächsten Atemzug getan habe, sind alle Unterhaltungen im Raum bereits verstummt. Die Amite um mich herum sitzen schweigend da, manche mit geschlossenen Augen, manche bewegen ihre Lippen und murmeln etwas, das ich nicht verstehe. Andere starren einfach in der Ferne.
Die Sekunden verstreichen schmerzhaft langsam. Als Johanna ihren Kopf wieder hebt, fühle ich mich völlig ausgelaugt.
»Heute stellt sich uns ein dringendes Problem«, beginnt sie, »denn wie sollen wir uns in diesen Zeiten des Kriegs als friedliebende Menschen verhalten?«
Jeder Amite im Raum wendet sich an seinen Nachbarn und beginnt zu reden.
»Wie kriegen sie auf die Art und Weise je etwas auf die Reihe?«, frage ich, als die Minuten unter nicht enden wollendem Geschnatter vergehen.
»Ihnen geht es nicht um Leistung oder Effektivität«, sagt Tobias. »Es kommt auf die gemeinschaftliche Einigung an. Pass auf.«
Wenige Schritte von uns entfernt erheben sich zwei gelb gekleidete Frauen und schließen sich einer Gruppe von drei Männern an. Ein junger Mann setzt sich in Bewegung, und die kleine Gruppe von Menschen, die sich um ihn schart, verschmilzt mit der benachbarten Gruppe zu einem großen Kreis. Im ganzen Raum wachsen die kleineren Menschentrauben an und dehnen sich weiter und weiter aus, gleichzeitig erfüllen immer weniger Stimmen den Raum, bis nur noch drei oder vier zu hören sind. Ich schnappe nur einzelne Satzfetzen auf: »Frieden – Ferox – Ken – Unterschlupf – Einmischung …«
»Das ist ja bizarr«, sage ich.
»Ich finde es wunderbar«, erwidert er.
Ich werfe ihm von der Seite einen Blick zu.
»Was denn?« Er lacht leise. »Jeder von ihnen spielt eine gleichberechtigte Rolle bei den Regierungsgeschäften; jeder fühlt sich gleichermaßen verantwortlich. Deshalb engagieren sie sich, deshalb sind sie freundlich zueinander. Ich finde das großartig.«
»Ich glaube nicht, dass so etwas auf die Dauer gut geht«, entgegne ich. »Okay, bei den Amite funktioniert es. Aber was, wenn nicht jeder auf Banjogeklimper und Ackerbau steht? Was, wenn jemand etwas wirklich Schlimmes tut und man das Problem nicht durch Reden lösen kann?«
Er zuckt die Schultern. »Ich schätze, das werden wir noch herausfinden.«
Schließlich erhebt sich einer aus jeder Gruppe, steigt vorsichtig über die Wurzeln des großen Baumes hinweg und geht zu Johanna. Ich rechne damit, dass sie jetzt das Wort an uns richten, aber stattdessen stellen sie sich in einem Kreis zu Johanna und den anderen Sprechern und unterhalten sich leise. Allmählich beschleicht mich das Gefühl, dass wir nie erfahren werden, was sie besprechen.
»Unsere Meinung interessiert sie nicht, oder?«, frage ich.
»Wohl kaum«, antwortet er.
Dann sind wir so gut wie erledigt.
Als jeder losgeworden ist, was er zu sagen hatte, setzen sie sich wieder hin. Nur Johanna steht noch in der Mitte des Raumes. Sie wendet sich in unsere Richtung und faltet die Hände vor der Brust. Wohin sollen wir gehen, wenn sie uns fortschicken? Zurück in die Stadt, wo wir nirgends sicher sind?
»Solange wir denken können, hat unsere Fraktion eine enge Verbindung zu den Ken gepflegt. Wir sind aufeinander angewiesen, um zu überleben, und wir haben immer zusammengearbeitet«, sagt Johanna. »Aber wir haben in der Vergangenheit auch enge Verbindungen zu den Altruan aufgebaut, und wir halten es nicht für richtig, ihnen gerade jetzt unsere in Freundschaft dargereichte Hand zu entziehen, wo sie doch so lange ausgestreckt war.«
Ihre Stimme ist honigsüß und auch ihre Worte fließen wie Honig – langsam und bedächtig. Ich wische mir mit dem Handrücken die Schweißperlen von der Stirn.
»Wir glauben, dass wir die Freundschaft mit beiden Fraktionen nur aufrechterhalten können, wenn wir unparteiisch bleiben und uns nicht einmischen«, fährt sie fort. »Obwohl ihr uns willkommen seid, macht eure Anwesenheit hier die ganze Sache kompliziert.«
Jetzt kommt’s, denke ich.
»Daher haben wir den Entschluss gefasst, unser Hauptquartier allen Fraktionen als sicheren Zufluchtsort zur Verfügung zu stellen«, sagt sie, »aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Erstens sind auf unserem Gelände keinerlei Waffen erlaubt. Zweitens gilt, dass, sollte ein ernsthafter Streit ausbrechen, ganz gleich, ob es sich dabei um Wortgefechte oder Handgreiflichkeiten handelt, alle daran Beteiligten uns verlassen müssen. Die dritte Bedingung ist, dass auf unserem Gelände niemand über diesen Konflikt auch nur ein Wort verlieren darf, nicht einmal unter vier Augen. Und die vierte Bedingung ist die, dass jeder, der sich hier auf unserem Gelände befindet, zum Wohlergehen unserer Allgemeinheit beitragen muss, indem er mitarbeitet. Wir werden die Ken, die Candor und die Ferox baldmöglichst über diesen Beschluss in Kenntnis setzen.«
Ihr Blick schweift zu Tobias und mir und ruht dann auf uns.
»Auch ihr könnt hier gerne bleiben, allerdings nur dann, wenn ihr euch an unsere Regeln haltet«, sagt sie. »So haben wir es entschieden.«
Ich muss an die Waffe denken, die ich unter meiner Matratze versteckt habe, und an die Spannungen zwischen mir und Peter, zwischen Tobias und Marcus, und mein Mund wird trocken. Streit aus dem Weg zu gehen, ist nicht gerade eine meiner Stärken.
»Wir werden nicht lange hier bleiben können«, flüstere ich Tobias zu.
Gerade noch hat er ein leichtes Lächeln auf den Lippen gehabt. Jetzt verzieht er verärgert den Mund. »Nein, das werden wir nicht.
3. Kapitel
Als ich an diesem Abend in mein Zimmer zurückkehre, greife ich unter die Matratze, um mich davon zu überzeugen, dass die Waffe noch an ihrem Platz ist. Meine Finger tasten über den Abzug, und sofort schnürt sich mir die Kehle zu, so als würde ich allergisch darauf reagieren. Ich ziehe meine Hand hervor und knie mich auf die Bettkante, warte schwer atmend, bis das Gefühl der Enge nachlässt.
Was ist los mit dir? Ich schüttle den Kopf. Reiß dich zusammen.
Genauso fühle ich mich, so, als müsste ich die einzelnen Teile von mir einfädeln und festbinden wie mit einem Schnürsenkel. Es ist ein erstickendes Gefühl, aber wenigstens fühle ich mich dabei auch stark.
Aus den Augenwinkeln nehme ich eine Bewegung wahr, und ich blicke aus dem Fenster, das auf den Apfelgarten hinausgeht. Johanna Reyes und Marcus Eaton gehen nebeneinander her, bleiben am Kräutergarten stehen und zupfen Pfefferminzblätter. Ich bin schon aus meinem Zimmer gelaufen, noch bevor ich mir überlegt habe, weshalb ich ihnen eigentlich folgen will.
Ich renne durch das Gebäude, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Sobald ich im Freien bin, muss ich vorsichtiger sein. Ich laufe an der gegenüberliegenden Seite des Gewächshauses entlang. Als ich Johanna und Marcus hinter einer Baumreihe verschwinden sehe, schleiche ich durch die benachbarte Reihe und hoffe, dass mich die Äste verdecken, falls einer von beiden sich umsieht.
»… was mich verwirrt hat, war der Zeitpunkt des Angriffs«, sagt Johanna. »War es nur, weil Jeanine ihre Planungen vollendet hatte und sie gleich in die Tat umsetzen wollte, oder gab es irgendeinen Auslöser dafür?«
Ich sehe Marcus’ Gesicht durch einen gespaltenen Baumstamm hindurch. Er presst die Lippen zusammen und brummt nur. »Hmmm.«
»Ich schätze, das werden wir nie erfahren.« Johanna zieht ihre gesunde Augenbraue hoch. »Oder?«
»Nein, wahrscheinlich nicht.«
Johanna legt ihre Hand auf seinen Arm und dreht sich in seine Richtung. Ich erstarre aus Angst, dass sie mich entdecken könnte, aber sie blickt nur Marcus an. Ich ducke mich und husche auf einen Baum zu, um mich hinter dem Stamm zu verstecken. Die Rinde sticht mir in den Rücken, aber ich rühre mich nicht vom Fleck.
»Aber du weißt es«, sagt sie. »Du weißt, warum sie gerade diesen Moment gewählt hat, um anzugreifen. Ich mag vielleicht keine Candor mehr sein, aber ich spüre immer noch, wann jemand mir etwas verheimlicht.«
»Neugier ist eigennützig, Johanna.«
Ich an Johannas Stelle würde ihm auf so eine Bemerkung hin eine ziemlich pampige Antwort geben, aber sie bleibt weiterhin freundlich. »Meine Fraktion ist auf meinen Rat angewiesen, und wenn du die entscheidenden Informationen hast, dann ist es für uns wichtig, dass auch ich sie weiß, um sie den anderen mitzuteilen. Ich bin sicher, das kannst du verstehen, Marcus.«
»Es hat seinen Grund, dass du nicht alles erfährst, was ich weiß. Vor langer Zeit hat man den Altruan heikle Informationen anvertraut«, sagt Marcus. »Jeanine hat uns angegriffen, um sie zu stehlen. Und wenn ich nicht aufpasse, dann wird sie sie zerstören. Deshalb kann ich dir nicht mehr sagen.«
»Aber bestimmt –«
»Nein«, schneidet ihr Marcus das Wort ab. »Diese Information ist weit wichtiger, als du dir vorstellen kannst. Die meisten Anführer in dieser Stadt haben ihr Leben riskiert, damit dieses Wissen Jeanine nicht in die Hände fällt, und ich werde das nicht alles aufs Spiel setzen, um deine egoistische Neugier zu befriedigen.«
Für ein paar Sekunden schweigt Johanna. Jetzt ist es so dunkel, dass ich kaum meine Hand vor Augen sehe. Die Luft riecht nach Erde und Äpfeln, und ich versuche, nicht zu laut zu atmen.
»Es tut mir leid«, sagt Johanna. »Ich muss irgendetwas getan haben, was in deinen Augen als nicht vertrauenswürdig gilt.«
»Beim letzten Mal, als ich einem Vertreter einer anderen Fraktion diese Informationen anvertraut habe, wurden alle meine Freunde ermordet«, erwidert Marcus. »Ich vertraue niemandem mehr.«
Ich kann nicht anders – ich beuge mich vor, damit ich besser sehen kann. Sowohl Marcus als auch Johanna sind zu sehr mit sich beschäftigt, als dass ihnen diese Bewegung auffiele. Sie stehen dicht beieinander, aber berühren sich nicht. Ich habe Marcus nie so müde, Johanna nie so wütend gesehen. Doch dann entspannt sich ihre Miene und sie berührt Marcus wieder am Arm, diesmal sanft und fast liebkosend.
»Um Frieden zu finden, müssen wir uns zuerst vertrauen«, sagt Johanna. »Deshalb hoffe ich, dass du deine Meinung änderst. Vergiss nicht, ich war dir immer eine Freundin, Marcus, auch als es nicht viele Leute gab, von denen du das hättest sagen können.«
Sie beugt sich vor und küsst ihn auf die Wange, dann verlässt sie die Obstplantage. Marcus bleibt einige Augenblicke lang stehen, er ist ganz offensichtlich verblüfft, dann geht auch er in Richtung Hauptquartier.
Die Entdeckungen, die ich in der vergangenen halben Stunde gemacht habe, schwirren mir durch den Kopf. Ich war überzeugt, dass Jeanine die Altruan angegriffen hat, um die Macht an sich zu reißen; aber sie hat sie angegriffen, um an Informationen zu gelangen – an wichtige Daten, die nur die Altruan besitzen.
Mein Gedankenkarussell kommt abrupt wieder zum Stehen, als mir eine andere Bemerkung von Marcus einfällt. Die meisten Anführer in dieser Stadt haben dafür ihr Leben riskiert. War mein Vater einer von diesen Anführern?
Ich muss es wissen. Ich muss herausfinden, was für die Altruan so wichtig ist, dass sie bereit sind, dafür zu sterben – und was die Ken sogar zu Mördern werden lässt.
Ich warte einen Moment, bevor ich an Tobias’ Tür klopfe, und lausche, was dahinter vor sich geht.
»Nein, doch nicht so«, sagt Tobias lachend.
»Was meinst du, nicht so? Ich habe es ganz genauso gemacht wie du.« Die andere Stimme gehört Caleb.
»Hast du nicht.«
»Ach ja, dann mach es noch mal.«
Ich öffne die Tür gerade in dem Augenblick, als Tobias – auf dem Boden sitzend, ein Bein lässig ausgestreckt – ein Buttermesser auf die gegenüberliegende Wand wirft. Es bleibt mit dem Griff nach oben in einem großen Stück Käse stecken, das sie auf die Kommode gelegt haben. Caleb, der neben Tobias steht, starrt ungläubig zuerst auf den Käse, dann auf mich.
»Sag mir, dass er so eine Art Ferox-Genie ist«, sagt Caleb. »Oder kannst du das auch?«
Er sieht jetzt besser aus, seine Augen sind nicht mehr gerötet und es blitzt die alte Neugierde aus ihnen hervor, als würde er sich wieder für die Dinge, die in der Welt um ihn herum vorgehen, interessieren. Sein braunes Haar ist struppig, sein Hemd ist falsch geknöpft. Mein Bruder sieht auf eine unbekümmerte Art sehr gut aus, gerade weil er selbst meist keine Ahnung hat, wie er wirkt.
»Mit rechts vielleicht«, antworte ich. »Aber es stimmt, Four ist so etwas wie ein Genie. Darf ich fragen, warum genau ihr mit Messern auf den Käse werft?«
Als ich »Four« sage, wirft Tobias mir einen Blick zu. Caleb weiß nicht, dass Tobias seine besondere Begabung stets in seinem Spitznamen mit sich trägt.
»Caleb kam vorbei, weil er etwas besprechen wollte«, sagt Tobias und lehnt den Kopf gegen die Wand, während er mich ansieht. »Und irgendwie sind wir dann aufs Messerwerfen gekommen.«
»Naheliegend«, sage ich, und ein verstohlenes Lächeln schleicht sich auf mein Gesicht.
Er wirkt so entspannt, wie er mit zurückgelegtem Kopf dasitzt, die Arme um das Knie geschlungen. Wir blicken uns ein paar Sekunden länger an, als es sich gehört. Caleb räuspert sich.
»Na ja, jedenfalls gehe ich jetzt wohl besser wieder in mein Zimmer«, sagt er und blickt abwechselnd Tobias und mich an.»Ich lese gerade das Buch über diese Wasserfiltersysteme. Der Junge, von dem ich es habe, hat mich angestarrt, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank, als ich ihn danach fragte. Ich glaube, eigentlich ist es als Reparaturanleitung gedacht, aber es ist wirklich sehr spannend.« Er unterbricht sich.»Tut mir leid, wahrscheinlich haltet ihr mich jetzt auch für verrückt.«
»Ganz und gar nicht«, sagt Tobias in gespieltem Ernst. »Vielleicht solltest du die Reparaturanleitung auch mal lesen, Tris. Das könnte dir doch vielleicht auch gefallen.«
»Ich kann’s dir gerne leihen«, sagt Caleb eifrig.
»Später vielleicht«, antworte ich. Als Caleb die Tür hinter sich schließt, werfe ich Tobias einen bösen Blick zu.
»Vielen Dank auch«, sage ich. »Jetzt wird er mir die Ohren vollquasseln, wie diese Wasserfilter genau funktionieren. Obwohl ich das vermutlich immer noch dem vorziehen würde, worüber er mit mir sprechen will.«
»Oh? Und was wäre das?« Tobias zieht die Brauen hoch. »Aquaponik vielleicht?«
»Aqua-was??«
»Das ist eine der Methoden, mit der sie hier Nahrungsmittel anbauen. Das willst du gar nicht so genau wissen, glaub mir.«
»Du hast recht. Will ich nicht. Worüber wollte er mit dir reden?«
»Über dich«, sagt Tobias. »Ich glaube, es war so eine Art Großer-Bruder-Gespräch. ›Spiel nicht mit meiner Schwester‹ und so.«
Er steht auf.
»Was hast du ihm gesagt?«
Er kommt auf mich zu. »Ich habe ihm erzählt, wie wir uns kennengelernt haben – dabei sind wir dann auf das Messerwerfen gekommen. Und ich habe ihm noch gesagt, dass ich nicht mit dir spiele.«
Mein ganzer Körper wird heiß. Er legt seine Hände auf meine Hüften und drückt mich sanft gegen die Tür. Seine Lippen suchen meine.
Ich weiß nicht mehr, weshalb ich eigentlich hierhergekommen bin.
Und es ist mir auch egal.
Ich umarme ihn mit meinem gesunden Arm und ziehe ihn an mich. Meine Finger suchen den Saum seines T-Shirts und gleiten darunter; mit gespreizten Fingern fahre ich über seinen Rücken. Er fühlt sich so stark an.
Er küsst mich wieder, diesmal leidenschaftlicher, seine Hände umklammern meine Taille. Sein Atem, mein Atem, sein Körper, mein Körper, wir sind uns so nahe, dass wir beinahe verschmelzen.
Er weicht zurück, nur ein paar Zentimeter. Ich lasse ihn kaum so weit weg.
»Das ist nicht der Grund, warum du hergekommen bist«, sagt er.
»Nein.«
»Warum dann?«
»Wen kümmert das?«
Ich fahre mit den Fingern durch sein Haar und suche wieder seine Lippen. Er lässt es geschehen, aber nach ein paar Sekunden murmelt er »Tris« an meiner Wange.
»Okay, okay.« Ich schließe die Augen. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. Ich will ihm von dem Gespräch erzählen, das ich belauscht habe.
Wir setzen uns nebeneinander auf sein Bett und ich erzähle ihm alles von Anfang an. Ich schildere, wie ich Johanna und Marcus in die Obstplantage gefolgt bin, wie sich Johanna nach dem Zeitpunkt des Angriffs erkundigt hat, was Marcus darauf geantwortet hat und von dem Streit, der darauf folgte. Dabei beobachte ich seinen Gesichtsausdruck. Er wirkt weder erschrocken noch neugierig. Stattdessen verzieht er seine Mundwinkel voller Bitterkeit, als ich Marcus erwähne.
»Und, was hältst du von dem Ganzen?«, frage ich.
»Ich glaube«, sagt er langsam, »dass sich Marcus wichtiger machen will, als er ist.«
Diese Antwort habe ich nicht erwartet.
»Also … was? Du denkst, er redet einfach nur Unsinn?«
»Ich denke, es gibt tatsächlich etwas, was Jeanine von den Altruan wissen wollte, aber ich glaube nicht, dass es so extrem wichtig ist, wie er tut. Er wollte nur sein Ego polieren, indem er Johanna glauben macht, dass er etwas weiß, was er ihr vorenthält.«
»Das bezweifle ich …«, sage ich stirnrunzelnd. »Er hörte sich nicht an, als ob er lügen würde.«
»Ich kenne ihn besser als du. Er ist ein begnadeter Lügner.«
Es stimmt – ich kenne Marcus nicht, und erst recht nicht so gut wie er. Aber instinktiv habe ich Marcus geglaubt und auf mein Bauchgefühl kann ich mich normalerweise immer verlassen.
»Vielleicht hast du recht«, sage ich, »aber meinst du nicht, wir sollten herausfinden, was es damit auf sich hat? Nur um sicherzugehen?«
»Ich finde, wir sollten uns erst einmal um das Nächstliegende kümmern«, antwortet Tobias. »In die Stadt zurückgehen. Herausfinden, was dort vor sich geht. Einen Weg suchen, wie wir die Ken ausschalten können. Dann, wenn wir das alles erledigt haben, können wir vielleicht herausfinden, worüber Marcus geredet hat. Okay?«
Ich nicke. Es hört sich nach einem guten Plan an – einem cleveren Plan. Aber ich glaube ihm nicht – ich glaube nicht, dass es jetzt wichtiger ist, einfach so weiterzumachen, statt die Wahrheit ans Licht zu bringen. Als ich herausgefunden habe, dass ich eine Unbestimmte bin … als mir klar wurde, dass die Ken die Altruan angreifen wollen … diese Entdeckungen haben alles verändert. Manchmal wirft die Wahrheit alle Pläne über den Haufen.
Aber es ist schwierig, Tobias von etwas zu überzeugen, was er nicht will, und noch schwieriger ist es, mein ungutes Gefühl zu erklären, wo ich doch nur auf meine innere Stimme höre.
Deshalb bin ich einverstanden. Aber meine Ansichten ändern sich deshalb nicht.
4. Kapitel
»Biotechnologie gibt es schon lange, aber sie war nicht immer so wirkungsvoll«, sagt Caleb. Gerade beginnt er, an der Kruste seines Toasts zu knabbern – das Innere hat er zuerst gegessen, so wie er es schon als kleines Kind immer gemacht hat.
Er sitzt mir gegenüber in der Cafeteria, an einem Tisch gleich neben den Fenstern. In den Rand des Tisches sind ein »D« und ein »T« geritzt und beide Buchstaben sind durch ein kleines Herz miteinander verbunden. Sie sind so winzig, dass ich sie fast nicht bemerkt hätte. Ich fahre mit dem Finger über die Rillen, während Caleb weiterredet.
»Aber dann haben die Wissenschaftler der Ken vor einiger Zeit diese hochwirksame Mineralstofflösung entwickelt. Für die Pflanzen ist das viel besser als Erde«, sagt er. »Diese Substanz ist eine frühere Version der Salbe, die du für deine Schulter bekommen hast – sie beschleunigt das Wachstum neuer Zellen.«
Seine Augen leuchten angesichts des neu gewonnenen Wissens. Nicht alle Ken sind so machthungrig und gewissenlos wie ihre Anführerin Jeanine Matthews. Manche von ihnen sind wie Caleb, sie sind einfach für alles zu begeistern und erst dann zufrieden, wenn sie herausgefunden haben, wie etwas funktioniert.
Ich stütze das Kinn in die Hand und lächle ihn an. Heute Morgen scheint er gut gelaunt zu sein. Ich bin froh, dass er etwas gefunden hat, was ihn von seinem Kummer ablenkt.
»Also arbeiten die Ken und die Amite zusammen?«, frage ich.
»Die Ken arbeiten mit den Amite enger zusammen als mit jeder anderen Fraktion«, antwortet er. »Erinnerst du dich nicht mehr an unser Buch über die Geschichte der Fraktionen? Dort hießen sie die unentbehrlichen Fraktionen – ohne sie könnten wir nicht überleben. In manchen Schriften der Ken nennt man sie auch bereichernde Fraktionen. Und ein erklärtes Ziel der Ken ist es, beides zu werden – unentbehrlich und bereichernd.«
Es gefällt mir nicht, wie sehr unsere Gesellschaft auf die Ken angewiesen ist, um zu funktionieren. Die Ken sind tatsächlich unentbehrlich – ohne sie wäre die Landwirtschaft weniger ertragreich, die medizinischen Behandlungen wären nicht so wirkungsvoll und es gäbe keinen technischen Fortschritt mehr.
Ich beiße in meinen Apfel.
»Isst du deinen Toast nicht?«, fragt er.
»Das Brot hier schmeckt irgendwie seltsam«, sage ich. »Du kannst es haben, wenn du willst.«
»Es fasziniert mich, wie die Amite leben«, sagt er, während er den Toast von meinem Teller nimmt. »Sie haben alles, was sie zur Versorgung brauchen. Sie haben ihre eigenen Energiequellen, ihre eigenen Wasserpumpen, ihr eigenes Filtersystem, ihre eigenen Nahrungsmittelreserven … sie sind komplett unabhängig.«
»Ja, sie sind unabhängig«, antworte ich, »und sie halten sich aus allem raus. Das muss schön sein.«
Und was ich sehe, ist wirklich schön. Durch das große Fenster neben uns fällt so viel Sonnenlicht, dass es den Anschein hat, als wäre man im Freien. Gruppen von Amite sitzen an ihren Tischen, ihre helle Kleidung leuchtet auf ihrer gebräunten Haut. An mir wirkt das Gelb eher matt und langweilig.
»Ich nehme an, die Amite waren nicht unter den Fraktionen, die für dich infrage kamen«, sagt er grinsend.
»Nein.« Die Amite, die ein paar Stühle von uns entfernt sitzen, brechen in Gelächter aus. Seit wir uns zum Essen hingesetzt haben, haben sie nicht einmal in unsere Richtung geschaut. »Das musst du jetzt aber nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Es ist nicht gerade das, was ich hier in aller Öffentlichkeit herumposaunen möchte, okay?«
»Entschuldigung«, sagt er. Er beugt sich über den Tisch und senkt die Stimme. »Welche Fraktionen waren denn für dich geeignet?«
Ich spüre, wie sich meine Muskeln anspannen, und richte mich auf. »Warum willst du das wissen?«
»Tris«, sagt er. »Ich bin dein Bruder. Du kannst mir alles erzählen.«
Seine grünen Augen blinzeln nie. Er hat seine nutzlose Brille abgelegt, die er bei den Ken getragen hat, und sie gegen ein graues Altruan-Hemd und den für diese Fraktion typischen Kurzhaarschnitt eingetauscht. Jetzt sieht er wieder so aus wie vor ein paar Monaten, als wir Tür an Tür lebten und beide mit dem Gedanken spielten, in eine andere Fraktion zu wechseln, aber nicht den Mut aufbrachten, es uns gegenseitig zu gestehen. Ihm nicht zu vertrauen war ein Fehler gewesen, den ich nicht noch einmal wiederholen möchte.
»Altruan, Ferox«, antworte ich deshalb, »und Ken.«
»Drei Fraktionen?« Er zieht die Augenbrauen hoch.
»Ja, warum?«
»Hört sich nach einer ganzen Menge an«, sagt er. »Bei der Initiation der Ken musste sich jeder von uns einen Forschungsschwerpunkt aussuchen, und meiner war die Simulationen für den Eignungstest, deshalb weiß ich ganz gut darüber Bescheid. Es ist ziemlich schwierig, zwei Ergebnisse zu erreichen – das lässt das Programm eigentlich nicht zu. Aber gleich drei … ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll.«
»Na ja, die Prüferin musste den Test abändern«, sage ich. »Sie musste die Simulation zu dieser Situation im Bus lenken, um meine Eignung für die Ken auszuschließen – was aber nicht funktionierte.«
Caleb stützt sein Kinn in die Hände. »Sie hat den Test abgeändert«, wiederholt er. »Ich frage mich, wieso deine Prüferin das überhaupt konnte. So etwas lernen sie nicht.«
Seine Antwort irritiert mich. Tori arbeitet normalerweise in einem Tattoo-Studio, für die Eignungstests hat sie sich freiwillig gemeldet – woher wusste sie, wie man das Programm für die Eignungstests ändert? Wenn sie sich mit Computern auskennt, dann vielleicht, weil es ein Hobby von ihr ist – und ich bezweifle, dass jemand mit Amateurkenntnissen an einer Simulation der Ken herumbasteln kann.
Doch dann fällt mir etwas ein, was sie bei einer unserer Unterhaltungen sagte: Mein Bruder und ich sind beide von den Ken zu den Ferox gewechselt.
»Sie war eine Ken«, sage ich. »Sie hat ihre Fraktion gewechselt. Vielleicht deshalb.«
»Vielleicht«, antwortet er und trommelt mit den Fingern auf seine Wange. Unser Frühstück steht vergessen zwischen uns. »Was sagt das über deine Gehirnfunktionen aus? Oder über deine Anatomie?«
Ich muss lachen. »Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mir immer bewusst bin, dass ich mich in einer Simulation befinde, und manchmal kann ich sie steuern, mich aus ihr befreien. Manchmal wirken sie auch überhaupt nicht. Wie bei dem Simulationsangriff.«
»Wie kannst du dich aus einer Simulation befreien? Wie machst du das?«
»Ich …« Ich versuche, mich zu erinnern. Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, seit ich zum letzten Mal in einer Simulation war, obwohl es nur ein paar Wochen her ist. »Schwer zu sagen, die Simulationen bei den Ferox endeten, sobald wir uns wieder beruhigt hatten. Aber in einer meiner Simulationen … als Tobias herausfand, wer ich wirklich bin … habe ich etwas gemacht, was eigentlich unmöglich ist. Ich habe Glas zerbrochen, indem ich mit meiner Hand dagegen gedrückt habe.«
Calebs Miene ist undurchdringlich, er scheint in die Ferne zu blicken. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ihm in seinem eigenen Eignungstest nie passiert, so viel ist klar. Vielleicht fragt er sich, wie es sich wohl angefühlt hat oder wie es überhaupt möglich ist. Meine Wangen fangen an zu brennen – er nimmt mein Gehirn unter die Lupe, als würde er einen Computer oder eine Maschine untersuchen.
»Hey«, sage ich. »Wach auf.«
»Tut mir leid.« Er blickt mich wieder an. »Es ist nur …«
»Faszinierend, ich weiß. Du siehst immer aus wie ein Zombie, wenn dich etwas fasziniert.«
Er lacht.
»Könnten wir vielleicht über etwas anderes reden?«, frage ich. »Selbst wenn gerade keine Ken oder Ferox-Verräter in der Nähe sind – es fühlt sich trotzdem komisch an, so in aller Öffentlichkeit darüber zu sprechen.«
»Schon gut.«
Bevor er fortfahren kann, geht die Tür auf und eine Gruppe Altruan betritt den Raum. Genau wie ich tragen sie Kleidung der Amite und genau wie bei mir ist trotzdem deutlich zu sehen, welcher Fraktion sie wirklich angehören. Sie wirken still, aber nicht ernst – sie lächeln die Amite im Vorbeigehen an und nicken ihnen zu, manche bleiben kurz stehen und tauschen Höflichkeiten aus.
Susan setzt sich mit einem scheuen Lächeln neben Caleb. Sie hat ihr blondes Haar wie üblich zu einem Knoten zurückgebunden, aber es glänzt dennoch wie Gold. Sie sitzt ein wenig dichter bei Caleb, als es Freunde normalerweise tun würden, aber sie berühren sich nicht. Sie grüßt mich mit einem Kopfnicken.
»Entschuldigung«, sagte sie. »Störe ich?«
»Nein«, sagt Caleb. »Wie geht es dir?«
»Mir geht es gut. Und dir?«
Ich will die Cafeteria fluchtartig verlassen, um mich nicht an einer ausgesucht höflichen Altruan-Unterhaltung beteiligen zu müssen, aber dann kommt Tobias herein. Er wirkt gehetzt. Wahrscheinlich kommt er direkt aus der Küche, wo er heute Morgen gearbeitet hat, so wie es die Amite verlangt haben. Morgen bin ich damit dran, in der Wäscherei zu arbeiten.
»Was ist los?«, frage ich ihn, als er sich neben mich setzt.
»Bei ihrer Begeisterung für die Schlichtung der Streitereien haben die Amite anscheinend vergessen, dass es erst recht zu Konflikten führt, wenn man sich in die Angelegenheiten anderer Leute mischt«, sagt Tobias. »Wenn wir hier noch länger bleiben, dann flippe ich noch aus, und das wird dann nicht lustig.«
Caleb und Susan blicken ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ein paar von den Amite am Nebentisch unterbrechen ihre Unterhaltungen und starren zu uns herüber.
»Ihr habt schon richtig gehört«, sagt Tobias zu ihnen. Sie blicken alle schnell weg.
»Tja, also«, sage ich und verstecke mein breites Grinsen hinter meiner Hand, »was ist denn passiert?«
»Erzähl ich dir später.«
Es muss etwas mit Marcus zu tun haben. Tobias hasst die schiefen Blicke, die ihm die Altruan zuwerfen, wenn er von Marcus’ Grausamkeit spricht, und Susan sitzt ihm direkt gegenüber. Ich verschränke meine Finger im Schoß.
Die Altruan sitzen an unserem Tisch, aber nicht direkt neben uns; sie lassen respektvoll zwei Stühle zwischen ihnen und uns frei, doch die meisten von ihnen nicken uns zu. Sie waren die Freunde, Nachbarn und Kollegen meiner Familie, und früher hätte ich mich in ihrer Gegenwart still und zurückhaltend gezeigt. Aber jetzt erweckt gerade das den Wunsch in mir, lauter zu sprechen, mein altes Selbst und den Schmerz, der damit verbunden ist, so weit wie möglich hinter mir zu lassen.
Tobias verstummt abrupt, als mir jemand eine Hand auf die rechte Schulter legt. Ein stechender Schmerz durchzuckt meinen Arm. Ich beiße die Zähne zusammen, um nicht laut aufzustöhnen.
»Sie wurde da angeschossen«, sagt Tobias, ohne den Mann, der hinter mir steht, anzusehen.
»Entschuldigung.« Marcus nimmt die Hand von meiner Schulter und setzt sich auf den Stuhl links von mir. »Hallo.«
»Was willst du denn hier?«, frage ich.
»Beatrice«, wirft Susan vorsichtig ein, »es gibt keinen Grund, so –«
»Susan, bitte«, sagt Caleb leise. Ihre Lippen verziehen sich zu einem dünnen Strich und sie blickt weg.
Ich sehe Marcus finster an. »Ich habe dir eine Frage gestellt.«
»Ich möchte etwas mit dir besprechen«, antwortet Marcus. Sein Gesichtsausdruck ist gelassen, aber er ist wütend – sein schroffer Tonfall verrät ihn. »Ich habe mit den anderen Altruan gesprochen, und wir haben beschlossen, nicht hierzubleiben. Da sich weitere Konflikte in unserer Stadt wohl kaum vermeiden lassen, halten wir es für eigennützig, hierzubleiben, während diejenigen, die von unserer Fraktion noch übrig sind, hinter dem Zaun ausharren müssen. Wir bitten euch, uns zu begleiten.«
Damit habe ich nicht gerechnet. Weshalb will Marcus in die Stadt zurückkehren? Ist es wirklich nur eine typische Entscheidung der Altruan oder hat er in der Stadt etwas vor – etwas, das mit den Daten zu tun hat, die die Altruan besitzen?
Ich blicke ihn ein paar Sekunden lang unverwandt an, dann schaue ich zu Tobias. Er hat sich ein wenig entspannt, hält den Blick aber immer noch gesenkt. Ich weiß nicht, weshalb er sich so benimmt, wenn sein Vater in der Nähe ist. Niemand sonst, nicht einmal Jeanine, bringt Tobias dazu, sich zu ducken.
»Was meinst du?«, frage ich ihn.
»Ich denke, wir sollten übermorgen gehen«, erwidert Tobias.
»Okay. Danke«, sagt Marcus. Er steht auf und setzt sich zu den anderen Altruan ans Ende des Tisches. Ich rutsche näher an Tobias; ich bin mir nicht sicher, wie ich ihn trösten kann, ohne alles noch schlimmer zu machen. Mit der linken Hand greife ich nach meinem Apfel, mit der rechten fasse ich unter dem Tisch nach seiner Hand.
Aber ich kann den Blick nicht von Marcus wenden. Ich möchte mehr über die Dinge erfahren, über die er mit Johanna gesprochen hat. Manchmal muss man hartnäckig sein, um die Wahrheit herauszufinden.
5. Kapitel
Nach dem Frühstück sage ich Tobias, dass ich einen Spaziergang mache, aber dann folge ich Marcus. Ich bin davon ausgegangen, dass er zu den Gästezimmern gehen würde, aber er überquert das Feld hinter dem Speisesaal und betritt das Gebäude, in dem das Wasser gereinigt wird. Auf der untersten Stufe bleibe ich stehen. Will ich das wirklich tun?
Ich steige die Treppe hinauf und öffne die Tür, die Marcus gerade erst hinter sich geschlossen hat.
Das Filterhaus ist klein, eigentlich nur ein einziger Raum, in dem ein paar riesige Maschinen stehen. Soweit ich weiß, nehmen einige dieser Maschinen das Schmutzwasser aus dem Hauptquartier auf, andere reinigen es oder überprüfen die Wasserqualität und wieder andere pumpen das saubere Wasser in die Gebäude zurück. Die Rohre sind alle unterirdisch verlegt bis auf eines, das über dem Boden verläuft und Wasser für das Kraftwerk in der Nähe des Zauns liefert. Das Kraftwerk versorgt die ganze Stadt mit Strom, den es sowohl aus Wind-, Wasser- als auch Sonnenenergie erzeugt.
Marcus steht neben den Filtermaschinen. Die Rohre sind durchsichtig. Braun verfärbtes Wasser strömt durch sie hindurch und verschwindet in der Maschine. Wir sehen beide zu, wie es gereinigt wird, und ich frage mich, ob er das Gleiche denkt wie ich, dass es schön wäre, wenn es bei den Menschen auch so leicht ginge und man den Schmutz aus unserem Leben wegwaschen und uns wieder sauber in die Welt hinausschicken könnte. Aber es gibt Schmutz, der für immer an einem haften bleibt.
Ich richte den Blick auf Marcus’ Hinterkopf. Ich muss es tun.
Jetzt.
»Ich habe dich neulich gehört«, platze ich heraus.
Marcus fährt herum. »Was machst du hier, Beatrice?«
»Ich bin dir gefolgt«, sage ich und verschränke die Arme vor der Brust. »Ich habe gehört, wie du mit Johanna über die Gründe von Jeanines Angriff auf die Altruan geredet hast.«
»Haben die Ferox dir beigebracht, dass man seine Nase in die Privatangelegenheiten anderer Menschen stecken darf, oder hast du das selbst gelernt?«
»Ich bin von Natur aus neugierig. Lenk nicht vom Thema ab.«
Marcus legt die Stirn in Falten, zwischen den Augenbrauen bilden sich tiefe Furchen und auch um den Mund. Es sieht aus, als hätte er sein ganzes Leben lang immer nur die Stirn gerunzelt.