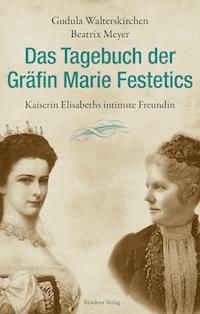Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Zwischenkriegszeit ist in Österreich auch heute noch eine ideologische Kampfzone. Berichte über den "Schattendorf-Prozess" und den folgenden Brand des Justizpalastes 1927 sind oft fehlerhaft, wichtige Fakten werden ausgelassen und Ereignisse einseitig dargestellt. Ähnliches gilt für die Februarkämpfe 1934, in denen die Gewalt zwischen den verfeindeten Lagern eskalierte. Die Historikerin Gudula Walterskirchen präsentiert die unterschiedlichen Sichtweisen, Widersprüche, Lücken bzw. Unrichtigkeiten, analysiert die Quellen und fördert auch völlig Neues zutage. Brisant ist auch die Zeit des Dollfuß- und Schuschnigg-Regimes. "Ständestaat" wie Sozialdemokratie zielten auf den falschen Feind. Statt gemeinsam gegen den Terror des Nationalsozialismus zu kämpfen, bekämpften sie einander, mit fatalen Folgen: Die politisch geschwächte österreichische Politik hatte Hitlers Einmarsch nichts entgegenzusetzen. Die blinden Flecken der Geschichte prägen den Diskurs bis heute: Es gibt keine gemeinsame Gedenkkultur zu den damaligen Ereignissen, Gedenkveranstaltungen sind immer auch politisch eingefärbt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gudula Walterskirchen • Die blinden Flecken der Geschichte
GUDULA WALTERSKIRCHEN
Die blinden Flecken der Geschichte
ÖSTERREICH 1927–1938
www.kremayr-scheriau.at
eISBN 978-3-218-01076-4Copyright © 2017 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, WienAlle Rechte vorbehaltenSchutzumschlaggestaltung: Sophie Gudenus, WienCoverfoto © Bildarchiv ÖNB (OEGZ-H-359-3, Albert Hilscher): Das Bundesheer in Kindberg (Steiermark) während des Pfrimer-Putsches 1931.Typografische Gestaltung und Satz: Sophie Gudenus, Wien
INHALT
VORWORT
ZEITTAFEL
1. BLUTIGER AUFTAKT: SCHATTENDORF UND DAS GEMETZEL VOM JULI 1927
2. DER FEBRUAR 1934: ARBEITERAUFSTAND, BÜRGERKRIEG ODER PUTSCHVERSUCH
3. „STÄNDESTAAT“ ODER „AUSTROFASCHISMUS“?
4. DER „ANSCHLUSS“: WAR ÖSTERREICH OPFER ODER TÄTER?
5. GEDENKKULTUR UND DIE INSTRUMENTALISIERUNG DER GESCHICHTE
DANK
ANMERKUNGEN
Wenn die Gegenwart über die Vergangenheitzu Gericht sitzen will, wird die Zukunft verlieren.
WINSTON CHURCHILL
VORWORT
Seinen „blinden Fleck“ zu entdecken, ist medizinisch betrachtet eine recht einfache Übung: Man schließt das linke Auge, blickt in eine bestimmte Richtung, und plötzlich verschwindet ein Bereich aus dem Sichtfeld. Mit dem rechten Auge funktioniert das genauso. Es gibt diese „blinden Flecken“ im übertragenen Sinn aber auch bei der Wahrnehmung seiner Umgebung, der aktuellen oder der historischen Ereignisse. Ein Auge wird geschlossen, wegen einer bestimmten persönlichen Einstellung, einer Ideologie, aus Ablehnung, Hass oder Ignoranz. Gleichgültig, aus welchem Grund man dies tut, einzelne Bereiche werden dabei nicht gesehen oder die Wahrnehmung wird beeinträchtigt. Diese „blinden Flecken“ in der heute noch umstrittensten Phase der österreichischen Zeitgeschichte, der Zwischenkriegszeit, habe ich eingehend untersucht.
Ein Buch über Österreich in den Jahren 1927 bis 1938 zu schreiben, ist ein heikles Unterfangen. Handelt es sich doch um eine Zeit, in der Österreicher aufeinander schossen, Diktaturen errichtet und politisch Andersdenkende verfolgt wurden. Es ist eine Zeit, über deren Persönlichkeiten und Ereignisse keine Einigkeit herrscht; eine Zeit, die eine ideologische Kampfzone ist; eine Zeit, die immer wieder Gegenstand heftiger Kontroversen in Politik, Gesellschaft, Medien und innerhalb der Historikerzunft ist. Es existieren unterschiedliche Geschichtsbilder über diese Zeit, die recht genau entlang der ideologischen Trennlinien verlaufen: Sozialdemokraten, Christlichsoziale und Deutschnationale. Begriffe wie „Schattendorf“, „Justizpalastbrand“, „Februarkämpfe“, „Ständestaat“, „Austrofaschismus“ oder „Anschluss“ rufen völlig unterschiedliche Bilder und Assoziationen auf. Doch so umstritten diese Ereignisse auch sind, die jeweiligen Bilder sind dennoch erstaunlich konstant. Es scheint, als ob man diese Bilder, die teilweise zu Mythen stilisiert wurden, nicht aufgeben will, selbst wenn mittlerweile Fakten vorliegen, die diese verändern oder gar zerstören.
Es herrscht heute in der Zeitgeschichte eine Tendenz vor, Geschichtsschreibung als eine Art Tribunal über die Protagonisten der Vergangenheit zu betrachten und diese mit heutigen (moralischen) Maßstäben und Erfahrungen zu be- oder gar zu verurteilen. Dadurch setzen sich jene, die sich dieser Art von Geschichtswissenschaft nicht unterwerfen, sondern Personen und Ereignisse rein aus dem historischen Kontext heraus und bewusst nicht wertend beschreiben, der Gefahr aus, selbst zu Objekten des Tribunals zu werden. Trotzdem, ja umso mehr ist es notwendig, heikle Punkte in unserer Geschichte ambivalent darzustellen, Widersprüche zuzulassen oder diese herauszuarbeiten. Denn wie bei jedem Menschen gibt es in der Geschichte und deren handelnden Persönlichkeiten nicht nur Gutes oder Böses, sondern fast immer ein Sowohl-als-Auch.
Ich habe mich darauf konzentriert, Fragen neu zu stellen, vermeintlich Bekanntes zu hinterfragen, Zahlen, Fakten und Quellen zu analysieren, Thesen und Gegenthesen zu studieren, all dies zu überprüfen, um erst dann zu einer Schlussfolgerung zu gelangen. Im Anschluss daran habe ich mich bemüht, die unterschiedlichen Sichtweisen herauszuarbeiten und einander gegenüberzustellen, damit der Leser sich selbst sein Bild machen kann. So wird auch deutlich, dass jede Seite ihre eigene „Wahrheit“ hat.
Die bisher vorherrschenden divergierenden Geschichtsbilder könnten bald ihre reale Abbildung erfahren: 2017 und 2019 werden in Österreich voraussichtlich zwei „Häuser der Geschichte“ eröffnet. Keines der „Lager“ wird es dem anderen überlassen, allein das Geschichtsbild zu prägen. Im Zuge des deutschen Historikerstreits meinte der konservative Historiker Michael Stürmer, „dass in geschichtslosem Land die Zukunft gewinnt, wer die Erinnerung füllt, die Begriffe prägt und die Vergangenheit deutet“.1 Um diese Deutungshoheit scheint es dabei (auch) zu gehen. Ich habe bewusst die besonders umstrittenen Punkte der österreichischen Zeitgeschichte herausgegriffen, über die auch im Zuge der Diskussion um das „Haus der Geschichte“ keine Einigkeit erzielt werden konnte; Reizworte, die in Politik und Öffentlichkeit regelmäßig zu heftigen Kontroversen führen. Diese Themen spielen auch bei der Diskussion rund um das 100-Jahr-Jubiläum der Gründung der Republik und das „Haus der Geschichte“ in Wien eine zentrale Rolle und sind damit hoch aktuell.
Das vorliegende Buch, Ergebnis fünfzehnjähriger Forschungsarbeit, bietet über eine Analyse der unterschiedlichen Interpretationen von Ereignissen hinaus neue oder bisher unbeachtet gebliebene Fakten. In manchen Fällen, wie etwa beim Schattendorfer Prozess oder beim Februaraufstand, folgt daraus eine völlig andere Erzählung, als es bisher der Fall war. Dies wurde auch möglich, weil ich neues und bisher unveröffentlicht gebliebenes Material einarbeiten konnte. Bei manchen Problemstellungen war eine interdisziplinäre Vorgangsweise sinnvoll, etwa durch die Zusammenarbeit mit namhaften Juristen. Aufgrund der Fülle an Material war es nicht möglich, alle relevante Literatur zu berücksichtigen und aufzulisten. Da der Umfang des Textes stark begrenzt ist, war eine Auswahl notwendig. Ziel war es nicht, eine lückenlose Geschichte dieser Jahre zu erzählen, sondern den Scheinwerfer auf einzelne, entscheidende Ereignisse zu richten und bei diesen mehr in die Tiefe zu gehen. Wichtig dabei war mir, möglichst viele Originalzitate und Quellen zu präsentieren, um ein ungefiltertes, möglichst authentisches Bild jener dramatischen Zeit zu zeichnen. Dies bildet die Grundlage des Aufspürens und Reflektierens von „blinden Flecken“, Verfälschungen, Auslassungen und Manipulationen in der Darstellung sowie Missbräuchen jener historischen Ereignisse.
Ernst Hanisch, ein Doyen der österreichischen Geschichtsforschung, meint: „Bei aller Entschiedenheit der Analyse, bei allem Bemühen um klare Urteile: Der Historiker muss sich der Widersprüchlichkeit und der Ambivalenz der historischen Realität stets bewusst sein.“2 Darum habe ich mich bei dem gewählten Thema bemüht. Ich verstehe dieses Buch auch nicht als die abschließende, allerletzte Wahrheit, sondern als Diskussionsgrundlage, die sich neue Einsichten, aber auch Widersprüche erhofft.
Gudula Walterskirchen, Jänner 2017
ZEITTAFEL
11/1918
Waffenstillstand zwischen Österreich-Ungarn und den Alliierten. Verzichtserklärung Kaiser Karls, Gang ins Exil und Ausrufung der „Republik Deutschösterreich“. Karl Renner wird Staatskanzler.
1919
Friedensvertrag von St. Germain zwischen Alliierten und Österreich; kommunistische Räteregierungen in Ungarn und Bayern; Gründung der DAP, der Vorläuferin der NSDAP.
1920
Neue Verfassung in Österreich von Hans Kelsen. Eine Volksabstimmung in Kärnten entscheidet für Österreich.
1921
Johann Schober bildet eine Regierung aus Christlichsozialen (CS) und Großdeutschen. Putsch ungarischer Freischärler im Burgenland, Ödenburg (Sopron) fällt durch eine manipulierte Abstimmung an Ungarn. Adolf Hitler wird Vorsitzender der NSDAP.
1922
Neue Regierung unter Ignaz Seipel (CS). Im Genfer Abkommen wird die Unabhängigkeit Österreichs garantiert und eine Finanzhilfe des Völkerbunds gewährt.
1923
Putschversuch Hitlers in München. Gründung von Heimwehren und Republikanischem Schutzbund.
1924
Rücktritt Seipels (schwere Verletzung wegen eines Attentats), neue Regierung unter Rudolf Ramek (CS).
1925
Die Schilling-Währung wird eingeführt und beendet die Hyperinflation.
1926
Seipel wird neuerlich Bundeskanzler (im Amt bis 1929).
1927
Zusammenstoß von paramilitärischen Einheiten in Schattendorf. Nach dem Freispruch der Täter im Prozess kommt es zu Ausschreitungen mit 94 Toten, der Justizpalast brennt.
1931
Wirtschaftskrise, Versuche einer Sanierung. Putschversuch der rechtsradikalen steirischen Heimwehr (Pfrimer-Putsch).
1932
Engelbert Dollfuß wird Bundeskanzler. Unterzeichnung der Lausanner Anleihe. Verzicht auf einen „Anschluss“. Die Landtagswahlen in drei Bundesländern ergeben starke Zuwächse für die NSDAP.
1933
Hitler wird Reichskanzler in Deutschland. Terrorwelle der Nationalsozialisten in Österreich; Verbot der NSDAP und des Schutzbundes. Staatsstreich durch Engelbert Dollfuß, Ausschaltung des österreichischen Parlaments und autoritäre Regierung.
1934
Neue Terrorwelle der NS. Der Aufstand des sozialdemokratischen Schutzbundes im Februar scheitert. Dollfuß verbietet alle Parteien außer der „Vaterländischen Front“. Er erlässt eine ständisch-autoritäre Verfassung („Ständestaat“). Im Juli Putschversuch durch die Nationalsozialisten, den Hitler befohlen hatte, Dollfuß wird dabei getötet. Neuer Bundeskanzler wird Kurt von Schuschnigg.
1936
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, die Heimwehr wird aufgelöst. Österreich schließt ein Abkommen mit Deutschland.
1938
Abkommen von Berchtesgaden zwischen Hitler und Schuschnigg. Letzterer setzt für den 13. März eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Österreichs fest. Hitler kommt dieser mit einem Einmarsch am 12. März zuvor. Österreich wird Teil des Deutschen Reiches.
1. BLUTIGER AUFTAKT: SCHATTENDORF UND DAS GEMETZEL VOM JULI 1927
ZUR VORGESCHICHTE DER EREIGNISSE VON SCHATTENDORF
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, dem Zusammenbruch der Monarchie und dem Zerfall des einst riesigen Habsburgerreiches blieb das heutige Österreich als „Rest“ zurück. Bitter arm und von instabilen, teils neuen Staaten umringt. Die kommunistischen Putsche 1919 in Bayern und Ungarn, der kommunistische Putschversuch in Wien, zuvor die blutigen Revolutionen in Russland 1917 und 1918 – all dies jagte dem Bürgertum einen gewaltigen Schrecken ein und bildete in Österreich eine reale Grundlage für den starken Antikommunismus. Bald folgten Bedrohungen anderer extremer politischer Strömungen, etwa durch den gescheiterten Putsch der Nationalsozialisten in München 1923. Die Machtübernahme durch das rechtsgerichtete Horthy-Regime in Ungarn und die jahrelangen Grenzstreitigkeiten im Burgenland destabilisierten Österreich zusätzlich und verunsicherten die Bevölkerung. Dazu kam die schlimme Wirtschaftskrise mit hohen Arbeitslosenraten und Hyperinflation, durch die immer breitere Bevölkerungsschichten verelendeten. Die Überwindung der Wirtschaftskrise bedeutete somit die größte Herausforderung für die jeweilige Regierung. Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel, der an der Spitze der – mit kurzen Unterbrechungen – seit 1920 an der Macht befindlichen Christlichsozialen Partei stand, schien dies zu jenem Zeitpunkt, 1926/27, bereits gelungen zu sein: Er erreichte eine Völkerbundanleihe und führte die Schillingwährung ein, wodurch die Hyperinflation beendet wurde. Doch die innenpolitische Stimmung verschärfte sich nach einer Zeit relativer Ruhe wieder. Den Auftakt machte der Parteitag der Sozialdemokraten im November 1926 mit dem Beschluss des „Linzer Programms“, in dem kämpferisch von der „Diktatur des Proletariats“ die Rede war. Wenn es sich auch um bloße Parteirhetorik handelte, das Bürgertum hatte sofort das Bild der blutigen Russischen Revolution vor Augen und geriet in Angst.
Die zunehmende Präsenz der paramilitärischen Verbände führte zu einer immer gewalttätigeren innenpolitischen Auseinandersetzung. Seit dem Kriegsende hatten sich in Österreich verschiedene Frontkämpfervereinigungen gebildet, die mit Waffen aus dem Ersten Weltkrieg ausgerüstet waren. Die 1920 gegründeten Frontkämpfer waren strikt antikommunistisch und antisemitisch ausgerichtet und wollten sich nicht mit der Republik abfinden. Als ehemaligen Soldaten hing ihnen auch noch das Trauma des verlorenen Kriegs nach. Es gab daher auch umstürzlerische und monarchistische Tendenzen und Kontakte mit derartigen Gruppierungen, die in der leidenschaftlichen Gegnerschaft zu den Austromarxisten geeint waren.
Als besonders brisant gestaltete sich die Lage im Burgenland: Das frühere Westungarn wurde zwar 1918 Österreich zugesprochen, wurde aber von Ungarn nicht freigegeben und konnte erst nach Kämpfen der Gendarmerie 1921 endgültig erobert werden. So erlebte die Bevölkerung die kommunistische Räteregierung in Ungarn, was lange Zeit nachwirken sollte und das Misstrauen und die Radikalisierung auf beiden Seiten verstärkte. Die Sozialdemokraten verdächtigten die Frontkämpfer, das Burgenland wieder Ungarn zuschlagen zu wollen, und die Frontkämpfer fürchteten, dass die Linke in Österreich eine kommunistische Diktatur errichten würde. Beides war nicht ganz unbegründet. Die Ungarn betrieben aktive Wühlarbeit im Burgenland und manipulierten die Volksabstimmung, wodurch Ödenburg (heute Sopron) Ungarn zugeschlagen wurde. Die Kommunisten hatten tatsächlich immer wieder Putschversuche unternommen, angefangen bei der Gründung der Republik, als es vor dem Parlament sogar zu Schießereien und Toten gekommen war. Und der Schutzbund hegte im Geheimen ebenfalls Pläne für einen Umsturz.
Der sozialdemokratische Schutzbund wurde im Jahr 1923 gegründet, jedoch gab es auch zuvor schon Kampfformationen auf Seiten der Arbeiterschaft. Der Schutzbund stieg unter der Leitung von Julius Deutsch zu einer straff geführten, schlagkräftigen Truppe auf. Mitte der zwanziger Jahre zählte er mehr als 80.000 aktive Mitglieder und war zahlenmäßig weitaus stärker und besser mit Waffen ausgerüstet als das Bundesheer. Auf der „Gegenseite“ wurden zeitgleich die ebenfalls paramilitärisch organisierten Heimwehren gegründet, die allerdings in den Anfangsjahren mäßigen Erfolg hatten und intern zerstritten waren. Sie litten unter Finanznöten und verloren, als die akute Gefahr eines kommunistischen Putsches gebannt war, viele Mitglieder. Erst durch das radikale „Linzer Programm“ 1926 erlebten die Heimwehren plötzlich einen Aufschwung und regen Zulauf.
DIE VERHÄNGNISVOLLEN EREIGNISSE AM 30. JÄNNER 1927
Zusammenstöße zwischen den bewaffneten Einheiten der politischen Hauptgegner – Schutzbund und Frontkämpfervereinigung – waren in jener Zeit an der Tagesordnung. Meistens handelte es sich nur um Raufereien oder gegenseitige Provokationen. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis die Lage eskalieren würde. Am 30. Jänner 1927 war es in dem kleinen Ort Schattendorf an der burgenländisch-ungarischen Grenze so weit. Anhand der umfangreichen Prozessakten1 lassen sich die Ereignisse recht exakt rekonstruieren:
Für den 30. Jänner 1927, es war ein Sonntag, hatten die örtlichen Frontkämpfer eine Versammlung bei der Behörde angemeldet. Versammlungsort war das Gasthaus Tscharmann, dessen Wirt ein aktiver Frontkämpfer war. Dazu hatte man Prominenz aus Wien eingeladen, unter ihnen den bekannten Führer der Frontkämpferorganisation, Oberst Hermann Hiltl. Als nun der örtliche Schutzbund davon Wind bekam, beschloss man, ebenfalls eine Kundgebung abzuhalten. Diese wurde jedoch nicht bei der Behörde angemeldet, sondern spontan anberaumt.2 Vor allem die „Gäste aus Wien“ waren den Sozialdemokraten ein Dorn im Auge, sie fühlten sich provoziert. Man forderte aus den umliegenden Ortschaften Unterstützung an. Ein Aufmarsch oder eine aktive Verhinderung der Gegenversammlung war vom Schattendorfer Schutzbund aber nicht geplant. Dies teilte zumindest der Bürgermeister von Schattendorf, Johann Grafl, gleichzeitig Obmann des örtlichen Schutzbundes, Sonntagmittag dem sich erkundigenden Gendarmen mit. Inzwischen war die Verstärkung in Form des Schutzbund-Bezirkskommandanten Thomas Preschitz mit seinen Leuten eingetroffen, Schattendorfer Schutzbündler schlossen sich an, und gemeinsam marschierten alle zum Gasthaus Tscharmann. Dort kam es zu Wortgefechten, aber keinen Handgreiflichkeiten. Preschitz ordnete an, man solle die Tür absperren, worauf der Gastwirt in Panik geriet und seinem Sohn befahl, die Gendarmerie zu rufen. Dieser flüchtete in den Wohntrakt des Hauses, wo er aus seinem Jagdgewehr zwei Schüsse in die Luft abgab, um die Gendarmerie zu alarmieren. Der Gendarm eilte ins Gasthaus Tscharmann, wo die Schutzbündler ihm mitteilten, es sei auf sie geschossen worden. Der erste Fehlschluss, dem noch etliche folgen sollten.
Ohne seine Einvernahme abzuwarten, marschierte Preschitz mit den Schutzbündlern ab, Richtung Bahnhof. Dort wollte man die Frontkämpfer aus Wien abfangen. Auf dem Weg dorthin trafen sie auf Frontkämpfer aus Loipersbach, die ebenfalls zum Bahnhof marschierten, um die Kollegen zu empfangen. Es kam zu einer Schlägerei, bei der einige Frontkämpfer verletzt wurden und diese flohen. Sie trafen auf zwei Gendarmen, denen sie berichteten, sie seien von den Schutzbündlern mit Leibriemen geschlagen und es seien sogar Schüsse auf sie abgegeben worden. Ob tatsächlich ein Frontkämpfer durch einen Schuss verletzt wurde, konnte später nicht zweifelsfrei geklärt werden.
Inzwischen, es war 14 Uhr 30, fuhr am Bahnhof der Personenzug mit den zur Kundgebung eingeladenen Frontkämpfern aus Wien und diversen burgenländischen Ortschaften ein, insgesamt dreizehn Mann. Hiltl war nicht unter ihnen. Sie wurden von mehr als hundert Schutzbündlern erwartet, die sie anhielten und aufforderten, gleich wieder in den Zug zu steigen und heimzufahren. Sie weigerten sich, woraufhin sie verprügelt und verletzt wurden. Einige Frontkämpfer konnten flüchten und trafen im Wartesaal des Bahnhofs auf die Gendarmen. Die Schutzbündler drängten nach, der Zugang wurde jedoch von der Gendarmerie versperrt. Die Gendarmen ordneten an, dass die Frontkämpfer nach Hause zurückkehren sollten und die Schutzbündler sich ebenfalls zu entfernen hätten. Letztere zogen zurück nach Schattendorf zu ihrem Vereinslokal, unter Absingen von Liedern und Schmährufen gegen die Frontkämpfer. Als der Zug am Gasthaus Tscharmann schon fast vorbeigezogen war, bogen einige Schutzbündler ab, um in der Gaststube die dort anwesenden, teils Karten spielenden Frontkämpfer zu provozieren. Ohne Ergebnis, sie zogen wieder ab.
Allerdings war inzwischen die Kunde von der Schlägerei am Bahnhof nach Schattendorf und ins Gasthaus Tscharmann gedrungen. Es hieß, es seien sogar Tote zu beklagen, zumindest ein Frontkämpfer erschlagen worden – ein verhängnisvolles Gerücht! Daraufhin gerieten einige Frontkämpfer in Panik und verschanzten sich im benachbarten Wohntrakt des Gasthauses, unter ihnen der Sohn des Gastwirts, Josef Tscharmann, sein Bruder Hieronymus und deren Schwager Johann Pinter. Diese hatten Gewehre und Munition mitgebracht und bereitgelegt, um auf einen eventuellen Angriff der Schutzbündler vorbereitet zu sein. Da die Tür zum Wohntrakt verschlossen und die Fenster vergittert waren, befanden sie sich nicht in unmittelbarer Gefahr. Sie hatten nicht mitbekommen, dass das Eindringen der Schutzbündler ohne Gewalt ablief und diese gleich wieder abzogen. Angeblich seien von den Schutzbündlern Schüsse abgegeben worden. Die verschanzten jungen Männer gingen von einem Angriff auf das Gasthaus aus – der nächste Fehlschluss. Sie gaben einige Schüsse auf die Gasse ab, und einige Menschen sanken zu Boden. Die Schützen überblickten jedoch die Situation nicht, da sie immer wieder Deckung suchten. Als klar war, dass sie jemanden getroffen hatten, gerieten sie in Panik und flohen. Sie befürchteten, dass es nun zu einer Eskalation kommen würde. Auch alle anderen Beteiligten flohen in Panik, die Schutzbündler in ihr Vereinslokal, das Gasthaus Moser.
Das schreckliche Resultat der blinden Schießerei: Zwei Tote, nämlich der mit den Schutzbündlern marschierende Matthias Csmarits, der wegen einer Kriegsverletzung ein Glasauge trug, sowie ein Schulkind, das aus Neugier vom Straßenrand aus zusah: Josef Grössing. Es gab weitere fünf Verletzte, unter ihnen ein Kind. Soweit der Ablauf der Ereignisse anhand der Polizeiberichte und Zeugenaussagen im Gerichtsakt.
DIE DARSTELLUNG DER EREIGNISSE IN DEN ZEITGENÖSSISCHEN MEDIEN UND IHRE MOTIVE
Unmittelbar nach den Vorfällen war der tatsächliche Ablauf noch nicht im Detail bekannt, dafür gab es umso mehr Gerüchte, die gern geglaubt und nicht überprüft wurden. Der Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschösterreichs wandte sich in einem offenen Brief mit wilden Gerüchten und kämpferischer Rhetorik an seine Anhänger: „Genossen und Genossinnen! Wieder sind Blutopfer der Arbeiterklasse gefallen. Die Mörderbanden der Frontkämpfer haben unseren Genossen, den Kriegsinvaliden Zmaritsch (sic), haben das einzige Kind unseres Eisenbahnergenossen Grössing meuchlerisch ermordet. Die burgenländischen Frontkämpfer sind die Spione Horthys im Burgenland. […] Die Republik wird keinen Tag sicher sein, solange die Regierung der Republik in den Händen der Feinde der Republik liegt! Das Leben des Arbeiters wird nicht sicher sein, solange uns die Protektoren hochverräterischer Mordbanditen regieren! Ihr müßt die Republik, ihr müßt euer Leben selbst schützen! Bauet den Republikanischen Schutzbund aus!“3
Wenige Tage später, am 4. Februar, fand eine reguläre Sitzung der Nationalversammlung statt. In dieser stellten der frühere sozialdemokratische Staatskanzler Karl Renner und Genossen eine Dringliche Anfrage an die Regierung, mit der Aufforderung, dass die Täter zur Verantwortung gezogen und die Frontkämpfervereinigung aufgelöst werden müssten. Bundeskanzler Seipel nahm daraufhin zum ersten Mal zu den Vorfällen Stellung: „Es ist Blut vergossen worden; in diesem Fall ganz bestimmt unschuldiges Blut. Ein Arbeiter und ein Kind sind ein Opfer von Leidenschaften – oder vielleicht ein Opfer der Angst, die ja auch eine Leidenschaft ist – geworden. Wir alle stehen erschüttert vor diesem Ereignis. Wir wünschen eine derartige Austragung von Kämpfen, welcher Art immer sie seien, in unserem Land nicht, […] daß in diesem Falle von den zuständigen Behörden und von den Gerichten alles geschehen wird, daß die Tat so gesühnt wird, wie sie es verdient, und die Regierung ist sich ihrer Pflicht vollkommen bewußt, darauf zu sehen, daß es so sei.“4
In seiner Replik auf die Rede des Bundeskanzlers gestand Renner diesem zu, mäßigend zu wirken, und auch er selbst beteuerte, dass die Arbeiterschaft keineswegs Bürgerkrieg oder Umsturz anstrebe, sondern sich vorbildlich zurückgehalten habe. Somit stand diese Rede Renners im Gegensatz zur kämpferischen Parole, die der Parteivorstand zuvor in der „Arbeiter-Zeitung“ ausgegeben hatte. Zeitungen bildeten in jener Zeit die wichtigste Nachrichtenquelle. Sie berichteten aber nicht nur, sondern bezogen Stellung, produzierten Stimmungen, beeinflussten die Geschehnisse wesentlich und machten somit Politik. Aus diesem Grund wird hier Zitaten aus den auflagenstärksten Medien breiter Raum gegeben. Von den Redakteuren der wichtigen Zeitungen wurden die Ereignisse völlig unterschiedlich dargestellt, je nach politischer Ausrichtung.
Die sozialdemokratische „Arbeiter-Zeitung“ schrieb am Montag, den 31. Jänner 1927: „Ein grauenhafter Mord wurde gestern im Burgenland verübt: Es war keine Sonntagsrauferei, kein Geplänkel, kein Zusammenstoß; nein, es war ein Mord, ein wirklicher Mord, nach allen Regeln der Mordtechnik vorbereitet. Die sozialdemokratische Partei hatte für gestern in Schattendorf eine Versammlung einberufen. […] Um die Ruhe der gestrigen Versammlung zu verbürgen, waren daher Schutzbündler als Versammlungsschutz aus der Umgebung herangezogen worden. Die Soldaten des Soldatenauspeitschers (Hiltl, Anm.) hatten nun offenbar beschlossen, unter allen Umständen die sozialdemokratische Versammlung zu sprengen. Sie versammelten sich, einige Häuser vom sozialdemokratischen Versammlungsort entfernt, im Gasthaus des Josef Tscharmann, eines bekannten Frontkämpfers. Noch bevor die Versammlung begonnen hatte, fielen aus dem Frontkämpfergasthaus einige Schüsse auf die vor dem sozialdemokratischen Versammlungslokal angesammelte Menge. Die Folge war eine Panik. Hoffmann (der Referent, Anm.) und der Bürgermeister Grafl bemühten sich, im Verein mit den Vertrauensmännern die Menge zu beruhigen und sie zu bewegen, sich in das sozialdemokratische Versammlungslokal zu begeben. Während der Versammlung hörte man plötzlich ein regelrechtes Gewehrfeuer aus dem Gasthaus Tscharmann: Die Frontkämpfer hatten eine Abteilung des Schutzbundes, die von auswärts zu der sozialdemokratischen Versammlung gekommen war, unter Gewehrfeuer genommen: einem Kriegsinvaliden wurde der Schädel zertrümmert, ein achtjähriges Kind erschossen, ein sechsjähriges Kind schwer verwundet, vier Schutzbündler leichter durch die Schüsse verwundet. Nachdem der feige Mord geschehen war, flüchteten die Mörder von hinten aus dem Wirtshaus. Dieser feige, infame Mord darf nicht ungesühnt bleiben.“
Dieser Bericht war sehr einseitig und entsprach großteils nicht den Tatsachen. Ebenfalls sehr polemisch berichtete die christlichsoziale „Reichspost“ über die Vorfälle: „Im Burgenlande ist gestern Blut geflossen. Den Versuch der sozialdemokratischen Schutzbündler, die Frontkämpfer an ihrer erfolgreichen Werbetätigkeit im Burgenlande zu hindern und eine Versammlung, die für gestern angesagt war, zu vereiteln, müssen zwei Menschen mit ihrem Leben und mehrere andere mit Verletzungen verschiedensten Grades bezahlen. Dieses traurige Ereignis […] wird von gewissenlosen Gerüchteerstattern und einer noch gewissenloseren Sensationspresse, die ihrer Parteiarmee willig jeden Lügendienst leistet, zu einem perfiden Anschlag auf die öffentliche Meinung, zu einer frechen Irreführung der Bevölkerung und zu einer aufreizenden Stimmungsmache für die Partei der roten Schutzbündler benützt […]. Nicht dreißig, sondern nur einige wenige Schüsse wurden abgegeben, stellt die amtliche Aussendung fest. Nicht vier, sondern zwei Menschenleben, darunter das eines unbeteiligten Schulknaben, sind zu beklagen. Der Hergang des Zwischenfalles, die Schuldfrage, ist noch gar nicht geklärt und muß erst aufgehellt werden, sagt die amtliche Aussendung, aber die Gewissenlosigkeit der montäglichen Sensationspresse, die für sich keine andere Entschuldigung hat, als daß sie sich von gewissenlosen Informationen bedienen ließ, trug keine Bedenken, die Frontkämpfer als Mordanstifter und Arbeitermörder zu schmähen.“5
Die liberale „Neue Freie Presse“ widmete am 31. Jänner 1927 ihre Titelseite dem Vorfall und versuchte, mäßigend zu wirken: „Das, was sich in dem kleinen Grenzorte Schattendorf abspielte, war kein Krieg im Frieden, sondern traurigster Wahnsinn und alle Politiker und Kreise, die es mit der Ruhe und Ordnung ernst nehmen, die sich ihrer Verantwortung bewußt sind, müssen nun alle Kräfte aufbieten, um die Wiederkehr ähnlicher Exzesse ein für allemal unmöglich zu machen. […] Um so eher kann man annehmen, daß die Sozialdemokraten dieses tiefbedauerliche Vorkommnis zu keiner Staatsaffäre aufbauschen werden, daß sie es unterlassen, Komplikationen zu schaffen, da doch die Pflicht, beruhigend zu wirken, unabweislich ist. Oesterreich befindet sich inmitten einer wirtschaftlichen Krise und die Arbeitslosigkeit wächst von Woche zu Woche. Da muß alles vermieden werden, was unmittelbar oder mittelbar dazu beizutragen vermöchte, das Vertrauen im Auslande zu gefährden und ein falsches Bild von den Zuständen in unserem Staate zu erwecken.“6
Und das liberale „Prager Tagblatt“ berichtete am 1. Februar 1927: „Die Berichte des Schutzbundes und der Frontkämpfervereinigung widersprechen einander. […] Im niederösterreichischen Landtag stimmte der christlichsoziale Landeshauptmann Doktor Buresch der sozialdemokratischen Forderung zu, daß die Frontkämpferorganisationen im Burgenland, die anders geartet seien als die im übrigen Österreich, aufgelöst werden und die Verantwortlichen für den letzten Zwischenfall streng bestraft werden müßten.“
DIE SCHICKSALSWAHL VON 1927
Zur bereits aufgeheizten Stimmung durch die zunehmende Radikalisierung von linken und rechten paramilitärischen Gruppierungen kam noch die Nervosität in den Parteien. So ist auch die Heftigkeit der Reaktionen zu verstehen. Die Vorfälle von Schattendorf fielen nämlich in eine politisch äußerst sensible und angespannte Zeit, in die Zeit des Wahlkampfes für die Nationalratswahl im April 1927. Diese war wegen der zunehmenden Spannungen im Parlament vorverlegt worden. Es ging dabei für die Sozialdemokraten um „alles oder nichts“. Bei den letzten Wahlen hatten die Christlichsozialen nur sechs Prozentpunkte vor der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschösterreichs (SDAP) gelegen, besaßen also nur eine hauchdünne Mehrheit und konnten nicht alleine regieren. Die Christlichsozialen bildeten eine Koalition mit der Großdeutschen Volkspartei und traten 1927 als Einheitsliste an („Heimatblock“). Die Sozialdemokraten rechneten sich aufgrund der allgemeinen Unzufriedenheit und Not in der Wirtschaftskrise gute Chancen auf einen Sieg aus. Sie wollten unbedingt die Vorherrschaft der Christlichsozialen brechen und den verhassten Bundeskanzler Ignaz Seipel endlich stürzen, der 1926 zum zweiten Mal Bundeskanzler geworden war. Seipel war katholischer Theologe, Priester und prononcierter Antimarxist. Er galt den Sozialdemokraten schon allein deshalb als Feindbild, aber auch, weil er sich zuvor massiv für die Aufrüstung rechter Verbände, allen voran der Frontkämpfervereinigung, eingesetzt hatte. Seipel war 1924 als Bundeskanzler zurückgetreten, nachdem ein Attentat auf ihn verübt worden war. Die Arbeiterschaft hatte ihn dafür verantwortlich gemacht, dass durch die Einführung der Schillingwährung 1925 die Reallöhne gesunken und die Arbeitslosigkeit stark gestiegen waren. Allerdings war es Seipel wie erwähnt auch gelungen, die Hyperinflation zu beenden und durch eine Völkerbundanleihe die Staatsfinanzen zu sanieren.
DAS „LINZER PROGRAMM“
Seipels neuerliche Übernahme des Bundeskanzleramtes im Oktober 1926 brachte die Sozialdemokraten gehörig in Wallung. Beim Linzer Parteitag 1926, der nur wenige Tage nach Seipels Amtsantritt und nur drei Monate vor den Ereignissen in Schattendorf stattfand, fiel die Wortwahl dementsprechend deftig aus. Der Parteiführer der Sozialdemokraten, Otto Bauer, verstieg sich dazu, mit der „Diktatur des Proletariats“ zu drohen und sprach ständig von „Kampf“. Dennoch war seine Rede eindeutig defensiv orientiert, indem er den Kampf um die Seele der Menschen betonte.7 Zu echter Gewalt könne es nur kommen, wenn die „Bourgeoise“ die Demokratie stürze und statt dessen eine faschistische Diktatur errichte. Dann werde dem Proletariat nichts anderes übrig bleiben, als zu Gewalt zu greifen und seinerseits eine Diktatur zu errichten. Otto Bauer zählte zu den Begründern des Austromarxismus und zum linken Flügel seiner Partei. Die Persönlichkeit Otto Bauer ist bis heute mit vielen Widersprüchen und Rätseln behaftet, der Historiker Ernst Hanisch hat sich in einer umfangreichen Biografie mit dieser Person auseinandergesetzt.8 Für ihn ist Bauer ein glänzender Intellektueller, faszinierend in seinen Gedankengebäuden, jedoch kein Mann der Tat. Hanisch beschreibt ihn als depressiven Charakter, vielleicht mit ein Grund, warum er als Politiker zwar flammende Reden hielt, im entscheidenden Moment aber stets vor dem Handeln zurückschreckte. Es sei eine „Politik des Einerseits/ Andererseits“ gewesen. Bauer machte seinen Anhängern Hoffnungen, die er nicht erfüllte oder erfüllen konnte.
Das auf diesem Parteitag beschlossene Programm hingegen war äußerst radikal formuliert und ließ – zumindest in der Theorie – an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Es war ebenfalls unter der Federführung Bauers entstanden, der darin widersprüchliche Signale aussandte. Gleich in der Einleitung heißt es: „Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschösterreichs, gestützt auf die Lehren des wissenschaftlichen Sozialismus und auf die Erfahrung jahrzehntelanger sieghafter Kämpfe, eng verbunden den sozialistischen Arbeiterparteien aller Nationen, führt den Befreiungskampf der Arbeiterklasse und setzt ihm als Ziel die Überwindung der kapitalistischen, den Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung.“ Unter dem Titel „Der Kampf um die Staatsmacht“ heißt es in dem Programm: „Die Geschichte der demokratischen Republik ist die Geschichte der Klassenkämpfe zwischen der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse um die Herrschaft in der Republik.“ Und weiter unten: „Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei erstrebt die Eroberung der Herrschaft in der demokratischen Republik, nicht um die Demokratie aufzuheben, sondern um sie in den Dienst der Arbeiterklasse zu stellen, den Staatsapparat den Bedürfnissen der Arbeiterklasse anzupassen und ihn als Machtmittel zu benützen, um dem Großkapital und dem Großgrundbesitz die in ihrem Eigentum konzentrierten Produktions- und Tauschmittel zu entreißen und sie in den Gemeinbesitz des ganzen Volkes zu überführen. […] Wenn es aber trotz allen diesen Anstrengungen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei einer Gegenrevolution der Bourgeoisie gelänge, die Demokratie zu sprengen, dann könnte die Arbeiterklasse die Staatsmacht nur noch im Bürgerkrieg erobern. […] Wenn sich aber die Bourgeoisie gegen die gesellschaftliche Umwälzung, die die Aufgabe der Staatsmacht der Arbeiterklasse sein wird, durch planmäßige Unterbindung des Wirtschaftslebens, durch gewaltsame Auflehnung, durch Verschwörung mit ausländischen gegenrevolutionären Mächten widersetzen sollte, dann wäre die Arbeiterklasse gezwungen, den Widerstand der Bourgeoisie mit den Mitteln der Diktatur zu brechen.“9
DAS GEGENPROGRAMM DER CHRISTLICHSOZIALEN
Diese marxistische Diktion, unter der Federführung Otto Bauers eingesetzt, musste als nichts anderes als eine Drohung mit Gewalt, Putsch und Enteignung aufgefasst werden. Dass dies – nur sieben Jahre nach der Ausrufung der kommunistischen Rätediktaturen in den Nachbarländern Bayern und Ungarn, und nur acht Jahre nach der blutigen Revolution in Russland – beim Bürgertum Entsetzen und Angst hervorrief, erscheint verständlich. Prompt erhielten die bis dahin eher schwächelnden paramilitärischen Heimwehren regen Zulauf, was zeigt, dass man auf bürgerlicher Seite die Drohungen sehr ernst nahm.
Interessant ist, dass die Reaktion der „Reichspost“ auf die Rede Bauers am Parteitag recht positiv ausfiel: „Es ist bemerkenswert, daß er sich in seiner langen Rede von dem überradikalen Standpunkt entfernte, der noch bis in die jüngste Zeit in der sozialdemokratischen Presse vertreten wurde. […] Als Mittel zur Eroberung der Staatsmacht lehnte der Redner die Anwendung von Gewalt ab. Er verwirft auch die Aufrichtung einer ‚einseitigen Arbeiter-Klassenherrschaft‘, zu der sich die ‚Arbeiter-Zeitung‘ noch vor wenigen Tagen so nachdrücklich bekannt hat. […] Er warnt vor den Straßenraufereien – der Schutzbund wird den Wink verstehen – und er warnt auch vor dem Spiel mit dem Bürgerkrieg.“ Heftig kritisiert wird in dem Artikel allerdings die kompromisslose Ablehnung der Religion durch Bauer und sein erklärter Kampf gegen die katholische Kirche, die der Artikelschreiber so zusammenfasst: „Einfacher ausgedrückt heißt das: ‚Wir bekämpfen die Kirche mit allen Mitteln, wir wollen sie enteignen und wir fördern die Freidenker in all ihren Frechheiten und Gemeinheiten.‘“ Die katholisch orientierte „Reichspost“ mit ihrem offenen Kurs des politischen Katholizismus fühlte sich herausgefordert und machte diesen Punkt des Parteiprogramms zu ihrem Hauptangriffspunkt.
Bereits am Tag nach der Eröffnung des Parteitages der Sozialdemokraten, am 31. Oktober, widmete sich Chefredakteur Friedrich Funder in der „Reichspost“ dem an diesem Tag begangenen Christkönigsfest und entwarf unter diesem Stichwort sein Gegenprogramm. Funder war einer der wichtigsten Berater Bundeskanzler Seipels. Das zu dieser Zeit noch recht junge Christkönigsfest bedeutete den Abschluss des Kirchenjahres, man gedachte an diesem Christi als Herrscher der Welt. Dies war im Zuge des politischen Katholizismus nicht nur in einem theologischen, sondern durchaus auch in einem politischen Sinne gedacht. Funder schrieb: „Der mächtige Gegner, der weiß was er will, hat uns nichts geschenkt. Was erhalten wurde – und es ist viel – war der Preis, der in diesem politischen Ringen mit geschliffenen Waffen ausgestochen wurde. Freilich, hinter dem Schützengraben gab es auch eine Etappe und mancher, der vorne gekämpft hatte, glaubte, zwischen den Gefechten sich dort vergnügen zu können, wie andere auch.“10
Bemerkenswert ist, dass Funder ebenso wie Bauer häufig Kriegsvokabular im Hinblick auf die politische Auseinandersetzung benützt und ausdrücklich die Unterstützung der paramilitärischen Verbände fordert. Besonders empörte sich Funder über die „opportunistische Haltung“ Bauers, der von dem Dogma, dass ein Proletarier kein Katholik sein könne, abrücke. Vielmehr gebe Bauer diese Haltung auf, um nicht jene Leute „kopfscheu“ zu machen, denen die Religion noch etwas bedeute.11
WAHLSIEG ODER WAHLNIEDERLAGE?
Der Parteitag sollte die Parteifunktionäre der Sozialdemokratie und die Arbeiterschaft mobilisieren, um für die alles entscheidende Wahlschlacht gerüstet zu sein. Man hoffte, bei den bevorstehenden Wahlen die Christlichsozialen endlich überholen, Seipel stürzen und die Macht im Staat übernehmen zu können. Interessant ist, dass Bauer seine Genossen vorsichtshalber noch darauf vorbereitete, vorübergehend eine Koalition mit dem Erzfeind eingehen zu müssen, selbstverständlich aber unter sozialdemokratischer Führung. Die Wahlen, die am 24. April 1927 abgehalten wurden, die dritten in der Ersten Republik, gingen jedoch ganz anders aus, als es sich die Sozialdemokraten erhofft hatten: Die Einheitsliste „Heimatblock“ unter Führung der Christlichsozialen gemeinsam mit dem Landbund erhielt 48,2 Prozent der Stimmen, also die Mehrheit gegenüber der SDAP, die auf nur 42 Prozent kam. Interessantes Detail: Die kandidierenden Kommunisten erhielten nur 0,4 Prozent der Stimmen und die neu antretenden Nationalsozialisten gar nur 0,02 Prozent, das waren 779 Stimmen im ganzen Land.
Bemerkenswert ist jedenfalls die fette Schlagzeile der „Arbeiter-Zeitung“ am Tag nach der Wahl: „Der glänzendste Sieg für die Sozialdemokratie“. Der Autor schrieb sich in eine übersteigerte Euphorie, wie bei einem Fußballmatch: „Sieg! Sieg! Sieg! Wir hängen keine Fahnen aus, entzünden keine Freudenfeuer, keiner Posaunenstöße bedarf es, denn was wäre alles Aeußerliche gegenüber dem unermeßlichen, dem herrlichen Glücksgefühl, das nun jeden Genossen unserer heiligen Sache erfüllt! Um uns zu besiegen, haben sie sich alle vereinigt; uns zu vernichten, sind sie ausgezogen; diese Wahlen, so wähnten sie, werden der Schlag sein, der die Sozialdemokratie ins Mark trifft. Aber das arbeitende Volk erhob sich in seiner gigantischen Kraft und der haßerfüllte Ansturm der Einheitsliste war hinweggefegt.“12 Diese verblüffende Auslegung des Wahlergebnisses ist so zu erklären, dass man den Fokus auf Wien legte, wo bei der zeitgleich stattfindenden Landtagswahl die Sozialdemokratie ihre Vormachtstellung behaupten konnte, sowie auf den Zugewinn von zwei Mandaten im Nationalrat. Doch der Jubel war verfrüht, bei Erscheinen der Ausgabe war die Auszählung der Stimmen noch nicht abgeschlossen. Tags darauf wandte sich die Parteileitung in einem offenen Brief an die Leser der „Arbeiter-Zeitung“, um die Divergenz zwischen dem verkündeten Wahlsieg und dem gleichzeitigen Rückstand gegenüber der Einheitsliste um sechs Prozentpunkte zu erklären: „Unsere Stimmenanzahl ist über alles Erwarten gestiegen. Obwohl sich infolge der Konzentration der bürgerlichen Stimmen auf eine Liste unser Stimmenzuwachs nicht vollständig in der Mandatszahl ausdrückt, haben wir unsere Mandatszahl auf Kosten der kapitalistisch-klerikalen Einheitsliste vermehrt.“ Besonderes Augenmerk wird in dem Bericht auf die Tatsache gelegt, dass der Abstand zwischen der Einheitsliste und den Sozialdemokraten auf nur noch fünf Mandate geschrumpft war. Damit sei die Einheitsliste nicht regierungsfähig, so die Schlussfolgerung: „Das bisherige christlichsozial-großdeutsche Regierungssystem ist gestürzt, Seipel hat zu gehen!“13 Somit sah man das eigentliche Wahlziel als erreicht an: den Sturz des verhassten Bundeskanzlers Seipel.