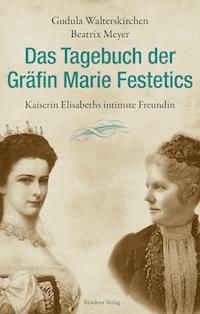Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
1918 war ein Jahr der Umwälzungen und Emotionen. Wie haben Zeitzeugen es erlebt? In authentischen Berichten kommen Adel, Bürgertum und Arbeiterklasse zu Wort. Sichtbar werden die höchst unterschiedlichen Bewertungen jenes Umbruchs, der für die einen den Untergang ihres Vaterlandes und ihren persönlichen Zusammenbruch, für die anderen einen hoffnungsvollen Neubeginn bedeutete: Trauer um Alt-Österreich und Monarchie, Hass auf Adel und Habsburger, Schock wegen des verlorenen Krieges, Verbitterung und Resignation, Freude über das Kriegsende, Hoffnung auf bessere Zeiten. Gudula Walterskirchen lässt anhand von bisher unveröffentlichten Briefen, Tagebüchern und Erinnerungen ein Jahr der großen Zäsur wieder lebendig werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gudula Walterskirchen
Mein Vaterlandzertrümmert
1918 – Kriegsende und Neuanfangin Briefen, Tagebüchernund Erinnerungen
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2018 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Boutiquebrutal.com
Bildnachweis: © Lukiyanova Natalia frenta / shutterstockTypografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Barbara Köszegi
ISBN ePub:
978 3 7017 4571 5
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 3420 7
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1: Schlachtfelder und Kriegsleid – Berichte aus dem Grauen
Bericht eines Generals
Kriegsalltag einfacher Soldaten
Frauen an der Front
Kapitel 2: Die Not an der Heimatfront
Kriegswaisen, Hunger und Heimweh – das Leid der Kinder
Eine Kindheit zwischen Klosterneuburg und Arad
Frauen an der »Heimatfront« und der Kampf gegen den Hunger
»Kriegsehen« als Belastungsprobe
Kapitel 3: Heimkehr in den Untergang
Chaos, Gefangenschaft und Heimkehr
Das schmähliche Ende der Seeflotte
Nieder mit dem Kaisertum!
Kapitel 4: Das Reich zerfällt
Wie die engsten Berater Kaiser Karls die letzten Monate der Monarchie erlebten …
Ein Reich zerbricht
Kapitel 5: Neubeginn – Trauer und Hoffnung
Umstürze, Putschversuche und die neue Republik
Das Los der Kriegsheimkehrer
Der Verlust der alten Welt
Hoffnung auf die neuen Zeiten
Das Elend der einfachen Leute
Nachwort
Danksagung
Die Zeitzeugen
Anmerkungen
Quellen und Literatur
Einleitung
Das Jahr 1918 bedeutete einen tiefen Einschnitt in der österreichischen Geschichte – es veränderte alles. Das wissen wir nicht nur aus der Rückschau, das war auch den Zeitgenossen wohl bewusst. Sie bezeichneten diese Zäsur als den »Zusammenbruch« oder den »Umsturz«, je nach ihrer persönlichen und politischen Einstellung. Besonders dramatisch erlebten die Kriegsteilnehmer und Heimkehrer dieses Jahr. In seinem Familien-Historien-Roman »Der Engel mit der Posaune« lässt der erst kürzlich wiederentdeckte österreichische Autor Ernst Lothar seinen Protagonisten Hans, stellvertretend für viele andere, seine Emotionen als Kriegsheimkehrer beschreiben: »Dass die Menschen zu Hause das Unmaß des Vergangenen nicht ermaßen, fiel ihm im ersten Augenblick auf, es brannte wie Schläge in sein Gesicht. Die Leute gingen herum, sie trachteten fortzusetzen. Aber hier ließ sich nichts fortsetzen! Wien war eine Reichshauptstadt, zu einer Reichshauptstadt gehörte ein Reich; das Reich gab’s nicht mehr. Österreich war die Idee, Nationalitäten zu einer übernationalen Nation zu vereinigen – Vereinigte Nationen, lange bevor es Vereinigte Staaten gab; diese Idee lag in Trümmern.«1
Dieses Bild der Heimat, die in Trümmern lag, findet sich bei etlichen Zeitzeugen, wie etwa bei Fürst Alois Schönburg-Hartenstein, General und in der Zwischenkriegszeit Heeresminister; oder auch bei Graf Botho Coreth, der sich als 16-Jähriger freiwillig meldete und innerlich zerstört heimkehrte. Zeitlebens verarbeitete er dieses Trauma nicht, den Verlust seiner Ideale und seiner Heimat, wie er sie zuvor gekannt und geliebt hatte.
Diese Trauer um die Niederlage und den Verlust der früheren Größe teilten allerdings nicht alle, viele hatten auch ambivalente Gefühle. Die Nationalisten freuten sich über das Ende des »Völkerkerkers«, allen voran die Tschechen. Aber auch unter den »Deutschen« zeigten sich etliche erleichtert über die Trennung. Fürst Schönburg-Hartenstein etwa merkt in seinem Tagebuch an, er sei trotz allem froh, dass er mit den Böhmen nicht mehr in einem Land zu leben brauche. Er äußerte diese Haltung, obwohl er dort Besitzungen und damit einen persönlichen Bezug hatte. Hier zeigt sich, wie stark die gegenseitige Abneigung der Angehörigen verschiedener Sprachgruppen gediehen war, trotz der langen gemeinsamen Geschichte.
Das Jahr 1918 bedeutete für diese Generation von Österreichern einen tiefen Einschnitt. Das geht aus den zahlreichen Briefen, Tagebucheinträgen und Berichten aus jenen Tagen hervor. Es war nicht nur der Krieg, der verloren war, die Menschenleben, die er gekostet, die vielen Krüppel, die er hervorgebracht hatte, die Not und das Elend, die Krankheiten und was sonst noch an Leid zu ertragen war. Es war darüber hinaus der Zusammenbruch einer Welt, der Verlust der Heimat, all dessen, was vertraut und gewohnt war und worauf man sich verlassen hatte.
Die Briefe und Tagebücher aus der Zeit, oft unter der unmittelbaren Wirkung der Ereignisse geschrieben, geben einen anschaulichen und emotional berührenden Eindruck von dem Zustand Österreichs, einem Land, von dem keiner wusste, ob und wie es weiterbestehen würde. Die Berichte sind lebendig, drastisch, authentisch und gut nachvollziehbar. Viele der in diesem Buch wiedergegebenen Texte sind noch nie veröffentlicht worden, sie ruhten bisher in privaten oder öffentlichen Archiven oder waren längst vergessen.
Interessant sind diese persönlichen Aufzeichnungen, die ursprünglich nicht für die Veröffentlichung bestimmt waren, in ihrer Wahrhaftigkeit und Absichtslosigkeit. Sie wollen nichts rechtfertigen und dienen keinem Zweck, schon gar keinem politischen. Sie wollen einfach beschreiben, was die Schreiberinnen und Schreiber beobachtet, was sie erlebt und was sie dabei empfunden haben. Diese Unmittelbarkeit macht den Wert und den Reiz dieser Texte aus, auch wenn sie stilistisch natürlich keinen literarischen Anspruch erheben.2
Aufschlussreich ist, dass die Berichte mitunter inhaltlich sehr einheitlich sind, in anderen Zusammenhängen aber auch stark differieren, je nach persönlicher und politischer Einstellung, Gesellschaftsschicht, Position, Nationalität oder Herkunft. So etwa kommentiert ein Metallarbeiter die Abdankung des letzten Kaisers und das Ende der Monarchie völlig anders als ein Mitglied des Hochadels. Aber auch innerhalb der Schichten unterscheiden sich die Sichtweisen. Ein Fürst konnte durchaus froh sein über das Ende der Monarchie und ein Handwerker unsagbar traurig darüber, dass es nun keinen Kaiser mehr gab. Es waren nicht alle »kleinen Leute« glücklich über die Ausrufung der Republik, nicht alle entsetzt über den verlorenen Krieg und die Niederlage, etliche froh über das Ende des alten Österreichs und den hoffentlich baldigen Anschluss an Deutschland.
Es herrschten in diesem für Österreich dramatischen, alles verändernden Jahr die unterschiedlichsten Ängste, Hoffnungen, Erwartungen und Vorstellungen, was aus einem selbst, der eigenen Familie und aus Österreich werden würde: ein Land, das seine Größe, seinen Stolz, sein Herrscherhaus, seine Identität und seine weltweite Bedeutung auf einen Schlag verloren hatte. Niemand hätte damals zu träumen gewagt, dass dieser »Rest«, dieser armselige Rumpf, im Jahr 1918 verarmt, gedemütigt und verzweifelt, hundert Jahre später noch existieren würde; dass Österreich zu einem der reichsten Länder der Welt aufsteigen und wieder eingebettet sein würde in einen – freiwilligen – Verbund verschiedener Staaten und Nationalitäten. Doch, zumindest einen gab es: Schließlich war es die Vision Graf Richard Coudenhove-Kalergis, eines glühenden Österreichers und Monarchisten, die mit der Europäischen Union Wirklichkeit wurde.
Kapitel 1
Schlachtfelder und Kriegsleid – Berichte aus dem Grauen
Der Erste Weltkrieg war der bis dahin umfassendste Krieg der Menschheitsgeschichte. Er begann als regionaler Konflikt zwischen zwei Ländern und entwickelte sich innerhalb von Tagen zu einem globalen Krieg, an dem insgesamt 40 Staaten beteiligt waren. Insgesamt kämpften fast 70 Millionen Soldaten, bis zu seinem Ende im November 1918 verloren 17 Millionen Menschen ihr Leben. Er begann bekanntermaßen 1914 mit der sogenannten »Julikrise«: In Bosnien-Herzegowina wurde der Thronfolger Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand, ermordet und Österreich stellte ein Ultimatum an Serbien, das man für die Tat verantwortlich machte. Man vertraute mit der Unterstützung des deutschen Kaiserreiches, weitere Verbündete waren das Osmanische Reich und Bulgarien. Serbien weigerte sich, der Forderung nachzukommen, und wurde unterstützt von Russland. Dieses wiederum konnte mit der Unterstützung Frankreichs rechnen, und so befand sich durch die Kriegserklärung Österreich-Ungarns innerhalb kürzester Zeit die halbe Welt im Kriegszustand. Durch den Vormarsch der Deutschen nach Belgien und Frankreich trat auch noch Großbritannien in den Krieg ein, dieser breitete sich sogar auf die Kolonien aus. Im Jahr 1915 erklärte dann noch Italien – in Erwartung von Gebietsgewinnen – Österreich den Krieg. Diesen Wechsel nahm Österreich-Ungarn dem ehemaligen Verbündeten besonders übel.
Der Kriegsverlauf war gekennzeichnet von verhärteten Fronten, Stellungskriegen, grauenvoller Materialschlacht bis hin zum Einsatz von Giftgas und schrecklichen Verlusten an Menschenleben. Als Synonyme des Grauens gelten bis heute die Schlacht von Verdun und die Isonzo-Schlachten.
Im Herbst und Winter 1917/18 standen die Dinge nach dreieinhalb Jahren Krieg trotz großer Verluste an Soldaten und Mangel an Kriegsmaterial und Ausrüstung strategisch nicht schlecht für die Verbündeten Österreich-Ungarn, Deutschland und das Osmanische Reich: Durch die kommunistische Revolution in Russland kam es zu einem Machtwechsel, die Revolutionäre hielten ihr Versprechen und beendeten ihre Kriegsteilnahme. Somit hatten die Mittelmächte keinen Zweifrontenkrieg mehr zu führen und Österreich-Ungarn konnte seine Kräfte nach Süden verlegen, an die Front nach Italien. Dort gelangen einige Offensiven, man hoffte auf einen Friedensschluss. Denn trotz der unerwarteten Erfolge sehnte sich das Volk nach Frieden.
Auch der junge Kaiser Karl, der nach dem Tod Kaiser Franz Josephs im Jahr 1916 auf den Thron gekommen war, strebte von Beginn an einen raschen Frieden an. Doch dies gestaltete sich schwierig. Seine Geheimverhandlungen mit Frankreich, bekannt geworden als »Sixtus-Affäre«, flogen auf, der Bündnispartner, der deutsche Kaiser Wilhelm, war erzürnt. Er wollte weiterkämpfen, er wollte siegen.
Bericht eines Generals
Wie die Herrschenden die weltpolitische Lage und die Kampfhandlungen bewerteten, welche Motive sie antrieben und was sie dachten und sagten, ist mittlerweile gut erforscht und publiziert. Doch was dachten jene, die die Konsequenzen ihres Handelns zu tragen hatten, die Befehle ausführen mussten, deren Familien darunter zu leiden hatten? Lesen wir zu Beginn, was ein Mann dachte, der weit oben in der Hierarchie der Armee und des sozialen Gefüges der Monarchie stand, ein General und Abkömmling eines alten Adelsgeschlechts:
Es war Juni 1914, als am 28. die Schreckensnachricht von der Ermordung des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Gattin, Erzherzogin Sophie von Hohenberg, eintraf. Wir ahnten: Das ist der Krieg!
So beginnt der Bericht von Fürst Alois Schönburg-Hartenstein über seine Erlebnisse während und nach dem Ersten Weltkrieg. Schönburg-Hartenstein, Jahrgang 1858, stammte aus deutschem Hochadel und diente ab 1877 in der österreichisch-ungarischen Armee. 1878 nahm er an der Okkupation Bosniens teil und machte Karriere, bis zum Major. 1897 trat er in die Reserve und widmete sich der Verwaltung der ausgedehnten familieneigenen Güter in Sachsen, Mähren und Böhmen. Ihm gehörten die Besitzungen Hartenstein, Miletín, Königsfeld (heute: Královo Pole, Anm.) und Alt-Brünn, mit jeweils 1000 bis 1700 Hektar Grundbesitz, sowie eine Jagd beim Tiroler Achensee. Damit zählte er damals zu den reichsten Männern des Landes. Schönburg-Hartenstein hegte auch ein lebhaftes Interesse für die Politik, war Mitglied des Herrenhauses und Obmann der »Mittelpartei« sowie Präsident des österreichischen Roten Kreuzes. Mit Beginn des Krieges trat er wieder in den aktiven Dienst und übernahm verschiedene Kommandos, im September 1917 wurde er zum General und Kommandanten des IV. Korps und im Sommer 1918 der 6. Armee ernannt. In seinen bisher unveröffentlichten Erinnerungen und Briefen aus dieser Zeit an seine Frau beschreibt Schönburg-Hartenstein als Zeuge in der obersten Führungsschicht der Armee und der österreichisch-ungarischen Monarchie anschaulich, offen und detailliert die Ereignisse aus seiner Sicht als hoher Offizier und Mitglied des Hochadels.3 Diese bisher unveröffentlichten Texte aus dem Familienarchiv geben ein wertvolles Zeugnis der damaligen, für die Zeitgenossen und auch die Nachwelt schicksalhaften Jahre. Mit seiner Frau Johanna hatte er sieben Kinder, von denen ein Sohn, Hieronymus, damals schwer krank war.4 Über seine Gefühle schreibt Schönburg-Hartenstein rückblickend:
Ich hatte teilweise den aktiven Dienst verlassen, weil mir mein Soldatenberuf ohne je die Aussicht auf seine wahre Betätigung – das Vaterland zu verteidigen –, für mich persönlich unvollkommen erschienen war. Gewiss ist die Verteidigung der höchste Sinn der Vaterlandsliebe, daher auch die Vorbereitungen hiezu, der Friedensdienst. Aber damals, nach dem Tode meines Vaters, sah ich andere Pflichtenkreise vor mir, in welchen ich dem Vaterland nützlich sein konnte. […] Der Gedanke aber, Johanna allein bei meinem armen, todkranken Sohne zurückzulassen, war mir sehr schwer. Zunächst kam zwar nur die teilweise Mobilisierung gegen Serbien in Betracht, aber ich zweifelte nicht daran, dass ein Krieg gegen Russland an Deutschlands Seite und gegen Frankreich folgen würde. Die Spannung während des ganzen Monats Juli war groß, Österreich und Ungarns Völker hielten sie aber gut aus, bis auf die Tschechen, die gleich von Anfang an eine eindeutige Abneigung gegen den Krieg mit Serbien zeigten. Im Ganzen aber war die Stimmung in der Monarchie eine gute. Als endlich die Entscheidung fiel und das Ultimatum an Serbien ungenügend und mit Ausflüchten beantwortet wurde, war der Elan ein fast allgemeiner. Die Reservisten rückten so rasch ein, und zwar nicht etwa nur die Deutschen und Ungarn, sondern von allen Nationen, sogar von den Tschechen, dass weder die Kasernen noch die Depots ausreichten. Auf diesen raschen Ansturm zur Kriegseinrückung war man nicht gefasst.
Im Verhältnis zu früheren Kriegen war die Monarchie besser gerüstet. Ungenügend war jedoch vor allem die schwere Artillerie, ungenügend waren die Feldmunitions-Vorräte, welcher letztere Mangel sich eigentlich bei allen kriegführenden Staaten anfänglich gezeigt hat. Nirgends war man auf einen solchen Munitionsverbrauch gefasst. Noch ein schwerwiegender Übelstand war jedoch bei uns vorhanden: die große Zahl ungenügend ausgebildeter Ersatz-Reservisten in der ganzen k.u.k. Armee und in den beiden Landwehren. Der Überschuss an tauglichen Stellungspflichtigen über das Jahres-Rekruten-Kontingent von 103 000 Mann betrug jährlich 80 000 Mann, die eine achtwöchentliche, durchaus ungenügende militärische Ausbildung in den Ersatz-Kaders erhielten.
Erst im Juni 1912 wurde das Jahres-Rekruten-Kontingent von 103 000 auf 159 000 jährlich erhöht, also um 56 000 Mann, zu wenig und viel zu spät, da uns diese 80 000 Mann jährlich an Leuten Jahr für Jahr fehlten, was für zehn Jahre die Riesensumme von 800 000 Mann ergab; rund zwei Armeen, die wir hätten mehr haben können, im Gegensatz zu allen anderen Großstaaten. Schuld an diesem Versäumnis waren die leidigen politischen Verhältnisse der letzten 15 Jahre und besonders das Verhalten Ungarns gegenüber lebenswichtigen militärischen Forderungen. (Die ungarischen Abgeordneten verhinderten im Parlament wichtige Gesetzesvorlagen wie die Aufstockung des Militärs, Anm.)
Ich fuhr in diesen letzten Julitagen zwischen Vöslau und Wien öfters hin und her, um meine Feldausrüstung zu ergänzen. Als ich am Tage nach der Ablehnung des Ultimatums die Kärntner Straße bei der Oper kreuzte, begegnete ich unserem Gesandten in Belgrad, Baron Giesl, der den Auftrag erhalten hatte, sobald die Antwort Serbiens ungenügend ausfiele, die Pässe zu verlangen und Belgrad mit dem Gesandtschaftspersonal zu verlassen, was zwar nicht nach damaliger Auffassung des Ballhausplatzes, wohl aber nach jener der späteren öffentlichen Meinung, so viel wie eine Kriegserklärung bedeutete. Ich hatte früh in der Zeitung Serbiens unbefriedigende Antwort gelesen. Besonders einen wichtigen Punkt, worin wir verlangt hatten, dass unsere Funktionäre in der Gerichtsverhandlung in Belgrad gegen die Mörder des Erzherzogs und gegen die uns bekannten Hintermänner mitzusprechen und mitzuentscheiden haben müssen. Um diese Forderung hatten sich die Serben mit Ausflüchten gedrückt. Welche Verantwortung für Giesl, sich für den Krieg entschieden zu haben! Ich habe nie begriffen, warum Berchtold (Graf Leopold Berchtold, k.u.k. Außenminister 1912–1915, Anm.) sich diese Letzt- und Hauptentscheidung nicht selbst vorbehalten hat, wiewohl sie auch nicht hätte anders ausfallen können als jene Giesls.
Wladimir Giesl von Gieslingen (1860–1936) war Diplomat und General, seit 1913 k.u.k. Gesandter in Belgrad. Obwohl Giesl nicht zur »Kriegspartei« gehörte, musste er das Ultimatum an die serbische Regierung übergeben und auf Befehl Außenminister Berchtolds das Land binnen 48 Stunden verlassen, weil Serbien die Demarche nicht bedingungslos akzeptierte. Dieser Vorgang ging als »Julikrise« in die Geschichte ein. Dies war zwar keine Kriegserklärung und nicht in Giesls Sinn, er hatte nur einen Befehl ausgeführt, es hieß jedoch, ein »General« habe den Krieg begonnen.
Die Würfel waren gefallen. Am 28. Juli 1914 wurde der Krieg an Serbien erklärt. Die Folge war zunächst nur eine Teilmobilisierung, darunter das IX. Leitmeritzer Korps, zu dem Alexander (der älteste Sohn, Anm.) als Reserveoffizier einzurücken hatte, für meinen erst kürzlich verheirateten Sohn eine schwere Pflicht, die er natürlich sofort erfüllte und an seinem 26. Geburtstag als Ordonnanz-Offizier zu dem 10. Infanterie Divisions-Kommando Josefstadt abreiste. Von seiner jungen Frau (Agathe Prinzessin von Auersperg, Anm.) nahm er in Goldegg schweren Abschied. Die 10. ID (Infanterie Division, Anm.) wurde noch nicht, wie anfangs bestimmt, auf den serbischen Kriegsschauplatz transportiert, sondern rückte erst später, und zwar direkt gegen Russland, ins Feld. Zwei Tage darauf trat allgemeine Mobilisierung ein, Russland hatte durch nicht misszuverstehende Anzeichen zu erkennen gegeben, dass es auf Seite Serbiens in den Krieg ziehe. War das nicht vorauszusehen? Ich glaube ja. […]
Ich muss offen bekennen, dass ich und fast jeder andere in Österreich und Ungarn eine Strafaktion gegen Serbien erhoffte, nach den vielen Provokationen dieses Volkes gegen uns. Man dachte es sich einfacher, nach Abrechnung mit den Serben alle verfügbaren Kräfte nach Norden zu »werfen«. Ich selbst habe im Winter 1889 an den Mobilisierungstransporten des V. Korps Tag und Nacht gearbeitet, als man damals dachte, es komme zum Krieg mit Russland, und weiß, wie kompliziert diese zahllosen Eisenbahn-Instradierungen sind (bei Instradierungen werden Soldaten mittels Marschroute oder Eisenbahn-Requisitionsschein in Marsch gesetzt, Anm.). Wie aber erst der Transport zweier Armeen mit allen Trains und Anstalten vom südlichen Kriegsschauplatz nach Galizien! Wir werden später sehen, dass diese Transporte, obwohl sie im Allgemeinen glatt verliefen, doch zu spät kamen. Die Niederwerfung Serbiens hatte man sich doch zu leicht vorgestellt, Serbien hatte ein kriegsgewohntes, gut ausgerüstetes Heer, das uns noch schwer zu schaffen machte.
Ich nahm Abschied von meinem armen, dem Tod geweihten Hieronymus und meinen Kindern, Johanna begleitete mich noch nach Wien. Ich übergab ihr nicht nur die Sorge um Hieronymus und die anderen Kinder, um unser Haus und Hauswesen, sondern auch das gesamte Vermögen und die Verwaltung unserer Besitzungen in Mähren und Sachsen. Mein Alexander und ich waren im Krieg, mein Zentral-Direktor Forstmeister Stefan war auch eingerückt und ist schon im dritten Kriegsmonat im Norden gefallen. So musste meine tapfere, liebe Lebensgefährtin alles in der Heimat besorgen, sich um alles kümmern, und sie hat das auch in ausgezeichneter Weise getan.
In Wien herrschte Kriegsbegeisterung. Der Kampf gegen Russland, gemeinsam mit Deutschland, ließ uns den sicheren Sieg hoffen. Inzwischen war aber auch England auf Seite Frankreichs und Russlands in den Krieg getreten, was entscheidend für den ganzen Krieg war. Am 1. August nahm ich endgültig Abschied von meinen Lieben und fuhr mit der Nordbahn nach Lemberg, um dort das mir verliehene Kommando über die 11. Marschbrigade zu übernehmen. Es war eine lange Fahrt. In allen Stationen wurden wir von einer großen Menge begrüßt und bewirtet. Die Fahrtzeit verbrachte ich zum größten Teil mit dem Nachlesen von alten und neuen Vorschriften, Reglements und Befehlen, denn ich war 17 Jahre nicht aktiv gewesen und hatte viel nachzuholen. So verging mir die lange Zeit rasch und in Lemberg empfing mich schon ein Offizier meines Brigadestabs und begleitete mich in mein Quartier, in eines der Stadthotels. Ich meldete mich beim Korps-Kommandanten, General d[er] Kav[allerie] v. Kolossváry, einem ausgezeichneten Mann und ehemaligen Flügeladjutanten des Kaisers, der die schwere Aufgabe hatte, den Aufmarsch des größten Teiles des gegen Russland aufgestellten Heeres, zunächst der Armee Brudermann, gegen Osten zu decken.
General Rudolf von Brudermann befehligte die Armee in Ostgalizien, hatte mehrere schwere Niederlagen zu verantworten und verließ deshalb bereits im November 1914 das Heer. Ausführlich beschreibt Schönburg-Hartenstein die Kriegsereignisse an der russischen Front. Bemerkenswert ist dabei, wie rasch die Kriegsbegeisterung nicht nur bei den einfachen Soldaten, sondern auch bei einem hohen Offizier wie ihm angesichts der Strapazen und des Grauens an der Front verflog.
Brief vom 28. November 1914 an Johanna
Ich habe Dir schon einige Tage keinen Brief mehr geschrieben. Es geht uns gut, physisch; moralisch könnte ich nicht sagen, tägliche verlustreiche Rückzugsgefechte sind für Offiziere und Mannschaften deprimierend und wegen der häufigen Nachtmärsche auch sehr ermüdend. Wegen mir möchte ich nicht ein Wort sagen, ich ertrage alles so leicht, aber wenn ich sehe, wie meine armen Landesschützen geschunden werden, oft nutzlos, durch Verluste geschwächt, dann steigt Ärger in mir auf. Man hat nicht recht in Wien, dem Generalstab die Schuld beizumessen. Ich möcht die moderne Armee sehen, die heutzutage ohne Generalstab geführt werden könnte. Fast alle Generalstabsoffiziere sind äußerst fleißige Männer, die ihre Pflicht tun. Die Schuld an unseren Misserfolgen, nebst einigen anfänglichen Missgriffen, trägt die riesige Überzahl der Russen, die eine Folge der neunjährigen ungarischen Obstruktion ist.
Unter »Obstruktion« verstand man die Blockade von nicht genehmen Gesetzen durch Abgeordnete einzelner Nationalitäten im Parlament, indem sie die Verhandlungen dazu durch Lärmen und sogenannte »Pultdeckelkonzerte«, also das Zuschlagen der Pultdeckel, störten. Es wurden auch immer wieder Abgeordnete wegen Obstruktion von der Polizei abgeführt. Durch diese Manöver konnte in dem von Schönburg erwähnten Fall die Zahl der Soldaten nicht aufgestockt werden, was zu einer zahlenmäßigen Unterlegenheit im Krieg führte.
Für den modernen Krieg taugen nur gut und genügend ausgebildete Soldaten, nicht die Ersatzreservisten, Leute, die statt zwei oder drei Jahre nur sechs Wochen ausgebildet wurden und von denen wir, dank der ungarischen Obstruktion, eine Überzahl haben. Apponyi5 hat das seinerzeit arrangiert und verschuldet, es gibt keinen Galgen, der hoch genug für ihn wäre, für diesen Hund. Bitte sage, dass dieses mein Urteil sei, wenn du willst. Da nützen schöne Reden beim Kriegsbeginn gar nichts mehr. Das sind sehr ernste Zeiten, in denen wir leben. Damals, als Albert Apponyi Präsident des Abgeordnetenhauses war, stellte er den Grundsatz auf, ohne Concessionen auf nationalem Gebiet gibt es keine Wehrvorlage (Rekruten-Kontingent-Erhöhung, Anm.). Dadurch haben er und seine Freunde die ordentliche Ausbildung von ca. 100 000 Rekruten jährlich verhindert, das macht in zehn Jahren eine Million ausgebildeter Streiter. Diese gehen uns jetzt ab. Die Sache stimmt insofern nicht ganz, als in der Wehrvorlage vor zehn Jahren nicht 200 000, sondern nur 125 000 Rekruten jährlich verlangt wurden, Apponyi daher nicht die Ausbildung von 100 000, sondern von 25 000 Rekruten verhindert hat. Aber im Laufe der letzten Jahre wäre sicher der ersten Wehrvorlage eine zweite, vielleicht sogar dritte gefolgt, sodass man sagen kann, Apponyi und Konsorten haben uns um nur eine halbe Million ausgebildeter Rekruten gebracht.
Die nationalen Reibereien haben sich in den letzten 10 bis 15 Jahren unleugbar verschärft, das ist kein Wunder bei der Configuration Österreichs, bei der alles demoralisierenden Obstruktion und dergleichen. Leider hat sich hiebei auch die nationale Verräterei verschärft, wurde geduldet, bei Serben und Ruthenen. Gegen die Serben sind die Ungarn sehr scharf eingeschritten, das hat eigentlich nichts genützt. Gegen die Ruthenen waren wir mild, das hat auch nichts genützt – wie hätte man das also machen sollen. Ich halte in dieser Richtung das ungarische System für das bessere. Ich kann mich auf den Einfluss der nationalen Verräterei auf das Heer nicht weiter einlassen, weil das das militärische Gebiet streift. Du verstehst schon, was ich meine, wenn ich sage, am Nordkriegsschauplatz hat uns nichts so sehr geschadet als die russophile Stimmung unter der armseligen ruthenischen Bevölkerung. Daran haben übrigens die Polen einen großen Teil der Schuld, da sie, um die Ruthenen zu teilen, den Antagonismus zwischen austrophilen Ruthenen (Ukrainer) und russophilen Ruthenen förderten. Alles das sind Erscheinungen des politischen Lebens, die auch in anderen Ländern vorkommen. Sie sollen aber übertaucht werden durch eine großzügige Staatsidee.
Als Ruthenen bezeichnete man in der Habsburgermonarchie die Ostslawen, die vor allem in Ostgalizien, dem Norden der Bukowina und in den ungarischen Karpaten lebten. Vereinfacht, aber nicht ganz korrekt, wurden die Ruthenen mit den Ukrainern gleichgesetzt. Heute bezeichnen sie sich als »Russinen« und sind auf mehrere Länder verteilt. In der Ukraine bestreitet man die Eigenständigkeit der Identität der Ruthenen. Interessanterweise gibt es aber noch heute einen Gegensatz zwischen der Ostukraine, die sich den Russen nahe fühlt, und den Westukrainern, die die Russen als Imperialisten betrachten. Das führte zum aktuellen bewaffneten Konflikt.
Über militärische Dinge kann ich natürlich nichts schreiben und kann nur sagen, dass nach dem, was ich sah und erfuhr, außer einer Nation (Tschechen) alles seine Pflicht tut und mehr als das.
Nun noch kurz über die anderen Fragen. Ich bin lebhaft beunruhigt, liebster Schatz, über Deine Kraschauer Reise (Kraschau ist der deutsche Name für Chráš?any u Rakovníka in Tschechien, dort in der Nähe verlief damals die Ostfront, Anm.). Ich bewundere aufrichtig Eure Schneid, aber erstens bin ich von Kraschau überhaupt nicht zu erreichen und dann dürfen Frauen, Ihr armen, lieben Frauen, nicht zur Armee. Erstens weil Du mir und unserer Familie so wichtig bist als Hüterin des Herdes, als Mutter und kluge Betreuerin des Vermögens. Zweitens weil Du nicht ahnst, welchen Gefahren Ihr Euch aussetzt. Ein Pneudefekt, eine Panne, kann Euch durch Stunden und Tage aufhalten, die militärische Situation ändert sich rasch, orientiert darüber ist fast niemand als die höchsten Leitenden. Du bist wirklich sehr unternehmend, aber ich hoffe zu Gott, dass Du aufgehalten wirst.
Freut Euch über Hindenburgs6 Erfolge, Deutschlands und unsere Sache sind unauflöslich verbunden. Eifersucht wäre ein heilloser Irrtum. Wir können und werden den Krieg nur gemeinsam gewinnen, wenn jeder auf seine Sonderinteressen, auch wenn sie noch so berechtigt sind, vergisst.
Nach vielen heftigen und verlustreichen Kämpfen, die Schönburg-Hartenstein die gesamte Zeit über an der Front im unmittelbaren Kampfeinsatz mitmachte und in denen er auch Verletzungen erlitt, wurde seine Truppe im Oktober 1915 nach dem Kriegseintritt Italiens an die Südfront verlegt. Dort blieb er bis zum Ende des Krieges. Im Juli 1916 berichtet er von seiner Beförderung zum Kommandanten des berühmten XX. Korps, der Kaiserjäger und der Edelweiß-Division, als Nachfolger des Thronfolgers Erzherzog Karl. Auf diese Beförderung war er sehr stolz, wie seinen Erinnerungen zu entnehmen ist, und reiste bereits einen Tag später zu seinem neuen Einsatzort an der italienischen Front, nach Denno, Trentino.
Meiner Gewohnheit gemäß war ich schon am nächsten Tag auf meinem neuen Posten. Am Weg zum Palazzo Parisi, der durchaus kein Palast, sondern ein einfaches Haus nahe der Kampffront war, besuchte ich meine Tochter Aglae, die seit zwei Monaten in einem Feldspital in Folgaria strengen Pflegerinnendienst versah. Sie waren während der Offensive ab 15. Mai sehr oft stark beschossen worden, doch das machte den tapferen Pflegerinnen nichts, sie waren stolz darauf, im Feuer gewesen zu sein. Was aber das gütige Herz meiner Aglae heftig ergriffen hatte, waren die Leiden der Verwundeten und ihr Sterben, wenn weder die Ärzte noch treue Pflege die tödlich Getroffenen retten konnten.
[…] Am 21. November schloss unser verehrter Kaiser Franz Joseph seine müden Augen nach fast 68-jähriger Regierung. Was hat unser verehrter alter Herr alles erlebt, ertragen und erduldet! Mein ganzes Leben, die nachhaltigsten Eindrücke meiner Kindheit, meiner Jugend, alle Arbeit und Tätigkeit meiner Zeit als Mann waren von dieser hohen und erhabenen Gestalt überschattet, aber auch mein Vater und zum Teil mein Großvater hatten unter ihm gewirkt und gedient. Seine Person ragte in das Leben jedes Österreichers und Ungarn wie ein erhabenes Symbol hinein. In ganz Deutschland genoss er unbegrenzte Verehrung, es hat zur Tragik seines prüfungsreichen Lebens gehört, dass die unverständige Feindschaft der übrigen Welt sein Ende verdüstern musste, statt dass die ganze gesittete Menschheit sich zusammengefunden hätte, um den Tod dieses edlen Menschen und Monarchen zu betrauern. Wir alle waren tief bekümmert, denn wir haben Franz Joseph nicht nur als Kaiser verehrt, sondern auch wie einen Vater geliebt. Bei der Eidesleistung für den neuen jungen Allh[erhöchsten] Kriegsherrn Kaiser Karl am Kirchenplatz von Folgaria schwuren wir nicht nur ihm, sondern auch jeder sich selbst, dem neuen Namensträger unseres Kaiserhauses Treue und Gehorsam zu halten bis in den Tod.
Anfang Dezember setzten starke Schneefälle ein, und da auch bald ein für diese Jahreszeit ungewöhnliches Tauwetter und damit große Lawinengefahr auf den Bergen herrschte, war die Stimmung bei den Truppen beklommen. Alles vertragen unsere tapferen Alpentruppen, aber vor dem weißen Tod hatten sie Angst – eine ihnen sonst ganz fremde und unbekannte Empfindung. Am 6. Dezember ereignete sich am Pasubio der erste große Unglücksfall: 95 Mann tot, 55 vermisst – eine Riesenlawine hatte sie heruntergerissen. Am 10. gingen allerwärts viele Lawinen nieder und richteten großes Unheil an, im Campoluzzotal, am halben Weg auf den Pasubio und im Penkalatal. Das größte Lawinenunglück in meinem Korpsbereich ereignete sich aber in diesen Tagen bei einem von der Divisions-Sanitäts-Anstalt 8 aufgestellten Feldspital, das mit seinen Kranken und Verwundeten gänzlich verschüttet wurde. Als ich tags vorher dort vorbeikam, hatte ich die sofortige Räumung angeordnet, man sah schon große, schwere Wächten drohen. Diese Räumung wurde nur teilweise ausgeführt, in der Meinung, der untere Teil der großen Baracken sei nicht gefährdet, und so gingen die unglücklichen Insassen dieses Teiles zugrunde. Unter allen grässlichen Verlusten, welche dieser große Krieg brachte, tat es uns um diese armen Kranken und Verwundeten besonders leid, weil ihr Unglück wenigstens teilweise vermeidbar gewesen wäre.
[…] Eine besondere Freude und Ehrung stand jedoch dem XX. Korps Mitte Jänner (1917, Anm.) durch das Erscheinen unseres Kriegsherrn, des Kaisers Karl, bevor. Er hatte die siegreiche Offensive aus Südtirol, Asiago und Arsiero mitgemacht. Unter ihm hatte das Korps im Verbande der 11. Armee entscheidend gewirkt und gesiegt, wobei er wiederholt in vorderster Front erschienen und im Feuer gewesen ist. Es waren also schöne Erinnerungen, die ihn mit dem Korps und besonders mit den Kaiserjägern verbanden. Das XX. Korps erhielt den Namen Edelweißkorps und bei einer Aufstellung aller Höherdekorierten sprach der Kaiser mit einer sehr großen Anzahl von Offizieren und Mannschaften, zu Letzteren mit jedem in seiner Muttersprache. Er beherrschte fast alle Sprachen der Monarchie, und zwar vollkommen: Ungarisch, Tschechisch, Italienisch, weiters genügend: Polnisch, Ruthenisch und Rumänisch, Kroatisch und Slowenisch. Das freute die Soldaten besonders und trug sehr dazu bei, den 16. Jänner 1917 zu einem Freudentag für das ganze Edelweißkorps zu machen. Auch meine brave Tochter Aglae, die seit Kriegsbeginn als Kriegs- und seit einem Jahr als Frontpflegerin in Folgaria den Krieg in erster Linie mitgemacht hatte, erhielt von S. M. (Seiner Majestät, Anm.) das goldene Verdienstkreuz überreicht.
Kaiser Karls Charakter zeichnete vor allem eine Eigenschaft aus: eine große Herzensgüte. Er war glücklich, wenn er jemandem eine Freude machen konnte. Das Schicksal hat ihn in einer großen, schweren Zeit zu einer Aufgabe berufen, die für einen starken und energischen, zielbewussten Charakter nicht leicht zu erfüllen gewesen wäre. Die österr. ung. Monarchie, das Erbe der Habsburger, war zu seinem Existenzkampf aufgerufen, umgeben von einer Welt von Feinden, unter welchen vier hochgerüstete Staaten, Russland, Frankreich, Italien und das Meer beherrschende England, standen, gar nicht zu rechnen alle kleinen Verbündeten der Entente, zu welchen von Anfang an in verdeckter, zum Schluss in offener Form der Kriegserklärung die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit ihrem unermesslichen Material und Geldreichtum und ihren unverbrauchten Menschenkräften stießen.
[…] Im März 1917 standen alle Fronten der Zentralmächte fest. In Russland waren Anzeichen der inneren Zersetzung zu merken, in Rumänien und Serbien große Erfolge errungen worden. Trotzdem war die Situation für uns sehr ernst, denn die Vereinigten Staaten begannen ihre Karten ganz aufzudecken und waren nicht nur wie bisher Materiallieferanten der Ententemächte, sondern bereits deren erklärte Verbündete. Das Friedensangebot Deutschlands und Österr.-Ungarns vom Dezember 1916 war von London und Paris zurückgewiesen worden und unabsehbar schien das Ende des Krieges. Hier will ich eine Äußerung des Unmutes über das Verhalten der Vereinigten Staaten nicht unterdrücken: Vor acht Jahrzehnten haben die USA die sogenannte Monroe-Doktrin verkündet; die Unzulässigkeit der Einmischung fremder Staaten in die politischen Verhältnisse Amerikas. Die Welt hat sich damals dieser Doktrin gefügt – Kaiser Max von Mexiko (aus dem Haus Habsburg) ist ihr zum Opfer gefallen.7 Und nun, 1917, in der entscheidenden Phase des Weltkrieges, unternahmen es die Vereinigten Staaten, sich in unseren europäischen Krieg als offene Bundesgenossen unserer Feinde aktiv einzumengen. Welche Vermessenheit!
Im November 1917 sah es für die Armee Österreich-Ungarns an der Südfront nicht schlecht aus. Die Offensive in Oberitalien war bisher erfolgreich verlaufen, ein Viertel der oberitalienischen Tiefebene war eingenommen worden, man hatte etwa 250 000 Gefangene gemacht und Hunderttausende Waffen erbeutet. Der »Erbfeind« hatte für seinen »Verrat« am Isonzo bluten müssen. Der junge Kaiser Karl inspizierte mit Freude und Wohlwollen seine erfolgreiche Truppe. Schönburg-Hartenstein berichtet darüber:
Am Abend des 25. Oktober machten die Verbündeten im Angriff weitere große Fortschritte, 43 000 Gefangene und 40 feindliche Geschütze zählten schon am 26. zu unserer Beute. Von meinem Korps hatte die 20. Honvéd-Division den Stützpunkt Nord genommen und alle feindlichen Stellungen am Nordosthang des Monte San Gabriele (heute: Škabrijel bei Gorizia, Anm.), am Abend war die ganze durch zwei Monate heiß umkämpfte italienische Stellung in unserer Hand. Die Anzahl der Gefangenen und der erbeuteten Geschütze und Material war auf große, fast unwahrscheinlich scheinende Zahlen gestiegen. An diesem Tag kam Kaiser Karl auf meinen Gefechtsstandpunkt westlich Karnica (heute: Krnica, Anm.), der eine weite Aussicht über das ganze, große Schlachtfeld bot. Ein wunderbares Panorama eröffnete sich unseren Blicken vom Triester Hafen aus über das Meer und das weite Kampffeld bis hinauf zu den Höhen des Krn. Das Hochgefühl des großen Sieges belebte uns und ließ uns alle Anstrengungen und Strapazen der letzten Monate vergessen.
Brief vom 1. November 1917 an Johanna
Ich war heute in Görz, welches das Bild der entsetzlichsten Verwüstung bietet. Zwölf Schlachten sind über diese Stadt hinweggegangen. […] Die armen Bewohner dieser Stadt und des ganzen Landstreifens, wo alle diese vielen Kämpfe stattfanden. Wenn sie jetzt zurückkehren, welcher Anblick für sie! Nun geht es weiter, in Italien wird ein anderer Landstreifen verwüstet und ringsum so viel Unglück verbreitet werden.
Brief vom 9. November 1917
Heute bin ich endlich in Italien eingerückt, auf dem Rücken meines braven Chudenitz ritt ich über die Grenze und ließ dort ein Honvéd-Regiment an mir vorbeimarschieren. Die Katzelmacher laufen so, dass nur jene Truppen an ihnen blieben, die unmittelbar zur Verfolgung bestimmt waren, und dazu zählen meine Truppen leider nicht. Von der Front hört man nicht viel Gefechtslärm, hie und da einen Kanonenschuss. Ab und zu eine große Explosion – für unsere kampfgewohnten Ohren die reinste Idylle. […]
Der Tagliamento wurde von der Division meines Vetters Fml. (Feldmarschallleutnant, Anm.) Felix Prinz Schwarzenberg als erster überschritten. Obst. (Oberst, Anm.) Graf Zedtwitz, Kdt. (Kommandant, Anm.) von Dragoner 14 als Gruppen Kmd. (Kommandant, Anm.) mit bosnischen Truppen an der tête (Spitze, Anm.) der Division Schwarzenberg, gelangte mit seinen Leuten teils schwimmend, teils auf den Resten einer halb zerstörten Brücke ans andere Ufer und sicherte dadurch sofort den Weitermarsch gegen den Piave. Nun ging es unaufhaltsam weiter; beiderseits waren die Marschlinien von zurückgelassenen feindlichen Geschützen, Kampfresten und Material gesäumt.
Am 7. November besichtigte der Kaiser Teile der 20. Honvéd-ID (ungarische Infanteriedivision, Anm.) und dankte mir für die gute Verteidigung des Monte Gabriele. Am 11. November war ich in einer Villa in Frattina einquartiert, als ich kurz vor dem Abmarsch durch Feuerlärm geweckt wurde; mein Haus brannte, ich konnte mich gerade noch beizeiten auf einer Leiter aus dem 2. Stock retten. Am 13. November Piavon a destra. Ich beschleunigte so viel als möglich den Vormarsch, besonders der schweren Geschütze, die zurückzubleiben drohten, weil es an Auto-Zugmaschinen mangelte. Ohne schwere Artillerie war an ein Forcieren des Piave nicht zu denken, besonders da Nachrichten eintrafen, dass die deutsche Armee von Below (Otto von Below, General der Infanterie, Anm.) auf den westlichen Kriegsschauplatz abberufen worden sei.
Am 15. November erkundigte ich die besten Übergangsstellen über den Piave von einer Flussinsel aus. Gm (Generalmajor, Anm.) Steiger mit der 29. ID begann am 16. November halb sieben Uhr früh mit dem I.Regt 92 (Infanterieregiment, Anm.) den Übergang auf Schiffen, um halb acht Uhr waren zwei Baone (Bataillone, Anm.) drüben. Der Fluss ist, wie dies unglückseligerweise an diesem Tag und später jedes Mal bei unseren Übergangsversuchen der Fall sein sollte, sehr hoch gewesen und wälzte seine trüben Fluten durch das sonst halbleere Bett. Die übersetzten Teile von I.Rgt 92 wurden drüben von beiden Seiten umfasst und gingen mit 24 Gewehren verloren. Nur 120 Mann retteten sich schwimmend herüber. Ein böser Tag, der dem I.Rgt 92 leider große Verluste brachte.
Der Begriff »Katzelmacher« für die Italiener, den Schönburg-Hartenstein in diesem Brief verwendet, war damals allgemein zur Verächtlichmachung der Feinde gebräuchlich. Über den Ursprung des Wortes herrschte allerdings Unklarheit. Daher ging die Wiener »Neue Freie Presse« in ihrer Ausgabe vom 30. Juni 1916 der Sache auf den Grund: »Im Allgemeinen wird jetzt die Vorstellung herrschen, als ob in unserem Spottausdruck für den Italiener eine Anspielung auf ›Katze‹ stecke, ›weil der Italiener schmeichlerisch falsch wie eine Katze ist‹. Aber nirgends findet sich das Wort ›Katze‹ in der Bedeutung ›Intrige‹, ›falsche Handlung‹, ›schmeichlerisches Benehmen‹ u.a. In Wahrheit liegt der Ursprung des Wortes anderswo. Der Katzelmacher ist ein Kesselflicker; in Südtirol kennt man den Gatzelmacher, das ist ein Mann, der ›Gatzel‹ macht und verkauft. Das Gatzel ist ein kupfernes Schöpfgefäß mit langem Stil, das zum Milchschöpfen in der Käserei, aber auch sonst in der Bürgersküche Verwendung findet. Da sich nun hauptsächlich die Italiener mit der Verfertigung dieser kleinen Gefäße beschäftigen, die sie von Haus zu Haus ziehend zum Verkauf bringen, wurden zunächst die italienischen Hausierer ›Gatzelmacher‹ benannt und die Heimat des Wortes ist ohne Frage im österreichisch-italienischen Grenzgebiet zu suchen.«
Brief vom 17. November 1917
Dass ich keine Post von Euch bekomme, das empört mich nachgerade. Gestern habe ich eine Brandmeldung abgesendet, wegen unserer schlechten Feldpost, hoffentlich nützt es etwas. Du wirst glauben, mein armer alter Schatz, dass Dein sonst so konzilianter Alter ganz meschugge geworden ist. Aber diese schlechte Feldpost macht mich schon wütend.
Brief vom 21. November 1917
Das ist merkwürdig, dass der Sterbtag unseres guten alten Kaisers und mein Geburtstag zusammenfallen. Es geht mir gut für meine 59 Jahre, vielleicht werde ich auch 86 wie Kaiser Franz Joseph (Schönburg-Hartenstein wurde wirklich 86 Jahre alt, Anm.). Seit dem 16. herrscht relative Ruhe an unserer Front. Die Gefechtsführung in diesem flachen, ganz unübersichtlichen Terrain ist eine ganz andere, wie wir sie im Gebirge gewohnt waren. Namentlich gilt das für die Artillerie, welche nicht gut schießen kann, wenn sie nicht beobachtet. Wir arbeiten daher viel mehr als früher mit Ballons und Fliegern, das bedarf einer eigenen Einübung.
Heute ist eine Dame bei uns eingerückt, eine Kriegspresseberichterstatterin von einer polnischen Zeitung. Sie ist eher jung, lächelt verführerisch, hat aber etwas scharfe Züge. Sie erschien heute mit Hosen, abends war sie wieder als Dame gekleidet.
Brief vom 28. November 1917
Vor allem müssen wir uns alle endlich den Frieden wünschen und auch ich finde, dass er gerade jetzt nach unserem großen Sieg über Italien am gelegensten käme. Ich denke auch, dass der Friede nicht mehr lange auf sich warten lassen kann. Die Russen sind abgetan. Drei Kriegspresseberichterstatter sind jetzt hier, unter ihnen ein Schweizer, der erzählte, die Deutschen hätten auf den Vorschlag von Lenin gemeint, es sei niemand mit genügenden Vollmachten da, mit dem man verhandeln könne. Czernin (Graf Ottokar Czernin, k.u.k. Minister des Äußeren, von Kaiser Karl 1916 dazu ernannt, Anm.) aber sagte, das sei ihm ganz gleich, er verhandle mit jedem, denn wenn