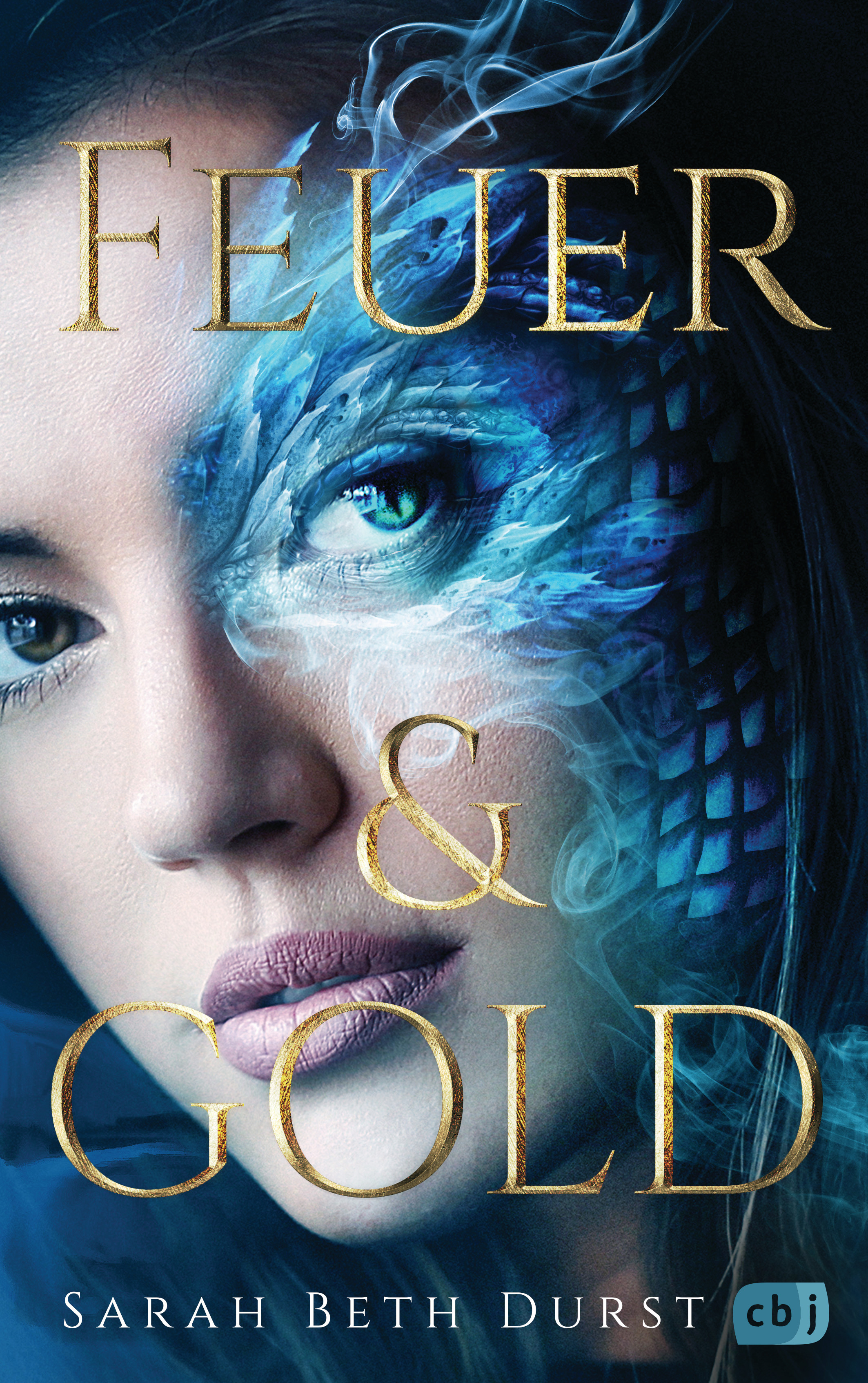9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Königinnen von Renthia
- Sprache: Deutsch
Sie ist die größte Königin aller Zeiten – doch zu welchem Preis?
Daleina gehört zu den wenigen Frauen, die über die Gabe verfügen, die Elementargeister zu kontrollieren, die das Königreich Renthia terrorisieren. Diese Frauen werden Königin – oder sterben bei dem Versuch, zerfetzt von den Klauen und Zähnen der Elementare. Daleina ist bei weitem nicht die mächtigste der potentiellen Erbinnen der Königin. Doch dann wird ausgerechnet jener Mann ihr Mentor, der die amtierende Königin liebt – und von ihr verraten wurde …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Daleina gehört zu den wenigen Frauen, die über die Gabe verfügen, die Elementargeister zu kontrollieren, die das Königreich Renthia terrorisieren. Diese Frauen werden Königin – oder sterben bei dem Versuch, zerfetzt von den Klauen und Zähnen der Elementare. Daleina ist bei weitem nicht die mächtigste der potentiellen Erbinnen der Königin. Doch dann wird ausgerechnet jener Mann ihr Mentor, der die amtierende Königin liebt – und von ihr verraten wurde …
Autorin
Sarah Beth Durst hat an der Princeton University Anglistik studiert. Sie verbrachte dort vier Jahre damit, über Drachen zu schreiben und sich zu fragen, was die Campus-Gargoyle wohl sagen würden, wenn sie sprechen könnten. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Stony Brook, New York.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Sarah Beth Durst
Die Blutkönigin
Roman
Deutsch von Michaela Link
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Queen of Blood« bei HarperVoyager, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Sarah Beth Durst
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München
Redaktion: Michelle Gyo
Umschlaggestaltung und -illustration: Isabelle Hirtz, Inkcraft
Karte/Illustrationen: © Andreas Hancock
HK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-21468-5V001www.penhaligon.de
Karte
Für Rick Keuler
Kapitel 1
Vertrau nicht dem Feuer, denn es wird dich verbrennen.
Vertrau nicht dem Eis, denn es wird dich erfrieren.
Vertrau nicht dem Wasser, denn es wird dich ertränken.
Vertrau nicht der Luft, denn sie wird dich ersticken.
Vertrau nicht der Erde, denn sie wird dich begraben.
Vertrau nicht den Bäumen, denn sie werden dich zerfetzen, zerreißen, zerfleischen, bis du tot bist.
Es ist ein Kinderlied. Du springst über ein Seil, schneller und immer schneller, und zählst dabei die Geister auf, einen nach dem anderen. Wenn du über das Seil stolperst, dann ist es der zuletzt Genannte, der dich eines Tages töten wird: Feuer, Eis, Wasser, Luft, Erde oder Holz.
Die sechsjährige Daleina schnappte sich ihr Seil, schlüpfte aus dem Fenster des Baumhauses und lief über die Äste auf den Hain zu, angelockt vom Fackellicht. Ihre Eltern hatten Nein gesagt, auf gar keinen Fall, geh ins Bett und bleib dort, aber trotzdem, obwohl sie noch so jung war und auch unbedingt ein gutes, gehorsames Kind sein wollte, ließ sich Daleina nicht von ihrem Schicksal fernhalten. Sie würde mit ausgebreiteten Armen darauf zulaufen und ihm ins Gesicht schlagen.
Alle anderen Kinder hatten sich bereits unter der Aufsicht der Dorfhexe auf dem Waldboden unter den Bäumen versammelt. Daleina ließ sich von den Ästen hinunter aufs Moos fallen und gesellte sich zu ihnen. Ihre Wangen waren vom Laufen gerötet, und ihr Haar vom Wind zerzaust. Sie schwenkte ihr Seil und stimmte in den Gesang ein. »Vertrau nicht dem Feuer …«
Bänder in leuchtenden Farben flatterten um sie herum, sie stellten jeden der sechs Elementargeister dar. Unter den Pfosten, an denen man die Bänder befestigt hatte, waren Amulette vergraben, und weitere Amulette baumelten im Schein der Fackeln zwischen den Pfosten um sie herum. Das Kinderlied und die Bänder würden die Elementargeister anlocken, und die Amulette hielten sie auf Abstand. Das war so sicher, wie es die Dorfhexe nur hinbekommen konnte, und sie lächelte die Kinder an, während sie gegen den Uhrzeigersinn im Kreis herumging und die Schutzworte sprach, so wie sie es gelernt hatte.
Die Kinder sprangen schneller und schneller und wiederholten dabei das Lied. Mindestens zwei Dutzend Mädchen und Jungen, das jüngste Kind sechs Jahre alt und das älteste zwölf, waren in den Hain gekommen, um sich ihre Zukunft prophezeien zu lassen. Einige waren mit der Zustimmung ihrer Eltern hier, sie trugen ihre besten Kleider, hatten Bänder in den Haaren und ihre Hemden waren frisch gestärkt. Andere, wie Daleina, steckten in Nachthemden, hatten ungekämmtes Haar und nackte Füße.
Während Daleina hüpfte, sah sie, wie der erste Holzgeist seine spitze Nase zwischen den Blättern hindurchschob. Er huschte über die Zweige und baumelte dann mit dem Kopf nach unten, um die Kinder zu beobachten, sein Schatten riesig im Fackellicht. »Vertrau nicht dem Wasser …« Ein weiterer Holzgeist löste sich vom Stamm eines Baums, sein knorriger Körper war mit einer dicken Schicht aus Moos und Blättern überzogen. Ein Erdgeist, unbehaart und braun, strich aufreizend nahe an den Rändern der Amulette vorbei und bleckte dabei die Zähne, die wie kleine Felsen aussahen. »Vertrau nicht der Luft …«
Ein Kind strauchelte.
Ein anderes stürzte.
Wie Daleina hatten auch sie gesehen, dass die Geister aus dem dunklen Wald auftauchten und den Hain einkreisten. »Vertrau nicht der Erde …« Ihre nackten Füße patschten über den weichen Boden. Es hatte vor einigen Stunden geregnet, und zwischen Daleinas Zehen klebte Schlamm. Sie stellte sich vor, wie ein Erdgeist seine Hände durch den Morast streckte, um ihren Knöchel zu packen, und wie ein Luftgeist sie emporriss und sie von weit oben hinabfallen ließ. Sie kniff die Augen zusammen und hüpfte weiter. »Vertrau nicht den Bäumen …«
Weil sie ihre Augen geschlossen hatte, sah sie nicht, wie sich der winzige Holzgeist von seinem Ast und über die Amulette herabschwang, und sie sah auch nicht, wie die anderen Kinder stolperten und stürzten, jedes von ihnen, alle wurden sie durch ihre Seile zu Fall gebracht. »… sie werden dich zerfetzen, zerreißen, zerfleischen …«
Ihre Stimme war bald die einzige, bis die Schreie einsetzten.
Sie öffnete die Augen, als die Dorfhexe etwas rief und die Kinder aufkreischten. Blut befleckte das Mieder der Frau, und ein buckliges, mit Blättern bedecktes Geschöpf klammerte sich an ihre Schulter. Daleinas Fuß blieb im Schlamm stecken, und sie vergaß zu springen.
Ihre Eltern kamen auf sie zugerannt – ihre Mutter zuerst, ein Messer in der Hand, und sie durchschnitt das Seil, gerade als es auf Daleinas reglose Füße zuschwang. Die beiden Hälften des Seils klatschten links und rechts von ihr zu Boden.
Weitere Dorfbewohner strömten in den Hain. Sie drängten an Daleina und ihren Eltern vorbei und nahmen ihre eigenen Kinder in die Arme. Mehrere eilten der Dorfhexe zu Hilfe. Während sie noch immer die Enden des schlaffen Seils umklammert hielt, sah Daleina, wie der Geist den Stamm einer Eiche hinauf floh. Sein verschrumpeltes Blättergesicht war noch immer blutverschmiert. Dann verschwand er in der Nacht.
»Nein, Holz wird dich nicht holen«, murmelte ihre Mutter in ihr Haar. »Und auch nicht Feuer oder Eis oder Wasser, Erde oder Luft. Du wirst leben, mein Kind. Du musst leben.«
»Mir ist ja nichts passiert, Mama«, antwortete Daleina.
»Das war dumm von dir.« Mama drückte mit den Fingern Daleinas Kinn hoch und zwang sie, ihr in die Augen zu sehen. »Nur weil es Tradition ist, muss es nicht unbedingt auch klug oder notwendig sein. Versprich mir, dass du dich nie wieder in Gefahr bringen wirst.«
»Ich werde es versuchen«, sagte Daleina, und ihre engelsgleiche Miene nahm einen ernsten Ausdruck an. »Aber versprechen kann ich es nicht, Mama.«
Daleina war zehn Jahre alt, als sich die Prophezeiungen aller Kinder erfüllten. Sie war zu einer Miniaturausgabe ihrer Mutter herangewachsen: Ihr Haar war von Strähnen in den Farben des Herbstlaubs durchzogen – Orange-, Gold-, Rot- und Brauntönen –, und ihre Hände waren von der Sonne gebräunt und rau und schwielig von all den Tagen, die sie damit zugebracht hatte, durchs Dorf zu klettern. Sie hatte die Aufgabe übernommen, sich um Arin zu kümmern, ihre jüngere Schwester, die erst vier war.
An diesem Nachmittag brachte Daleina ihre Schwester von der Schule nach Hause. Die Sonne fiel durch die Blätter und malte ein Muster aus grünen und gelben Schatten auf die Baumstämme, auf die Hütten und auf Daleinas nackte Arme und Beine, während sie die Äste hinaufkletterte.
»Komm schon, Arin, nicht trödeln!«, rief sie.
»Wenn ich mal älter bin als du, werde ich dir sagen, was du tun sollst.« Arin befestigte den Haken ihres Gurts an einem Ast und stemmte ihre pummeligen Beine dagegen. Vor Anstrengung blies sie die Wangen auf.
»Du kannst gar nicht älter sein als ich.«
»Kann ich doch. Ich habe einen Geburtstag und dann noch einen und noch einen, und dann werde ich dich einholen. Und dann bin ich größer als du. Mama hat das gesagt, weil ich nämlich meinen Haferbrei esse.«
Daleina beugte sich hinab und half ihrer Schwester, sich am nächsten Ast einzuhaken. Alle Wege durch das Dorf waren mit Halterungen und Haken versehen, um den ganz Jungen und den Hochbetagten zu helfen, die Pfade durch die Baumkronen zu bewältigen. »Kann schon sein, dass du mal größer wirst als ich, aber ich bin trotzdem älter. Ich werde immer älter sein. So läuft das eben.« Sie fand, dass sie sehr vernünftig klang.
»Das ist ungerecht!«
Oh nein, dachte sie, Wutanfall im Anmarsch. Mama sagte immer, dass Arin ihre Wutanfälle förmlich perfektioniert habe: Als Erstes verzog sie die Lippen zu einer mustergültigen Schnute, die wie ein Regenbogen geformt war, dann ließ sie wahre Tränenfluten auf ihren Wimpern zusammenströmen. Ihre rosigen Wangen liefen dunkel an, und während sie immer röter wurde, begann sie mit dem Wimmern. Sie schrie nicht, nicht draußen im Freien – das war zu gefährlich –, aber sie blökte wie ein geprügeltes Lamm, bis die Nachbarn herauskamen, um nachzusehen, wer denn da die arme, unschuldige und engelsgleiche Arin quälte. »Wenn du weinst, werfe ich dich den Holzgeistern zum Fraß vor«, erklärte Daleina. Es war die schrecklichste Drohung, die ihr einfiel.
Arins Augen wurden rund, der Kiefer klappte ihr herunter, und ihre Unterlippe zitterte.
Na großartig. Ich habe es nur noch schlimmer gemacht.
»Nein, das werde ich natürlich nicht tun«, fügte Daleina hastig hinzu. »Ich habe es nicht so gemeint. Aber bitte weine nicht, Arin.«
Da entdeckte sie den Holzgeist, über Arin, einige Bäume weiter vorn. Es war ein kleines Exemplar, dem helle Blätter aus der Haut ragten und in dessen Haar Beeren reiften. Seine Augen sahen aus wie Walnüsse, und seine langen Finger, die wie Zweige waren, krümmten sich um den Ast, auf dem er hockte. Er beobachtete sie.
»Komm, lass uns nach Hause gehen.« Sie musterte den Geist – er schien nicht näher zu kommen, aber es gefiel ihr nicht, dass er sie bemerkt hatte. Mama riet ihr immer, möglichst nicht die Aufmerksamkeit der Geister auf sich zu ziehen. Als Daleina fünf Jahre alt gewesen war, hatte ihr Onkel das Interesse eines aufmüpfigen Geistes erregt und war in seinem eigenen Obstgarten in Stücke gerissen worden. Der wild gewordene Geist war gefangen worden, und man hatte ihn zur Bestrafung zur Königin geschickt, aber das bedeutete nicht, dass man anderen Geistern trauen konnte. Hier, so weit entfernt von der Hauptstadt, stellten viele Geister den Befehl der Königin auf die Probe, der es ihnen verbot, Böses zu tun und Schaden anzurichten – das wurde zumindest behauptet, wann immer jemand unerwartet verstarb. »Ich bleibe hier bei dir, aber du musst versuchen, dich ein wenig zu beeilen, in Ordnung?«
Sie half ihrer Schwester, den Stamm einer dicken Eiche hinaufzuklettern, und hob sie dann hoch, damit sie sich auf die Brücke ziehen konnte. Mit baumelndem Rucksack langte Arin oben an, und Daleina kroch hinter ihr her und stand auf. Fast zu Hause. Sie atmete ein und füllte ihre Lunge mit dem Duft von Kiefern, modernden Blättern und frischer Wäsche und … ah, Lebkuchen! Mama hatte gebacken, wie sie es versprochen hatte.
Der Geruch nach Wäsche wehte von ihrer Nachbarin herüber. Tief unten, nahe den Wurzeln des Dorfbaums, stand die alte Frau Hamby auf zwei Ästen und hängte ihre Wäsche auf. Ihr Mann war auf dem Dach ihres Baumhauses und schob neue Amulette zwischen die Schindeln. Er winkte, als Daleina und Arin vorbeikamen. Daleina winkte zurück, und Arin wackelte ohne ersichtlichen Grund nur mit den Ellbogen.
»Sei nicht unhöflich«, schalt Daleina sie.
»Sei nicht langweilig«, gab Arin zurück.
Von weiter oben im Baum riefen einige ihrer Freunde Daleina zu, sie solle doch zu ihnen spielen kommen – Juju, Sarbin und Mina. Sie winkte hinauf und deutete auf ihre Schwester. Sie würden das Spielen verschieben müssen, bis sie Arin sicher zu Hause abgeliefert hatte. Mithilfe der Strickleitern kletterten Daleina und Arin an Herrn Yillit vorbei, der Nüsse zu Nussmehl stampfte. Der feine Staub klebte ihm an seinen haarigen Armen. Er lächelte und nickte den Schwestern zu. Seinen Gruß erwiderte Arin. Daleina wusste, dass ihre Schwester Herrn Yillit mochte, weil ihm ein Schneidezahn fehlte, genau wie Arin selbst. Zu ihrer Linken weiter oben sahen sie Rosasi, ihre Cousine zweiten Grades, die sich hoch über ihrem Haus in einer Astgabel ausgestreckt hatte. Ihre nackten Füße ragten in ein sonniges Fleckchen hinaus. Sie hatte einen Haufen Strickzeug auf dem Schoß, arbeitete aber nicht daran. Mama sagte oft, Rosasi sei allergisch gegen Arbeit. Aber sie erzählte hervorragende Geschichten über Königinnen und Thronanwärterinnen und deren Meister. Wenn Rosasi Arin abends ins Bett brachte, was sie manchmal tat, wenn Mama bis spät in die Nacht schnitzen musste, hörte Daleina ihr von ihrem Bett auf dem Speicher aus immer gerne zu.
Wie die anderen Häuser im Dorf war auch das Elternhaus von Daleina und Arin dicht mit den Ästen verwoben. Böden und Wände waren lebendige Teile des Baums selbst. Die Dorfgeschichte überlieferte, dass zwei Generationen zuvor eine Königin den Geistern befohlen habe, ihr Dorf aus einer Handvoll Eicheln wachsen zu lassen. Daleina wünschte, sie hätte das sehen können. Die einzige magische Macht, die sie jemals aus der Nähe erlebt hatte, war die der Dorfhexe, und deren Fähigkeiten beschränkten sich größtenteils auf das Herstellen von Amuletten, während das Erteilen von Befehlen nicht so ihre Sache war. Einen solchen Baum wie den ihren wachsen zu lassen … Ihr Baum beherbergte zwanzig Familien, in Häusern, die aus den dicken Ästen über und unter denen von Daleinas Familie hervorsprossen und sich spiralförmig an dem gewaltigen Baumstamm emporwanden. Leitern, Flaschenzüge und Brücken verbanden sie miteinander. Tagsüber wimmelte es im Baum von Menschen, die ihren Geschäften nachgingen und ihr Leben lebten, und nachts wurden überall Krüge voller Feuermoos angezündet und ließen den Baum aussehen, als sei er von Leuchtkäfern übersät. Mama pflegte zu sagen, es gebe bei Tag wie bei Nacht immer etwas Liebenswertes an ihrem Baum, und genauso auch in jeder Jahreszeit. Im Herbst wurden die Blätter rot und golden, und im Winter glitzerte Eis auf den Zweigen. Im Frühling ließen die Dorfbewohner in Kübeln und Trögen voller Erde Blumen wachsen; sie wucherten aus jedem Fenster und bedeckten jedes Dach. Und jetzt, im Sommer, war der Baum üppig und grün und schwer von reifenden Früchten. Mama meinte, es gebe in den Wäldern von Aratay Hunderte von Bäumen wie dem ihren, aber Daleina hatte ihr Dorf noch nie verlassen. Eines Tages, nahm sie sich vor, eines Tages werde ich fortgehen und andere Dörfer sehen, vielleicht eine Stadt, vielleicht sogar die Hauptstadt, vielleicht sogar das Land dahinter. Hoch oben im Norden, in der Nähe der Berge von Semo, stünden die Bäume wie Wachposten da, hieß es, mit weißen Ästen, die sich wie erhobene Arme kerzengerade ins Land streckten. Und im Westen, wo der Wald bis an die ungebändigten Lande heranreichte, seien die Bäume ein wildes Gewirr, so dicht, dass auf dem Boden darunter nichts wuchs. Es gab in Aratay sogar Gebiete, die man allein den Wölfen, Bären und Geistern überlassen hatte, und die seit langen Jahren von niemandem mehr betreten worden waren.
Ich will das alles sehen!
Mama erwartete sie auf ihrer Veranda. Als Arin sie sah, rannte sie über die Brücke und kletterte ohne jede Hilfe rasch die Leiter hinauf. Daleina folgte ihr.
»Hat es irgendwelche Schwierigkeiten gegeben?«, fragte Mama.
Daleina blickte zurück, aber sie sah den kleinen Holzgeist nicht, nur den dicken Blätterteppich und die Westbrücke. »Nein, aber Arins Lehrerin hat gesagt, dass Arin ihr Mittagessen nicht gegessen hat.«
»Petze.« Arin streckte Daleina die Zunge heraus.
»Arin, das ist unhöflich. Außerdem fängst du damit noch Fliegen, wenn du sie zu lange herausstreckst.« Mama tat so, als sei ihr Finger eine summende Fliege und bewegte ihn auf Arins Zunge zu, und Arin klappte den Mund schnell wieder zu. »Ich habe dir doch dein Lieblingsessen eingepackt. Warum hast du es denn nicht …«
Ein roter Tropfen klatschte auf Arins Wange. Sie griff sich ins Gesicht, nahm dann die Hand wieder weg und starrte auf ihre blutverschmierten Fingerspitzen.
Für einen Sekundenbruchteil starrten sie alle drei auf den Klecks, dann sagte Mama: »Rein mit euch. Sofort.«
»Mama, ich blute! Ich bin verletzt! Mama!«
Doch sie war nicht verletzt. Es war nicht ihr Blut. Es war von oben gekommen. Der Baum regnete Blut. Daleina lief zum Haus, während Mama Arin in die Arme nahm und mit ihr hineinrannte. »Wo ist Papa?«
Mama antwortete nicht. Sie schlug die Tür hinter ihnen zu, schob rasch den Riegel vor und lief dann nacheinander zu sämtlichen Fenstern, um sie zu verschließen. »Daleina, die Amulette, schnell!«
Daleina eilte an jedes Fenster und schob Amulette in die Ritzen. Sie drückte sie so fest hinein, dass ihr die Finger schmerzten.
»Mama, wo ist Papa?« Arin weinte, von Schluchzern geschüttelt.
»Schscht«, befahl Mama. »Ich weiß es nicht. Keine Bange. Er versteckt sich. Wir müssen ebenfalls drinnen bleiben. Leise.« Sie ließ sich auf die Knie fallen. »Bitte, Kleines, sei für mich ein braves, starkes Mädchen.« Arin hielt die Luft an und versuchte, ihr Schluchzen hinunterzuschlucken, aber es brach sich gleich wieder Bahn. Mama presste sie fest an ihre Brust und streichelte ihr durchs Haar. »Pst, pst … beruhige dich, Kleines, beruhige dich.«
Daleina stopfte Amulette unter die Tür und in den Kamin, füllte ihn damit aus, bis keine mehr übrig waren; dann lief sie zurück zu ihrer Mutter, um sich von ihr ebenfalls in die Arme nehmen zu lassen. Das Haus begann zu klappern und zu beben.
»Euer Papa versteckt sich. Macht euch keine Sorgen. Es wird alles wieder gut«, sagte Mama. »Die Geister werden uns nichts antun. Das wagen sie nicht. Die Königin wird es ihnen nicht erlauben. ›Tut nichts Böses‹, erinnert ihr euch? Das ist ihr Befehl. Ihr Versprechen. Ihre Pflicht. Vertraut auf sie. Glaubt an sie.« Sie wiegte sich hin und her, und Daleina und Arin klammerten sich an sie. Arin schniefte in ihre Bluse hinein, und Daleina vergrub das Gesicht im Haar ihrer Mutter. Die Schreie draußen klangen wie die Rufe eines verwundeten Habichts, die Daleina einmal gehört hatte, aber sie waren lauter und dutzendfach verstärkt. Die Wände zitterten, und das Holz des Bodens knackte und bekam Risse.
Mama drückte sie noch fester an sich.
Daleina sah zu, wie sich die Risse im Holz ausbreiteten und die Wände hinaufjagten, die daraufhin zerbrachen wie Eierschalen, während das Haus erbebte. Die Fenster klapperten, und Daleina sah draußen Schatten vorbeihuschen. Arin zitterte genauso heftig wie die Wände, aber sie hatte zu große Angst, um weiter zu weinen.
Etwas hämmerte an die Tür, und Arin wimmerte und vergrub sich tiefer im Schoß ihrer Mutter, wodurch sie Daleina zur Seite drängte. Daleina glaubte, die Stimme ihres Vaters zu hören.
»Papa?«, flüsterte Daleina.
»Bleib hier«, befahl Mama.
Daleina begann, sich von ihr wegzubewegen. Er rief. Oder nicht? Es war schwer, eine einzelne Stimme aus dem Lärm herauszuhören, aus dem Schreien und Brüllen, dem Krachen und Donnern. Sie konzentrierte sich und versuchte, die einzelnen Geräuschquellen voneinander zu trennen – dort, das war Papa! Sie hörte erneut das Hämmern an der Tür. Er war hier, dort draußen, versuchte hereinzukommen! Daleina riss sich von ihrer Mutter los und rannte zur Tür.
»Daleina, nein!«, rief Mama, die Stimme ein raues Flüstern.
»Es ist Papa!« Sie zerrte an dem Türriegel und zog ihn zurück.
Hinter sich hörte sie, wie Mama aufstand, aber sie wurde dabei von Arin gebremst, die wie ein Stachelbusch an ihr hing. Etwas drückte die Tür nach innen, dann stürzte eine Gestalt herein, knallte auf die Knie – Papa!
Ein Holzgeist von der Größe eines Eichhörnchens haftete an seiner Schulter und hatte ihm die Zähne tief ins Fleisch geschlagen. Papas Gesicht war nass und rot vor Blut, und Blut verklebte ihm auch das Haar. Er sprang sofort wieder auf, und der Geist packte ihn nur noch fester.
»Geh runter von ihm!«, schrie Daleina. Sie packte den Geist an der Hüfte, während Papa versuchte, sein Gesicht wegzudrücken. Die Krallen des Geistes zerrissen Papas Hemd und Brust. Eine Klaue schlitzte Daleinas Arm auf, und Blut quoll aus der Haut. »Lass ihn in Ruhe!«
Der Geist zischte und spuckte.
Und dann war Mama da, ein Nudelholz in der Hand. Sie schlug damit auf Kopf und Rücken des Geistes ein. »Verschwinde! Hinaus aus meinem Haus! Weg von meiner Familie!«
Der Geist verdrehte den Kopf und richtete den Blick auf einen Punkt hinter ihnen.
Arin.
Der Geist ließ Papa los und lief zu Arin hinüber, schneller als jemand ihn hätte packen können.
Arin kroch unter den Küchentisch und schrie, hoch und schrill.
Nein! Tu meiner Schwester nichts! Daleina kam es so vor, als schrie sie das mit all ihren Sinnen und ihrem ganzen Körper, als würden die Worte aus ihr herausgerissen und nach draußen gestoßen. »Halt!«
Und erstaunlicherweise gehorchte der Geist.
Er hielt mitten im Schritt inne. Dann wandte er den Kopf und sah Daleina an. Seine Augen waren rot vor Adern, die von seinen ebenfalls roten Pupillen nach außen verliefen. Er trat von einem dornenbesetzten Fuß auf den anderen und zischte.
»Geh weg!«, sagte Daleina. »Lass uns in Ruhe.«
»Noch einmal, Daleina«, sprach Mama mit leiser, seltsam gelassener Stimme auf sie ein. »Er hört auf dich.«
»Lass uns in Ruhe«, wiederholte sie.
»Noch einmal.«
Lass uns in Ruhe, lass uns in Ruhe, lass uns in Ruhe. »Geh!«
Der Geist riss den Blick von ihr los, sah wieder zu Arin hinüber. Er streckte seine spindeldürren Finger nach ihr aus, aber seine Füße bewegten sich nicht, als seien sie im Holz des Bodens verwurzelt.
»Lass uns in Ruhe!«, schrie Daleina. Sie legte alles, was sie an Angst und Wut im Leib hatte, in diese vier Worte hinein und trieb sie durch ihren Körper nach draußen. Es fühlte sich an, als zerbreche durch die Kraft des Schreis etwas in ihr.
Und als hätte der Schrei ihm einen spürbaren Stoß verpasst, rannte der Geist los und schlitterte zur Tür hinaus – und Daleina erhaschte einen Blick nach draußen. Die Brücken waren zerfetzt und hingen von den oberen Ästen herab, und das Haus, das ihrem am nächsten stand, war eingestürzt. Ein Mann in Grün rannte von Ast zu Ast, ein Schwert in der Hand. Bevor Daleina fragen konnte, was da geschah und wer dieser Mann war, hatte Papa die Tür zugeschlagen, und Mama schob den Riegel vor.
Das Haus erbebte immer heftiger, und Daleina hörte ein Kratzen auf dem Dach, als risse jemand die Schindeln herunter und zerfetze das Holz. Mama und Papa zogen den Küchenschrank vor die Tür, dann kippten sie den Tisch um und schoben ihn gegen eines der Fenster.
»Befiehl ihnen«, wies Mama Daleina an.
Daleina kniff die Augen fest zusammen und wiederholte: »Lasst uns in Ruhe, lasst uns in Ruhe, lasst uns in Ruhe.« Sobald sie die Worte ausgestoßen hatte, sank sie auf die Knie. Die Schreie draußen entfernten sich. Arin wimmerte, und Mama und Papa gaben sich alle Mühe, sie zum Schweigen zu bringen, und immer noch setzte Daleina ihre Beschwörungsformel fort. Das Kratzen auf dem Dach hörte auf.
Durch die Wände hörte sie noch immer schreckliche Laute von draußen, aber sie waren jetzt weiter entfernt.
Und dann endlich – nach sehr langer Zeit – herrschte Stille.
Daleina hatte Mühe, die Augen zu öffnen. Ihre Lider fühlten sich verklebt an, als seien sie zusammengeleimt worden. In der Ecke entdeckte sie ihre Familie. Ihr Vater hockte in sich zusammengesunken an der Wand und atmete schwer. Ihre Mutter drückte ihm ein Tuch fest auf den Arm. Das Tuch war rot durchweicht. Arin lag wie zu einem Ball zusammengerollt unter einem der Stühle. Die Tränen hatten Spuren auf ihren Wangen hinterlassen, sodass sie ganz nass und verschmiert aussahen. »Papa?«, fragte Daleina.
»Haben sie dir wehgetan, Ingara?«, erkundigte sich Papa und hielt nach jedem Wort kurz inne, um nach Luft zu schnappen. »Daleina? Arin?« Er versuchte, sich aufzusetzen, zuckte zusammen und hielt sich die Seite.
»Es ist ihnen nichts passiert, und du bist nicht tot, und ich will, dass das auch alles so bleibt. Sag mir, wie schlimm du verletzt bist«, befahl Mama.
»Das wird schon wieder.« Er schnaufte schwer.
»Lügner.«
Daleina stand mit wackligen Beinen auf. Sie sah zur Tür. Ein gezackter Riss verlief mitten hindurch. Als sie jetzt zur Tür ging, zitterten ihre Beine wie die eines neugeborenen Hirschs. Sie drückte das Gesicht an den Riss, versuchte hindurchzusehen und erblickte einen winzigen Schimmer: Sonnenschein und Grün, aber das war auch schon alles.
Sie drückte das Ohr gegen die Tür und lauschte.
Sie hörte kein Geschrei mehr. Und auch sonst nichts. Nur Stille. Furchtbare Stille, die irgendwie noch schlimmer war als all der Lärm zuvor. Daleina trat zurück und starrte auf die Tür.
Papas Atem war das lauteste Geräusch, das sie hören konnte.
»Du brauchst einen Heiler«, wandte sich Mama an Papa.
»Nein«, widersprach er.
»Es ist so still«, sagte Mama und stand auf. Daleina kam der Gedanke, dass sie ihre Mutter noch nie so gesehen hatte, so entschlossen und verängstigt zugleich, und in diesem Moment beschloss sie, dass sie genauso werden wollte wie Mama, wenn sie einmal groß war. »Was auch immer die Geister getan haben, sie sind jetzt fertig.«
Er packte ihr Handgelenk und hielt sie fest. »Oder sie warten darauf, dass wir uns in Sicherheit wiegen.«
Mama schob seine Hand weg. »Ich werde mich nie wieder in Sicherheit wiegen lassen.« Sie nahm das Nudelholz in die eine Hand und ein Küchenmesser in die andere – das lange Messer, das sie immer möglichst scharf hielten, um damit das Fleisch zu schneiden. »Mach die Tür auf, Daleina, langsam.«
Daleina holte tief Luft, schob den Riegel zurück und stieß die Tür einen Spaltbreit auf. Sie machte sich darauf gefasst, sie mit aller Kraft ihrer zehn Jahre wieder zuzuschlagen, aber nichts stemmte sich von außen dagegen. Sie zog die Tür Zentimeter um Zentimeter weiter auf und spähte nach draußen.
Was sie dort sah, ergab keinen Sinn.
Sie zog die Tür noch ein wenig weiter auf, schaute hinaus und versuchte zu begreifen. Da waren nur Bäume, Stamm für Stamm eines unbewohnten Waldes. Keine Brücken. Keine Häuser. Sie lehnte sich hinaus und blickte nach oben – all die höher liegenden Äste waren vom Baum gebrochen. Nur ihr Haus war noch daran befestigt. Sie schaute hinab, immer weiter hinab, bis ganz hinunter zum Waldboden. Ein Haufen zerbrochener Bretter lag dort unten kreuz und quer übereinander. Sie sah einen Stuhl und einen umgekippten Tisch. Kleider waren zwischen den Ästen verstreut, wie Bänder, die von einer Geburtstagsfeier übrig geblieben waren.
»Sind sie dort draußen?«, fragte Arin, die immer noch unter dem Stuhl kauerte.
»Nein«, antwortete Daleina. Ihr Mund war trocken, als hätte sie seit sehr langer Zeit kein Wasser mehr getrunken. »Dort draußen ist niemand.«
»Wie meinst du das: ›Dort draußen ist niemand‹?«, fragte Mama und schob Daleina zur Seite, sodass sie neben ihr in der Türöffnung stehen konnte. Seite an Seite schauten sie hinaus auf den unberührten Wald über den Trümmern. Der Sonnenuntergang nahte, und die Schatten zwischen den Bäumen waren lang. Es war windstill und nichts bewegte sich. Keine Geister. Keine Tiere. Keine Menschen.
Nichts.
»Hol unsere Heilausrüstung.«
Daleina rührte sich nicht von der Stelle.
»Sofort.«
Eilig lief Daleina zu dem Schrank über dem Spülbecken hinüber. Sie zog einen Korb heraus, der voller Verbandszeug, Stärkungsmittel, getrockneter Wurzeln und Kräuter war. Sonnenstrahlen fielen durch die Risse in dem verschlossenen Fenster über der Spüle, als sei draußen ein schöner, ganz normaler Tag. Daleina wollte das Fenster nicht öffnen.
»Mama?«, fragte Arin. »Was machen wir jetzt?«
»Zuerst versorgen wir euren Vater.« Mama kehrte zu Papa zurück, öffnete seine Weste und schälte ihm das Hemd von der blutigen Haut. »Und dann gehen wir hinaus und sehen nach.«
»Was sehen wir nach?«
»Ob irgendwer übrig geblieben ist«, antwortete Mama.
Arin fing wieder an zu weinen.
Wortlos half Daleina ihrer Mutter, Wasser vom Küchenspülbecken zu holen und außerdem Verbandszeug und Kräuter, wie es ihr aufgetragen worden war. Mama wusch die Wunden aus – es waren viele, an Papas Hals, Beinen und Armen. Seine dicken Kleider hatten einige der Bisse abgehalten, sodass er an diesen Stellen statt klaffender Wunden nur blaue Flecken hatte, aber es waren trotzdem so viele Verletzungen, dass sein einst weißes Hemd über und über mit roten Flecken besprenkelt war. Während Mama die Wunden versorgte, lauschte Daleina auf Geräusche von den Nachbarn – bestimmt hatte doch jemand gesehen, wie Papa verletzt hereingestürmt war –, aber niemand kam, um ihnen zu helfen. Sie dachte an den Mann in Grün, den sie gesehen oder sich eingebildet hatte.
»Geister dürfen den Menschen doch gar nicht wehtun«, sagte Arin, den Blick unverwandt auf die Verbände und Papas Hemd gerichtet. »Die Königin erlaubt es ihnen nicht.«
»Ich weiß, Kleines«, antwortete Mama.
»Warum hat sie es dann zugelassen?«, fragte Arin.
»Vielleicht konnte sie sie diesmal nicht aufhalten«, antwortete Daleina. »Vielleicht war sie krank oder abgelenkt. Vielleicht wusste sie nicht, was sie getan haben. Vielleicht haben die Geister einfach entschieden, dass wir zu weit von der Hauptstadt entfernt sind, als dass sie es erfahren würde.« Und vielleicht haben sie damit auch recht, setzte sie in Gedanken hinzu.
»Aber sie ist die Königin«, wandte Arin ein. »Sie hat die Aufgabe, uns alle zu beschützen.«
»Wir sind hier nicht sicher«, warf Papa ein. »Wir müssen die Waldwachen finden, bevor die Geister zurückkommen. Sie auf die Gefahr aufmerksam machen. Ihnen mitteilen, dass es vielleicht Dorfbewohner gibt, die Heiler brauchen.« Die Tatsache, dass Papa in der Lage war, so viel zu reden, ohne nach Luft zu ringen, tröstete Daleina, und sie fühlte sich ein wenig besser. Ihre Eltern waren bei ihr, heil und in Sicherheit, und sie würden für sie und Arin sorgen. Alles würde wieder gut werden, und irgendwann wäre das hier nur noch eine jener Geschichten, wie sie Rosasi abends erzählte.
Nachdem Mama Papa verbunden hatte so gut sie konnte, befestigte sie den Korb am Flaschenzug – an jenem, den sie für gewöhnlich dazu nahmen, schwere Vorräte vom Waldboden hochzuziehen – und kletterte hinein. »Alle einsteigen. Wir bleiben zusammen. Daleina …« Mama zögerte. »Die Geister haben auf dich gehört. Kannst du sie dazu bringen, wieder auf dich zu hören, wenn es sein muss?«
Alle drei sahen Daleina an, und sie zuckte unwillkürlich zurück. Nein, ihre Eltern sollten sich um sie kümmern, nicht andersherum! Sie hatte gerade erst angefangen, sich wieder sicher zu fühlen. »Ich … ich weiß nicht.« Sie hatte keine Ahnung, wie sie es angestellt und warum es funktioniert hatte. Sie hatte noch nie zuvor Geister befehligen können, und niemand in ihrer Familie hatte je irgendeine Art von Wesensnähe, eine Verbindung mit den Geistern gezeigt. Vielleicht war es einfach nur Glück gewesen. Oder ein Zufall. Vielleicht hatte es ja überhaupt nicht an ihr gelegen.
»Du kannst es«, bekräftigte Mama. »Du hast es einmal geschafft, und es wird dir wieder gelingen.«
Papa lächelte sie an – nur der schwache Schatten eines Lächelns, aber Daleina bemerkte es trotzdem, als sie zu Mama und Arin in den Korb kletterte. »Wir haben immer gewusst, dass du etwas Besonderes bist«, sagte er.
Arin schob die Unterlippe vor. »Ich bin auch etwas Besonderes.«
»Natürlich, Arin.« Er schenkte ihr ein Lächeln, diesmal ein echtes, während er ebenfalls in den Korb stieg. Und dann, als Mama den Korb hinunterließ, verschwand sein Lächeln.
Sie erkannten rasch, dass von den zwanzig Häusern, die bisher auf dem Dorfbaum gewesen waren, nur ihres übriggeblieben war. Alle anderen waren von den Ästen gerissen und zertrümmert und über den Waldboden verstreut worden. Küchentische, Vorratskammern, Nahrungsmittel, Schalen, Tassen … Betten, Kommoden, Spielzeug, Laken, Kleider … die Ausstattung von zwei Dutzend Häusern lag unter den Bäumen verstreut. Daleina sah die Wäscheleine der alten Frau Hamby, ihre Kleider darin verheddert und zusammengeknüllt. Und dann sah sie Frau Hamby selbst, ihr entstellter Körper ragte unter etwas hervor, was einst eine Tür gewesen war. Ihre Augen standen offen. Ihr fehlte ein Arm, und ihre Brust war … Daleina wandte den Blick ab. Der Korb senkte sich weiter hinab, und sie sah noch mehr.
Beine. Arme. Gesichter. Die Gesichter waren das Schlimmste.
»Schaut nicht hin«, sagte Papa, aber es war schon viel zu spät.
Rosasi. Die liebe, witzige, arbeitsscheue Rosasi, die so wunderbare Geschichten erzählen konnte. Ihre Kehle sah aus wie eine rote Blume. Ihre Hände umklammerten noch immer ihr Strickzeug.
Sie sah ihre Freunde: Juju, Sarbin … Mina sah sie nicht. Wollte sie auch nicht sehen. Aber sie konnte doch auch nicht aufhören, ihren Blick über das Chaos schweifen zu lassen, bis er an der Gestalt eines Mannes in Dunkelgrün hängenblieb. Er lebte und kam auf sie zu.
Zwei Männer und eine Frau begleiteten ihn, einer in Weiß gekleidet und zwei in Schwarz – ein Heiler und zwei Wachen. Der Mann in Grün hielt ein Schwert in der Hand. Sein Blick suchte die Äste über ihnen ab, während die anderen in den Trümmern herumstocherten.
»Hier drüben!«, rief Papa und winkte.
Als die Fremden sie erreichten, eilte der Mann in dem weißen Heilerumhang sofort zu ihrem Vater und untersuchte dessen Verletzungen. Die beiden Wachen bezogen rechts und links von ihnen Stellung, während der Mann in Grün ihre Familie und das unversehrt gebliebene Haus in Augenschein nahm. »Wer von euch hat die Verbindung?«, fragte er.
Mama und Papa deuteten auf Daleina. »Unsere Tochter, Herr«, antwortete Papa. »Aber wir haben bis heute nichts davon gewusst.«
Der Mann in Grün sah Daleina an, und sie hatte das Gefühl, als schaue er durch ihre Haut hindurch, um ihre Knochen einer Prüfung zu unterziehen. Seine Augen waren von einem blassen Wasserblau, und unter seinem schwarzen Bart war sein Gesicht mit Narben überzogen. Er hielt noch immer sein Schwert in der Hand, und Daleina sah, dass es mit Baumsaft überzogen war und rostrote Flecken aufwies. »Sie muss ausgebildet werden.« Ohne eine Antwort abzuwarten, befahl er den Wachen: »Nehmt sie zusammen mit den anderen Überlebenden mit.«
»Oh, Dank sei der Königin, es gibt noch andere!«, rief Mama.
Der Heiler legte ihr die Hand auf den Arm. »Ich fürchte, es sind nur wenige.«
»Dann sollten wir uns auch nicht bedanken«, bemerkte Arin und packte Daleinas Hand. Ihre plumpen Finger waren glatt und rutschig vor Schweiß, aber Daleina hielt sie fest. »Die Königin hat uns nicht geholfen. Wir sollten uns nicht bei ihr bedanken.«
»Sei ruhig, Arin«, herrschte Papa sie an.
»Daleina sollte Königin sein«, fuhr Arin fort. »Sie hat uns beschützt.«
Mutter legte Arin die Hand auf den Mund. »Arin! Still! Das hier ist ein Meister!«
Daleina starrte den Mann in Grün an – sie hatte noch nie zuvor einen Meister gesehen. Es gab nur wenige von ihnen, und sie waren verantwortlich für die Ausbildung der Thronanwärterinnen und für den Schutz der Königin. Sie hätte sich nie vorzustellen vermocht, dass einer in ihrem Dorf auftauchen würde – oder in dem, was von ihrem Dorf noch übrig war.
Für einen kurzen Moment stellte sie sich vor, wie er sie sich einfach schnappte, sie in die Hauptstadt mitnahm und zu seiner auserwählten Kandidatin erklärte. Genauso passierte das in den Geschichten: Ein Meister erschien in einem winzigen Dorf, unterzog die Kinder einer Prüfung und griff sich ein Mädchen heraus, das zur Thronanwärterin ausgebildet werden sollte. Diese Anwärterinnen wurden dann selbst zu Legenden, gründeten Dörfer, sicherten die Grenzen und hielten in enger Verbindung mit der Königin die Geister im Zaum. Sie stellte sich vor, im Palast zu sein, einen Kranz aus goldenen Blättern auf dem Kopf und ihre Familie bei sich, dank ihrer Macht in Sicherheit. Nie wieder würden sie sich voller Angst in einer Hütte auf einem Baum zusammenkauern.
Ihre eigene Geschichte hätte genau in diesem Moment beginnen sollen. Das Schicksal hatte entschieden, dass angesichts der Tragödie in ihrem Dorf ihre Macht erwachte, und der Zufall hatte den Meister genau in dem Moment, in dem die Geister angriffen, in die nahen Bäume geführt; zu spät, um das Dorf zu retten, aber doch rechtzeitig, um Daleina kennenzulernen. Dieser Moment hätte der Beginn einer Legende sein sollen, der Augenblick, in dem er ihre Anlagen erkannte und sie sich mit offenen Armen ihrer Zukunft stellte.
Aber so war es nicht.
Der Meister sah von ihr weg, ließ seinen Blick über das zerstörte Dorf und die zerfetzen Leiber schweifen. »Nur die Besten können Königin werden. Und sie ist nicht die Beste.« Daleina spürte seine Worte wie Ohrfeigen, dann versetzte er ihr auch noch den schlimmsten Schlag von allen: »Wenn sie es wäre, würden diese Menschen noch leben.«
Kapitel 2
Meister Ven kniete in den Ruinen des Dorfes und durchsuchte die Trümmer. Dabei zog er eine kaputte Puppe aus dem Schutt, deren rosafarbenes Kleid voller Schmutz und deren getöpfertes Gesicht zerbrochen war.
Es gab immer eine kaputte Puppe.
Warum musste es nur immer so eine verdammte Puppe geben?
Andere Dinge störten ihn nicht – das zerbrochene Geschirr, die Bettlaken, die Kleider, all diese Zeugnisse gelebter Leben, die ein abruptes Ende gefunden hatten. Aber die Puppen gingen ihm jedes Mal unter die Haut. Früher hatte er sie gesammelt, nach jedem Unglück, und er hatte sie zu einem Spielzeugmacher gebracht, um sie reinigen zu lassen, und sie dann einem Kind in den nächsten Dörfern geschenkt. Doch nach einer Weile hatte er entschieden, dass das allzu makaber war.
Er warf die Puppe zur Seite. Es gab nicht viele Überlebende. Zwei Kinder. Eine Handvoll Erwachsene. Man hatte sie in ein anderes Dorf gebracht, ihnen ein neues Zuhause und ein neues Leben gegeben. Das ältere Mädchen würde ausgebildet werden und eines Tages vielleicht die Dorfhexe irgendeines kleinen Fleckens sein. Wenn sie Glück hatte, würde sie so etwas wie das hier nie wieder erleben. Aber sie würde immer Albträume haben.
Ven kannte sich mit Albträumen gut aus. Er verabscheute den Schlaf. An einem Tag wie diesem mochte er es allerdings auch nicht besonders, wach zu sein. Er straffte sich und gestand sich ein, dass er keine weiteren Überlebenden finden würde. Und die Geister würden auch nicht zurückkommen, um ihm zu erlauben, ihnen eine noch heftigere Niederlage zuzufügen.
Er wünschte, er könnte die Verantwortlichen aufspüren und sie für ihr Tun bezahlen lassen oder sie zumindest dazu bringen zu verstehen … Aber sie würden nie verstehen, dass das, was sie getan hatten, falsch war, und diese Geister zu vernichten würde nur dem Wald schaden und weiteren Menschen ihr Zuhause rauben.
»Meister Ven?« Es war eine der Wachen. Er hatte den Namen der Frau vergessen. Sie bevorzugte die Axt, auch wenn sie ihre rechte Seite beim Kämpfen einen Wimpernschlag zu lange ungeschützt ließ. Sie war eine ordentliche Messerwerferin und hatte einen leichten Schlaf, und sie wachte oft auf, um nach ihrem Lager zu sehen. Er reiste jetzt seit fünf Tagen mit ihr. Konnte sich ihren Namen immer noch nicht merken. »Die Überlebenden wollen die Toten begraben.«
Er schüttelte den Kopf. »Darum wird sich die Königin kümmern.« Sie würde den Erdgeistern gestatten, sich das Dorf einzuverleiben und dann die Umgebung mithilfe von Wassergeistern reinigen.
Die Wachfrau stieß mit dem Fuß ein Holzstück beiseite. Darunter kam eine Hand zum Vorschein, grau und blutleer. Die Leichenstarre setzte bereits ein. »So, wie sie sich zu Lebzeiten um sie gekümmert hat?«
Ven zog beide Augenbrauen hoch. Er wusste, dass dieser Gesichtsausdruck die meisten Menschen verstummen ließ. Doch diese Wachfrau war aus härterem Holz geschnitzt, oder aber die Gründlichkeit, mit der die Geister das Dorf zerstört hatten, hatte sie so sehr beunruhigt, dass selbst seine grimmigste Miene ihr nichts mehr ausmachte. Dieses Dorf – wie war noch gleich sein Name gewesen? Graubaum? – mochte weit in den Randbezirken gelegen haben, aber es hatte sich doch innerhalb von Aratays Grenzen befunden. Es hätte sicher sein sollen.
Die Wachfrau erwiderte Vens Blick ohne mit der Wimper zu zucken. »Ist sie womöglich tot?«
Das ließ ihn aufschrecken und vor seinem inneren Auge erschien der Leichnam der Königin, entstellt und zerstört wie die toten Körper dieser Dorfbewohner. Aber es war eine berechtigte Frage – nach dem Tod einer Königin drehten die Geister immer durch, bis die Thronanwärterinnen die Krönung einer neuen anberaumten und den Geistern ihre Macht nahmen. »Ich habe keine Glocken gehört.« Ein dreifaches Läuten beim Tod einer Königin, überall im Wald widerklingend. »Selbst wenn sie gestorben wäre, gäbe es viele tüchtige Thronanwärterinnen.« Sollte Königin Fara sterben, würden sie sich der Krönungszeremonie unterziehen, und eine von ihnen würde die Befehle der Königin erneuern. Dafür existierten die Thronanwärterinnen und nur deshalb gab es auch die Meister. Die Meister entdeckten mögliche Thronanwärterinnen und bildeten sie aus, um sicherzustellen, dass Aratay immer eine Königin hatte und dass die Geister immer beherrscht wurden.
Nur dass sie hier nicht beherrscht worden sind, dachte Ven, und die spitze Bemerkung der Wachfrau hallte in ihm nach.
Er fluchte leise, aber doch sehr energisch und anschaulich vor sich hin.
Wenn er sicherstellen wollte, dass so etwas nicht noch einmal geschah, musste er herausfinden, warum es hier geschehen war, warum sich die Geister der Königin widersetzt hatten, und im äußeren Wald würde er keine Erklärungen dafür finden. Er musste in die Hauptstadt zurückkehren, mit Fara reden und feststellen, warum ihre Schutzmaßnahmen versagt hatten. Er war ein Meister. Er war für das alles verantwortlich. Es war die einzige Möglichkeit, die Antworten zu finden, die er brauchte, die Antworten, die diese Menschen verdient hatten. »Ich werde mit der Königin sprechen.«
»Man muss sie davon in Kenntnis setzen«, pflichtete ihm die Wachfrau bei.
»Sie wird nicht erfreut sein, mich zu sehen. Ich bin im Palast nicht willkommen.« Er zuckte zusammen. Ihm wurde bewusst, dass seine Worte einem Jammern gefährlich nahekamen, und so etwas stand einem Meister nicht gut zu Gesicht, erst recht nicht unmittelbar nach einer Tragödie, die er nicht zu verhindern vermocht hatte. Mit strengerer Stimme fügte er hinzu: »Sorgt dafür, dass die Überlebenden sicher untergebracht werden, und setzt die Kontrollgänge dann fort. Ich komme so bald wie möglich zurück.«
»Passt auf, dass ihr nichts Wertvolles zerbrecht.«
»Es war ein Unfall«, knirschte er.
»Ihr habt ihre Krone zerbrochen.«
»Ich glaubte, sie würde angegriffen!«
»Sie ist die Königin«, sagte die Wachfrau mit Nachdruck. »Sie hätte sich gegen einen tückischen Zweig verteidigen können.« Die Krone der Königin bestand aus ineinander verflochtenen lebendigen Zweigen, an denen in jedem Frühling Blumen wuchsen und in jedem Sommer Blätter, obwohl sie keine Verbindung zum Boden hatten. Er hatte geglaubt, die Krone wende sich gegen ihre Trägerin. Er wünschte, diese Geschichte hätte niemals die Runde gemacht. Es ließ ihn wie einen Idioten dastehen. Nur weil er sich damals wie ein Idiot benommen hatte, brauchte nicht ganz Renthia davon zu erfahren.
»Benachrichtigt mich, wenn es weitere Angriffe gibt«, sagte er.
Die Stimme der Wachfrau wurde ernst. »Beeilt Euch, Meister Ven.«
Er nickte knapp, dann lief er zum nächsten Baumstamm. Mithilfe der am Baum übrig gebliebenen Halterungen kletterte er hinauf und schaute nur noch ein einziges Mal zurück. Er sah die Wachfrau in den Trümmern knien und die zerbrochene Puppe aufheben.
In Mittriel, der Hauptstadt von Aratay, das im Herzen Renthias lag, glänzten die weißen Äste des Palastbaums im Mondlicht. Die Schatten wirkten hier weicher, und Ven hatte das Gefühl, nach Hause zu kommen, obwohl er diesen Ort hasste.
Er war durch die Baumkronen gereist und hatte nach anderen Zeichen von Unruhe unter den Geistern Ausschau gehalten, aber nichts Ungewöhnliches bemerkt. In jedem Dorf und jeder Stadt lebten Männer und Frauen ihr Leben ohne Angst – oder doch zumindest nicht mit größerer Angst als sonst. Wenn man von vernunftlosen, mächtigen Kreaturen umringt lebte, deren erster Instinkt darin bestand, einen zu ermorden, war ein wenig gesunde Angst ganz normal. Nicht einmal Meister waren ohne Angst. Wir haben nur größere Messer, dachte Ven.
Ven hockte auf einem Ast direkt außerhalb des Palastbereichs und beobachtete die Geister, die der Königin dienten. Heute Abend schienen es mehr als sonst zu sein, oder vielleicht nahm er sie einfach nur stärker als sonst wahr. Es hatte ihm nie gefallen, wie sie die Königin umschwärmten, ganz so als seien sie ihr treu ergeben und als würden sie ihr nicht mit Freuden sofort die Kehle aufreißen, sollte ihr die Kontrolle über sie jemals entgleiten. Über dem Nordturm jagten zwei Luftgeister ein Banner um einen Mast herum, schlangen es darum, wickelten es dann wieder ab und spielten mit dem Wind. Auf der Wendeltreppe zündete ein Feuergeist die Kerzen an und tanzte mit jeder Flamme. Unten kümmerten sich Erdgeister um den Rosengarten der Königin und ließen die schwarzen Rosen für die Nacht aufblühen.
Vielleicht war das Verderben, das dieses Dorf heimgesucht hatte, ein einmaliger Ausrutscher gewesen. Vielleicht würde Königin Fara einfach ihre Willensherrschaft über die Schuldigen erneuern, sobald er ihr Bericht erstattet hatte, und der Fall wäre erledigt. Er hoffte, dass der Vorfall nicht darauf hindeutete, dass sich unter der prächtigen Fassade aus Schönheit Fäulnis verbarg.
Fäulnis unter der prächtigen Fassade.
Es klang richtig poetisch, wenn er es so betrachtete. Offensichtlich hatte er zu viel Zeit damit verbracht, den Baumkronensängern zu lauschen, und nicht genug Zeit damit, Dinge zu Kleinholz zu zerschlagen. Nach der Audienz mit Königin Fara würde er sich einige Stunden Zeit nehmen, in einen Übungsring steigen und sich dieses ganze Melodrama aus dem Kopf schlagen.
»Die Königin wünscht zu wissen, ob Ihr Euch in ihren Bäumen versteckt, weil Ihr zum Meuchelmörder geworden seid, oder ob Ihr vorhabt, hereinzukommen und ihr Eure Aufwartung zu machen.« Die Stimme knisterte wie der Wind zwischen getrockneten Blättern, und Vens Nackenhaare stellten sich auf. Er drehte sich um und sah einen Luftgeist kopfüber von einem Blatt baumeln. Seine durchscheinenden Flügel schlugen schnell wie die eines Kolibris, und seine in vielfachen Facetten schillernden Augen huschten nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Er konnte es nicht ausstehen, wenn sie Geister sandte, die für sie sprachen.
»Richte ihr aus, dass ich meine Wahlmöglichkeiten abwäge.«
Die Flügel des Geistes flatterten schneller, und Ven roch die Süße von Glyzinien und auch von Wein. »Die Königin versteht keinen Spaß, wenn es um Euch geht.«
Er seufzte. »Dessen bin ich mir bewusst. Ich hätte gern eine Audienz bei Königin Fara, im Blauen Zimmer. Sei so gut und bitte Ihre Majestät, ihre Bogenschützen daran zu hindern, mich aufzuspießen.«
»Sie wird ihre Möglichkeiten abwägen.«
Der Luftgeist schoss empor und ließ die Blätter hinter sich rascheln. Ven kletterte höher hinauf, um einen der spinnwebdünnen unzerreißbaren Drähte zu erreichen, die von den äußeren Bäumen bis zum Zentrum des Palasts gespannt waren. Er befestigte einen Haken daran und hoffte, dass der Geist seinem Wunsch entsprochen hatte. Die Bogenschützen der Königin waren wachsam und schießwütig, eine Tatsache, die er zu schätzen gewusst hatte, solange er für die Verteidigung verantwortlich gewesen war. Er wickelte ein Seil um den Haken und um seine Handgelenke. Dann stieß er sich mit den Füßen ab und glitt an dem Seil durch die Luft. Der Wind pfiff ihm um die Ohren. Es flogen keine Pfeile.
Er landete mit einem dumpfen Aufprall, hakte sich los und befreite sich von dem Seil. Er richtete sich auf und Applaus ertönte. Von Wachen flankiert, kam die Königin ihm entgegen und klatschte in die Hände. Sie trat so weit vor, bis sie ganz in Mondlicht gehüllt war. Sie war wie immer von makelloser Schönheit, von Kopf bis Fuß, über ihre ganze Größe von etwa einem Meter achtzig hinweg. Ihre Locken fielen ihr in einer kunstvollen Frisur über die nackten Schultern, und sie trug ein blauweißes Gewand, das aussah, als sei es aus einem Mondstrahl gewebt worden. Auf ihrem Kopf prangte ein neues Diadem, eine grazile Metallranke mit einer einzelnen Perle, die ihr auf die Stirn herabhing. »Ihr habt schon immer gewusst, wie man einen gelungenen Auftritt hinlegt.« Er hatte sie kurz nach ihrer Krönung kennengelernt. Er war damals ein neuer Meister gewesen, aber sie hatte schon zu jener Zeit die majestätische Ausstrahlung einer Königin gehabt.
»Das Gleiche gilt für Euch.« Er ließ sich auf ein Knie sinken und verneigte sich. »Euer Majestät.«
»Oh, steht auf, Dummerchen. Wir sind alte Freunde. Oder habt Ihr das etwa vergessen?« Sie streckte die Arme aus, als erwarte sie von ihm, dass er sie an sich drückte wie eine liebe Cousine. Ihre bis zu den Ellbogen geschlitzten Ärmel fielen an den Seiten herunter. Als er die nackte Haut sah, erinnerte er sich daran, wie er sie früher in den Armen gehalten hatte – auf eine Art und Weise, an der rein nichts an Cousins und Cousinen erinnert hatte. Ihre Wangen verfärbten sich rosa, und er wusste, dass sie sich ebenfalls erinnerte. Gefährliche Gedanken.
Statt sie zu umarmen, blieb Ven knien. »Meine Königin, ich bringe ernste Neuigkeiten.«
»Und da hatte ich gehofft, Ihr würdet mich um alter Zeiten willen besuchen.« Ihre Stimme klang sehnsüchtig, aber Ven traute ihr nicht. Sie war eine wahre Meisterin darin, ihre echten Gefühle zu verbergen. Er wusste, dass sich hinter einer freundlichen Begrüßung wie dieser auch mörderischer Zorn verbergen konnte. Oder zumindest ernsthafte Verärgerung. Bei ihrer letzten Begegnung war sie jedenfalls »verärgert« genug gewesen, um ihm einen Feuergeist auf den Leib zu hetzen. Die Verbrennungen hatten dauerhafte Narben auf seinen Armen zurückgelassen, und sie hatte den Geist erst zurückgerufen, als Ven ihn fast getötet hatte.
»Ich bin in den Randbezirken gewesen und habe die Baumkronendörfer besucht …«
»Wozu denn das?«, fragte Königin Fara. »Ihr habt bereits eine Thronanwärterin für mich gefunden. Entzückendes Mädchen. Sana, nicht wahr? Oder Sata? Sie ist unablässig mit ihrer weiteren Ausbildung beschäftigt. Offen gesagt, es ist fast schon ein wenig beleidigend für mich – als erwarte sie, dass ich jeden Moment tot umfalle. Ihr solltet Eure Kandidatinnen lehren, mehr Vertrauen in ihre Königin zu setzen.«
»Ich bilde sie dazu aus, allzeit bereit zu sein, und hoffe zugleich, dass sie diese Ausbildung niemals brauchen werden.«
»Ah, da haben wir ihn ja wieder, den bezaubernden Ven, den ich vermisst habe. Verratet mir doch, was habt Ihr in diesen Dörfern im abgelegenen Hinterland entdeckt? Dass die dortigen Waldbewohner ihr tägliches Bad öfters auslassen? Ein völliges Unverständnis, wie man genießbare Speisen zubereitet? Ich schwöre, wenn ich noch eines dieser gekochten Gemüsegerichte hätte essen müssen, dann …«
»Den Tod, Euer Majestät. Eure Geister haben Euch hintergangen und ein ganzes Dorf niedergemetzelt.« Er bemühte sich, gefasst zu klingen, wollte die Neuigkeiten einfach nur berichten und sie nicht noch einmal durchleben. Er hatte auch zuvor schon die Folgen von Naturkatastrophen gesehen – von Waldbränden, Erdbeben und Winterstürmen; Verwüstungen, die zerschmetterte Leiber und zerstörte Häuser mit kaputten Puppen hinterlassen hatten –, aber dies … dies war das schlimmste Beispiel einer wohlüberlegt ausgeführten Zerstörung gewesen, das er je erlebt hatte.
Königin Fara erstarrte. »Ihr plaudert ganz ruhig mit mir und erzählt mir das schließlich so beiläufig?«
»Es besteht keine unmittelbare Gefahr. Die Überlebenden sind in Sicherheit gebracht worden, und die Geister sind in die Tiefen des Waldes geflohen. Die Waldwachen behalten die anderen Dörfer im Auge, aber bisher hat es keine Hinweise darauf gegeben, dass sich diese Tragödie wiederholen wird. Meine Sorge ist: Wie konnte das überhaupt passieren?«
»Da habt Ihr recht.« Sie gab ihren Wachen ein Zeichen. »Ich spreche mit Meister Ven im Blauen Zimmer. Sorgt dafür, dass man uns nicht stört.« Ohne eine Antwort abzuwarten – es war nicht nötig zu warten, sie war schließlich die Königin –, rauschte sie durch den Flur auf das Innere des Baums zu. Ven folgte ihr. Ein winziger Feuergeist huschte im Gang auf und ab und zündete vor der Königin die Kerzen an, um sie dann hinter ihr wieder auszumachen. Dabei sah es so aus, als lösche ihr Schatten die Flammen. Hübscher Effekt, dachte er.
Die Wachen eilten ihr voraus und rissen die Doppeltüren zum Blauen Zimmer auf. Dann bezogen sie beiderseits der Tür Stellung und nahmen Haltung an – die Knie leicht gebeugt, die Glieder gelockert, die Schwertgriffe in Reichweite ihrer kampfbereiten Hände –, während Ven und die Königin eintraten. Er spürte die Blicke der Wachen auf sich, wie sie eine Bestandsaufnahme seiner Waffen machten und den Abstand zwischen der Königin, seinem Schwert und ihren eigenen Schwertern berechneten. Als Meister durfte er in Anwesenheit der Königin Waffen tragen. Das brauchte den Wachen jedoch nicht zu gefallen, und als jemand, der sich dem Wohlergehen der Königin verschrieben hatte, konnte Ven ihnen ihr Misstrauen nicht übelnehmen.
Das Blaue Zimmer war in Gerüchten und Geschichten bekannt als das »Totenglöckchenzimmer« – man bat nur dann um eine Unterredung dort, wenn man eine Privataudienz über ernste Belange wünschte. Der Legende zufolge hatte eine Königin aus lang vergangenen Zeiten in diesem Zimmer vom Tod ihres Sohnes erfahren und verfügt, dass innerhalb der Wände dieses Raumes von jenem Moment an nur noch über bevorstehende oder vergangene Tode gesprochen werden dürfe. Eine Fassung dieser Geschichte behauptete, dass in Wirklichkeit er es gewesen sei, der sie getötet habe. Eine andere berichtete, dass der Sohn der Königin hier gestorben sei, in ihren Armen, und dass ihre Tränen die Wände blau gefärbt hätten. Letzteres entsprach zweifellos nicht der Wahrheit, denn Ven wusste, dass der Baumsaft blau gefärbt worden war, als er aus den Wänden ausgetreten war, und mit dem Verhärten hatte er einen blauen Schimmer angenommen, der im Kerzenlicht glitzerte und flimmerte. Aber wer wollte es schon nüchtern und sachlich, wenn er stattdessen deftige Gerüchte haben konnte? Er folgte Königin Fara in den Raum hinein.
Das Totenglöckchenzimmer war ein kleines Achteck, das in das Kernholz des Baums geschnitzt worden war. Königin Fara schlug die Schleppe ihres Kleides so zusammen, dass sie zu ihren Füßen in Falten lag, und nahm auf dem polierten blauen Thron, der an einer der Wände stand, Platz. »Lasst uns allein«, befahl sie den Wachen. Sie verneigten sich und schlossen hinter sich die Tür.
Ven wurde bewusst, dass es keine Fenster in diesem Zimmer gab. Wenn sie ihm einen Geist auf den Hals hetzte, würde er kämpfen müssen, wieder einmal. Aber soweit würde es nicht kommen. Das heute war kein Privatbesuch, und er verspürte kein Verlangen, ihren alten Streit erneut aufleben zu lassen. Er war lediglich ein Überbringer von Nachrichten.
Hoffte er jedenfalls.
»Erzählt mir alles«, befahl sie.
Er berichtete ihr, dass er zehn Meilen von Graubaum entfernt gewesen sei, als er bemerkt hatte, dass die gewohnten Geister ringsum fehlten. Und nicht nur das: Die Tiere des Waldes hatten sich versteckt, und die Vögel waren verstummt. Er war dem Schweigen gefolgt, aber als er den Ort gefunden hatte, von dem es ausging, war das Gemetzel schon fast vorüber gewesen. Die Geister hatten jeden getötet, den sie hatten finden können, bis hin zu den Neugeborenen, und sie hatten die Häuser aus ihren Ästen gerissen. Er hatte gegen die verbliebenen Geister gekämpft und die Waldwachen zu Hilfe gerufen. Zwei hatten sich ganz in der Nähe befunden – er war während der vergangenen Woche immer mal wieder mit ihnen gereist –, und ein Heiler kam hinzu. »Ihnen ist ein Großteil des Erfolgs zuzuschreiben.«
»Ihr stellt Euer Licht unter den Scheffel«, murmelte Königin Fara. »Ihr seid ein Held, den es zu den Schutzlosen zieht, um ihnen zu Hilfe zu eilen. Das ist bewundernswert.« Aber es klang nicht so, als mache sie ihm Komplimente oder als höre sie ihm auch nur zu. Sie starrte die Wände an und presste die Lippen zusammen.
Ven wartete ab, während sie nachdachte. Früher hatte er geglaubt, er könne erkennen, was sie dachte; doch mittlerweile machte er sich da nichts mehr vor.
»Habt Ihr mir alles mitgeteilt?«
»Eine Familie hat überlebt, sie hat sich selbst zu retten vermocht. Die ältere Tochter, die bisher offenbar noch nie hat erkennen lassen, dass sie mit den Geistern in Verbindung treten kann, hat ihr Zuhause unversehrt gehalten. Ich habe empfohlen, sie ausbilden zu lassen.«
»Wie alt?«
»Ungefähr neun.« Er dachte noch einmal an das Mädchen zurück. Sie hatte ihrer Mutter bis an die Schulter gereicht und noch immer die runden Wangen eines Kindes gehabt. Energisch, aber voller Angst – und das zu Recht. »Vielleicht auch zehn.«
»Und sie lässt jetzt erst ihre Fähigkeiten erkennen? In so einem Fall hätte sie nicht zu ihnen gesprochen.«
Er nahm an, dass sie die Geister meinte. Es bedurfte einer besonderen Ausbildung und besonderer Fähigkeiten, um Geister zu beschwören, die hoch genug entwickelt waren, um der Sprache fähig zu sein, und einer noch größeren Begabung, um sie außerdem dazu zu zwingen, selbst dann zu kommunizieren, wenn sie das von sich aus nicht wollten. »Sie konnte niemanden außer ihrer Familie beschützen. Ihr Einfluss endete an den Wänden ihres Hauses. Eines Tages wird sich irgendein Dorf glücklich schätzen, sie als Dorfhexe zu haben, obwohl ich bezweifle, dass sie die Umstände, unter denen sie ihre Fähigkeiten entdeckt hat, jemals als ein Glück betrachten wird.«
»Gut. Und habt Ihr mir jetzt alles berichtet?«
Er ging im Geiste die Einzelheiten noch einmal durch. »Ja, Euer Majestät.«
»Dann werde ich Erdgeister ausschicken, um das Dorf zu vergraben, und ich werde seinen Namen von den Karten löschen.« Sie seufzte, wehmütig, dachte Ven, was nach einem derartigen Massaker eine merkwürdige Empfindung war. Ven hatte Betroffenheit erwartet, Empörung oder sogar Unglauben. »Ich wünschte nur, ich könnte auch Eure Erinnerung aus Eurem Gedächtnis löschen. Glaubt mir, wenn ich Euch sage, ich wünschte, es hätte nicht gerade Euch getroffen.«
»Euer Majestät, es könnte auf ein größeres Problem hindeuten, das …«
»Es gibt kein ›größeres Problem‹.«
Er wollte es dabei bewenden lassen – er hatte seine Königin informiert, seine Pflicht war erfüllt –, aber er dachte an die kaputte Puppe und daran, wie die kleine Schwester des Mädchens von der Königin gesprochen hatte. »Wir müssen herausfinden, warum die Geister Euch den Gehorsam verweigert haben, als …«
»Die Geister haben mir nicht den Gehorsam verweigert, Ven.« Königin Fara erhob sich. Auf dem Thronpodest stehend, ragte sie hoch über ihm auf, und ihr Schatten erstreckte sich blau durch den Raum. »Sie verweigern mir niemals den Gehorsam, und Ihr dürft auch niemals dahingehende Andeutungen machen. Es würde das Vertrauen unseres Volkes schwächen und uns alle in Gefahr bringen.«
Er wusste ihr Selbstbewusstsein zu schätzen, doch er hatte die Beweise mit eigenen Augen gesehen. »Aber …«
»Es gab Verräter in diesem Dorf, mehrere, die sich gegen Aratay verschworen hatten, gegen uns. Es war ein Nährboden für Verrat. Ich habe diese Bedrohung ausgeschaltet.« Sie trat näher an Ven heran, und ihr Gewand streifte über den Boden. Dann legte sie Ven die Hand auf die Wange und fügte hinzu: »Es tut mir leid, dass Ihr Zeuge davon wurdet. Aber es tut mir nicht leid, getan zu haben, was getan werden musste. Eine Königin muss für das höhere Wohl Opfer bringen.«
Ven wich zurück, sodass sich ihre Hand von seiner Wange löste. Er hatte das Gefühl, als sei die Haut an der Stelle, an der sie ihn berührt hatte, verbrannt, und er glaubte ihr nicht. Sie konnte dieses Unglück nicht selbst herbeigeführt haben. Sie wäre niemals so weit gegangen. »Dort waren Kinder. Alte. Unschuldige. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das ganze Dorf des Hochverrats schuldig war.«
»Genügend von ihnen waren es. Es musste getan werden.«
»Es hätte einen anderen Weg geben müssen!«
»Erregt Euch nicht, Ven …«
»Ich bin sehr erregt!« Ven ging im Blauen Zimmer auf und ab. Er wollte ihr nicht länger in die Augen sehen müssen, in ihre schönen, unschuldigen Augen. Sie war nicht dort gewesen. Sie verstand den Schrecken nicht, den die Geister anrichten konnten … Nur, sie muss es verstehen, dachte er, denn sie ist die Königin. Er wusste, wie umfassend ihre Ausbildung gewesen war. »Es ist Eure Aufgabe, Euer Volk vor den Geistern zu beschützen, Euer ganzes Volk. Ihr dürft die Geister nicht gegen Eure Untertanen wenden! Niemals. Ganz gleich, welches Verbrechen begangen wurde. Ganz gleich, welche Gefahr auch drohen mag.«
»Ach, Ihr seid so ermüdend, Ven. Ich habe getan, was ich tun musste. Glaubt Ihr, ich hätte keine Schuldgefühle? Würde keinen Kummer empfinden? Keinen Zorn? Glaubt mir, das tue ich! Ich finde es furchtbar, dass ich solche Entscheidungen treffen muss, aber ich laufe nicht vor ihnen davon. Wie Ihr es getan habt, als Ihr zu den äußeren Dörfern geflohen seid – versucht nicht vorzugeben, es sei keine Flucht gewesen. Ich bleibe und tue, was das Beste für mein ganzes Volk ist, nicht nur für einige wenige, nicht nur für mich selbst und nicht nur für jene, die ich am liebsten habe. Das eben bedeutet es, Königin zu sein.«
»Es muss einen anderen Weg gegeben haben!«, wiederholte er.
»Es ist der beste Weg für unser ganzes Volk gewesen.«
»Woher habt Ihr überhaupt gewusst, dass es dort Verräter gegeben hat, die …«