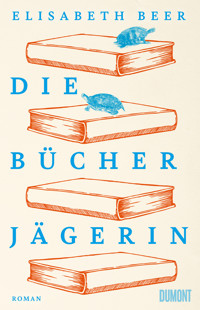
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sarah ist Bücherjägerin, Kartensammlerin und Restauratorin, sie liebt Manuskripte und alte Landkarten und kann generell besser mit Büchern als mit Menschen umgehen. Seit dem Tod ihrer Tante Amalia, die sie und ihre Schwester aufgezogen hat, lebt Sarah zurückgezogen in deren Kölner Villa mit dem wild sprießenden Garten. Ihre einzige Gesellschaft: die Schildkröten Bonnie und Clyde. Das ändert sich, als Benjamin, ein junger Bibliothekar aus London, vor der Tür steht. Er bittet Sarah, ihm beim Finden einer alten römischen Straßenkarte zu helfen ein Auftrag, den Amalia kurz vor ihrem Tod angenommen hatte. Sarah zögert, dann tut sie es doch und fährt mit Ben in seinem alten Auto los, im Gepäck zwei Schildkröten, einige Atlanten und viele Fragen. So machen sie sich auf eine Reise, die sie nach Frankreich und England führt, in die Welt der Bücher und Karten, in Amalias Vergangenheit eine Reise, die ihr Leben verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sarah ist Bücherjägerin, Kartensammlerin und Restauratorin, sie liebt Manuskripte und alte Landkarten und kann generell besser mit Büchern als mit Menschen umgehen. Seit dem Tod ihrer Tante Amalia, die sie und ihre Schwester aufgezogen hat, lebt Sarah zurückgezogen in deren Kölner Villa mit dem wild sprießenden Garten. Ihre einzige Gesellschaft: die Schildkröten Bonnie und Clyde. Das ändert sich, als Benjamin, ein junger Bibliothekar aus London, vor der Tür steht. Er bittet Sarah, ihm beim Finden einer alten römischen Straßenkarte zu helfen, ein Auftrag, den Amalia kurz vor ihrem Tod angenommen hatte. Sarah zögert, und dann tut sie es doch, fährt mit Ben in seinem alten Auto einfach los, im Gepäck zwei Schildkröten, einige Atlanten und viele Fragen. So machen sie sich auf eine Reise, die sie nach Frankreich und England führt, in die Welt der Bücher und Karten, in Amalias Vergangenheit – eine Reise, die ihr Leben verändern wird.
Ein warmherziger, feinhumoriger Roman über Familie und das Abschiednehmen, die Magie der Bücher – und die Liebe.
ELISABETH BEER, geboren 1989 in Westfalen, wuchs auf dem Land in der Nähe von Köln auf. Sie studierte Komparatistik in Berlin, wo sie inzwischen lebt und arbeitet. Wenn sie nicht in der einen oder anderen Form mit Büchern beschäftigt ist, befindet sie sich am liebsten auf Reisen. Die Bücherjägerin‹ ist ihr erster Roman, der beide Leidenschaften verbindet.
Elisabeth Beer
Die Bücherjägerin
Roman
E-Book 2023
© 2023 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Fagott, Ffm
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-6072-2
www.dumont-buchverlag.de
PROLOG
Die Sache mit der Tabula Peutingeriana
Im Nachhinein ist völlig klar, dass es von Anfang an eine Schnapsidee war, mich auf die Suche nach dem verlorenen ersten Teil der Tabula Peutingeriana zu machen. Die Sache mit alten Landkarten ist, dass sie einen in die Irre führen. Die Sache mit der Kartografie insgesamt ist, dass sie die Dinge in einem Maßstab darstellt, der natürlich nicht der Realität entspricht. Das führt zu ungeahnten Problemen, die man unmöglich vorhersehen kann.
Ich habe einmal eine Geschichte gehört, ein Märchen eigentlich, in der ein chinesischer Kaiser seinen Kartografen den Auftrag gab, eine möglichst detailgetreue Karte seines Kaiserreichs anzufertigen. Die Kartografen sprachen mit allen Reisenden und Feldherren, mit den fahrenden Händlerinnen und den Eremiten aus den Bergen und zeichneten in wochenlanger Arbeit eine Karte, die das damals bekannte Reich so genau wie nie zuvor erfasste. Der Kaiser betrachtete die riesige Karte, die aus zahlreichen Bogen Papier bestand, und war nicht zufrieden. Noch genauer, befahl er, und so machten sich seine Gelehrten an die Arbeit, eine noch größere, noch genauere Karte zu erstellen. Diesmal bestand sie aus einem riesigen Garten, in dem alle Straßen, Städte, Dörfer und Bergzüge, alle Flüsse und Seen in Miniatur nachgeahmt waren. Der Kaiser schritt durch sein Reich in Miniatur und war nicht zufrieden. Noch genauer, befahl er, und so, wie die Welt wirklich ist. Also begannen seine Kartografen, das ganze Land mit Papier zu bedecken, auf dem das dargestellt war, auf dem es ruhte, bis das ganze Reich von der Karte bedeckt war und Karte und Reich eins wurden.
So genau kann ich nicht sagen, was die Geschichte eigentlich bedeutet. Aber ich habe das Gefühl, dass es um Verhältnisse geht, Verhältnisse und Maßstäbe. Denn so ist das, wenn man das Verhältnis verliert und den Maßstab einer Karte mit dem der Realität verwechselt, plötzlich werden Karte und Welt eins und man ist blind für das, was wirklich da ist. Oder so ähnlich.
Jedenfalls ging mir diese Geschichte nie ganz aus dem Kopf. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so lange in meinem Haus allein war, versunken in meine Bücher und Karten, immer nur in der Welt unterwegs auf der Jagd nach dem nächsten Faksimile, dem nächsten uralten Manuskript, in das ich mich vergraben konnte. Als bestünde die Welt aus Papier. Und auch wenn die Suche nach der alten römischen Straßenkarte mein Leben auf den Kopf stellen sollte, hat sie mich eins gelehrt: Man muss den vorgezeichneten Weg verlassen, um das zu entdecken, was wirklich zählt. Oder zumindest, um mit beiden Füßen darüber zu stolpern.
Und manchmal ist eine kleine Irrfahrt dabei eben nicht zu vermeiden.
In jedem Fall sollte man dann besser eine wetterfeste Jacke dabeihaben und ein paar Kekse, die man mit jemandem teilen kann. Auch das kann zu ungeahnten Problemen führen, aber es lohnt sich. Pfadfinder-Ehrenwort.
beiliegend den folgenden Aufzeichnungen, unterzeichnet S.R., 15.
PARS III
Colonia, Treveri, Argentorate (Segmente II, III)
»Until I feared I would lose it, I never loved to read. One does not love breathing.«
Harper Lee, To Kill a Mockingbird
»Bis ich befürchtete, ich würde es verlieren, habe ich das Lesen nie geliebt. Man liebt das Atmen nicht.«
Harper Lee, Wer die Nachtigall stört
1
Prinzessin im Papierpalast
Es klingelte an der Tür. Meine behandschuhten Finger fuhren gerade über den Rücken eines alten Ritterromans. Sein Ledereinband musste ersetzt werden, bevor ich ihn an den Sammler weiterverkaufen konnte, der ihn bei mir bestellt hatte. Das unbarmherzige Klingeln der Glocke schallte durchs Haus bis hier in die Bibliothek und Werkstatt und unterbrach meinen Gedankenfluss, der um den unangenehmen Mann kreiste, der bald dieses schöne Buch in Händen halten würde. Mir ist nie so richtig klar geworden, warum Tante Amalia eine Türglocke mit dem Läuten von Big Ben installiert hatte, ein unseliges Gebimmel, wenn man es mehrmals die Woche hören muss. Ich hielt in meiner Bewegung inne und wartete darauf, dass der Eindringling wieder verschwand. Wenn es der Paketbote war, dann würde er sicher gleich gehen. Er kannte mich schon und hatte wohl ein bisschen Angst vor mir, seinem hektischen Rückzug nach zu schließen, wenn er mich zur Tür kommen hörte. Aber es läutete erneut.
Ich seufzte und legte das alte Buch vorsichtig auf meine Arbeitsfläche, zog die Handschuhe aus und machte mich auf den Weg zur Haustür. Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Die ganze Bibliothek sowie das Wohnzimmer, der Salon, der Flur und die angrenzenden Räume sind mit Bücherstapeln und aufgerollten Karten gefüllt, die kleine und mittlere Türme auf dem Boden bilden, Möbel und Regale bedecken und manchmal auch umfallen. Das sind natürlich nicht die alten und wertvollen Manuskripte, sondern die Bibliothek von Amalias Großmutter, Romane und Erstdrucke oder einfach das, was ich oder Amalia zuletzt gelesen hatten oder woran wir nicht vorbeigehen konnten, ohne es zu kaufen. Ich bahnte mir einen Weg durch die Stapel und dachte wieder einmal daran, dass ich Amalias Sammlung ordnen, vielleicht ein paar Bücher weggeben, vielleicht einige verkaufen und spenden sollte. Aber allein bei dem Gedanken daran verkrampfte sich mein Magen.
Die Villa ist ein Labyrinth, aber keines von der Sorte, die Spaß macht. Das Haus meiner Tante steht in Marienburg, es ist eine jener alten Kölner Villen, die ein bisschen außerhalb des Zentrums liegen und einen eigenen Garten haben, weil sie früher einer wichtigen Person gehörten, die sich beim Promenieren nicht die Füße in der Stadt schmutzig machen wollte. Das zumindest erzählte mir meine Tante, als ich mit zehn Jahren zusammen mit meiner Schwester bei ihr einzog, eine Woche nachdem unsere Eltern tödlich verunglückt waren.
Das Haus besteht aus mehreren Teilen, die alle miteinander verbunden, aber ungleich groß sind und verschiedene Formen haben. Es gibt diesen Hauptteil im Fachwerkstil, dann eine Art Türmchen aus rosaroten Steinen, einen Anbau, der wahrscheinlich früher mal der Stall war und der jetzt als Garage genutzt wird. Das Haus hat unten eine Steinfassade mit einem Erker, auf dem der Balkon im ersten Stock liegt. Der Rest der Fassade ist weiß verputzt. Die langen, schlanken Fenster erinnern an die von Fachwerkhäusern, sind aber größer. Außen am Haus sind mehrere Balken zu sehen, die aber eher der Dekoration als der Statik dienen. Die Dachgiebel sind verziert, und das Dach selbst ist schwarz wie Schiefer. Keine Ahnung, welcher architektonische Banause sich das hier ausgedacht hat. Der Großteil der Fassade ist inzwischen von Efeu und Brombeeren bewachsen, deshalb ist es nicht so schlimm anzusehen.
Am besten ist eigentlich der Garten, fast so groß wie ein Park, von einer hohen Steinmauer umgeben. Hier stehen ein Kirschbaum, Apfel-, Mandel- und Zwetschgenbäume, eine Himalaja-Kiefer, eine Hängebuche und eine weiße Magnolie, auf die Amalia immer sehr stolz war, obwohl der Baum geradezu entgegen ihren Bemühungen überleben musste; Amalia hatte das Gegenteil eines grünen Daumens. Es gibt einen Schilfteich, in dem ihre zwei Schildkröten leben, und einen verwilderten Kräutergarten, Blumen nur wenige, dafür Brombeerranken und Blaubeersträucher, sodass man eigentlich rund ums Jahr aus irgendetwas Marmelade kochen muss. Zwetschgenmus mit Zimt, Apfel-Brombeer-Marmelade oder Kirsch-Schokoladen-Gelee. Auf dem Kompost wuchern riesige Kürbisse, die aus unerklärlichen Gründen die Krähen anziehen. Früher sind Milena und ich auf die Mauer geklettert, haben die Beine baumeln lassen und die Straße beobachtet. Oder wir haben unter den Ästen des Apfelbaums geschaukelt und wei springen auf den Rasen geübt. Die Blaubeeren musste man sofort vom Strauch in den Mund stecken, bevor die Armada an Amseln und anderen Vögeln sie entdecken konnte und sie morgens vor unserem Aufstehen bereits vertilgt hatte.
Die Villa selbst hat viele verschieden große Zimmer, von denen die, die Amalia und ich am meisten genutzt haben, im Zentrum des Hauses liegen und fensterlos sind. Denn alte Bücher und Landkarten sollten besser nicht von Sonnenlicht beschädigt werden, und heutzutage braucht man die Sonne nicht mehr zum Lesen. Im ersten Stock hatten Milena und ich unsere Zimmer, Amalia bewohnte einen ganzen Flügel.
Jetzt war nur noch ich übrig, die ich mich im Innersten des Hauses verkroch. Dort restaurierte ich die alten Handschriften, Manuskripte und Karten, die ich im Internet oder auf meinen Jagden durch Altbestände, Haushaltsauflösungen, Antiquariate und Nachlässe ausfindig machte. Ich bin Bücherjägerin und Kartensammlerin, so wie meine Tante es war, und mein Reich ist aus staubigem Papier.
Wenn ich restauriere, versenke ich mich ganz in meine Arbeit, den Rhythmus der Finger, den leicht modrigen Geruch alten Papiers, das Rascheln der Seiten. Es braucht Konzentration, eine Bindung zu lösen, die Papieranfaserung aufzusetzen, ein handumstochenes Kapitalband zu erneuern oder die Initialen einer Inkunabel behutsam nachzukolorieren. Konzentration und Ruhe und keine Unterbrechungen durch hartnäckige Postboten.
Meine Füße führten mich nun zielstrebig zum Hauseingang, ohne dass ich über einen einzigen Bücherstapel stolperte. Unwillig öffnete ich die Tür.
Auf der Schwelle stand ein mir unbekannter Mann in einem beige gestreiften Anzug, der einen schönen Kontrast zu seiner dunklen Haut bildete. Ich sah in sein kantiges Gesicht, meine Augen wanderten über seinen Kopf mit kurz geschorenem, schwarzem Haar, seine runde Brille mit Metallrahmen bis zu seinem markanten Kinn und fixierten schließlich seine Augen. Braune Augen, stellte ich fest, groß und von dunklen Wimpern gerahmt, Augen, die mich ansahen, während er mit dem Zeigefinger seine Brille zurechtschob.
Der Anzug ließ mich darauf schließen, dass dies nicht der Paketbote war.
»Ja?«, fragte ich unwirsch. Dann schob ich mit einer Hand meine Haare aus der Stirn, die ich aus Gewohnheit beim Arbeiten durcheinanderbrachte, wenn ich in Gedanken mit meinen behandschuhten Fingern hindurchfuhr und sie sich aus dem Zopf lösten. Ich mochte keine Unterbrechungen, die meine Konzentration störten, und vor allem mochte ich keine Überraschungen. Dieser Mann roch nach Überraschungen, und das allein irritierte mich. Vielleicht lag es auch daran, dass er so schön war, dass er mich durcheinanderbrachte. Das mochte ich am allerwenigsten.
Er blinzelte.
»Sind Sie Amalia von Richtershofen?«, fragte er mich, die Worte elegant und ungewohnt aus seinem Mund. Das war ein britischer Akzent, dachte ich, und dass es noch schöner klang als im Fernsehen.
»Nein«, sagte ich.
Er starrte mich an. Dann schien er sich zu sammeln. »Aber das hier ist ihre Adresse, wo kann ich sie denn dann finden?«
»Auf dem Friedhof«, sagte ich, und wollte gerade die Tür schließen, als er eine Hand auf den Türrahmen legte.
»Wie bitte? Amalia ist verstorben? Das tut mir schrecklich leid«, sagte er, als ich die Tür wieder ein Stück öffnete.
Ich versuchte, den Ausdruck auf seinem Gesicht zu lesen. Es schien offen und ernst, passend zu seiner Beileidsbekundung. Ich bin nicht besonders gut mit Menschen, besonders nicht darin, ihre Gefühle zu lesen. Milena hat immer gespottet, dass ich die ältesten Karten und Handschriften lesen könne, Gesichter aber ein Buch mit sieben Siegeln für mich seien. Amalia meinte, ich solle mir einfach Zeit nehmen und mich nicht verunsichern lassen, wenn ich mit Leuten rede, irgendwann würden sie schon sagen, was sie wollen. Ich meine, dass Menschen zu kompliziert sind, und wenn alle einfach sagen würden, was sie meinen, anstatt alles immer so kompliziert wie möglich zu machen, hätte ich gar keine Probleme damit.
Jedenfalls schien der Mann vor mir seine Worte aufrichtig zu meinen, auch wenn sie natürlich nicht stimmen konnten.
»Danke«, sagte ich, »aber Sie sind ja nicht schuld daran.«
Ich wollte die Tür wieder schließen, aber seine Hand lag noch dazwischen. Also warf ich einen vielsagenden Blick auf seine Finger, die ich gleich im Türrahmen einquetschen würde. Er zog sie schnell weg.
»Bitte warten Sie einen Moment«, sagte er. »Ich hatte mit Amalia beruflich zu tun. Vor etwa neun Monaten. Das erklärt natürlich, warum ich seitdem nichts von ihr gehört habe … Ach, entschuldigen Sie, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Ballantyne. Ich komme von der Britischen Bibliothek, hier haben Sie meine Karte.«
Er zog eine Visitenkarte aus der Brusttasche seines Anzugs und reichte sie mir. Ich ließ die Tür los, um die Karte zu nehmen, und las:
Benjamin Ballantyne, Ph.D., Research & Acquisition
»Hören Sie, Dr.Ballantyne, meine Tante ist vor sechs Monaten verstorben. Ich arbeite mich immer noch durch ihre letzten Aufträge. Wenn es um eine Restaurierung geht, dann kommen Sie in ein paar Monaten wieder. Wenn sie Ihnen Geld schuldet, dann kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, denn sie hat mir nur Schulden vererbt. Einen schönen Tag noch.«
Damit gab ich ihm seine Karte zurück, die er etwas perplex wieder entgegennahm. Er sah mich mit großen Augen an. Ich nutzte die Gelegenheit, dass seine Hand nicht mehr im Türrahmen lag, und ließ die Tür ins Schloss fallen.
Das war meine erste Begegnung mit Benjamin Ballantyne, Wissenschaftler und Bibliothekar der Britischen Bibliothek. Natürlich würde es nicht die letzte sein, denn die Dinge, in die Amalia sich verwickelte, hatten eine Art, sie wieder einzuholen. Und weil sie nicht mehr da war, holten sie jetzt mich ein. Der Tod ist nur das Ende für die Person, die sich davongemacht hat. Für alle anderen folgt danach eine endlose Verwicklung in schmerzhafte und unangenehme Prozesse, die mit dem Loch zu tun haben, das ein Mensch durch seinen Tod hinterlassen kann. Man kann zwar bei einer alten Karte einen Riss nicht einfach mit neuem Papier unterfüttern und neu beschriften, nein, aber man kann vorsichtig, ganz vorsichtig in Wasser verteilte Papierfasern sich durch ein feines Sieb an der beschädigten Stelle ansetzen lassen, das Wasser durch das Sieb entziehen und die Fasern mit dem Original verfilzen lassen. Das geht bei Papier, auch wenn es nie mehr genau so sein wird wie zuvor. Mit dem Leben ist das anders. Der Riss, den das Verschwinden von jemandem reißt, wird nur durch die Zeit abgeschliffen an den Rändern, aber das Loch bleibt und lässt sich nicht wieder auffüllen.
So fühlte es sich an, als ich mit der Hand auf dem Türgriff stehen blieb und dem erneuten Läuten des Big Ben lauschte, ohne die Tür zu öffnen. Amalia war weg und hatte mich zurückgelassen, um mit allem allein zurechtzukommen, was wir gemeinsam begonnen hatten. Aber es fühlte sich nicht so an, als würde ich zurechtkommen, im Gegenteil, es war ein bisschen so, als hätte ich mich ohne Bindfaden in einem Labyrinth verirrt und hörte das Atmen des Minotaurus in meinem Nacken. Okay, das klingt vielleicht etwas dramatischer, als es war, aber Amalia hatte mich mit klassischer Literatur großgezogen, und das hatten wir jetzt davon.
Ich ließ die Türklinke los und wanderte zurück in das Labyrinth, das ich kannte. Der Ritterroman würde sich nicht von allein neu binden. Als ich im Wohnzimmer leicht gegen einen Bücherstapel stieß, fiel dieser mit dem Geräusch einer Papierlawine um und verteilte sich auf dem gesamten freien Dielenboden. Ich fluchte und starrte einen Moment auf die unzähligen Seiten Papier, die in vergilbte oder haarsträubend bunte Einbände gehüllt waren. Einen Moment lang dachte ich: Wenn jetzt noch eine weitere Sache passiert, ein weiteres Buch zu Boden geht, ein weiterer Auftrag abgesagt wird, eine weitere Rechnung ins Haus flattert, dann lege ich mich neben diese Paperbackausgabe von Moby Dick und stehe nie wieder auf. Nicht dass ich normalerweise zur Dramatik neige, eigentlich bin ich eine pragmatisch veranlagte Person. Aber es war einer von diesen Tagen. Dann rutschte eines der gefallenen Bücher in den nächsten Stapel hinein, der gefährlich schwankte und schließlich mit einem Rumps zu Boden krachte.
Ich sah auf eine geblümte Sonderausgabe von Stolz und Vorurteil, die aus irgendeinem Grund direkt vor meinen Füßen landete, und fühlte mich vom Universum nicht ernst genommen.
Seufzend machte ich mich auf den Rückweg in meine Werkstatt und hatte den Besucher von der Britischen Bibliothek bereits wieder vergessen, als ich dort ankam.
2
Liste zum Überleben
Niemand sagt einem, was passiert, wenn jemand stirbt. Dabei ist das ja im Grunde ein wiederkehrendes Ereignis im Leben der meisten Menschen – also der Tod von jemand anderem, versteht sich. Ich meine, klar, ich wusste, dann kommt die Beerdigung et cetera, und eigentlich sollte ich auch schon Erfahrung damit haben, nachdem meine Eltern gestorben waren, als ich zehn war. Das ist aber alles recht schwammig in meiner Erinnerung, außerdem musste ich mich damals um nichts kümmern. Diesmal war es anders, und ich hätte wirklich ein paar Hinweise dazu gebrauchen können, wie das eigentlich geht. Eine hilfreiche Liste, auf der zum Beispiel steht:
–Die Augenblicke, in denen deine Tante auf den letzten Stufen der Treppe zu Boden geht, du den Krankenwagen rufst und ihre Hand hältst, bis die Sanitäter eintreffen, du nicht mit ihr in die Notaufnahme fahren darfst und sie das Bewusstsein verloren hat, wenn du im Krankenhaus ankommst, sind Momente, die du immer und immer wieder im Kopf abspielen wirst.
–Die Hand einer nahen Person im Krankenhaus zu halten, die langsam verschwindet, ist in dem Moment wichtig und schmerzhaft und später wichtig und wesentlich. Es fühlt sich an, als würde nur deine Hand sie im Leben halten, und du weißt, du darfst nie, niemals loslassen.
–Die Welt hört nicht auf, sich zu drehen, weil deine Tante tot ist, Überraschung! Du bekommst trotzdem Anrufe, du musst trotzdem mit dem Krankenhaus und dem Bestatter sprechen und mit deiner Schwester, die am Telefon einen Heulkrampf bekommt, während im Hintergrund ihre Kinder kreischen.
–Auch wenn du dich eigentlich selbst in ein Erdloch legen willst, musst du die Sterbeurkunde beantragen und herausfinden, wer im Staate Deutschland eigentlich vom Tod deiner Tante erfahren muss, von den Versicherungen bis hin zum Zeitungsabo-Dienst. Merke: Nicht die Strom- und Gasanbieter informieren, bevor man die Verträge übertragen kann, sonst wird es kalt.
–Zeitungsabos – wer hat eigentlich noch so was?
–Erkenntnis: Egal, wie gut man einen Menschen zu kennen glaubt, man weiß nicht, wie viele Abos er oder sie hatte.
–Es wäre hilfreich, wenn du die Handschrift der verstorbenen Person lesen könntest.
–Es wäre hilfreich, nicht im Nachhinein zu erfahren, dass deine Tante Krebs hatte, den sie nicht behandeln lassen wollte, wovon sie dir nichts erzählt hat, obwohl du bei ihr gelebt hast.
–Immer eine Rücklage für Beerdigungskosten bereithalten. Der Tod ist teuer.
–Auf der Beerdigung genug Kekse für die Kinder mitbringen, um einen Moment Ruhe zu haben, wenn sie untereinander darum streiten.
–Darauf vorbereitet sein, dass niemand darauf wartet, dass man wieder denken kann.
–Die Situation vermeiden, das Testament nicht lesen zu können (siehe auch: die Sache mit der Handschrift).
–Einkalkulieren, dass man auch Schulden erben kann. (Wer hätte das gedacht?)
–Einplanen, dass jeder Gang durchs Haus, jedes Papierrascheln, die grüne Teekanne und die Kaktuspalme, die weiter eintrudelnden Zeitungen, das Läuten der Türglocke, die Werkstatt, eine Zeile in ihrer Sauklaue auf einem Post-it am Kühlschrank, der Geruch von Kardamom und der ganze verdammte Garten dich an deine Tante erinnern werden, wenn du es am wenigsten erwartest, und sich die ganze Welt einen Augenblick zusammenzieht und es dauert, bis du wieder atmen kannst.
3
Schätze, Ritterinnen und Walrösser
Die warmen Strahlen der Sommersonne warfen ein Muster auf den orientalischen Teppich im Flur, als ich am nächsten Morgen die Treppe herunterkam. Einen Moment beäugte ich das Chaos im Wohnzimmer, dann ging ich in die Küche und stellte die Kaffeemaschine an. Ich betrachtete den Holztisch und Amalias Sitzplatz, der immer noch nicht wie jede andere ungenutzte Fläche im Haus mit Büchern bedeckt war. Dann wandte ich den Blick ab. Die Tür zum Kräutergarten öffnete wie immer mit einem Knarzen, und ich streckte den Kopf hinaus und atmete die frische Morgenluft ein. Mein Blick fiel auf die Elster, die auf dem Kompost zwischen den riesigen Kürbisblättern herumhüpfte. Sie hob den Kopf, legte ihn schief und starrte mich mit einem schwarzen Knopfauge an. Ich musterte den schwarz-weißen Vogel missmutig, der sich nicht beirren ließ und weiter in den Resten meines letzten Kochversuchs herumpickte.
Fürs Wochenende hatte ich eine Annonce geschaltet und eine partielle Haushaltsauflösung angekündigt. Das hieß, ich hatte viel zu tun.
Mit der Kaffeetasse in der Hand ging ich ins Wohnzimmer und machte mich daran, die Bücherstapel in ordentlichere Türme zu schichten, ich befreite Sessel und Sofas von Manuskriptseiten, fand eine alte Karte von Polen wieder, die ich in der Werkstatt in Sicherheit brachte, und versteckte ein paar Schundromane in den hinteren Regalreihen. Ich verteilte Silberbesteckkästen, antike Vasen (so sahen sie zumindest aus, ich bin Restauratorin, keine Archäologin) und allerlei Dinge, die Amalia und ich bei Haushaltsauflösungen neben Büchern und Karten erstanden hatten, auf dem großen Esstisch und anderen Flächen, sodass sie gut sichtbar waren.
Die Schulden, die Amalia mir vermacht hatte, waren durch die Beerdigungskosten noch vermehrt worden. Die Kosten hatte ich mir nicht mit Milena teilen können, da ihr Mann Thomas der Meinung war, sie bräuchten das Geld für den Hausumbau und die Kinder, und Milena verfügte über kein eigenes Einkommen.
Dafür hatten wir beide jetzt Amalias Haus geerbt und ich einen Berg Schulden durch das Restaurationsgeschäft, das ich übernommen hatte. Ein paar Sessel und Bücher weniger zu besitzen, dafür aber neues Material für die Fadenheftung von Manuskriptseiten kaufen und ein paar Rechnungen begleichen zu können, hielt ich daher für eine gute Idee. Das Haus zu verlieren war keine Option.
Amalia und ich hatten zahlreiche Bestandsauflösungen und Versteigerungen besucht, ich wusste also, wie das ablief. Und zwar so: Amalia fand eine Anzeige in einer ihrer abonnierten Zeitungen. Meistens morgens, wenn wir gemeinsam am Küchentisch saßen, sie ihre Grapefruit löffelte und ihren starken Kaffee mit Kardamom trank, während mir der Honig vom Schwarzbrot auf die Finger tropfte und ich versuchte, langsam aufzuwachen. Amalia versah ihre Zeitungslektüre mit einem laufenden Kommentar. »Ha!«, rief sie in etwa. »Das war doch schon immer klar, dass der korrupt ist, mit dem Bubigesicht. Die spinnen, die Österreicher.« Oder: »Also bevor wir den Wein aus der Zeitung bestellen, trinke ich lieber keinen einzigen Tropfen mehr, nie wieder! Willi würde sich im Grab umdrehen, ich meine: Merlot aus Jütland! Da ist doch etwas faul im Staate Dänemark.« Willi war der Weinhändler ihres Vertrauens gewesen. Meine Tante hatte ein breites Netzwerk von Menschen, die sie kannte, und für alles, was sie brauchte, die passende Beziehung. Es würde mir erst nach ihrem Tod auffallen, wie sehr ich auf ihre Kontakte angewiesen war und dass ich mir nie selbst die Mühe gemacht hatte, welche zu pflegen. Wie gesagt, ich bin nicht so gut mit Menschen, aber Amalia machte es mir leicht.
In diesen Morgenstunden, in denen ich, bis ich meine zwei Tassen Filterkaffee getrunken hatte, alles, was Amalia sagte, mit einem Brummen quittierte, war es friedlich im Haus. Die Morgensonne drang durch die großen Küchenfenster und die Tür zum Kräutergarten hinein, die im Sommer immer offen stand, sodass wir das Summen der Bienen hören und den Lavendel riechen konnten. Der alte Holztisch, übersät mit dunklen Ringen von zu heiß darauf abgestellten Getränken, Wein- und anderen Flecken, war zur Hälfte mit Büchern und Magazinen, zur anderen mit Frühstücksgeschirr bedeckt. Neben Amalias Stimme waren die tickende Wanduhr, die leisen Vogelrufe und das Rascheln der Zeitung die einzigen Geräusche im Haus. Das war jeden Morgen so, im Sommer wie im Winter. Ich mochte Routine, und auch wenn Amalia eher der Typ für Abwechslung und Aufregung war, hatte es immer dieses gemeinsame Frühstück gegeben, unser kleines Ritual. Nachdem Milena und ich als Kinder nach dem Tod unserer Eltern zu ihr gekommen waren, hatte Amalia es so eingeführt. Sie weckte uns, schickte uns ins Bad und wartete in der Küche mit Honigbroten und Tee auf uns, mit sanften Augen und ruhigen Händen und einer Stimme, die die Stille füllte, die das Verschwinden unserer Eltern hinterlassen hatte.
So war es auch in den Jahren geblieben, als ich nach dem Studium in Amalias Haus zurückkehrte, um ihr Handwerk zu lernen und in das Restaurationsgeschäft einzusteigen. Milena war da schon längst verheiratet und wohnte in Buchheim. Der Name des Vororts war das Einzige, was Amalia und ich daran gut fanden, denn ihren Mann Thomas hielten wir für einen Fehlgriff, genauso wie das Leben in der Vorstadt mit 1,5Kindern. Natürlich hatten wir nichts gegen die Kinder, nur gegen den Lebensstil Typ unglückliche Hausfrau mit unsensiblem Ehemann. Milena war da selbstverständlich anderer Meinung, sie fand es komisch, dass ich mit Anfang zwanzig nach dem Studium in das Haus meiner Tante zurückgezogen und in ihr erratisches Business eingestiegen war. Aber ich mochte es so. Ich mochte dieses wunderschöne alte Haus, in dem es überall nach Papier roch, ich mochte die Arbeit mit Folianten und alten Sternkarten und die Jagd nach Büchern auf Dachböden, in Truhen, Sammlungen, Bibliotheken, Ramschkisten und einmal sogar in einem ausgestopften Bären. Für jemanden wie mich, der eigentlich Routinen mag, klingt das nach viel Aufregung. Änderungen mochte ich nur bedingt, im Rahmen meiner gewohnten Bahnen, denn Routine konnte einen nicht überraschen, und wenn einen etwas nicht überraschte, konnte es einem auch nichts anhaben. Anderen gegenüber ist es schwer zu erklären, aber Amalias und mein Leben, bestehend aus Schatzsuchen, Internetauktionen, Schnäppchenjagden und langen Stunden in der Werkstatt mit der Arbeit an alten Büchern, Karten, Drucken und Handschriften, war für mich gewohnt, komfortabel. Nur weil man Routinen mag, muss das noch lange nicht heißen, dass die Routinen selbst so öde und traurig sein müssen wie ein Job beim Finanzamt.
Amalias und mein Frühstücksritual war jedenfalls im Großen und Ganzen gleichg eblieben, bis vor sechs Monaten. Amalia ging morgens die Seiten mit den Annoncen und den Todesanzeigen durch, und manchmal war etwas Interessantes für uns dabei, vor allem in den Lokalblättern. Antiquariatsmenschen, Sammlerinnen und Restaurator*innen wie wir sind eben ein komisches Völkchen. Natürlich gibt es auch einen ganzen Internet-Parallelmarkt, aber viele von uns sind etwas altmodisch, so wie meine Tante. Amalia hasste Handys, Einkaufszentren, »Twittergram«, Bücher mit Klebebindung, Nazis und Verschwörungstheoretiker, Theodor Fontane und eingeschweißten Käse. Die Sache mit Fontane habe ich nie so recht verstanden.
Sie liebte bunte Kleidung und farbenfrohe Schals, die sie sich um ihre rot gefärbten Haare band. Sie liebte Schnäppchen, gepresste Blumen und vergessene Schätze, mich und Milena, und sie liebte es, Ankündigungen von Haushaltsauflösungen in der Zeitung zu finden. »Aha«, rief sie dann, »Jackpot, mein Mädchen! Los gehts.« Ein Funkeln trat in ihre Augen, und sie erinnerte mich ein wenig an eine Elster, wenn sie mit ihren weiten Kleidern, die wie Federn hinter ihr herflatterten, vom Tisch aufstand. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich meistens schon eine Tasse Kaffee getrunken und war zumindest zur Hälfte wach.
Dann fuhren wir mit ihrem alten Armeejeep, der nur mit einer Plane abgedeckt war, zur angegebenen Adresse. Amalia saß am Steuer und bretterte durch die Straßen, beschimpfte dabei Autofahrer, die ihr nicht schnell genug auswichen, und stellte allgemein eine ziemliche Verkehrsgefahr dar. Oft hatte ich ihr schon gesagt, was ich von ihrem Fahrstil hielt, aber da war sie unverbesserlich. »Papperlapapp«, sagte sie dann, »so schlimm ist es nicht.« Ich saß auf dem Beifahrersitz und versuchte zu recherchieren, was es über die Haushaltsauflösung der jetzigen oder ehemaligen Eigentümerinnen der Gegenstände, die wir bald begutachten würden, im Internet zu finden gab. Das half dabei, eine Ahnung davon zu bekommen, ob wir erst mal stöbern oder gleich versuchen sollten, den ganzen Kram auf einmal für einen Abschlagspreis zu kaufen und später alles in Ruhe durchzugehen, ohne die Konkurrenz. Und es half dabei, ein realistisches Preisangebot einschätzen zu können: Waren die Besitzer Erben, die keine Ahnung hatten, auf welchen Schätzen sie vielleicht saßen? Handelte es sich um eine Sammlerin, die einen gut geordneten Bestand auflösen musste und selbst genau wusste, was der Wert war? War es eine genervte Witwe, die Erhards Briefmarkensammlung endlich loswerden wollte? Im Auto las ich Amalia die Infos vor, die ich gefunden hatte, und wir erstellten einen Schlachtplan. Bei der Bücherjagd kam es nämlich vor allem auf die Geschwindigkeit an. Wir mussten vor unseren Konkurrenten die besten Stücke ausfindig und den Deal klarmachen, sodass sie keine Chance hatten, uns zu überbieten. Denn unser Budget war begrenzt.
»Du nimmst dir die obere Etage vor, ich hänge mich an Dengelmann dran und verhindere, dass das Wiesel uns wieder die besten Folianten wegschnappt«, sagte Amalia etwa. Dengelmann, ein kleiner, untersetzter Sammler und Antiquar mit akkurat gescheiteltem, grauem Haar und schlecht sitzenden ebenso grauen Anzügen, war so etwas wie Amalias Erzfeind. Immer wenn wir ihn bei einer Auktion oder einer Bestandsauflösung trafen, verwickelten sich die beiden in einen Wettkampf, der oft damit endete, dass wir viel mehr für eine Erstausgabe von Wilhelm Tell ausgaben, als man für ein Stück über jemanden, der auf seinen eigenen Sohn schießt, ausgeben sollte, Kupferstiche hin oder her.
Unsere Arbeitsaufteilung war jedenfalls klar: Ich würde mich um die Begutachtung und Schätzung der für uns relevanten Gegenstände kümmern und Amalia sich ums Verhandeln, Vergraulen der Konkurrenz und Knüpfen von Kontakten. So war es uns beiden am liebsten, ich kümmerte mich um die Dinge, sie kümmerte sich um die Menschen. Amalia rückte dann ihre roten Haare in einem ihrer bunten Tücher zurecht und bereitete sich so auf den Kampf vor wie eine Ritterin auf die Schlacht. Bevor wir uns ins Getümmel stürzten, schenkte sie mir einen Blick und lächelte, dankbar, dass ich dabei war, und aufmunternd, um meine Nerven zu stärken.
Jetzt würde ich mit allem allein umgehen müssen. Und diesmal war ich auch nicht als Schnäppchenjägerin im Haus eines anderen unterwegs, sondern musste den Dengelmanns dieser Welt selbst die Türe in mein Refugium öffnen.
Am Morgen der teilweisen Bestandsauflösung öffnete ich früh Haustür und Gartentor, um eine Horde Menschen hineinzulassen, die durch die Villa trampeln, alles anfassen und gelegentlich etwas in ihren Hosentaschen verschwinden lassen würden. Die Türen zur Werkstatt und die zu den oberen Zimmern hatte ich abgesperrt. Wenig später war das Haus voll, die vielen Menschen, ihre Lautstärke und die ständigen Bewegungen in meinen Augenwinkeln waren fast zu viel für mich. Schnell wurde ich in unangenehme Verkaufsgespräche verwickelt.
»Was kostet das?«, fragte eine Dame in einem dunklen Kostüm und zeigte mit einer abschätzigen Handbewegung auf die Kuckucksuhr an der Wand.
»Ist nicht zu verkaufen, die gehörte meiner Tante«, sagte ich.
»Doch, natürlich, das hier ist doch eine Haushaltsauflösung, oder nicht?«
Ich rollte mit den Augen. »Fünfhunderttausend«, sagte ich.
»Sind Sie noch zu retten?«, fragte die Dame indigniert.
»Ich hoffe schon«, sagte ich.
»Sagen Sie doch gleich, dass Sie nicht verkaufen wollen!«
»Habe ich ja.«
»Ich dachte, das sei Teil des Verkaufsgesprächs!«
»War es doch auch.«
Die Dame zeigte mir einen Vogel, packte einen älteren Herrn am Arm und machte sich laut schimpfend davon. Ich seufzte.
Gerade war ich dabei, mit einem jungen japanischen Pärchen über eine Wilhelm-Busch-Gesamtausgabe zu verhandeln, als ich aus den Augenwinkeln eine grau gekleidete Gestalt hereinschleichen sah. Ein kleiner, untersetzter Mann, der versuchte, sich an mir vorbei in die Bibliothek zu stehlen. Dengelmann. Meine inneren Alarmglocken läuteten, ich drückte dem verblüfften Pärchen vor mir das Buch in ihre vier Hände, ließ die beiden stehen und folgte unserem Kontrahenten. Das hatte mir gerade noch gefehlt, dass der hier auftauchte.
Dengelmann war gerade im Begriff, die Hand nach einer Emily-Brontë-Schmuckausgabe auszustrecken, als ich ihm auf die Schulter tippte. Er war einen Kopf kleiner als ich und fuhr nun mit einem erschrockenen Gesichtsausdruck zu mir herum.
»Fräulein von Richtershofen!«, quiekte er.
»Herr Dengelmann«, sagte ich und zog die Brauen zusammen. Nichts Gutes kam jemals von Leuten, die einen Fräulein nannten.
»Sie haben mich aber erschreckt«, sagte er und griff sich theatralisch an die Brust.
»Offensichtlich«, sagte ich.
Dengelmann musterte mich mit einem Ausdruck, den ich nicht deuten konnte, aber da ich ihm sowieso nicht über den Weg traute, war das auch egal. Er schluckte sichtbar, und ich kniff die Augen zusammen. Ein Taschentuch kam zum Vorschein, mit dem er seine hohe Stirn unter den Geheimratsecken abtupfte.
»Ich wollte Ihnen noch mein Beileid aussprechen, Fräulein von Richtershofen«, sagte er.
Ich wartete. Es entstand eine Pause.
»Generell sagt man dann Danke«, sagte er schließlich.
»Generell haben Sie mir noch gar kein Beileid ausgesprochen, sondern es nur angekündigt«, sagte ich.
Dengelmann seufzte und trocknete sich etwas hektischer die Stirn.
»Fräulein von Richtershofen«, sagte er.
»Herr Dengelmann«, sagte ich.
Er sah sich Hilfe suchend um und beugte sich dann zu mir vor, was den Effekt hatte, dass er meiner Armbeuge recht nahe kam.
»Wissen Sie, ich habe Ihre Tante immer sehr respektiert. Sie war eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Eine tolle Frau und eine tolle Konkurrentin. Wäre da nicht die Sache mit dem Gedichtband gewesen, wir hätten sogar Partner werden können«, sagte er.
Meine Augen verengten sich. »Sie meinen, als Amalia die Droste-Hülshoff-Ausgabe rerestaurieren musste, die Sie fast ruiniert hätten? Oder als Sie die Emily-Dickinson-Fälschung verkauft haben?«
Dengelmann zog den Kopf zurück, was ihm einen Augenblick lang das Aussehen einer Schildkröte verlieh, und blinzelte.
»So war es nicht! Hat Ihre Tante Ihnen das erzählt? Aber ich bitte Sie!« Dengelmann war lauter geworden, und neben mir räusperte sich plötzlich jemand. Mein Blick wanderte zur Seite, bevor ich etwas erwidern konnte.
Neben uns war der Mann aufgetaucht, der vor ein paar Tagen geklingelt hatte, der schöne Bibliothekar mit dem hellen Anzug, der diesmal ein beiges Jackett und ein schwarzes Hemd dazu trug. Mein Blick wanderte zu seinen dunklen Augen hinter der Brille, und ich stockte einen Moment, als im gleichen Augenblick Amalias alte Kuckucksuhr, die schon lange nicht mehr richtig funktionierte, zu rufen begann.
»Gibt es hier ein Problem?«, fragte Benjamin Ballantyne, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Britischen Bibliothek, sanft an mich gewandt.
Ich blinzelte. »Kein Problem. Der Herr wollte gerade gehen.«
Dengelmann schnappte nach Luft. »Wollte ich nicht! Sie haben doch Ihr Haus geöffnet, da können Sie mich nicht einfach so wieder zur Tür rausschmeißen!«
»Kann ich schon, es ist ja meine Tür«, sagte ich und begann, ihn mit scheuchenden Handbewegungen zwischen den anderen Schatzjägern und den Bücherstapeln hindurch Richtung Haustür zu manövrieren.
»Aber … Sarah, ich bitte Sie!«, protestierte Dengelmann.
»Um was bitten Sie mich denn eigentlich?«, fragte ich, langsam von der Situation genervt. Dengelmann musste fort. Er war ein Eindringling, und er erinnerte mich zu sehr an Amalia, beides Dinge, die ich jetzt schlecht vertragen konnte.
Dengelmann blieb stehen, unwillig schaute ich ihm ins Gesicht, und er bedachte mich mit einem Hundeblick, den ich noch nie zuvor an ihm gesehen hatte.
»Ich … Ich …«, stotterte er, und seine Augen füllten sich zu meinem Entsetzen mit Tränen. Hilfe suchend sah ich mich um und wechselte einen Blick mit Benjamin Ballantyne, Bibliothekar der Britischen Nationalbibliothek, dessen Augen weit geworden waren.
»Herr Dengelmann, was ist denn los?«, fragte ich den kleinen Mann vor mir.
Einen Moment schwieg er, seine Unterlippe zitterte, dann flüsterte er. »Ich vermisse sie, wissen Sie? Amalia. Ich meine, sie war im Grunde eine unmögliche Dilettantin und skrupellose Halsabschneiderin, aber sie hat Farbe ins Leben gebracht. Die Auktionen mit ihr waren immer die besten, und niemand war so geschickt wie Amalia darin, einem die wirklich guten Funde vor der Nase wegzuschnappen.«
»Sie hat gerne bunte Kleider getragen, ja«, sagte ich und ballte unwillkürlich eine Hand zur Faust, als könnte ich damit die Erinnerungen zurückhalten. »Sie hat immer gesagt, dass alle Farben zusammenpassen. Dass sie noch nie eine Farbe getroffen habe, die nicht zu einer anderen passe, sodass, genau genommen, am Ende alle zusammenpassen. Das stimmt so natürlich nicht.«
Dengelmann und der britische Bibliothekar sahen mich an.
Dengelmann nickte schließlich bedächtig. »So war sie, Ihre Tante, nicht wahr? Voller Überzeugungen, mit denen sie einen überzeugen konnte.«
Benjamin Ballantyne ließ seinen Blick zwischen mir und Dengelmann hin und her springen.
»Kann ich nicht wenigstens … wenigstens eine klitzekleine Brontë-Ausgabe mitnehmen?«, fragte Dengelmann. Er versuchte noch mal die Sache mit dem Hundeblick. »Zur Erinnerung, wissen Sie?«
Darum ging es also. »Finger weg von den Brontë-Schwestern, ich weiß genau, was Sie damit vorhaben«, zischte ich. »Ich helfe Ihnen ganz sicher nicht dabei, eine weitere falsche Sonderausgabe unter unwissende SammlerInnen zu bringen!«
Dengelmanns Augen weiteten sich, als ich ihn am Ärmel packte und ohne weiter auf sein Gestotter zu hören, zur Haustür und über die Schwelle zog. Ich ließ die Tür vor seinem Gesicht mit dem offens tehenden Mund ins Schloss fallen.
»So«, sagte ich, »das wäre erledigt.«
Neben mir im Hauseingang stand immer noch der schöne britische Archivar und sah mich mit einem Ausdruck an, der mir mal wieder nichts sagte.
»Was ist?«, fragte ich daher etwas unwirsch.
Benjamin Ballantyne schien kurz zusammenzufahren, sich dann aber wieder zu sammeln.
»Sie waren ganz schön hart zu dem armen Mann«, sagte er. Seine Stimme leise und dunkel, genau wie seine kastanienfarbenen Augen.
»Sie kennen Dengelmann nicht«, sagte ich. »Ihn einen Moment unbeaufsichtigt zu lassen, hat gefährliche Konsequenzen. Wie ein Walross im Porzellanladen.«
Der Mann der Britischen Bibliothek musterte mich und lächelte dann plötzlich. Einen Moment lang konnte ich die Augen nicht von ihm abwenden, von der überraschten Freude auf seinen Zügen, die sein schönes Gesicht noch schöner machte, was gar nicht hätte möglich sein sollen.
»Sie erinnern mich ein bisschen an meine Schwester«, sagte er.
»Aha«, sagte ich. »Was machen Sie eigentlich wieder hier?«
Der Mann blinzelte. »Entschuldigen Sie die Störung … Sie kommen ziemlich direkt zur Sache.«
»Ja«, sagte ich, »das spart im Allgemeinen Zeit.«
Die schlanken Finger seiner linken Hand spielten mit dem Manschettenknopf an seinem rechten Ärmel.
»Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich der ungünstigste Zeitpunkt, aber es gibt eine Sache, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Besprechen muss, gewissermaßen. Und da unsere Unterhaltung vor ein paar Tagen so abrupt endete, wusste ich mir nicht anders zu helfen, als es noch mal bei Ihnen zu versuchen, da Ihre Tür offen stand.«
Seine Wortwahl wirkte ein wenig altmodisch, aber nicht so aufgesetzt wie bei Dengelmann, sondern so, als hätte er Deutsch mit Goethe und Schiller gelernt und nicht in einem Sprachkurs an der Uni. Ohnehin war sein Deutsch perfekt, nur der britische Akzent und die manchmal ungewöhnlichen Formulierungen verrieten ihn als jemanden, der wahrscheinlich kein Muttersprachler war. Sein Gesicht mit den starken Zügen, der glatten, dunklen Haut, die Brille und das kurz geschorene, schwarze Haar ließen mich sein Alter auf Ende zwanzig schätzen, während Sprach- und Kleidungsstil zu einem älteren Mann gepasst hätten. Benjamin Ballantyne erschien mir auf den ersten Blick wie ein Rätsel.
»Frau von Richtershofen?«, fragte er, nachdem ich eine Weile nichts gesagt hatte.
»Äh, ja.« Ich räusperte mich. »Wir können uns im Wohnzimmer unterhalten, während ich darauf aufpasse, dass nicht wieder jemand den Louis-XIV.-Sessel zu stehlen versucht.«
»So etwas machen die Leute?«, fragte er.
»Aber natürlich. Eigentlich stehlen sie gern alles, was nicht festgenagelt ist. Außer hässliche Paperbackausgaben, die will aus irgendeinem Grund nie jemand.«
Benjamin lachte überrascht auf, was mir das Gefühl gab, dass er genau verstand, was ich meinte; er arbeitete ja auch für eine Bibliothek. Sein Gesicht leuchtete auf, seine Züge sahen jünger, entspannter aus. Seine dunklen Augen blitzten mich an, als hätten wir schon unzählige Male einen Witz geteilt. Automatisch verzogen sich meine Mundwinkel zu einem antwortenden Lächeln. Als ich mich umdrehte, hatte ich das Gefühl, seinen warmen Blick in meinem Rücken zu spüren, auf dem ganzen Weg durch die Bücherstapel zurück ins Wohnzimmer.
4
Der Rhythmus der Dinge
Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, als wir zu meiner Tante kamen. Ich war damals neun, fast zehn, und Milena war sieben Jahre alt. Die Zeit davor ist ein bisschen verschwommen, der endlose Sommer bei den Pfadfindern im Nachhinein eine ausgeblichene Erinnerung an den Geruch nach Hitze und Sonnencreme, dunkles Seewasser und Eulenrufe in der Nacht. Diese Sommer waren Milenas und meine Ausbrüche aus der strengen Ordnung des Alltags, die unsere Eltern uns auferlegten: Morgengymnastik, Frühstück, Schule, Mittagessen, Hausaufgaben, Spielen, Abendessen, Zähneputzen, Vorlesen und Schlafen; jeder Programmpunkt, immer zur selben Uhrzeit und mit vorgegebener Start- und Endzeit, wurde im Planungsheft meiner Mutter eingetragen und abgehakt. Bei uns musste alles nach einem geordneten Rhythmus gehen. Nicht dass die Pfadfinder gerade chaotisch sind, aber im Vergleich zur militärischen Tagesorganisation meiner Mutter sind sie ein Saftladen.
Doch in diesem Sommer sollte alles aus dem Takt geraten. Es war der Sommer, der damit endetet, dass wir ins Büro der Campingplatzleitung gerufen wurden, Milena und ich, wo uns ein überforderter Sozialarbeiter eröffnete, dass unsere Eltern mit dem Flugzeug über dem Amazonas abgestürzt seien. Der Mann trug ein helles Hemd und graue Haare in einem Pferdeschwanz, das weiß ich noch, da mein Blick an seinem wippenden Zopf hängen blieb, während er sprach. Ich wartete darauf, dass er seine Erklärung ausführte, dass er sagte, wo sie jetzt seien, ob sie sich nun, wie die AbenteurerInnen aus unseren Kinderbüchern, durch den Dschungel schlagen mussten mit Macheten, bis ein dort lebendes Volk sie kopfschüttelnd vor ihrer europäischen Unfähigkeit rettete. Aber der Mann sah uns nur erwartungsvoll an. Milena griff nach meiner Hand.
Es dauerte noch ein paar Tage, bis das Jugendamt die einzige lebende Verwandte meiner Eltern ausfindig gemacht hatte, denn sie war gerade in Frankreich. Diese Tage im Zeltlager waren die unangenehmsten, die ich je irgendwo verbracht habe. Niemand wusste, wie mit mir und Milena umzugehen war. Trauer und Verlust scheinen andere abzuschrecken wie der Geruch des Todes die Tiere einer Herde.
Schließlich fuhr uns der Mann mit dem Pferdeschwanz in einem grauen Sedan eine endlose Strecke über Autobahnen und durch Landstriche, die von der Sonne ausgeblichen waren. Er hatte uns erklärt, dass wir nun zu unserer Tante Amalia nach Köln fahren würden und sie uns erwartete. Tante Amalia, die Schwester meiner Mutter, bei deren Namen, wenn er bei uns zur Sprache kam, meine Mutter seufzte und mein Vater ihr einen Seitenblick zuwarf. Es war nicht so, dass meine Mutter und Amalia sich schlecht verstanden, vielmehr war es so, dass meine Mutter Amalia verantwortungslos fand. »Sie übernimmt keine Verantwortung«, sagte meine Mutter mit einer steilen Falte auf der Stirn, während sie gerade eine Zucchini in winzige Teile schnitt. Wofür Amalia keine Verantwortung übernahm, das kam nicht zur Sprache. Stattdessen schaute mein Vater von der studentischen Hausarbeit auf, die er gerade am Esstisch korrigierte, und sagte: »Nicht vor den Kindern.«
»Nicht vor den Kindern« war einer seiner Lieblingssätze, eine weitere Konstante in unserem Leben. Wenn meine Mutter morgens nach der Dusche im Bademantel die Treppe herunterkam, ihr erdbeerblondes Haar zurückband und meinem Vater, der mit Kaffee und einer Zeitung am Küchentisch saß, einen Kuss gab und dann noch einen und schließlich sein Gesicht in ihre Hände nahm, um den Kuss zu vertiefen, sagte er: »Nicht vor den Kindern.«
Wenn beide abends auf der Terrasse saßen, bei ihrem zweiten Glas Wein, und meine Mutter eine Schachtel Zigaretten hervorholte, die sie meinem Vater anbot, sagte er: »Nicht vor den Kindern.«
Wenn er uns morgens die Frühstücksschalen mit dem Müsli und ein Glas Orangensaft hinstellte und meine Mutter ihm einen Ausschnitt aus einem ihrer Artikel für ein Fachjournal vorlas, den er schlecht fand, worüber sie dann anfingen zu streiten, machte er den Mund auf, und meine Mutter sagte im gleichen Moment wie er: »Nicht vor den Kindern!«, und warf ihre ausgedruckten Seiten auf den Tisch, bevor sie in ihr Arbeitszimmer stürmte und die Tür zuknallen ließ.
Für meine Eltern waren Milena und ich eine Art nachträglicher Einfall gewesen. Beide waren Vollblutakademiker, beide waren renommiert in ihren Fachgebieten, die pflanzliche Pharmakologie bei meiner Mutter, bei meinem Vater die Botanik. Mein Vater extrahierte Enzyme aus Pflanzen, und meine Mutter vergiftete Frösche. Man würde meinen, das seien verschiedene Fachgebiete, aber so, wie meine Eltern an die Sache herangingen, war es symbiotisch: Ihre Laborforschung baute aufeinander auf und ergänzte sich. Genauso, wie ihre Beziehung symbiotisch war, wie die beiden aufeinander aufbauten und einander ergänzten. Man würde meinen, mit Eltern aufzuwachsen, die sich so sehr lieben, dass sie alles teilen, deren Leidenschaft für ihre Forschung genauso groß ist wie die füreinander, müsste eine wunderbare Erfahrung sein. Und ich will mich nicht beklagen, die beiden waren wunderbare Vorbilder in Fragen des Forschergeists, der Partnerschaftlichkeit, akademischer Leidenschaft und Leistungsbereitschaft. Was sie nicht waren, waren aufmerksame Eltern. Eine Liebe, die so in sich geschlossen ist wie ihre, lässt kaum Platz für andere.
Bevor wir zu ihr kamen, kannten Milena und ich Amalia nur von den wenigen Malen, die sie an Weihnachten bei uns zu Besuch gewesen war. Meistens gab es dann gefüllten Truthahn, und wir saßen um den großen Esszimmertisch. Ich spielte mit den Erbsen auf meinem Teller, Milena versuchte, die Aufmerksamkeit unserer Mutter auf sich zu lenken, indem sie sie unablässig an ihrem Ärmel zupfte. Amalia trug auch im Winter weite bunte Kleider, dazu Strumpfhosen und geringelte Socken. Als sie mich und Milena einmal fragte, was der Weihnachtsmann uns denn gebracht habe, schüttelten wir verständnislos den Kopf. Unsere Eltern hielten nichts davon, uns »irgendwelche Lügen zu erzählen«, über die man uns später ohnehin würde aufklären müssen. Amalia sah sich um. Es gab auch keinen Weihnachtsbaum, keine Dekoration mit Engeln oder formtechnisch falschen Schneekristallen und keine Berge von Geschenken. Geschenke bekamen wir trotzdem, aber sie waren eher praktischer Natur, wie Schulbücher, Stifte und ergonomische Rucksäcke. Amalia verzog den Mund und meinte: »Wenn man nicht früh lernt zu glauben, dass es noch Wunder gibt, dann lernt man es später gar nicht mehr.« Woraufhin meine Mutter und mein Vater sich einen Blick zuwarfen und mein Vater einen großen Schluck Rotwein trank.
Amalia galt als schwierig in unserer Familie: »Sie ist schwierig«, sagte meine Mutter, während sie mit einem Rotstift Zahlen in einer ausgedruckten Tabelle markierte. »Sie wird sich schon noch einkriegen«, sagte mein Vater, legte meiner Mutter eine Hand auf die Schulter und stellte ihr ein Glas Grüntee neben die Arbeit.
An dem Tag, als wir zu Amalia gebracht wurden, schien die Sonne unerbittlich durch die Autofenster, und Milena hatte schon seit Stunden nichts mehr gesagt. Das war ungewöhnlich, normalerweise plapperte sie ununterbrochen. Auf dem Rücksitz des Sedans spielte sie mit ihrer Puppe mit dem erdbeerblonden Haar und sah erst auf, als wir in einer ruhigen, von Bäumen gesäumten Straße parkten. Der Sozialarbeiter mit dem Pferdeschwanz stieg aus, öffnete uns die Autotüren und nahm Milena und mich an die Hand, mich an die linke, Milena an die rechte. Wir gingen ein paar Meter auf dem Bürgersteig, vorbei an großen altmodischen Häusern. Schließlich blieben wir vor einem Tor stehen, das der Mann aufschob. Ein gepflasterter Pfad führte auf eine Villa zu. Als Erstes fielen mir die Fachwerkbalken und die geschmückten Giebel auf, die rote Farbe, in der sie gestrichen waren, der Erker und das rosafarbene Türmchen. Das Gras rechts und links des Pfades war hoch gewachsen, Milena konnte gerade so mit dem Kopf darüberschauen. Der Garten sah verwildert aus, der Rasen ungemäht, überquellende Ranken und Pflanzen schienen sich umeinander zu winden, die Bäume wuchernd und nicht zurückgeschnitten, die grüne Vielfalt ein organisches Chaos. Das schien dem Mitarbeiter des Jugendamtes zu denken zu geben, er blieb auf dem Steinpfad stehen und sah sich suchend um, als gäbe es irgendwo eine Hinweistafel über den Zustand des Gartens. Dann seufzte er und ging mit uns die drei Stufen bis zur überdachten Haustür empor. Er ließ meine Hand los und drückte die Klingel, die ein seltsames Läuten von sich gab. Nichts geschah. Er versuchte es erneut, drückte diesmal länger, klopfte an der Tür und spähte durch die Butzenglasscheibe hinein.
Schließlich saßen Milena und ich auf den Stufen vor der Haustür, Milena spielte wieder mit ihrer Puppe, und ich versuchte, in dem ausufernden Grün des Gartens die Pflanzenarten aufzuzählen, die ich kannte: ein Apfelbaum, Malus domestica, die Brombeere an der Hauswand mit dem Namen Rubus aus der Gattung der Rosenpflanzen, der Gemeine Löwenzahn namens Taraxacum, der in der Wiese wucherte, und die verschiedenen Grassorten, die ich mir bei aller Liebe und obwohl mein Vater sie immer wieder Sorte für Sorte aufgezählt hatte, nie richtig merken konnte.
Der Sozialarbeiter lief den Pflasterweg auf und ab und sprach ins Telefon. Gerade als er mit dem Rücken zur Straße stand und aufgeregt etwas in sein Handy sagte, wurde die Pforte zum Garten aufgeschoben, und Amalia trat ein. Sie hielt in jeder Hand einen Koffer, einen roten und einen blauen, ihr Kleid an diesem Tag war weinrot, mit weiten Taschen und einem gelben, breiten Gürtel mit großer Schnalle. Sie trug eine Reihe von Halsketten aus gelb gefärbten Muscheln, eine riesige Sonnenbrille mit gelbem Rahmen und braune Handschuhe, Stiefel und ein weiß geblümtes Tuch, das ihr feuerrotes Haar zurückband. Sie blieb hinter der Pforte auf dem Pfad stehen, schob ihre Brille in die Haare zurück und musterte mich und Milena, während der Mann ihr noch den Rücken zugewandt hatte. Ihr Blick sprang zwischen uns hin und her, dann verhärtete sich der Zug um ihren Kiefer. Sie ließ ihre Koffer stehen und tippte dem Sozialarbeiter auf die Schulter, der erschrocken herumfuhr. Als er sie sah, ließ er sein Handy sinken.
»Entschuldigt die Verspätung, aber jetzt bin ich ja hier«, sagte Amalia an Milena und mich gewandt. Sie nahm uns nicht in die Arme, sie streichelte uns nicht über die Köpfe, sie schloss einfach nur die Haustür auf und führte uns durch ein Labyrinth aus Bücherstapeln, Möbeln und Regalen. In der Küche räumte sie wortlos vier Stühle frei, riss die Tür zum überwucherten Kräutergarten auf und stellte den Wasserkocher an. Milena und ich hielten uns an den Händen, wir standen im Türrahmen, der Sozialarbeiter hinter uns. Amalia stützte sich mit dem Rücken zu uns mit beiden Händen an der Spüle auf, ihre Schultern hoben und senkten sich ein paarmal, der Mann hinter uns räusperte sich. Sie blieb noch einen Moment regungslos, dann wandte sie sich zu uns um, fand zielsicher meinen Blick.
»Kommt, setzt euch«, sagte sie, holte Honig aus dem Schrank und einen Apfel aus ihrer Handtasche, den sie in Schnitze teilte und mit dem Honig übergossen vor uns hinstellte.
Dann hörte sie dem Mann mit dem Pferdeschwanz eine Weile schweigend zu, unterschrieb einige Zettel und begleitete ihn zur Tür. Als sie zurückkam, setzte sie sich zu uns an den Tisch, an dem Milena wortlos mit ihrer Puppe spielte und nicht aufsah, auf dem ich etwas Tee verschüttet hatte und mit klebrigen Honighänden in die Pfütze Gesichter malte.
»Jetzt sind es also nur noch wir drei«, sagte Amalia, nahm ihre Brille aus dem Haar, legte ein Magazin auf dem Tisch und seufzte.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht geglaubt, dass Milenas und meine Eltern wirklich gestorben waren. Ich dachte, es müsse sich um einen Fehler handeln, dass die Leute vom Jugendamt bestimmt andere Kinder meinten und eine Verwechslung vorlag, dass sich alles aufklären würde und meine Eltern braun gebrannt und mit lachenden Gesichtern und strahlenden Augen jeden Moment von ihrer Forschungsreise zurückkehren würden.
»Wo sind Mama und Papa?«, fragte ich also.
Amalia holte tief Luft. »Tot, mein Kind, von ihrer Chartermaschine sind nur noch geschmolzene Metallteile und Asche übrig. Niemand überlebt einen Absturz dieser Art. Es tut mir leid«, sagte sie.
Milena sah von ihrer Puppe auf und starrte Amalia an.
»Du lügst«, sagte sie leise.
»Ich wünschte, es wäre so. Aber mit einem hatten eure Eltern recht, auch wenn sie sonst wenig Sinn für Erziehung hatten: Es bringt nichts, euch anzulügen, wenn man die Lüge später sowieso aufklären muss«, sagte Amalia.
Milena sah zurück auf ihre Puppe.
Es würde noch einige Tage dauern, bis die neue Realität wirklich in unsere Köpfen eingesickert war. Es fühlte sich an wie ein böser Traum, aus dem Kneifen nicht als Aufwachhilfe nutzte, ein Traum, der sich über unsere Normalität gestülpt hatte und nicht enden wollte.
Später an dem Tag, Amalia hatte uns im zweiten Wohnzimmer vor den Fernseher gesetzt und eine Kinderserie angemacht, folgte ich ihr in den Garten. Ich folgte der Spur aus niedergetretenen Gräsern von der Küchentür bis zu einer halb überwachsenen Holzbank unter dem Apfelbaum, auf der Amalia saß und rauchte.
Ich blieb vor ihr stehen. »Was machst du?«, fragte ich.
»Ich rauche«, sagte sie und blies eine Wolke in die Zweige des Baumes über uns.
»Papa sagt, rauchen ist ungesund«, sagte ich.
»Papa ist nicht hier, mein Kind, das ist ja der Schlamassel. Sonst würde ich auch gar nicht rauchen. Komm, setz dich einen Moment zu mir. Wo ist denn deine Schwester?«, fragte Amalia.
Ich setzte mich neben sie auf die Holzbank und spielte mit den Fingern am Saum meines Hemdes. »Vor dem Fernseher«, sagte ich und fügte hinzu: »Das ist auch ungesund«, und Amalia lachte hustend.
»Keine Sorge«, sagte sie, »das wird nicht zum Dauerzustand. Ich brauchte nur ein Momentchen zum Nachdenken, weißt du?«
Ich nickte, und Amalia blies eine weitere Qualmwolke in den Himmel.
»Sarah, willst du den Tropenhelm nicht abnehmen, mh?«
»Nein«, sagte ich. Das Forscherinnenkostüm mit den Kakihosen, dem hellen Hemd und dem Tropenhelm hatte ich nicht mehr ausgezogen, seit Milena und ich vom Absturz über dem Amazonas gehört hatten.
»Mich hat das schon immer gewundert«, sagte Amalia, »wenn die Rede davon ist, was Forscher alles entdeckt haben. Ich meine, Tropenforscherinnen und so. Dann heißt es, sie haben eine Pyramide im Dschungel gefunden oder eine neue unbekannte Tierart, und ich denke immer: Aber da wohnen ja Leute drumherum, die wussten, dass es diese Ruinen gab und das Dschungeltier mit Streifen. Was heißt hier also eigentlich Entdeckung? Hätte man mal nachgefragt, hätte man sich mal die Mühe gemacht, die Leute vor Ort zu verstehen, hätten die einem das sicher sagen können. Muss man denn immer mit dem Flugzeug in die sogenannte Wildnis raus, auf die Gefahr hin, dass man abstürzt und seine Verwandten ohne irgendeine Vorwarnung zurücklässt, um was Neues zu finden, auch wenn das Neue eigentlich den Menschen dort schon längst bekannt ist?«, sagte Amalia. Ihre Stimme war immer lauter geworden, und sie blies ihren Rauch in kürzeren Abständen in die Luft.
Über ihre Worte dachte ich einen Moment nach.
»Wir müssen jetzt zusammenhalten, wir drei, Sarah. Du, Milena und ich. Das wird nicht einfach, aber gemeinsam kriegen wir das schon hin. Es würde ja mit dem Teufel zugehen, wenn nicht«, fügte Amalia schließlich hinzu.
Meine Finger verharrten in ihrer Bewegung, der Saum meines Hemdes fransig unter meinen Fingerkuppen.
»Den Teufel gibt es nicht«, sagte ich.
»Stimmt«, sagte Amalia, »stimmt. Aber Jugendämter gibt es, und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen Ordnung schaffen. Das kriegen wir schon hin.«
Dann drückte sie ihre Zigarette aus und stopfte sie in ein halb mit Stummeln gefülltes Einmachglas, das unter der Holzbank stand.
»Komm jetzt«, sagte sie, »lass uns mal nach deiner Schwester gucken, bevor das Fernsehen zu ungesund wird.«
Und dann waren es nur noch wir drei.
An dem Abend und in den folgenden paar Nächten schliefen Milena und ich in Amalias Zimmer, in ihrem großen Bett mit den schmiedeeisernen Löwenfüßen, in einem Raum mit Regalen voller Bücher und unheimlicher Masken, einem ausgestopften Raben, Muscheln und gerahmten Fotografien. Irgendwann in der ersten Nacht wachte Milena auf und fing an zu schluchzen, und Amalia nahm sie in den einen Arm, mich in den anderen und flüsterte beruhigende Worte und sanfte Sätze, bis wir alle drei aneinandergekuschelt wieder einschliefen.
In den ersten Tagen nahm sie uns mit auf den Dachboden, den sie ausräumte, mit Lichterketten dekorierte und in dem sie, nach mühseliger Säuberungsaktion, zwei Holzbetten unter den gegenüberliegenden Dachschrägen aufbaute. Wenn bei einem der Betten ein paar Schrauben fehlten oder Milena sich beim Spielen mit dem Hammer auf den Finger schlug, sagte Amalia: »Das kriegen wir schon hin.« In diesen Tagen gingen wir einkaufen. Wir kauften Lebensmittel, Süßigkeiten, Pyjamas und Hosen für uns beide und ein neues Forscherinnenkostüm für mich, damit Amalia mein altes waschen konnte, bis wir den Rest unserer Kleidung aus dem Haus unserer Eltern holen konnten. Als ich mich weigerte, meinen Tropenhelm in der neuen Schule auszuziehen, und Amalia mit mir im Zimmer der Rektorin saß, sagte sie: »Wir kriegen das schon hin.«
Wenn der Honig ausging und Milena einen Schreikrampf bekam, der nahtlos in Weinen überging, streichelte sie Milena durchs Haar und seufzte. »Das wird schon wieder, meine Kleine, wir kriegen das schon hin.«
Wenn ich aus der Schule kam mit einem blauen Auge und mich im hintersten Winkel des Gartens versteckte und Milena Amalia die ganze Geschichte, wie ich mich geprügelt hatte, weil die anderen Kinder über mein Forschungsheft gelacht hatten, brühwarm aufgetischt hatte, fand Amalia mich unter einem Oleanderstrauch und legte sich neben mich auf den Rücken in die Halme des zu hohen Grases.
Ich drehte einen Halm in meinen Händen.
»Amalia, bin ich ein Psychopath?«, fragte ich.
Sie wandte den Kopf zu mir. »Wie kommst du denn darauf?«
»Weil ich so gut mit Zahlen bin und mir alles merken kann, aber nie weiß, was die anderen denken. Weil ich nicht die ganze Zeit weine wie Milena, obwohl Mama und Papa tot sind, und weil das alles Anzeichen für einen Psychopathen sind, sagt Martin«, zählte ich die Indizien auf.
»Unsinn«, sagte Amalia. »Dieser Martin hat offensichtlich zu viel Fernsehen geschaut, du weißt ja, wie ungesund das ist, vor allem fürs Nachdenken. Du bist nur einfach anders als Milena, und überhaupt, Trauer ist für jeden anders. Siehst du mich die ganze Zeit weinen?«
»Nein«, gab ich zu.
»Na also«, sagte Amalia. »Wir kriegen das schon hin.«
Was genau wir wieder hinkriegen mussten, hat sie nie so genau erklärt, aber es wurde zum neuen Takt unserer Kindheit, die Antwort auf alle Fragen, die Lösung für alle Probleme und in den ersten Jahren nach dem Tod meiner Eltern die einzige Konstante, an der ich mich festhalten konnte.
5
Hier sind Drachen
Meine nackten Füße ruhten im kühlen Gras. Ich saß auf der Bank unter dem Apfelbaum im Garten. Wenn ich nach oben schaute, flirrte die Sonne durch die Äste und grünen Blätter und wärmte mein Gesicht. Der Wind fuhr auf, das Rascheln des Laubes beruhigte meine Nerven, die seit gestern angespannt waren. Es war Sonntag, der Andrang und das Getümmel und die flohmarktartige Situation der teilweisen Bestandsauflösung lagen zum Glück hinter mir. Das Ganze hatte meine Sinne überfordert, mir Kopfschmerzen bereitet und mich fast außer Gefecht gesetzt.
Die Einnahmen hatte ich bereits gezählt und die Verkäufe katalogisiert, leider war nicht so viel dabei herumgekommen, wie ich mir gewünscht hätte. Dafür war ein Chaos hinterlassen worden, das ich den ganzen Morgen über aufgeräumt hatte. Man würde meinen, dass es bei Bücherstapeln nicht viel aufzuräumen gab, aber es war eine innere Ordnung, die es wiederherzustellen galt. Ich fühlte mich erst wieder wohl in meinen eigenen vier Wänden, nachdem ich mit der Hand über die Buchrücken der meisten verbliebenen Bücher gestrichen und ich mich versichert hatte, dass es sie noch gab, den Boden gewischt, die Fenster geputzt und die Sammlung in Amalias Zimmer kontrolliert hatte. Und nachdem ich eine leise Entschuldigung im Geiste an meine Tante gerichtet hatte für das Sakrileg, unser Haus für die Schatzjäger geöffnet zu haben. Aber auch das hatte mein schlechtes Gewissen nur halb beruhigen können.
Über mir saß eine Elster in den Zweigen und beobachtete mich mit ihren schwarzen Knopfaugen. In der Ferne hörte ich das Läuten einer Kirchturmglocke. Es war bereits Nachmittag, ich konnte den Anruf nicht länger vor mir herschieben.
Ich griff zu meinem Handy. Das Telefon an meinem Ohr tutete. Ich legte auf, bevor die Mailbox drangehen konnte, und wählte Milenas Nummer erneut. Es klickte, als sie endlich dranging.
»Sarah! Wie schön, dass du dich meldest. Aber ich bin grad ziemlich





























