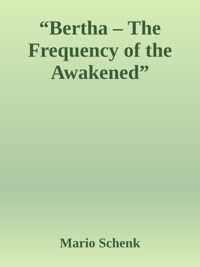4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein einzigartiger Mix aus verschiedensten Legenden und Mythen aus Religion und Geschichte. Susan und ihre Gefährten wurden bei der letzten Auseinandersetzung voneinander getrennt. Während die Wächter um Iris und Nerosa von Afallon aus agieren, um weitere Verbündete zu gewinnen, versucht sich Susan mit unverhoffter Hilfe aus der Gefangenschaft zu befreien. Dabei führen beide Pfade zu unbequemen Wahrheiten. Gerade die Rolle der Weltenwanderer scheint schwerer zu wiegen, als sich jemand hätte ausmalen können. Doch noch ein weiteres Geheimnis steht zur Lüftung an, das insbesondere Susan und ihre Familie vor tiefgreifende Veränderungen stellt: Hierzu erfahren wir endlich, wieso es Susan gelang, nach dem ersten Aufeinandertreffen mit No‘ara, die Geschehnisse aus Band 1 umzukehren und was dies für den weiteren Verlauf ihrer Mission bedeuten kann. Die erschütternde Einleitung zum Finale der vierteiligen Urban & High Fantasy Reihe um das erste Fragment des Elfenkristalls.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Von Magie und Unsterblichkeit
Fragment 1
Impressum
© 2023 Mario Schenkc/o Fakriro GbR / Impressumservice, Bodenfeldstr. 9, 91438 Bad Windsheim
Autor: Mario SchenkUmschlaggestaltung: Sören MedingLektorat, Korrektorat: Lisa Reim
Verlag & Druck: tolino media GmbH & Co. KG, Albrechtstr. 14, 80636 München
ISBN:
978-3-757-94660-9 (Taschenbuch)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.vmuu.dewww.marioschkah.de
Teil 3: Die Bürde von Medina
mit einem herzlichen Dank an
meine Testleser
Leonie Eberl
Marco Ruckerbauer
Präludium 5 - Auf ewig
Da’ken las in Nerosa wie in einem offenen Buch. Worte und Bilder drangen in Massen auf ihn ein und füllten seinen Kopf mit Wissen über unzählige Welten und Völker. Nur wenige Seiten waren unleserlich oder unvollständig.
Auch das Wissen über das Weltenspringen eignete er sich an. Doch ihre zu verschiedene Physis hinderte ihn daran, es zu versuchen.
Er musste sich etwas anderes überlegen. Schnell.
Die flüchtige Weltenwanderin durfte nicht Alarm schlagen und mehr dieser Medinae nach Ka’ara führen. Mehr potentielle Bedrohung für Ka’ara und seine Schwester.
Wie allein durch den Wunsch, den Drang nach Medina zu gelangen, tat sich vor Da’ken eine große schwarze Verzerrung auf. Wie das Loch in einer Leinwand klaffte es in dem frostigen Gemälde von Ka’aras Eislandschaft.
Da’ken ließ von Nerosa ab und blickte auf die Narach, die sich weiter erwartungsvoll hinter ihren neuen Gebieter reihten.
„Hinterher!“, rief er, worauf sich die Kreaturen zu Tausenden durch die Verzerrung stürzten.
Da’ken wandte sich an die wenigen hundert verbliebenen Ka’ara. „Geleitet meine Schwester zurück ins Schloss und sorgt für sie.“
Mit Nicken und Bejahungen setzten sie sich zusammen mit Nerosa auf der Stelle in Bewegung. No’ara hoben sie in ihre Mitte, die mit schwachem Blick auf ihren Bruder starrte. Da’ken sah es ihr an, dass sie nicht von ihm getrennt werden wollte.
Genau so ging es ihm selbst. Doch zunächst musste diese Weltenwanderin gestellt werden.
Mit raschem Schritt trat er mit dem nach wie vor anhaltenden Strom an Narach um sich durch die Verzerrung.
Kaum einen Fuß vom niedergetrampelten Schnee auf noch härteren Boden gesetzt, stach die Helligkeit schmerzend in seine Augen. Durch seine Finger erblickte er eine Vielzahl an Blitzen, die in den Himmel flüchteten, wie jener der entflohenen Iris von Ka’ara.
Eine Großzahl raste wie in einem Bündel in dieselbe Richtung, doch nochmal so viele stoben einzeln in unterschiedliche davon.
Da’kens Blick folgte nur einem bestimmten Lichtblitz. Sein Gefühl sagte ihm, dass es Iris sein musste. Hatte sie genug Zeit gehabt, um ihre Art aufzuklären? Oder flohen sie allein vor den einfallenden Narach, die sich wie ein schwarzer Teppich über eine felsige, aber begrünte Fläche mit einer nahegelegenen Stadt aus weißen Gebäuden mit hohen, schmalen Türmen legten?
Da’ken erreichte Iris’ Geist bei der Entfernung und ihrem nicht körperlichen Zustand leider nicht gut genug, und im nächsten Moment war sie schon außer Reichweite. Doch ihm kam der Name „Axioma“ in den Sinn. Mit Nerosas Wissen hatte er gleich darauf eine Vorstellung von dieser anderen Welt.
Er öffnete eine Verzerrung und schritt hindurch.
Iris’ Lichtblitz kam gerade vom violetten Himmel herabgefallen. Doch sie setzte nicht auf dem roten Sand auf, sondern schoss sofort wieder davon.
„Netrell“ war der nächste Weltenname, der in Da’kens Kopf auftauchte und zu der er ein klares Bild vor Augen hatte. Während die ersten Narach durch die Verzerrung folgten, öffnete Da’ken eine weitere.
Aber auch auf dem matschigen, mit jedem Schritt Dunst aufwirbelnden Untergrund, wurde Da’ken nur Zeuge von Iris’ Eintreffen und Davonschnellen.
Durch zehn weitere Welten verfolgte Da’ken Iris auf diese Weise, ohne ungeduldig zu werden. Im Gegenteil. Solange keine Welt auf ihrem Weg lag, von der Da’ken keine Vorstellung hatte, würde sie nicht entkommen können. Und die Narach auf seiner Fährte würden sich gleich um die Bewohner kümmern, ehe diese sich zu einer Gefahr entwickeln konnten. Dies ersparte ihm später die Entscheidung der Reihenfolge.
So betrat er gelassen die hohe, schilfartige Landschaft von Doronia und fand sich von hunderten, heranspringenden Wesen in katzenartiger Gestalt umzingelt. Noch bevor er Nerosas Wissen in seinem Kopf über die Bewohner dieser Welt konsultieren konnte, entging er dem Schlag eines Beins, das wie eine Sichel durch das Schilf schnitt. Der Angriff hätte ihn bei dieser absurd hohen Geschwindigkeit mit Sicherheit in zwei Hälften geschnitten. Unmittelbar darauf wich er einer Kralle nach hinten aus und blockte einen folgenden Faustschlag mit dem festesten Schild, das er noch schaffte aufzubauen.
Die Wucht schleuderte ihn zur gegenüberliegenden Reihe an Doroniern, die nicht auf sein Auftreffen warteten, sondern im Begriff waren, ihm entgegenzuspringen. Im letzten Moment öffnete Da’ken für den Bruchteil einer Sekunde eine Verzerrung und stürzte auf seiner Flugbahn hindurch.
Er schlug auf dem schwarzen Boden des Gebieterschlosses auf. Schwer atmend stützte er sich sofort mit den Armen davon ab, um sicher zu gehen, dass ihm niemand gefolgt war.
Was zum Hüter?!
Haben diese Wesen ihn erwartet? Hatte sie jemand gewarnt? Iris hatte unmöglich Zeit dazu gehabt.
Er versuchte, mit tiefen Atemzügen seinen Puls zu senken und die panische Starre aus seinen Gliedern zu pumpen.
Einer der Saalgänger kam auf Da’ken zugelaufen. „Mein Gebieter! Ihr seid verletzt!“
Da’ken schaute fragend zu dem Bediensteten auf, der ihm ein Tuch reichte. Tatsächlich spürte er jetzt ein Brennen an seiner linken Wange.
Er nahm das Tuch, drückte es einmal dagegen und blickte mit weiten Augen darauf.
Drei kurze Striche blauen Blutes fand er auf dem Stoff.
Da’ken hätte schwören können, dass er den Krallen noch entgangen war. Doch konnte es sein, dass allein der Luftzug schon diese Schnitte verursacht hatte?
Er legte das Tuch wieder an die Wange und ließ sich auf die Beine helfen. „Wo ist meine Schwester? Wie geht es ihr?“
„In ihrem ersten Schlafzimmer. Ihr Zustand ist deutlich besser, nur etwas kraftlos. Aber mit Abnahme ihrer Schwäche steigt auch ihre Ungeduld.“
Da’ken trennte sich von seinem Untergebenen, in dessen Augen sein eigenes Grün leuchtete, und machte sich gefestigten Schrittes auf den Weg zu No’aras Gemächern im Westflügel. Den Doroniern würde er sich später widmen. Die Spur zu Iris schien fürs Erste verloren.
Es hatte sich in so kurzer Zeit so viel verändert. Die Welt war mit einem Schlag auf eine unvorstellbare Größe angewachsen. Wie sollte er sein Volk, seine Heimat, seine Familie je gänzlich davor schützen können?
Es reichte nicht, nur da zu sein. Er konnte nicht mal mehr versprechen, in No’aras Nähe zu bleiben, wenn er sich den anderen Welten widmen musste.
Eine Barriere um ganz Ka’ara.
Würde das reichen? Wie viele Arten zu Reisen gab es? Er konnte nicht alles bedenken. Früher oder später würde jemand einen Weg hindurch finden.
Da’ken musste mehr für den Schutz seiner Schwester tun. – Auch vor ihm selbst. Vor jeglicher Gefahr. Sie musste leben, gesund sein und glücklich. Doch wie konnte er das alles zusammen sicherstellen? Sie in einen goldenen Käfig zu sperren wäre ihrem Glück sicherlich abträglich. Auf zufriedene Art und Weise ihr Leben zu führen, würde sie dagegen unkalkulierbaren Risiken aussetzen.
Etwas muss ihr das Leben garantieren, selbst wenn sie es verlieren sollte, zerbrach sich Da’ken weiter den Kopf, als er die Treppenstufen hinter sich gebracht hatte.
Vor der Tür zu No’aras Schlafzimmer hielt er einen Moment inne, um sich wieder einen klaren Kopf zu verschaffen, ohne zu einem Ergebnis gekommen zu sein.
Er öffnete die Tür und trat ein.
No’ara stand unruhig mitten im Raum. Ihr Blick richtete sich sofort auf Da’ken. Ihre Wangen schienen noch feucht. Noch mehr ihre Kleidung, an der ihr blaues Blut klebte.
„Wieso bist du noch nicht umgezogen?“, fragte Da’ken aufgebracht.
No’aras drei Kammermädchen, allesamt weit älter als No’ara selbst, standen mit beschämt geneigten Köpfen in einer Ecke, mit Handtüchern und frischer Kleidung in den Händen. Eine von ihnen zeigte eine blau verfärbte Gesichtshälfte wie von einer kräftigen Ohrfeige.
No’ara stürzte unter Tränen auf Da’ken zu und umklammerte ihn in seiner ebenfalls noch von Schmelzwasser feuchten Kleidung.
„Es tut mir so leid, es tut mir so leid“, schluchzte sie in seine Schulter. „Ich hätte hierbleiben sollen. Bitte sei mir nicht böse.“
Da’ken drückte No’ara fest an sich. Auch in seine Augen trieb es Tränen. Er küsste sie auf das Haupt. „Nein, mir tut es leid. – Und ich werde deinen Wunsch erfüllen. Ich werde dir zu eigenen Kräften verhelfen.“
No’ara hob den Kopf und blickte Da’ken mit stetig strahlenderen Augen an. Sie vergrub das Gesicht wieder in seiner Schulter. „Oh, danke, danke. Vielen, vielen Dank. Ich will auch immer gehorchen. Ich will auf ewig deine kleine Schwester bleiben. Ewig und immer.“
Da’kens Herz schlug kräftig und so unbeschwert, wie schon seit Kindertagen nicht mehr. Diese Wärme, die ihn in diesem Moment durchfuhr. Darauf hatte er so lange gehofft und ausgeharrt, ungewiss, ob es jemals eintreten würde.
Auch wenn er noch nicht wusste, wie er No’ara mit Kräften ausstatten konnte, es würde ihm auf irgendeine Art gelingen. Dieses Versprechen würde er keinesfalls brechen.
Er strich mit langen Bewegungen durch No’aras weißes Haar, als ihm noch eine weitere Idee in den Sinn kam.
Präludium 6 - Expansion
In nur wenigen Monaten unterjochte Da’ken über ein Dutzend Welten. Zunächst bot er allen Völkern von kriegerischer Natur eine bedingungslose Kapitulation an, wofür Nerosa als Dolmetscher herhalten musste. Diese wurde erwartungsgemäß stets ausgeschlagen.
Anschließend fegten die Narach über sie hinweg und nährten sich an ihnen, bis sie schließlich doch auf das anfängliche Angebot zurückkamen.
Hatten sich talentierte Individuen durch ihren außergewöhnlichen Widerstand behaupten können, wurden sie rekrutiert und in Formationen der eigenen Streitmacht einverleibt.
Da’ken stellte auch wieder eine Armee aus Ka’ara auf, welche den anderen Gruppierungen vorstand. Dabei spürte er den inneren Trotz gegen den reinitialisierten Kriegsdienst unter seinem Volk, doch er wurde nicht offen zu Tage getragen. Nein. Sie fügten sich auf loyalste Weise. Nach seiner Schwester waren seine Untertanen die nächsten, denen Da’ken uneingeschränkt vertrauen konnte. Und das nicht nur aufgrund seines Einflusses.
In ihnen spiegelte sich vielmehr Da’kens eigenes Widerstreben, diesen Schritt gemacht zu haben. Aber er brauchte einen starken militärischen Rückhalt. Gerade bei Doronia, worum er bisher einen großen Bogen geschlagen hatte. Hätte sich die erste Verzerrung nicht mit jener von Da’kens Flucht geschlossen, wären die folgenden Narach zumindest schwerwiegend reduziert worden. Selbst seine zusammengesammelte Streitmacht, so beeindruckend sie sein mochte, wäre gegen diese Bewohner hoffnungslos unterlegen, wenngleich auch mit hohen Verlusten auf der anderen Seite. Sobald seine heimische Kampfformation ein paar weitere Monate des Trainings hinter sich gebracht hatte, würde er einen Versuch wagen.
Ob er hierbei im Vorfeld eine diplomatische Lösung anbieten sollte, wenn er überhaupt die Gelegenheit dazu bekäme? Mit seiner augenblicklichen Umzingelung und dem unmittelbaren Angriff hatte es nämlich den Eindruck erweckt, als hätten sie genau um Da’kens Intention gewusst und dass er in jenem Moment mit den Narach an dieser Stelle auftauchen würde.
Eventuell brauchte es hier eine ganz andere Taktik.
Doch vorerst war Da’ken zufrieden. Weitere Welten wurden Tag um Tag erobert. Auch friedfertige wurden unterworfen, wenngleich mit weniger starker Hand. Selbst wenn sie nach aktuellem Stand keine Gefahr darstellten, mussten sie überwacht werden – und sich an ihren Kulturen bedient.
Tatsächlich erfreuten sich die Ka’ara an den Waren aus fremden Welten. Neuartige Stoffe, Schmuck, exotisches Essen …
Unter dem Lächeln seiner Landsleute fand sich auch No’aras freudiges Gesicht auf einem der Wandermärkte. Mit ihren nun pechschwarzen Haaren war sie aus der Menge hunderte Meter heraus zu erkennen.
Schon von weitem wurde Da’ken von den ersten Händlern mit lauten Rufen und ausladenden Gesten herangewunken und willkommengeheißen. Ohne Leibwächter, nur in Begleitung von sechs Zofen, drei zu jeder Seite hinter ihm, schritt er mit aufmerksamem und freundlichem Blick nach links und rechts durch seine Untertanen. Doch Halt machte er an keinem der Stände.
Er arbeitete sich weiter auf No’ara zu, die ihn noch nicht bemerkt hatte, trotz des Getöses und des Beiseiteweichens der Marktbesucher für den Gebieter.
No’ara betrachtete sich in einem Spiegel. Sie trug eine Art Kopfbedeckung aus roten, feinen Kettchen, die im Schwarz ihrer Haare leider wenig zur Geltung kam.
In ihrem Spiegelbild bemerkte Da’ken No’aras Enttäuschung. Doch die gesenkten Mundwinkel zuckten sofort nach oben, als sie ihn hinter sich entdeckte.
„Bruder!“ Sie schnellte herum und fiel ihm in die Arme. „Du bist zurück. Wie schön.“
Das Getöse um ihn ausgeblendet, stimmten sich Da’kens Sinne nur auf den Geruch seiner Schwester, den Druck ihrer Arme und das Gefühl ihres Körpers an seinem ein.
Nun erst war Da’ken wirklich wieder zu Hause.
„Gefällt dir das Geschmeide nicht?“, holte sich Da’ken aus der wohligen Empfindung.
No’ara schüttelte den Kopf, ohne ihr Gesicht von seiner Schulter zu nehmen.
Da’ken tippte sanft auf eine Stelle des metallischen Geflechtes, worauf sich das Rot zu Weiß färbte. „Mir gefällt es sehr gut. Schau nochmal in den Spiegel.“
No’ara löste sich mit fragendem Blick von Da’ken und mit einem Gesichtsausdruck, als hätte man sie gerade nach einem langen Schlaf geweckt.
Sie trat an den Spiegel. Mit weiten Augen und einem breiten Lächeln betrachtete sie sich. Gleich darauf schnellte sie zurück in Da’kens Arme. „Danke.“
„Sehr gerne. Aber das hättest du selbst auch vollbringen können.“
No’ara verharrte still, während der Druck ihrer Umarmung ein wenig abnahm.
Im nächsten Moment öffnete sich hinter No’ara eine schwarze Verzerrung, in die sie sich durch einen weiten Schritt rückwärts mit Da’ken hineinzog.
No’ara trennte sich mit gesenktem Kopf von Da’ken und ging auf das Fenster ihres schon lange verlassenen Kinderzimmers zu, um in den Innenhof zu blicken. Dieselbe Stelle, an der ihre Mutter an jenem folgenschweren Tag gestanden hatte.
Was wollte sie hier? Der gesamte Flügel stand seit der Rückeroberung von Ta’kon leer. Zu sehr hatten er und seine Anhänger die Zimmer besudelt. Neben unschönen Erinnerungen auch mit allerlei Abarten.
„Ich mache mir Sorgen“, sagte No’ara mit schwachem Ton.
Da’ken trat mit einem anschwellenden Schmerz in seiner Brust langsam auf No’ara zu, die ihren Blick weiter nach draußen gewandt hatte.
Worüber konnte sie sich denn Sorgen machen? Hatte er noch nicht genug getan, um jegliche Angst vor Bedrohung auszulöschen?
„Worüber?“, fragte er sanft, doch die Nervosität kribbelte auf seiner Haut.
Was konnte er übersehen haben?
No’ara drehte sich herum, aber sie schaute ihm nicht in die Augen. „Ich weiß, dass du mir keine eigenen Kräfte gegeben hast – nicht geben konntest. Stattdessen zehre ich an deinen, nicht wahr?“
Da’ken stand wie versteinert vor ihr. Wie konnte sie …?
No’ara blickte ihn nun direkt an. „Ich sehe, wie dich das alles belastet. Ich spüre es sogar. Vor allem durch die Lichtkuppeln über den Städten von ganz Ka’ara. Aber auch mit den schwarzen Toren, durch die du mit den Armeen schreitest oder die Narach selbst durch dich erschaffen dürfen. Ich hatte die ersten Wochen Spaß damit, Kräfte zu haben. Doch nicht länger für diesen Preis.“
Da’ken atmete tief durch. Er konnte es nicht leugnen.
Beim Blick in den Spiegel hatte er es anfangs selbst nicht wahrhaben wollen. Aber er alterte zusehends. Nun mit No’aras einfacher Telekinese von Stühlen und Tischen bis hin zum Zersprengen und Wiederaufbau verlassener Steinhäuser furchte sich jede Anwendung tiefer in Da’kens Gesicht.
Nicht dass er kurz vor der Altersgebrechlichkeit stand, doch auf Dauer würde es ihn einige Jahre seiner Lebenszeit kosten. Lebenszeit, die er nicht mehr mit No’ara verbringen konnte.
Da’ken hatte sich schon früher über die Zukunft Gedanken gemacht.
So sehr er auf No’ara achtete, würde sie in nicht allzu weiter Ferne zu einer Frau heranwachsen. Wie würde sich das auf ihr Verhältnis auswirken? Würde sie weiter unter seinem Schutz leben wollen als seine kleine Schwester? Oder würde sie auf eigenen Beinen stehen, sich einen Gefährten suchen und ihren Bruder nur noch mit gelegentlichen Besuchen bedenken?
Eine weitere Sache, die ihm Kopfzerbrechen bereitete, war die Nachfolge, die er irgendwann ins Auge fassen musste. Der Grundstein für folgende Generationen gehörte gesetzt, indem er sich selbst eine Partnerin wählte. Doch wie würde No’ara auf sie reagieren?
Dabei störte Da’ken der Gedanke, dass sich jemand in ihre Zweisamkeit mischen könnte.
Ihm ging seit dem Tag des Einfalls der Narach ein Satz nicht aus dem Kopf, den No’ara geäußert hatte.
Er trat nah an sie heran und blickte ihr tief in die Augen. „Weißt du noch, was du nach deiner Verletzung zu mir gesagt hast?“
No’ara runzelte die Stirn. „Dass ich gehorchen will?“
Da’ken schüttelte sanft den Kopf. Sein Herzschlag stieg an. Sollte er es wirklich zur Sprache bringen? Da’ken atmete tief ein, ohne No’aras Augen aus dem Blick zu verlieren. „Du sagtest, du willst auf ewig meine kleine Schwester bleiben. – Ewig und immer.“
No’aras Gesichtszüge glätteten sich zu einem selbstverständlichen Ausdruck. „Ja, sicher.“
Da’ken schluckte durch seine vor Aufregung staubtrockene Kehle. „Würdest du tatsächlich mit mir zusammen die Ewigkeit verbringen wollen, als meine kleine Schwester?“ Vorsichtige Euphorie mischte sich in seine Stimme, die nahezu einem Betteln anmutete. „Wir brechen aus dem Kreislauf des Lebens aus und existieren für immer und ewig, ohne auch nur einen weiteren Tag zu altern. Ich habe mir das genau überlegt. Nichts würde sich verändern. Alles bleibt so, wie es jetzt ist.“
Da’kens Begeisterung steckte das Feuer in No’ara erst langsam an, doch es breitete sich schnell zu einem Flächenbrand aus. „Ja. Ja! Unbedingt!“
In Da’kens Gesicht zeichnete sich das breiteste Lächeln ab, das er jemals aufbringen konnte, was No’ara noch weiter in Aufregung versetzte.
„Was müssen wir dazu machen? Wie kann ich helfen?“
Da’ken drängte sich, etwas Ruhe in sich einkehren zu lassen, um seinen Plan klar erläutern zu können. „Wir müssen im Grunde genommen sehr wenig dafür leisten. Es kommt auf unser Volk an und auf wenigstens einen Narach als Übermittler.
Würden uns alleine die älteren Bürger eines ihrer restlichen Lebensjahre überlassen, genügte dies nicht nur für unsere ewige Existenz. Es böte auch ausreichend Potential für die Nutzung unserer Kräfte, ohne dass wir weiter an meiner eigenen Substanz nagen müssten.“
Gerade mit den letzten Worten sprühten No’aras Augen förmlich voller Hingabe zu dieser Idee.
Da’ken atmete auf. Nicht nur, weil er seiner Schwester die Sorgen hatte nehmen können, sondern vielmehr wegen ihrer überschwänglichen Zustimmung zu seinem innigsten Wunsch.
Er und No’ara würden für immer zusammengehören. Niemand würde sich zwischen sie drängen können.
Das Volk der Ka’ara war nicht schwer von dem Vorhaben zu überzeugen. Abermals war nicht sein verstärkender Einfluss auf sie von entscheidender Bedeutung. Vielleicht sollte er ihn sogar zurücknehmen. Doch sollte es irgendwann Ausreißer geben und sie unentdeckt eine Rebellion anzetteln …
Im Augenblick zumindest war es ihnen ein geringer Preis, ihren geliebten und gütigen Gebieter auch über Generationen an ihrer Spitze zu wissen, indem sie ihm und No’ara lediglich je ein Lebensjahr opferten.
Dazu löste die versprochene Aussicht, sobald alle Welten der Weite erobert seien, ihren Militärdienst nur noch auf freiwilliger Basis fortsetzen zu müssen, geradezu Begeisterungsstürme im ganzen Land aus.
Und bei dem Angebot, dass sie ihm alle ein weiteres Jahr opfern sollten, um die Sonne wieder zu entfachen, waren die Bürger nicht mehr zu halten. Tagelang feierte man über die Grenzen hinaus, bis der Tag gekommen war, an dem sich die Narach über Ka’ara verteilten, um den Tribut einzufordern und an Da’ken zu übereignen.
Auch viele der benachbarten Karshar und Deto’nash fanden sich mit Freuden in der Hauptstadt ein, um dem Ereignis beizuwohnen. Sie wollten Teil der Geschichte sein und zahlten sogar selbst einen Obolus von ein paar Tagen bis hin zu mehreren Wochen ihrer Lebenszeit.
An der Stelle, wo Da’ken der Welt unter Ta’kons Tyrannherrschaft das Sonnenlicht genommen hatte, um den Thron zurückzuerlangen, stand er auf einem breiten Podest. No’ara und alle anderen aus erster Reihe himmelten ihn an. Nachdem sich Da’ken ausgiebig der tosenden Menge präsentiert hatte, blickte er mit einem verstohlenen Lächeln zu seiner Schwester.
Er hatte eine Überraschung für sie.
Seinen Arm zu hier gestreckt, holte er sie zu sich herauf und flüsterte ihr ins Ohr: „Wollen wir es gemeinsam vollbringen?“
No’ara blickte ihn für einen Moment an, als würde er scherzen. Doch dann zog Vorfreude in ihr Gesicht. „Was muss ich tun?“
Da’ken zeigte nach oben, worauf sich die Lichtkuppel über der Stadt von diesem Punkt aus auflöste. Sein Finger war auf den kaum zu erkennenden Schatten inmitten des klaren Sternenhimmels gerichtet, während die Kälte in einer Welle heranzog.
„Wir blicken mitten hinein und entzünden die Kugel aus unserem Inneren heraus. Du musst es dir ganz genau vorstellen und nicht von dem Gedanken abweichen. Drücke deine Vorstellung hinauf, bis sie das Ziel erreicht, und halte daran fest bis sie sich entfaltet.“
No’ara nickte ihm entschlossen zu und richtete den Blick in den Himmel. Da’ken begab sich hinter sie, während Ruhe in die Menge um sie herum einkehrte und sie zusammen mit ihrem Gebieter den Blick ebenfalls nach oben lenkten. Er hob den rechten Arm mit zwei gestreckten Fingern in die Sichtlinie seiner Augen.
No’ara tat es ihm gleich. Da’ken spürte die ansteigende Energie in No’aras Körper vor sich. Er lächelte zufrieden. „Gut so.“ Doch nun musste er sich selbst konzentrieren, sonst konnte es in einem Desaster enden.
Minute um Minute verstrich, in denen mehr und mehr Schweißperlen auf seine Stirn traten und beim Tropfen auf den Boden sofort gefroren. Doch schließlich glimmte ein winziger Punkt auf. Gleich darauf weitere, die sich verbanden. Letztlich schwappte eine tief in die Augen stechende Helligkeit in einer überwältigenden Welle über das gesamte Firmament hinweg und verschluckte den dunklen Himmel samt seiner Sterne.
In kurzen Schmerzensschreien wandten alle Beobachter die Gesichter ab, doch die Blendung klang zusammen mit dem Eintreffen der Wärme auf Haut, Haaren und Kleidung ab.
Erste Jubelschreie drangen an Da’kens Ohren, während er sich selbst noch von der Grelle erholte. Er tastete nach No’ara und bekam ihren Arm zu greifen. Mit einem Ruck zog er sie an sich. „Das hast du toll gemacht. Geht es dir gut?“
No’ara drückte sich an ihn und nickte. „Ja. Vielen Dank.“
Ohrenbetäubender Lärm voller überschwänglicher Begeisterung umzog die beiden und hallte weit über die Stadtgrenzen hinaus.
Sie trennten sich voneinander, nahmen sich an der Hand und präsentierten sich ihrem Volk, bevor sie in den Himmel davonstiegen und sich hinter die Schlossmauern begaben.
Auch wenn es nicht an ihrer eigenen Energie gezehrt hatte, war No’aras Körper dennoch in der Umsetzung durch Erschöpfung gezeichnet.
Da’ken geleitete seine Schwester zu einem ihrer Zimmer, das von der feiernden Stadt abgewandt lag, während die Kammermädchen hinter ihnen aufschlossen.
Mit schweren Augenlidern blickte sie zu Da’ken hoch. „Darf ich dich bei deiner nächsten Eroberung begleiten?“
Die Bitte kam nicht überraschend. Er hatte eigentlich früher damit gerechnet.
Er ging kurz in sich. Als Nächstes stand eine moderat aggressive Welt an, mit nur wenigen Jägern und Wachen der Adeligen, aber mit noch gering erforschtem magischen Potential.
Gerade in No’aras Begleitung würde er mit der gesamten Stärke der Narach, die inzwischen durch üppige Nahrung über die letzten Monate kräftig gewachsen war, nach Eilia schreiten.
„Ja, du darfst.“
Fast schon im Stehen schlafend glitt ein glückliches Lächeln auf No’aras Lippen.
Da’ken half ihr, sich zu entkleiden, und warf einem der Kammermädchen den dünnen Mantel und das lange blaue Kleid zu. Ein anderes Mädchen stand mit ihrem ärmellosen Nachtkleid bereit und zog es No’ara nach kurzem Zögern über, abwartend, ob ihr Gebieter auch diese Aufgabe übernehmen wollte.
Stattdessen nahm er ein befeuchtetes Tuch aus der Hand des dritten Kammermädchens und fuhr No’ara über die Stirn und unter die Achseln die Arme entlang zu ihren Fingerspitzen.
Wie in den Zeiten auf den Giftinseln., schwärmte er halb in Gedanken.
Er setzte sie auf das Bett, legte ihre Beine unter die Decke und zog sie ihr bis ans Kinn. Augenblicklich war No’ara eingeschlafen.
Da’ken strich ihr eine schwarze Strähne aus dem hübschen Gesicht und betrachtete es mehrere Minuten lang. Schließlich gab er ihr einen Kuss auf die Stirn und schritt aus dem Zimmer.
Gleich darauf lenkte er seine Gedanken auf die Vorbereitung der kommenden Mission. Mit No’ara an seiner Seite durfte er nichts dem Zufall überlassen. Sie musste um jeden Preis sicher sein.
Doch zunächst sollte auch er für Erholung sorgen. Er betrat sein Gemach, vor dem bereits seine eigenen Zofen bereitstanden, um ihm zur Hand zu gehen.
Präludium 7 - Wendepunkt
Der Einfall auf Eilia musste um mehrere Wochen verschoben werden, da das Schmelzwasser No’ara und Da’ken über ganz Ka’ara hinweg in Atem hielt. Ihr eigenes Volk konnte sich durch die eigenen magischen Fähigkeiten selbst behelfen. Die benachbarten fragten bereits früh nach Hilfe, die ihnen der Gebieter selbstverständlich gewährte.
Da’ken war ein gütiger Herrscher. Dafür bewunderte No’ara ihren Bruder zutiefst. Auch wenn sie ihn in manchen Situationen doch zu nachgiebig empfand.
Mochte sie zu kleinlich sein?
Allerdings sammelte No’ara diese ganzen Kleinigkeiten immer mehr an.
Das Küchenpersonal, das – wenn auch nur einmal, und er wäre wohl auch noch genießbar gewesen – den Braten anbrennen ließ. Ein Diener, der an ihrem Geburtstagsempfang Wein verschüttete und ein paar Tropfen fast ihr Kleid besudelt hatten.
Doch nichts davon zog Konsequenzen nach sich. Würde sich ihre Dienerschaft an ungerügte Fehler gewöhnen, wie lange dauerte es, bis sich diese Nachlässigkeit im ganzen Volk verbreitete?
So sehr es ihr gefiel, als Retterin vor den Wassermassen gefeiert zu werden, wollte sie auch gefürchtet werden. Ein wenig zumindest. Ihre Kraft gäbe ihr jede Befähigung dazu. Auch wenn diese nun auf der freiwillig vom Volk zur Verfügung gestellten Lebensenergie gründete.
Schließlich kam der Tag der Invasion, auf den No’ara hingefiebert hatte. Doch Ernüchterung zog kurz vor dem Übertritt in ihre gespannte Nervosität ein.
„Du bleibst in der Nähe der Vier“, sprach Da’ken sie von der Seite an, kaum war er vom obligatorischen Angebot der Kapitulation an einen der Herrscher von Eilia zurückgekehrt.
Seine vier Begleiter reihten sich nun um No’ara, während Da’ken die Verzerrung vor der Abertausendende zählenden Armee aus Narach aufspannte.
Die vier zu einem Rang eines Feldherren erhobenen Artgenossen, trugen nicht von ungefähr die Rüstungen der gefallenen Or’kon, Zar’kon, Der’kon und Lur’kon.
Immerhin zeigten sie stetig deutlicher deren charakterliche Züge. Wie auch bei allen anderen Narach diente ihre Nahrung nicht nur ihrem Fortbestand, sondern ebenso ihrer Weiterentwicklung. So blieben sie nicht länger stumm und gaben allein krächzende Laute von sich. Neben Wissen und Sprache eigneten sie sich dazu weitere Eigenschaften ihrer Opfer an, wie auch den Gebrauch von Waffen. Sie waren nicht länger wilde Tiere mit einem Instinkt zum Jagen und Morden, wenngleich dieser nicht an Gefährlichkeit eingebüßt hatte, sondern verhielten sich zivilisierter.
Diese Vier nun als ihre Leibwache abzustellen, gefiel No’ara gar nicht. Sie wollte an der Seite ihres Bruders schreiten, ihm helfen und auch mal auf ihn aufpassen.
Stattdessen trottete sie, inmitten der Feldherren, der Armee hinterher durch das schwarze Loch in einen dämmernden Abend hinein.
Ihre vier Lungenflügel gewöhnten sich schnell an die neue Zusammensetzung der Atemluft. Von der Anhöhe eines Hügelkamms beobachtete sie, wie die Narach wie eine Schmelzwasserwelle, die sie bis vor kurzem noch bekämpfen durfte, in das Tal vor ihnen stürzten. Die Bewohner auf den Straßen einer großen Stadt aus verschiedenartigen Kuppelgebäuden flohen zunächst zu Fuß, verschwanden dann aber durch ein Verschwimmen der Luft um sie herum. Vor allem brachten die Elfen, wie sich die Bewohner von Eilia nannten, ihre Kinder in Sicherheit. Derweil stellten sich andere Frauen und Männer den Angreifern entgegen bis kurz darauf einzelne, dem Anschein nach Kämpfer oder Wachen, vor ihnen erschienen.
Ihren Bruder erblickte No’ara auf einer der breiteren Straßen, einige Reihen hinter der Front.
Er sei immer nah dran, wie er No’ara erläutert hatte. Dadurch verlor er zwar den Überblick über das ganze Feld, aber mit den Augen der Narach hatte er auch seine überall. Wichtiger war für ihn, die Momente an der Frontlinie selbst zu spüren, um den Fortschritt eigens bewerten zu können und gegebenenfalls einzugreifen.
Eine Erklärung, die No’ara wenig einleuchtete. Immerhin begab er sich dadurch in unmittelbare Gefahr. Wenigstens stach er nicht, wie sie mit vier Säulen aus Narach-Feldherren um sich, heraus wie ein Leuchtturm.
No’ara fühlte sich wie eine Bremse und eine Bedrohung für den Erfolg der Mission, als auch der Unversehrtheit Da’kens. Wäre sie nicht hier, könnten die Vier selbst dort unten kämpfen und befehligen oder ihren Bruder schützen, anstatt hier für sie Kindermädchen zu spielen.
Sie wollte sich schon enttäuscht zurückziehen, als ihr zwei Personen in die Augenwinkel gerieten. Äußerst links, im Schatten des ansteigenden Bergrückens, lag ein Felsvorsprung, zu dem eine lange Treppe führte. An den obersten Stufen schienen sich die beiden uneinig.
Eine der silberhaarigen Elfen wies den Anstieg hinunter, um vermutlich zu helfen. Die andere zerrte sie dagegen weiter auf den Vorsprung.
Fast gänzlich im Schatten der Bäume verborgen erkannte No’ara darauf einen Bogen aus Stein.
Eines der Elfentore, von denen der Diener Nerosa bei der Einführung um Eilia erzählt hat? Tore, die in andere Welten führen?
Die eine Elfe hatte die zweite wohl überzeugt, denn nun schritten beide auf das Tor zu, in dessen Bogen sich eine wässrige Wand bildete.
Nein!
Sie durften nicht entkommen.
No’ara trat rasch durch eine schwarze Verzerrung auf den Felsvorsprung, doch zu spät. Beide tauchten in die wabernde Fläche ein, von der sie gänzlich verschluckt wurden.
No’ara wollte sofort folgen, bevor sich das Tor schloss, doch sie zögerte. Stattdessen schleuderte sie schwarze Nebelschwaden auf die Oberfläche, die aus ihren Händen strömten.
Noch selbst von dem Vorgang überrascht, denn in ihrem Kopf hatte sich der Wunsch geformt, den Übergang nur irgendwie offen zu halten, prallten die dunklen Schwaden von dem Tor ab. Einen Augenblick später fiel die wässrige Fläche unter dem steinernen Bogen in sich zusammen.
„Verdammt!“
Verzweifelt stürmte No’ara hinterher, in der Hoffnung, dass sich das Tor wieder öffnen würde, doch sie lief ohne Reaktion durch den Bogen hindurch.
Die vier Feldherren tauchten um sie herum auf und starrten sie finster an.
No’ara schloss die Augen und ließ den Kopf in den Nacken fallen. Na toll. Das hätte meine Gelegenheit sein können.
Und so schritt sie mit den Feldherren an ihrer Seite an die oberste Stufe der Treppe und wohnte weiter der Eroberung durch ihren Bruder bei. Zumindest konnte sie nun an dieser Stelle die Flucht anderer Bewohner von dieser Welt vereiteln.
Ein Trost, der wohl letzten Endes von geringer Bedeutung und Wertschätzung bleiben würde. Entsprechend gut bewacht blieb das Tor natürlich von weiteren Aufsuchenden unbehelligt.
Während die Front durch die Stadt und schließlich auf das Vorland rollte, verstreuten sich Ausläufer der Heeresformation in die verwinkelteren Straßen und Gassen. No’ara beobachtete das barbarische Vorgehen der Narach, wie sie die überlebenden Bewohner an sich zogen, eine Kralle an ihrer Brust, den weit geöffneten Schlund über ihrem Gesicht. Zu hunderten verfolgte sie die Narach bei ihrer Nahrungsaufnahme.
Ob das Volk der Ka’ara auch auf diese Weise ihren einjährigen Tribut zollen musste? Gut, dass Da’ken sie unter Kontrolle hatte. Wer würde sonst garantieren, dass sie sich nicht mehr als nur dieses eine Jahr statt zwei oder drei nahmen, so wie sie sich hier alles einverleibten.
Doch No’ara beobachte noch etwas. Mit jedem Opfer schienen die Narach träger zu werden. Ein Umstand, von dem sie bisher nicht gehört hatte.
„Was geschieht da?“, fragte sie den Feldherren in der dunkelgrün drapierten Rüstung Lur’kons neben sich.
Auch die anderen richteten den Blick genauer auf die abgelegeneren Viertel der Stadt, in denen die Narach verweilten, anstatt zum restlichen Heer aufzuschließen. Sie krümmten sich, als hätten sie sich überfressen, ohne sich übergeben zu können.
Die Feldherren blickten sich ratlos an.
Irgendwas stimmte hier ganz und gar nicht.
„Kommt mit“, befahl No’ara mit entschlossener Stimme und faltete eine Verzerrung auf, hoch und breit genug für die Leibwächter.
No’ara schritt voran und tauchte im Rücken von Da’ken auf.
„Bruder!“, rief sie durch den Lärm von Gebrüll und aufeinander krachender Klingen.
Da’ken wandte sich um und starrte No’ara inmitten der Feldherren an. Er trat rasch aus der um ihn kämpfenden Menge heraus.
Noch bevor er seinen Mund zu was auch immer öffnen konnte, kam sie ihm zuvor. „Die Narach erkranken an der Labung von Elfen. Schau.“
No’ara lenkte Da’kens Blick zu den Rändern des Schlachtfelds, an denen einzelne Gruppen von Narach verbliebene Elfen in ihren Häusern aufspürten. Sie wankten durch die Gassen der Vororte, die den Bergkamm hinauf führten. Weiter zurückliegend brachen einige Narach bereits zusammen und zuckten vor Krämpfen.
„Wir müssen uns zurückziehen, zumindest solange du sie nicht instruiert hast, sich nicht an den Elfen zu nähren. Sonst opferst du die gesamte Streitmacht.“
Viele der sich krümmenden Narach bewegten sich gar nicht mehr und lagen verendet neben ihren gefallenen Artgenossen.
Da’ken deutete den Feldherren mit einer Kopfbewegung, No’aras Anweisung umzusetzen. Sie verteilten sich mit weiten Sprüngen auf den gesamten Rücken der Frontformation und stießen ein heftiges Gebrüll aus, worauf sich ein Narach nach dem anderen durch eine schwarze Verzerrung zurückzog.
Die dunkle Wand von Da’kens Armee löste sich binnen Sekunden vollständig auf und gab den Blick auf die Verteidigungslinie an braunhaarigen Elfen frei, die sich außer Atem ungläubig umblickten.
Da’ken trat mit einem sanften Lächeln auf No’ara zu, nahm sie in die Arme und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. „Ich danke dir.“
No’ara bemerkte erst jetzt, wie aufgeregt und angespannt sie selbst war. Durch die Umarmung legte sich ihre hektische Atmung. Und der unerwartete Dank ihres Bruders, der ihr eine tiefe Wertschätzung bedeutete, umspielte besänftigend ihr Herz.
Sie schritten durch eine Verzerrung und folgten den Narach auf den Kasernenhof vor dem Gebieterschloss. Die Meute ließ auf ein Fauchen der Feldherren Ruhe einkehren. Doch anstatt, dass Da’ken den Narach die Instruktion erteilte, trat er vor No’ara. Mit einem Lächeln und den Blick fest auf ihre blassblauen Augen gerichtet, schnippte er mit den Fingern der rechten erhobenen Hand.
Wie eine Welle wusch das Geräusch Da’kens Grün aus den Augen der Narach und ersetzte sie durch Gold.
Was sollte das?
Da’ken nahm No’aras Hand. „Sie unterstehen ab sofort deinem Kommando.“
No’ara war wie erstarrt. Sie hat sich bestimmt verhört.
Da’ken legte nach seinem Lächeln eine strenge Miene auf. „Du bleibst aber der Front fern und zu jeder Zeit im Schutz der Feldherren.“
No’ara schluckte. Es ist ihm tatsächlich ernst.
Sie fiel Da’ken um den Hals und schluchzte voller Freude.
Präludium 8 - Intrige
Da’ken ließ seine Schwester neu mit der Invasion auf Eilia ansetzen, begleitete sie aber noch als neutraler Beobachter. Dabei ging es ihm vorrangig natürlich darum, No’ara in Sicherheit zu wissen, statt ihre Entscheidungen zu übersehen.
Während der Hilfsaktionen auf Ka’ara hatte sie rasch gelernt, mit den Kräften umzugehen und sie gezielt einzusetzen. Ohne Übermaß und ohne Überschwang. Doch vielmehr blühte sie durch die ihr überlassene Verantwortung auf. Daher hatte er ihr das Rückgrat seiner gesamten Streitmacht übereignet. Nicht ganz ohne Sorge, aber mit der Intention, ihr alle Wünsche zu erfüllen und sie glücklich zu sehen.
Mit der Verantwortung stieg aber auch der Erfolgsdruck auf Eilia. Denn so schnell No’ara das restliche, von Flussströmen durchzogene Gebiet unter Kontrolle gebracht hatte – das benachbarte Moor war verlassen und das bewaldete Land undurchdringlich – stockte das Vorankommen. An den Grenzen zum nächsten Areal mit weiten Feldern erwartete sie eine inzwischen gut organisierte Verteidigungslinie verschiedenartiger Elfen mit starken Barrieren, hinter die selbst mit einer Verzerrung kein Narach gelangen konnte.
Hätte Da’ken seine Formation aus Ka’ara herangezogen, wäre die Linie mit Sicherheit bald gefallen. Aber No’ara leistete soweit gute Arbeit.
Sie erkannte Schwachstellen und nutzte sie taktisch gut aus. Würde er nun eingreifen, käme es einer Demütigung gleich und entpuppte das Vertrauen nur als hohle Worte.
Die Narach machten nun schon seit Tagen kaum einen Schritt mehr gut. Nicht zuletzt durch die Unterstützung einzelner fremder Wesen mit abgerundeten Ohren, anstatt die langen, spitz zulaufenden der Elfen.
Das Vorhaben entwickelte sich zu einer Belagerung, was No’ara unter der Beobachtung Da’kens immer weiter unter Druck setzte.
Also beschloss er, sich zeitweise zurückzuziehen und No’ara unbehelligt walten zu lassen. Er umarmte sie zum Abschied und versicherte ihr unmissverständlich, wie stolz er auf sie war und dass er es kaum hätte besser machen können. Die Elfen seien ein äußerst widerspenstiger Gegner, was man ebenso wenig hätte voraussehen können, wie die Reaktion der Narach auf deren Konsum. Aber sie allein hatte es erkannt.
In der Hoffnung, dass es wirklich zu ihr durchgedrungen war und sie nicht zur Leichtsinnigkeit verführte, zog er sich vorerst ins Schloss zurück.
Aber nicht für lange.
Zunächst lagen weitere Eisen im Feuer, die darauf warteten, geschmiedet zu werden. Allen voran Doronia.
Doch noch etwas lag im Argen. Eine Welt im Schatten, die sich in Nerosas Wissen nur äußerst schemenhaft zeigte. Allein die Warnung, sich davon fernzuhalten war deutlich gewesen. Und der Name „Naharott“.
Dorthin zu gelangen erforderte keinerlei Mühe. Auch keine Sicherheitsvorkehrungen fanden sich auf dem kargen Felsbrocken mit so dünner Atmosphäre, dass der Sternenhimmel darüber zu erkennen war.
Da’ken schritt über den rissigen Boden aus dunkelgrauem Fels in eine beliebige Richtung. Nichts hier deutete auf einen besonderen Ort hin. Kein Weg, der irgendwo hinführte. Doch dann erkannte er ein Muster, das die zahlreichen Steine am Boden bildeten. Sie waren anscheinend im gleichen Abstand zu großen, konzentrischen Kreisen angeordnet, die sich schwer über die Anhöhen und Gefälle hinweg als solche identifizieren ließen.
Da’ken versuchte einen der Steine anzuheben, um eine eventuelle Inschrift abzulesen oder darunter etwas Verborgenes zu entdecken. Der faustgroße Brocken ließ sich aber keinen Millimeter bewegen. Auch der daneben nicht. Alle Steine, die der Formation angehörten, waren wie festgeheftet.
Da’ken steuerte das vermeintliche Zentrum der Kreise an, das mehrere Kilometer entfernt liegen musste. Mit jedem Schritt über den nächsten Ring hinaus, aber besonders deutlich nach einem größeren Sprung durch eine Verzerrung weiter in die Mitte, fühlte Da’ken eine intensiver werdende Aura. Eine Präsenz, die immer drängender eine Anziehung auf ihn ausübte. Nicht auf seinen Körper, sondern auf sein Inneres.
Nach drei weiteren Sprüngen erblickte er eine hohe Felsformation. Der Druck war inzwischen so unangenehm, dass Da’ken übel wurde. Er spielte tatsächlich mit dem Gedanken, umzukehren. Irgendetwas hier war ihm nicht geheuer. Doch es trieb ihn tiefer hinein.
Nach fünf weiteren Steinkreisen erkannte Da’ken in der Formation eine Art Bauwerk, das nach oben spitz zulief. Gerade als sich Da’ken fragte, ob es hierzu einen Eingang gab, bemerkte er eine Gestalt davor kauern, gehüllt in eine dunkle Kutte.
Da’ken schritt weiter auf die reglose Person zu, deren Kleidung flatterte, obwohl keinerlei Brise zu spüren war.
Mit der Überquerung des letzten Kreises in eine leere Fläche schreckte die Gestalt auf. Den verhüllten Kopf zu Da’ken gerichtet erhob sie sich in einer fließenden Bewegung.
Da’kens bisheriger Anflug von Kopfschmerzen verstärkte sich zu einer Welle, die ihm kurz die Orientierung und das Gleichgewicht raubte.
Einen Moment später normalisierte sich sein Zustand.
Die Gestalt trat langsam auf Da’ken zu. „Mein Herr, ich biete meine treuen Dienste als Seher an. Gestattet mir, Euch zu begleiten, um all Eure Ziele zu erreichen, indem ich beratend zur Seite stehe.“
In Da’ken kam die Frage auf, wieso er solch ein Angebot annehmen sollte, ohne nur ein Gesicht oder einen Namen erfahren zu haben. Doch diese wurde mit allen anderen Zweifeln und Bedenken durch ein sich aus dem Nichts stärkendes Vertrauen verdrängt. Er versuchte, das zu hinterfragen, aber auch dieser Drang löste sich in Wohlgefallen auf.
Da’ken stimmte kurz und knapp zu. Da er sonst kein weiteres Interesse an Naharott zu haben schien, geleitete er den Fremden durch eine Verzerrung nach Ka’ara.
Kaum hatten sie den Boden des Thronsaals betreten, in dem Nerosa an der Seite des Throns bereitstand, atmete der Seher auf. Doch Da’ken beachtete es nicht weiter.
Eine Idee manifestierte sich in seinem Kopf.
Er rief einen der Saalgänger heran. „Sorge für die Einsatzbereitschaft der Kampfformation. Wir ziehen nach Doronia.“
Er musste diese Welt besitzen, unbedingt. Noch heute.
Der Seher trat an Da’ken heran. „Eine weise Entscheidung. Ich darf Euch doch begleiten und Eurem Sieg beiwohnen?“
Da’ken nickte. „Zuerst suchen wir meine Schwester auf Eilia auf. Ihr solltet euch kennenlernen.“
Der Seher verbeugte sich. „Sehr wohl. Wie Ihr wünscht, mein Herr.“
„Ich werde mit Gebieter betitelt, merk dir das.“
Eine weitere Verbeugung folgte. „Sehr wohl, mein Gebieter.“
Da’ken öffnete eine Verzerrung und beide schritten nach Eilia, das in der Abenddämmerung lag. No’ara sollte zu dieser Zeit in einem der prachtvolleren Säulengebäude der Hauptstadt zu finden sein, in das sie sich zeitweise eingerichtet hatte.
Zwei der Feldherren standen am Eingang, die Da’ken sogleich aufforderte, mitzukommen. Die anderen beiden hielten sich mit No’ara in einem Vorraum zur Küche auf.
No’ara verschluckte sich fast an einem kräftigen Zug aus einem Wasserglas. Ein langer, heißer Tag im Lager hinter den Gefechtslinien ließ sich vom Schmutz und Schweiß ihrer Haut ablesen.
„Bruder!“, gluckste sie hervor. Sie stellte das Glas ab und trat auf Da’ken zu. „Ich wollte dich aufsuchen, sobald ich mich ein wenig erfrischt hätte. Wir konnten heute Geländegewinne er…“ No’ara hielt ein, als sie neben den Feldherren halb hinter ihm verborgen die Begleitung bemerkte.
Da’ken machte einen Schritt zur Seite. „Das ist unser Seher. Er wird uns ab sofort als Berater dienen.“
No’ara kniff die Augen zu einem skeptischen Blick zusammen, während der Seher in seiner Verhüllung eine Verbeugung andeutete.
„Wir werden die Narach von Eilia abziehen, um sie gemeinsam mit unserer eigenen Formation auf Doronia einzusetzen.“
No’aras Blick schnellte entsetzt zu ihrem Bruder. „Was? Aber ich mache doch Fortschritte, hast du nicht gehört?“
Da’ken schüttelte den Kopf. „Doronia ist wichtiger. Lass eine Linie zurück, um das eroberte Gebiet zu sichern, wenn du willst. – Hast du ein Problem damit?“
In Da’kens Stimme klang ein herrischer Ton, den er selbst von sich nicht kannte. Insbesondere gegenüber seiner Schwester.
Er zeigte Wirkung. No’ara senkte beschämt den Kopf mit einem verneinenden Schütteln.
Ein Stechen in seiner Brust ließ Da’ken für einen Moment zaudern, doch er rückte nicht von seiner Linie ab. „Dann sammle die Truppen auf Ka’ara. Wir werden heute noch aufbrechen und siegreich sein. Zusammen.“
No’ara hob den Kopf. Ein schmales Lächeln schlich sich in ihr Gesicht.
Sie nickte. „Ja, Bruder.“
Kapitel 1 - Thronfolge
Seit zwanzig Minuten ging Celes schon vor der übergroßen weißen Flügeltür zum Zeremoniensaal auf und ab. Vollkommen allein brachte sie in der Hinterhalle die Zeit zu, bis die Flügel aufschwingen und ganz Andalon auf sie blicken würde.
Dort drinnen fand soeben Kronos’ Krönung statt, nachdem die Trauerzeit durch einen letzten Ritus beendet worden war. Vor drei Tagen erst hatten sie den eigentlichen Thronfolger, Kronos’ Vater Leras, auf Afallon zu Grabe getragen.
Celes hoffte, dass das Klacken ihrer Schuhe nicht durch das Tor hindurch im Saal vernommen werden konnte. Sie blieb einen Moment stehen, hob das lange weiße Kleid an und betrachtete die Absätze. Sie waren nicht annähernd so hoch wie jene, die Celes aus Susans Kleiderschrank kannte, nach deren Vorbild sie aber gefertigt worden waren. Dennoch schmerzte die ungewohnte Stellung der Füße. Celes wunderte sich deshalb nicht, dass eine solche Art von Schuhen eher besonderen Gelegenheiten vorbehalten war und man sich danach sehnte, sie wieder loszuwerden.
Aber gerade zu diesem Anlass hatte sich Celes solche gewünscht, auch wenn sie unter dem breit auslaufenden Rock nicht zur Geltung kamen. Nur das Geräusch, das sie auf dem Marmorboden von sich gaben, machte schon von weitem auf sie aufmerksam.
Celes marschierte weiter. Sie konnte sich nicht ruhig halten. Auf den Sesseln hätte sie sich nur den seidenen Stoff vom Hin- und Herrutschen aufgerieben.
Sie blieb abermals an einem der hohen Wandspiegel stehen und betrachtete ihr schulterfreies Kleid mit einer Unmenge Verzierungen. Sie reichten von der oberen Kante bis hinab zur Hüfte, wo der Rock unter der Korsage in dezenten, glänzenden Wellen herausquoll.
Celes strahlte. Nicht nur wegen des permanenten Lächelns auf ihren Rosé gefärbten Lippen. Ihr Gesicht war makellos wie nie. Eine fünftägige Qual aus verschiedenen Peelings und teils unangenehm brennenden Essenzen musste sie hierfür über sich ergehen lassen. Doch die Anstrengungen der bis zu acht Bediensteten an einem Tag hatten Früchte getragen.
Früchte und Blumen nach denen sie seit Tagen duftete. Ihre in Wellen liegenden, teils hochdrapierten Haare allein verströmten einen Geruch wie ein ganzer Rosengarten.
Unbändiger Jubel drang durch die Türen und zerriss die ehrfürchtige Stille.
Celes schnappte nach Luft – davon gelangte aber nur wenig in ihre Lungen. Die flache Atmung rührte sicherlich von der engen Korsage her, doch auch ihre Muskeln krampften sich vor nervöser Energie um den gesamten Oberkörper.
Drei Schläge erschütterten den Boden und bedeuteten sowohl Celes, sich vorzubereiten und ihre Stellung gegenüber des Tores einzunehmen, als auch dem Volk, Ruhe einkehren zu lassen.
Einen stillen Moment später schwangen die Flügel mit einem hölzernen Krachen auf und setzten Celes’ blütenweißes Kleid in das Licht des sonnengefluteten, runden Saals.
Mit einem beklemmenden Gefühl in der trockenen Kehle schritt Celes gemächlich auf die Mitte zu, um die sich das gesamte Volk kreisförmig versammelt hatte. Sie war überwältigt von der Masse an strahlenden Augen und dem stetigen leisen Seufzen der Leute, das ihr wie eine seichte Welle auf ihrem Weg durch die Menge folgte. Ihre Schuhe gaben ungewollt den Takt zu der schmachtenden Melodie vor.
Celes bewegte sich weiter in das Gegenlicht der hohen Fenster. Die Sonne wärmte ihre Schultern und das dezente Dekolleté. Auch ihre Wangen glühten, doch nicht von den Sonnenstrahlen, sondern aufgrund der Silhouette ihres Liebsten am Ende einer kleinen Treppe, die zum Altar empor führte.
Auf den Stufen standen beiderseits im Spalier ihre Freunde in adrettem Aufzug – für die Dauer der Feierlichkeiten von Eilia zurückgekehrt. Sie lächelten breiter als jeder andere in dem Saal, trotz der entbehrungsreichen Wochen, die hinter ihnen lagen.
Celes trat an die Seite ihres Geliebten, auf dessen Haupt die silberne Krone Andalons saß. Ihr Blick wanderte an ihm hinab und wieder zurück. Sein drahtiger Körper steckte in einem engen weißen Anzug mit schwarzen und silbernen Applikationen und einem leichten Umhang über den Schultern.
Behutsam legte sie die rechte Hand in seine Handfläche, die er ihr entgegenstreckte. Sie zitterte nicht, doch ihre Finger waren eiskalt.
Kronos führte sie vor seine Lippen und ließ einen warmen Hauch auf sie niedergehen. Die Wärme hielt sich kaum auf der Haut, wich Celes aber direkt ins errötende Gesicht.
Gemeinsam traten sie die letzten Schritte auf den abgedankten König Hektas und Kronos’ Mutter Calystra zu, in deren Antlitz sowohl Trauer um Kronos’ Vater als auch Freude für das Brautpaar und und nicht zuletzt die baldige Nachkommenschaft standen.
Celes’ hielt die freie Hand an ihren Bauch.
Knirsch.
Ein schlurfendes Geräusch riss Susan aus dem Schlaf.
Sie stickte beim Einatmen der fast brennenden, nach Schwefel riechenden Luft. Ihr verbliebenes Auge suchte getrübt das Halbdunkel der Zellengrube ab, soweit es ihr vor Husten gekrümmter Körper erlaubte.
Ihre Seite, mit der sie auf dem kargen Boden lag, schmerzte. Allein die zusammengerollte Jeans als Kopfkissen sorgte für so etwas wie Bequemlichkeit. Ansonsten trug sie nur ihre durchgeschwitzte Unterwäsche und Reste des Elfengewands.
Teile davon hatte sie mit dem Schwert abgetrennt, um sich damit zu säubern, nachdem sie zu Anfang ihrer Gefangenschaft ihre Notdurft in einer Ecke der Zelle verrichtet hatte. Inzwischen befand sich in ihrem Körper nichts mehr, das ihn hätte verlassen müssen.
Susan vermochte nicht einzuschätzen, wie viele Tage sie hier schon ausharrte. Noch kein einziges Gefängnisessen war ihr gereicht worden.
Asra hatte sie seit No’aras Selbstmord nicht mehr gesehen oder gehört. Und auch sonst war ihr nicht ein Lebenszeichen untergekommen.
Nicht einmal für Wasser wurde hier gesorgt. Hätte Susan nicht an den feuchten Wänden geleckt, wäre sie wohl schon verdurstet.
Sie hatte die Mauer zunächst nur mit der Zungenspitze berührt, um giftige Substanzen schmecken zu können. Inzwischen wäre ihr aber auch das egal gewesen. Sie musste einfach irgendetwas trinken.
Solch eine Qual, die ein derartiges Durstgefühl hervorbringen konnte, hatte sie sich bislang nicht einmal vorstellen können.
Mit den Rinnsalen, die sie mit den Händen als Trichter an der Wand sammelte, hielt sie sich irgendwie am Leben. Dabei wunderte sie sich selbst über ihren anhaltenden Lebenswillen.
Anfangs störte sie sich nur an der eigenen, klebriger werdenden Haut – am eigenen Geruch – an den fettigen Haaren. Ihre Sinne verloren sich aber von Tag zu Tag mehr in einem Nebel.
Sie klammerte sich stattdessen an Erinnerungen. An ihre Mutter, an Tina, an Chris – an Blue. Aber auch diese wurden zusehends verschwommener.
Das Geräusch eben war vielleicht sogar nur Einbildung gewesen. Der Beginn von Halluzinationen. Die Abkehr von der schmerzlichen Realität, in der sie kaum einen Muskel mehr rühren konnte.
Sie legte den Kopf zurück auf die fetttriefende Rolle ihrer Jeans.
„Hey du“, sprach eine gediegene Frauenstimme. „Nicht einschlafen.“
Susan drehte den Kopf nach oben und schlug das rechte Auge halb auf – das zerstörte linke hielt sie schon aus Gewohnheit geschlossen.
Sie erkannte durch die löchrige Wand hindurch eine Person.
No’ara? – Nein. Kann nicht sein. – Eine neue Gefangene? Einer der Wächter?!
Susan stützte sich auf den Ellbogen und drehte sich der Frau zu. Doch neben einzelnen Umrissen ließ sich nur ein grünes Schimmern ausmachen.
Auf der anderen Seite der Wand war ein scharfes Einatmen zu hören. „Ach du meine Güte. Wie siehst du denn aus?“
Susan erkannte keine ihr vertraute Stimme.
„Wer bist du?“, kratzten sich die Worte durch ihre raue Kehle.
„Wir haben uns schon mal vorgestellt“, entgegnete die Zellennachbarin. „An der Bushaltestelle.“
Susan überlegte kurz. „Selina?“
„Richtig.“
Susan erkannte das von schwarzen Haaren eingerahmte, lächelnde Gesicht. Und sie machte auch die Quelle des grünen Funkelns aus: Es ging von ihrem rechten Auge aus.
„Was machst du denn hier?“, fragte Susan überrascht. „Wieso bist du auch gefangen?“
„Ich bin keine Gefangene“, antwortete Selina mit einem schmalen Lächeln, während sie Susan weiter musterte. „Ich bin freiwillig hier.“
Sie wandte sich um und ging ein paar Schritte zurück.
Susan hatte noch nicht angefangen, über die Bedeutung der Worte zu rätseln, da sah sie Selina eine graue Weste vom Boden aufheben.
Ist das meine? Wie kommt die da rüber? Susan senkte nachdenklich den Kopf. Sie hatte nicht bemerkt, dass sie in eine andere Zelle gestoßen worden war.
„Gehörst du zu denen?“, fragte Susan mit Abscheu in der Stimme.
„Denen, die dich hier gefangen halten? Nein, sicherlich nicht.“ Selina griff in eine Seitentasche der Weste und trat an die Wand zurück. „Hiermit konnte ich dir folgen.“
Sie holte einen haselnussgroßen Kristallsplitter hervor und streckte ihn Susan durch eines der Löcher auf offener Handfläche entgegen. „Den habe ich dir an der Bushaltestelle zugesteckt.“
Sie legte eine schuldbewusste Miene auf, wirkte aber keineswegs beschämt.
Obwohl Selina nur einen grünen Splitter in der Hand hielt, sah Susan zwei davon. Sie wischte sich über das intakte Auge. Der andere Splitter schien mit Selinas Handmitte verwachsen zu sein.
„Und jetzt sitzt du mit mir in der Falle“, bedauerte Susan, obgleich es Selinas eigene Schuld war.
Was musste sie mir auch folgen?
„Ach was. Keineswegs.“
Susan bekam abermals Selinas freudiges Lächeln zu sehen, bevor sie plötzlich verschwand und im selben Moment neben ihr stand.
„Du kannst dich hier drin teleportieren?“, fragte Susan nicht zuletzt darüber überrascht, dass dieses Mädchen überhaupt Teleportationen beherrschte.
Selina hob die Hand, an der der grüne Kristall auch an der Handoberfläche herausragte. „Damit komme ich überall hin.“
Die Erklärung erschien nicht nur selbstsicher, sondern über die Maßen selbstverliebt. „Soll ich dich hier rausholen, oder möchtest du weiter die Trockensauna hier genießen?“
Susan war sich unsicher, wie sie reagieren sollte. Zu ihrem eigenen Schrecken hatte sie sich damit abgefunden, in dieser Zelle zu sterben. Eine Rettung oder Flucht war ihr schon seit geraumer Zeit nicht mehr in den Sinn gekommen.
Ein kleines Quäntchen Hoffnung keimte auf, wenngleich es sich in Grenzen hielt. Vielleicht war diese Unterhaltung doch nur Einbildung.
Aber wozu zweifeln? Sie war schon lange am Ende ihrer Optionen angekommen.
„Wenn es dir keine Umstände macht?“, klang Susan mehr flehend, als bescheiden.
„Gar nicht.“ Selina lächelte zurück. „Hier, trink erst mal was.“
Susans rechtes Auge wurde weit, als ihr Selina eine kleine Plastikflasche aus der Innentasche ihres Mantels reichte.
„Ich bin derweil nur zwei Sekunden etwas vorbereiten. Allein kann ich mich ohne weiteres überall hinteleportieren. Zu manchen Zielen oder in Begleitung brauche ich allerdings einen Empfangspunkt als Verstärkung, oder als Tunnel durch Barrieren.“
Susan hörte den Ausführungen nur auf einem Ohr zu, während ihre größte Aufmerksamkeit der Wasserflasche galt.
Sie schraubte den Verschluss vorsichtig ab und nahm den Mund an die Öffnung, darum bemüht, ja keinen Tropfen zu verschwenden oder gar die Flasche aus den verkrampften Händen zu verlieren.
Diese war in wenigen Zügen geleert, als Selina wieder durch ein wellenförmiges Verschwimmen der Luft um sich herum zurückkam.
Susan begriff schwerfällig, dass die Art der Teleportation die der Wächter und Elfen entsprach. Das weiter zu hinterfragen oder wie Selina in die ganze Angelegenheit hineinpasste, war ihr aber herzlich egal. Zumindest verwendete sie nicht die Verzerrung der Feinde, was sie für den Moment vertrauensvoll genug erscheinen ließ.
„Danke.“
Selina nahm lächelnd die leere Flasche entgegen und steckte sie ein. „Gehe nie ohne ausreichend Wasser auf Reisen.“
Susan blickte sie an, ob sie das vorwurfsvoll meinte. Tatsächlich hatte sie sich nicht nur einmal in den vergangenen Tagen gewünscht, nebst ihrem Schwert und ihrer Rüstung auch einen Wasservorrat in ihrer geheimen Handtasche gelagert zu haben.
Selina hob Susans Jeans zu der Weste auf und reichte Susan die Hand. Diese bemerkte erst jetzt, dass sie noch immer auf dem Boden lag.
Sie erhob den Arm und griff fest nach Selinas Hand.
Für einen kurzen Augenblick hatte sie Angst, ihrer Retterin durch deren eingepflanzten Kristall in der Handfläche Schmerzen zuzufügen. Doch brachte sie trotz ihres eigenen Kristallsplitters im Kopf kaum genug Kraft auf, um einer Mücke zu schaden.
Im Gegensatz dazu zog Selina Susan mit einem unvermittelten Ruck hoch und führte Susans Arm um ihren Nacken, um sie auf den zittrigen Beinen zu halten.
Susan wurde schwindelig.
Im nächsten Moment fand sie sich mit Selina oberhalb der Gruben wieder – unweit von dem Ort, an dem No’ara gestorben war. An dessen Stelle befand sich ein großer, dunkler Fleck auf dem sandigen Boden. Doch von ihrer Leiche fehlte jede Spur.
Selina kniete sich ab, nahm den Kristall, den sie aus Susans Weste entfernt hatte, auf und steckte ihn in ein kleines Ledersäckchen.
„Wie beim Raumkristall“, sagte Susan mehr zu sich selbst und fühlte sich an das grüne Juwel erinnert, das sie durch Raum und Zeit zu den anderen Wächtern bringen konnte.
„Nur in einer etwas ausgefeilteren Variante“, kommentiere Selina und ließ mehrere der Kristallsplitter in dem Lederetui klimpern.
Auch wenn Susan ihr bereits jetzt viel für ihre Befreiung aus dem Kerker schuldete, sie durfte nicht so blauäugig sein und sie als Nächstes zu ihren Freunden führen, so gern sie ohne Umwege sofort zu ihnen wollte.
„Wer genau bist du?“
„Können wir das Frage-und-Antwort-Spiel darauf verschieben, wenn wir in Sicherheit sind?“, bat Selina. „Aber vorher würde ich mich gern noch kurz hier umsehen. Ich will wissen, wo wir hier sind.“
Auch für die Wächter mochte es nicht von Nachteil sein, sich einen Eindruck von dem Versteck ihres Feindes zu machen. Vielleicht fanden sie sogar Hinweise zu Asras weiterem Plan.
Doch vielmehr noch wollte sie nach etwas anderem suchen.
„Ich will auch nicht ohne No’aras Leiche hier weg“, ergänzte Susan Selinas Vorhaben.
Bei dem Namen der Herrscherin der Narach verlor Selinas Gesicht zum ersten Mal die Fassung.
„Die Leiche von wem?“, fragte sie behutsam nach.
„Sie ist …“, begann Susan zögerlich. Aber wie sollte sie fortfahren? Wie ließ sich dieses Gör mit ein paar wenigen Sätzen beschreiben? Am besten ohne irgendwas bei ihrer Retterin zu triggern. Susan hatte schließlich gar keine Ahnung, in welchem Bezug Selina zu dem Ganzen hier stand.
Doch vielleicht machte sie sich zu viele Gedanken. Sie musste ihr nicht zuletzt als Dankeschön für die Rettung einen Vertrauensvorschuss geben.
„Sie war die Schwester eines unserer Verbündeten. Und das soll er auch bleiben.“
Das war nun mal der vorrangige Grund.
Eine Erklärung an Da’ken alleine hätte mit Sicherheit weniger Gewicht als verbunden mit der Geste, den toten Körper an ihren Bruder zu übergeben. Es würde sonst nur Nachfragen zum Verbleib und Zweifel an der Echtheit ihrer Worte hervorrufen.
„Da’ken ist sehr mächtig. Daher ist er von unschätzbarem Wert. Allerdings steht er in der Schuld einer Welt namens Doronia. Da’ken sagte zu, sich seiner Verantwortung zu stellen …“
„Moment“, unterbrach Selina. Ihre Augen waren merkwürdig geweitet. „Diese No’ara. Wie kommst du darauf, dass ihre Leiche hier ist?“
„Sie war sozusagen meine Zellennachbarin. Aber sie nahm sich kurz nach unserer Gefangennahme das Leben.“
„Du und No’ara wurdet zum selben Zeitpunkt gefangen genommen?“
Susan ging nicht weiter auf Selinas gerunzelte Stirn ein. „Ja.“
„Ein Mädchen mit schwarzen langen Haaren?“
„Genau.“ Nun legte sich Susans Stirn in Falten, während Selina den Blick senkte. „Du kennst sie?“
Selina wirkte in Gedanken versunken, antwortete aber schließlich kleinlaut: „Ein wenig vielleicht. Mehr als genug, um ehrlich zu sein.“
Susan schmunzelte. „Kann ich verstehen.“
Selina richtete den Blick ohne Belustigung darin auf Susan. „Wo war sie vor eurer Gefangenschaft?“
„Wollten wir Fragen und Antworten nicht auf später verschieben?“
Selina blickte sich um. Es schien, als hätte sie für einen Moment vergessen, von schwefeldampfenden Felswänden umgeben zu sein. Auch Susans wacklige Beine nahm sie wieder wahr. „Ja, natürlich.“
Selina gab Susan mehr Stütze und zog sie mit sich weiter den Gang entlang.
Die feucht wirkenden Wände spiegelten noch immer das flackernde Zwielicht einer nicht erkennbaren Lichtquelle wieder. Als würde der Schein vom Fels selbst ausgehen – als würde er kurz davor stehen, zu glühen.
Susan konzentrierte sich auf jeden schlurfenden Schritt, konnte sie ihre Beine doch kaum spüren. Sie hatte keinerlei Schmerzen, stattdessen bestimmte ein elendes Taubheitsgefühl ihren gesamten Körper.
„Was ist eigentlich mit deinem Auge?“, fragte Selina von Susans linker Seite her. „Sieht ja gar nicht gut aus.“
Susan konnte die Schwere der Verletzung bisher nicht beurteilen. Den brennenden Schweiß in der Wunde nahm sie schon lange nicht mehr wahr. Sie glaubte zwar, das Augenlid öffnen zu können, doch konnte sie mit dem Auge nichts sehen.
„Du traust dir nicht zufällig zu, das zu richten?“
Selinas Mundwinkel zogen sich zu einem bedauernden Lächeln. „Tut mir leid. Auch wenn ich selbst Erfahrung mit einer solchen Verletzung habe, heilen kann ich das nicht.“ Selina drehte den Kopf zu Susan. „Wenn es dagegen um eine Verpflanzung geht, wärst du bei mir an der richtigen Adresse.“
Susan war die senkrechte Narbe schon früher aufgefallen und auch das andersfarbige Auge. „Das ist nicht dein eigenes?“
Selina schüttelte den Kopf und richtete den Blick nach vorne. „Ich glaube, da ist ein Ausgang.“
Schwarze Flocken rieselten durch einen leichten Luftzug wie dunkler Schnee um die Ecke ein paar Meter vor ihnen.
Susan bemühte sich, Selina nicht zu sehr zur Last zu fallen und sich besser auf den eigenen Beinen vorwärts zu bewegen. Sie erwartete, endlich wieder frische Luft schnappen zu können, doch als sie um die Kurve bogen, stockte ihr der Atem nicht nur von dem deutlich intensiveren Schwefelgeruch.
Ja, sie standen am Ausgang der Höhle. Der Anblick, der sich Susan von dem Felsvorsprung aus bot, ließ sie jedoch erschaudern.
Unter einer Decke von dunklen Wolken und grauen Dampfschleiern floss zu ihrer Rechten ein roter Wasserfall in das Tal hinab.
Er stürzte nicht. Keine Gischt und kein ohrenbetäubender Lärm ging davon aus. Der Strom bewegte sich gemächlich, als wäre der Abgrund von keiner Bedeutung. Wie Lava ergoss er sich in einen Fluss. Doch nicht zäh wie geschmolzenes Gestein, sondern deutlich flüssiger. Kochend stieg Dampf auf und vernebelte die Sicht.
An den Ufern erkannte Susan einzelne knöchern wirkende Bäume. Auf deren Äste saßen Gestalten wie Vögel, die ihre Flügel streckten und sich mauserten. Auf die Entfernung – und mit nur einem Auge – konnte Susan es nicht wirklich einschätzen, aber sie sahen weder Spatzen noch Geiern ähnlich. Sie trugen mehr menschliche Züge.
Susan riss sich von dem Anblick los und schaute zu Selina. Ihre weiten Augen zeugten ebenfalls zumindest von Verblüffung. Doch auch sie schüttelte die Starre von sich.
„Und weiter?“, fragte Susan. „Da runter klettern?“
„Bin ich nicht gerade von angetan. Du hast die Dinger mit den scharfen Krallen gesehen? Die will ich nicht unbedingt aufschrecken.“
Susan nickte langsam. „Du siehst das hier auch zum ersten Mal? Du hast keine Ahnung, wo wir sind?“
Selina verzog die Lippen. „Eine Vermutung hätte ich, aber die behalte ich lieber für mich. – Schau, dort führt ein Pfad den Fels hinauf.“
Susan wandte sich um, als sich Selina mit ihr auch schon in Bewegung setzte.
„Was denn für eine Vermutung?“ So leicht ließ sich Susan nicht abspeisen.
Selina atmete mit einem Seufzen aus. „Ach, vergiss es. War nur ein dummer Gedanke. – Vorsicht, da wird es ziemlich schmal.“
„Los, sag schon“, bestand Susan weiter auf einer Antwort, während sie den Blick nach vorne auf den aschebedeckten Pfad richtete.
„Ich will dich nicht unnötig beunruhigen.“