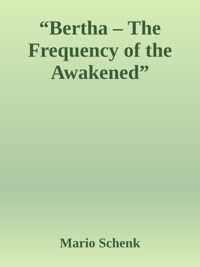4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Von Magie und Unsterblichkeit
- Sprache: Deutsch
Ein einzigartiger Mix aus verschiedensten Legenden und Mythen aus Religion und Geschichte. Susan erwacht unversehrt in ihrem Bett. Sie hat zwar überlebt, doch nur sie kann sich an den verlustreichen Krieg gegen die Narach erinnern. So viel sich verändert haben mag, holt Susan das Schicksal schnell wieder ein. Für Susan und ihre Freunde beginnt eine entbehrungsreiche Reise. Diesmal nicht nur um die Welt, sondern auch durch die Zeit. Dabei stehen ihnen neue, starke Verbündete zur Seite, aber auch mächtigere Gegner gegenüber. Doch die Grenzen verschwimmen: Wer hält tatsächlich zu ihnen, und wer spielt ein falsches Spiel? Die Antwort wird nicht nur die Wächter überraschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Von Magie und Unsterblichkeit
Fragment 1
Teil 2: Der Gebieter von Ka’ara
gewidmet meiner Oma Anna ( * 1922 / † 2020 )
mit einem herzlichen Dank an
meine Betaleser
Svennja Busch
Eva Müller
Impressum
© 2020 Mario Schenk, Lalling
Erstausgabe: November 2020
Autor: Mario Schenk
Umschlaggestaltung: Sören Meding
Lektorat, Korrektorat: Lisa Reim
Verlag &Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:
978-3-347-17390-3 (Paperback)
978-3-347-17392-7 (Ebook)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.vmuu.de
www.marioschkah.de
Präludium 1 - Putsch
„Da’ken! Komm sofort hoch!“
Der kleine Junge zuckte zusammen und blickte nach oben. Seine Mutter wandte sich an einem der Fenster des dritten Stocks wieder ins Innere des Zimmers.
Da’kens Herz pochte heftig. So fordernd hatte sie noch nie nach ihm gerufen.
Hab ich was falsch gemacht? Da‘ken kramte in seinem Kopf nach allem, was er angestellt haben könnte, um seiner Mutter zu missfallen.
Er schluckte. Gestern Abend hatte er sich für einen zweiten Nachtisch in die Küche geschlichen. Das war nicht das erste Mal, dass ihm die Küchenmagden nach den üblichen Essenszeiten mit einem Lächeln eine zusätzliche Portion zusteckten. Doch diesmal hatte es eine der Patrouillen bemerkt. Aber selbst wenn der Wachsoldat es gepetzt haben sollte, wieso war da so viel Angst im Blick seiner Mutter?
Da’ken ließ die Wiesenranken fallen, die er im Garten des Gebieterschlosses sammelte, und rannte auf das rote Tor zu, das zwischen mächtigen Mauerblöcken eingelassen war. Es führte in den Treppenaufgang, dem er hastig nach oben folgte.
Er überlegte immer noch, was seine Mutter so aufgebracht haben könnte. Ist etwas mit meiner Schwester?
Durch das erste Fenster, das in den Vorhof Richtung Stadt zeigte, drangen laute Stimmen herein. Da’ken war noch zu klein, um hindurchzuschauen. Erst fünf Stufen höher konnte er durch die längliche Aussparung in der Mauer bis zur Schlossgrenze blicken.
Da’kens hellgrüne Augen weiteten sich. Er blickte viele Meter hinab auf die Hauptstadt, aus dessen Mitte das Gebieterschloss auf einem mächtigen Felsen ragte.
Die gesamte Bürgerschaft schien aus sämtlichen Wegen und Gassen der Stadt auf das schwarze Schloss zu drängen. In einem gesammelten Strom bewegten sie sich die Anhöhe zum Haupttor hinauf. Sie brüllten Parolen, doch der weißhaarige Junge hörte den Wortlaut nicht heraus. Immer wieder wurde das Geschrei von Krachen und Stampfen übertönt, das durch das Gemäuer zog. Einzelne Brocken und Staub brachen aus dem Felsmassiv.
Ein mulmiges Gefühl wand sich durch Da’kens Bauch. Was hat das zu bedeuten? Außerhalb der Audienzen dürfen die Bürger doch nicht ins Schloss.
Dabei konnte sich Da’ken nicht in Erinnerung rufen, wann der letzte Bürgerempfang abgehalten worden war. Aber er war sich gewiss, dass dieser deutlich länger zurücklag, als ein übliches halbes Jahr.
Da’ken schüttelte die aufkommende Angst aus den Gliedern und folgte der Treppe aus schwarzem Gestein weiter nach oben. Er bog in den langgezogenen Gemächergang der gebieterlichen Familie mit mehreren Türen zu beiden Seiten. Vier Soldaten, die unruhig auf der Stelle traten, bewachten den einzigen Zugang. Nach zwei unbelegten Gemächern, seinem eigenen und dem gegenüberliegenden seiner Eltern, erreichte Da’ken das offen stehende Zimmer seiner Schwester. An der Türe standen sechs weitere Wachen postiert. Zwei von ihnen kannte Da’ken so lange er zurückdenken konnte. Sie waren schon in die Jahre gekommen, aber immer noch rüstig.
So’tan mochte Da’ken am meisten. Er hatte oft mit ihm gespielt, wenn seine Eltern im Rat saßen. Sorge stand in seinem verkrampften Gesicht, das dem jungen Prinzen mit einem gezwungenen Lächeln entgegenblickte.
Da‘ken hielt den Atem an, als er in das Zimmer trat. Die Gebieterin blickte vom Bündel in ihren Armen auf und befahl den Jungen sofort an ihre Seite.
Do’rea war eine sehr schöne Frau. Zumindest in Da’kens Augen. Hatte er doch innerhalb der Schlossmauern, die er noch nie verlassen hatte, mit den Dienerinnen die einzigen Vergleichsmöglichkeiten. Die langen weißen Haare waren in Zöpfen verschiedener Breite kunstvoll um ihr Haupt geschlungen und mündeten in einzelnen Strähnen auf ihren Schultern. Ihre Augen strahlten im selben Eisblau seiner Schwester – einer sehr seltenen Farbe unter den Ka’ara, hatte man Da’ken wissen lassen.
„Die Unruhen werden immer heftiger.“ Ihre Stimme zitterte, während sie ihm No’ara in die Arme drückte. „Pass auf deine Schwester auf und bleib hier, bis ich zurück bin. Ich sehe nach eurem Vater.“
Einer der jüngeren Wachen stellte sich ihr in den Weg, als sie aus dem Zimmer treten wollte. „Der Gebieter gab Befehl, sie drei hier zu bewachen.“
Mit einer beiläufigen Handbewegung fegte Do’rea den Soldaten beiseite und lief den Gang Richtung Treppe entlang. Während zwei der Wachen dem grummelnden Kameraden auf die Beine halfen, schloss und verriegelte So’tan die Türe.
Da’ken wagte keinen Schritt in dem schwarzen Zimmer und blickte sorgenvoll auf den in eine rote Decke gehüllten, schlafenden Säugling mit weißem Schopf. Die rosig blasse Haut roch nach Frühlingsbüschlingen. Dichte schwarze Wimpern stachen unter weißen Augenbrauen aus dem runden Gesicht.
Da’ken erinnerte sich, wie er No’ara zum ersten Mal auf den Arm nehmen durfte. Er hatte Angst, das Püppchen zu zerbrechen und hielt sie wie den kostbarsten Schatz des gesamten Schlosses. Auch jetzt hatte er Angst, aber nicht davor, dass er No’ara verletzten könnte, sondern jemand anderes – jemand Fremdes.
Die Schlossanlage erbebte. Da’ken knickte ein und drückte No’ara fester an sich.
Was war das?
Staub rieselte aus einem Riss, der sich fast senkrecht durch eine der glattpolierten Steinmauern bis über die Decke zog. Da’ken spürte sein pochendes Herz bis in die Kehle.
Eine weitere Explosion drang vom Innenhof durchs Fenster. Da’ken trat vorsichtig heran und streckte den Hals über den Sims, bis er etwas erkennen konnte. Ein Loch klaffte in den Resten eines der Tore, die hinab in den Thronsaal führten. Wenige Schritte von der Stelle entfernt, an der Da’ken zuvor noch einen Kranz aus Wiesenranken für seine Mutter geflochten hatte.
Da’ken hielt den Atem an. Der Gebieter Sa’ren stolperte mit verkrampften Gesichtszügen die breite Treppe herauf.
Vater!
Eine Gruppe mit Lanzen bewaffneter Männer und Frauen des gebieterlichen Heeres trieb den Herrscher über Ka’ara vor sich her. Gefolgt von einer größeren Menge an einfachen Bürgern. Sa’rens Handgelenke waren ohne erkennbares Mittel aneinandergeheftet. Die Krone aus schwarzem Steingeflecht saß schief auf dem Haupt. Der Boden tat sich zu einer Grube auf, in die der Gebieter stürzte. Im nächsten Moment, kaum hatte er sich aufgerichtet, wurde er bis zu den Schultern begraben. Nur Sa’rens Kopf ragte noch inmitten der aufgewühlten Erde und der Rankenwiese mit weißen und gelben Blüten heraus.
Der Kommandant des Heeres trat aus der stetig wachsenden Menge. Da’ken hatte ihn immer an seines Vaters Seite im Thronsaal gesehen. Ta’kon bewegte sich auf den gestürzten Gebieter zu und richtete eine Art Sense auf dessen Hals.
Nein! VATER!
Kein Wort verließ Da’kens verkrampfte Kehle.
„Bitte lasst meine Kinder am Leben!“, schrie Sa’ren so laut es ihm die von der Erde beengte Brust und die von den eigenen Tränen erstickte Stimme erlaubten.
Als die Worte noch durch die Wände des Innenhofs hallten, holte der Kommandant weit aus und hieb Sa’ren mit einer Bewegung den Kopf von den Schultern.
Da’ken nahm den Jubel der Menge nur gedämpft wahr. Seine Ohren blendeten den Gesang fast gänzlich aus, während sich seine Stirn an die kalte Wand unterhalb des Fenstersims legte. Der Puls hämmerte gegen die Mauer und warf die Schläge zurück an seinen Kopf. Da’kens Knie verloren an Kraft. Mit No’ara im Arm sank er zu Boden.
Das Bild des Sensenschwungs hatte sich in Da’kens Hirn gebrannt und verdrängte jeden Gedanken. Tränen tropften von seinen Wangen in das Wickeltuch seiner friedlich schlafenden Schwester.
Ein heftiges Gepolter riss Da’ken aus der Schockstarre. Er blickte auf die rote Zimmertüre aus gepresstem Flechtholz, durch die näher kommende Kampfgeräusche drangen. Ein Raum nach dem anderen wurde aufgebrochen, bis die Angreifer kurz davor waren, No’aras Zimmer zu erreichen.
Da’ken wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und drückte No’ara fester an sich. Sein Herz schlug unregelmäßig. Er schloss die Augen und legte den Kopf an No’aras.
Bleibt weg! Bitte bleibt weg! – Bitte.
Ein schriller Schrei gebot dem Vordringen Einhalt. Da’ken blickte zur Tür.
Lautes Getöse, Krachen und Bersten jagte durch den Gang, begleitet von panischen Rufen und hasserfüllten Flüchen. Mit einem gewaltigen Wummen endete der Kampf und ein Wasserschwall drückte sich durch den unteren Spalt der Türe.
Stille. Nur das Verteilen des Wassers im Zimmer mischte sich mit dem Singsang vom Innenhof.
„Das war knapp“, vernahm Da’ken eine keuchende Stimme.
„Hast du etwas anderes erwartet?“, fragte eine weitere Person, nicht minder außer Atem. „Immerhin ist sie die bisher stärkste Gewinnerin des Anwenderturniers.“
Schritte durch Wasserpfützen näherten sich.
Da’ken atmete schnell und flach.
Die Türe brach in drei Teile. Da’ken wandte den Kopf vor den Splittern schützend ab, lenkte den Blick aber gleich darauf zurück. Ein Soldat des Heeres stand klatschnass im Rahmen und blickte auf die Kinder.
Da’ken schaute sofort auf den Boden an den Beinen des Eindringlings vorbei. Hinter ihm lag Do’rea reglos auf dem steinernen Grund – ihre starren Augen auf ihn gerichtet.
„Mutter!“
Keine Regung, kein Blinzeln von ihr. Angst stürmte Da’kens Gedanken. War sie …?
„Schafft die Verräterin zu Kommandant Ta’kon. Soll er entscheiden, was mit ihr geschehen soll“, klang eine weitere Stimme aus dem Gang, worauf die Gebieterin davongeschleift wurde.
Der Soldat im Türrahmen trat auf den Prinzen zu und verstand seinen verstörten Blick. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir deine Mutter lebend kriegen. Willst du ihr freiwillig folgen oder wählst du mit deiner Schwester den Weg durchs Fenster?“
Da’ken zögerte nicht. Er ging einen Bogen um den Soldaten herum und trat auf den Gang. Sein Weg führte durch Wasserpfützen an zahlreichen Leichen vorbei. Darunter ein Dutzend Schlosswachen, die sie beschützen sollten, und die Reste von dreimal so vielen abtrünnigen Heeressoldaten.
Blaues Blut und Klümpchen tropften von den Mauern und der Decke. Es roch nach Nebel und ekligen, Da’ken bislang unbekannten Gerüchen.
Er richtete den Blick starr geradeaus, auch wenn der Anblick es kaum vermochte, ihm noch mehr Angst zu bereiten, als er ohnehin schon verspürte. Er holte die Gruppe von nur fünf Überlebenden, die seine Mutter hinter sich herzog, ohne sie zu berühren, am Anfang der Treppe ein.
Die Soldaten kümmerte es nicht, dass die Gefangene von Stufe zu Stufe mit dem Kopf auf das Gestein aufschlug. Seine Schwester mit einer Hand an sich gedrückt, stolperte Da’ken hinterher und griff mit der freien Hand nach dem von Blut und Wasser getränkten Umhang. Mit aller Kraft versuchte er, ihre Schultern vom harten Boden zu heben und den Aufschlag des reglosen Kopfes von Kante zu Kante zu mildern.
Da’ken atmete mit jedem Schritt schwerer. Seine Hand krampfte vor Schmerz.
Nur noch ein paar Stufen. Nur noch ein paar.
Auf dem letzten Absatz verließ ihn die Kraft und der Umhang glitt durch seine Finger. Da’ken fiel erschöpft mit dem Rücken an die Wand. Doch er drückte sich sofort davon weg, biss die Zähne zusammen und trottete weiter hinterher.
Im Innenhof angekommen, bildete sich eine schmale Gasse durch die feiernde Menge. Schnell schlug die Stimmung um. Schimpfwörter wie Verräterin und Lügnerin wurden begleitet von verachtenden Gesten und angewiderten Blicken. Erst als die Kinder in das Sichtfeld gelangten, wurden die Leute leiser.
Die Wiese tat sich erneut auf und nahm die Gebieterin neben ihrem toten Gemahl auf.
Verzweiflung kroch durch jeden Winkel von Da’kens kleinem Körper. Er blickte in die zahlreichen Gesichter der aufgebrachten Meute über sich. Was wollt ihr denn? Was haben wir euch getan?, fragte er in sich hinein.
Der Bann fiel von der Gebieterin, als der Kommandant mit der Hinrichtungsklinge auf sie zutrat.
„Ich leugne nichts!“, schrie sie benommen durch die nassen Strähnen ihrer Haare, die ihr im Gesicht klebten. „Ich gebe alle Verfehlungen zu! Ich habe alles für das Wohl meiner Kinder getan! Bitte tut ihnen nichts zu Leide!“
Der Kommandant setzte an und holte aus.
NEIN! Da’ken warf sich mit tränenden Augen über das nasse Haupt seiner Mutter.
Auch das im selben Moment einsetzende Babygeschrei ließ Ta’kon zögern.
Für einen kurzen Augenblick war nur No’aras Geschrei innerhalb der Mauern zu hören, denn auch die Menge hielt den Atem an.
Da’ken öffnete die zusammengekniffenen Augen und blickte über die Schulter nach oben. Die Blicke zwischen ihm und Ta’kon trafen sich.
„Bitte“, schluchzte Do’rea durch Da’kens Arme und an der schreienden No’ara an ihrer Wange vorbei.
Der Kommandant schüttelte sein Gewissen ab und nahm die Waffe wieder höher.
Da’kens Blick verließ Ta’kon nicht. Was sollte er nur tun? Was konnte er tun, um diesen Albtraum zu beenden?
Mit ganzer Kraft fiel die Klinge herab.
„Haltet ein!“
Die Bewegung verlangsamte sich gegen den Willen des Kommandanten und kam halben Wegs zum Stillstand. Da’kens Blick richtete sich an Ta’kon vorbei. Ein alter Mann schritt vorsichtig heran.
„Die Kinder können nichts dafür“, rechtfertigte der Mann sein Einschreiten. „Von ihnen geht keinerlei Gefahr aus.“
Ta’kon ließ von der in der Luft stillstehenden Waffe ab und trat aufgebracht auf den Mann zu.
„Und was gedenkt Ihr, wie wir mit ihnen stattdessen verfahren sollen, werter Volksvertreter? Ich lasse nicht zu, dass sich jemand ihrer annimmt und sie Teil unserer Gesellschaft werden. Wachsen sie mitten unter uns auf, bringen sie früher oder später ihren Fluch in andere Familien und verbreiten ihn.“
„Wir könnten sie in den Kerker sperren“, meldete sich Ta’kons Adjutant zu Wort.
„Die Gören ganze drei Phasen am Leben erhalten? Ständig im Wissen, dass der Fluch unter uns weilt? Nein. Ich gebe ihm keine Möglichkeit, einen Weg aus den Verliesen zu finden.“
Der Kommandant war im Begriff, sich wieder der Hinrichtung zu widmen, als die Gebieterin das Wort erhob: „Verbannt sie! Bringt sie …“
„Du bist still!“, schrie Ta’kon sie an und versiegelte ihren Mund mit nur einem Gedanken.
„Die Giftinseln wären tatsächlich eine Möglichkeit“, nahm der Adjutant den Ausstoß der todgeweihten Gebieterin auf und zog damit den hasserfüllten Blick seines Kommandanten auf sich.
„Da können wir die beiden auch gleich umbringen“, winkte der Volkssprecher ab und gab Ta’kon unbeabsichtigt das Einverständnis zur Fortführung der Hinrichtung. Doch er ergänzte schnell: „Sie bräuchten natürlich einen Erwachsenen, der für sie sorgt.“
„Als würde ich zulassen, dass sich auch nur ein Freiwilliger mit den verfluchten Kindern auf die Giftinseln begibt, oder sogar jemanden dazu bestimmen“, wiegelte Ta’kon ungeduldig ab. „Das Gerede führt doch zu nichts, Herr Volksvertreter. Wir waren uns doch einig.“
„Herr Kommandant.“ Eine Frau mittleren Alters trat kleinlaut aus der Menge heraus. „Entschuldigt mein Auftreten. Aber dürfte ich Euch darum ersuchen, die Gebieterin selbst samt den Kindern auf die Inseln zu schicken?“
„Seid Ihr noch bei Sinnen?“, schrie er die Frau an. „Wer seid Ihr, die nach dem Leben dieser Verräterin ruft?“
„Das ist ihre Mutter“, meinte der Volksvertreter knapp. „Ich habe sie seit der Vermählung nicht mehr zu Gesicht bekommen“, sprach die Frau weiter und blickte auf die Kinder. „Meine Enkel sehe ich heute zum ersten Mal.“
Da’ken entgegnete dem Blick mit Hoffnung in den wässrigen Augen. Er wusste nicht einmal, dass er neben dem alten Gebieter und seiner Frau weitere Großeltern hatte, doch fühlte er in diesem Moment Geborgenheit. Einen winzigen Fleck Wärme in seiner Brust.
„Ich bitte um ihrer aller Leben – ein Leben auf den Inseln, bis ihre Zeit gekommen ist.“
Der Kommandant schaute durch die stille Menge. Einstimmiges Mitgefühl ließ sich aus den Gesichtern ablesen. Das brodelnde Verlangen des aufrührerischen Mobs war erkaltet. Die Bürger erwarteten die Entscheidung des Anführers der gemeinschaftlichen Rebellion von Volk und Militär.
Präludium 2 - Überfall
„Was machst du da?“, fragte Da’ken seine kleine Schwester.
No’ara hockte in der Nähe der Todesgrenze in einem verschlissenen, aus zwei kleineren zusammengenähten Kleid mit dem Rücken zu ihm. Sie drehte den Kopf zu ihrem Bruder und schenkte ihm ein Lächeln. Ihre blassblauen Augen funkelten aus dem zarten Gesicht. Ohne ein Wort wandte sie sich wieder nach vorne.
Sie spielte gern am Strand der Insel – sammelte Stöcke und funkelnde Steine. Dass sie sich dabei aber von der Linie aus rot eingefärbten Warnsteinen fernzuhalten hatte, verstand sie früh. Und so begleitete Da’ken sie nur noch in einigem Abstand und konnte sich zwischendurch seinen eigenen Gedanken widmen, anstatt jeden Schritt im Auge zu behalten. Meist rationierte er im Kopf die Mahlzeiten der nächsten Tage, die größtenteils aus dem selbstangelegten Garten und der spärlichen Vegetation stammten.
Da’ken ging weiter auf das Mädchen zu, deren weißes Haar inzwischen bis zur Hüfte reichte und sich an den Schläfen kräuselte. Sie erreichte bald das gleiche Alter wie er, als ihre Verbannung hierher ausgesprochen worden war.
Als er an ihre Seite trat, erkannte Da’ken, wie sie mit einem Stock im Inneren eines halb toten Tieres herumstocherte.
Seine Kehle krampfte bei dem Anblick der blutnassen Eingeweide, in denen No’ara mit strahlenden Augen rührte. Er zog sie mit einem Ruck an der Schulter von dem Steinnager weg und schlug ihr den Stock aus der Hand. Erschrocken blickte das Mädchen zu ihm auf.
Worte der Rüge lagen ihm auf der Zunge. Doch konnte er sie nicht aussprechen. Zu unschuldig und zu zerbrechlich wirkte seine Schwester, als dass er sie mit Zurechtweisungen gegen sich aufbringen wollte.
Ihre Mutter hätte schon viel früher damit anfangen müssen, ihre zuweilen grausamen Züge auszutreiben. Doch diese verlor seit ihrer Ankunft auf den Giftinseln mehr und mehr das Interesse, eine intakte Familie zu erhalten.
Die ätzenden Dämpfe der Schwefelgewässer, die sowohl die Inseln als auch das gesamte Festland der Ka’ara umgaben, zeichneten vor allem sie. Hielten die drei seit langer Zeit einzigen Bewohner der Inselgruppe den markierten Abstand zum Ufer ein, wiesen die Gase keine tödliche Konzentration auf. Doch zogen verdünnte Schwaden davon über die kleinen Inseln und vernarbten das Gesicht ihrer alternden Mutter. Es war gerade so, als würde der giftige Dunstschleier nicht nur ihre Haut verätzen, sondern auch ihre Seele.
Von einer liebenden Mutter war kaum etwas übrig geblieben. Sie wurde mit jedem Tag verbitterter und sorgte sich weniger um das Wohlergehen ihrer Kinder. Nur den Schild, der die Haut der Geschwister bedeckte und unversehrt ließ, erhielt sie aufrecht. Ihren eigenen hatte sie aufgegeben.
Die steinerne Hausruine, die sie bewohnten, hielt nur noch Da’ken instand, während die ehemalige Gebieterin in Verdruss und Wehleiden versank. Das, was man unter den widrigen Umständen als Haushalt bezeichnen konnte, führte ebenfalls der Junge. Er sorgte sowohl für Do’rea als auch für das kleine Mädchen. Zumindest No’ara war bei der Pflege des mickrigen Gemüsegartens eine Hilfe.
Doch Da’ken liebte seine Mutter. Anders als No’ara erinnerte er sich noch an die Güte und Liebe, die ihm damals zuteilwurde. Er sah noch immer die Frau vor sich, die ihn hegte und ihnen zum Überleben verhalf. Wenngleich sie ihm nie erzählte, worin ihr Verrat bestanden hatte.
So wenig sie sich um ihre Tochter kümmerte, erkannte Da’ken doch mehr Ähnlichkeiten zwischen den beiden als ihm lieb war. Nicht die mütterliche Liebe und Güte von damals spiegelte sich in seiner Schwester, sondern die erreichte Kälte ihres Herzens.
„Es gibt gleich Essen.“
Freude vertrieb den Schrecken aus No’aras Gesicht. Sie lief die Anhöhe hinauf, zu dem kleinen Ruinendorf, in dessen Mitte das noch intakteste Gebäude stand, das sie bewohnten.
Da’ken blieb zurück und betrachtete das leidende Getier mit steigendem Puls. Er kniff die Augen zusammen, bevor er mit einem zögerlichen Tritt den Nager erlöste.
Angewidert streifte er sich die Reste blauen Blutes und Splitter von Schädelknochen vom Pelzstiefel.
Ein schriller Schrei.
„No’ara!“, rief Da’ken.
Ohne eine Antwort abzuwarten, sprintete er den Hügel hinauf. Krachen und Poltern von Gestein drang ihm entgegen. Qualvolle Schreie von Männern und das Kreischen einer Frau.
Was zum … ?!
Ein Schauder durchzog jeden seiner Muskeln. Erinnerungen erwachten bei diesen Geräuschen. Er trotzte seiner Angst und bemühte sich, schneller zu laufen.
Die Erde bebte, als Da’ken den Rand des Dorfes erreichte. Er eilte durch zerfallene Häuser über verwilderte Schotterwege.
„No’ara!“, keuchte Da’ken.
„NO’ARA!“ Er schrie so laut er konnte.
O Hüter, lass es ihr gut gehen!
Stille kehrte ein.
Da’ken flehte weiter, während sich seine Haut anfühlte, als würde sie sich jeden Moment vor Angst vom Körper pellen.
Er nahm die letzte Biegung.
Da’kens Herzschlag setzte aus.
Der Garten und das Dach ihres Hauses standen in Flammen. Der Boden ringsum lag in tiefen Rissen, in denen Dutzende zerfetzte und zerquetschte Leichen klemmten. Nur wenige befanden sich weitestgehend in einem Stück, an denen Da’ken noch die Kleidung der gebieterlichen Armee erkannte. Eine Handvoll Überlebender sah er in einiger Entfernung in Richtung Küste davon stolpern.
Da’ken stand reglos auf der Stelle und blickte über die in rotem Licht flackernde Umgebung. Sein Körper zitterte. Der eklige Geruch von damals stieg ihm in die Nase. Diesmal nicht vermischt mit wässrigem Nebel, sondern mit rauchender Hitze. Er wollte nochmal nach No’ara rufen. Doch in diesem Augenblick erkannte er es.
Zuerst meinte er, es handelte sich um einen großen glimmenden Aschehaufen. Doch unter diesem schwelenden Bogen bemerkte Da’ken seine wimmernde Schwester – über sie gebeugt seine verkohlte Mutter.
Da’ken lief auf die beiden zu und drückte das verbrannte Stück Fleisch beiseite, um No’ara zu befreien. Do’rea stürzte stöhnend zur Seite.
„Mutter?!“, fragte Da’ken, entsetzt, dass sie noch am Leben sein konnte.
Mit pochendem Herzen starrte er in das zerklüftete Gesicht, während er seine nahezu unversehrte Schwester an sich zog.
„Mein Tod wird ihnen bald schon nicht mehr genügen“, krächzte Do’rea durch die versengte Kehle. „Sie werden zurückkommen, um auch euer Leben einzufordern.“
Tränen traten in ihre Augen beim letzten Blick auf ihren Sohn.
Verzweifelt fasste Da’ken nach ihrem Arm. Doch seine Finger brachen wie durch verkohltes Holz. Nicht in der Lage, es zu verstehen, schaute er auf die Asche in seinen Händen.
„Es tut mir so leid. Ich liebe euch.“
Da’kens verwässerter Blick suchte erneut die Augen seiner Mutter. Doch diese gaben nur noch den Tod von sich. Eine letzte Träne verdampfte auf der heißen Kohlehaut.
Ein reißender Schmerz schwoll in einer Welle in Da’kens Brust heran. Doch nicht nur Traurigkeit nährte sie, sondern auch ein Gefühl, dass er zuvor noch nie verspürt hatte. Pure Wut peitschte die Flut an. Höher und mächtiger drückte sich die Welle an Da’kens Geist und drohte ihn zu zerbersten.
Gerade als Da’ken der Qual keinen Einhalt mehr bieten konnte und sich in einem unbändigen Trauerschrei entladen wollte, war der Schmerz verschwunden. Der innere Damm, der eben drauf und dran gewesen war, zu brechen, war plötzlich weg. Stattdessen spürte er eine unendliche Weite in sich. Eine unergründliche Leere, in deren Dunkelheit etwas lauerte. Es kroch heran und zog sich langsam durch jeden Muskel und jede Ader. Ein brennendes Gefühl von Macht erfüllte seinen Körper, und auch das Bewusstsein darüber, wozu er sie einsetzen wollte.
Da’kens Gesicht verfinsterte sich. Er erhob sich vom Boden. No’ara glitt von ihm und blickte ihm verängstigt hinterher. Er entfernte sich zunächst nur langsam Richtung Küste. Mit stetig rascheren Schritten nahm er die Verfolgung der Mörder seiner Mutter auf. Ohne einen klaren Gedanken eilte er den Peinigern seiner Familie nach. Nur der Zwang, Gerechtigkeit für den Tod und die Qual einzufordern, die man ihnen gebracht hatte.
An der roten Steinreihe blieb Da’ken abrupt stehen. Im feinen Kiesstrand erkannte er eine tiefe Furche, von der zahlreiche Fußspuren weg, doch nur wenige zurückführten.
Durch den gelben Nebel machte er gerade noch die Umrisse des mehrere Meter langen Schiffes aus, das auch sie vor Jahren hier abgesetzt hatte.
Stechende Wut zirkulierte durch Da’kens Adern und spannte jede Faser seines Körpers. Wie gern würde er das Schiff zurück an Land ziehen. Doch weder befand sich die Kraft dazu in seinen Gliedern noch eine Kette in seinen Händen, die mit dem Transportschiff verbunden gewesen wäre.
Aber er spürte etwas anderes in den Fingern. Die Haut an den Spitzen kribbelte. Er fühlte kaltes Metall.
Da’ken betrachtete die leeren Hände für einen Moment und streckte sie nach vorne. Als er sie zurückzog, bemerkte er einen Widerstand, als würde tatsächlich eine Metallplatte an seinen Fingern kleben. Ohne weiter zu überlegen stellte er sich seitlich und stemmte sich dagegen.
Mit einer ausladenden Bewegung riss er das Schiff aus den Schwaden heraus. Es streifte über die Wasseroberfläche und raste auf den Strand zu. Mit einem mächtigen Donnern schlug der brechende Schiffskörper wenige Meter von Da’ken entfernt auf.
Nur einen kurzen Moment selbst über diesen mühelosen Gewaltakt überrascht, zerfetzte er mit einer weiteren Handbewegung die leckgeschlagene Außenwand.
Das giftige Gas flutete das Innere. Nur drei der Soldaten schafften es, schwer benommen noch rechtzeitig ihre ledernen Gasmasken aufzusetzen. Der Rest, der nicht bereits durch das Schleudern ein Ende gefunden hatte, suchte panisch nach seinen Masken, röchelte sich aber binnen Sekunden an den Dämpfen zu Tode.
Die Überlebenden krochen heraus und rappelten sich auf. Durch Verdichten des Dunstes schufen sie einen gelblich transparenten Schild vor sich.
„Ist dieses verdammte Weib immer noch nicht tot?!“, fluchte einer der Soldaten.
Sie taten sich sichtlich schwer, die Umgebung durch das von den Masken beengte Blickfeld abzusuchen. Ein Soldat erfasste Da’ken an der Todesgrenze und schritt unbekümmert auf ihn zu.
„Wo ist deine Mutter, Kleiner?“, richtete sich die Stimme gedämpft an Da’ken. „Sie hat wohl noch nicht genug von unserem Besuch.“
Da’ken fixierte mit einem finsteren Blick die Augen hinter dem ovalen Guckloch aus Glas.
„Hast du mich nicht gehört, Fluchkind?“, fuhr er Da’ken an, während die letzten zwei Kameraden nachzogen.
Da’ken entgegnete mit von Zorn ummantelten Worten: „Was haben wir euch getan, dass ihr meiner Familie so etwas antut?“
„Du sollst uns zu deiner Verrätermutter bringen!“
Der Soldat trat rasch auf den Jungen zu, schwenkte seinen Schild beiseite und streckte die Hand nach Da’kens Oberarm aus. Noch bevor das Leder des Handschuhs das Leinenhemd berührte, wurde der gesamte Arm des Mannes von der Schulter gerissen. Kaum ein Geräusch ging davon aus. Auch kein Schmerzensschrei folgte.
Ungläubig blickten die Kameraden auf die Stelle, wo erst nach und nach blaues Blut pulsierte. Der Verletzte sank unter Schock auf die Knie.
Da’ken trat auf den einarmigen Soldaten zu, auf dessen Augenhöhe er sich befand.
„Was ist dieser Fluch?“, fragte er mit leiser, aber vor Wut schwelender Stimme.
Doch sein Gegenüber starrte ihn nur mit großen, panischen Augen an.
Nach kurzem Staunen seines Kameraden hinter ihm, stammelte dieser: „Das – das war der Junge! – Das war der Junge!“
„Unsinn!“ Der Dritte suchte hektisch die Anhöhe ab. „Durch den Fluch können die Gebieterkinder gar keine Fähigkeiten haben.“
„Aber seine Augen! Sieh dir seine Augen an!“, schrie der Soldat immer ängstlicher.
Da’kens Emotionen formten inzwischen ein von Hass zerfurchtes Gesicht. Nicht nur die Augen, deren Grün zirkulierte wie Milch in schwarzem Kaffee, legten nahe, dass der Junge hierfür verantwortlich war. Eine düster werdende Aura stieg um ihn auf. Kaum sichtbar, aber dennoch wahrnehmbar.
„Geh weg von ihm, du Missgeburt!“, fuhr ihn der Soldat an und baute sich bedrohlich vor ihm auf. „Oder ich verpasse dir auch so eine knusprige Haut wie deiner Verrätermutter!“
Da’kens Augen verengten sich. Kaum hatten sie den Soldaten hinter dem massiver werdenden Schild erfasst, explodierte sein gesamter Körper von innen heraus.
Von den Überresten seines Kameraden besudelt, flüchtete sich der andere rückwärts schreitend weiter in die Todeszone. Da’ken schritt hinterher und überquerte die Steingrenze. Die giftigen Nebelschwaden wichen vor ihm zurück, als würde er in einer Luftblase hindurchschreiten.
Der flüchtende Soldat blieb gegen seinen Willen stehen. Seine Gliedmaßen gehorchten ihm nicht mehr. Wie eine Statue stand er auf dem Strand und sah den Jungen auf sich zu kommen.
Das von Wut gezeichnete Gesicht stieg empor und schwebte dem seinem gegenüber.
Da’ken erweiterte die giftfreie Blase auf den Soldaten und zog ihm die Maske vom Kopf.
„Was haben wir euch getan?!“, schrie ihn Da’ken mit wässrigen Augen an.
„Ich erzähle es. Ich erzähle es dir“, stammelte der Soldat. „Seit – seit jeher werdet ihr Gebieterkinder mit den begabtesten Anwendern aus dem Volk vermählt, zu denen auch deine Mutter zählt. Deine Familie bringt aber seit über zwanzig Generationen ausschließlich Nachkommen hervor, die keinerlei Fähigkeiten entwickeln. Um weiter zu verbreiten, dass die Gebieterfamilie die mächtigsten Befähigten unterhält, haben seither alle Gewinner dabei geholfen uns zu täuschen. Auch deine Mutter hat das Leben am gebieterlichen Hof dem Volk, dem sie entstammt, vorgezogen.“
Der Soldat endete mit seinen Ausführungen.
Doch Da’ken wartete. Er erwartete mehr.
„Das war es? Das ist der Verrat?“, schrie ihn Da’ken fassungslos an.
„Auch du – solltest keine Kräfte haben“, krächzte der Soldat durch die vom Bann weiter beengte Kehle. „Und – sie – auch nicht.“
Der Gebannte blickte über Da’kens Schulter. Dieser war gerade drauf und dran ihm den Hals zu zerfetzen. Doch er hielt ein und folgte dem Blick.
No’ara stand auf der Anhöhe und wohnte dem grausamen Schauspiel mit weiten Augen und offenem Mund bei.
Ein Hammer an Schuldgefühlen stampfte Da’kens Hass in Grund und Boden. Beschämt ließ er den Bann vom Soldaten fallen, der erleichtert auf die Knie sank. Da’ken entfernte sich.
Der Befreite hustete, kaum hatte die Luftblase seinen Körper freigegeben. Er versuchte, den Atem anzuhalten. Doch der eine Atemzug brannte sich bereits durch seine Lunge. Er kroch und streckte den Arm nach der im Kies liegenden Maske aus. Mit einer Hand bekam er sie noch zu fassen, aber es war zu spät. Die von Gift durchzogenen Adern traten dunkel auf dem blassen Gesicht hervor. Die gelblich verfärbten Augen blickten leer in den Himmel.
Präludium 3 - Einforderung
Da’ken vertröstete No’ara unzählige Male und zögerte das Verlassen der Insel, um seinen rechtmäßigen Thron zurückzufordern, immer weiter hinaus. Dabei fühlte er sich schon lange dazu bereit, für seinen angestammten Platz zu kämpfen.
Er rechnete jeden der zahlreichen Tage damit, dass ein zweiter Trupp kommen würde, um es zu Ende zu bringen. Oder sie suchten nach dem Schiff der ersten Invasion um sich von dem Ergebnis zu überzeugen. Auch diese Ungewissheit, ob und wann ein weiterer Überfall stattfinden würde, machte es unmöglich hier länger zu leben.
Doch er wartete ab, bis No’ara alt genug war. Er wollte sie nicht als Kind in eine Schlacht ziehen. Auch wenn sie von einer normalen Kindheit kaum weiter entfernt hätte sein können.
Das Gemetzel am Strand hatte sie überaus interessiert verfolgt. Da’ken wusste nicht, ob es ihm lieber gewesen wäre, dass sie ihn für sein Handeln verabscheut oder gar Angst vor ihm gehabt hätte, als dass sie es so gefühlskalt hinnahm. Auch der gewaltsame Tod ihrer Mutter ließ sie kaum merklich trauern.
Da’ken selbst war sich nicht sicher, ob ihn der Mord an seiner Mutter von Tag zu Tag mehr verbitterte, oder ob die Kälte seiner Schwester auf ihn abfärbte.
No’ara war zu einem jungen Mädchen herangewachsen. Kein kleines Kind mehr, das er jeden Moment im Auge behalten musste. Sie gehorchte und konnte Konsequenzen von Handeln und Unterlassen einschätzen.
Die Zeit war reif.
Die Strecke war länger als gedacht, die sie hoch über dem von gelblichen Schwaden bedeckten Meer schwebend zurücklegen mussten. Für einen kurzen Moment zweifelte Da’ken an seiner Orientierung, und fürchtete, dass er sie weiter aufs Meer hinausführte. Doch dann kamen die drei mickrigen Stege in Sicht, die den unbelegten Hafen der Hauptstadt bildeten. Da’ken setzte mit No’ara und ihrem Paket Fuß auf den von ätzenden Dämpfen angegriffenen metallenen Planken. Sie traten aus der Todeszone heraus und schritten an dem Tor zum Trockendock vorbei, das von zwei müden Soldaten bewacht wurde. Diese mussten mehrmals hinsehen, bevor sie begriffen, woher die zwei Fremden ohne Schutzkleidung kamen. Ganz abgesehen davon, dass freiwillig noch nie ein Zivilist dem Hafenbereich so nahe gekommen war, schwebte hinter dem jungen Mann und dem Mädchen ein mannsgroßes Bündel.
„Halt! Wer seid ihr?“
Die zögerlichen Rufe ignorierte Da’ken. Nur No’ara betrachtete die unentschlossenen Wachen im Vorübergehen. Sie verlor schnell das Interesse an ihnen und richtete den Blick wieder nach vorne.
Die Geschwister bewegten sich ohne Eile Richtung Stadtgrenze.
Sich endlich ihrer Aufgabe besonnen, beschworen die Soldaten eine transparente Barriere, die sie den Eindringlingen in den Weg stellten. Doch ohne einen Moment zu zögern, schritt Da’ken ungebremst mittendurch.
Während sich eine Wache noch fragte, was hier falsch gelaufen war, ließ die andere das Bodenpflaster vor Da’ken aufplatzen und sich zu einer Mauer auftürmen. Aber diese tat sich in der Mitte zu einem Torbogen auf, durch den die Kinder unaufhaltsam weiter Richtung Stadtzentrum schritten.
„Gefahr!“, hallte es über die gesamte Stadt hinweg. „Eindringlinge vom Hafen her! Gefahr!“
Nur No’ara wandte sich überrascht um und blickte auf den Soldaten, dessen Stimme so immens verstärkt aus seinem Mund drang.
Da’ken blieb erst am Ende der kleinen Seitenstraße stehen, die auf einen großen Platz mündete, und sah sich tausenden Marktbesuchern gegenüber. Nur ein Teil schaute ängstlich in seine Richtung. Der Rest war bereits in Aufruhr. Die Händler brachen eiligst ihre Stände ab, während sich die Besucher aufmachten, in ihre Wohnhäuser zu flüchten.
Das Stadtzentrum räumte sich rasch. Viele verlängerten ihre Schritte durch Luftstöße an ihre Fersen. Die Händlerkarren erhielten Rückenwind in aufgesetzte kleine Segel.
Doch der ovale Platz verwaiste nur kurz. Hinter ihm ragte das mächtige schwarze Schloss weit in den weißen Himmel auf. Aus dem Schatten des Gebieterschlosses, das die größte Fläche der Stadt einnahm, stürmten hunderte Heeressoldaten heran. Ein Teil eilte durch mehrere Seitenstraßen dem Hafen entgegen. Aber vor der direkten Verbindung versperrte dem Großteil der Soldaten ein Junge den Weg.
Die Soldaten liefen mit skeptischem Blick an Da’ken vorbei, in dessen Rücken sich No’ara drückte. Dann kam der erste Rempler. Doch keineswegs wurde der einen Kopf kleinere Junge weggestoßen, sondern der Soldat. Noch ein zweiter wurde wie von einem starken Schlag zurückgeschleudert und der Zug kam zum Erliegen.
Die Truppen nahmen Abstand und nun erst Notiz von dem schwebenden Paket. Die anderen Teile des Heeres drangen von hinten durch die Hafenstraße heran und umzingelten die Eindringlinge.
Aus der Masse tat sich ein breit gebauter Soldat in aufwendig gearbeiteter Rüstung und dunkelviolettem Umhang hervor. Seine Statur war außergewöhnlich für die sonst so schmächtigen Ka’ara.
„Ich bin Feldherr Or’kon“, stellte er sich knapp vor. „Wer seid ihr, und was hat das hier zu bedeuten?“
Der Junge atmete ruhig und tief. Mit verstärkter Stimme, für alle Soldaten hörbar, gab er ohne Umschweife bekannt: „Wir sind die verbannten Kinder eures Gebieters und ich, Da’ken, beanspruche meinen rechtmäßigen Thron.“
Entsetzen stieg in viele Gesichter. Um keinen Zweifel zu lassen, ließ Da’ken das Bündel herbeischweben und die Laken davon abblättern.
Für jeden erkennbar stand zwei Meter über dem Boden erhoben der einarmige Überlebende der Invasion. Hager und verwildert, doch gerade noch am Leben. Anhand der Blicke erkannte Da’ken jedoch, dass Or’kon – als auch der Rest des Heeres – nichts mit diesem Beweis anfangen konnte.
„Hier weiß niemand über den Überfall auf die Giftinseln“, kam ein Ruf aus Richtung des Schlosses.
Auch ohne die Stimme von einst zu erkennen, wusste Da’ken, wer dort hinter den Reihen der Soldaten sprach.
Das Heer machte sich daran, eine Gasse zu bilden. Begleitet von drei weiteren in Rüstungen mit verschiedenfarbigen Umhängen gehüllten Feldherren schwebte der einstige Aufrührer rasch heran.
Ta’kon glitt in der aufwändigsten aller Rüstungen, künstlich umspielt von einer flatternden blauen Schärpe, herab.
„Diese geheime Aktion bestand ausschließlich aus meinen getreuesten Untergebenen“, gestand er offen mit einem herablassenden Lächeln.
Da’ken – nach außen wenig beeindruckt von dieser Offenbarung – nahm Augenkontakt zu seiner Geisel auf. „Dann besteht für ihn also keine weitere Lebensgrundlage mehr.“
Ihm blickten zwei sowohl verständnisvolle als auch erleichterte Augen entgegen. Da’ken hatte keinerlei Grund es zu bedauern, doch den Gefangenen die lange Zeit leidvoll am Leben zu erhalten war mit einem Mal vollkommen sinnlos. Doch für einen kleinen Eindruck sollte er noch von Nutzen sein.
Die halbe Armee war wie versteinert, als im nächsten Moment die zerquetschten Einzelteile des Erlösten auf das Bodenpflaster platschten. Nur Ta’kon reagierte ungewöhnlich gefasst – fast schon neugierig.
„Du hast es also geschafft, den Fluch zu brechen? Oder ist das nur ein Trick? Hast du jemanden angeheuert, der dies alles im Hintergrund inszeniert? Ist es gar deine Mutter?“
Die Soldaten blickten sich erschrocken um, während aus Da’kens Gesicht zum ersten Mal die Fassung wich. Seine Augen sprühten voller Zorn.
„Nein“, wusste Ta’kon dies gut zu deuten. „Die Gebieterin ist tot und der kleine Prinz, der kürzlich seine Kräfte entdecken durfte, wagt es, seinen Anspruch zu erheben.“
Da’ken fasste sich schnell wieder und sprach ruhig: „Unterschätzt meine Kräfte lieber nicht, Gebietermörder.“
Ta’kon wandte sich unbeeindruckt an Or’kon: „Ergreift die Kinder und sperrt sie in den Kerker, bis zu ihrer längst überfälligen Hinrichtung. Setzt sie für die Öffentlichkeit heute Abend an.“
Er entfernte sich, als der Feldherr mit seinem ersten Trupp von zehn Soldaten auf die Kinder zutrat. Nur einen Schritt vor dem Prinzen ging die Einheit in einer Stichflamme auf und zerfiel zu kleinen Kohlehaufen. Or’kons magisch verstärkter Rüstung gelang es, die meiste Energie zu absorbieren. Doch das Potential war schnell ausgeschöpft, so dass die Flammen ihm dennoch Haare, Haut und Umhang versengten. Unter fürchterlichen Schmerzensschreien sank er in der heißen Panzerung zu Boden.
Die Aufmerksamkeit des Tyrannen hatte Da’ken damit zurückerlangt. Mit einem Blick über die Schulter starrte er auf die Kinder, umringt von knisternden Überresten.
„Ich bin es leid, noch länger zu warten!“, rief Da’ken am Gewimmer des Feldherren vorbei. „Bringen wir es jetzt zu Ende.“
Ohne Ta’kon die Gelegenheit einer Erwiderung zu geben, zog sich Da’ken mit ihm und seiner Schwester aus der Masse heraus. Im nächsten Moment standen sie auf einem steinernen Podest, das sich binnen Sekunden in der Mitte des Marktplatzes errichtete.
In der gesamten Stadt sprangen Türen aus den Angeln und Fenster zerbarsten.
Noch bevor sich Ta’kon fassen konnte, um auch die anderen Feldherren nach ihren Armeen zu schicken, war Da’kens Stimme weit über die Häuser hinaus zu vernehmen: „Bürger und Soldaten von Ka’ara! Kommt herbei und erfahrt die Wahrheit über euren Führer!“
Da’ken las in Ta’kons Gesicht, wie er sich bemühte, dem überraschenden Vermögen, das der Junge vollbrachte, nicht zu viel Respekt zukommen zu lassen.
„Was bezweckst du damit?“, fragte er herablassend, während die Bewohner zögerlich ihre Häuser verließen und weitere Soldaten massenweise aus dem Schloss strömten. „Die Leute sehen in mir schon lange keinen wohlwollenden Anführer mehr. Die Volksvertretung habe ich abgeschafft und die Kerker sind voll mit Aufständischen. Du brauchst sie nicht davon zu überzeugen, dass sie mit mir einem absoluten Herrscher zur Macht verhalfen.“
„Ich habe keineswegs vor, hier irgendwen von etwas zu überzeugen.“
Die Feldherren und Soldaten warteten auf Anweisung, doch ihr Anführer machte keine Anstalten, gegen den Unruhestifter vorzugehen. Ta’kon ließ den Jungen sein Spielchen spielen. Auch er schien die Öffentlichkeit hier versammelt sehen zu wollen.
Der Marktplatz füllte sich noch, als Da’ken mit der Vorstellung von sich und seiner Schwester begann. Er schuldigte den damaligen Kommandanten seiner Verbrechen an und stellte alsgleich seine Forderung: „Erkennt mich und meine Schwester als rechtmäßige Erben des Throns an, und wir werden den Verrat an uns vergessen. Euch erwartet kein Leid, keine Bestrafung.“
Soldaten als auch Bürger blickten auf ihren schmunzelnden Tyrannen, der den Jungen geringschätzig mit verschränkten Armen betrachtete. Die Untertanen stimmten zuerst nur mit müdem Lächeln ein, bis die ersten spöttischen Rufe zum Podest drangen. Rasch wurde das belustigte Geschimpfe gegen den Gebietersohn lauter, bis es zu einem Stimmengewirr angewachsen war.
Mit einem breiten Lächeln trat Ta’kon heran. „Die Epoche eurer Familie und die Zeit der Gutmütigkeit und des Stillstands sind vorbei. Die nördlichen Provinzen habe ich dem Reich vor Jahren einverleibt. Die Wilden im Osten sind unser nächstes Ziel.“
Da’ken blickte ihm tief in die Augen. „Ich bin der einzige Gegner, um den Ihr Euch Gedanken machen müsst. Doch Ihr habt Recht. Für Gutmütigkeit ist es zu spät. Aber lasst es mich noch ein letztes Mal versuchen, manchen Eurer Unterjochten zur Vernunft zu rufen.“
Ta’kons Blick verlor die Belustigung.
„Ich gebe euch hiermit die letzte Gelegenheit, mir die Treue zu schwören. Ansonsten werde ich uns allen das Sonnenlicht nehmen.“
Ta’kons Lächeln erwachte erneut. Das Volk stimmte mit Spott ein.
„Das Sonnenlicht willst du uns nehmen?“, rief der Tyrann über die Menge hinweg. „Willst du uns ein Segel über die Stadt spannen?“ Ta’kon musste sein Lachen unterdrücken, während die Untertanen in Gelächter ausbrachen.
Da’ken war weder überrascht, noch enttäuscht, dass sich jemand der Verantwortung seiner Familie gegenüber freiwillig entziehen wollte. Genug Gebietertreue würde er unter den Gefangenen in den Kerkern finden, wie er von Ta’kon eben selbst erfahren hatte. Mit ihnen würde er ein neues Ka’ara aufbauen.
Er atmete tief durch und nahm seine Schwester an die linke Hand.
Da’ken hob den rechten Arm mit gestrecktem Zeige- und Mittelfinger der hoch am Himmel stehenden Sonne entgegen. Er blickte mit schmerzenden Augen direkt in die gelbe Scheibe über seinen Fingerspitzen.
Das Gelächter um sie herum nahm langsam ab. Die Entschlossenheit des Jungen machte Eindruck. Sekunde um Sekunde verstrich, in der gespenstische Ruhe in die Menge einkehrte. Die Einschüchterung stand allen ins Gesicht geschrieben.
Doch nichts passierte.
Da’ken nahm den Arm herunter und wandte sich mit entschlossenem Blick und Schweißperlen auf der Stirn zu Ta’kon.
Das Volk atmete auf. Es belächelte die eigene Angst. Die Bedrückung wich wieder der Belustigung.
Spott und Geschimpfe brach auf die Geschwister herein.
Auch Ta’kon hatte genug von dieser Spielerei. Der Junge hatte schon zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Er beäugte Da’ken, der immer noch solch eine Selbstsicherheit ausstrahlte. „Was siehst du mich so an? Denkst du, ich lenke jetzt noch ein und entlasse dich?“
„Nein.“ Da’ken glitt ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht. „Dazu ist es zu spät. Du konntest ohnehin nie Gnade von mir erwarten.“
Mit einem Mal verdunkelten sich die Schatten der Häuser. Es wurde spürbar kühler, als würden Wolken die Sonne verdecken. Immer mehr Leute hoben die Köpfe. Zunächst war es nur schwer zu erkennen, doch schwarze Flecken breiteten sich rasch auf der Sonnenscheibe aus.
Panik stieg in die Gesichter der Ka’ara. Die ersten verzweifelten Schreie, er solle damit aufhören, wurden laut. Auch Ta’kon richtete seinen ungläubigen Blick von der erlöschenden Sonne auf Da’ken, der ihn immer noch mit diesem diabolischen Ausdruck fixierte.
Ta’kon spürte einen ansteigenden Druck, beginnend von seinen Händen und Füßen, der langsam seinen Körper hinaufkroch. Voller Schmerz biss er die Zähne zusammen. Doch je weiter die blauen Adern auf der blassen Haut hervortraten, desto weniger konnte er den Schreien Einhalt gebieten. Jede einzelne Zelle seines Körpers schwoll an, bis sie schließlich eine nach der anderen zerplatzte.
Da’ken spürte, dass er versuchte, dagegenzuwirken. Aber jedes Mittel verpuffte. Er hatte nicht im Geringsten eine Vorstellung davon, was gerade mit ihm passierte. Auch Angriffe auf ihn oder seine Schwester gelangen nicht einmal im Ansatz.
„Nein! – Nicht!“, stammelte Ta’kon mit Angst in den sich auflösenden Augen.
Unheimliches Entsetzen strömte durch Volk und Soldaten bei dem Anblick ihres selbsternannten Herrschers, der sich qualvoll von Sekunde zu Sekunde, Minute zu Minute zersetzte.
„Hör auf… bitte…“, sprotzte es aus der mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüllten Kehle.
Da’ken hätte es gerne bis zum Schluss verfolgt, doch er wollte seine Schwester diesem Schauspiel entziehen. Ebenso Hass und Flüchen, Holz und Steinen, Betteleien und Schwüren, die auf sie einprasselten.
Da’ken schwebte mit No’ara rasch in den Himmel auf und verließ die todgeweihte Hauptstadt. Sie schnellten den Spitzen der Schlossmauern entgegen und verschwanden dahinter.
Präludium 4 - Der Beginn
Die Schwefelmeere gefroren und die gelben Giftnebel versiegten. Jegliches Leben außerhalb der Schlossmauern war nahezu undenkbar geworden. Nur manche der aus den zahlreichen, von Ta’kon erweiterten Kerkern befreiten Untertanen zogen den Beistand ihrer Familie dem sicheren Leben im Schloss vor. Daher gestattete Da’ken, Dörfer und Städte des restlichen Landes als Kolonien in der Eiswüste weiter zu besiedeln, sofern die Bewohner ihm gleichfalls die Treue schworen. Wie das Schloss selbst, schützte sie eine eigene magische Barriere vor der eisigen Kälte. Nach innen hin gab die Kuppel künstliches Sonnenlicht ab, das vor allem den in Gewächshäusern errichteten Gärten zugutekam.
Die erste Zeit bewegte sich No’ara zufrieden und glücklich durch das weitläufige Gebieterschloss. Auch nach Wochen gab es immer noch Gänge und Winkel ihres Geburtsortes, die sie noch nicht durchschritten hatte.
An jeder Ecke verneigten sich die neuen Bürger vor ihr. Sie genoss die Aufmerksamkeit und Unterwürfigkeit. Doch schon bald verlangte sie mehr als bloße Gesten.
Nicht, dass sie vom angestellten Personal nicht genug Essen bekam. Aber sie forderte die Essensration eines Untertanen ein, an dessen Zimmer sie während einer neuerlichen Erkundungstour vorbeikam. Nur, um seine Reaktion zu sehen.
Würde er die Schale nur unter Protest abtreten, oder ohne zu zögern, mit einem Lächeln? Des Öfteren war sie zu müde, um selbst weiter zu laufen, und ließ sich tragen oder schwebend fortbewegen.
Bei einer dieser Gelegenheiten kam es ihr in den Sinn: Sie wollte eigene Fähigkeiten haben. Sollte sie die einzige Nichtbefähigte ihres Reiches sein? Sie, die Prinzessin?
Doch auch Bitten und Betteln bei ihrem Bruder verhalfen ihr nicht dazu. So mächtig er war – dass er den Damm, der sein Potential über so viele Generationen hinweg aufgestaut hatte, brechen konnte, lag nicht in seiner Gewalt.
„Aber wie soll ich mich sonst unter all den Befähigten verteidigen können?“, versuchte sie, ein Argument anzubringen, das ihren Bruder nicht so einfach über diese Angelegenheit hinwegschauen lassen konnte.
Doch er entgegnete mit einem abschließenden Lächeln, dass er schon auf sie achtgeben würde. „Außerdem hast du von unseren treuen Bürgern nichts zu befürchten. Sie lieben uns. Oder siehst du das anders?“
No’ara schüttelte schweren Herzens den Kopf und entschwand unzufrieden.
Wir brauchen von ihnen nichts zu befürchten?
Das wollte sie unter Beweis stellen. Vielleicht überdachte ihr Bruder dann seine Einstellung und würde sich ernsthafter mit ihrem Wunsch auseinandersetzen.
Sie ließ die Angelegenheit zum Schein auf sich beruhen und nutzte die Zeit, um sich einen Plan zurechtzulegen. Sie ließ sogar davon ab, das Volk weiter mit ungerechten Forderungen zu traktieren, um sich später nicht der Provokation beschuldigen lassen zu müssen.
Sie wollte in der Erntezeit für einen Unfall sorgen, der eindeutig als aggressiver Akt gegen sie ausgelegt werden würde. Je schlimmer sie dabei verletzt werden würde desto besser. Wie auch bei ihrem Bruder sah es mit dem Heilpotential unter allen Ka’ara nicht rosig aus. Dennoch wollte sie das Risiko eingehen. Sie wollte unbedingt Fähigkeiten haben. Sie musste Kräfte haben.
Doch ein anderes Ereignis sollte ihr in die Karten spielen, das sie noch vor der Erntezeit in die erhoffte Situation brachte.
Schon etliche Tage lag die Eiswüste, aus der das Schloss mehrere Meter herausragte, in Windstille. Es war selten, dass sich kein Schneesturm an den schwarzen Mauern brach.
Eine Vielzahl Kolonisten fegte über die Schneedecke hinweg und schlug gegen die massiven Außentore des Gebieterschlosses. Verzweifelt schrien sie um Hilfe.
Da’ken eilte sofort herab, nachdem man nach ihm geschickt hatte.
„Mein Gebieter!“, riefen sie ihm entgegen. „Ein Angriff. Ein schrecklicher Angriff an der Nordküste, von jenseits des Meeres. Schreckliche Kreaturen. Tausende.“
Von jenseits des Meeres? Kann das sein? Gibt es noch weiteres Land auf dieser Welt?
Da’ken hatte das gesamte Festland erkundet und seine Grenzen samt Inseln umrundet. Alle Länder waren befriedet, trotz anfänglicher Konflikte mit den Karshar und den Hobdaylen.
Eine Armee hatte er nie mehr gegründet. Doch er war für die Sicherheit seines Volkes verantwortlich.
Da’ken war im Begriff davonzustürmen, als er im Augenwinkel No’ara die Treppe herabeilen sah.
„Schützt meine Schwester“, trug er den Wachen auf, bevor er alleine das Schloss verließ.
Er flog so schnell über die aufwirbelnden Schneemassen, wie noch nie zuvor. In der Ferne erkannte er ein schwaches Licht. Was würde ihn erwarten?
Ich bete, dass ich dem gewachsen bin.
Er dachte an No’ara – an sein Versprechen, dass ihr nie etwas zustoßen würde. Nichts anderes zählte.
Schnell erreichte er die Kolonie an der nördlichen Eisküste. Da’ken versuchte, seinen schweren Atem in der eisigen Kälte zu beruhigen und atmete durch den Ärmel der Jacke. Seine Augen weiteten sich.
Die Kuppel über der Stadt war zerbrochen, doch gaben die Scherben weiter ihr Licht ab und leuchteten den Kampfschauplatz in der ewigen Nacht aus. Ein Heer aus dunklen, unbekleideten Monstern fiel über das gefrorene Meer herein. Ledrig schimmernde Haut spannte sich über die spitzen Knochen ihres hageren Skeletts.
Viele ihrer von Magie zerrissenen Körper unter grünem Blut säumten die Küste und den Boden der Mulde, in der die Stadt lag. Doch so tapfer sich die Ka’ara gegen die einen Kopf größeren Gestalten wehrten, auch auf ihrer Seite fiel einer nach dem anderen. In deutlicher Überzahl rissen die Kreaturen die Bürger an sich und sogen einen grauen Nebel aus ihrem Mund, den sie in den eigenen, von langen Zähnen umrandeten Schlund aufnahmen.
Obwohl von dem Anblick verstört, durfte Da’ken nicht zögern. Er drängte seine Angst beiseite und versuchte, klar zu denken.
Um den Kolonisten nicht selbst zu schaden, unterbrach Da’ken zunächst den Zustrom der Eindringlinge durch eine mächtige Eiswand, die aus dem Boden brach. Danach bannte er alle, die einen seiner Untertanen in den Fingern hielten und riss sie von ihnen weg.
Mehrere Dutzend Kreaturen standen reglos in der Luft. Die noch nicht erfassten Feinde blickten überrascht zu ihren Artgenossen auf und ließen von weiteren Angriffen ab.
Unter den wenigen Überlebenden der Kolonie erkannte Da’ken einen der ehemaligen Feldherren. Er trug seine hastig angelegte Rüstung mit dunkelgrünem Umhang, an dem manche Schnallen offen standen.
Die ersten Kreaturen der Nachhut sprangen auf die Kante der Mauer und tauchten an den seitlichen Rändern auf. Sie beobachteten in steigender Anzahl die Geschehnisse vor sich.
„Zieht euch sofort zurück!“, hallte Da’kens Stimme über das Schlachtfeld den Eindringlingen entgegen, ungewiss, ob sie ihn überhaupt verstehen konnten.
Doch nicht nur die Beobachter auf der Mauer, selbst die in der Luft gebannten reagierten auf die Aufforderung unbeeindruckt. Die langen, spitzen Zähne zogen sich auf dem lippenlosen Maul in die Breite und bildeten damit ein angsteinflößendes Lächeln. Ein krächzendes Zischen drang aus dem Schlund hervor.
Da’ken spürte, dass er mühelos mehrere Wellen der Angreifer einstampfen konnte. Sein Gefühl sagte ihm auch, dass die Kreaturen keinerlei magische Fähigkeiten besaßen. Nur ihre schwarmartige Vielzahl und körperliche Stärke machte diese Tiere gefährlich.
Doch er wollte nicht noch mehr Opfer unter den Bewohnern riskieren, die in der Senke verharrten. Er musste überlegter vorgehen.
Die Aufmerksamkeit der Gegner richtete sich auf ein näherndes Getöse durch den Schnee. Gruppen von ehemaligen Soldaten aus dem Schloss und den angrenzenden Kolonien eilten zur Verstärkung heran.
Während sich die Männer und Frauen hinter Da’ken formierten, reihten sich auch die Überlebenden des Angriffs verwundet, weinend und ihrem Gebieter sowie dem Hüter dankend ein.
Aus den verschiedenen Strömen der Unterstützung traten die anderen drei ehemaligen Feldherren hervor und knieten sich zusammen mit dem vierten ab.
„Mein Gebieter. Bitte gebt uns die Ehre an Eurer Seite kämpfen zu dürfen. Wir schwören Euch die Treue, hätten aber schon deutlich früher unser Haupt neigen sollen. Vergebt, dass wir uns in Euren Kolonien verbargen.“
Auch wenn die Unterstützung aus wenigen hundert eingerosteten Soldaten kaum einen entscheidenden Vorteil bei der wachsenden Invasion brachte, nahm Da’ken das Angebot als Rehabilitierung der Armeeführung Ta’kons an. Doch auf ihre Hilfe wollte er verzichten. Kein Ka’ara sollte heute mehr sein Leben riskieren oder gar lassen. Dafür wollte er sorgen – alleine. Er wollte seinem Volk – und sich selbst – beweisen, dass er ihr Vertrauen verdiente. „Haltet euch zurück und schützt euch im rechten Moment mit dem stärksten Schild, den ihr erschaffen könnt“, wies er seine provisorische Armee an. Da’ken hatte eine Idee. Er wollte es in wenigen Schritten zu Ende bringen. Ohne Zweifel an dem Befehl zu äußern, warteten seine Gefolgsleute gehorsam.
Reglos standen sich die beiden Fronten gegenüber.
Da’ken atmete ruhig, trotz der eisigen Kälte, die sich durch seine Nase brannte. Er hätte sich mit seinen Kräften davor schützen können, doch er ignorierte den Schmerz und konzentrierte sich allein auf die Bedrohung vor sich. Seine Muskeln spannten sich an.
Wenige Augenblicke darauf stürzte die Horde von der Eismauer herab. Da’ken riss im selben Moment die in der Luft gebannten Gegner entzwei. Die heranstürmende Meute schwappte über die Wand, wie Wasser aus einem überlaufenden Becken. Doch weder Da’ken noch seine Untergebenen wagten eine Bewegung. Im Gegensatz zu ihrem Gebieter stieg in den Ka’ara allerdings mit jeder Sekunde die Nervosität. Tausende hatten bereits die Mauer überwunden. Die Frontreihe stand unmittelbar davor, über sie hinwegzufegen.
Jetzt!
Mit einer Bewegung der Handflächen auf sich zu, ließ Da’ken die massive Eiswand in Millionen kleine Eispflöcke zerbersten und auf die Ka’ara zuschnellen. Auf ihrem Weg durchlöcherten sie das feindliche Heer mit einem Schlag.
Kurz bevor die vordersten Angreifer Da’kens Linie erreichten, klatschten sie mit ihren durchsiebten Körpern gegen die erschaffenen Schilde, an denen auch die Eisgeschosse zerschellten. Ansätze von Begeisterung in Form von einzelnen Jubelrufen waren aus den Reihen hinter Da’ken zu vernehmen. Ansonsten bemühte sich die Menge um Ruhe. Es war noch nicht vorüber.
Aber auch Da’ken atmete kurz auf. Es hat geklappt. – Wie soll mein nächster Schritt aussehen?
Eine zweite Welle sammelte sich vor den Überresten der Eiswand. Vor ihr erstreckte sich ein Meer gefallener Artgenossen. Sie zögerten, über die Leichen in ihren eigenen Tod zu schreiten, während der Zustrom der Kreaturen über den gefrorenen Ozean nicht abriss.
„Die letzte Gelegenheit, euch zurückzuziehen“, bot Da’ken an.
Diesmal von seinem Angebot weniger belustigt, warteten sie ab.
„Mein Gebieter!“, hörte Da’ken nur beiläufig aus der leise tuschelnden Menge hinter sich heraus.
„Mein Gebieter!“, versuchte erneut jemand, seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. „Eure Schwester!“
Da’ken hielt den Atem an und schnellte herum.
Ein Soldat trat auf Da’ken zu. In den Armen trug er No’ara, aus deren Hals blaues Blut pulsierte.
Da’ken verlor den Boden unter den Füßen und stürzte in seinem Geiste in einen tiefen Abgrund. Er starrte auf das halbwache Gesicht No’aras, das ihm so hilflos und voller Angst entgegenblickte. Wie versteinert standen seine Beine auf dem Grund. Er streckte die Arme aus und nahm seine kleine Schwester an sich. Tränen liefen von No’aras Wangen.
Ein verzweifelter Ruf nach Hilfe wurde von einem hasserfüllten Schrei nach einem Verantwortlichen verdrängt. Doch keines von beiden verließ Da’kens Lippen.
Die Verletzung war so schwer, dass es kein Ka’ara verbringen mochte, seine Schwester zu heilen. Kein Hilferuf würde nützen.
Der Verantwortliche für diese Tat eröffnete sich Da’ken im selben Moment beim Blick auf die Wunde. Ein Eissplitter ragte daraus hervor.
Mit tränenden Augen sank Da’ken auf die Knie, seine Schwester fest an sich gedrückt. Ein zerfetzender Schmerz zog an seinem Herzen. „O Hüter! Was hab ich getan?!“
Er legte seinen Kopf an No’aras Stirn. Tränen tropften ihm vom Gesicht.
„Verzeiht.“
Unter Da’kens Schluchzen drängelte sich eine Person in einem weißen Umhang durch die starre Menge. „Ich traue mir zu, dem Mädchen zu helfen.“
Da’kens Blick schnellte nach oben und blickte in ein männliches Gesicht, das von einer weißen Kapuze eingefasst war. An der Stirn prangte ein auf dem Kopf stehendes schwarzes Dreieck.
Da’ken nickte hektisch und legte No’ara ab. Er hatte ein komisches Gefühl bei der Person, doch durfte er jetzt nicht zweifeln. Der fremd wirkende Mann kniete sich nieder und zog den Splitter aus dem Hals, worauf noch mehr Blut herausquoll.
Da’kens Herzschlag setzte aus.
DU …!
Doch bevor Da’ken dazu kam, ihn dafür in Stücke zu reißen, legte der Fremde orange schimmernde Hände auf die Wunde. Der Blutfluss stoppte augenblicklich. Noch einen Moment länger und der Mann wischte mit den Handflächen das vergossene Blut vom unversehrten Hals.
Wie …?! Wer …?
Noch bevor Da’ken es schaffte, nur eine einzige Frage in seinem Kopf zu formulieren oder gar zu stellen, versenkte No’ara die Finger kraftvoll in seiner Jacke.
Da’ken zog sie an die Brust und weinte in ihre Schulter. „Es tut mir so leid!“
Er verfluchte sich. Nicht nur konnte er sein Versprechen nicht halten – er wäre fast selbst für ihren Tod verantwortlich gewesen.
„Seid Ihr Prinz Da’ken?“, riss ihn der Fremde aus der Erleichterung.
So viel Dankbarkeit er für den Retter seiner Schwester übrig haben sollte, blickte er ihm skeptisch entgegen.
Er sah aus wie ein Ka’ara. Doch nicht zuletzt das Symbol auf der Stirn strahlte etwas gänzlich anderes aus. Die Person war so wenig seinesgleichen wie die weiter lauernden Bestien hinter ihm.
Da’ken starrte ihm immer tiefer in die Augen, als könnte er damit das Trugbild durchschauen. Aus dem Nichts geriet der Name Medina in seinen Kopf. Der Name der Welt des Fremden. Für einen kurzen Moment dachte er, diese Information wäre ihm freiwillig preisgegeben worden. Doch mehr Namen und Bilder durchzogen Da’kens Gedanken, während der vermeintliche Ka’ara die Hände an seine schmerzende Stirn zog.
Gierig, aber mit steigender Nervosität, durchstreifte Da’ken die Erinnerungen des Fremden namens Nerosa-El. Jede weitere Information über unbekannte und zuweilen gefährliche Wesen, die er dem Weltenwanderer entriss, jagte ihm Angst ein.
Riesenhafte Gestalten, die Berge zertrümmerten. Geisterartige Schemen, die parasitär in fremde Körper drangen. Grausame Jäger mit abartigen Waffen und Fallen.
So viele weitere potentielle Bedrohungen für das Leben seiner Schwester und sein Volk. Wie sollte er sich dieser Übermacht nur behaupten können?
Erst nach dem dritten Ruf No’aras zog er seine Aufmerksamkeit aus den Gedanken Nerosa-Els heraus und bemerkte, wie seine Schwester panisch an seiner Kleidung zerrte.
Die Narach – nun befand sich auch die Bezeichnung der Monster in seinem Kopf – hatten den nächsten Angriff eingeleitet. Seine Untertanen warfen sich tapfer vor das Geschwisterpaar und den benommenen Weltenwanderer. Die Feldherren waren bereits gefallen. Der Rest würde in nur einem Moment folgen.
Ohne selbst zu wissen, was die folgende Geste auslösen würde, wischte Da’ken mit einer Armbewegung über das gesamte Schlachtfeld. Er befürchtete sogleich die letzten für ihn Kämpfenden und seine Schwester entzweizureißen. Doch ein Befehl des unbedingten Gehorsams fegte über Ka’ara wie Narach hinweg. Wie eine Sturmflut spülte sie die Farbe aus den Augen der Abertausenden und ersetzte sie durch das Grün von Da’kens Augen.
Die Kampfhandlungen erlagen auf der Stelle. Die bedingungslos Hörigen blickten auf ihren Gebieter und erwarteten Anweisungen. Doch sie wurden zu keinen gedankenlosen Marionetten. Vielmehr wurde ihre Einstellung zu Da’ken und seiner Schwester neu begründet.
Während die Überzeugung der Ka’ara nur noch gefestigt wurde, schienen die Narach selbst über ihren plötzlichen Sinneswandel überrascht.
Doch Da’ken spürte Widerstand. Nur eine Person versuchte, unter höchster Anstrengung dagegen anzukämpfen. Und nicht nur das.
Während seine Augen gegen das Grün rebellierten, hatte Nerosa-El den Arm zu einem weiteren Weltenwanderer gestreckt. Erst jetzt bemerkte Da’ken die Begleitung des Fremden. Eine Frau in einer schwarzen Kutte, um die der Medinae eine Barriere errichtet hatte.
„Flieh endlich!“, schrie Nerosa-El, als sein Versuch, sie von dem Einfluss Da’kens abzuschirmen bemerkt wurde.
Kaum sah sie die bedrohlichen Augen des Gebieters dieser Welt auf sich, entschloss Iris schweren Herzens, ihren Mentor zurückzulassen.
„Ergreift sie!“, schmetterte Da’kens Stimme über das gesamte Reich.
Ohne zu zögern stürmten die Narach auf die Frau zu, die – einen Augenblick bevor die Barriere brach – zu einem Lichtblitz zerfiel und in den Sternenhimmel davonjagte.
Da’kens neue Streitmacht aus Narach und Ka’ara kam zum Stillstand und wandte sich wieder ihrem Gebieter zu. Auch Nerosa-Els Augen wiesen nun ein blasses Grün auf.
Da’ken begab sich ihm hektisch gegenüber, während die Narach erwartungsvoll auf die beiden blickten.
„Zeig mir alles!“, befahl er seinem neuesten Untertan. „Ich will ALLES wissen!“
Kapitel 1 - Zweifel
Susan blinzelte in ihr sonnendurchflutetes Zimmer.
Das Licht schmerzte in den Augen. Ungewöhnlich stark sogar – selbst durch ihre Augenlider hindurch.
Sie wollte einen ersten Gedanken fassen. Doch nur grelle Fetzen zuckten durch ihren Kopf, ohne ein klares Bild zu formen. In ihrem Körper fand sich kein Funken eines Antriebs, sich auch nur zu strecken, geschweige denn das Bett zu verlassen.
Ein fast verblasster Geruch von frischer Bettwäsche zog in ihre Nase. Kaum wahrnehmbar, aber Susan bemerkte ihn. Als wäre es der erste Duft, den sie je erleben durfte.
Susan betastete den glatten Matratzenbezug unter sich. Sie versuchte, das Gefühl der Bettdecke auf ihr und des Kissens im Nacken zu beurteilen. Es fühlte sich echt an – lebendig.
Doch war sie wirklich am Leben?
Ich stand doch vor wenigen Momenten noch in den Ruinen von Andalon und …
Susan konnte den Gedanken nicht weiterführen.
Sie wollte sich gar nicht an die Geschehnisse in der Arktis erinnern. Zu grausam war das Erlebte. Die Qualen – nicht nur die körperlichen.
Chris!
Ein Stich ins Herz raubte Susan einen Moment lang jegliche Sinne. Der Schmerz war wieder da und bohrte sich tief in sie hinein. Die Bilder von seinem ausdruckslosen Gesicht, seinem abgetrennten Kopf.
Ein Druck baute sich in Susans Brust auf, als würde eine Palette Ziegelsteine darauf abgesetzt.
Ihre Gedanken vernebelten beim Blick an die weiße Zimmerdecke.
„Susi?! Bist du wach?!“
Der Ruf ihrer Mutter holte sie zurück. Ihr Blick verdüsterte sich kaum und bewegte sich nur gemächlich Richtung Zimmertüre. Der Reflex, aufzuspringen, zur Türe zu hechten, sie aufzureißen und nach unten zu brüllen, dass sie nicht mit der verhassten Verniedlichung Susi