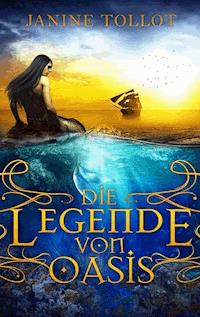Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Elexandale – eine zerstörte Welt in den Klauen eines Tyrannen; eine Welt, in der die Menschen nur noch Sklaven sind. Das Mädchen Kiathira entflieht ihrer Gefangenschaft, und mit sich trägt sie Erebus, das leere Buch, geschrieben vom Zauberer Aros. Dieser ist die einzige Hoffnung der Menschen auf Freiheit; ihn zu finden ist ihre Queste. Das leere Buch, das in Form von Gedichten zu ihr spricht, hilft ihr auf dem Weg durch das menschenleere und zerstörte Land, das von Tochors Seuchen und Plagen heimgesucht wird. Und nicht nur Erebus steht ihr zur Seite. Nach und nach trifft Kiathira auf weitere treue Gefährten, Überlebende der verschiedenen Völker Elexandales, die sich ihr anschließen, um gemeinsam mit ihr das Unmögliche zu wagen. Doch die Reise der tapferen Gemeinschaft wird begleitet von grässlichen Krankheiten, furchteinflößenden Kreaturen, bösartigen Landschaften und vielen anderen gefährlichen Abenteuern. Die Rettung des Zauberers wird mit jedem Schritt, den sie vorankommen, unwahrscheinlicher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1331
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAS BUCH
Elexandale – eine zerstörte Welt in den Klauen eines Tyrannen; eine Welt, in der die Menschen nur noch Sklaven sind.
Das Mädchen Kiathira entflieht ihrer Gefangenschaft, und mit sich trägt sie Erebus, das leere Buch, geschrieben vom Zauberer Aros. Dieser ist die einzige Hoffnung der Menschen auf Freiheit; ihn zu finden ist ihre Queste.
Das leere Buch, das in Form von Gedichten zu ihr spricht, hilft ihr auf dem Weg durch das menschenleere und zerstörte Land, das von Tochors Seuchen und Plagen heimgesucht wird. Und nicht nur Erebus steht ihr zur Seite. Nach und nach trifft Kiathira auf weitere treue Gefährten, Überlebende der verschiedenen Völker Elexandales, die sich ihr anschließen, um gemeinsam mit ihr das Unmögliche zu wagen.
Doch die Reise der tapferen Gemeinschaft wird begleitet von grässlichen Krankheiten, furchteinflößenden Kreaturen, bösartigen Landschaften und vielen anderen gefährlichen Abenteuern.
Die Rettung des Zauberers wird mit jedem Schritt, den sie vorankommen, unwahrscheinlicher.
DIE AUTORIN
Die Schweizerin Janine Tollot wanderte im Jahr 2009 nach Kanada aus, wo sie heute lebt, arbeitet und schreibt.
Die Chroniken von Elexandale entstanden in den Jahren 2004 bis 2006 und sind ihr Herzensprojekt.
Besuchen Sie die Autorin unter www.janinetollot.com
INHALTSVERZEICHNIS
P
ROLOG
D
IE
S
UCHE NACH DER
T
REUEN
H
AND
D
IE
F
LUCHT UND DER
N
EBEL
D
ER
W
EG IN DIE
D
UNKELHEIT
D
AS
L
ICHT DES
L
EBENS
G
ESCHICHTEN UND
H
ELDENTATEN
A
CHALENS
W
ALD
T
RA
A
TREB
D
IE
W
ÜSTE
E
SSANE
O
RMOG UND
I
NGOT
A
NARIEN
N
ANDUREEN
D
IE
S
ÜMPFE VON
M
ORHARD
T
OCHORS ZWEITER
K
RIEG
D
ER
W
ALD VON
L
AMON
D
IE
K
AMUNARISCHE
K
ÜSTE
F
EUER UND
F
REIHEIT
D
IE SCHWARZEN
T
ÜRME UND DER GEHEIME
W
EG
D
AS
K
ÖNIGREICH DER
N
ATUR
J
EN
N
ADOLIN
D
IE
S
IEBZEHN
H
ALLEN
VON
T
ASS
T
AREA
S
ANDRETTE
D
AS
Ö
DLAND
A
N
-R
ANEB
A
ROS
D
ER LETZTE
K
AMPF
D
IE
H
EILUNG
E
LEXANDALES
E
PILOG
D
ANKE
B
UCHVORSCHAU
PROLOG
Kiathira schlüpfte durch ihren Geheimausgang nach draußen. Am Himmel funkelten kalt und hell Millionen Sterne. Ein kühler Wind strich ihr über das Gesicht. Tief atmete sie ein und aus – wie sehr sie den frischen Geruch der Nacht liebte.
Sie spähte um die Hausecke. Es war kein Requeb auf seinem Rundgang zu sehen. Also schnupperte sie in der Luft nach den Ausdünstungen der Kreaturen. Das Mädchen konnte sie aus mehreren Hundert Metern Entfernung wittern. Sie rochen säuerlich, nach Schweiß und verwesendem Fleisch. Dieser Gestank war so unerträglich, dass ihr jedes Mal schlecht davon wurde, wenn auch nur ein Requeb in ihre Nähe kam. Aber die Luft war rein. Kiathira huschte zur Mauer direkt hinter ihrer Hütte. Dort kniete sie sich auf den Boden und kroch durch den feuchten Schlamm, darauf achtend, nicht über ihre langen Haare zu fallen. Etwa zweihundert Meter weit robbte sie an der Mauer entlang. Sie kannte die Stelle, wo sie abbiegen musste, dennoch schlug ihr das Herz bis zum Hals. Man wurde gefoltert, wenn man nachts von den Requeben draußen erwischt wurde. Aber Kiathira musste einfach den Sternenhimmel sehen. Die meisten Menschen im Lager wussten nicht, wie er aussah. Wenn sie es wüssten, würden sie das Risiko auf sich nehmen, dachte sie. Doch die Angst herrschte in den Herzen der Menschen der heutigen Welt, die keine mehr war. Die Welt war nur noch »Das Lager«, etwas anderes kannten sie nicht. Doch der eigentliche Grund, weshalb Kiathira sich nachts nach draußen wagte, war ihr Großvater. Die Requeben gestatteten keinen Kontakt unter den Menschen. Aber auch tagsüber konnte sie ihren Großvater nicht sehen, weil sie hart arbeiten musste. Kiathira liebte ihn über alles, so sehr, wie sie die Kreaturen hasste, und deshalb war es ihr das Risiko wert. Sie war süchtig nach Großvaters Abenteuergeschichten, die noch von der alten Welt erzählten – von der Zeit, als die Menschen keine Sklaven waren und nicht in diesen grausamen Lagern vor sich hin vegetierten. Von der Zeit, als sie frei in der Welt von Elexandale lebten.
Kiathira hatte die Stelle erreicht, wo sie abbiegen musste. Es gab keine Anhaltspunkte, sie wusste es einfach. Alles sah gleich aus: die eng aneinandergereihten Lehm- und Holzhütten, die Straßen aus Staub und die Mauer, die alles umgab. Die verfluchte Mauer, die alle so abgrundtief hassten. Die Mauer, über die niemand zu klettern vermochte und die keiner zerstören konnte. Das einzige Tor war mit schweren Schlössern verbarrikadiert und wurde streng bewacht.
Kiathira krabbelte an der Hütte von Sedin vorbei. Er war ein Junge in ihrem Alter, mit dem sie manchmal sprach, wenn sie auf den Feldern schuften mussten. Sein Vater war vor zwei Jahren in den Minen ermordet worden. Fast täglich starb ein Mann in diesem Berg. Waren es nicht die unermüdlichen Schläge der Kreaturen, so brachten Hunger, Durst und völlige Erschöpfung den Tod.
Drei weitere Hütten passierte Kiathira, deren Bewohner sie nicht kannte. Die Menschen in den Lagern waren sich fremd. Jetzt kam der gefährlichste Teil des Weges zu Großvaters Behausung: der große Platz, der das Zentrum des Lagers markierte. Hier mussten sich die Menschen jeden Morgen versammeln, um die Befehle und Bestrafungen der Requeben entgegenzunehmen.
Der aufgehende Mond warf ein verräterisches Licht über den Platz. Hier konnte man sie leicht erwischen. Kiathira stand auf, drückte sich flach an die Wand einer Hütte und spähte hinter der Ecke hervor. Zwei Requeben standen auf dem Platz und unterhielten sich mit gestikulierenden Armen. Kiathira verstand sie nicht. Ihre Sprache glich einem Grunzen und Schnarchen. Aber sie beherrschten auch die Menschensprache.
In der Hoffnung, dass die Monstren den Platz bald verlassen würden, wartete Kiathira ab. Über eine halbe Stunde blieb sie regungslos hinter der Hausecke stehen. Die Kälte kroch ihren Rücken herauf, und ihre Beine wurden taub. Diese scheußlichen Monster konnten doch nicht die ganze Nacht dort herumlungern! Irgendwie musste sie die Requeben ablenken.
Kiathira nahm einen faustgroßen Stein und warf ihn, soweit sie konnte, zu den Häusern auf der anderen Seite des Platzes. Der Stein fiel auf ein Dach. Erschrocken grunzten die Kreaturen auf und verschwanden zwischen den Hütten, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Wie dumm diese Viecher sind, lachte Kiathira innerlich. Lautlos huschte sie über den Platz und erreichte unbemerkt die andere Seite. Bald hatte sie es geschafft. Jetzt bog sie nach rechts ab, und endlich erblickte sie die Hütte ihres Großvaters. Nicht eine Behausung in dem Lager besaß ein Fenster, es gab nur eine Tür aus massivem Holz. Die Menschen mussten auf dem ungehobelten Holzboden schlafen. Nur im Winter bekamen sie von den Requeben ein paar Lumpen, aber nur so viele, dass sie nicht erfroren. Es gab keine Möbel oder Bilder, alles aus der alten Menschenwelt war vernichtet worden – außer den Kochtöpfen aus Ton. Der eine Raum, aus dem die Hütte bestand, war völlig leer. Eine in die Erde gegrabene Vertiefung draußen vor den Hütten diente als Feuerstelle. Das Essen wurde jeweils am Morgen und am Abend verteilt. Es bestand meistens aus den Überresten der Mahlzeiten der Sklaventreiber oder war bereits verdorben. So manche Menschen starben an Krankheiten, die von verfaultem Essen herrührten, und noch viel mehr erfroren im Winter. Aber die grausame Folter der Requeben forderte die meisten Opfer.
Kiathira klopfte leise drei Mal an die Türe. Lange Zeit tat sich nichts. Sie stand da wie versteinert und betete, dass man sie nicht erwischte. Sie wagte sich nicht vorzustellen, was diese stinkenden Kreaturen mit ihr anstellen würden, wenn sie sie mitten in der Nacht hier überraschten. Doch die Türe öffnete sich langsam und quietschend. Ein Auge blinzelte durch den schmalen Spalt. Es weitete sich, als es sah, wer auf der Schwelle stand.
»Kiathira! Bin ich froh, dass du es geschafft hast«, flüsterte Pandru. »Ich habe schon befürchtet, man hätte dich ertappt.« Er vergrößerte den Spalt um wenige Zentimeter, und Kiathira schlüpfte hindurch.
Pandru schloss die Tür leise und starrte sie an, als könnte er durch sie hindurchsehen. Für einen Moment herrschte lähmende Stille in dem Raum, den Pandru allein bewohnte. Er hielt ein Ohr an das Holz und horchte angestrengt. »Bist du auch ganz sicher, dass dich kein Requeb gesehen hat?«
»Hätten sie mich gesehen, wäre ich nicht hier.«
Pandru drehte sich zu ihr um. »Ja, da hast du recht.«
Er atmete erleichtert auf und schaute sie ernst an. Pandru war ein Mann mittlerer Größe mit wirrem, mausgrauem Haar. Die harte Arbeit in den Minen hatte seinen Rücken gebeugt, und das Gesicht schien wie aus Stein gemeißelt. Tiefe Furchen durchzogen die bleiche Haut. Mehr schlecht als recht hielt er sich auf den krummen Beinen. Aber seine einzigartigen Augen … Kiathira verlor sich immer wieder darin. Die Augen ihres Großvaters funkelten silbern wie die Sterne am Himmel. Trotz der Gefangenschaft hatte Pandru noch immer etwas Wildes und Barbarisches an sich.
»Es gibt einen bestimmten Grund, warum ich wollte, dass du kommst«, begann Pandru. »Ich weiß, dass ich dich in große Gefahr gebracht habe, aber ich muss dir etwas Wichtiges zeigen.«
Kiathira wunderte sich. Was gab es in dieser Hütte schon, das wichtig sein konnte? Doch sie wusste, Pandru war sehr schlau. Er kniete in einer Ecke hin und hob eine ächzende Holzlatte aus dem Boden, wobei er sich an dem rauen Holz etliche Splitter einholte. Dann reckte er mit beiden Händen weit nach unten und brachte ein altes, in Leder gebundenes Buch zum Vorschein.
Kiathiras Unterkiffer klappte vor Erstaunen nach unten. »Ein Buch«, platzte es aus ihr heraus. Sofort schlug sie sich die Hand auf den Mund. Die Requeben hatten gute Ohren. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Woher hast du es?« Sie war bemüht, ihre Stimme zu beherrschen.
Pandru stand wieder auf und pustete den Staub vom Einband. Mit der Hand strich er über das Leder und betrachtete es eine Weile. Sehnsucht schimmerte in seinen Augen, und in seiner Stimme klang Ehrfurcht. »Das ist Erebus, das leere Buch. Geschrieben von Aros’ Hand.«
»Der Zauberer Aros?«, fragte Kiathira ungläubig.
»Ja, Aros der Hoffnungsvolle, wie ihn heute manche nennen. Diejenigen, die sich noch an ihn erinnern.«
»Wo ist er? Ist er tot?«
»Nein, er ist nicht tot. Er ist ein Gefangener Tochors – wie wir alle.« Pandrus Worte waren von Traurigkeit geprägt. »Aber er hält ihn nicht, wie uns, in Lagern gefangen, sondern auf einem Berg. Dort sitzt er seit dem Ende des großen Krieges an einen Felsen gekettet. Er kann sich nicht bewegen, nicht selbst befreien, er ist Tochor völlig ausgeliefert. Er sitzt dort im Sommer in der unerträglichen Hitze und im Winter in der eisigen Kälte, während der Schneesturm um ihn tobt. All das Leiden und die Schmerzen, die Tochor den Menschen zufügt, wiederfahren auch Aros.«
Lange Zeit schwiegen sie und dachten über das Gesagte nach. Pandru erinnerte sich wehmütig an die Zeit, in der die Völker frei gewesen waren und in den Weiten von Elexandale gelebt hatten.
Kiathira riss ihn aus seinen Gedanken. »Warum nennt man ihn Aros den Hoffnungsvollen? «
»Weil er der Einzige ist, der die Macht hat, Tochor zu besiegen und die Menschen zu befreien.«
»Und warum tut er es nicht?«
»Er braucht dazu sein Buch.« Pandru hielt es ihr hin. »Das ist der Grund, warum Tochor ihn gefangen hält. Er will dieses Buch unbedingt haben.«
Kiathira nahm es mit beiden Händen entgegen. Sie war nervös, noch nie hatte sie etwas so Kostbares berührt. Immerhin begehrte Tochor höchstpersönlich diesen Schatz. Ein Berg, von dem ein Fluss in ein Tal aus Wiesen strömte, war in den ledernen Umschlag geprägt. Ein alter Baum gedieh am Ufer, Sonne und Mond standen über diesem idyllischen Bild.
Kiathira hatte diese Geschöpfe der Natur noch nie gesehen. Sie kannte sie nur aus Pandrus Geschichten. Schwermut machte sich in ihr breit, und sie hasste Tochor, ihr Leben, die Requeben, die Arbeit auf den Feldern. Sie wollte Elexandale sehen, wollte wissen, was Natur und Freiheit waren. Sie wünschte sich sehnlichst, Schnee zu fühlen und den Wald zu riechen. Wie wohl ein Fluss klang? Und welche Tiere gab es da draußen? Aber das waren törichte Wünsche. Die Einsicht, dass ihr Schicksal ihr nie erlauben würde, all diese Dinge zu erleben, verursachte in ihrer Brust brennende Schmerzen.
Kiathira würgte ihren Groll herunter und öffnete das Buch. Auf der ersten Seite stand geschrieben: Erebus, das leere Buch
Und darunter in kleinerer Schrift: Die Welt von Elexandale nach ihrem Fall
Das Papier war dick und bräunlich. Es fühlte sich wunderbar an. Kiathira roch daran, sog den Duft tief in sich ein und versuchte, sich daraus ein Bild von Elexandale zu machen, der Welt außerhalb der Mauern, aus der das Buch kam.
»Gefällt es dir?« Pandru entging die Begeisterung seiner Enkelin nicht. Auch er war von einem Feuer beseelt, wenn er das Buch in den Händen hielt. Kiathira antwortete nicht, sondern blätterte die Seite um. Dort stand ein Gedicht geschrieben. Die Menschen von heute konnten nicht lesen und schreiben. Nur die Alten kannten noch die Kunst der Buchstaben. Die Alten – so nannte Pandru jene, die noch aus der früheren Welt stammten, aus der Zeit vor der Versklavung. Lesen und Schreiben waren nicht mehr von Belang, denn die Menschen mussten nur hart arbeiten können. Buchstaben, Worte und Namen waren in Vergessenheit geraten. Doch Pandru hatte seiner Enkelin Lesen und Schreiben in den vielen Nächten beigebracht, in denen sie zu Besuch war. Mit Steinen auf Holz oder auf flachen Steinen hatten sie geschrieben. Manchmal kratzten sie sich die Buchstaben in die Haut oder schrieben mit Blut. Kiathira las das Gedicht vor, so gut sie konnte. Auf keinen Fall wollte sie versagen, wenn sie zum ersten Mal aus einem richtigen Buch lesen durfte.
Dieses BuchBestimmt nur für gute AugenNur denen wird es etwas taugenSeine Seiten sind schwer zu lesenDies können nur die weisesten WesenDie Texte scheinen dir verborgenNicht stehst du an den richtigen OrtenAuf dieser Welt lastet ein böser FluchDie Erlösung birgt dieses BuchNur den Menschen mit der treuesten HandFührt Erebus durch das verzerrte LandWelches besteht aus hundert GegensätzenDoch verbirgt es tausende von SchätzenDas Böse wird nicht ewig bestehenSo finde den richtigen Weg zu gehen
Kiathira schaute ihren Großvater fragend an.
Dieser lächelte. »Das hast du gut gemacht.« Er umarmte sie und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Kiathira freute sich über ihren ersten Erfolg. Sie hatte das Lesen schon immer geliebt. Sie blätterte um, doch die folgenden Seiten waren weiß. Jetzt begriff sie, warum es das leere Buch hieß.
»Was hat das zu bedeuten, und wie bist du zu diesem Schatz gekommen?«, fragte sie stirnrunzelnd.
»Als der große Krieg zu Ende war, kamen die Requeben, um die Überlebenden zusammenzutreiben und gefangen zu nehmen. Manche mussten Leichen begraben und andere wurden gezwungen, die Lager aufzubauen. Wir waren dazu verurteilt, unser eigenes Gefängnis zu errichten. Es war unser Untergang. Wir waren nur noch sehr wenige, und die Requeben wurden immer mehr und immer boshafter. Doch Tochor fehlte noch ein Gefangener, den er so gerne in Ketten gesehen hätte: Aros. Er suchte überall nach ihm, ohne ihn zu finden. Aros hat Tochor gefunden. Er ist durch die vergiftete Welt von Elexandale gewandert und hat mitangesehen, wie Tochor sie gewaltsam veränderte. Auf dem Weg zu Tochor hat Aros das Buch geschrieben. Doch bevor er dem Dunklen Herrscher gegenübertrat, rief er nach seinem Spion Nael dem Hohen. Nael ist ein Vogel, der sehr weite Distanzen mit überirdischer Geschwindigkeit zurücklegen kann. Nael brachte mir Erebus und eine Nachricht auf Papier geschrieben: Dies ist Erebus, das leere Buch. Es beinhaltet die Mysterien Elexandales nach Tochors Machtergreifung. Bewahre es gut. Dein Freund Aros.«
»Und warum wolltest du es mir unbedingt zeigen?«
»Über all die Jahre sind Erebus’ Seiten leer geblieben. Dieses Gedicht steht erst seit gestern auf dem Papier. Es ist an der Zeit, die Treue Hand zu suchen. Ich habe das Buch bereits mit in die Minen genommen, aber ich habe den Auserwählten nicht gefunden. Es muss also ein Kind oder eine Frau sein.«
»Was für ein Auserwählter? Wovon sprichst du?«
»Der Auserwählte wird sich auf die Suche nach Aros machen und ihn befreien, damit Elexandale wieder wird, wie es einmal war. Erebus wird die Treue Hand durch die Welt führen, die Tochor erschaffen hat, um alles unter seiner Kontrolle zu halten.«
»Wie ist denn die Welt da draußen?«
Pandru wollte antworten, doch er stockte. Lange und mit einem nicht zu deutenden Ausdruck in den Augen sah er Kiathira an. Plötzlich wirkte er hilflos und ängstlich.
Sie wusste, dass er diese Frage nicht beantworten konnte und sich dafür schämte. Er hasste es, seiner Enkelin eine Antwort schuldig zu bleiben, und so sprach er: »Ich habe über dieses Buch sehr lange nachgedacht. Ich vermute, dass die Gedichte Rätsel und Wegweiser zugleich sind. Es steht Das verzerrte Land. Das bedeutet wohl, dass Tochor eine Welt erschaffen hat, die voller Fallen und Gefahren ist. Dass man einen Weg geht und plötzlich feststellt, die ganze Zeit nur im Kreis gelaufen zu sein. Ohne Zweifel wandeln da draußen unzählige, uns Menschen nicht bekannte Ungeheuer umher. Das Land ist verzerrt und unter Dunkelheit begraben. Riesige Erdoberflächen, die sich gewaltsam verschieben. Elexandale ist surreal, man meint, sich in einem Albtraum zu befinden, aus dem man nie mehr erwacht. Man irrt durch diese Welt bis zum Wahnsinn …« Pandru konnte nicht mehr weitererzählen. Ihm grauste vor dem Gedanken, es könnte da draußen wirklich so sein und dass bald jemand diese Welt durchqueren musste – falls dies überhaupt möglich war. Obwohl er ganz sicher war, dass Elexandale verseucht, tückisch und gefährlich war, wünschte er sich nichts mehr, als diesen einst heiligen Boden eines Tages wieder betreten zu können. Aber er war alt, seine Knochen wie aus Glas. Der nächste Hieb einer Peitsche konnte sie zerbrechen, jeder Atemzug der endlosen Erschöpfung konnte der Letzte sein. Vielleicht würde er den Tag nicht erleben, an dem die Treue Hand Aros fand und dieser Tochor vom hohen Thron stieß.
»Also gut«, unterbrach Kiathira seine trüben Gedanken. »Was muss ich tun?«
Pandru schüttelte den Kopf, um sich wiederzufinden, und schaute seine Enkelin durchdringend an. »Nimm das Buch mit auf die Felder. Lass jedes Kind, egal wie jung, und jede Frau, egal wie alt, die nächste leere Seite berühren. Sie müssen die Hand flach auf das Papier legen. Wahrscheinlich wird so das nächste Gedicht erscheinen. «
»Wahrscheinlich?«
»Wie gesagt, das Buch ist in Rätseln geschrieben, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das Gedicht richtig gedeutet habe. Es heißt Die Treue Hand, und diese gilt es zu finden. Nur jenen, der sich selbst treu ist, mutig und stark‚ führt dieses Buch durch das verzerrte Land. Und es heißt: Die Texte scheinen dir verborgen, doch nicht, stehst du an den richtigen Orten. Das Buch wird den Auserwählten bis zu Aros führen. Sobald die Treue Hand das Rätsel gelöst hat und sich am richtigen Ort befindet, erscheint das nächste Gedicht. Es klingt zu einfach. Viel mehr Sorgen bereitet mir Tochors Land.«
»Aber Großvater, ich kann doch nicht einfach mit dem Buch auf den Feldern herumspazieren und es jeden betatschen lassen«, erwiderte Kiathira beinahe wütend. »Was ist, wenn die mich erwischen? Was ist, wenn das Buch den Requeben in die Hände fällt und sie es Tochor bringen?«
»Diese Monster wissen nicht einmal, was ein Buch ist«, spottete Pandru. »Sie würden es eher auffressen. Aber du hast recht. Wir müssen bedächtig vorgehen. Möglich ist, dass Tochors Diener wissen, dass ihr Herr nach Erebus giert. Aber du musst es wagen, Kiathira! Ich flehe dich an, tu es für dich und die Freiheit unserer Völker.«
»Weißt du, ich habe keine Angst, Pandru«, sagte Kiathira leise und schaute beschämt zu Boden. »Mir ist es gleich, wenn die Requeben mich zu Tode foltern, mich verhungern lassen oder tagelang in der Dunkelheit einsperren. Viel mehr fürchte ich um das Buch. Es ist viel zu wertvoll, als dass du es mir in die Hände legen darfst. Wenn ich versage, ist der letzte kleine Hoffnungsschimmer der Menschen zunichte gemacht.«
»Ich vertraue dir, mein Schatz«, sagte Pandru leise und schob ihre Hände, die ihm das Buch entgegenhielten, zurück. »Du wirst nicht versagen und du wirst die Treue Hand finden. Nimm es! Ich bitte dich inständig darum.«
Ein bitterer Kloß brannte in ihrem Hals. Keinesfalls wollte sie vor ihrem Großvater in Tränen ausbrechen. Pandru hatte ihr den Auftrag und die Ehre erteilt, die Treue Hand zu suchen. Was würde er denn denken? Doch Kiathira war traurig, sie konnte nichts dagegen tun. Pandru wischte ihr die Tränen mit den Daumen von den Wangen und strich sie sich auf die Lippen. Dies war einst eine tröstende Geste unter den Menschen gewesen.
»Pandru«, flüsterte sie und trocknete die Tränen mit ihren Lumpenkleidern, »gibt es da draußen noch Menschen?«
Wieder herrschte langes Schweigen, wieder dachte Pandru angestrengt nach. »Ich weiß es nicht«, sagte er zaghaft. »Ich glaube nicht. Falls es aber noch Menschen gibt, die durch Elexandale irren, sind es Wahnsinnige – gefährliche und böse Menschen!«
Sie saßen noch eine Weile da und schwiegen. Beide zweifelten an ihrem selbstmörderischen Plan. Sie fürchteten, dass die Treue Hand gar nicht existierte oder das Buch in die Hände der Requeben gelangte. Wie sah die Welt da draußen aus? Was, wenn sie wirklich unbezwingbar war?
»Pandru?«
»Ja?«
»Glaubst du, ich kann mit ihm gehen … mit dem Auserwählten?«
»Dort draußen würdest du eher sterben als hier drin.«
»Aber …«
»Du musst jetzt gehen, Kiathira«, unterbrach er sie. Das Silber in seinen Augen war ermattet. »Nimm Erebus mit.«
Kiathira schaute auf das Buch herab. Ihre Hände, die es umklammerten, zitterten. Mit größter Sorgfalt vergrub sie Erebus unter ihren Lumpen.
»Gib darauf acht«, flüsterte Pandru, als könnten laute Worte das Buch beschädigen.
Geräuschlos glitt Kiathira durch die Tür und machte sich auf den Weg zu ihrer Hütte, in der sie mit zwei alten Frauen, drei Kindern und einem jungen Mann hauste. Sie schaffte es erneut, nicht erwischt zu werden. Morgen aber würde es nicht so einfach sein. Doch Kiathira wollte sich nicht selbst entmutigen und Pandrus Wunsch erfüllen. Sie glaubte an Erebus und hegte große Hoffnung für die Befreiung der Menschen.
DIE SUCHE NACH DER TREUEN HAND
Kiathira und ihre Mitbewohner wurden, wie jeden Morgen kurz vor Sonnenaufgang, mit einem wütenden Klopfen geweckt. Die gegebene Zeit, sich anzuziehen und zu essen, war kurz und die Bestrafung schmerzvoll, wenn sie nicht eingehalten wurde. Abends nach der Arbeit wurden sie auf dem großen Platz im Zentrum des Lagers mit Wasserkrügen abgeduscht. Die Requeben gönnten ihnen diesen Luxus nur, weil sie die Ausdünstungen ihrer Gefangenen genauso wenig ertragen konnten, wie die Menschen die ihren. Zudem war dies die Tageszeit, an der Nahrungsmitteln verteilt wurden.
Das Frühstück bestand üblicherweise aus Kartoffeln, Wurzeln und Hafer, wenn die Requeben guter Laune waren. Sobald sie das Essen gekocht und heruntergewürgt hatten, mussten sich die Sklaven in Reih und Glied auf dem Platz versammeln. Hier wurden die Berichte der Arbeiten der vergangenen Tage vorgetragen, und sie erhielten Anweisungen für den bevorstehenden Tag. Im Lager von Skelta lebten etwa tausend Menschen. Etwas mehr als die Hälfte davon waren Männer, die in die dunkle, staubige Minen getrieben wurden, wo sie nach Metallen, Erzen, Edelsteinen, Diamanten und Wasser gruben. Dann und wann gingen sie in die Wälder, die an den Hängen der Bergmiene wuchsen, um Feuerholz zu schlagen. Die Frauen und Kinder mussten auf die Felder, die sich kilometerweit rund um die Hütten erstreckten. Kräuter, Gemüse und Getreide wurden dort angebaut. Niemand fragte sich, wofür diese kostbare Nahrung war, die regelmäßig auf Schubkarren verladen und fortgebracht wurde. Die Requeben waren ausschließlich Fleischfresser und so mit Sicherheit auch ihr Herr. Ging es nur darum, die Menschen zu demütigen? Tagtäglich rangen sie mit dem Hunger, während sie Hunderte von Körben mit frischem Gemüse füllten. Und wehe dem, der es wagte, etwas zu stehlen.
In den Lagern gab es keine Tiere, und ob außerhalb dieser Mauern noch Lebewesen existierten, konnten die Menschen nicht sagen. Der Einzige, der das wusste, war Aros. Doch über dessen Befinden wusste außer Tochor niemand Bescheid. Und diese leibhaftige Gestalt des Bösen hatte noch kein Mensch zu Gesicht bekommen.
Kiathira betrat mit der Gruppe aus Frauen und Kindern die Felder, um Kartoffeln zu ernten. Requeben umzingelten die Menschen und schlugen mit den Peitschen rhythmisch in ihre Hände, um den Sklaven zu zeigen, dass sie selbst keinen Schmerz verspürten und dass sie jederzeit bereit waren, eine Tracht Prügel auszuteilen. Kiathira hatte noch immer keine Idee, wie sie nach der Treuen Hand suchen sollte. Sie kniete auf dem Boden, völlig verdreckt, stinkend und erschöpft, obwohl es noch früh am Morgen war. Die Arbeit war sehr hart. Vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung, manchmal auch länger, arbeiteten sie auf den Feldern. Hin und wieder machten sich die Requeben einen Spaß daraus, die Pause erst kurz vor Arbeitsschluss einzuläuten. So schufteten sie den ganzen Tag, ohne etwas Ordentliches im Magen zu haben. Wasser gab es nur wenig. Es wurde in kleinen Rationen ausgeteilt und schmeckte scheußlich. Es war bräunlich und stank und machte die Menschen krank, doch das war den Requeben gleichgültig. Es gab für die Diener Tochors keine größere Freude, als die Menschen leiden zu sehen.
Sie musste durchhalten! Kiathira spürte das Buch unter ihrem Hemd und hatte Mühe, so zu arbeiten, als würde nichts ihre Bewegungen behindern. Die Requeben waren überall und stets wachsam.
Plötzlich rutschte das Buch unter ihrem Hemd heraus und landete mit offenen Seiten auf dem Boden. Als würde Erebus sie auffordern, mit der Suche endlich zu beginnen, zeigte sich jene Seite, welche die Menschen berühren mussten. Kiathira duckte sich so unauffällig wie möglich über das Buch und schaufelte mit den Händen Erde darüber. Seila, Salias Tochter, die neben ihr arbeitete, hatte es gesehen. Sie starrte Kiathira mit weit aufgerissenen Augen an.
»Was ist das?«, zischte sie durch zusammengebissene Zähne.
»Ein Buch.«
»Ein Buch?« Seila glaubte, ihren Ohren nicht zu trauen.
»Möchtest du es einmal berühren?« Kiathira konnte ihr Glück kaum fassen.
Seila wusste, dass so etwas sehr gefährlich war, doch sie konnte nicht widerstehen. Sie kniete sich neben Kiathira hin und wischte die Erde weg. Mit der Hand fuhr Seila langsam über das Papier. In ihrem Gesicht spiegelte sich ein Lächeln wider. Gespannt beobachtete Kiathira, ob das Papier sich veränderte. Doch es tat sich nichts. Es blieb so weiß wie zuvor. Nicht einmal die Erde vermochte die Seiten zu beschmutzen.
»Es fühlt sich wunderbar an. Woher hast du es?« Seila musste sich zusammenreißen, vor lauter Aufregung nicht zu kreischen.
»Das ist eine komplizierte Geschichte«, flüsterte Kiathira, »und es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Dieses Buch ist das einzig Kostbare, das wir Menschen noch besitzen. Es ist die letzte Hoffnung auf unsere Befreiung. Bitte tue mir einen Gefallen …« Kiathira schaute sich vorsichtig um, wandte sich wieder Seila zu und gab ihr ein Zeichen, weiter zu arbeiten. »Erzähl allen, was ich hier habe. Jeder soll im Verlauf des Tages und in den darauffolgenden zu mir kommen, um das Buch zu berühren.« Kiathira wusste, dass das merkwürdig klang, doch was sollte sie sonst tun? Vielleicht war es kein Zufall, dass das Buch so offensichtlich auf den Boden gefallen war. War es möglich, dass das Buch lebte?
»Warum?«, fragte Seila.
Kiathira zuckte mit der Schulter. Dann lächelte sie, als sie an ihre gestrige Begegnung mit dem Buch dachte. »Jene, die noch nie ein Buch gesehen haben oder nicht einmal wissen, was es ist, sollen die Chance bekommen zu erfahren, wie wunderbar es sich anfühlt. Und jene, die es kennen, sollen sich an die früheren Zeiten erinnern, als Bücher noch ein Bestandteil ihres Lebens waren.«
Seila unterdrückte nur schwer ein lautes Seufzen. Endlich passierte etwas Besonderes und Aufregendes in ihrem armseligen Dasein. »Das hört sich gut an, Kiathira. Ich helfe dir, auch wenn es sinnlos und gefährlich ist.«
Das Wort »gefährlich« hallte in Kiathiras Kopf wider. Seila hatte recht. Es war lebensgefährlich. Doch sie wollte nicht zu Pandru zurückkehren und ihm sagen, dass ihr der Mut fehlte, den Auserwählten zu suchen. Er hatte es schließlich auch getan und sie wollte so mutig sein wie er.
»Bitte sei vorsichtig«, flüsterte sie Seila zu. »Dieses Buch darf auf keinen Fall den Requeben in die Hände fallen. Es ist zu wichtig, zu wertvoll.«
»Du kannst dich auf mich verlassen, Kiathira.«
Und das konnte Kiathira wahrhaftig. Viele Kinder und auch einige Frauen kamen. Als wäre nichts, knieten sie sich neben sie. »Darf ich es sehen?« oder »Kann ich es anfassen?« flüsterten sie schüchtern, als würden sie sich schämen. Die Menschen hatten Angst, dennoch konnte niemand dem Drang widerstehen. Die meisten gingen mit einem breiten Lächeln davon, manche aber stimmte es unendlich traurig. Das Buch war ein Schatz aus der Vergangenheit, aus der heilen Welt. Mit tiefen Seufzern streichelten sie zärtlich das Papier, während Tränen in ihre Augen traten. Manche konnten sich kaum davon lösen. Diese Menschen musste Kiathira verscheuchen, damit die Requeben keinen Verdacht schöpften. Einige wollten das Buch sogar ausleihen, und niemand fragte, warum die Seiten keine Texte enthielten. Vor lauter Erregung fiel es ihnen gar nicht auf. Die wenigsten der Erwachsenen auf diesen Feldern und keines der Kinder konnten lesen, und für viele war es gar das erste Mal, dass sie ein Buch erblickten. So kam es ihnen nicht seltsam vor, dass das Papier leer war. Die häufigste Frage war, woher sie es hatte. Darauf antwortete Kiathira, dass sie es aus der Erde gegraben hätte.
So machte Kiathira drei Tage lang weiter, ohne erwischt zu werden, aber auch ohne Erfolg. Mit jedem Menschen, der wieder von ihr ging, wuchs ihre Verzweiflung. Und die Angst, ertappt zu werden, machte sie schier wahnsinnig. Etwa vierzig Frauen und Kinder hatten das Buch bisher berührt. Sie wusste, dass sich diese Neuigkeit wie ein Lauffeuer verbreitete, und deswegen befürchtete sie, dass die Requeben es früher oder später bemerken würden. Es waren im Ganzen etwa vierhundertfünfzig Menschen, die sie testen musste. Es war einfach zu riskant.
Am dritten Tag geschah es dann. Es war Mandra, die ihre Mission vor dem Scheitern bewahrte. Sie kam auf Kiathira zu und blieb vor ihr stehen.
»Ich habe gehört, dass du im Besitz von etwas ganz Besonderem bist.« Mandra war eine alte Frau mit schlohweißem Haar. Die qualvolle Schufterei hatte ihren Körper während all der Jahre verkrüppelt und ausgelaugt. Sie war eine von den wenigen, die noch in Elexandale gelebt hatten. Ihre klaren Augen strahlten Weisheit und Mut aus.
»Ja, knie dich neben mich, und ich werde es dir zeigen«, flüsterte Kiathira.
So tat sie es, und Kiathira strich nur so viel Erde von den Seiten weg, wie es nötig war. Mandras Augen weiteten sich, als sie die schwungvollen, anmutigen Buchstaben des Gedichtes erblickten. »Meine Güte, das ist Erebus«, hauchte sie.
Mandra war die Erste, die das Buch kannte. Diesmal war es an Kiathira, erstaunt zu sein. »Du kennst dieses Buch?«
»Es ist das leere Buch Aros’«, sagte sie erregt.
»Weißt du auch etwas über den Inhalt?«
»Nein. Ich weiß nur, dass Erebus und Aros eins sind. Sie sind die Einzigen, die die Macht haben, uns zu befreien. Aber ich glaube, Aros ist längst tot.« Traurig schlug sie die Augen nieder.
»Nein, er ist nicht tot«, entgegnete Kiathira.
In dem Moment ertönte eine rostig-kratzende und schwer verständliche Stimme hinter ihnen. »Was habt ihr da?«
Kiathira und Mandra drehten sich erschrocken um. Zwei Requeben standen breitbeinig und mit verschränkten Armen vor ihnen und blickten verachtend auf sie herab. Der Gestank von Hass und Bosheit hüllte die beiden ein. Die Haut dieser Kreaturen war wie aus Stein, hart, schrumpelig und krustig. Manche hatten grüne, andere graue Haut. Die Augen waren tief in den Höhlen verborgen und wurden von schlaffen Falten fast gänzlich verdeckt, sodass man sie nur noch als Schlitze erkannte. Dafür hatten die Monstren ein umso größeres lippenloses Maul. Die spitzen, dicht aneinandergereihten Zähne wuchsen in einem schrägen Winkel aus dem Maul, sodass die Requeben es kaum schließen konnten. Sie pfiffen laut beim Atmen, denn wo eigentlich eine Nase hätte sein sollen, befanden sich zwei große Löcher, aus denen Rotz quoll. Auf ihren Schädeln wuchsen nur ein paar Fetzen spröder Haare. Die Requeben gingen barfuß und trugen klobige Plattenröcke aus Eisen. Sie waren mit Speeren, Äxten, Schwertern, Hellebarden, Lanzen, Peitschen oder Morgensternen bewaffnet. Diese beiden hielten Hellebarden in ihren grobschlächtigen Händen.
»Nichts, mein Herr«, antwortete Mandra mit zitternder Stimme.
»Lüg nicht, du nichtsnutziger Abschaum«, brüllte der eine. »Ich habe gesehen, dass ihr etwas versteckt. Zeigt es mir sofort oder ich töte euch! Und wenn es etwas Verbotenes ist, töte ich euch auch.«
»Wir verstecken wirklich nichts vor euch, Herr«, versuchte Kiathira, die Bestie zu besänftigen. »Wir haben hier nur eine riesige Kartoffel, die wir nicht aus der Erde ziehen können.« Sie wusste, dass sie sich mehr als unglaubwürdig anhörte. Doch sie musste irgendetwas tun, auch wenn es zu spät war. Plötzlich sprang Mandra kreischend einen Requeb an. Sie krallte sich an seinem Hals fest und drückte ihm mit dem Daumen ein Auge aus. Er brüllte vor Überraschung und Wut auf und packte Mandra selbst am Hals, um sie von sich wegzuzerren. Der Requeb hielt sie in die Höhe und schloss seine Hand. Die alte Frau würgte und hustete und spuckte, die zappelnden Beine in der Luft baumelnd.
»Du wagst es, einen von uns anzugreifen?«, schrie der Requeb und spuckte ihr dabei ins Gesicht. »Du wirst mit einem qualvollen Tod bestraft.«
»Nein, nein!«, schrie Kiathira unter Tränen.
»Halt dein Maul, Göre, und arbeite weiter! Oder willst du mitkommen?«, schrie der andere sie an.
Kiathira beugte sich demütig zu Boden, aber nur, um das Buch unauffällig zu vergraben. Doch die Requeben schauten nicht mehr hin, um zu überprüfen, ob sie auch wirklich Kartoffeln ausgrub. Sie wusste, dass sie nichts für Mandra tun konnte. Noch nie hatte ein Requeb Gnade oder Mitleid gezeigt. Die Menschen waren in ihren Augen nicht einmal Kreaturen, sie waren nur Arbeitstiere und ein köstliches Mahl. Sie durfte nichts mehr riskieren, um des Buches willen. Kiathira war bereit, es mit ihrem Leben zu beschützen, doch nun war es Mandra, die dafür sterben musste. Hilflos schaute sie mit an, wie die Requeben Mandra an ihren Haaren über den Boden zerrten. Sie kreischte wie verrückt und strampelte mit den Beinen, wobei sie Spuren in die Erde zeichnete. Kiathira wurde übel bei dem Gedanken, welche Folter Mandra bevorstand. Eine Folter, die eigentlich ihr gelten sollte.
Gefoltert wurden die Menschen in der Mine, die nicht weit außerhalb des Lagers war. Die Gänge und Höhlen waren riesig, endlos, staubig und dunkel. Jener Berg war einst von den Menschen Den Amwoja genannt worden, was bedeutete: Wo die Welt beginnt. Den Amwoja war ein Teil einer kleinen Bergkette – Elhan hatte man diese benannt –, die sich von Osten nach Westen durch die Ebene von Skelta dehnte. Früher war Den Amwoja von den Menschen verehrt worden, weil er so majestätisch schön war, doch heute hassten ihn alle. Er stand nicht mehr als Symbol des Beginns, sondern als Symbol des Endes – dem Ende der Menschen. In seinen Tiefen lagen Unmengen von Schätzen verborgen. Niemals hatte es ein Mensch gewagt, diese Schätze zu berühren, denn sie standen ihnen nicht zu. Die Völker von Elexandale hatten sich ohnehin nie viel aus materiellen Dingen gemacht, weil es nicht für ihr Überleben notwendig war. Doch Tochor und seine Requeben gierten nach dem Reichtum, der in diesem Berg verborgen lag. In der Mine gab es eine riesige Höhle – die Folterhöhle –, wo die Requeben die verschiedensten Folterwerkzeuge aufbewahrten. Die Menschen wurden gestreckt, bis alle Muskeln rissen und Knochen brachen. Danach wurden die Gepeinigten an eine Wand gehängt, wo sie verhungerten und verdursteten, während sich die anderen Sklaven weiter abplagten. Manchmal wurden die Opfer mit dem Kopf nach unten aufgehängt, bis sie starben. Manchen Menschen hackten die Requeben auch Körperteile ab und ließen sie langsam verbluten, während sie ununterbrochen auf die Wunde einschlugen. Andere warfen sie in flüssiges Metall, das zum Waffenschmieden verwendet wurde. Und nicht selten wurde ein Mensch zu Tode gepeitscht. Die Schreie der Opfer hallten durch den ganzen Berg, und manchmal hörte man sie bis auf die Felder hinaus.
Tochor hatte die Menschen sechzig Lager errichten lassen, in denen er die letzten Überlebenden des Krieges versklavte. Weder in diesem noch in irgendeinem anderen Lager hatte es je einen Aufstand gegeben. Die Menschen waren zu schwach und verängstigt, um sich zu wehren. Sie wussten nicht, wie man kämpft, und sie besaßen keine Waffen. Die Requeben waren zu zahlreich, zu schwer bewaffnet und stark. Zudem gab es niemanden, der die Menschen anführte, niemanden, der ihnen Hoffnung und Mut zusprach. Die Menschen hatten sich schon lange mit ihrem Schicksal abgefunden: auf ewig verdammt, Sklaven zu sein.
In der dritten Nacht ihrer Suche schlich Kiathira wieder zu Pandru. Sie wusste, dass es jetzt besonders gefährlich war. Die Requeben würden sie wegen des Vorfalles auf den Feldern aufmerksamer beobachten. Aber Kiathira war klein und flink. Jeden Winkel, jede Hausecke und jeden Baumstrunk konnte sie als Versteck nutzen und mit der Finsternis zur Unsichtbarkeit verschmelzen. Völlig lautlos bewegte sie sich zwischen den schäbigen Hütten hindurch und schaffte es ohne Probleme zu Pandru. Dieser war wie immer sehr erfreut über ihren Besuch, obwohl er ständig predigte, wie riskant es war. Dennoch brannte er darauf, Kiathiras Bericht zu hören. Er kam aber nicht dazu, seine Enkelin zu fragen, denn sie brach sogleich in Tränen aus. Als er fragte, was passiert sei, erzählte Kiathira ihm von dem Vorfall mit Mandra und dass sie bis jetzt erfolglos geblieben war.
»Mandra hat das Buch sofort erkannt«, schluchzte Kiathira. »Sie wusste, wie wichtig es ist und hat sich ohne zu zögern dafür geopfert.«
»Kann es sein, dass sie die Auserwählte gewesen ist?«, fragte Pandru geistesabwesend. »Sie hat erstaunlichen Mut und Kampfgeist gezeigt. Diese Tugenden sind heute bei den Menschen nicht mehr vorhanden.« Er blickte wieder auf. »Kiathira, es tut mir so leid wegen Mandra. Wieder haben wir einen Menschen verloren, der aus der alten Welt stammt.« Er nahm ihre Hand und küsste sie. »Ich weiß, dass das alles schrecklich für dich ist, aber du musst weitersuchen!«
»Nein, ich kann das nicht mehr tun.« Sie zog ihre Hand zurück. »Du hast mir gesagt, dass dieses Buch uns befreien soll, doch bis jetzt hat es nur Opfer gefordert. Wie kann dieser hoffnungsvolle Zauberer ein solches Buch erschaffen?«
»Du darfst nicht Aros die Schuld dafür geben. Er ist ebenso ein Gefangener von Tochor wie wir, und er trägt das größte Leid von allen. Er muss all die Schmerzen, die jeder Einzelne von uns erfährt, auf einmal ertragen. Er kann sich nicht rühren, er kann nicht klar denken, und er weiß wahrscheinlich nicht einmal mehr, wer er ist und welche Bestimmung er hat. Sein Herz schlägt und er atmet, aber sonst ist Aros so gut wie tot.«
Kiathira schämte sich und wandte den Blick von Pandru ab. Sie sah ein, dass er recht hatte. »Großvater, ich würde gerne weitermachen, aber nicht mehr wie bisher. Es ist zu gefährlich.«
»Du hast dich schon so oft mitten in der Nacht zu mir geschlichen, ohne dass sie dich erwischt haben. Versuche, zu den Hütten der anderen zu gelangen. Das könnte weniger gefährlich sein. So kannst du dich und das Buch besser verstecken. «
Und so ging Kiathira in der darauffolgenden Nacht vor. Bereits während des Tages auf den Feldern hatte sie den Frauen und deren Kindern erzählt, dass sie ihnen etwas zeigen wollte und in der Dunkelheit zu ihnen kommen würde. Kiathira schaffte etwa drei Hütten pro Nacht, danach war sie zu erschöpft, um weiterzumachen. Die Arbeit auf den Feldern zerrte an ihren Gliedern, die ewigen Fragen der Menschen über das Buch strengten sie an, und die Treue Hand schien nicht zu existieren. Aber sie sah schon einen kleinen Erfolg darin, nicht erwischt zu werden und niemanden mehr in Gefahr zu bringen.
Viele Nächte schlich sich Kiathira zu den Häusern, und als sie die Hoffnung endgültig verloren hatte, besuchte sie Pandru wieder.
»Großvater, ich habe alles versucht. Jeden Jungen, jedes Mädchen und jede Frau, egal wie alt, habe ich das Buch berühren lassen. Doch nichts ist geschehen. Weder erschien ein Gedicht, noch fing es an zu leuchten oder Funken zu sprühen. Entweder irrst du dich, oder die Treue Hand befindet sich nicht in diesem Lager.«
»Sie muss hier sein, sonst hätte Aros Nael nicht hierher geschickt.«
»Und was ist, wenn Aros sich geirrt hat?« Kiathira schrie beinahe. Sie war die Suche leid und ertrug Pandrus Gerede nicht mehr. All ihre Mühe war umsonst gewesen.
Pandru sagte nichts, und sie saßen für lange Zeit schweigend nebeneinander. Er konnte nicht begreifen, dass die Treue Hand nicht aufzufinden war. Der Zauberer irrte sich nie. Er hatte das Buch kurz vor seiner Gefangenschaft hierher geschickt, als er noch bei klarem Verstand war. Und Nael, der Bote, konnte sich nicht verflogen haben, denn Aros konnte den Vogel mit seinen Gedanken leiten. Nael war sehr schlau und vertrauenswürdig. Der Fehler muss bei mir liegen, dachte Pandru. Wahrscheinlich hatte er den Text falsch gedeutet oder die verborgenen Gedichte mussten anders hervorgerufen werden.
»Ich gehe wieder nach Hause«, sagte Kiathira müde und stand auf. »Behalte das Buch und mach damit, was du für richtig hältst. Ich will nichts mehr damit zu tun haben.«
Noch bevor sie die Türe öffnen konnte, rief Pandru plötzlich: »Warte!«
Kiathira hielt inne und drehte sich um. Sein Gesicht hatte sich erhellt und Hoffnung ließ seine silbernen Augen funkeln. »Hast du selbst die Seite jemals berührt?«
Sie überlegte und fing plötzlich zu lachen an. »Ich glaube nicht, dass ich die Treue Hand bin. Ich wäre die Letzte, die mutig und stark ist.«
»Dass du die Suche nach der Treuen Hand gewagt hast, beweist, wie mutig und stark du bist. Es spielt keine Rolle, was du denkst. Komm hierher und lege deine Hand auf die leere Seite!«
Kiathira kniete sich widerwillig neben Pandru. Sie hatte Angst und befürchtete, dass sie genau das war, wonach sie so lange gesucht hatte. Sollte ausgerechnet sie durch Elexandale irren und Aros befreien? Zögernd streckte sie die rechte Hand aus, die vor Anspannung zitterte. Ganz vorsichtig legte sie sie auf die erste leere Seite und streichelte das seidenzarte Papier mit dem Zeigefinger. Ein Zucken raste durch ihren Körper, und für einen kurzen Moment fühlte sie sich frei, glücklich, zufrieden, stolz, mutig und stark zugleich. Gefühle, die ihr kaum bekannt waren, und so war es für Kiathira, als würde ein Sturm in ihr toben, um alle negativen Gedanken und Erinnerungen wegzufegen. Ihre Lider schlossen sich wie von selbst, und sie erblickte dahinter eine wunderschöne Landschaft. Dieses Bild kannte sie. Es war jenes, das auf dem Umschlag des Buches ins Leder geprägt war. Nun konnte sie die saftige Wiese riechen, das weiche Sprudeln des Flusses hören und den kühlen Wind, der nach Schnee roch, auf ihrer Haut fühlen. Der Berg ragte steil vor ihr auf, mächtig und königlich. Er war wunderschön und bedrohlich zugleich. Eine Stimme rief ihren Namen. Sie war tief und verführerisch und sie schien vom Berg zu kommen.
»Kiathira, wach auf!« Pandru schüttelte sie behutsam. Sie schlug die Augen auf und sah ihren Großvater verdutzt an. Im ersten Moment wusste sie nicht, wo sie sich befand, noch wer sie war und was sie hier tat. Doch als ihr Blick auf die Hand auf dem Papier fiel, kamen ihre Erinnerungen schlagartig und fast schmerzend zurück. Als wäre das Papier glühend heiße Kohle, zog sie die Hand hastig zurück.
»Was war mit dir los?«, fragte Pandru besorgt. »Du warst wie in Trance.«
»Ich weiß es nicht. Ich habe … etwas gesehen … und gehört, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war.«
Wie gebannt starrten sie auf das Buch, doch die Seite war immer noch so leer und blendend weiß wie zuvor. Sie warteten noch eine Weile voller Ungeduld, und in dem Moment, als Kiathira sagen wollte, dass sie nicht die Richtige war, veränderte sich die Farbe des Papiers. Es war, als würde es zum Leben erwachen. Schwarze, verschwommene Schleier bewegten sich schlangenartig auf und ab. Langsam verfestigten sie sich zu schwungvollen Buchstaben. Kiathira stockte der Atem. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie Zeuge von Magie.
»Siehst du«, rief Pandru aufgeregt, »wie ich dir gesagt habe, erscheinen die Gedichte nur, wenn man das vorangehende Rätsel gelöst hat. Dadurch bleibt der Inhalt vor dem Bösen geschützt. Und du bist die Treue Hand. Ich hätte es von Anfang an wissen müssen.«
Neugierig und fasziniert beobachteten die beiden, wie Erebus sein nächstes Geheimnis offenbarte. Kiathira las das neue Gedicht vor:
Seit vielen Jahren an diesen Stein gebundenDoch nun fühle ich, man hat dich gefundenSei mutig, stark und treuUnd zeige vor dem Ungewissen keine ScheuElexandale, die verfluchte Welt, musst du durchquerenUnd dem Bösen niemals den Rücken kehrenFolge nun stets des Buches WortenUnd finde schnell die rostige Pforte
Kiathira starrte ihren Großvater an, als wäre dies seine verrückte Idee. »Aber ich kann doch nicht einfach hinausspazieren und mich in diese Welt stürzen. Was wird mich da draußen erwarten? Ich werde mich verirren und vor Hunger umkommen. «
»Du bist die Auserwählte, die schützende Hand Aros’ wird dich begleiten, und Erebus wird dir den Weg weisen. Das Buch ist nur für dich geschrieben worden, es ist für dich bestimmt, Kiathira. Bitte, du musst es versuchen!«
»Ich bin doch viel zu jung und unerfahren, Pandru.«
»Du bist jetzt achtzehn, und als Sklave wirst du nicht viel älter werden. Aber wenn du gehst, dann hast du vielleicht eine Chance.«
»Ja«, antwortete sie mit ferner Stimme. »Du hast wohl recht. Ehrlich gesagt freue ich mich sogar auf die Welt hinter den Mauern.« Sie sprang plötzlich auf und hüpfte im Zimmer herum. Ihre langen Haare wirbelten umher, sie jubelte und lachte.
»Kiathira! Setz dich hin und sei still«, sagte Pandru streng und mit gedämpfter Stimme. »Man wird dich hören.«
Abrupt verstummte sie und setzte sich artig wieder hin, beschämt über ihre Dummheit.
Pandru tippte mit seinem knochigen Zeigefinger auf den letzten Satz und las ihn laut: »Finde schnell die rostige Pforte. Aros hat für dich irgendwo einen Ausgang angebracht. Wahrscheinlich ist er unsichtbar, sonst hätten die Requeben ihn längst gefunden. Ich werde selbst auch in der folgenden Nacht nach draußen gehen und diese Pforte suchen. Du bewahrst so lange das Buch. Und packe das Nötigste für deine Reise zusammen.«
»Aber wo genau hält denn Tochor Aros gefangen?«
»Irgendwo in den Bergen von An-Raneb.«
»An-Raneb?«
»Das ist ein riesiges Gebirge, weit südlich von hier. Es bildet das Zentrum von Elexandale, von dem alles Übel ausgeht. In An-Raneb hat Tochor seine Festung Tra Atreb errichtet.«
Kiathiras Magen drehte sich um. Würde sie etwa ihrem Peiniger gegenübertreten müssen, um den Zauberer zu befreien?
»Ich habe Angst«, sagte sie leise.
Pandru nahm ihre Hand und streichelte mit der anderen ihr Gesicht. »Ich weiß«, flüsterte er. »Ich auch.«
DIE FLUCHT UND DER NEBEL
Kiathira und Pandru trafen sich wie verabredet drei Nächte später hinter seiner Hütte. Kiathira trug eine alte, braune Ledertasche bei sich, in der sie ihre wenigen Habseligkeiten eingepackt hatte: ihren Kochtopf, eine Wolldecke, drei Hemden und zwei zerlöcherte Hosen sowie eine Feldflasche mit Wasser – Überreste aus der alten Welt, die Pandru wie das Buch unter dem Fußboden aufbewahrt hatte. Das kostbarste Geschenk jedoch war das große Tuch aus Baumwolle. Durch einen Schlitz in der Mitte hatte sich Kiathira das Kleidungsstück über den Kopf gestreift, sodass es wie ein Mantel auf den Schultern ruhte. Als Proviant hatte sie so viel eingepackt, wie sie in den vergangenen Tagen von den Ernten hatte stehlen können. Dies waren jede Menge Kartoffeln und Kohl, ein Lederbeutel gefüllt mit Kleeblättern und Löwenzahn sowie ein halbes Dutzend Gurken und Karotten. Der Tontopf war mit vorgekochtem Haferbrei gefüllt und sorgsam verschlossen. Es schien eine beachtliche Menge an Nahrung zu sein, doch wie weit würde es sie bringen in einer vergifteten Welt?
Als sich Kiathira flach an die Mauer presste, um in deren Schatten zu verschwinden und auf Pandru zu warten, überfielen sie Zweifel. Konnten diese schlotternden Knie ihr überhaupt zur Flucht verhelfen? Würde es überhaupt so weit kommen? Die Requeben waren zahlreich und wachsam in dieser Nacht, als spürten sie, dass etwas im Gange war. Überall lauerten sie, grunzten und verpesteten die Luft mit Schwefel und Fäulnis. Kiathira versuchte, den Gestank zu ignorieren, indem sie in den Himmel hinauf blickte. Der Vollmond würde ihr Vorhaben zusätzlich erschweren. Aber Pandru eilte es, die Flucht musste heute Nacht geschehen.
Endlich öffnete sich die Tür, und ihr Großvater schlüpfte durch einen schmalen Spalt ins Freie. Auf dem Arm trug er einen dicken Pelzmantel. Er war dreckig, denn Pandru hatte auch dieses edle Gut für viele Jahre unter der Erde versteckt. Geschwind verstaute er das Kleidungsstück in ihrer Tasche, die nun überquoll mit Dingen.
»Was ist das?«, fragte sie im Flüsterton.
»Mein Mantel aus Tierfellen. Den wirst du gebrauchen, falls du Anarien durchqueren musst.«
»Anarien?«
«Ein Gebirge westlich von hier. Ich habe fast mein ganzes Leben dort verbracht, und glaube mir, dass du keine Ahnung hast, was Kälte wirklich bedeutet!«
Auf Zehenspitzen schlichen die beiden entlang der Mauer, in jene Richtung, wo morgens die Sonne aufging. Der Wall war ungefähr fünfzehn Meter hoch. Dicht aneinandergereihte Sperren ragten oben aus dem Stein. An vielen klebte trockenes Blut, denn unzählige Menschen hatten in panischer Angst versucht zu fliehen – meistens jene, denen die Todesfolter bevorstand. Männer hatten heimlich Hämmer aus den Minen mitgenommen und während vielen Nächten Löcher in die Mauer geschlagen, um sie später als Stufen zu benutzen. Einmal hatte es jemand mit einem Seil versucht. Bis zu den Sperren hinauf hatte der Knabe es geschafft, wo er sich brüstete und kreischte vor Freude und Triumph. Über das ganze Lager hinweg hatte man ihn gehört. Doch in dem Moment, als er sich in die Freiheit abseilen wollte, durchbohrte ihn der Pfeil. Er lebte noch, als er auf der anderen Seite herunterstürzte, und all die Menschen, die zusahen, hofften, dass er es dennoch schaffen würde. Aber irgendetwas war hinter dieser Mauer gewesen, das ihn letztendlich getötet hatte. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen auf dem großen Platz verbrannt und von den Requeben verspeist. Die Menschen mussten dabei zusehen, damit ihnen der Wunsch nach Flucht verging.
Die größte Gefahr würde vorüber sein, wenn sie die Felder erreicht hatten. Dort lauerten in der Nacht nur selten Requeben. Kiathira schaute zur Mauer hinauf. Wie sollte sie hier rauskommen? Plötzlich wurde der Gestank der Requeben stärker. Sie mussten sich ganz in der Nähe befinden. Pandru roch sie auch.
»Sie sind direkt vor uns«, flüsterte er.
Schnell versteckten sie sich hinter einer Hütte, die an die Felder grenzte. Und schon im nächsten Moment tauchten zwei Requeben auf. Sie kamen von den Feldern. Ruckartig blieb einer von ihnen an der Stelle stehen, wo sich kurz zuvor Pandru und Kiathira aufgehalten hatten. »Hast du das auch gehört?«
»Ja, und ich rieche es«, grunzte sein Kumpan. Beide reckten ihre Nasen, die keine waren, in die Luft und schnupperten laut wie Schweine.
»Es sind zwei«, raunzte der linke. »Ein Greis und ein Mädchen.«
Kiathira und Pandru hielten den Atem an und pressten sich noch flacher an die Hauswand. Kiathiras Herz zog sich krampfhaft zusammen. Hier war also ihre heldenhafte Reise bereits zu Ende. Nicht einmal die Pforte, die ihr zur Flucht verhelfen sollte, hatte sie erreicht.
»Lauf«, flüsterte ihr Pandru zu.
»Pandru, nein! Ich gehe nicht ohne dich.«
Die Schritte der Requeben kamen näher.
»Lauf! Oder es ist zu spät«, sagte er und sprang aus dem Schatten der Hütte direkt vor die Kreaturen. Im selben Augenblick schlich sich Kiathira leise weg. Als sie außer Hörweite war, fing sie an zu rennen wie noch nie zuvor in ihrem Leben.
Die Requeben waren nicht überrascht, den Greis zu sehen. Es war viel mehr sein Mut, der sie verblüffte. Er stand vor ihnen, stemmte seine Arme in die Seiten und pustete sich selbstgefällig auf. »Hat euch eigentlich schon mal jemand gesagt, wie stinkend und hässlich ihr seid?«, rief er und lachte höhnisch. Es tat gut, sich endlich diesen Missgeburten entgegenzustellen. Doch das Gefühl würde nicht lange anhalten, das wusste Pandru. Er würde dafür mit seinem Leben bezahlen.
Die Kreaturen sahen sich verdattert an. Dann stampfte der Rechte auf ihn zu und packte ihn am Hals. »Du wagst es, so etwas zu sagen?« Er spuckte vor Wut, und sein Mundgeruch schlug Pandru wie ein Hammer ins Gesicht.
»Ja, das tue ich, weil dein Gebieter Tochor ein Narr ist«, ächzte er mit dem letzten Quäntchen Luft in den Lungen.
Der Requeb schlug ihm ins Gesicht. Schwärze umhüllte Pandru, in der farbige Sterne tanzten. Der Requeb packte noch fester zu. Seine Hand konnte einen Menschenhals so leicht zerbrechen wie ein Streichholz. »Wir foltern dich zu Tode«, grunzte er freudig.
»Nein, noch nicht!« Der andere hielt ihn zurück. »Erst wenn wir das Mädchen gefunden haben.«
Sie hatten Kiathira für einen Augenblick vergessen und Pandru sein Ziel erreicht: Sie hatte einen kleinen Vorsprung. Der Requeb schlug Pandru mit solcher Wucht ins Gesicht, dass er das Bewusstsein verlor. Er band ihn an einen vermoderten Baumstrunk, und die beiden liefen los, um Alarm zu schlagen. In kürzester Zeit hatten sich die Requeben zu Dutzenden versammelt und nahmen Kiathiras Fährte auf.
Kiathira lief an der Nordwand entlang, wie Pandru es ihr gesagt hatte. In der zweiten Nacht hatte er die Pforte gefunden und ihr genau erklärt, wo sie war. Bis zum Ende dieser Mauer musste sie gehen, dort rechts abbiegen und der Ostwand folgen. Genau zwanzig Schritte weit. Die östliche Mauer war von Efeu und Moos überwuchert. Es war der einzige Ort in dem Lager, wo Pflanzen wild wuchsen. Pandru meinte, dass dies das Werk Aros’ sein musste, um die Pforte zu verbergen.
Kiathira hörte in nicht weiter Ferne die Requeben brüllen. Es waren viele, und alle suchten nach ihr. Sie wünschte sich, ihre Beine könnten so schnell laufen, wie ihr Herz pochte. Die Mauer schien kein Ende zu nehmen. Ihre Gedanken galten nur Pandru. Jeder Mut fiel von ihr ab, und Angst und Trauer machten ihre Beine zentnerschwer. Als sie die Ecke erreichte, fiel sie in einen Laufschritt. Das Abzählen der Schritte gönnte ihr eine Verschnaufpause. Elf. Das Gebrüll der Requeben kam beängstigend schnell näher. Vierzehn. Massige Umrisse tauchten in der fernen Dunkelheit auf. Siebzehn. Waffen klimperten und klirrten an den metallenen Rüstungen. Achtzehn.
»Dort ist sie!«, hörte sie den verräterischen Schrei. Zwanzig. Kiathira blieb stehen und wandte sich der Mauer zu. Keuchend riss sie den Efeu herunter, und tatsächlich kam die Pforte zum Vorschein. Doch sie bot keinen Ausgang, denn sie war aus Stein und eins mit der Mauer. Leicht standen die Konturen der Gitterstäbe hervor, an manchen Stellen waren sie gar nicht auszumachen. Am oberen Ende vollführte das Gebilde einen Bogen. Kiathira öffnete mit zitternden Händen das Buch. Erebus wusste, dass die Eile groß war und schrieb:
Nicht nur das Böse strebt danachWoran auch der Mensch zerbrach
Sie begriff, dass es sich um ein Zauberwort handeln musste, welches das Tor öffnete. Kiathira konnte bereits den Gestank der Requeben riechen, und so versuchte sie, ihre Gedanken des Rätsels Lösung zu widmen. Angestrengt überlegte sie. Es war kein schweres Rätsel. Als das Böse kam ihr nur Tochor in den Sinn, und dieser strebte vor allem, wie auch einst die Menschen, nach …
»Macht«, sprach sie laut und deutlich.
Ein dumpfes Rumoren ertönte im Inneren der Mauer, zuerst ganz leise, dann immer lauter werdend. Voller Ehrfurcht wich Kiathira zurück. Langsam traten die Konturen der Gitterstäbe aus dem Stein heraus, und gleichzeitig verwandelten sie sich in durchgerostetes Eisen. Der dumpfe Klang ging in ein Quietschen über, und der Stein, der die Pforte eingefasst hatte, zerfiel zu Staub. Kurz darauf stand die Pforte frei und in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit da. Die Requeben waren nur noch wenige Meter entfernt.
Hastig riss sie das Tor auf, das ächzte und quietschte, und schlüpfte hindurch. In dem Moment setzte ein Requeb zum Sprung an. Das Tor schloss sich von selbst. Der Requeb griff durch das Gitter und bekam ein Büschel ihrer Haare zu fassen. Mit einem Ruck zerrte er sie zurück, und Kiathira prallte mit dem Kopf gegen das Eisen. Sie schrie auf und warf ihren Kopf nach vorne, um sich loszureißen. Dem Requeben blieb nur das Büschel Haare, und er warf es wütend weg. Die anderen prallten gegen das widerspenstige Tor und reckten fluchend die Fäuste durch das Gitter. Kiathira wagte nicht zurückzublicken und lief auf das weite Feld hinaus, wo die Dunkelheit sie verschluckte.
Erst als die Luft wie Glut in ihren Lungen brannte, blieb sie stehen und drehte sich um. Das Mondlicht war hell genug, damit sie die Mauern des Lagers erkennen konnte. Die rostige Pforte hatte sich wieder in Stein verwandelt, damit kein Requeb sie durchbrechen konnte. Aros war wahrhaftig ein großer Zauberer. Trotzdem musste sie sich beeilen, denn die Requeben würden den Ausgang an der Nordseite benutzen. Wieder fing sie an zu spurten. Vor ihr erstreckten sich Wiesen mit kniehohem Gras, die vom Vollmond in ein mattes Licht getaucht wurden. In dieser Ebene würden die Requeben sie leicht finden. Zudem hatte sie nicht die geringste Ahnung, welche Richtung sie einschlagen musste. Doch das spielte im Moment keine Rolle. Das Wichtigste war, ein Versteck zu finden. Aber wo? Dies schien eine endlos weite Prärie zu sein, die keine Deckung bot. Sie musste weiterrennen.
Die Luft, die sie gierig ein und aus atmete, war frisch und leicht. Zum ersten Mal roch Kiathira Luft, die nicht vom Gestank der Requeben verpestet war. Noch hatte sie Kraft zu laufen, und einmal wagte sie einen kurzen Blick über die Schulter. Die Requeben hatten das Lager mittlerweile verlassen und nahmen die Verfolgung wieder auf. Sie waren unglaublich schnell. Das Poltern ihrer Schritte hallte bis zu ihr. Kiathira befahl ihren Beinen, noch schneller zu rennen. Dennoch holten die Requeben auf, während sie selbst immer langsamer wurde. Ihre Füße wurden schwer wie Blei, die Beine zitterten vor Anstrengung, und der Hals schmerzte vom keuchenden Ein- und Ausatmen. Was sollte sie bloß tun? Das Einfachste war, stehenzubleiben und aufzugeben. Man würde ihr mit Sicherheit einen sehr qualvollen Tod bereiten. Aber ihr Sklavenleben würde beendet sein, und sie würde nicht diese Bürde, die ihr bevorstand, auf sich nehmen müssen. Warum sollte ausgerechnet sie Aros und die Menschheit befreien? Warum hat der Zauberer mich auserwählt, wenn ich schon nach zwei Kilometern schlappmache?, fragte sie sich verbittert.
Kiathira blieb stehen und drehte sich erneut um. Aus der Ferne erkannte sie, wie groß das Lager war – und wie schrecklich. Mauern, die sich kilometerweit erstreckten, um die Hütten und Felder zu umschließen, und Speere darauf, die wie Zähne eines Ungeheuers aus dem Stein ragten. In dem faden Mondlicht wirkte das Gebilde gespenstisch und alptraumhaft.
Nein, jetzt wo sie es endlich auf die andere Seite der Mauer geschafft hatte, wollte sie auf keinen Fall wieder dorthin zurück. Sie war wahrscheinlich der erste Mensch, dem es gelungen war, aus einem Lager zu entkommen. Aros’ Treue Hand durfte nicht so schnell aufgeben. Treue und Dankbarkeit für ihre Befreiung wollte Kiathira dem Zauberer nun erweisen.
»Aros, bitte gib mir Kraft«, flüsterte sie und sprintete weiter. Mit jedem Schritt, den sie nahm, schwand ihre körperliche Kraft. Das Lager hinter ihr wurde kleiner und die Verfolger größer.
Plötzlich trübte sich die Luft und wurde feucht. Nebel kam auf und verdichtete sich zusehends, bis sie kaum mehr ihre Hand vor Augen erkennen konnte. Kiathira blieb stehen. Keuchend sog sie die Luft ein, die irgendwie nicht durch ihre Luftröhre zu passen schien. Es war, als würde dieser Nebel der Luft den Sauerstoff entziehen. Nichts war zu hören, weder das Brüllen und Fauchen der Requeben, noch der Wind oder sonst ein Geräusch, das von Leben gezeugt hätte. Panik flammte in ihr auf. Sie wusste nicht, aus welcher Richtung sie gekommen war. Die Nebelbank raubte ihr jeden Orientierungssinn. Aus Angst, den Requeben direkt in die Arme zu laufen, traute sich Kiathira nicht mehr von der Stelle. Stattdessen sank sie erschöpft zu Boden. Tief durchatmend wartete sie, bis ihr Herz wieder in einem ruhigeren Rhythmus schlug.