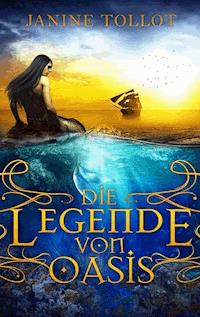Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jenny ist eine Außenseiterin und wird von ihrer geistig kranken Mutter vernachlässigt. Durch einen Verkehrsunfall verliert sie ihre einzige Freundin. Sie verlässt ihr Heimatland – die Schweiz –, um in dem verschlafenen Nest Little Silence in Kanada ein solitäres Leben zu führen. Hier schreibt sie Romane und arbeitet in einem Lebensmittelgeschäft, wobei die immer gegenwärtige innere Stimme oft ihre einzige Gesellschaft ist. Doch die Vergangenheit holt sie ein, und nach der Begegnung mit dem geheimnisvollen Jerry Lee, der wie ein Protagonist aus einem ihrer Romane aussieht, geschehen seltsame Dinge um sie herum. Am meisten macht ihr jedoch die unerwiderte Liebe zu Jerry Lee zu schaffen. In all dem Chaos schließt sie Freundschaft mit Victoria, einem Mädchen, das in ihrer Nähe wohnt. Durch sie erinnert sich Jenny plötzlich wieder daran, dass sie Zeugin eines Mordes wurde, den sie verdrängt hatte. Jetzt will sie den Fall aufklären. Oder ist sie selbst die Mörderin? Jennys Universum ist ein Roman voller mystischer Begegnungen, seltsamer Ereignisse und mit einem überraschenden Ende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAS BUCH
Jenny ist eine Außenseiterin und wird von ihrer geistig kranken Mutter vernachlässigt. Durch einen Verkehrsunfall verliert sie ihre einzige Freundin. Sie verlässt ihr Heimatland – die Schweiz –, um in dem verschlafenen Nest Little Silence in Kanada ein solitäres Leben zu führen. Hier schreibt sie Romane und arbeitet in einem Lebensmittelgeschäft, wobei die immergegenwärtige innere Stimme oft ihre einzige Gesellschaft ist. Doch die Vergangenheit holt sie ein, und nach der Begegnung mit dem geheimnisvollen Jerry Lee, der wie ein Protagonist aus einem ihrer Romane aussieht, geschehen seltsame Dinge um sie herum. Am meisten macht ihr jedoch die unerwiderte Liebe zu Jerry Lee zu schaffen.
In all dem Chaos schließt sie Freundschaft mit Victoria, einem Mädchen, das in ihrer Nähe wohnt. Durch sie erinnert sich Jenny plötzlich wieder daran, dass sie Zeugin eines Mordes wurde, den sie verdrängt hatte. Jetzt will sie den Fall aufklären. Oder ist sie selbst die Mörderin?
Jennys Universum ist ein Roman voller mystischer Begegnungen, seltsamer Ereignisse und mit einem überraschenden Ende.
DIE AUTORIN
Die Schweizerin Janine Tollot wanderte im Jahr 2009 nach Kanada aus, wo sie heute lebt, arbeitet und schreibt.
Jennys Universum erschien in der 1. Auflage bereits 2007. Im Jahr 2015 werden drei weitere Fantasy-Romane das Licht der Welt erblicken, darunter das epochale zweiteilige Fantasy-Werk Die Chroniken von Elexandale.
Besuchen Sie die Autorin unter www.janinetollot.com
© Autorenfoto: Sharilyn Clowes
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Kapitel Achtundzwanzig
Kapitel Neunundzwanzig
Kapitel Dreißig
Epilog
PROLOG
Es klingelte.
Jenny raste die Treppe hinunter und sprang mit einem Satz die letzten Stufen hinab bis vor die Haustüre und riss sie ungestüm auf. Das Keuchen blieb ihr im Hals stecken, als sie in dieses zerschlagene Gesicht blickte.
»Hat er dir wieder wehgetan?«
Ihre Freundin Sarah nickte. Jenny trat über die Schwelle und schloss die Tür hinter sich. Das Mädchen schaute beschämt zu Boden und versuchte, das geschwollene rechte Auge hinter einer Haarsträhne zu verbergen. Aber die von blauen und purpurnen Flecken verwüstete Wange war nicht zu übersehen. Getrocknetes Blut klebte an Nase und Oberlippe.
»Warum, Sarah?« Jenny trat ganz nahe an sie heran, weil Sarah nur wisperte, wenn sie über ihren Vater redete.
»Ich habe geflucht«, antwortete sie kaum hörbar. »Ich habe den Namen des Gottvaters in den Schmutz gezogen.«
»Aber deswegen darf er dich nicht schlagen«, empörte sich Jenny.
»Schscht!«, zischte Sarah und presste den Zeigefinger auf den Mund. Nervös blickte sie um sich. Kein Mensch ging durch die Reinhardtstraße an diesem schwülen Sommertag. Die Bilderbuchfamilien in dem vornehmen Wohnquartier saßen wohl alle drinnen in der Kühle und schlürften Eisbecher. Die Gärten und die Straße wirkten wie eine Einöde, sterbend in der klebrigen Hitze.
»Es kann uns niemand hören«, stöhnte Jenny, genervt von Sarahs Beklemmung. Aber konnte man ihr böse sein? Es war der Vater, der das Kind so machte.
Sarah zwang sich, Jenny mit dem heilen Auge anzusehen. Es schimmerte eine Träne darin.
»Es geschieht mir ganz recht. Vater sagt, ich bin als Sünderin auf die Welt gekommen und als Sünderin werde ich sterben, egal, wie sehr ich mich anstrenge.« Ein Schluchzen ließ den mageren Körper erbeben.
Jenny schlang die Arme um ihre Freundin und drückte sie an sich.
»Das ist alles Quatsch, das weißt du. Ich bin deine Freundin, okay? Ich hab dich lieb!«
Sarah ließ Jenny los und putzte sich Rotz und Tränen mit dem T-Shirt ab. »Danke Jenny«, sagte sie leise.
»Wollen wir Ball spielen? Das wird dich ablenken.« Jenny lächelte Sarah aufmunternd an. Es war schwer, Sarah zu etwas Spaß zu bewegen. Doch ihr linkisches Augenzwinkern und das Grinsen halfen ihrer Freundin immer, die Schreckhaftigkeit zu überwinden. Sarah fürchtete sich for fast allem: vor den Kindern in der Schule, vor den Schatten der Bäumen und sogar vor Spielsachen ... doch am meisten fürchtete sie ihren Vater. Sie wurde wegen ihrer Furchtsamkeit gehänselt, was ihre Angst den Kindern gegenüber noch mehr nährte.
Auch über Jenny machten sich die Kinder in der Schule lustig. Sie war pummelig und in ihrem Gesicht sprossen Pickeln, obwohl sie erst neun Jahre alt war. Wie eine zweite Haut spannten sich die Geschwüre über die linke Gesichtshälfte. Der Arzt nannte es Akne, und es gab kein Medikament, das Jenny nicht schon ausprobiert hatte.
Biest und Bammelmäuschen wurden die beiden in der der Schule gerufen. Aber das war ihnen mittlerweile egal, denn sie hatten sich gefunden in dem Sturm aus Spott und Gemeinheiten, mehr brauchten sie nicht.
»Stört es denn deine Mutter nicht, wenn du nicht im Haus bist oder wenn wir zu laut sind?«
Jenny winkte ab. »Nein, meine Mutter interessiert sich nicht viel für mich. Die hat sich wieder im Zimmer eingeschlossen.«
»Warum?«
»Mutter sagt, sie ist gerne allein, und dann weint sie sehr lange, aber sie weiß nicht, warum.«
Sarah dachte darüber nach und ihr Blick verriet, dass sie es nicht verstand. Welches Kind verstand schon die seltsamen Sachen, die Erwachsene taten?
»Okay«, antwortete sie dann, kaum hörbar. »Ich versuche es.«
Die Mädchen sprangen hinaus in den Garten und Jenny schnappte sich den knallroten Ball, der im Sandkasten lag.
»Du sollst es nicht versuchen, du sollst einfach spielen«, rief sie. Um Sarah herauszufordern, warf sie ihr den Ball kräftig zu. Verzweifelt starrte das Mädchen das bedrohende Flugobjekt an, nicht wissend, wie sie damit fertig werden sollte. Da war es bereits zu spät: Der Ball prallte hart auf Sarahs Nase und sie taumelte rückwärts.
»Hoppla! Passiert nicht noch mal«, lachte Jenny. »Komm schon, wirf so kräftig, wie du kannst.«
Also kratzte Sarah zum zweiten Mal ihr bisschen Mut zusammen. Mit zitternden Händen hob sie den Ball auf und hielt ihn, als wäre er aus Glas. Doch genau wie Sarahs Wesen, war auch ihr Wurf: zaghaft und schwach. Jenny musste nach vorne springen, um den Ball zu erwischen. Dann positionierte sie sich mit leicht gespreizten Beinen und blickte auf den Ball, den sie in ihren Händen jonglierte. Sie holte mit der Wurfhand weit aus und schleuderte ihn mit voller Wucht.
Im hohen Bogen flog der Ball durch die Luft, und das verlieh Sarah endlich Wagemut. Den roten Punkt nicht aus den Augen lassend, sprang sie ihm hinterher.
Jenny war stolz auf ihren Wurf. So weit hatte sie es noch nie geschafft. Sarah musste bis auf die Straße springen.
Glas blitzte im Sonnenlicht auf und dann verschwand die Welt um Jenny.
Eins
Liebevoll streichle ich Gamby über den Nasenrücken. »Bist du bereit?«
Das Pferd wippt mit dem Kopf auf und ab und schnaubt laut. Ohne eine weitere Aufforderung schwinge ich mich auf seinen Rücken. Nur ein leises Zungenschnalzen und der schwarze Riese setzt sich in Bewegung. Der Tag könnte nicht herrlicher sein. Nicht das feinste Wölkchen trübt den Himmel und mein sensibles Gemüt. Die Morgensonne ist noch weich, aber die Hitze schleicht bereits über das Land.
Eine nach Sommergras riechende Briese kühlt mein Gesicht. Ach, wie sehr ich diesen täglichen Ritt zur Arbeit liebe. Hier fühle ich mich wie im Garten Eden. Dieses Stück Welt ist so ganz anders als meine Heimat. Im Asphaltdschungel von Zürich bin ich aufgewachsen, der mir wie ein Gefängnis vorgekommen ist. Doch hier umgibt mich nur die wunderbare Mutter Natur.
Immer weiter entfernen wir uns, in einem leichten Trab, von unserem Zuhause. Immer weiter trägt Gamby mich in das weite ebene Tal hinaus, das zu unserer Linken von hohen, in ein dünnes Kleid aus Gras gehüllten Bergen und zur Rechten von einem dichten Wald flankiert wird. Ich reite auf den Horizont zu, wo schneebedeckte Gipfel in der Hitze glitzern. Es ist mir egal, wohin mich mein Pferd führt, denn im Moment fühle ich nichts als Freiheit. Als will er es bestätigen, fällt Gamby in einen stürmischen Galopp und es kommt mir vor, als ob er über die Erde hinwegfliegt. Ich streichle über seinen Hals, an dem vor Anstrengung die Adern hervortreten. Der Wind rauscht und berauscht mich, Gambys wirbelnde Mähne kitzelt mein Gesicht und ich schreie vor Freude. Es dauert lange, bis die Energie mein Pferd verlässt und es in einen gemütlichen Schritt übergeht. Gamby weiß genau, wohin wir gehen.
Etwa eine Stunde Ritt ist es bis zum nächstgelegenen Dorf. Man nennt es Little Silence und es macht seinem Namen alle Ehre. Rund zweihundert Einwohner leben hier, es gibt einen bescheidenen Lebensmittelladen, einen Friseur, eine Tankstelle und eine vor Rauch dampfende Bar. Nur eine asphaltierte Straße führt durch das von der Welt vergessene Kaff im Herzen von British Columbia, alle anderen Wege bestehen aus Schotter.
Die Silhouette von Little Silence taucht nun zur Linken auf. Ich weiß nicht, warum, aber dieses Bild beschwört jedes Mal Unbehagen in mir herauf. Ich fühle mich nicht besonders wohl unter Menschen und manchmal erscheint mir sogar Little Silence eng und überbevölkert. Und die Leute saugen mich schier aus mit ihren Röntgenblicken. Wenn ich mit Gamby durch die Straße reite und auf Lextons Lebensmittelgeschäft zuhalte, in dem ich arbeite, kommt es mir vor, als hätte das Dorf auf mich gewartet. Als würden alle nur den Atem anhalten und sich von ihren alltäglichen Beschäftigungen abwenden, um mich zu beäugen. Die meisten Leute gaffen mich an, als wäre ich eine Außerirdische, aber manche kennen mich auch, oder besser, sie kennen mein Pseudonym – Jenny Hill. Doch ich zweifle nicht daran, dass keiner von diesen verkorksten Farmern auch nur den Titel eines meiner Bücher kennt, geschweige denn den Inhalt. Es ist bloß Neugierde, weil ich anders bin und vielleicht für ein klein wenig Abwechslung sorge. Denn wer ist so verrückt und führt heute noch ein Einsiedlerleben? Ich bewohne die alte Hütte am Rande der Welt seit knapp einem Jahr, doch irgendwann werde auch ich zu ihrem Alltag gehören.
Heute ist es nicht anders. Gambys Hufeisen klappern auf der Straße und erzeugen ein klirrendes Echo. Es ist mittlerweile heiß geworden und die Menschen von Little Silence haben sich auf ihre schattigen Veranden zurückgezogen, um im Schaukelstuhl zu wippen und Limo oder Bier zu schlürfen. Und natürlich, um mich ungeniert zu beobachten. Ich spüre die Blicke der Späher regelrecht auf meinem Rücken wie eine eklig kitzelnde Spinne. Bestimmt schütteln sie gerade die Köpfe, weil ich noch wie zu Wild-West-Zeiten mit einem Pferd und Packtaschen unterwegs bin. Nicht, dass es eine Straße zu meiner Hütte gegeben hätte. Das ist mir nur recht, denn ich hasse Autos, fürchte mich vor ihnen, ohne zu wissen, warum. Deshalb habe ich vor Jahren auf einer Farm in Lilooet als Hilfskraft gearbeitet und reiten gelernt. Als ich das nötige Kleingeld zusammengespart und etwas geerbt hatte, kaufte ich mein Traumhäuschen, wo ich in aller Ruhe meine Geschichten schreibe.
Drei Since Fiction Romane habe ich bereits veröffentlicht. Die ersten beiden liefen nicht besonders, aber die Verkaufszahlen von Sonnenwinde, der vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde, sind vielversprechend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis mir der endgültige Durchbruch gelingt. Und dann werde ich nie mehr langweilige Jobs wie den in Lextons Lebensmittelgeschäft verrichten müssen.
Ich steige vom Pferd und führe es hinter den Laden, wo Lexton ein Stück Weide im Schatten eingezäunt hat. Dankbar schüttelt Gamby den Kopf, als ich ihm Sattel und Zaum abnehme.
»Du hast es gut.« Ich streichle ihn am Hals und er beginnt, das Gras zu zupfen. »Ich wünschte, ich könnte den Tag auch draußen in der Sonne verbringen!« Zum Glück ist heute Freitag. Samstag und Sonntag gehören der Freiheit. Mit einem befriedigten Seufzer trete ich in die Kühle des Ladens. Dabei fällt mein Blick kurz auf mein mageres Spiegelbild in der Glastüre, das mich jedes Mal erschreckt.
Du hast nicht immer so ausgesehen, sagt eine Stimme, meine alte Freundin, in mir.
»Hey Jen«, grüßt mich Lexton erfreut.
»Hey Lex.«
Ohne ein weiteres Wort beginne ich, die Produkte in die Regale einzuräumen, zähle, rechne und notiere, was bestellt werden muss. Hin und wieder bediene ich die Kasse, wenn Lexton im Hinterhof seine stündliche Zigarette raucht. Sehnsüchtig streift mein Blick immer wieder zur Tür, wo ein Sonnenstrahl in die Düsternis des Ladens fällt, als wolle er mich rufen, ich solle doch nach draußen kommen. Ich versuche mich auf die Arbeit zu konzentrieren, damit die Zeit schneller vergeht. Die Leute, die in den Laden kommen, grüße ich freundlich, ansonsten gehe ich ihnen möglichst aus dem Weg. Ihre Gesichter kenne ich alle, aber nicht einen Namen.
Die Zeit schleicht dahin, quält mich, aber der Feierabend kommt immer. Bevor ich nach Hause gehe, muss ich selbst noch einige Besorgungen machen.
So, was brauchen wir heute?, fragt mich die innere Stimme, die meine treue Begleiterin ist, seit ich denken kann.
Ich schlendere durch den Gang aus Regalen und ziehe, ohne wählerisch zu sein, Essbares heraus. Vollkornbrot, Nudeln, Reis, Schokolade, Müsli - einfach alles, was nicht in meinem Garten wächst. Eine Packung Chips, die berühmten kanadischen Cookies, eine Flasche Ahornsirup und …
»So in Gedanken versunken, Miss?«
Erschreckt blicke ich hoch, direkt in ein von Runzeln und Falten geprägtes Gesicht, das mich verschmitzt anlächelt. Der Mann überragt mich um fast zwei Köpfe und trotz seiner hageren Riesenhaftigkeit wirkt er vertrauenswürdig.
»Oh, Verzeihung«, sage ich verlegen.
»Mein Name ist Samuel Tucker. Aber für Sie bin ich lieber Sam.« Er greift meine Hand und schüttelt sie energisch. Ich fasse es nicht. Der Alte hat mir seinen Namen genannt.
»Ich bin …«
»Jenny Hill, ich weiß, ich weiß.« Er lässt meine Hand los und begleitet mich auf meinem Spaziergang durch den Laden.
»Naja, eigentlich Jenny Lauper«, entgegne ich. »Aber meinen Familiennamen benutze ich schon lange nicht mehr«, füge ich leise hinzu, eher zu mir selbst sprechend. Warum empfinde ich diesem Namen gegenüber Abscheu? Sam scheint meine plötzliche Verwirrung nicht bemerkt zu haben.
»Wie lebt es sich da draußen?«
Es war vom ersten Tag an das Zuhause, das ich mein Leben lang gesucht habe.«
»Freut mich zu hören, freut mich wirklich!« Schräg, dieser alte Kauz, aber sehr liebenswert.
»Hast du morgen Abend etwas vor?«
Was? Will der dich etwa zu einem Date einladen?, japst meine innere Stimme.
»Wir feiern ein Fest«, erzählt Sam aufgeregt.
»Das ganze Dorf wird dort sein und du bist auch herzlich willkommen.«
»Natürlich, ich komme sehr gern!«
Bist du dir sicher?
»Wunderbar! Um acht Uhr also. Hat mich gefreut, Jenny Hill.« Er verbeugt sich wie ein Gentleman und ist für einen alten Herrn erstaunlich schnell aus dem Laden verschwunden. Lange stehe ich noch da, die Arme mit Einkäufen überladen, und starre zur Tür. Zum ersten Mal, seit ich hier wohne, habe ich mit jemandem Bekanntschaft geschlossen, abgesehen von Lexton. Bereitet mir das Angst oder Freude?
Die Packtaschen, die Gamby trägt, sind vollgestopft und festgeschnallt. Sam geht mir nicht aus dem Kopf.
Egal! Ab nach Hause an den Schreibtisch!, fordert mich die Stimme auf.
Gamby spürt meinen Drang und schreitet die Asphaltstraße hinab, die wie abgeschnitten mitten in der Prärie aufhört. Bald höre ich die Hufeisen meines Pferdes nicht mehr und widme meine Aufmerksamkeit der mich umgebenden Schönheit. Am früheren Abend – die Zeit ist mir egal geworden, seit ich hier lebe – bin ich wieder daheim. Das Häuschen aus Holz liegt verlassen am Waldrand, genau deshalb ist es mir so sympathisch. Die Veranda ist dem Westen zugewandt, wo ich oft stundenlang sitze und schreibe, und wenn abends die Sonne untergeht, tippen die Finger noch immer auf die Tasten, während mein Blick auf die feurige Kugel gerichtet ist. Der Stuhl, auf dem ich draußen zu sitzen pflege, ist unbequem und der kleine Tisch wackelt, weil er auf drei schiefen Beinen steht. Der Luxus gebührt Gamby. Seine von einem morschen Holzzaun umrahmte Weide ist fast eine Meile lang und eine halbe breit. Dort, wo die Ecke des Zaunes an den Gemüsegarten grenzt, wächst ein schattenspendender Hain.
Ich sattle mein Pferd ab und bringe die Ausrüstung in dem Schopf unter, der an die Hütte angebaut ist, dann betrete ich mein bescheidenes Zuhause durch die Verandatür.
Vertrautes Heim, Glück allein!
»Du sagst es«, antworte ich der Stimme laut.
Es gibt nur einen großen Raum in der Hütte. In der Mitte steht mein altes, karminrotes Sofa, das ich schon als Kind hatte. Von manchen Dingen konnte ich mich nicht trennen, so auch davon nicht. Wenn ich darauf sitze, schaue ich aus einem Fenster, das fast so groß ist wie eine Kinoleinwand, mit Blick auf Gamby und den Sonnenuntergang. An der gegenüberliegenden Wand der Verandatür in der linken Ecke steht das Bett.
Ich durchquere den Raum und verstaue die Nahrungsmittel im Wandschrank. Es gibt kein warmes Wasser hier und Licht spenden mir Petroleumlampen und haufenweise Kerzen. Meine Geschäfte erledige ich irgendwo draußen und waschen tue ich mich in dem großen Holzbrunnen am Tor von Gambys Weide. Im Winter muss ich das Wasser auf dem Gasherd wärmen, falls es im Brunnen nicht gefriert. Aber noch ist es brütend heißer Sommer und was mich in wenigen Monaten hier draußen erwartet, soll mich noch nicht kümmern. Was mich jetzt noch interessiert, sind der Bleistift und die zahllosen leeren Blätter. Ich setze mich hinaus auf die Veranda und beginne zu schreiben. Alles, was meine Ohren noch wahrnehmen, sind das zufriedene Schnauben von Gamby und das Tastenklappern der alten Schreibmaschine. Und alles, was meine Augen noch sehen, sind die Wörter und Sätze, die unaufhaltsam auf dem weißen Blatt entstehen.
Zwei
Nur mit großer Überwindung habe ich mich von meiner Arbeit trennen können, die mich die ganze Nacht und den darauffolgenden Tag beschäftigt. Gamby und ich sind wieder auf dem Weg nach Little Silence und die letzten geschriebenen Sätze hallen noch in meinem Kopf. Gemütlich streift Gamby durch das kniehohe sommergrüne Gras. Die Sonne ist bereits hinter dem Horizont verschwunden und das flammende Licht, das sie zurücklässt, durchleuchtet ein leichtes Gespinst aus Federwolken. Die einsetzende Frische ist eine Erlösung und ich verliere mich in Gedanken. Erst, als Gamby vor Lextons Laden stehen bleibt, merke ich, wo ich bin. Nicht einmal das Hufgeklapper habe ich wahrgenommen.
»Ich kann mich glücklich schätzen, ein so schlaues Pferd wie dich zu haben«, sage ich zu meinem vierbeinigen Freund, tätschle seinen Hals, steige ab und bringe ihn auf die Weide. »Wünsch mir Glück!« Ich küsse seine Oberlippe. »Ich werde nicht länger als zwei Stunden weg bleiben.« Er blickt mir hinterher, wie ich dem Gelächter von Menschen folge, das nicht von weitem erklingt. Es führt mich die Straße hinab, weiter ins Dorf hinein. Es sind vielleicht fünfundzwanzig Häuser und Gebäude, die an die Hauptstraße – die Eternity Road - grenzen. Ich biege nach links ab, schlendere zwischen eng aneinander gebauten Häuschen hindurch, wie sie für die Kanadier typisch sind. Warum drängen diese Menschen ihre Häuser so dicht beisammen, wenn sie doch so viel Platz haben?
Die Schotterstraße führt mich auf eine große Wiese, wo die Menschenmasse von Little Silence versammelt ist, alle in Gespräche vertieft und in Gelächter verfangen. Holztische und Bänke sind aufgestellt worden, brennende Holzstrünke spenden Licht in der aufziehenden Nacht. Unmengen Köstlichkeiten sind aufgetischt worden, an denen sich die Leute nach Herzenslust bedienen. Schreiende und lachende Kinder springen zwischen den stehenden Erwachsenen umher, die bemüht sind, das Abendessen nicht fallen zulassen. Irgendwo höre ich jemand auf einer Gitarre spielen.
Halte dich lieber etwas abseits!
Die Dorfbewohner haben mich noch nicht bemerkt. So beginne ich, die Menschen mit wachen Augen zu beobachten, mir sämtliche Einzelheiten zu merken, ihre Gesten zu studieren und ihre Kleider in Gedanken zu beschreiben – das ist eigentlich der Grund, warum ich hierher gekommen bin.
»Hallo Jenny«, ruft eine bekannte Stimme.
»Hey Sam.«
»Schön, dass du da bist. Hast du schon von den Salaten probiert?«
»Nein, ich ...«
»Zuerst muss ich dir noch jemanden vorstellen.« Ehe ich mich versehe, werde ich auf die Menschenmasse zugezogen. Ich weiß nicht, was mir mehr Unruhe bereit, die bevorstehende Bekanntschaft oder mich in das Gewühl aus Gerede und Gelächter stürzen zu müssen. Die Leute treten zur Seite und mustern mich beim Vorbeilaufen aufmerksam, um sich sogleich wieder ihren Freunden zuzuwenden. Ich lächle ihnen verlegen zu und grüße jene leise, die mein Lachen erwidern. Obschon dieses Dorf wohl kleiner ist als irgendein Stamm in den Büschen Afrikas, kommt es mir vor, als nähme der Strom aus Menschen kein Ende, durch den mich Sam energisch zieht. Er steuert auf eine mächtige Trauerweide zu, die am Rande des Festplatzes steht. Die lang nach unten hängenden Äste verleihen ihr das Aussehen einer erstarrten Fontäne aus perlgrünen Blättern. Meine Umgebung lichtet sich allmählich, die Menschen stehen hier am Rande der Wiese nicht so dicht beieinander. Ein Schritt, und wir sind der Masse entkommen.
Was ich jetzt erblicke, lässt mich den Atem anhalten. Ein junger Typ steht alleine unter der Weide, die Hände vornehm hinter dem Rücken verschränkt. Regungslos wie eine Statue hält er sich aufrecht und blickt mich durchdringend an, so, als hätte er mich erwartet. Ich kenne dieses Gesicht! Ich kenne es ganz genau. Das ist doch Alexis!
Das Bild dieses Mannes verwahre ich seit fast zwei Jahren in meinen Gedanken und jetzt steht er leibhaftig vor mir. Er hat die genau gleiche Frisur wie die Figur aus meinem dritten Roman. Braunes Haar mit dunkelblonden Strähnen, das bis zum Nacken reicht und leicht nach hinten gekämmt ist. Sein schmaler Mund wirkt weiblich, die hohen Wangenknochen verletzlich. Das kindliche Gesicht ist dünn und wohlgeformt, die Haut hell und rein. Aber das Bemerkenswerteste sind seine Augen. Ihre Farben sind ein ruheloses Gemisch aus Grün, Blau und Grau. Die Lider eng, verleihen ihm einen unbewusst verführerischen Blick. Meine vermeintliche Traumgestalt ist einfach gekleidet: eine verblichene Jeans und ein dunkelblaues Karohemd, das er offen trägt, darunter ein weißes Hemd.
»Das ist mein Enkel Jerry Lee«, sagt Sam und will mich näher an mein Fantasiegeschöpf heranziehen. Aber ich stehe genauso an den Boden gefesselt da wie Jerry Lee. Sam lässt meine Hand los und schaut verwirrt zwischen mir und seinem Enkel hin und her.
»Kennt ihr euch etwa schon?«
Ja!, schreit meine innere Stimme.
»Nein«, lüge ich und zwinge mich aus meiner Erstarrung. Und sobald ich einen Schritt auf Jerry Lee getan habe, fällt mir diese Bewegung nicht mehr schwer, so als würde mich dieser Mensch wie ein Magnet anziehen.
»Es freut mich, dich endlich kennenzulernen«, sagt Jerry Lee. Seine tiefe Stimme birgt eine kaum hörbare Rauigkeit in sich, was sie erotisch klinken lässt. Ich strecke meine leicht zitternde Hand aus.
Fass ihn nicht an, sonst könnte sich der Traum in Luft auflösen! Schwach ergreife ich seine Hand.
»Ja … Hallo!« Mehr zu sagen bin ich nicht fähig und ich komme mir selten dumm vor. Seine stechenden Augen durchbohren mich schier. Wie kann so etwas möglich sein? Jerry Lee ist das exakte Abbild von Alexis.
Das ist ein Traum. Wach auf!
»Ich habe deine Bücher gelesen.« Er versucht, seine Aufregung zu verbergen, aber ich spüre sie deutlich. Sie ist längst nicht so schlimm wie die meine. Er weiß also über Alexis Bescheid. Ob ihm wohl die eigene Ähnlichkeit mit dem Romanheld aufgefallen ist? Ich beruhige mich mit dem Gedanken, dass jeder Leser die Figuren anders sieht, egal, wie detailliert sie beschrieben sind.
»Ach wirklich?«, erwidere ich, was mehr wie ein Hauchen als ein Sprechen klingt.
»Jerry ist der Sohn von Jeff McAuffrey, meinem Schwiegersohn. Du kennst doch die McAuffrey Farm?«
Ich nicke auf Sams Frage, ohne den Blick von Jerry Lee zu wenden. »Ja, aus der Ferne.«
»Es ist die größte Farm in der Umgebung. Jeff besitzt zweihundert Hektar Getreideland, rund fünfzig Rinder und zwanzig Pferde, ein Dutzend Angestellte und …«
»Bitte, hör auf damit!« Jerry Lee blickt seinen Großvater ermahnend, aber nachsichtig an, und dieser klappt seinen Mund zu.
»Ich bin für die Pferde meines Vaters verantwortlich«, wendet er sich wieder mir zu.
Ich bin immer noch sprachlos.
Nach einer verlegenen Pause fragt er: »Hättest du Lust, morgen mit mir auszureiten? Ich bin mir sicher, ich kann dir viele Orte zeigen, die du noch nicht entdeckt hast.«
Beobachtet er dich etwa seit einiger Zeit?
»Sehr gerne«, flüstere ich.
»Dann hole ich dich um sieben Uhr ab, solange es noch nicht zu heiß ist … und dir nicht zu früh.«
»Einverstanden.«
»Na dann«, sagt Sam zufrieden, »stürzen wir uns aufs Bankett!« Ohne sich umzuschauen, ob wir seinem Befehl Folge leisten, verschwindet er durch die Lücke zwischen den Menschen. Jerry Lee aber fixiert mich weiterhin mit seinen magischen Augen.
Er versucht, in dein Innerstes zu dringen!
Er schweigt, ich schweige. Nach ein paar Sekunden wird es mir peinlich, aber er lächelt mich nur an.
»Würdest du mich bitte kurz entschuldigen?«, frage ich mit erstickter Stimme.
Irgendetwas Undefinierbares steckt in meinem Hals fest, ich spüre, wie ich schwach werde.
»Natürlich«, sagt Jerry Lee und nickt kaum merklich mit dem Kopf. Auch er blickt mir hinterher, wie es viele immerzu tun. Ich bemühe mich, Anmut wirken zu lassen, aber die Welt schwankt unter meinen weichen Beinen und mir ist speiübel. Ich verlasse die Festwiese und torkle in die im Dämmerlicht brennende Prärie hinaus. Die Stille und die Einsamkeit hier draußen beruhigen mich. Meine Schritte werden zügiger, als hätte ich ein klares Ziel vor Augen. Aber ich habe keines, ich will nur weg. Erst, als ich ein paar dürre Büsche erreiche, erkenne ich ein Ziel. Ich muss ganz dringend! Ich schaue mich kurz um. Weit genug weg vom Getümmel. Gut. Schnell hinter dem Gebüsch verschwinden, Hose runter und die Erleichterung genießen.
Aber ich kann es nicht.
Der Klos in meinem Hals brennt, so dass es mir vorkommt, als würde ich durch den Mund pinkeln und mein Urin wäre kochend heißes Wasser. Tränen in den Augen lassen die Blätter vor meiner Nase doppelt und dreifach erscheinen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Bin ich etwa nicht glücklich, dass ich endlich dem Mann meiner Träume begegnet bin? Ich habe mich in meine Romanfigur Alexis verliebt, so, wie es sich für einen Schriftsteller gehört. Aber das Originalexemplar ist noch unglaublicher, zu schön, um wahr zu sein!
Vielleicht weine ich deswegen – weil ich Angst habe, er könnte nur ein Traum sein.
»Was machst du da?«
Ich schrecke hoch, kaum habe ich zu Ende gepinkelt, und wäre beinahe auf dem Boden kauernd und mit heruntergelassener Hose zur Seite gekippt. Hinter mir steht ein Mädchen und grinst frech auf mich herab.
»Pinkeln. Siehst du das nicht?« Hastig stehe ich auf und zerre die Hose über meine Hüften. Sie antwortet nicht und fixiert mich weiterhin. Diese Menschen hier können einem mit ihren schweigenden Blicken in den Wahnsinn treiben, denke ich. Sie hat voll gelockte, dunkelbraune Haare, die ihr Mondgesicht umrahmen. Das Mädchen ist klein gewachsen, ihre Gestalt dünn und zart. Das schelmische Lächeln zeigt eine Lücke, wo die beiden oberen vorderen Schneidezähne fehlen.
»Wie heißt du?«, fragt sie mich. Ich bin erstaunt. Zum ersten Mal, seit ich hier lebe, fragt mich jemand nach meinem Namen.
»Ich heiße Jenny Hill. Und du?«
»Victoria Orsen.«
Ich schaue sie noch eine Weile an, aber sie schweigt wieder. Also drehe ich mich um und gehe zurück zur Festwiese. Die ersten Sterne blitzen am bordeauxvioletten Himmel auf. Victoria folgt mir, ich höre ihre tippelnden Schritte im Gras.
»Wo wohnst du?«
Ich verlangsame meinen Gang, um neben ihr zu gehen. »Ich wohne draußen in der Prärie, etwa zwei Stunden mit dem Pferd von hier entfernt. Mein Haus grenzt direkt an einem Wald.«
»Oh, du wohnst in der alten Charity Hütte?«
»Ja, kennst du sie?«
»Natürlich! Wir sind Nachbarn.«
Ich bleibe wie vom Blitz getroffen stehen. Nachbarn? Ich dachte, ich wäre allein dort
draußen.«
Oh nein! Unsere Einsamkeit ist dahin.
»Nein, nein. Ich wohne mit meiner Mutter im Wald, nicht weit von der Charity Hütte entfernt. Wenn du willst, kann ich es dir zeigen.«
»Ja, tu das«, erwidere ich desinteressiert und setze mich wieder in Bewegung. Eigentlich leide ich unter klaustrophobischen Anfällen, aber dennoch stürze ich mich in das Meer aus Menschen, um die Kleine abzuhängen.
Was machst du hier eigentlich?
»Nach Jerry Lee Ausschau halten«, murmle ich vor mich hin. Er steht nicht mehr unter der Trauerweide und meine Worte gehen in dem Gelächter und Stimmengewirr unter. Dieses Mal machen die Leute mir keinen Platz. Geschmeidig wie eine Katze weiche ich Ellbogen und unachtsamen Füßen aus und schlüpfe zwischen den Lücken hindurch, ohne jemanden zu streifen. Aber egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich finde dieses Gesicht unter den vielen Fremden nicht, als hätte das mystische Wesen niemals existiert.
Es ist besser so, Jenny, versucht die innere Stimme meine Enttäuschung zu beschwichtigen. Lass uns nach Hause gehen!
Ohne eine weitere Aufforderung verlasse ich das Fest und flüchte mit Gamby in die Nacht. Tatsächlich geht es mir jetzt besser. De frische Luft der Nacht bläst die Verwirrtheit aus meinem Verstand.
Drei
Der nächste Morgen trotzt nicht weniger vor Schönheit wie die vorhergegangenen. Das Morgenlicht strömt durch das Zimmer und wärmt mein Gesicht. Ich setze mich auf die Bettkante und gähne laut. Staubkörner schweben in dem weißgelben Sonnenstrahl, der durch das Fenster fällt, und je länger ich diese Stimmung betrachte, desto mehr erscheint es mir, als wären sie glitzernde Sterne, die einen wilden Tanz vollführen. Ein Blick aus dem Panoramafenster und ich sehe Gamby zufrieden grasen.
Jerry Lee!, erinnert mich die innere Stimme.
»Nichts weiter als ein dummer Traum«, entgegne ich und stehe auf. Ich bereite ein Frühstück aus Äpfeln, Birnen und trockenem Müsli vor und schüttle dabei lachend den Kopf. Manchmal träume ich wirklich verrückte Sachen. Das muss ich gleich aufschreiben! Könnte eine Geschichte wert sein.
Mit einer nie gekannten Seelenruhe genieße ich das bescheidene Frühstück und dann mache ich mich auf, mein Pferd zu füttern. Ich öffne die Haustür auf der Ostseite, wo mir am Morgen die aufgehende Sonne ins Gesicht lacht und mich der Tag begrüßt. Aber heute schweift mein Blick nicht zu der brennenden Kugel über der leicht geschwungenen Hügelkette sondern zu einer anmutigen Gestalt, die einen breitrandigen, leicht eingedrückten Hut aus Leder trägt. Vor Schreck stolpere ich die drei Stufen hinunter, aber Jerry Lee ist bereits am Fuß der Treppe, um mich aufzufangen. Seine Nähe betört mich, genauso, wie sie mich zutiefst verwirrt. Grob stoße ich ihn von mir weg und er tritt zwei Schritte zurück, in dem Wissen, mir zu nahe getreten zu sein.
»Ist alles in Ordnung?«
Nein, gar nichts ist in Ordnung, jetzt, wo du wieder vor mir stehst!
»Ja, ja, ich bin okay.«
»Hast du unsere Verabredung vergessen?«, fragt er und streift die Zügel über den Hals seines Schimmels, dessen Weiß mich blendet.
»Ja … Nein … Ich dachte nur, du …«
Still! Sonst hält er dich für verrückt!
»Was dachtest du?«
»Ach, vergiss es«, lächle ich, um meine Verstörtheit zu verbergen, und gehe um das Haus. Laut pfeife ich durch die Zähne und ein Wiehern kommt als Antwort zurück. Gamby steht bereits am Tor, stolz auf mich herabblickend. Jerry Lee ist mir beim Putzen und Satteln behilflich, schweigend, und zu allem Übel stelle ich fest, dass sein ganzes Erscheinen mit einer vollendeten Grazie erfüllt ist. Seine Hände sind zart, und mit geschickten Fingern schnallt er den Sattelgurt fest, legt Gamby sorgfältige den Zaum an. Jeder Handgriff sitzt, jede Bewegung fließt.
Er arbeitet schließlich täglich mit Pferden, Jenny!
Trotzdem! Er ist …
»So, das hätten wir«, sagt Jerry Lee zufrieden, lächelt und bindet den Strick los. »Ihr edles Ross ist bereit, Eure Majestät.«
Kichernd steige ich auf, während er die Zügel festhält. Dann packt er das Horn seines Sattels und schwingt sich mit einem Satz auf den Schimmel, ohne den Steigbügel zu gebrauchen. Erstaunlich, wie gut Pferd und Reiter zusammenpassen, beide geschmeidig und gertenschlank. Mit kleinen Schritten tippelt der Schimmel durch das taufeuchte Gras und Gamby lässt sich von seiner Motivation mitreißen. Dass Jerry Lee wie ein Bilderbuch-Cowboy aussieht, lässt ihn noch unwirklicher erscheinen.