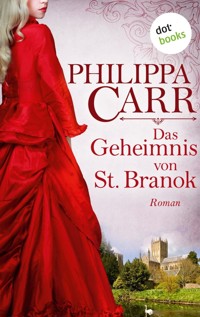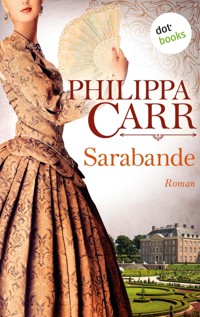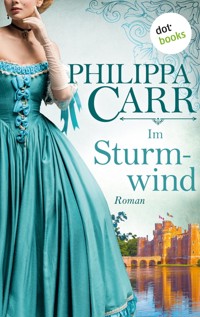Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Töchter Englands
- Sprache: Deutsch
Große Gefühle in Zeiten des Krieges: der historische Roman "Die Dame und der Dandy" von Philippa Carr jetzt als eBook bei dotbooks. Intrigen, Machtkämpfe und Leidenschaft im frühen 18. Jahrhundert … Ihr Vater war ein britischer Lord, der nach Frankreich fliehen musste, ihre Mutter eine kapriziöse Femme fatale – nun sind beide tot. Im letzten Moment wird die kleine Clarissa vor dem Schicksal gerettet, als Straßenmädchen zu enden, und nach England gebracht. Dort wächst sie im herrschaftlichen Enderby Hall zu einer schönen Frau heran. Aber kann sie die Schatten der Vergangenheit jemals abstreifen? Als Clarissa die Verwandten ihres Vaters in Schottland besucht, gerät sie unter Verdacht, eine Spionin zu sein. Nur der junge jakobitische Rebell Dickon Frenshaw glaubt an ihre Unschuld – und wird Clarissas erste große Liebe. Doch dann schlägt das Schicksal unerbittlich zu … Fesselnd und romantisch – ein Roman aus der Saga "Die Töchter Englands": Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen! Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Dame und der Dandy" von Philippa Carr, auch bekannt als Jean Plaidy und Victoria Holt. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Intrigen, Machtkämpfe und Leidenschaft im frühen 18. Jahrhundert … Ihr Vater war ein britischer Lord, der nach Frankreich fliehen musste, ihre Mutter eine kapriziöse Femme fatale – nun sind beide tot. Im letzten Moment wird die kleine Clarissa vor dem Schicksal gerettet, als Straßenmädchen zu enden, und nach England gebracht. Dort wächst sie im herrschaftlichen Enderby Hall zu einer schönen Frau heran. Aber kann sie die Schatten der Vergangenheit jemals abstreifen? Als Clarissa die Verwandten ihres Vaters in Schottland besucht, gerät sie unter Verdacht, eine Spionin zu sein. Nur der junge jakobitische Rebell Dickon Frenshaw glaubt an ihre Unschuld – und wird Clarissas erste große Liebe. Doch dann schlägt das Schicksal unerbittlich zu …
Fesselnd und romantisch – ein Roman aus der Saga »Die Töchter Englands«: Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen!
Über die Autorin:
Philippa Carr ist – wie auch Jean Plaidy und Victoria Holt – ein Pseudonym der britischen Autorin Eleanor Alice Burford (1906–1993). Schon in ihrer Jugend begann sie, sich für Geschichte zu begeistern: »Ich besuchte Hampton Court Palace mit seiner beeindruckenden Atmosphäre, ging durch dasselbe Tor wie Anne Boleyn und sah die Räume, durch die Katherine Howard gelaufen war. Das hat mich inspiriert, damit begann für mich alles.« 1941 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem in den nächsten 50 Jahren zahlreiche folgten, die sich schon zu ihren Lebzeiten über 90 Millionen Mal verkauften. 1989 wurde Eleanor Alice Burford mit dem »Golden Treasure Award« der Romance Writers of America ausgezeichnet.
Eine Übersicht über den Romanzyklus »Die Töchter Englands« finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
eBook-Neuausgabe April 2017
Copyright © der Originalausgabe 1981 by Philippa Carr
Die Originalausgabe erschien 1981 bei William Collins Sons & Co. Ltd., London, unter dem Titel »The Drop of the Dice«.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1982 Paul Neff Verlag, Wien
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Kieselev Andrey Valerevich und Viecheslav Lopatin
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-009-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Dame und der Dandy« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Philippa Carr
Die Dame und der Dandy
Roman
Aus dem Englischen von Hilde Linnert
dotbooks.
Kapitel 1 In der Familie geborgen
Es gehört zu den Widersprüchen des menschlichen Wesens, daß Dinge, die wir leidenschaftlich begehren, in dem Augenblick, in dem wir sie bekommen, ihre Anziehungskraft verlieren; eines Tages ist es dann soweit, daß wir nur noch einen Wunsch haben, nämlich sie wieder loszuwerden. So erging es auch mir. Als Kind hatte ich mich – offensichtlich infolge der Wechselfälle meines Lebens – verzweifelt nach Sicherheit gesehnt. Als ich im Jahre 1715 dreizehn Jahre alt war, sehnte ich mich danach, aus dem behaglichen Kokon zu entkommen, den meine Familie um mich gesponnen hatte, und als sich mir die Gelegenheit dazu bot, ergriff ich sie.
Ich muß ungefähr vier Jahre alt gewesen sein, als mich Tante Damaris und Onkel Jeremy nach England brachten. Diese ersten vier Jahre meines Lebens waren äußerst dramatisch verlaufen, obwohl mir das damals nicht bewußt war. Wahrscheinlich hielt ich es für selbstverständlich, daß ein Mädchen von seinem Vater entführt wird, mit seinen Eltern in einem anderen Land in größtem Luxus lebt, dann in die Armut der Pariser Seitenstraßen gestoßen wird, von wo es gerettet und wieder in eine englische Familie verpflanzt wird. Das alles ertrug ich mit dem philosophischen Gleichmut, den Kinder besitzen.
Eines der Ereignisse, die sich mir unauslöschlich eingeprägt haben, ist die Heimkehr nach England. Ich erinnere mich genau daran, wie ich von Bord ging und auf den Kiesstrand trat, und werde nie den glücklichen Ausdruck in Tante Damaris’ Augen vergessen. Ich liebte sie seit dem Tag innig, an dem ich sie kennengelernt hatte; sie war für mich der rettende Engel, den mir ein gütiger Himmel geschickt hatte. Verwirrt stand ich vor ihr. Ich wußte, daß ich keine Mutter hatte, denn sie war unter mysteriösen Umständen zugleich mit meinem Vater gestorben, und ich war sehr besorgt, denn anscheinend mußte jeder Mensch eine Mutter haben – und auch einen Vater. Deshalb hatte ich gefragt: »Tante Damaris, wirst du jetzt meine Mutter sein?«, und sie hatte geantwortet: »Ja, Clarissa.« Ich weiß noch, wie sehr mich diese Worte beruhigten.
Onkel Jeremy hatte Damaris die ganze Zeit über genau beobachtet, und da ich meinen gutaussehenden, unvergleichlichen Vater verloren hatte, war ich bereit, ihn als Ersatz zu akzeptieren. Ich fragte ihn also, ob er mein Vater sein wolle, und er erwiderte, das hinge von Damaris ab.
Erst heute weiß ich, was damals in den beiden vorgegangen ist. Sie waren zwei unglückliche, vom Leben enttäuschte Menschen, die sich vor neuen Enttäuschungen schützen wollten. Damaris war sanft, liebevoll und liebebedürftig, aber Jeremy war anders. Er war immer auf der Hut und mißtraute den Beweggründen der Menschen. Sein Wesen war düster, während Damaris von sonnigem Gemüt war.
Als Kind hatte ich das nicht begriffen. Mir war nur klar gewesen, daß ich Sicherheit suchte und daß diese beiden sie mir bieten konnten. So jung ich auch war, wußte ich dennoch in diesem Augenblick auf dem Strand, daß ich mich an sie klammern mußte. Damaris verstand meine Gefühle, denn trotz ihrer scheinbaren Ahnungslosigkeit war sie sehr weise – wesentlich weiser als zum Beispiel Carlotta, meine strahlende, genußsüchtige Mutter.
Die Tage in England waren für mich eine einzige freudige Offenbarung. Ich entdeckte, daß ich eine Familie besaß, die sich auf mich freute und bereit war, mich in ihrem magischen Kreis aufzunehmen. Ich gehörte zu ihnen, sie liebten mich – und infolge des tragischen Schicksals meiner Mutter war ich ein Trost für sie. In jenen Tagen hatte ich das Gefühl, auf einer Wolke von Liebe zu schweben, und ich genoß diesen Zustand. Gleichzeitig dachte ich immer wieder an den Augenblick, als Damaris den Kellerraum betreten hatte, in dem ich mit Jeannes Mutter und Großmutter wohnte. Ich erinnerte mich an die Feuchtigkeit und an den Geruch der welkenden Blätter, der immer im Raum lag und der daher kam, daß die unverkauften Blumen in Kannen mit Wasser aufbewahrt wurden, damit man sie vielleicht am nächsten Tag an den Mann bringen konnte. Ich hörte noch ihre Stimme, als sie fragte: »Wo ist das Kind?« Ich hatte mich in ihre Arme gestürzt, und sie hatte mich fest an sich gedrückt und leise gemurmelt: »Danke, lieber Gott, o danke.« Das hatte mich sehr beeindruckt, denn ich fand, daß sie mit Gott sehr gut stehen müsse, wenn sie so mit ihm sprechen konnte.
Sie hielt mich fest, als fürchtete sie, ich würde davonlaufen; das hatte ich aber keineswegs vor. Ich war froh, daß ich den Keller verlassen konnte; denn obwohl Jeanne gut zu mir war, hatte ich Angst vor Maman, die immer die wenigen Sous nahm, die Jeanne für ihre Blumen bekommen hatte, und sie, fieberhaft vor sich hin murmelnd, zählte. Ich hatte immer gewußt, daß sie mich nicht wollte und mich nur Jeannes wegen nicht auf die Straße setzte. Noch schrecklicher als Maman war Grand’mère, die immer muffige schwarze Kleider trug; sie hatte eine große Warze auf dem Kinn, aus der Haare wuchsen, und dieser Anblick faszinierte mich und stieß mich zugleich ab. Mir war sehr bald bewußt geworden, daß die beiden Frauen mich nicht mochten, und Jeanne mußte mich immer vor ihnen in Schutz nehmen. Manchmal durfte ich mitgehen, wenn sie Blumen verkaufte, aber ich weiß nicht, ob mir das lieber war, als zu Hause zu bleiben. Es war natürlich schön, dem Keller, Maman und Grand’mère für eine Weile zu entgehen, aber mir war immer so kalt, wenn ich neben Jeanne auf der Straße stand und den Vorübergehenden Veilchensträuße oder andere gerade in Blüte stehende Blumen anbot. Die Blumen waren naß, damit sie frisch blieben, und meine Hände wurden rot und rissig.
Es war eine dramatische Heimkehr gewesen, die sich mir bis ins kleinste Detail eingeprägt hatte. Wir fuhren an dem großen, Eversleigh Court genannten Haus vorbei, in dem, wie mir Damaris erklärte, meine Urgroßeltern lebten, und hielten vor dem Dower House, dem Heim von Damaris und meinen Großeltern. Sie waren so aufgeregt, meine Großmutter kam herausgelaufen, stieß einen Freudenschrei aus, als sie Damaris sah, und umarmte sie, als wolle sie sie nie wieder loslassen. Dann wandte sie sich mir zu und hob mich weinend in die Höhe.
Dann kam ein Mann heraus, der Damaris und mich immer wieder küßte. Danach gingen wir in das Haus, und alle sprachen gleichzeitig. Jeremy stand verlegen im Hintergrund, und da die anderen ihn anscheinend vergessen hatten, trat ich zu ihm und ergriff ihn bei der Hand – worauf sie sich wieder um ihn kümmerten. Meine Großmutter sagte, wir seien sicherlich hungrig und sie würde uns etwas zum Essen bringen lassen.
Damaris erklärte zwar, daß sie zu glücklich sei, um an Essen zu denken, aber ich meinte, daß ich gleichzeitig glücklich und hungrig sein konnte, worauf alle lachten.
Bald darauf saßen wir um einen Tisch herum und aßen. Es war ein schöner Raum – ganz anders als Jeannes Keller –, und ich hatte das Gefühl, in Wärme und Glück eingehüllt zu sein. Soweit ich begriff, war dieses Haus von nun an mein Daheim. Ich fragte Damaris danach, und sie sagte: »Bis ...«, und sah dabei sehr glücklich aus.
»Natürlich«, stimmte Großmutter zu. »Es ist wunderbar, daß du wieder hier bist, mein Liebling, und daß du Clarissa mitgebracht hast. Du wirst eine Weile bei uns bleiben, mein geliebtes Kind.«
»Bis ...«, wiederholte ich unglücklich.
Damaris kniete neben mir nieder: »Onkel Jeremy und ich werden bald heiraten, und dann wirst du in unser Haus übersiedeln und bei uns wohnen.«
Damit gab ich mich zufrieden, denn sie freuten sich offensichtlich alle darüber, mich wiederzuhaben.
Jeremy ritt heim, und ich blieb im Dower House. Man wies mir ein kleines Zimmer neben Damaris an. »Damit wir nahe beisammen sind«, meinte sie, und das war sehr beruhigend, denn gelegentlich träumte ich, daß ich wieder in Jeannes Keller war, daß sich die alte Grand’mère in eine Hexe verwandelte und daß die Haare, die aus ihrer Warze wuchsen, zu einem Wald wurden, in dem ich mich verirrte.
Dann lief ich zu Damaris und erzählte ihr von dem Wald, in dem die Bäume das Gesicht von Grand’mère trugen; ihre Äste waren wie braune Finger, die immerzu Geld zählten.
»Nur ein Traum, mein Liebling«, beruhigte mich dann Damaris. »Träume können dir nichts anhaben.«
Es ist herrlich, daß ich mich in Damaris’ Bett flüchten konnte, wenn die schlimmen Träume kamen.
Dann besuchten wir Eversleigh Court, wo weitere Verwandte lebten, die sehr alt waren. Es handelte sich um meine Urgroßmutter Arabella und um meinen Urgroßvater Carleton, einen grimmigen alten Mann mit buschigen Augenbrauen. Aber er mochte mich. Er sah mich streng an, aber ich stellte mich vor ihn hin, verschränkte die Hände hinter dem Rücken und starrte ihn an, um ihm zu zeigen, daß ich keine Angst vor ihm hatte. Schließlich war er nicht annähernd so schrecklich wie Grand’mère, und ich wußte, daß Damaris, Jeremy und die anderen ihm nicht erlauben würden, mich fortzujagen. »Du bist wie deine Mutter«, stellte er fest. »Eine der kämpferischen Eversleighs.«
»Das stimmt«, antwortete ich und versuchte, genauso grimmig auszusehen wie er, worauf alle lachten und meine Urgroßmutter bemerkte: »Clarissa hat Carleton im Sturm erobert.«
Es gab noch einen Zweig der Familie, der in Eyot Abbas lebte und uns aufsuchte. Ich erinnerte mich undeutlich an Benjie, weil er vor Hessenfield mein Vater gewesen war. Es war sehr verwirrend, und ich konnte es überhaupt nicht begreifen. Ich hatte einen Vater gehabt, dann war Hessenfield gekommen und hatte gesagt, er würde mein Vater sein; jetzt war er tot, und Jeremy nahm seine Stelle ein. Ein solches Übermaß an Vätern war bestimmt sehr ungewöhnlich.
Der arme Benjie sah sehr traurig aus, aber als er mich erblickte, leuchteten seine Augen auf. Er hob mich hoch und drückte mich gerührt an sich.
An seine Mutter Harriet konnte ich mich kaum erinnern; sie hatte die blauesten Augen, die ich je gesehen hatte. Außerdem gab es noch Benjies Vater Gregory, einen ruhigen, freundlichen Mann. Das war also noch ein Paar Großeltern. Ich war von Verwandten umgeben und begriff sehr rasch, daß es Streit in der Familie gab und daß es dabei um mich ging. Benjie wollte, daß ich mit ihm kam, weil er irgendwie doch mein Vater war und einen größeren Anspruch auf mich hatte als Damaris. Großmutter Priscilla meinte, daß Damaris das Herz brechen würde, wenn man mich ihr wegnahm, und daß schließlich sie es gewesen war, die mich geholt hatte.
Es war für mich sehr angenehm, daß alle mich haben wollten, aber ich war traurig, als Benjie heimfuhr. Beim Abschied sagte er zu mir: »Liebe Clarissa, wenn du willst, wird Eyot Abbas immer dein Zuhause sein. Wirst du dir das merken?« Ich versprach es ihm, und Harriet fügte hinzu: »Du mußt oft zu uns kommen, Clarissa, weil du uns damit große Freude machst.«
Auch das versprach ich, und dann fuhren sie fort. Kurz danach heirateten Damaris und Jeremy, und Enderby Hall wurde mein Zuhause. Jeremy hatte allein dort gelebt, und als Damaris ihn heiratete, war sie entschlossen, eine Menge zu ändern. In den Tagen vor der Hochzeit fuhr ich oft mit ihr hinüber; ich war von dem Haus fasziniert. Es gab dort einen Mann namens Smith, der ein Gesicht wie eine Reliefkarte mit Flüssen und Bergen hatte; es war voller Runzeln, und überall hatte er kleine Warzen; seine Haut war braun wie die Erde. Wenn er mich sah, verzog sich sein Gesicht, und ein Mundwinkel ging in die Höhe. Das faszinierte mich, denn irgendwann hatte ich begriffen, daß das Smiths Art war zu lächeln.
Außerdem gab es Damon, einen mächtigen Neufundländer, der so groß war wie ich. Er hatte ein dichtes, gewelltes, schwarzweißes Fell und einen buschigen Schwanz, der am Ende nach oben gebogen war. Wir sahen einander an und liebten einander.
»Vorsichtig«, warnte Damaris, »er kann sehr angriffslustig sein.«
Aber nicht mir gegenüber – nie mir gegenüber, denn er wußte, daß es Liebe auf den ersten Blick war. Wir hatten im hôtel keine Hunde gehabt und schon gar nicht in Jeannes Keller, und ich war so glücklich, weil ich mit Damon, Damaris, Jeremy und Smith in einem Haus leben würde. Smith sagte: »Er hat sich noch nie so rasch an jemanden angeschlossen.« Ich legte Damon einfach die Arme um den Hals und küßte ihn auf die feuchte Schnauze. Die anderen sahen besorgt zu, aber Damon und ich wußten, wie es um uns stand.
Jeremy freute sich darüber – überhaupt freuten sich damals alle über eine Menge Dinge. Der einzige Wermutstropfen in diesem Freudenbecher war die Erinnerung an Carlotta, und wenn ich an sie und den lieben, schönen Hessenfield dachte, wurde ich ebenfalls traurig. Damaris versicherte mir, daß beide jetzt glücklich waren, weil sie im Himmel lebten, so daß ich an meinem neuen Aufenthaltsort ebenfalls glücklich sein durfte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Enderby Hall war zunächst ein finsteres Haus, bis man einige Büsche entfernte und Rasenflächen und Blumenbeete anlegte. Damaris nahm einen Teil der schweren Vorhänge ab und ersetzte sie durch leichtere Stoffe in hellen Farben. Die Halle war großartig; sie hatte eine gewölbte Decke und eine schöne Holztäfelung; an einem Ende befand sich die Zwischenwand, hinter der die Küche lag, und am anderen Ende eine elegante Treppe, die zur Galerie hinaufführte.
»Wenn wir eine Gesellschaft geben, werden dort oben die Musiker spielen«, erklärte mir Damaris.
Ich hörte ihr andächtig zu, nahm jede Einzelheit meines neuen Lebens in mich auf und genoß es rückhaltlos.
Es gab ein Schlafzimmer, das Damaris nur ungern betrat; ich bemerkte es bald und fragte sie direkt danach, wie eben Kinder sind. Sie sah erstaunt aus, wahrscheinlich, weil ihr nicht bewußt gewesen war, daß sie ihren Widerwillen zeigte.
Sie sagte nur: »Ich werde alles ändern, Clarissa. Das Zimmer wird nicht wiederzuerkennen sein.«
»Aber ich mag es«, widersprach ich, »es ist hübsch.« Ich trat ans Bett und fuhr mit der Hand über die Samtbespannung. Sie sah es voller Abscheu an, als erblicke sie etwas, das ich nicht sehen konnte. Ich verstand erst später – viel später –, was der Raum für sie bedeutete.
Jedenfalls veränderte sie ihn, und er hatte dann wirklich ein ganz anderes Aussehen. Statt des roten Samts kam weiß-goldener Damast an die Wand und an die Fenster dazu passende Vorhänge. Sie wechselte sogar den Teppich aus, und sie hatte recht damit. Der Raum sah jetzt viel freundlicher aus, aber sie benützte ihn nicht, obwohl es das schönste Zimmer im Haus war. Die Tür war immer verschlossen, und ich glaube, sie betrat es nicht oft.
Das war also mein neues Heim: Enderby Hall, jeweils zehn Reitminuten vom Dower House und von Eversleigh Court entfernt, so daß ich inmitten meiner Familie lebte. Zweifellos waren Damaris und Jeremy miteinander glücklich. Was mich betraf, war ich so froh darüber, dem Pariser Keller entronnen zu sein, daß ich in den ersten Monaten einfach alles schön fand. Ich pflegte mich in die Mitte der großen Halle zu stellen, zur Galerie hinaufzusehen und zu sagen: »Ich bin hier.« Und dann versuchte ich, mich an den Keller mit dem Steinfußboden und an die Ratten zu erinnern, die nachts kamen und mich aus bösen, in der Dunkelheit gelblich schimmernden Augen ansahen. Ich wollte niemals vergessen, was hinter mir lag, und niemals, niemals dorthin zurückkehren. Deshalb konnte ich auch Schnittblumen in Vasen nicht ausstehen, weil sie die Erinnerung in mir wachriefen. Damaris liebte sie und brachte sie körbeweise aus dem Garten herein. Es gab ein eigenes Zimmer, das Blumenzimmer, in dem sie die Blumen in die Vasen ordnete. Am Anfang forderte sie mich auf: »Komm, Clarissa, laß uns ein paar Rosen holen«, aber sie bemerkte bald, daß ich dann still und traurig wurde und oft in der darauffolgenden Nacht einen Alptraum hatte. Deshalb hörte sie auf, Blumen abzuschneiden. Damaris war sehr feinfühlend, mehr als Jeremy. Wahrscheinlich mußte er zu oft daran denken, wie das Leben ihm mitgespielt hatte, bevor er Damaris kennenlernte, um sich über andere den Kopf zu zerbrechen. Damaris dachte immer zuerst an die anderen und stand auf dem Standpunkt, daß es meist ihre Schuld gewesen war, wenn sie im Leben Pech gehabt hatte, und nicht eine Laune des Schicksals.
Als die Veilchen blühten, nahm sie mich zu den Hecken mit, und wir pflückten sie dort büschelweise. Sie rief mir ins Gedächtnis: »Weißt du noch, daß wir einander dank der Veilchen gefunden haben? Deshalb werden Veilchen immer meine Lieblingsblumen bleiben. Deine auch?«
Natürlich wurden sie daraufhin auch meine Lieblingsblumen, und dann machte es mir auch bald nichts mehr aus, andere Blumen zu pflücken. Um Damaris meine Sinnesänderung zu zeigen, brachte ich ihr eines Tages Rosen aus dem Garten mit; sie begriff sofort und drückte mich an sich, wandte dabei aber das Gesicht ab, damit ich nicht die Tränen in ihren Augen sah.
In der ersten Zeit sprachen alle immerzu über mich – nicht nur in Enderby, sondern auch im Dower House –, und in Eversleigh Court wurden wahre Konferenzen abgehalten. Wie oft hörte ich damals den Satz: »Ja, aber was wäre für das Kind das Beste?«
Sie spannen mich in einen ganz dichten, schützenden Kokon ein. Mein Leben war bisher in überaus seltsamen Bahnen verlaufen, deshalb brauchte ich besondere Fürsorge. Vielleicht fühlte ich mich deshalb bei Smith so wohl. Ich sah ihm oft zu, wenn er im Garten arbeitete oder das Silber putzte. Bevor Damaris die Führung des Haushaltes übernommen hatte, war er für alle Arbeiten zuständig gewesen, aber jetzt sandte Großmutter Arabella Diener aus Eversleigh Court herüber. Jeremy war mit diesem Arrangement nicht einverstanden, genausowenig wie Smith.
Smith ging mit mir sozusagen »rauh« um. »Steh nicht so müßig herum«, pflegte er zu sagen. »Müßiggang ist aller Laster Anfang.« Und dann ließ er mich Messer und Gabeln in Laden einordnen, oder ich mußte Zweige und welke Blumen einsammeln und in den Schubkarren legen. Damaris war oft dabei, und wir drei verbrachten glückliche Stunden miteinander. Bei Smith fühlte ich mich wohl; ich war für ihn nicht ein Kind, auf dessen Wohlergehen man ununterbrochen bedacht sein mußte – was meinen Verwandten wahrscheinlich gelegentlich Schwierigkeiten bereitete –, sondern eine nicht sehr brauchbare Arbeitskraft. Es war merkwürdig, daß ich mich danach sehnte, nicht ständig im Mittelpunkt zu stehen, aber es war natürlich ein Hinweis darauf, daß ich bereits gegen das Eingesponnensein im Kokon revoltierte.
Die Familie beriet lange darüber, ob ich eine Gouvernante bekommen sollte, bis Damaris sich bereit erklärte, mich selbst zu unterrichten.
»Du darfst dich nicht überanstrengen«, wandte Großmutter Priscilla besorgt ein.
Damaris lächelte. »Es ist ein Vergnügen für mich, Mutter, und ich werde dabei die ganze Zeit sitzen.«
Urgroßmutter Arabella überlegte, ob man für mich eine französisch sprechende Gouvernante aufnehmen sollte. Ich hatte bei meinen Eltern im hôtel außer Englisch auch Französisch gelernt, und später im Keller hatten wir nur noch Französisch gesprochen.
»Es wäre schade, wenn sie es vergißt«, meinte Arabella.
»Das wird nie der Fall sein«, erklärte Urgroßvater Carleton. »Wenn man eine Sprache einmal beherrscht, verlernt man sie nie wieder. Das Kind braucht nur ab und zu die Möglichkeit, sie zu sprechen. Aber solange zwischen unseren Ländern Krieg herrscht, wirst du nie eine französische Gouvernante für Clarissa bekommen, meine Liebe.«
Daher wurde beschlossen, daß Damaris mich vorläufig unterrichten sollte, und das Problem einer Erzieherin wurde auf später verschoben.
Durch die vielen Diskussionen über meine Französischkenntnisse mußte ich oft an Jeanne denken. Ich hatte sie damals in der schweren Zeit sehr geliebt, weil sie das einzige Bollwerk zwischen mir und den gnadenlosen Straßen von Paris gewesen war. Sie hatte mir Sicherheit gegeben, und ich fragte mich oft, was wohl aus ihr geworden war. Ich wußte, daß Damaris ihr angeboten hatte, sie nach England mitzunehmen, aber wie konnte sie Maman und Grand’mère allein lassen? Ohne sie mußten sie ja verhungern.
Damaris hatte ihr damals erklärt: »Wenn Sie die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen, werden Sie uns immer willkommen sein.«
Dieses Angebot von Damaris hatte mich gefreut, und ich wußte auch, daß sie Jeanne für ihre Mühe reichlich entschädigt hatte. Jeanne konnte gut haushalten und würde mit dem Geld lange auskommen.
So ging das Jahr vorbei. Ich bekam ein Pony, und Smith lehrte mich reiten. Wenn ich in der Koppel an der Longe ritt, die Smith hielt, und Damon laut bellend hinter mir herlief, fühlte ich mich so glücklich wie nie zuvor. Das war noch schöner, als auf Hessenfields Schultern zu sitzen.
An den langen Sommertagen saß ich zuerst mit Tante Damaris im Schulzimmer und lernte, dann ritt ich aus – jetzt nicht mehr an der Longe –, oder ging mit Damon spazieren oder lag mit Damon im Gras oder fuhr nach Eversleigh Court oder Dower House, wo man mir Limonade und kleine Bäckereien vorsetzte. Im Winter gab es dampfenden Glühwein und frisch gebackene Pasteten. Ich liebte alle Jahreszeiten: Aschermittwoch und den Beginn der Fastenzeit; den endlosen Gottesdienst am düsteren Karfreitag und die Korinthenbrötchen hinterher; Ostern, wenn überall die Narzissen blühten und der köstliche Kranzkuchen auf dem Tisch stand, wenn ich neben Damaris in der Kirche saß und zählte, wie viele rote und blaue Farbflecken sich in den Glasfenstern befanden oder wie viele Leute ich sehen konnte, ohne den Kopf zu wenden, oder wie viele Ahs, Hms und Sosos Pastor Renton in seine Predigt einflocht. Es gab das Erntedankfest, bei dem die Kirche mit Obst und Feldfrüchten geschmückt war, und vor allem Weihnachten mit Krippe, Efeu, Stechpalmen, Mistelzweigen, Weihnachtsliedern, Geschenken und Erwartung. Alles war herrlich, und ich stand immer im Mittelpunkt, denn für sie war »das Kind« das wichtigste.
»Das Kind sollte mit Gleichaltrigen zusammenkommen.« Daraufhin wurden Kinder eingeladen, aber es gab in der Umgebung nur wenige, und ich machte mir nicht viel aus ihnen. Am liebsten war ich mit Damaris, Smith und Damon beisammen. Dennoch befriedigte es mich, »das Kind« und damit der Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit zu sein. Als ich älter wurde, begann ich, durch die Diener, die von Eversleigh Court herüberkamen, auch andere Dinge zu lernen. Die Dienstboten gingen nur ungern nach Enderby, da es für sie ein Abenteuer war. Die Bediensteten, die es dennoch wagten, wurden von ihren Kollegen bewundert und hatten nach ihrer Rückkehr viel zu erzählen. Ich interessierte mich immer für Menschen und vor allem für das, was in ihren Köpfen vorging. Ich fand bald heraus, daß die Menschen nur selten wirklich das meinen, was sie sagen, und daß Worte oft dazu dienen, um Gedanken zu verschleiern, statt sie klar auszudrücken. Zu meiner Entschuldigung kann ich allerdings anführen, daß ich eine sehr bewegte Kindheit hinter mir hatte und daß mir meine Verwandten gewisse Dinge verschwiegen hatten. Es war ganz selbstverständlich, daß ich mehr über mich erfahren wollte.
Einmal befand ich mich oben auf der Galerie, als zwei Dienstmädchen unten in der Halle miteinander plauderten. Sie sahen mich nicht, und ich verstand jedes Wort, das sie sprachen.
»Dieser Jeremy war immer ein komischer Kauz.«
Zustimmendes Brummen.
»Hat immer allein mit einem Diener gehaust. Nur er und dieser Smith ... und der Hund, der jeden Besucher verjagte.«
»Das hat sich zum Glück geändert, seit Miß Damaris hier ist.«
»Daß sie so allein nach Frankreich gereist ist ...«
»Das war sehr tapfer von ihr.«
»Allerdings. Diese Miß Clarissa ist ein kleiner Fratz.« Meine Aufregung nahm zu. Ich war also ein kleiner Fratz!
»Es würde mich nicht wundern, wenn sie ihrer Mutter nachgerät. Miß Carlotta hatte es ja faustdick hinter den Ohren. Sie war so schön, daß ihr kein Mann widerstehen konnte. Aber es war eine Schande, daß sie den armen Mr. Benjie verließ. Gewaltsam entführt – daß ich nicht lache!«
»Na ja, das ist alles vorbei, und sie ist jetzt tot. Ein sehr früher Tod, nicht wahr?«
»Hm, das ist der Lohn der Sünde, könnte man sagen.«
»Und die kleine Clarissa gerät ihr nach, du wirst noch an meine Worte denken.«
»Es heißt ja, die Sünden der Väter ... und so weiter.«
»Du wirst schon sehen, hier werden noch die Funken fliegen. Warte nur ab, bis sie ein bißchen älter ist. Putzt du jetzt die Galerie?«
»Ich muß wohl, aber ich bekomme dort immer eine Gänsehaut.«
»Das ist der Teil des Hauses, in dem es spukt. Man kann zwar neue Vorhänge aufhängen und neue Tapeten anbringen, aber was nützt das schon? Neue Vorhänge haben noch nie Gespenster vertrieben.«
»Wenn es einmal in einem Haus spukt, hört das angeblich nie mehr ganz auf.«
»Das stimmt. In diesem Haus hat es immer Schwierigkeiten gegeben, und sie werden wiederkommen, trotz Rasen, Blumenbeeten, neuen Vorhängen und Teppichen. Wenn du willst, gehe ich mit dir in die Galerie; aber hilf mir zuerst hier unten.«
Damit bot sich mir die Möglichkeit, rechtzeitig zu verschwinden.
Meine schöne Mutter hatte sich also schamlos betragen und Benjie wegen meines Vaters verlassen. Ich erinnerte mich undeutlich an eine Nacht im Gestrüpp, durch das mich starke Arme trugen, an den Geruch des Meeres und daran, wie aufgeregt ich war, weil ich auf einem Schiff fuhr.
Ja, ich war in dieses schändliche Abenteuer verstrickt; ich war ja eigentlich seine Folge.
Erst später erfuhr ich den vollen Umfang der Geschichte; damals reimte ich sie mir aus dem Tratsch und aus meinen Erinnerungen zusammen.
Innerhalb der Familie kam es auch zu Spannungen; Jeremy litt unter sogenannten »Stimmungen«, die nicht einmal Damaris immer vertreiben konnte. Dann wirkte er sehr traurig; es hing mit seinem kranken Bein zusammen, das in irgendeiner Schlacht verwundet worden war und das ihm immer wieder Schmerzen verursachte. Auch Damaris hatte Tage, an denen sie sich nicht wohl fühlte. Sie versuchte, es vor mir geheimzuhalten, aber ich spürte das Unbehagen hinter ihrer fröhlichen Miene.
Sie sehnte sich nach einem Kind.
Und dann erzählte sie mir, als wir eines Tages beisammen saßen, daß sie nun ein Kind erwarte. Ich hatte schon geahnt, daß sich etwas Außergewöhnliches ereignet hatte, denn Jeremy sah aus, als würde er nie wieder eine seiner Stimmungen haben, und Smith lächelte dauernd vor sich hin.
Ich freute mich auf das Baby und versprach, daß ich mich mit ihm befassen und ihm französische Lieder vorsingen würde, die Jeanne mich gelehrt hatte. Im Haus wurden eifrig Vorbereitungen getroffen; Großmutter Priscilla machte sich Sorgen wegen Damaris, Großvater Leigh benahm sich, als wäre sie aus Porzellan, Urgroßmutter Arabella erteilte ungefragt gute Ratschläge, und Urgroßvater Carleton murmelte immer wieder: »Weiber!«
Irgendwann fiel mir auf, daß ich nach der Geburt des Babys nicht mehr »das Kind« sein würde, und daß Damaris ihr eigenes Kind natürlich mehr lieben würde als ihre adoptierte Nichte. Der Gedanke bedrückte mich, aber ich schob ihn beiseite und beteiligte mich an dem allgemeinen aufgeregten Treiben.
Den Tag werde ich nie vergessen. Die Wehen setzten um Mitternacht ein; Großmutter Priscilla und die Hebamme wurden geholt, und einige Diener aus Eversleigh Court kamen herüber.
Durch die Unruhe wurde ich wach, kletterte aus dem Bett und lief zu dem Zimmer von Damaris. Dort fing mich die besorgte Priscilla ab. »Geh sofort wieder auf dein Zimmer«, befahl sie mir so streng, wie sie noch nie mit mir gesprochen hatte. Ich gehorchte, schlüpfte aber nach einer Weile wieder hinaus; diesmal sagte mir einer der Diener: »Steh uns nicht im Weg herum, du hast hier nichts verloren.«
Ich kehrte also in mein Zimmer zurück und wartete dort angsterfüllt, denn ich merkte, daß etwas nicht in Ordnung war. Es war so wie damals im Keller, eine Veränderung bereitete sich vor, und ich bangte um meine Sicherheit. Das Warten schien überhaupt kein Ende zu nehmen, und als es endlich vorbei war, war die Freude aus dem Haus verschwunden, das jetzt womöglich noch düsterer und trauriger wirkte als zuvor. Es war eine Totgeburt gewesen, und Damaris war sehr krank. Niemand kümmerte sich um mich. Die Großeltern sprachen miteinander; diesmal wurde ich nicht erwähnt, sondern es ging immer nur um die arme Damaris und was das für sie bedeutete. Außerdem schwebte sie in Lebensgefahr; Jeremy war in eine seiner Stimmungen versunken und hatte einen bitteren Zug um den Mund. Sicherlich glaubte er, daß Damaris ihrem Kind nachfolgen würde.
Großmutter Priscilla wollte eine Weile in Enderby bleiben, um ihre Tochter zu pflegen. Dann kam Benjie und machte sich erbötig, mich für einige Zeit nach Eyot Abbas mitzunehmen. Zu meinem Kummer versuchte niemand, ihn davon abzubringen.
Ich fuhr also nach Eyot Abbas mit, wo mir die gleiche liebevolle Fürsorge zuteil wurde wie in Enderby.
Benjie liebte mich innig und hätte mich gern als Tochter bei sich behalten. Merkwürdigerweise tauchten aber in Eyot Abbas längst vergessene Erinnerungen wieder auf. Ich wußte plötzlich wieder, daß ich unter der Aufsicht meiner Nurse im Garten gespielt hatte. Und vor allem erinnerte ich mich an den Tag, an dem Hessenfield mich entführt, auf das Schiff und in das hôtel gebracht hatte – und an das Ende im kalten, bedrohlichen Keller, in dem Jeanne meine einzige Beschützerin gewesen war.
Beinahe wider Willen fühlte ich mich zu Harriet hingezogen, und da auch ihr Mann Gregory sanft und freundlich war, hätte ich in Eyot Abbas vollkommen glücklich sein können, wenn ich mich nicht nach Damaris gesehnt hätte, zu der ich eine besonders starke Gefühlsbeziehung hatte. Diese Dinge müssen sich um das Jahr 1710 abgespielt haben, denn ich war damals acht Jahre alt. Wahrscheinlich war ich aber durch alles, was ich mitgemacht hatte, frühreif – jedenfalls war Harriet dieser Auffassung.
Harriet und ich waren einander ähnlich. Wir interessierten uns beide für Menschen und erfuhren dadurch sehr viel über sie.
Sie war eine erstaunliche Frau, deren Schönheit unzerstörbar schien. Sie muß damals schon sehr alt gewesen sein - sie verriet uns nie ihr wahres Alter –, aber die Jahre schienen spurlos an ihr vorübergegangen zu sein. Sie ließ sich einfach nicht von ihnen unterkriegen. Ihre Haare waren immer noch schwarz. »Bevor ich sterbe, werde ich dir mein Geheimnis verraten, Clarissa«, versprach sie mir mit übermütigem Lächeln, als wäre sie noch ein junges Mädchen. Ihre leuchtendblauen Augen bildeten einen faszinierenden Gegensatz zum dunklen, gewellten Haar, und angesichts ihres jugendlichen Feuers vergaß man die Krähenfüße in ihren Augenwinkeln.
Sie nahm sich meiner an und verbrachte viel Zeit mit mir, wobei sie mir oft Fragen über die Vergangenheit stellte.
»Du bist alt genug, um die Wahrheit über dich zu erfahren«, meinte sie. »Ich nehme an, du hast sowieso Augen und Ohren aufgesperrt, um möglichst viel aufzuschnappen.«
Das gab ich zu. Man konnte Harriet gegenüber läßliche Sünden eingestehen, weil man davon überzeugt war, daß sie in der gleichen Lage wahrscheinlich die gleichen, wenn nicht ärgere begangen hätte. Obwohl sie alt war und man sie deshalb mit Respekt behandeln mußte, war sie anders als meine Familie. Sie war zwar geistig jung geblieben, verfügte aber über die Erfahrungen eines langen Lebens, aus denen ich lernen konnte.
»Ja«, wiederholte sie, »es ist besser, wenn du die ganze Wahrheit erfährst. Ich nehme an, daß deine liebe Großmutter nie ein Sterbenswörtchen darüber verlieren würde. Ich kenne die gute Priscilla – und Damaris ist eine brave Tochter, die immer tut, was ihre Mutter will. Nicht einmal deine Urgroßmutter würde darüber sprechen, davon bin ich überzeugt. Ach, du meine Güte, also muß die arme, alte Harriet wieder einmal in die Bresche springen.«
Dann erzählte sie mir, daß meine Mutter im Gasthaus einige Jakobiten kennengelernt hatte, deren Anführer Lord Hessenfield war. Sie verliebten sich ineinander, und die Folge war ich. Aber sie waren nicht verheiratet, sie hatten keine Zeit dazu gehabt, denn Hessenfield mußte nach Frankreich fliehen. Ich kam auf die Welt, und Benjie erklärte sich bereit, Vaterstelle an mir zu vertreten, deshalb heiratete meine Mutter ihn. Hessenfield kehrte nach einiger Zeit heimlich zurück und holte meine Mutter und mich nach Frankreich, so daß der arme Benjie, der sich schon als mein Vater fühlte, einsam zurückblieb.
»Deshalb mußt du besonders lieb zu Benjie sein«, meinte Harriet.
»Darauf kannst du dich verlassen«, versicherte ich ihr.
»Der arme Benjie. Er sollte noch einmal heiraten und deine Mutter vergessen, aber er bringt es nicht fertig. Sie war so schön, Clarissa.«
»Ich weiß.«
»Aber sie machte weder sich noch andere glücklich.«
»Sie machte Hessenfield glücklich.«
»Ja, sie waren vom gleichen Schlag. Deine Eltern, Clarissa, waren außergewöhnliche Menschen, und du kannst auf sie stolz sein. Ich frage mich, ob du ihnen nachgeraten bist, denn dann müßtest du aufpassen. Du müßtest auf deine Neigung zur Unüberlegtheit achten und lernen zu denken, bevor du handelst. Ich habe mich immer an diesen Grundsatz gehalten und bin gut dabei gefahren. Ich habe ein schönes Haus, einen guten Mann und den liebevollsten Sohn der Welt, und ich kann meinen Lebensabend in Frieden und Glück verbringen. Aber das alles fiel mir nicht in den Schoß, Clarissa, ich bemühte mich darum, mein ganzes Leben lang. Du hast die besten Voraussetzungen, ein glückliches Leben zu führen, mein Kind. Du hast zwar deine Eltern verloren, aber du hast eine Familie, die dich liebt. Jetzt weißt du die Wahrheit über dich und mußt die Lehren daraus ziehen. Sei kühn, aber nicht unüberlegt, gehe einem Abenteuer nicht aus dem Weg, aber handle nie voreilig. Glaub mir, ich habe ein langes Leben hinter mir und weiß, wovon ich spreche.«
Ich saß oft mit ihr beisammen und hörte ihr fasziniert zu. Sie erzählte mir viel über die Vergangenheit, über ihr Leben als Schauspielerin und über ihr Zusammentreffen mit meiner Urgroßmutter Arabella kurz vor der Restauration Karls II. Sie sprach lebhaft, spielte mir die einzelnen Szenen förmlich vor, und ich erfuhr von ihr mehr über meine Familie als je zuvor.
Sie hatte recht; seit ich über meine Eltern Bescheid wußte, schwand langsam mein Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn ich hörte, was die Mitglieder meiner Familie alles erlebt hatten, fühlte ich mich selbstbewußt und sicher.
Wahrscheinlich erwachte damals der Wunsch nach Unabhängigkeit in mir – aber ich war erst acht Jahre alt.
Eines Tages rief mich Harriet zu sich. Sie hielt einen Brief in der Hand.
»Eine Botschaft von deiner Großmutter; sie möchte, daß du nach Enderby zurückkommst. Damaris geht es besser, und sie sehnt sich nach dir. Damit ist dein Besuch bei uns zu Ende, denn wir müssen dem Wunsch deiner Familie nachkommen. Ich war sehr glücklich darüber, daß du bei uns warst, und Benjie war selig. Er wird traurig sein, wenn du uns verläßt, aber ich darf nicht vergessen, daß Damaris dich aus Frankreich geholt hat und daher den ersten Anspruch auf dich hat. Ich weiß, daß du ungern weggehst, aber daß du dich auch darauf freust, deine liebe Damaris wiederzusehen.«
Natürlich wollte ich Damaris wiedersehen, aber ich verließ Harriet, Gregory und Benjie ungern. Ich liebte Eyot Abbas, und mir fiel zu meinem Kummer ein, daß ich nun nicht mehr auf die kleine Insel übersetzen würde, die ich von meinem Schlafzimmerfenster aus sehen konnte. Ich war richtig hin- und hergerissen.
Harriet sagte: »Gregory, Benjie und ich werden dich in der Kutsche heimbringen. Dadurch können wir noch eine Weile beisammensein.«
Die Vorstellung, in Gregorys Kutsche zu fahren, begeisterte mich. Es war ein großartiges Fahrzeug, hatte aber keinen Platz für unser Gepäck. Das wurde in den Satteltaschen mitgeführt. Zwei Reitknechte begleiteten uns – einer saß auf dem Kutschbock, der andere ritt hinterher, und von Zeit zu Zeit tauschten sie die Plätze.
Es war eine gemächliche, genußvolle Reise; wir hielten immer wieder bei Wirtshäusern. In mir erwachte undeutlich die Erinnerung daran, daß ich schon einmal in dieser Kutsche gereist war. Ich war damals noch sehr klein und hatte bei dieser Gelegenheit Hessenfield zum erstenmal gesehen. Er hatte einen Räuber gespielt und die Kutsche aufgehalten. Während wir dahinrumpelten, sah ich zum Fenster hinaus, und die einzelnen Bilder tauchten wieder vor meinem geistigen Auge auf. Der maskierte Hessenfield, der die Kutsche anhielt, uns befahl auszusteigen und meine Mutter und dann mich küßte. Ich hatte keine Angst gehabt, denn ich fühlte, daß auch meine Mutter sich nicht fürchtete. Ich gab dem Räuber den Schwanz meiner Zuckermaus. Dann ritt er fort, und ich sah ihn erst wieder, als er mich von Eyot Abbas auf das Schiff brachte.
Ich wurde langsam schläfrig. Harriet und Gregory dösten vor sich hin; Benjie saß neben ihnen, und wenn sein Blick dem meinen begegnete, lächelte er mir zu. Er sah sehr traurig aus, und ich dachte: Wenn du Hessenfield wärst, würdest du mich nicht fortlassen.
Ich verglich jeden Menschen mit Hessenfield, denn er war größer gewesen als alle Leute, die ich kannte. Er hatte sie in jeder Beziehung überragt. Ich war davon überzeugt, daß er, wenn er am Leben geblieben wäre, König Jakob auf den Thron gesetzt hätte.
Wir kamen nur langsam voran, weil die Straßen so schlecht waren. Es hatte geregnet, und wir fuhren immer wieder durch Pfützen, so daß das Wasser hoch aufspritzte. Das gefiel mir, und ich lachte jedesmal darüber.
»Für den armen, alten Merry ist es nicht so lustig«, sagte Benjie. Merry saß gerade auf dem Kutschbock.
Plötzlich gab es einen Ruck, und die Kutsche hielt an. Gregory riß erschrocken die Augen auf, und Harriet fragte: »Was ist los?«
Die beiden Männer stiegen aus. Ich blickte aus dem Fenster und sah, daß sie die Räder betrachteten. Dann steckte Gregory den Kopf herein. »Wir sitzen in einer Rinne neben der Straße fest«, erklärte er. »Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder hinauskommen.«
»Hoffentlich nicht zu lange«, antwortete Harriet. »In einer Stunde ist es finster.«
»Wir gehen sofort an die Arbeit«, beruhigte sie Gregory. »Das Wetter ist schuld daran; die Straßen sind in einem erbärmlichen Zustand.«
Harriet sah mich an und zuckte die Schultern. »Wir müssen uns eben in Geduld fassen. Freust du dich schon auf die warme Gaststube? Was möchtest du denn gern essen? Zuerst eine heiße Suppe, dann ein Spanferkel und eine Rebhuhnpastete?«
Wenn Harriet sprach, sah man das, was sie schilderte, zum Greifen deutlich vor sich.
Plötzlich sagte Harriet: »Du bist vor langer Zeit schon einmal in dieser Kutsche gefahren, kannst du dich daran erinnern, Clarissa?«
Ich nickte.
»Ein Räuber hielt euch auf«, fuhr sie fort.
»Es war in Wirklichkeit kein Räuber, sondern Hessenfield, der Spaß machte.«
Ich spürte, wie mir Tränen in die Augen stiegen, weil ich ihn nie wiedersehen würde.
»Er war ein Mann, nicht wahr?« meinte Harriet ruhig.
Ich verstand, was sie damit sagen wollte, und dachte: Es wird nie wieder jemanden wie Hessenfield geben. Dann fiel mir ein, daß neben einem wunderbaren Menschen wie ihm alle anderen so unbedeutend aussahen, daß es ein Jammer war.
Harriet beugte sich zu mir. »Sobald ein Mensch tot ist, wirkt er viel besser, als er zu Lebzeiten eigentlich war.«
Ich dachte noch über diese Feststellung nach, als Gregory wieder den Kopf in die Kutsche steckte. »Noch zehn Minuten, und wir sind wieder unterwegs.«
»Gut«, rief Harriet, »dann kommen wir noch vor Einbruch der Dunkelheit zum ›Eber‹.«
»So wie die Straße aussieht, haben wir Glück, wenn wir es überhaupt schaffen«, antwortete Gregory.
Etwas später nahmen er und Benjie ihre Plätze in der Kutsche wieder ein. Nach der Ruhepause waren die Pferde unruhig und trabten bald lustig dahin.
Die Sonne war beinahe hinter dem Horizont verschwunden, und es wurde rasch dunkel. Dann erreichten wir den Wald, und ich hatte das seltsame Gefühl, daß ich diesen Ort genau kannte: wahrscheinlich hatte uns Hessenfield seinerzeit hier überfallen.
Wir bogen in den Wald ein und waren erst ein kurzes Stück gefahren, als zwei Reiter aus dem Gebüsch brachen und neben uns herritten. Ich konnte einen von ihnen deutlich erkennen; er war maskiert und trug eine Flinte.
Räuber! Die Straßen wimmelten von ihnen. Mein erster Gedanke war: Diesmal ist es nicht Hessenfield, sondern es sind wirkliche Räuber.
Gregory hatte die Gefahr ebenfalls erkannt und griff nach der Büchse unter unserem Sitz. Harriet ergriff meine Hand und hielt sie fest. Merry rief etwas. Er gab den Pferden die Peitsche, so daß sie in Galopp fielen und wir in der Kutsche hin- und hergeworfen wurden.
Benjie zog den Degen, der vorsichtshalber in der Kutsche für solche Fälle bereitlag.
»Merry will anscheinend versuchen, ihnen zu entkommen«, murmelte Gregory.
»Das wäre am besten«, antwortete Benjie. Er sah Harriet und mich an; offensichtlich wollte er uns nicht durch einen Kampf gefährden.
Die Kutsche ratterte weiter. Wir schwankten wild – und dann geschah es plötzlich. Ich flog von meinem Sitz und prallte an das Verdeck der Kutsche.
Ich hörte noch, wie Harriet flüsterte »Gott schütze uns«, dann wurde es dunkel um mich.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem fremden Bett. Damaris und Jeremy standen neben mir.
Damaris sagte: »Ich glaube, jetzt ist sie wach.«
Langsam kehrte die Erinnerung zurück. »Wir waren in der Kutsche ...«, flüsterte ich.
»Ja, mein Liebling, du bist jetzt in Sicherheit.«
»Was ist denn geschehen?«
»Es kam zu einem Unfall ... denk aber jetzt nicht darüber nach.«
»Wo bin ich?«
»Im ›Eber‹. Wir werden bald mit dir nach Hause reisen, sobald du kräftig genug bist.«
»Du bleibst also hier?«
»Ja, bis wir dich heimnehmen können.«
Ich erholte mich rasch; ein Bein war gebrochen, und ich hatte zahlreiche Prellungen.
»Junge Knochen heilen schnell«, erklärte man mir.
Zwei Tage danach erfuhr ich die ganze Wahrheit. Die Kutsche konnte nicht mehr verwendet werden, und die Pferde waren so schwer verletzt worden, daß man sie erschießen mußte.
»Man konnte nichts anderes tun«, erklärte mir Damaris.
»Was ist aus den Räubern geworden?« fragte ich.
»Sie machten sich aus dem Staub, als die Kutsche umstürzte. Merry und Keller hatten die Pferde angetrieben, um ihnen zu entgehen, und übersahen dabei den umgestürzten Baumstamm. So passierte es.«
»Befinden sich auch Benjie, Harriet und Gregory hier im Gasthaus?«
Darauf folgte längeres Schweigen, und ich hatte plötzlich Angst.
»Clarissa, es war ein sehr schwerer Unfall. Du und Benjie, ihr habt Glück gehabt ...«
»Was meinst du damit?«
Damaris sah Jeremy an, der nickte. Das hieß: Sag es ihr, es hat keinen Sinn, ihr die Wahrheit zu verschweigen. »Harriet und Gregory wurden getötet, Clarissa.« Ich wußte nicht, was ich darauf antworten sollte, ich war wie betäubt. Ich war wieder einmal mit dem Tod konfrontiert. Er schlug immer dann zu, wenn man es am wenigsten erwartete. Meine stolzen Eltern ... der liebe, freundliche Gregory ... die schöne Harriet mit den blauen Augen und dem schwarzen Lockenhaar ... alle tot.
»Ich werde sie nie wiedersehen«, stammelte ich.
Dann schloß ich die Augen; vielleicht konnte ich einschlafen und alles vergessen.
Damaris und Jeremy verließen das Zimmer, und ich hörte, wie sie vor der Tür miteinander flüsterten.
»Vielleicht hätten wir es ihr nicht sagen sollen, sie ist ja noch ein Kind.«
»Nein«, antwortete Jeremy. »Sie muß erwachsen werden und lernen, wie das Leben ist.«
So lag ich im Bett und dachte an die Dahingegangenen.
An diesem Tag hatte ich das Gefühl, kein Kind mehr zu sein. Aber es stimmt, daß junge Knochen schnell heilen; und wenn man jung ist, überwindet man auch den psychischen Schock bald.
Der arme Benjie sah aus wie ein Gespenst. Das Leben war immer grausam mit ihm umgesprungen, und dabei war er so herzensgut und hatte bestimmt nie jemandem ein Leid zugefügt. Trotzdem hatte er meine Mutter an Hessenfield abtreten müssen und mich an Damaris, und jetzt hatte er seine Eltern verloren, an denen er mit so selbstloser Liebe gehangen hatte.
Damaris und Jeremy bestanden darauf, daß er mit uns nach Eversleigh kam.
Jeremy trug mich in Enderby ins Haus, wo Smith und Damon mich schon erwarteten. Smiths Gesicht war noch faltiger als gewöhnlich, weil ich endlich wieder da war, und Damon sprang immer wieder hoch und winselte leise, um mir zu zeigen, wie sehr er sich über meine Rückkehr freute.
Jeremy trug mich jeden Tag aus meinem Zimmer hinunter und am Abend wieder herauf, bis mein Bein in Ordnung war, und Arabella, Carleton und Leigh besuchten mich häufig, um mir die Zeit der Genesung zu verkürzen.
Arabella trauerte sehr um Harriet.
»Sie war eine Abenteurerin, aber sie war eine einmalige Persönlichkeit. Ich habe das Gefühl, daß ich mit ihr einen Teil meiner selbst verloren habe.«
Sie wollten, daß Benjie blieb, aber er mußte sich um den Besitz kümmern. Außerdem meinte er, daß die Arbeit eine Ablenkung bedeuten würde.
Er forderte mich nicht auf, ihn in Eyot Abbas zu besuchen, weil er fürchtete, daß es für mich ohne Harriet und Gregory dort sehr traurig sein würde.
Trotzdem beschloß ich, oft zu ihm zu kommen, um ihn zu trösten.
Kapitel 2 Ein Besuch aus Frankreich
Etwa ein Jahr nach dem Unfall wurde beschlossen, daß meine Erziehung vervollständigt werden müsse, und zwar durch eine Gouvernante.
Großmutter Priscilla übernahm es, eine zu suchen. Sie fand, daß man sich dabei am besten auf Empfehlungen verließ, und als der Rektor von Eversleigh, der über unser Problem im Bild war, nach Dower House geritten kam, um meiner Großmutter zu sagen, daß er jemand Geeigneten kannte, war sie begeistert.
Bald darauf stellte sich Anita Harley vor und wurde sofort aufgenommen.
Sie war etwa dreißig Jahre alt, die verarmte Tochter eines Pfarrers, die ihren Vater bis zu seinem Tod betreut hatte und jetzt ihren Lebensunterhalt selbst verdienen mußte. Sie verfügte über eine gute Bildung; ihr Vater hatte die Kinder der Landedelleute unterrichtet und sie an den Stunden teilnehmen lassen. Da sie wesentlich rascher lernte als ihre Mitschüler, hatte sie schon mit zweiundzwanzig Jahren die Dorfkinder unterrichtet, war also sehr gut dafür geeignet, meine Erziehung in die Hand zu nehmen.
Ich mochte sie. Sie war würdevoll, ohne borniert zu sein, und machte kein großes Aufhebens um ihr Wissen; sie hatte Sinn für Humor; sie bevorzugte Englisch und Geschichte und vernachlässigte die Mathematik ein bißchen – also stimmten unsere Vorlieben überein. Sie sprach auch ein bißchen Französisch, und wir konnten Geschichten in dieser Sprache lesen. Meine Aussprache war besser als die ihre, weil ich im hôtel immermit den Bediensteten geplaudert hatte; ich sprach Französisch so fließend wie eine Französin. überhaupt kamen wir gut miteinander aus.
Wir ritten, spielten Schach und unterhielten uns ununterbrochen; sie war wirklich eine glückliche Ergänzung unseres Haushalts.
Damaris war entzückt.
»Sie wird dir mehr beibringen, als mir je möglich gewesen wäre«, gab sie ganz offen zu.
Anita wurde wie ein Familienmitglied behandelt. Sie aß mit uns und begleitete uns, wenn wir Dower House oder Eversleigh Court einen Besuch abstatteten.
»Ein wirklich reizendes Mädchen«, bemerkte Arabella.
»Und sie ist das Richtige für das Kind«, fügte Priscilla hinzu.
»Das Kind« wuchs rasch und lernte viel. Ich wußte um meine Herkunft, ich hatte gehört, wie die Diener mich als vorlaut bezeichneten; außerdem waren sie der Ansicht, daß man kein Wahrsager sein müsse, um zu erkennen, wie sehr ich meiner Mutter nachgeriet.
Wie ich mir vorgenommen hatte, besuchte ich Benjie bald. Damaris war damit einverstanden, bestand aber darauf mitzukommen, weil sie sonst, wie sie sagte, keinen ruhigen Augenblick hätte.
Auf diesen Fahrten achteten wir darauf, daß wir den Schauplatz des Überfalls immer bei Tageslicht erreichten; außerdem waren wir von Bewaffneten begleitet. Für mich war es ein aufregendes Abenteuer, wieder durch diesen Wald zu fahren, obwohl er mich jetzt nicht nur an meinen Vater, sondern auch an Harriet und Gregory erinnerte.
Anita begleitete uns, weil Damaris meinte, daß ich meinen Unterricht nicht unterbrechen sollte, und ich war froh darüber. Ohne Harriet wirkte Eyot Abbas ganz anders, und es war deprimierend, überall im Haus auf die Spuren ihrer Tätigkeit zu stoßen.
Damaris meinte, daß Benjie die Einrichtung ändern sollte. Es war das beste Mittel, die Erinnerung an traurige Ereignisse zu verdrängen. Als sie das sagte, war sie sehr ernst, und ich dachte an das Schlafzimmer in Enderby.
»Vielleicht können wir ihm ein paar Ratschläge geben«, meinte Damaris. »Fallen Ihnen denn gar keine Vorschläge ein, Anita?«
Es hatte sich herausgestellt, daß Anita sehr gut Blumen anordnen und die Einrichtung farblich abstimmen konnte. Sie erzählte mir, daß sie so gern das alte Pfarrhaus, in dem sie gelebt hatte, neu eingerichtet hätte, aber es war nie genug Geld dafür dagewesen.
Wir fuhren also nach Eyot Abbas, und Benjie freute sich über den Besuch, aber man konnte nicht übersehen, wie kummervoll und niedergeschlagen er war.
Er bemerkte, daß er eigentlich froh darüber sei, daß sein Vater seine Mutter nicht überlebt hatte, weil er ohne sie so fürchterlich einsam gewesen wäre. Das hieß natürlich, daß Benjie selbst sich fürchterlich einsam fühlte.
»Du mußt alles tun, was du kannst, um ihn aufzuheitern«, erklärte mir Damaris. »Du kannst das besser als jeder andere.«
»Vielleicht sollte ich zu ihm ziehen«, meinte ich.
Damaris sah mich ernst an. »Möchtest du das?«
Ich schlang die Arme um ihren Hals. »Nein, nein. Ich möchte immer bei dir bleiben.«
Sie war sichtlich erleichtert, und ich dachte wider Willen daran, wie wichtig ich war. Dann fiel mir ein, daß diese Menschen mich ja nur als Ersatz wollten – Damaris, weil sie kein eigenes Kind bekam und weil Jeremy seine Stimmungen hatte; Benjie, weil er Carlotta und jetzt seine Eltern verloren hatte. Obwohl ich mich geschmeichelt fühlte, mußte ich mir darüber klar sein, daß sie alle eigentlich etwas anderes als mich wollten.
Anita, Benjie und ich ritten oft aus. Damaris begleitete uns manchmal, aber sie wurde müde, wenn sie zu lang im Sattel saß, also blieben wir drei allein. Auf diesen Ritten vergaß Benjie seine Trauer und lehrte mich eine Menge über die Forstwirtschaft. Anita verfügte auch auf diesem Gebiet über beachtliche Kenntnisse. Ich begann, die einzelnen Bäume voneinander zu unterscheiden, und Benjie hielt mir begeisterte Vorträge über die Eichen.
»Sie sind echt englische Bäume«, erklärte er, »die seit urdenklichen Zeiten hier wachsen. Wußtest du, daß die Druiden besondere Achtung vor ihnen hatten? Sie vollzogen ihre religiösen Riten unter Eichen; unter ihren Ästen wurde auch Recht gesprochen.«
»Ich glaube«, ergänzte Anita, »daß manche dieser Bäume zweitausend Jahre alt werden.«
»Das stimmt. Und unsere Schiffe werden aus den Brettern dieser Bäume gezimmert. Deshalb heißt es, daß unsere Schiffe Eichenherzen haben.«
Anita wollte wissen, worüber die Weiden trauerten, und erzählte uns, daß die Espe deshalb zittere, weil das Kreuz Christi aus ihrem Holz gemacht worden war und sie seither keine Ruhe mehr finde. Anita sprach auch über die Mistel, die als einzige nicht versprochen hatte, Baldur, dem schönsten der nordischen Götter, kein Leid zuzufügen. Deshalb konnte der böse Loki ihn mit einem Pfeil aus Mistelholz töten.
»Wie ich sehe, Miß Harley«, meinte Benjie, »stehen Sie der Natur sehr romantisch gegenüber.«
»Ich finde nichts Schlechtes daran«, meinte Anita.
Benjie lachte zum erstenmal seit dem Unfall und dem plötzlichen Tod seiner Eltern.
Wir machten in Gasthäusern Rast, tranken Apfelwein und aßen frisches Brot mit Käse und warme Pasteten. Benjie redete meist über seinen Besitz, für den er jetzt allein verantwortlich war. Er suchte offensichtlich etwas, das ihn beschäftigte, so daß er seinen Verlust leichter ertragen konnte.
Ich sprach mit Anita über ihn.
»Er ist anders als Jeremy«, stellte ich fest. »Jeremy hätschelt seinen Kummer, und obwohl seine Ehe mit Damaris glücklich ist, kann er nicht vergessen, daß er im Krieg verwundet wurde.«
»Der Schmerz erinnert ihn immer wieder daran.«
»Ja, während Benjie durch die Räume, in denen seine Eltern gelebt haben, daran erinnert wird. Solche Dinge kann ein Mensch überwinden, während Jeremy dem Schmerz in seinem Bein nie entrinnen kann.«
Nach einiger Zeit fand ich, wir sollten nach Hause fahren, weil der arme Jeremy ohne Damaris sicherlich sehr unglücklich war. Ich wußte, daß ich ihm ein Trost war, denn wenn er mich ansah, erinnerte er sich daran, wie er und Damaris mich aus dem Keller geholt hatten. Ohne seine Hilfe hätte es Damaris nie geschafft, und dieses Bewußtsein hob Jeremys Stimmung.
»Benjie«, fragte ich, »warum kommst du nicht zu uns nach Enderby?«
»Ich würde gern kommen, aber ich muß mich um den Besitz kümmern.« Er wollte nicht davonlaufen, sondern mit seiner Einsamkeit fertig werden.
Wir kehrten Ende September zurück, als die Blätter sich färbten und die ersten Früchte reif wurden. Anita und ich kletterten im Obstgarten auf Leitern, um Äpfel zu pflücken, während Smith die Schubkarren belud und Damon den Kopf schief legte und uns zusah.
Priscilla kam herüber und half Damaris beim Einkochen; wenn nicht die ständige leise Trauer gewesen wäre, hätte es ein ganz normaler Herbst sein können. Arabella vermißte Harriet sehr, was mich wunderte, denn sie war ihr gegenüber oft schroff gewesen, und ich hatte immer den Eindruck gehabt, daß vieles an Harriet sie störte.
Sogar Urgroßvater Carleton schien um sie zu trauern, und dabei hatte er nie ein Hehl daraus gemacht, daß er sie nicht mochte.
»Einmal muß jeder von uns gehen«, meinte Arabella, »früher oder später trifft es jeden.«
Damaris lehnte solche Aussprüche ab. Sie hielt sie für Unsinn und versprach, dafür zu sorgen, daß ihre Großmutter so alt wurde wie Methusalem.
Wieder ging ein Jahr vorbei. Ich war jetzt zehn, und überall wurde über den Waffenstillstand geredet, der den Krieg beenden sollte. Priscilla fand, daß es wirklich an der Zeit war. Sie konnte nicht begreifen, was es uns kümmerte, wer auf dem spanischen Thron saß.
Urgroßvater Carleton sah sie an, schüttelte den Kopf und sagte nur ein Wort: »Weiber!«
»Wenn es wirklich zum Frieden kommt«, stellte Damaris fest, »wird man frei zwischen Frankreich und England hin- und herreisen können.« Sie sah Jeremy an. »Ich möchte nach Paris fahren.«
»Eine sentimentale Reise«, meinte Jeremy lächelnd. Ich liebte dieses Lächeln an ihm, denn dann wußte ich, daß er im Augenblick keine Schmerzen verspürte und das Leben genoß.
»Ich frage mich, was aus Jeanne geworden ist«, sinnierte Damaris, »hoffentlich geht es ihr gut.«
»Sie gehört zu den Menschen, die sich zu helfen wissen«, bemerkte Jeremy.
»Ach ja, ich werde nie vergessen, wie sie sich Clarissas annahm.«
»Auch ich nicht«, stimmte Jeremy zu.
Dann wurde Damaris wieder schwanger und war sehr glücklich darüber. »Diesmal«, meinte sie, »werde ich sehr vorsichtig sein.«
Der Doktor verordnete ihr viel Bettruhe und erinnerte sie daran, daß ihre Gesundheit seit dem schweren Fieber, unter dem sie vor einigen Jahren gelitten hatte, geschwächt war. Eine Schwangerschaft war selbst für eine gesunde Frau sehr anstrengend.
Damaris und Jeremy strahlten vor Glück, denn der Schatten schien aus ihrem Leben zu verschwinden. Ihr Kind war auch für mich überaus wichtig, denn es würde mich von meiner Verantwortung ihnen gegenüber befreien. Es war merkwürdig, daß ich mich für sie verantwortlich fühlte, aber ich wußte jetzt, daß die Reise nach Frankreich zu einer neuen Beziehung zwischen ihnen geführt hatte. Ich war froh darüber, daß ich eine so positive Rolle in ihrem Leben gespielt hatte, aber sie belastete mich auch mit einer gewissen Verantwortung. Und jetzt kam auch noch Benjie dazu, den ich, allerdings unwissentlich, verlassen und ihm damit seine Tochter genommen hatte.
Weihnachten stand bevor. Arabella bestand darauf, daß wir alle, auch Benjie, zur Weihnachtsfeier nach Eversleigh Court kamen.
Damaris meinte, wir müßten uns besonders um Benjie bemühen, denn zu Weihnachten war die Erinnerung an die Verstorbenen besonders schmerzlich. Meinem Gefühl nach gaben sich alle ein bißchen zu fröhlich; sie taten so, als wäre es ein Weihnachtsfest wie alle anderen.
Anita und ich sammelten im Wald Stechpalmen, Efeu und Mistelzweige, und Smith brachte das Weihnachtsscheit. Arabella bestand darauf, daß wir alle bis Dreikönigsabend blieben, auch wenn wir es nicht weit nach Hause hatten.
Obwohl wir den Weihnachtsabend nicht in Enderby Hall verbringen würden, hatten wir das Haus geschmückt. Ich hörte, wie ein Dienstmädchen sagte: »Ich möchte wissen, was die Gespenster davon halten werden.«
»Es wird ihnen nicht gefallen«, prophezeite ein anderes.
Sie glaubten anscheinend fest daran, daß ein böser Geist in Enderby sein Unwesen trieb.
»Es ist eine Schande, daß wir nicht hierbleiben«, sagte ich zu Damaris. »Es sieht zu hübsch aus.«
»Deine Urgroßmutter will nichts davon wissen. Um so schöner wird es sein, in das geschmückte Haus zurückzukommen, und außerdem bleibt Smith hier, der es ja auch weihnachtlich haben soll.«
»Smith und Damon. Ich werde am Christtag hinüberreiten und ihnen ihre Geschenke bringen.«
»Das ist lieb von dir.«
Ich wies darauf hin, daß ich es aus Eigennutz tun wollte, weil ich bestimmt Sehnsucht nach den beiden haben würde. Außerdem befürchtete ich, daß die Stimmung in Eversleigh ohne Harriet und Gregory gedrückt sein würde.
Damaris verscheuchte die trüben Gedanken, indem sie mir durch das Haar fuhr und sagte: »Stell dir nur vor, beim nächsten Weihnachtsfest wird mein Kind schon dabeisein. Ich kann den April kaum mehr erwarten.«
»Ich hoffe, daß es ein Mädchen wird, ich wünsche es mir so sehr.«
»Aber Jeremy möchte einen Jungen.«
»Männer wollen immer Jungen, wahrscheinlich haben sie das Gefühl, in ihren Söhnen wiedergeboren zu werden.« Wir fuhren also nach Eversleigh und feierten Weihnachten. Benjie traf am Abend ein und freute sich sehr über das Wiedersehen mit mir.
In der Weihnachtsnacht gingen wir wie immer um Mitternacht zur Mette in die Kirche von Eversleigh. Für mich war das stets der schönste Teil von Weihnachten gewesen – wenn wir die Weihnachtshymne und -lieder sangen und dann über die Felder nach Eversleigh Court gingen, wo uns heiße Suppe, Toast, Glühwein und Rosinenkuchen erwarteten. Wir sprachen über den Gottesdienst, verglichen ihn mit dem vom Vorjahr und waren fröhlich und hellwach. In den vergangenen Jahren hatten wir auch über Harriets Scharaden gesprochen, denn sie hatte sie arrangiert und die Rollen verteilt.
In den Schlafzimmern brannten in den Kaminen lodernde Feuer, und die Dienstmädchen hatten Wärmepfannen unter die Bettdecken geschoben. Anita und ich teilten uns in ein Zimmer, was uns nicht im geringsten störte. Als wir nach der Mitternachtsmesse endlich schlafen gingen, lagen wir noch lange wach und plauderten. Anita erzählte mir von den Weihnachtsabenden im Pfarrhaus mit einer alten Tante, die bei ihnen wohnte, und wie sie mit allem knausern mußten. Als ihr Vater starb, war sie bei der Vorstellung entsetzt, daß sie jetzt allein bei der alten Tante bleiben sollte, und hatte deshalb versucht, eine Anstellung zu finden, um sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.
»Du wirst bei uns immer ein Zuhause haben, Anita«, sagte ich.