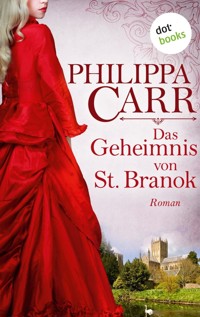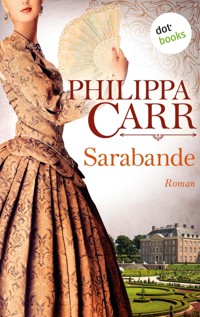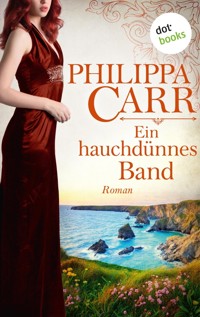Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Töchter Englands
- Sprache: Deutsch
Gefährliche Zeiten und unerwartetes Glück: Der historische Schicksalsroman "Der springende Löwe" von Philippa Carr jetzt als eBook bei dotbooks. Zwischen Machtanspruch und Liebe … Als Elisabeth I. den Thron besteigt, ziehen dunkle Wolken über England auf: Wird es wirklich zum Krieg mit Spanien kommen? In einer Zeit, in der es keine Sicherheit zu geben scheint, findet sich auch die schöne Catherine in einer ausweglosen Situation wieder: Sie war so unvorsichtig, die Aufmerksamkeit des ebenso attraktiven wie berüchtigten Kapitäns Jack Pennlyon zu erregen – und wird gezwungen, sich mit ihm zu verloben. Doch Catherines Schicksal nimmt eine ungeahnte Wendung, als sie eines Nachts von Spaniern entführt wird, die so Rache an Pennlyon nehmen wollen. Vor Catherine liegen ungeahnte Gefahren … und das Abenteuer ihres Lebens! Fesselnd und romantisch – ein Roman aus der international erfolgreichen Saga "Die Töchter Englands": Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Der springende Löwe" von Philippa Carr, auch bekannt als Jean Plaidy und Victoria Holt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Zwischen Machtanspruch und Liebe … Als Elisabeth I. den Thron besteigt, ziehen dunkle Wolken über England auf: Wird es wirklich zum Krieg mit Spanien kommen? In einer Zeit, in der es keine Sicherheit zu geben scheint, findet sich auch die schöne Catherine in einer ausweglosen Situation wieder: Sie war so unvorsichtig, die Aufmerksamkeit des ebenso attraktiven wie berüchtigten Kapitäns Jack Pennlyon zu erregen – und wird gezwungen, sich mit ihm zu verloben. Doch Catherines Schicksal nimmt eine ungeahnte Wendung, als sie eines Nachts von Spaniern entführt wird, die so Rache an Pennlyon nehmen wollen. Vor Catherine liegen ungeahnte Gefahren … und das Abenteuer ihres Lebens!
Fesselnd und romantisch – ein Roman aus der international erfolgreichen Saga »Die Töchter Englands«: Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen.
Über die Autorin:
Philippa Carr ist – wie auch Jean Plaidy und Victoria Holt – ein Pseudonym der britischen Autorin Eleanor Alice Burford (1906–1993). Schon in ihrer Jugend begann sie, sich für Geschichte zu begeistern: »Ich besuchte Hampton Court Palace mit seiner beeindruckenden Atmosphäre, ging durch dasselbe Tor wie Anne Boleyn und sah die Räume, durch die Katherine Howard gelaufen war. Das hat mich inspiriert, damit begann für mich alles.« 1941 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem in den nächsten 50 Jahren zahlreiche folgten, die sich schon zu ihren Lebzeiten über 90 Millionen Mal verkauften. 1989 wurde Eleanor Alice Burford mit dem »Golden Treasure Award« der Romance Writers of America ausgezeichnet.
Eine Übersicht über den Romanzyklus »Die Töchter Englands« finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2017
Copyright © der Originalausgabe 1974 Philippa Carr
Die Originalausgabe erschien 1974 unter dem Titel »The Lion Triumphant«.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1980 by Franz Schneekluth Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von shutterstock/faestock und eines Gemäldes von Tar Hjeida: »Battle of Scheveningen«
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-95824-980-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der springende Löwe« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Philippa Carr
Der springende Löwe
Roman
Aus dem Englischen von Erika Remberg
dotbooks.
Kapitel 1 Die spanische Galeone
Aus meinem Turmfenster konnte ich beobachten, wie die Schiffe in den Hafen von Plymouth hereingesegelt kamen. Manchmal stand ich nachts auf, denn der Anblick eines stattlichen Schiffes im Mondlicht munterte mich auf. Oft, wenn es dunkel war, hielt ich Ausschau nach Lichtern auf dem Meer; solche Lichter sagten mir, dort draußen ist ein Schiff, und ich fragte mich, was für eines es wohl sein könnte. Eine schnittige Karavelle, eine kriegerische Galeere, ein Preimastschoner oder eine stattliche Galeone? Mit dieser Frage ging ich wieder zu Bett und stellte mir die Männer auf diesem Schiff vor, und für eine Weile vergaß ich dann die Trauer um Carey und meine verlorene Liebe.
Wenn ich morgens aufwachte, galt mein erster Gedanke nicht Carey (obwohl ich es mir vor kurzer Zeit noch gelobt hatte, jeden Augenblick des Tages an ihn zu denken), sondern den Matrosen, die am Tag in den Hafen kommen würden.
Oft ging ich allein zum Hafen – obwohl ich das nicht sollte. Es galt als nicht schicklich für eine junge Dame von siebzehn Jahren, sich an einen Ort zu begeben, wo sie von rauhen Seeleuten angerempelt werden konnte. Wenn ich trotzdem darauf bestand, mußte ich eines der zwei Dienstmädchen mitnehmen. Ich habe mich nie demütig der entsprechenden Autorität gebeugt, aber ich konnte ihnen auch nicht begreiflich machen, daß es mir nur gelang, den Zauber des Hafens einzufangen, wenn ich allein war. Wenn Jennet oder Susan mitgingen, machten sie den Matrosen schöne Augen und kicherten und erinnerten einander daran, was einer ihrer Freundinnen einmal zugestoßen war, als sie einem Matrosen vertraut hatte.
Wann immer ich also Gelegenheit fand, schlich ich mich allein hinunter zum Hafen, ›on the Hoe‹, wie wir sagten, um mein Schiff für die Träume der Nacht zu entdecken.
Ich sah Männer, deren Haut mahagonifarben verbrannt war, deren glänzende Augen die Mädchen und ihre Reize abschätzten – und ihre Bereitwilligkeit, denn der Aufenthalt eines Matrosen an Land ist nur kurz, und er hat zu wenig Zeit, sie auf Freiersfüßen zu vergeuden. Ihre Gesichter waren verschieden von denen der Männer, die nicht zur See fuhren. Vielleicht war das Exotische, das sie erlebt hatten, dafür die Ursache, die Entbehrungen, die sie erlitten, oder ihre Ergebenheit, ihre Anbetung, Angst und ihr Haß dieser andersartigen Geliebten gegenüber, der schönen, wilden, unbezähmbaren See.
Ich liebte es zuzusehen, wenn die Schiffsvorräte verladen wurden – Säcke voll Mehl, gesalzenem Fleisch und Bohnen. Ich malte mir aus, wohin die Schiffsladungen mit Leinen- und Baumwollballen wohl gehen würden. Alles war erregend und in Bewegung. Dies war vielleicht kein Ort für eine junge, vornehm erzogene Dame, aber es war unwiderstehlich dort.
Es schien unvermeidlich, daß eines Tages, früher oder später, etwas Aufregendes geschehen mußte. Und so war es auch. Es war ›on the Hoe‹, wo ich zum erstenmal Jake Pennlyon sah.
Jake war groß, breitschultrig und stark und schien unbesiegbar. Das fiel mir sofort auf. Er war braun gebrannt, und obwohl er erst ungefähr fünfundzwanzig Jahre zählte, als ich ihn zum erstenmal sah, fuhr er doch bereits acht Jahre zur See; und er befehligte bereits sein eigenes Schiff, daher dieses Flair von Autorität. Ich bemerkte, wie die Augen der Frauen bei seinem Anblick zu glänzen begannen. Ich verglich ihn – wie alle Männer – mit Carey, und im Vergleich zu ihm war er grob, mangelte es ihm an Lebensart.
Natürlich wußte ich im ersten Moment nicht, wer er war, aber ich wußte, er war jemand von Bedeutung. Männer hoben ihre Hand zum Gruß an die Stirn, ein oder zwei Mädchen machten sogar einen Knicks. Jemand rief: »Einen schönen guten Tag, Kapitän Lyon!«
Der Name paßte irgendwie zu ihm. Die Sonne verlieh seinem dunkelblonden Haar einen lohfarbenen Schimmer. Er schwankte leicht, wie Seeleute es gerne tun, wenn sie gerade erst an Land gekommen sind, so als hätten sie sich noch nicht an die Standfestigkeit dort gewöhnt, als rollten sie noch mit dem Schiff. Lyon, der König der wilden Tiere, dachte ich.
Und plötzlich bemerkte ich, daß er mich angesehen hatte, denn er blieb stehen. Es war ein seltsamer Augenblick. Mir war, als hätte sich der Hafenlärm für einen Moment gelegt. Die Männer am Schiff mußten aufgehört haben zu arbeiten, die Matrosen und die beiden Mädchen, mit denen Jake gesprochen hatte, schienen mich und nicht einander anzusehen, und sogar der Papagei, den ein grinsender alter Seemann einem in Barchent gekleideten Bauern zu verkaufen versuchte, hörte auf zu kreischen.
»Guten Morgen, Mistreß«, sagte Jake Pennlyon und verbeugte sich. Seine übertriebene Servilität verriet Spott.
Ich war bestürzt. Natürlich mußte er denken, da ich allein hier war, daß er mich ansprechen dürfte. Junge Damen aus guter Familie standen an solchen Orten nicht einfach herum, und wenn sie es doch taten, erwarteten sie eben, mit einem liebeshungrigen Seemann handelseinig zu werden.
War es nicht aus eben diesem Grunde, daß ich mich nicht allein hier herumtreiben sollte?
Ich tat so, als hätte ich nicht bemerkt, daß er mich angesprochen hatte. Ich starrte an ihm vorbei auf das Schiff und auf die kleinen Boote, die darum herumwimmelten. Leider war mir die Röte in die Wangen gestiegen, er mußte also ahnen, daß er mich beunruhigte.
»Ich glaube, wir sind uns noch nie begegnet«, sagte er. »Ihr wart nicht hier vor zwei Jahren.«
Irgend etwas war an ihm, das es mir unmöglich machte, ihn zu ignorieren. »Ich bin erst seit wenigen Wochen hier.«
»Ach, Ihr seid nicht in Devon geboren?«
»Nein«, antwortete ich.
»Ich habe es gewußt. So eine hübsche junge Dame kann unmöglich in der Gegend sein, ohne daß ich sie aufgespürt hätte.«
»Ihr sprecht so, als wäre ich ein Wild, das es zu jagen gilt.«
Seine blauen Augen blickten durch mich hindurch. Sie schienen mehr von mir zu sehen, als mir angenehm war. Es waren die bemerkenswertesten blauen Augen, die ich je gesehen hatte – und später jemals sehen würde. Jahre auf dem Meer könnten ihnen dieses tiefe Blau gegeben haben. Ihr Blick war scharf, klug, auf eine gewisse Art attraktiv – und doch abstoßend. Er dachte ganz offensichtlich, ich sei irgendeine Dienstmagd, die hergekommen war, weil ein Schiff im Hafen lag, und die auf der Suche nach einem Matrosen war. »Ich glaube, Ihr irrt Euch, Sir«, antwortete ich kühl. »Also, das ist etwas, was mir selten passiert«, antwortete er. »Auch wenn ich manchmal unbesonnen bin, ist mein Urteil doch unfehlbar, wenn es darum geht, mir meine Freunde auszusuchen.«
»Ich wiederhole, Ihr irrt Euch, wenn Ihr glaubt, Ihr könntet mich ansprechen«, sagte ich. »Und jetzt muß ich gehen.«
»Dürfte ich Euch vielleicht begleiten?«
»Ich habe es nicht weit, nur bis Trewynd Grange.«
Ich forschte nach wenigstens einem Schimmer von Beunruhigung bei ihm, denn man konnte nicht jemanden, der dort zu Gast war, ungestraft ansprechen, das mußte er wissen.
»Ich werde Euch einmal besuchen, zu einem Zeitpunkt, der Euch genehm ist.«
»Ich hoffe, Ihr wartet, bis Ihr dazu aufgefordert werdet.« Wieder verbeugte er sich.
»In diesem Fall werdet Ihr sehr lange zu warten haben«, sagte ich und wandte mich ab.
Ich hatte keine große Lust zu gehen, aber er hatte etwas so Gefährliches an sich. Ich hielt ihn jeder Unverschämtheit für fähig. Er wirkte auf mich wie ein Pirat, aber viele Matrosen wirkten so.
Eilig kehrte ich zum Gutshof zurück. Zuerst hatte ich einerseits Angst, er könnte mir folgen, und war andererseits ein bißchen enttäuscht, daß er es nicht tat. Ich ging direkt hinauf in den Turm, in dem ich mein Zimmer hatte, und sah hinaus. Das Schiff – sein Schiff – war deutlich auf dem ruhigen, stillen Wasser auszumachen. Es mußte an die siebenhundert Tonnen haben, mit hochragenden Vor- und Achtermasten. Auch hatte es ganze Batterien von Geschützen an Bord. Es war kein Kriegsschiff, aber ausgestattet, um sich verteidigen und vielleicht sogar andere angreifen zu können. Es war ein stolzes Schiff und es hatte Würde. Daß es sein Schiff war, das fühlte ich einfach.
Bevor dieses Schiff nicht ausgelaufen war, würde ich den Hafen nicht mehr betreten. Das nahm ich mir vor, und jeden Tag hielt ich Ausschau, und jeden Morgen, wenn ich aufwachte, hoffte ich, daß es abgefahren sein würde.
Dann dachte ich an Carey – Carey, der so jung war, nur zwei Jahre älter als ich selbst, an meinen lieben Carey, mit dem ich so viel gestritten hatte als Kind, bis zu dem wundervollen Tag, als das Bewußtsein, daß wir uns liebten, über uns zusammenbrach. In einem solchen Augenblick übermannte mich der Schmerz, ich durchlebte alles noch einmal: den unerklärlichen Zorn seiner Mutter – eine Kusine meiner Mutter –, als sie erklärte, nichts könnte sie dazu bringen, einer Ehe zwischen Carey und mir zuzustimmen. Und meine eigene Mutter, die erst nicht verstanden hatte, bis sie mich an jenem entsetzlichen Tag in die Arme nahm, mit mir weinte und mir dann erklärte, daß Kinder für die Sünden der Väter bestraft würden und mein Traum von einem Leben mit Carey zu Ende sein müsse.
Warum kam mir das alles so lebhaft ins Gedächtnis? Nur weil ich im Hafen einen unverschämten Seemann kennengelernt hatte?
Ich muß erst einmal erklären, wie ich überhaupt nach Plymouth gekommen bin – an die südwestlichste Ecke von England – wo mein Zuhause doch im Südosten lag, nur wenige Meilen außerhalb von London.
Ich wurde in St. Brunos Abbey geboren, einem ziemlich seltsamen Ort, und wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, kann ich nur sagen, auch die waren recht seltsam. Ich war fröhlich, sorglos, überhaupt nicht wie Honey, die ich immer für meine Schwester gehalten hatte. Wir lebten während unserer Kindheit in einem Mönchskloster, das kein Mönchskloster mehr war, mit einer Spur von Mystizismus um uns herum. Daß wir davon nichts merkten, hatten wir meiner Mutter zu verdanken, die normal war, heiter und tröstlich – so wie eine Mutter sein sollte. Sollten wir einmal Kinder haben, hatte ich zu Carey gesagt, wollte ich zu ihnen sein wie meine Mutter zu mir.
Aber als ich älter wurde, bemerkte ich die Spannung, die zwischen meinen Eltern bestand. Ich glaube, manchmal haben sie sich sogar gehaßt. Ich fühlte, daß Mutter sich einen Mann wünschte, der lieb und ordentlich war, wie Careys Onkel Rupert, der nie geheiratet hat und den ich in Verdacht hatte, daß er sie liebte. Was meinen Vater anbelangt, so habe ich ihn nie verstanden. Dafür, daß er meine Mutter möglicherweise haßte, gab es auch einen Grund, den ich aber nicht verstand. Vielleicht war es so, daß er sich schuldig fühlte. Wir hatten es nicht einfach zu Hause, aber das wurde mir nicht so bewußt wie Honey. Honeys Gefühlsleben war weniger kompliziert als das meine. Sie war eifersüchtig auf mich, weil sie glaubte, Mutter liebte mich mehr als sie, was natürlich gewesen wäre, denn ich war ihr eigenes Kind. Honey liebte meine Mutter besitzergreifend. Sie wollte sie mit niemandem teilen. Und sie haßte meinen Vater. Sie wußte genau, zu wem sie sich hingezogen fühlte. Für mich war das nicht so leicht. Ich fragte mich, ob sie ihren Mann Edward jetzt genauso besitzergreifend liebte wie damals meine Mutter. Vielleicht war es aber anders mit einem Ehemann. Ich wäre genauso darauf aus gewesen, alle Liebe und alle Gedanken Careys auf mich zu ziehen, davon bin ich überzeugt.
Honey hatte eine gute Partie gemacht – zu jedermanns Erstaunen, wenn auch alle bereit waren zuzugeben, daß sie so ungefähr das schönste Geschöpf gewesen war, das sie je gesehen hatten. Im Vergleich mit ihr war ich mir immer unscheinbar vorgekommen. Honey hatte wunderschöne dunkelblaue, fast violette Augen. Die langen, dichten Wimpern machten sie aufsehenerregend. Auch ihr Haar war schwarz, lockig und voller Leben. Wo immer sie hinging, erregte sie Aufmerksamkeit. Neben ihr kam ich mir also unbedeutend vor. Dennoch, wenn sie nicht da war, fand auch ich mich ziemlich attraktiv mit meinem mittelbraunen Haar und meinen grünen Augen, die, wie meine Mutter zu sagen pflegte, zu meinem Namen paßten. »Du bist wirklich wie eine kleine Katze, Cat«, sagte sie gern, »mit deinen grünen Augen und deinem herzförmigen Gesicht.« In ihren Augen war ich genauso schön wie Honey, das wußte ich; aber sie war eben eine Mutter, die ihr Kind mit liebenden Augen sah. Wie auch immer, Edward Ennis, Sohn und Erbe von Lord Calperton, hatte sich in Honey verliebt und heiratete sie, als sie siebzehn Jahre alt war, was gleichzeitig ihren Eintritt in die Gesellschaft bedeutete. Honey hatte triumphierend erreicht, was viele Mädchen, die ebenfalls reich gesegnet waren mit weltlichen Gütern, trotzdem nicht erreichten.
Die Freude meiner Mutter war groß. Sie hatte, glaube ich, gefürchtet, es könnte schwierig werden, einen Ehemann für Honey zu finden, und Lord Calperton würde alle möglichen Einwände vorbringen, aber Careys Mutter, die ich Tante Kate nannte, hatte alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Sie war von der Art Frauen, die für gewöhnlich bekamen, was sie sich in den Kopf gesetzt hatten, denn obwohl sie bereits siebenunddreißig Jahre gewesen sein mußte, hatte sie großen Charme besessen, und die Männer verliebten sich Hals über Kopf in sie. Lord Calperton war da keine Ausnahme.
Im November des glorreichen Jahres 1558 starb unsere alte Königin, und überall herrschte große Freude. Jetzt hatte England wieder neue Hoffnung. Wir hatten lange genug unter der Regierung der blutdürstigen Mary gelitten. Weil das Kloster nicht weit vom Fluß und nur eine Meile von der Hauptstadt entfernt lag, zog der Rauch aus den Kaminen von Smithfield wie ein Leichentuch zu uns her, wenn der Wind aus dieser Ecke wehte. Meine Mutter pflegte sich krank zu fühlen, wenn sie ihn wahrnahm, schloß die Fenster und weigerte sich, das Haus zu verlassen.
Wenn sich der Rauch verzogen hatte, ging meine Mutter in den Garten und pflückte Blumen, Früchte oder Kräuter, je nach Jahreszeit, und schickte mich damit hinüber zu Großmutters Haus, das an das Kloster grenzte.
Der Stiefvater meiner Mutter war unter Queen Mary als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, deshalb wirkte der Rauch von Smithfield auch so besonders schmerzvoll auf uns. Aber ich glaube nicht, daß meine Großmutter immer noch so darunter litt, wie meine Mutter annahm. Sie war immer sehr interessiert gewesen an den Dingen, die ich brachte, und rief jedesmal Peter und Paul zu meiner Unterhaltung herein. Peter und Paul waren Zwillinge und ein Jahr älter als ich; aber sie waren die Halbbrüder meiner Mutter und damit meine Onkel. Wir waren eine komplizierte Familie. Es war seltsam, Onkels zu haben, die nur ein Jahr älter waren als man selbst, deshalb haben wir dieses Verwandtschaftsverhältnis nie wirklich ernst genommen. Ich mochte sie aber beide. Die beiden Zwillinge sahen sich so ähnlich, daß nur wenige sie auseinanderzuhalten vermochten, und sie waren unzertrennlich. Peter wollte zur See gehen, und da Paul ihm in allem nacheiferte, trug auch er sich mit der Absicht, zur See zu gehen.
Immer wenn Tante Kate uns im Kloster besuchte, ging ich in mein Zimmer, schloß mich ein und blieb da, bis meine Mutter kam und mich überredete, hinunterzukommen. Und nur ihr zuliebe tat ich ihr den Gefallen. Ich saß dort sonst am Fenster und schaute auf die alte Klosterkirche und auf den Schlaftrakt der Mönche, den Mutter immer in einen Speisesaal umfunktionieren wollte. Ich erinnerte mich daran, wie Honey mir erzählt hatte, daß, wenn man in die Stille der Nacht hineinlauschte, man das Singen der Mönche hören könnte, die hier vor langer Zeit gelebt hatten, und die Schreie derer, die gefoltert und am Tor aufgehängt worden waren, als die Männer von King Henry kamen, um das Kloster aufzulösen.
Sie erzählte mir solche Schauergeschichten, um mir Angst einzujagen, weil nur ich die Tochter meiner Mutter war. Als es damit anfing, daß ich gewisse Gerüchte über Honey zu hören bekam, rächte ich mich dafür: »Du bist ein Bastard. Deine Mutter war eine Dienstmagd und dein Vater einer der Mörder der Mönche.« Das war grausam von mir, denn es regte Honey mehr auf als irgend etwas sonst. Nicht daß es ihr soviel ausmachte, ein Bastard zu sein, aber daß sie nicht das Kind meiner Mutter war. Zu diesem Zeitpunkt war ihre erste besitzergreifende Liebe noch auf meine Mutter gerichtet gewesen.
Von Natur aus war ich aufbrausend, machte die verletzendsten Bemerkungen, die ich mir ausdenken konnte, nur um mich gleich darauf selbst zu hassen und alles zu versuchen, meine Grausamkeit wieder gutzumachen. Zum Beispiel sagte ich einmal zu Honey: »Es ist doch nur eine Geschichte. Sie ist gar nicht wahr. Und auf jeden Fall bist du so schön, daß es ganz egal wäre, wenn dein Vater der Satan persönlich wäre. Die Leute würden dich doch liebhaben.« Honey vergab nicht so leicht. Sie konnte tagelang über eine Beleidigung brüten. Sie wußte, daß ihre Mutter eine Dienstmagd gewesen und daß ihre Großmutter als Hexe verschrien worden war. Das letztere machte ihr nichts aus. Eine Hexe als Großmutter zu haben, gab ihr eine ganz spezielle Macht. Immer schon hatte sie sich auch für Kräuter und ihre Verwendungsmöglichkeiten interessiert.
Honey kam zur Zeit der Krönung in unser Kloster. Als ich meine Mutter fragte, ob auch mein Vater rechtzeitig da sein würde, verzog sich ihr Gesicht zu einer Maske. Es war unmöglich zu erraten, was sie fühlte.
»Er wird nicht zurück sein.«
»Du scheinst dir sehr sicher zu sein«, antwortete ich.
»Ja«, sagte sie fest, »das bin ich.«
Wir gingen nach London, um den Einzug der Königin in ihre Hauptstadt zu erleben und wie sie den Tower in ihren Besitz nahm. Es war aufregend, sie in ihrer Kutsche zu sehen, und Robert Dudley, einen der bestaussehenden Männer, die ich je gesehen hatte, wie er an ihrer Seite ritt. Er war ihr Stallmeister, und wie ich hörte, hatten sie sich kennengelernt, als sie beide unter der Regierung Marys, der Schwester der Königin, im Tower Gefangene waren.
Es war aufregend, die Kanonen vom Tower dröhnen zu hören und den begeisterten Begrüßungsrufen zu lauschen, die der jungen Königin auf ihrer Fahrt aus der Menge zugerufen wurden. Wir hatten uns in der Nähe des Towers aufgestellt und konnten sie ganz genau sehen, als dort sie hineinfuhr.
Sie war jung – ungefähr fünfundzwanzig Jahre alt, mit frischen roten Wangen und rötlichem Haar. Sie sprühte vor Vitalität, und doch war ein großer Ernst um sie, der ihr gut stand und dessentwegen sie von den Leuten sehr bewundert wurde.
Wir waren alle sehr ergriffen, als wir sie sprechen hörten, kurz bevor sie den Tower betrat.
›In diesem Land sind einige von uns zu Gefangenen geworden. Ich habe mich vom Gefangenen zum Prinzen erhoben. Jener Sturz war die Folge eines göttlichen Urteils; dieser Aufstieg das Ergebnis göttlicher Gnade; das Warten auf den Sturz verlangte Geduld, und für den Aufstieg muß ich mich Gott dankbar und den Menschen gnädig erweisen.‹
Das war eine Rede voll Weisheit, Bescheidenheit und Entschiedenheit, und sie wurde von allen, die sie gehört hatten, laut beklatscht.
Als wir zum Kloster zurückritten, wurde ich nachdenklich. Ich dachte an die Queen Elizabeth, die nicht viel älter war als ich und jetzt eine große Verantwortung trug. Etwas an ihr faszinierte mich, und mir fiel ihre Bemerkung über die Gefangenschaft ein, die sie erlitten hatte, und wie gnädig Gott gewesen war, als er sie aus ihrem Kummer zur Größe führte. Ich stellte sie mir als Gefangene vor, die den Tower durch die Armesünderpforte betrat, und wie oft sie sich wohl gefragt haben mußte, wann man sie – wie ihre Mutter – in den Hof hinausbringen und ihr befehlen würde, den Kopf auf den Richtblock zu legen. Wie fühlt sich wohl so ein junger Mensch, wenn der Tod ihm ins Auge blickt? Hatte sich diese junge Frau bei dem Gedanken, ihr Leben zu verlieren, genauso elend gefühlt wie ich, als ich Carey verlor?
Aber sie hat ihre Schwierigkeiten überwunden. Gott war gnädig gewesen. Sie war hinausgegangen aus dem großen Schatten des Towers, um als Herrin über alles und jeden in diesem Land zurückzukommen.
Dem Einzug der neuen Königin in ihre Hauptstadt beizuwohnen hatte meine Lebensgeister wachgerüttelt.
Beim Abendessen lauschte ich den Gesprächen, die natürlich Kate anführte. Sie tut dies glänzend, und obwohl ich sie haßte, mußte ich ihren unleugbaren Charme anerkennen. Sie war der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit an unserem Tisch. Sie unterhielt sich darüber, daß man nicht sicher sein könnte, was das neue Regime mit sich bringen würde, und was lauschende Dienstboten vom Hofe wohl zu erzählen hätten. Sie hatten ja auch unter der Regierung von Queen Mary geplaudert. Warum, dachten wir, sollte unter Elisabeth alles anders werden.
»Sie hat den Thron also geschafft«, sagte Kate. »Die Tochter von Anna Boleyn! Ihr müßt zugeben, sie sieht ihrem königlichen Vater ähnlich. Dasselbe wilde Temperament, die gleiche Haarfarbe. Ich habe einmal mit Seiner Königlichen Hoheit getanzt, und ich bin davon überzeugt, wenn er damals nicht in die Reize der Katherine Howard verstrickt gewesen wäre, hätte er sicher sein Auge auf mich geworfen. Wie anders wäre dann alles geworden!«
»Dein Kopf würde dir vielleicht nicht mehr auf den Schultern sitzen, Kate«, sagte meine Mutter. »Wir haben dich lieber in einem Stück.«
»Ich habe schon immer Glück gehabt. Arme Katherine Howard! Es war ihr Kopf, nicht meiner. Wie sich dieser Mann doch immer seiner Frauen entledigt hat!«
»Du hast eine lose Zunge, Kate«, sagte ihr Bruder Rupert. Kate dämpfte ihre Stimme und meinte verschwörerisch: »Wir dürfen nicht vergessen, daß es sich um Harrys Tochter handelt – Harrys und Anna Boleyns, was für eine Kombination!«
»Auch unsere letzte Königin war seine Tochter«, ließ sich Kates Sohn Nicholas vernehmen, den wir Colas nannten.
»Ja, aber das einzige, was zählt, ist, daß eine davon eine gute Katholikin ist«, antwortete Kate.
Meine Mutter versuchte das Thema zu wechseln und bat meine Großmutter um einige Kräuter, die sie benötigte. Großmutter war sehr bewandert bezüglich allem, was in der Natur wuchs, und sie und meine Mutter steckten bald tief in einer Diskussion über den Garten. Aber Kates Stimme war lauter. Sie sprach weiter über die Gefahren, die die neue Königin überstanden hatte, darüber, daß ihre Zukunft in großer Gefahr gewesen sei, als ihre Mutter zum Schafott ging, darüber, daß sie als illegitim erklärt worden war und daß sie nach dem Tod von Jane Seymour von den letzten drei Frauen des Königs freundlich aufgenommen und nach dem Tod des Königs mit Katharina Parr in Dewer House gelebt hatte.
»Und ich glaube«, sagte Kate boshaft, »es wäre nicht sehr klug, darüber zu diskutieren, was dort passiert ist. Der arme Thomas Seymour! Ich habe ihn einmal kennengelernt. Was für ein faszinierender Mann! Kein Wunder, daß unsere kleine Prinzessin … aber das ist natürlich Klatsch. Natürlich hat sie ihm nie wirklich gestattet, ihr Schlafzimmer zu betreten. Alles nur Klatsch, daß die Prinzessin von einem Kind entbunden worden sei. Wer würde denn solchen Unsinn glauben … noch dazu heute. Diejenigen, die solch üble Geschichten in Umlauf gebracht haben, sollte man aufhängen, rädern und vierteilen. Diese Geschichten heute zu wiederholen, wäre Hochverrat. Stellt euch einmal vor, als man ihr die Neuigkeit überbracht hat, daß er auf dem Richtblock gestorben sei, hat sie gesagt: ›Heute starb ein Mann mit viel Witz und wenig Scharfsinn.‹ Und sie sagte es ganz ruhig, so als wäre er nur ein Bekannter gewesen. Als ob zwischen diesen beiden nie eine tiefere Beziehung hätte bestehen können!«
Kate lachte, und ihre Augen strahlten. »Ich frage mich nur, wie es jetzt bei Hofe zugehen wird. Fröhlicher als unter Mary, soviel ist sicher. Unsere gnädige Dame wird eifrigst bestrebt sein, Gott, ihrem Volk und ihrem Schicksal ihre Dankbarkeit zu beweisen, für diesen großen Tag aufbewahrt worden zu sein. Sie wird fröhlich sein wollen. Sie wird die Schrecken der Vergangenheit vergessen wollen. Du lieber Gott, wenn man bedenkt: Nach der Wyatt-Rebellion war sie dem Schafott so nahe, wie ich euch jetzt bin.«
»Jetzt ist alles vorbei«, sagte meine Mutter.
»Der Vergangenheit entkommt man nicht, Damascina«, widersprach ihr Kate. »Sie ist immer präsent, wie der Schatten hinter uns.«
Ja, deine jämmerlichen Sünden haben einen Schatten auf mein Leben geworfen, aber du drehst dich nicht um und siehst hinter dich, scherst dich nicht darum, dachte ich verbittert.
»Übrigens, habt ihr Sir Robert an ihrer Seite gesehen?« fuhr Kate fort. »Man sagt, sie ist vernarrt in ihn.«
»Klatsch wird es immer geben«, antwortete Rupert.
»Er ist rasch in den Sattel gesprungen«, lachte Kate. »Aber was sonst kann man von einem Sohn von Lord Northumberland erwarten?«
Mit wachsender Entrüstung beobachtete ich Tante Kate. Wie taktlos sie doch war, wie frivol! Sie könnte Schwierigkeiten über unser Haus bringen mit ihrem sorglosen Gerede. Alles, was sie sagte, erinnerte mich an meine eigene Tragödie.
Als Kate und Colas nach Remus Castle aufbrachen, fühlte ich mich besser – natürlich nicht glücklich, aber erleichtert, weil Kate endlich weg war.
Es war November, und im Garten gab es wenig zu tun. Ich war lustlos. Unser Kloster war ein trostloser Ort. Das Haus selbst – gebaut wie ein Schloß, ähnlich Remus, das jetzt Carey gehörte – wurde, seit Vater weg war, langsam zu einem Zuhause. Nur wenn man hinausschaute und die Außengebäude sah, das Refektorium, den Schlaftrakt und die Fischteiche, wirkte es so gespenstisch.
Das Interesse meiner Mutter war jetzt allein auf mich konzentriert. Ihr größter Wunsch war, mein Elend zu beenden und meinem Leben einen neuen Sinn zu geben. Ihr zu Gefallen tat ich so, als hätte ich die Geschichte so gut wie überwunden, aber sie liebte mich zu sehr, um sich täuschen zu lassen. Sie versuchte, mein Interesse am Gebrauch von Kräutern zu erwecken, an allem, was sie selbst von ihrer Mutter gelernt hatte, an Stickereien und Wandteppichen. Und als sie merkte, daß mich diese Dinge nicht interessierten, beschloß sie, mir von ihren eigenen Ängsten und Nöten zu erzählen, was die größte Hilfe war, die sie mir angedeihen lassen konnte.
Ich war in meinem Zimmer, als sie mit ernstem Gesicht hereinkam. Erschreckt stand ich auf, und sie sagte: »Bleib doch sitzen, Cat. Ich bin gekommen, um mit dir zu sprechen.«
Also setzte ich mich wieder, und sie sagte: »Ich mache mir Sorgen, Cat.«
»Das sehe ich, Mutter. Was quält dich?«
»Die Zukunft … heute habe ich gehört, daß der Bischof von Winchester verhaftet worden ist.«
»Aus welchem Grund?«
»Du kannst dir doch denken, daß die religiösen Konflikte andauern werden. Er unterstützt den Papst. Es ist immer derselbe Kampf. O Gott, und ich hatte so gehofft, daß wir diese bösen Zeiten hinter uns haben.«
»Man sagt, die neue Queen wird tolerant sein.«
»Wenn ihr Thron in Gefahr ist, können Monarchen oft nicht tolerant sein. Sie sind von ehrgeizigen Männern umringt. Es hat viel Unglück in unserer Familie gegeben, Cat. Mein Vater hat seinen Kopf verloren, weil er einem Priester Unterschlupf gewährte, und mein Stiefvater wurde auf dem Smithfield verbrannt, weil er dem reformierten Glauben angehangen hatte. Und du weißt, Edward ist Katholik. Als Honey ihn heiratete, hat sie seinen Glauben angenommen. Das war unter der letzten Regierung noch möglich, aber jetzt haben wir eine neue Königin auf dem Thron.«
»Du machst dir Sorgen um Honey?«
»Mein ganzes Leben lang hat es immer wieder Verfolgungen gegeben. Ich fürchte, das wird so weitergehen. Sobald ich gehört hatte, daß der Bischof von Winchester verhaftet worden ist, mußte ich an Honey denken.«
»Du glaubst, die junge Königin wird anfangen, die Katholiken zu verfolgen?«
»Ich fürchte, ihre Minister werden sie dazu zwingen. Und dann haben wir wieder dieselben alten Ängste und Schrecken.«
Dann redeten wir über Honey und wie glücklich sie verheiratet war, und die Befürchtungen meiner Mutter wurden durch den Gedanken an Honeys Glück besänftigt. Das half ein bißchen.
Es war Weihnachten, und wir feierten in der großen Halle des Klosters. Backgeruch erfüllte das Haus. Es würde ein fröhliches Weihnachtsfest werden, sagte meine Mutter, weil wir nicht nur die Geburt unseres Herrn feierten, sondern auch die Thronbesteigung unserer neuen Königin. Ich glaube, sie dachte, wenn sie so tat, als ob alles wunderbar werden würde, dann würde es auch wunderbar werden.
Mein Vater war jetzt schon so lange weg, daß wir ihn nicht mehr zurückerwarteten. Die meisten unserer Diener waren Mönche und kannten ihn seit Kindheit. Für sie hatte er etwas Mystisches, und sie sprachen nicht über sein Verschwinden. Niemand trauerte um ihn, so als wäre er tot; das haben sie nie getan. Es gab also keinen Grund, warum wir Weihnachten nicht mit allem üblichen Jubel feiern sollten.
Das Fest würde die ganzen zwölf Weihnachtstage andauern. Wie sehr Mutter sich freute, weil Honey und ihr Mann es bei uns verbringen würden!
Sie kamen ein paar Tage vor Weihnachten. Wann immer ich Honey nach längerer Abwesenheit wiedersah, war ich von neuem von ihrer Schönheit gefesselt. Sie stand in der Halle. Es schneite ein wenig, und auf ihrer Pelzmütze glitzerten winzige Schneeflocken. Ihre Wangen waren leicht gerötet, und ihre wunderbaren violetten Augen strahlten.
Ich umarmte sie herzlich. Es gab Monate, da hatten wir uns schrecklich lieb, und jetzt, da sie ihren in sie vernarrten Mann hatte, hatte sie keinen Grund mehr, eifersüchtig auf die Liebe meiner Mutter zu ihrer eigenen Tochter zu sein. In Wirklichkeit hieß sie Honeysuckle – Geißblatt. Ihre Mutter, die sie meiner Mutter anvertraut hatte, soll erzählt haben, daß sie Honeysuckle gerochen hatte, als sie das Kind empfing.
Meine Mutter hatte ihre Ankunft gehört und kam in die Halle geeilt. Honey stürzte sich in ihre Arme. Lange schauten sie sich in die Augen. Ja, Honey liebte sie immer noch leidenschaftlich, sie würde auch immer noch eifersüchtig auf mich sein. Als ob sie das nötig hätte, sie mit ihrer blühenden Schönheit und ihrem verliebten Mann. Und ich hatte Carey für immer verloren.
Edward stand hinter ihr. Bescheiden hielt er sich im Hintergrund; er hatte alle Voraussetzungen, ein guter Ehemann zu werden.
Meine Mutter meinte, sie sollten Honeys altes Zimmer nehmen. Sie wußte, daß das genau ihren Wünschen entsprechen würde, und Honey sagte, ja, das wäre wunderbar. Sie hakte meine Mutter unter, und zusammen schritten sie die Treppe hinauf.
Es wurde für alle ein fröhliches Weihnachtsfest, außer für mich. Manchmal ertappte ich mich allerdings, daß ich mit den anderen sang und tanzte. Kate kam mit Colas, und Rupert kam auch. Und meine Großmutter und die Zwillinge feierten natürlich auch mit uns. Wir verbrachten den ersten Weihnachtstag in Großmutters Haus, das selbst zu Fuß ganz leicht vom Kloster aus zu erreichen war. Sie war ziemlich eingebildet auf ihre Kochkünste und übertraf sich wieder einmal in der Küche. Es gab Spanferkel und Truthahn, große Pasteten und Torten, und alles war mit ihren Spezialkräutern gewürzt, auf die sie so stolz war. Großmutter hat zwei Ehemänner verloren, beide wurden vom Staat ermordet. Aber sie stand da, mitten in der Küche, mit rotem Gesicht, schnaubend und schnurrend, und scheuchte die Küchenmädchen nur so durch die Gegend. Man hätte nie geglaubt, daß es in ihrem Leben irgendeine Tragödie gegeben hätte. Würde ich eines Tages auch so sein? O nein, Großmutter wußte nichts von der Liebe, so wie ich sie erlebt hatte.
Und dann waren da die alten Weihnachtsbräuche. Wir dekorierten die Halle mit Efeu und Stechpalmen, wir verteilten Geschenke an Neujahr, und in der zwölften Nacht fand Colas den Silberpenny im Kuchen und wurde König für eine Nacht. Er wurde von den Männern auf den Schultern umhergetragen und malte zum Schutz gegen alles Böse Kreidekreuze auf die Deckenbalken.
Ich bemerkte, wie meine Mutter ihn beobachtete, und nahm an, daß sie an Honeys Katholizismus und an mein Unglück wegen Carey dachte. Im geheimen betete sie für uns beide.
Kate und Honey blieben bis zur Krönung bei uns, die am 15. Januar stattfinden sollte.
Kate als Lady Remus’ und Edward als Lord Edwards Erbe hatten das Recht, in der königlichen Prozession mitzureiten, und Honey forderte mich auf, sie zu begleiten, also war ich auch dabei. Wir versammelten uns am Tower, während die Königin mit einer Barke von Westminster Palace kam. Das Ganze bot einen fantastischen Anblick und belebte die Gemüter aller, obwohl ein scharfer Winterwind wehte. Der Lord Mayor war anwesend und mit ihm die ganzen Honoratioren der Stadt, und er überbrachte seine untertänigsten Grüße. Wir sahen die Königin an ihrem Landungssteg am Tower anlegen.
Danach gingen wir nach Hause, und ein paar Tage später kam die Königin in die City, um die Treuebezeugungen ihrer Untertanen vor ihrer Krönung zu empfangen. Das Fest war aufregend, und es wurde von Tag zu Tag deutlicher, daß sich ein Umschwung anbahnte. Niemand sprach, wie unter dem letzten Regime, offen darüber, daß Elisabeth ein Bastard war. So etwas zu sagen, konnte einem das Leben kosten. Während des Festes wurde das Haus der Tudors verherrlicht. Zum erstenmal wurden Bildnisse von Anna Boleyn, der Mutter der Königin, Seite an Seite mit denen von Heinrich VIII. aufgestellt. Elizabeth von York, Mutter Heinrichs VIII., wurde mit weißen Rosen bekränzt dargestellt. Sie reichte ihrem Gatten Heinrich VII. die weiße Rose von York, der ihr dafür die rote Rose von Lancaster bot. In ganz Cornhill und den Chepe entlang wurden Schauspielstücke aufgeführt, und Kinder sangen Lieder und rezitierten Verse zu Ehren der Königin.
Die Krönung begeisterte alle. Ich war nicht in der Kapelle, aber Kate dank ihrer Pairswürde, und sie beschrieb uns später alles. Wie klar und verständlich die Königin gesprochen habe, wie sicher sie durch die Zeremonie geschritten sei, daß sie sich beklagt habe, weil das Öl, mit dem sie gesalbt worden war, fettig gewesen sei und schlecht gerochen habe, und wie beeindruckend sie ausgesehen habe in ihrer Krönungsrobe, und die Trompeter seien fantastisch gewesen. Kate schwor, daß der führende Hochadel ihr freiwillig und aus voller Überzeugung die Hand geküßt und Treue und Ergebenheit geschworen hätte – besonders ihr gutaussehender Stallmeister, Robert Dudley.
»Man sagt, daß sie ihn heiraten will«, sagte Kate. »Sie ist offensichtlich vernarrt in ihn. Sie läßt kein Auge von ihm. Es wird nicht lange dauern, und wir werden hier eine königliche Hochzeit erleben, denkt an meine Worte. Hoffen wir nur, daß ihre Vorlieben nicht so kurzlebig sind wie die ihres Vaters.«
»Beschreib uns ihr Gewand«, warf meine Mutter rasch dazwischen.
Kate beschrieb es bis in die kleinste Einzelheit, und alle waren so glücklich wie in der Zwölften Nacht.
Aber meine Mutter traute dem Frieden nicht, und als sie hörte, daß Papst Paul öffentlich erklärt hätte, es sei ihm unmöglich, die Erbschaftsrechte von jemandem anzuerkennen, der nicht von ehelicher Geburt war, kriegte sie es mit der Angst zu tun. In seiner Erklärung ging der Papst sogar noch weiter und sagte, daß die schottische Königin, die mit dem Dauphin von Frankreich verheiratet war, die einzig legitime Nachfolgerin von Heinrich VIII. war, und er schlug vor, es sollte ein Gerichtsausschuß erstellt werden unter seinem Vorsitz, um bezüglich der Rechtmäßigkeit der Ansprüche auf den englischen Thron zwischen Elizabeth und Mary zu entscheiden.
Dies schlug ihm Elisabeth natürlich hochmütig ab.
Und die Befürchtungen meiner Mutter wuchsen.
»Ich fürchte, es wird wieder einmal einen Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten geben«, sagte meine Mutter zu mir. »Die Königin der Schotten wird die Katholiken repräsentieren und Elizabeth die Protestanten. Zwist innerhalb der Familie … davor fürchte ich mich am meisten. Ich habe schon zuviel davon erlebt.«
»Wir werden nicht mit Honey streiten, bloß weil sie eine Katholikin ist«, beruhigte ich sie. »Ich glaube, sie ist nur Katholikin geworden, weil sie Edward heiraten wollte.«
»Ich bete darum, daß es keine Schwierigkeiten geben wird«, sagte meine Mutter.
Sie besuchte Honey auf eine Woche, und als sie zurückkam, schien sie vergnügter zu sein. Sie hatte mit Lord Calperton gesprochen.
Er sei alt und auf seine Art unbeweglich, aber er hätte die Absicht, Edward in den Westen zu schicken. Er hatte einen Besitz in der Nähe von Plymouth. Edward war ungestümer in seinem Glauben als sein Vater, und falls er den Mund zu weit aufrisse – was sehr gut passieren könnte –, wäre es besser für ihn, er täte das weit weg vom Hof.
Meine Mutter war untröstlich, Honey nicht mehr so regelmäßig sehen zu können, aber sie gab Lord Calperton recht, daß es sicherer war, weit weg zu sein vom Zentrum des Konflikts.
Den ganzen Sommer über wurden Pläne für Edwards und Honeys Abfahrt nach Trewynd Grange in Devonshire geschmiedet; und ich sollte mit ihnen gehen.
»Du wirst dich einsam fühlen ohne uns beide«, sagte ich zu meiner Mutter. Sie nahm mein Gesicht in ihre Hände und antwortete: »Aber du wirst dort glücklicher sein, zur Abwechslung … nur für eine Weile, Cat. Du mußt dich erholen und wieder von vorn anfangen.« Ich mochte sie nicht allein lassen, aber ich wußte, sie hatte recht.
In diesem Juni, einen Monat vor unserer Abfahrt, wurde der französische König Heinrich II. in einem Turnier getötet und sein Sohn François wurde zum König gekrönt. Mary of Scotland war seine Frau und wurde deshalb Königin von Frankreich. Meine Mutter meinte: »Das macht alles noch gefährlicher, denn Mary hat sich den Titel ›Königin von England‹ zugelegt.«
Rupert, der gerade da war – was in letzter Zeit öfter vorkam –, sagte, während sie in Frankreich sei, wäre nichts zu befürchten. Gefährlich würde es erst werden, wenn sie je nach Schottland zurückkäme, was sie als Königin von Frankreich aber kaum tun würde.
Ich war lustlos. Es war mir egal, ob ich nach Devon gehen oder in unserem Kloster bleiben sollte. Eigentlich wollte ich lieber bleiben wegen meiner Mutter. Auf der anderen Seite aber wäre es auch gut, Tante Kate nicht so regelmäßig sehen zu müssen und wegzukommen von dem Schauplatz so vieler bitterer Erinnerungen. In einem Monat oder zwei würde ich wieder zurückkommen, das versprach ich mir selbst.
Es war eine lange und beschwerliche Reise, und als wir Trewynd Grange erreichten, neigte der Sommer sich seinem Ende zu. Ich glaube, von dem Moment an, da ich den ersten Blick auf den großen Gutshof geworfen hatte, fühlte ich mich meiner Tragödie etwas entrückt. Das Haus war komfortabler als unser Kloster. Es war aus grauem Stein gebaut, zwei Jahrhunderte alt, und hatte hübsche Gärten. Es lag rund um einen Innenhof, und an jeder Ecke stand ein Turm. Von den Turmfenstern aus hatte man einen prachtvollen Blick über den Hafen und hinaus aufs Meer, und der faszinierte mich. Die Halle war, am Standard des Klosters und Schloß Remus gemessen, nicht sehr groß, aber sie hatte etwas Gemütliches, trotz der beiden Spione hoch oben an der Wand, durch die man, ohne selbst gesehen zu werden, von den Alkoven die Leute unten beobachten konnte. Die Kapelle war feucht und kalt und wirkte eher abstoßend. Vielleicht war ich auch allergisch gegen Kapellen geworden, wegen des Konflikts in unserer Familie – und eigentlich im ganzen Lande. Der Steinfußboden war ausgetreten von den Schritten all jener, die seit langem tot sind. Der Altar stand in einer finsteren Ecke, und die Maueröffnung für die Leprakranken wurde heute von den Dienstboten benützt, die die Syphilis hatten und vom Haushalt getrennt leben mußten. Man konnte das ganze als ein Haus bezeichnen, in dem man sich verlaufen konnte, als ein großes Haus. Seine einzige Großartigkeit lag jedoch in seinen vier Türmen.
Es amüsierte mich, Honey zu beobachten, wie sie ihr eigenes Reich in Besitz nahm. Die Ehe hatte sie natürlich verändert. Sie strahlte eine innere Zufriedenheit aus. Edward trug sie auf Händen, und Honey war ein Mensch, der Liebe verlangte. Ohne Liebe war sie unglücklich. Sie wollte über alle anderen geliebt und geschätzt werden. Eigentlich müßte sie zufrieden sein, ich habe nie in meinem Leben einen Mann gesehen, der seine Frau so sehr liebte außer Lord Remus, als er noch am Leben und mit Kate zusammen war.
Mit Honey konnte ich offen sprechen. Ich wußte, daß sie meinen Vater wie niemanden auf dieser Welt haßte. Sie hatte ihm nie verziehen, daß er sie nicht im Haus hatte haben wollen und sie als Kind ignoriert hatte.
Sie wollte über ihn sprechen, aber ich hatte keine Lust dazu, denn ich war mir über meine eigenen Gefühle ihm gegenüber nicht im klaren. Ich wußte jetzt, daß er nicht nur mein, sondern auch Careys Vater war, und das war der Grund, warum wir nicht heiraten konnten. Ich wußte jetzt, daß er, während er als Heiliger posierte, dessen Kommen ein Wunder war, in der Nacht in Kates Bett gekrochen sein mußte, oder sie in seines, in demselben Haus, in dem Mutter schlief. Und die ganze Zeit hatte Kate so getan, als wäre sie Mutters gute Freundin und Kusine.
Ich glaube, Honey ist von Mutter dahingehend beeinflußt worden, mich mit Sorgfalt zu behandeln, und Honey hat schon immer alles getan, um meiner Mutter zu gefallen. Vielleicht hatte meine Mutter ihr auch andere Ratschläge gegeben, was mich anbetraf. Ich halte dies für möglich, denn seit ich in Trewynd Grange war, hatte Honey bereits mehrere Dinnerpartys gegeben und die hiesigen Junker eingeladen.
Es war am Tag nach dem erstaunlichen Zusammentreffen im Hafen, als sie sagte: »Sir Penn Pennlyon und sein Sohn werden morgen mit uns zu Abend essen. Sie sind unsere nächsten Nachbarn. Sir Penn ist ein mächtiger Mann in dieser Gegend. Er besitzt mehrere Schiffe. Auch sein Vater war schon Handelsmann.«
»Das Schiff, das vor ein paar Tagen hereingekommen … ?«
»Ja«, sagte Honey, »es ist der ›Springende Löwe‹. Alle ihre Schiffe heißen Löwe. Da gibt es den ›Kämpfenden Löwen‹, den ›Alten Löwen‹ und den ›Jungen Löwen‹. Wann immer du ein ›Löwen‹-Schiff siehst, kannst du davon ausgehen, daß es den Pennlyons gehört.«
»Ich habe im Hafen einen Mann gesehen, der Captain Lyon genannt wurde.«
»Das muß Captain Pennlyon gewesen sein. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Aber ich weiß, er ist jetzt zu Hause. Er ist über ein Jahr auf See gewesen.«
»Die kommen also her?« fragte ich.
»Edward ist der Meinung, daß wir auf gute Nachbarschaft halten sollten. Ihr Gut liegt nur einen Steinwurf von hier entfernt. Du kannst es vom Westturm aus sehen.«
Ich nahm die erste Gelegenheit wahr, um auf den Westturm zu klettern. Und ich sah ein schönes Haus, auf einer Klippe stehend, mit Blick über das Meer.
Ich fragte mich, was er wohl sagen würde, wenn er bemerkte, daß die junge Frau, die er beleidigt hatte – ich bestand darauf, daß er das getan hatte –, ein Gast des Hauses war, in dem auch er geladen war. Ich freute mich eigentlich schon auf das Zusammentreffen.
Es war Herbst, und der Baldrian blühte noch immer. Wir hatten einen milden Sommer gehabt, und ich fragte mich, wie der Winter in Trewynd Grange wohl sein würde. Ich konnte die Reise zurück nach London nicht vor dem Frühjahr antreten, was mich deprimierte. Ich fühlte mich rastlos und unbehaglich, denn ich wollte nach Hause. Ich wollte mit meiner Mutter zusammen sein und mit ihr endlose Gespräche über meine Schwierigkeiten und Sorgen führen und ihre Sympathie fühlen. Ich glaube, ich wollte nicht wirklich vergessen. Ich genoß es als eine Form von Luxus, unglücklich zu sein und mich ununterbrochen daran zu erinnern, was ich verloren hatte.
Nur weil dieser Mann zum Abendessen kam, hörte ich für eine Weile auf, an Carey zu denken – genau wie im Hafen.
Was sollte ich anziehen, überlegte ich. Honey hatte viele schöne Kleider mitgebracht, und sie war sich ihrer eigenen Schönheit bewußt. Ich hatte die Kleider, die ich mitgebracht hatte, etwas lustlos zusammengerafft, und ich bereute das nun. Ich wählte ein Samtkleid, das mir elegant von den Schultern fiel. Es war nicht nach der neuesten Mode, den im letzten Jahr hatten die Frauen angefangen, Korsetts mit Walfischstäbchen und Reifröcke zu tragen, die ich aber nicht nur lächerlich, sondern auch häßlich fand. Ich konnte es nicht ertragen, eng geschnürt zu sein, was jetzt die große Mode zu werden begann. Anstatt ihre Haare in fließenden Locken zu tragen, kräuselten es sich modebewußte Frauen und trugen alle möglichen Ornamente darin.
Doch wir befanden uns nicht bei Hofe, und vielleicht konnte man es sich hier leisten, unmodern zu sein. Honey zog immer nur das an, was ihre Schönheit am vorteilhaftesten hervorhob. Sie hatte großes Talent darin und schien in ihrer Schönheit zu schwelgen. Allerdings hatte auch sie die gekräuselten Frisuren und die Fischbeinstäbchen abgelehnt.
Kurz vor sechs Uhr trafen unsere Gäste ein. Honey und Edward warteten bereits in der Halle, um sie zu begrüßen. Ich stand in ihrer Nähe, und als ich die Pforte im Innenhof gehen hörte, spürte ich, wie mein Herz schneller schlug.
Ein großer rotbackiger Mann betrat die Halle. Er schien sich gleich köstlich mit seinem Gastgeber und dessen Frau zu amüsieren. Der andere, der hinter ihm eintrat, sah ihm ähnlich; auch er war ein extrem großer Mann mit massiven viereckigen Schultern und einer dröhnenden Stimme. Alles an Sir Penn Pennlyon war groß. Ich konzentrierte mich auf ihn, und ich wollte nicht das geringste Interesse an seinem Sohn zeigen.
»Willkommen«, sagte Edward und sah dabei dünn und blaß im Vergleich mit diesem Giganten aus. Sir Penns blinzelnde Augen schossen über ihn und seine Frau hinweg und schienen sich immer noch zu amüsieren.
»Heilige Maria!« rief er aus, nahm Honey bei der Hand, zog sie an sich und gab ihr einen lauten Schmatz auf die Lippen. »Wenn das nicht die hübscheste Lady in ganz Devon ist, fresse ich den ›Springenden Löwen‹ mit Mann und Maus!«
Honey wurde rot, was ihr reizend stand. »Sir Penn, darf ich Euch meiner Schwester vorstellen?«
Ich machte einen Knicks. Die blauen Augen waren jetzt auf mich geheftet. »Ah, noch eine kleine Schönheit«, sagte er. »Noch eine kleine Schönheit. Die beiden hübschesten Ladys in Devon.«
»Es ist sehr freundlich, Sir, mich so zu nennen«, sagte ich. »Aber ich werde Euch besser nicht daran erinnern, Euer Schiff zu schlucken, sollte es sich beweisen, daß Ihr unrecht hättet.«
Er lachte ein dröhnendes, bellendes Lachen. Er klatschte sich dabei mit den Händen auf die Schenkel. Ein bißchen ungehobelt, dachte ich.
Und hinter ihm begrüßte sein Sohn gerade Honey. Gleich würde er mir von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen.
Er erkannte mich sofort wieder, nahm meine Hand, küßte sie und sagte: »Wir sind alte Freunde.«
In dreißig Jahren wird er genauso wie sein Vater sein, dachte ich verächtlich.
Honey guckte erstaunt.
»Ich habe Captain Pennlyon schon einmal am Hafen getroffen«, sagte ich kühl, ohne ihn anzusehen.
»Meine Schwester faszinieren Schiffe«, sagte Honey.
»Sieh mal an!« Sir Penn sah mich anerkennend an. »Sie weiß eben, was gut ist. Junge Dame, ich kenne nur eines, was schöner ist als ein Schiff, und das ist eine hübsche Frau.« Er versetzte seinem Sohn einen leichten Rippenstoß. »Jake ist ganz meiner Meinung.«
»Wir würden gern etwas über Eure Reise hören«, sagte Honey höflich. »Laßt uns in den Salon gehen, das Essen wird bald serviert.«
Sie führte uns die drei Treppen hoch, am Speisezimmer vorbei und in den Salon, und Edwards Dienstboten brachten uns Wein zu trinken. Honey war sehr stolz auf ihre feinen venezianischen Gläser, die groß in Mode waren und die sie mitgebracht hatte. Ich war überzeugt, die Pennlyons hatten nie etwas ähnlich Feines gesehen.
Wir saßen ziemlich steif auf unseren Stühlen, deren Stickereien auf Sitz und Rückenlehnen von Edwards Großtante angefertigt worden waren. Ich dachte schon, der Stuhl würde unter Sir Penn zusammenbrechen, er hatte sich daraufgesetzt wie auf eine schwere stabile Kiste. Honey warf mir einen Blick zu, der besagte, wir müßten uns wohl noch an die in der Provinz üblichen Manieren gewöhnen.
Sir Penn bemerkte, was für eine feine Sache es doch sei, Nachbarn zu haben, bei denen man den Wein in so schönen venezianischen Gläsern angeboten bekäme. Seine Augen glitzerten, während er sprach, als ob er sich über uns lustig machte, uns auf eine gewisse Weise verachtete – außer Honey natürlich und vielleicht auch abgesehen von mir. Beide – Vater und Sohn – hatten etwas Unverschämtes im Blick. Sie schätzten uns auf eine Art und Weise ab, die etwas Beunruhigendes an sich hatte.
»Und wie lange werdet Ihr hierbleiben?« wollte er von Edward wissen.
Edward erwiderte ausweichend, daß alles von den Umständen abhinge. Sein Vater hätte gewünscht, daß er sich eine Weile um den Besitz kümmere. Es käme darauf an, was sich auf dem Besitz in Surrey tun würde.
»Ah, Eure vornehme Familie hat einen Sitz in jeder Ecke des Königreichs«, sagte Sir Penn. »Lieber junger Herr, da muß es doch vorkommen, daß Ihr selbst nicht wißt, ob Ihr ein Surrey oder ein Devon seid, oder gibt es vielleicht noch eine Grafschaft, die Anspruch auf Euch erheben könnte?«
»Mein Vater hat noch Besitzungen im Norden«, antwortete Edward bescheiden.
»Maria! Da habt Ihr ja wirklich einen Fuß in jeder Grafschaft der Königin, junger Mann!«
»Das wäre übertrieben«, sagte Edward. »Aber dürfte ich erwähnen, daß Eure Schiffe alle bekannten Teile der Ozeane befahren?«
»Das kann man wohl sagen, Sir, das kann man wohl sagen! Und Jake kann es Euch bestätigen. Er kommt gerade von einer langen Reise zurück, aber er hat trotzdem auch eine Stimme in der Gesellschaft hier!«
»Die Gesellschaft macht mir Spaß, wie Ihr wißt«, sagte Jake und schaute mir dabei direkt und spöttisch in die Augen, weil er hier saß und ich ihm doch gesagt hatte, es wäre nicht sehr wahrscheinlich für ihn, eingeladen zu werden. »Aber es stimmt, daß ich erst vor kurzem von einer Reise zurückgekehrt bin.«
»Meine Schwester war ganz aufgeregt, als sie Euer Schiff hereinkommen sah. Von ihrem Fenster aus beobachtet sie die Schiffe und scheint dabei nie müde zu werden.«
Jake rückte seinen Stuhl näher an meinen heran. Die beiden Männer hatten nicht die Manieren, die wir von ihnen erwartet hatten. Diesen Leuten fehlte die Feinheit des Benehmens, sie waren deutlicher und direkter als wir und grober.
»Mein Schiff hat Euch also gefallen?« sagte er.
»Mir gefallen alle Schiffe.«
»So ist’s richtig! Hattet Ihr früher nie Gelegenheit, Schiffe zu sehen?«
»Wir leben nahe am Fluß. Ich habe oft Boote vorbeisegeln sehen.«
»Fährboote und Kähne!« lachte er.
»Und königliche Barken. Ich habe die Königin auf dem Weg zur Krönung gesehen.«
»Und jetzt habt Ihr die Königin der Schiffe gesehen.«
»Eures?« fragte ich.
»Der ›Springende Löwe‹, kein anderes.«
»Das ist also die Königin!«
»Ich werde Euch zu ihr bringen. Ich werde sie Euch zeigen. Dann könnt Ihr Euch selbst überzeugen.« Er beugte sich zu mir. Ich rückte ein Stück zur Seite und warf ihm einen kühlen Blick zu, was ihn zu amüsieren schien.
»Wann werdet Ihr kommen?« fragte er.
»Ich bezweifle, daß ich das überhaupt tun werde.«
Er zog eine Augenbraue in die Höhe, die noch dunkler war als sein Haar, was seine blauen Augen zusätzlich wirkungsvoll machte.
»Ihr habt auch nicht geglaubt, daß Ihr mich hier sehen würdet, und ich bin trotzdem hier. Und jetzt sagt Ihr, Ihr werdet nie an Bord meines Schiffes kommen. Ich sage Euch, Ihr werdet innerhalb der nächsten Woche mein Gast dort sein, ich wette mit Euch!«
»Ich wette nicht.«
»Aber Ihr werdet kommen.« Er beugte sich zu mir herüber, so daß sein Gesicht ganz nahe an meinem war. Ich versuchte, ihn gleichgültig anzusehen, aber ich wirkte dabei wohl nicht sehr überzeugend. Er bemerkte, welchen Eindruck er auf mich gemacht hatte. Ich rückte von ihm ab, und wieder machten sich seine Augen über mich lustig. »Ja, auf meinem Schiff«, fuhr er fort. »Spätestens in einer Woche, von heute ab. Das ist eine Wette.«
»Ich habe Euch schon einmal gesagt, daß ich nicht wette.«
»Über die Bedingungen reden wir später.«
Ich glaube nicht, daß ich gerne mit so einem Mann allein an Bord seines Schiffes gewesen wäre.
Wir wurden durch die Ankunft eines weiteren Gastes, Mistreß Crocombe, unterbrochen, eine gezierte Dame mittleren Alters. Als wir noch bei einem Gläschen Wein zusammen saßen, verkündete ein Diener, das Abendessen stehe bereit, und wir schritten die Treppe wieder hinunter ins Speisezimmer.
Es war ein wunderschönes Zimmer, das schönste überhaupt im Haus. Durch die bleigefaßten Fenster konnte man den Innenhof sehen. An den Wänden hingen Wandteppiche, die alle den Krieg der Rosen zum Gegenstand hatten. Der Tisch war geschmackvoll mit vielen Stücken aus venezianischem Glas und silbernen Tellern gedeckt. Honey hatte die Tischmatte mit verschiedenen Kräutern geschmückt, die in ihrem Kräutergarten wuchsen, was sehr hübsch aussah.
Edward saß am Kopfende des Tisches und Honey ihm gegenüber. An ihrer rechten Seite saß Sir Penn, an ihrer linken Jake. An Edwards Rechten saß ich und an seiner Linken Miß Crocombe, was bedeutete, daß ich neben Jake, Miß Crocombe neben dessen Vater saß.
Könnte es sein, daß dieser Captain Pennlyon als möglicher Anwärter auf meine Hand gedacht wäre, überlegte ich. Der Gedanke ärgerte mich. Dachte man wirklich, man könnte mich Carey vergessen machen, indem man einfach eine Reihe von Männern antanzen ließ, die mich, einer wie der andere, nur an Carey erinnern mußten, gerade wegen des Unterschiedes zu ihnen.
Honey hatte ein paar ausgezeichnete Köche. Das Essen war exzellent. Es gab Rindfleisch und Lamm und ein Spanferkel, einen Wildschweinkopf und eine riesige Pastete. Und sie hatten sich die Mühe gegeben, zu Ehren der Gäste auch hier den hübschen Brauch einzuführen, den wir zu Hause pflegten. Eine der Pasteten hatte die Form eines Schiffes, und darauf stand mit dünner Creme geschrieben ›Springender Löwe‹. Die Begeisterung der Pennlyons, als sie dies sahen, mußte man beinahe kindisch nennen. Sie lachten und verschlangen große Stücke von ihr. Ich habe nie einen solchen Appetit gesehen, wie ihn diese beiden Männer entwickelten. Oft wurden die Speisen geräuschvoll mit Muskateller und Malvasier hinuntergespült, diesen beiden Weinen aus Italien und der Levante, die damals gerade sehr in Mode kamen.
Natürlich dominierten sie auch das Gespräch. Miß Crocombe betete Sir Penn förmlich an, was komisch war, wenn man bedachte, daß sie eine etwas gezierte, alte Jungfer Ende Dreißig war und sicherlich nicht der Typ, einen Mann wie Sir Penn zu fesseln, dessen Appetit in allem ich mir als unersättlich vorstellte. Er warf Honey, wie mir schien, ziemlich laszive Blicke zu, schaute auch manchmal zu mir herüber, halb amüsiert, halb bedauernd, und ich erklärte es mir so, daß er mich der Aufmerksamkeit seines Sohnes überließ. Ich fand dieses Benehmen unverzeihlich. Es schien für ihn nicht von Bedeutung zu sein, daß Honey die Frau seines Gastgebers war.
Honey andererseits schien das alles nicht zu bemerken, oder vielleicht war sie auch so an offene Bewunderung gewöhnt, daß sie diese damals als normal akzeptierte. Ich fragte ihn, wohin ihn seine letzte Reise geführt habe.
»Zur Barbary Coast!« sagte er. »Was für eine Reise! Wir hatten jede Menge Schwierigkeiten. Stürme und Wellen, so hoch, daß sie über uns zusammenschlugen, und das Schiff wurde so schwer beschädigt, daß wir einmal sogar dachten, wir müßten nach Hause zurück laufen. Aber wir schafften es in den nächsten Hafen, und es gelang uns, unsere Reise nach einer Reparatur wie geplant fortzusetzen.«
»Während einer Reise sieht man sicher dem Tod oftmals ins Gesicht?«
»Das stimmt, Mistreß. Deshalb lieben wir das Leben auch so sehr. Begegnete Euch an Land nicht auch manchmal der Tod?«
Ich wurde ernst. Ich dachte an das besorgte Gesicht meiner Mutter und mußte daran denken, daß Großmutters Mann seinen Kopf aus keinem andern Grund verloren hatte, als daß er einen Freund versteckt hatte, und daß ihr zweiter Mann auf dem Scheiterhaufen starb, weil er eine abweichende Meinung vertrat.
»Doch. Niemand kann ganz sicher sein, daß er den nächsten Tag überleben wird.«
Er beugte sich zu mir. »Deshalb sollten wir jeden Tag genießen, so wie er kommt; und zum Teufel mit dem nächsten.«
»Ist das Eure Philosophie? Macht Ihr nie Pläne für die Zukunft?« Seine unverschämten Augen bohrten sich in meine.
»Oh … oft. Aber dann versichere ich mich jeweils, daß das, was ich mir wünsche, auch in Erfüllung geht.«
»Ihr seid sehr von Euch überzeugt.«
»Ein Seemann muß immer von sich überzeugt sein. Ich werde Euch noch etwas sagen: Er ist immer in Eile. Denn Zeit ist etwas, das zu vergeuden er sich nicht leisten kann. Wann werdet Ihr also kommen und mein Schiff besichtigen?«
»Ihr solltet meine Schwester und ihren Mann fragen, ob sie auch Lust zu dieser Besichtigung hätten.«
»Ich habe Euch eingeladen!«
»Ich würde gerne von Euren Abenteuern hören.«
»An der Barbary Coast? Das ist keine schöne Geschichte.«
»Das habe ich auch nicht erwartet.« Ich blickte über den Tisch zu Miß Crocombe hin, die Sir Penn gerade schüchtern bat, ihr von seinen Abenteuern auf hoher See zu berichten. Er begann fantastische Geschichten zu erzählen, die, davon war ich überzeugt, uns alle schockieren sollten. Er schien mehr Abenteuer erlebt zu haben als Sindbad der Seefahrer. Er hatte mit Seeungeheuern gekämpft und sich mit Wilden herumgeschlagen. Er war mit seinem Schiff an fremden Küsten gelandet und hatte sich Eingeborene aus dem Landesinneren geholt, die dann auf seinen Galeeren arbeiten mußten. Er hatte eine Meuterei unterdrückt und zahllose Stürme überlebt. Es gab nichts, was er nicht erlebt hätte, und alles, was er sagte, war voll von versteckten Anspielungen. Als er eine kleine Gruppe seiner Leute in ein afrikanisches Dorf führte, erzählte er, hatten sie Frauen dort vergewaltigt, geraubt und geplündert.
Mistreß Crocombe bedeckte ihre Augen vor Schreck und wurde hochrot. Sie war eine alberne Person und stellte ihre Absichten auf Sir Penn zu offensichtlich zur Schau. Glaubte sie wirklich, er würde sich für sie interessieren? Ich fand es beschämend, daß sie ihre Gefühle nicht zu verbergen suchte.
Teneriffa wurde erwähnt. Dies war die größte der Hundeinseln, wie wir sie nannten, denn als sie entdeckt worden war, hat man dort eine Unmenge Hunde vorgefunden. Jetzt waren sie als die Kanarischen Inseln bekannt.
Teneriffa war jetzt in den Händen der Spanier.