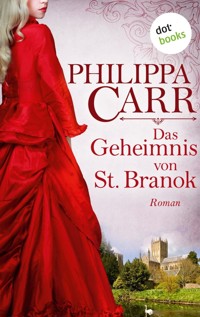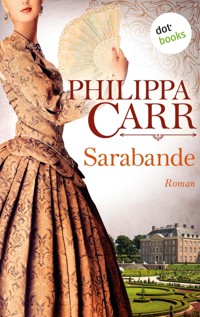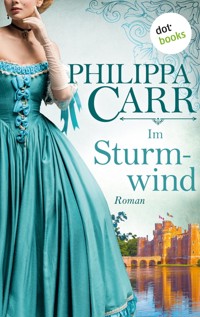
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen zwei Männern – und in großer Gefahr: der Schicksalsroman »Im Sturmwind« von Bestsellerautorin Philippa Carr jetzt als eBook bei dotbooks. Als im Frankreich des 18. Jahrhunderts die Wut der Bürger auf den König immer größer wird, herrscht in England noch Ruhe und Frieden. Behütet wächst Charlotte Ransome zu einer schönen Frau heran, die von nichts anderem träumt als ihrer Jugendliebe Dickon. Doch ihr Leben nimmt eine dramatische Wendung, als ihre Mutter ein Geheimnis offenbart: Charlotte ist die Tochter eines französischen Edelmanns, der sie nun zu sich nach Paris holen möchte. Wenig später findet sich Charlotte im glanzvollen Versaille wieder, wo sie sich Hals über Kopf in den charismatischen Charles de Tourville verliebt – aber der ist einer anderen versprochen. Während Charlotte hofft, doch noch ihr Glück zu finden, zieht eine Revolution gegen Ludwig XVI. herauf, die Frankreich für immer verändern wird … und allen zum Verhängnis werden kann, die auch nur einen Tropfen aristokratischen Blutes in sich haben! Verbotene Gefühle, gebrochene Versprechen und eine Zeit voller Gefahren: Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt in ihrer Familien-Saga »Die Töchter Englands« große Momente der Geschichte mit starken Frauenfiguren zu einem fesselnden Lesevergnügen. Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Im Sturmwind« von Philippa Carr, auch bekannt als Jean Plaidy und Victoria Holt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als im Frankreich des 18. Jahrhunderts die Wut der Bürger auf den König immer größer wird, herrscht in England noch Ruhe und Frieden. Behütet wächst Charlotte Ransome zu einer schönen Frau heran, die von nichts anderem träumt als ihrer Jugendliebe Dickon. Doch ihr Leben nimmt eine dramatische Wendung, als ihre Mutter ein Geheimnis offenbart: Charlotte ist die Tochter eines französischen Edelmanns, der sie nun zu sich nach Paris holen möchte. Wenig später findet sich Charlotte im glanzvollen Versaille wieder, wo sie sich Hals über Kopf in den charismatischen Charles de Tourville verliebt – aber der ist einer anderen versprochen. Während Charlotte hofft, doch noch ihr Glück zu finden, zieht eine Revolution gegen Ludwig XVI. herauf, die Frankreich für immer verändern wird… und allen zum Verhängnis werden kann, die auch nur einen Tropfen aristokratischen Blutes in sich haben!
Über die Autorin:
Philippa Carr ist – wie auch Jean Plaidy und Victoria Holt – ein Pseudonym der britischen Autorin Eleanor Alice Burford (1906–1993). Schon in ihrer Jugend begann sie, sich für Geschichte zu begeistern: »Ich besuchte Hampton Court Palace mit seiner beeindruckenden Atmosphäre, ging durch dasselbe Tor wie Anne Boleyn und sah die Räume, durch die Katherine Howard gelaufen war. Das hat mich inspiriert, damit begann für mich alles.« 1941 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem in den nächsten 50 Jahren zahlreiche folgten, die sich schon zu ihren Lebzeiten über 90 Millionen Mal verkauften. 1989 wurde Eleanor Alice Burford mit dem »Golden Treasure Award« der Romance Writers of America ausgezeichnet.
Bei dotbooks erscheint Philippa Carrs großer Romanzyklus »Die Töchter Englands«. Obwohl jeder Roman für sich gelesen werden kann, hat die Serie eine chronologische Reihenfolge, in der die wechselhafte Geschichte einer Familie Generation für Generation erzählt wird:
Band 1: Das Geheimnis im Kloster; Band 2: Der springende Löwe; Band 3: Sturmnacht; Band 4: Sarabande; Band 5: Das Licht und die Finsternis; Band 6: Die venezianische Tochter; Band 7: Die Halbschwestern; Band 8: Die Dame und der Dandy; Band 9: Die Erbin und der Lord; Band 10: Im Sturmwind; Band 11: Im Schatten des Zweifels; Band 12: Der Zigeuner und das Mädchen; Band 13: Sommermond; Band 14: Das Geheimnis von St. Branok; Band 15: Das Geheimnis im alten Park; Band 16: Der schwarze Schwan; Band 17: Zeit des Schweigens; Band 18: Ein hauchdünnes Band; Band 19: Wiedersehen in Cornwall
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1983 unter dem Originaltitel »Zipporah’s Daughter«
Copyright © der englischen Originalausgabe 1983 by Philippa Carr
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1984 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KH, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung von Bildmotiven von Shutterstock/Ivan Sorto Cobos und AdobeStock/darkbird
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-569-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Im Sturmwind« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Philippa Carr
Im Sturmwind
Roman
Aus dem Englischen von Hilde Linnert
dotbooks.
Kapitel 1Die Verschmähte
An dem Tag, an dem der Comte d’Aubigné in Eversleigh eintraf, war ich ausgeritten, und als ich die Halle betrat, war er in ein Gespräch mit meiner Mutter vertieft. Mir war sofort klar, daß es sich bei ihm um einen angesehenen Besucher handelte. Er war nicht mehr jung – ungefähr so alt wie meine Mutter, vielleicht auch um ein paar Jahre älter – und sehr elegant gekleidet, wenn auch nicht ganz nach englischer Art; sein verschnürter Rock aus dunkelgrünem Samt war etwas modischer, als es bei uns üblich war, die passepoilierte Weste etwas feiner, die gestreifte Hose weiter und die Schnallenschuhe glänzender. Er trug eine weiße Perücke, die seine blitzenden, dunklen Augen gut zur Geltung brachte. Außerdem war er einer der bestaussehenden Gentlemen, die ich bisher kennengelernt hatte.
»Da bist du ja, Lottie«, begrüßte mich meine Mutter. »Ich möchte dir den Comte d’Aubigné vorstellen, der sich einige Tage bei uns aufhalten wird.« Sie hängte sich bei mir ein und stellte mich ihm vor. »Das ist Lottie.«
Er ergriff meine Hand und küßte sie. Es war nicht zu übersehen, daß es sich um keinen gewöhnlichen Besuch handelte und daß es um etwas sehr Wichtiges ging. Ich kannte meine Mutter sehr gut und erriet deshalb, daß sie es sehr gern sehen würde, wenn wir einander sympathisch fänden. Er gefiel mir auf den ersten Blick, vor allem, weil er mir die Hand küßte, als ob ich erwachsen wäre, ein Zustand, der mir damals höchst erstrebenswert erschien, denn die Tatsache, daß ich noch nicht einmal zwölf Jahre alt war, störte mich sehr. Wäre ich älter gewesen, wäre ich längst mit Dickon Frenshaw durchgegangen, um den meine Gedanken ununterbrochen kreisten. Dickon und ich waren entfernt verwandt. Er war der Sohn der Cousine meiner Großmutter, und ich kannte ihn, seit ich auf der Welt war. Er war zwar um elf Jahre älter als ich, aber das hatte mich nicht daran gehindert, mich in ihn zu verlieben, und ich war davon überzeugt, daß er meine Gefühle erwiderte.
Jetzt klang die Stimme meiner Mutter fröhlich. Dennoch sah sie mich forschend an, um herauszufinden, was ich von unserem Gast hielt. Auch er beobachtete mich aufmerksam.
Seine ersten Worte, die er auf englisch mit einem fremdländischen Akzent sprach, lauteten: »Sie ist ja schön!«
Ich lächelte ihn an. Bescheidenheit war nicht gerade meine Stärke, und ich wußte, daß ich mein gutes Aussehen einer längst dahingegangenen Vorfahrin verdankte, von deren Schönheit die Familie heute noch sprach. Ich hatte ein Porträt von ihr gesehen – die Ähnlichkeit war unheimlich. Wir hatten das gleiche rabenschwarze Haar und die gleichen tiefliegenden Augen, die violett schimmerten, meine Nase war vielleicht um eine Spur kürzer als die ihre, mein Mund vielleicht ein wenig breiter, aber sonst war es das gleiche Gesicht. Sie hatte Carlotta geheißen, und mir kam es geradezu schicksalhaft vor, daß ich Charlotte getauft worden war, bevor diese Ähnlichkeit sichtbar wurde.
»Gehen wir in den Wintersalon«, schlug meine Mutter vor. »Ich habe Erfrischungen für unseren Gast bereitstellen lassen.«
Wir gingen hinüber und plauderten bei einem Glas Wein angeregt. Er war offensichtlich entschlossen, uns zu bezaubern, und wußte sehr genau, wie er es anstellen mußte. Er erzählte uns innerhalb kurzer Zeit sehr viel über sich selbst, als wolle er sich mir vorstellen und einen guten Eindruck auf mich machen. Das gelang ihm meisterhaft. Er war ein blendender Erzähler, und sein Leben war reich an Abwechslungen und Erlebnissen.
Die Zeit verging wie im Flug, und schließlich mußten wir uns für das Abendessen umziehen. Seit meinem letzten Beisammensein mit Dickon hatte ich mich nicht mehr so großartig unterhalten.
Während der nächsten Tage verbrachte ich viel Zeit in seiner Gesellschaft. Wir ritten oft gemeinsam aus, denn er wollte, daß ich ihm die Umgebung zeigte.
Er schilderte mir sein Leben in Frankreich, wo er als eine Art Diplomat am Hof tätig war. Er besaß ein Chateau auf dem Land und ein Haus in Paris, hielt sich aber oft in Versailles auf, wo der Hof hauptsächlich residierte, denn der König kam nur selten nach Paris ... nur wenn es sich gar nicht vermeiden ließ.
»Er ist wegen seines Lebensstils sehr unbeliebt«, erwähnte der Comte und erzählte von König Ludwig XV., von seinen Mätressen und darüber, wie tief ihn der Tod der Madame de Pompadour getroffen hatte, die nicht nur seine Geliebte, sondern die heimliche Herrscherin des Landes gewesen war.
Diese Einblicke in das Leben und Treiben in Frankreich faszinierten mich, und es freute mich besonders, daß der Comte so offen mit mir sprach, als wäre mein Alter unwesentlich – und dabei wies meine Mutter immer wieder darauf hin, seit sie wußte, was ich für Dickon empfand.
Der Comte beschrieb die rauschenden Feste in Versailles, an denen er regelmäßig teilnahm. Er schilderte alles so anschaulich, daß ich die eleganten Herren und vornehmen Damen genauso deutlich vor mir sah wie das Landleben, in das er sich gelegentlich flüchtete.
»Ich hoffe, daß Sie mir eines Tages die Freude machen werden, mich zu besuchen«, sagte er.
»Das würde ich nur zu gern tun«, antwortete ich begeistert, was ihn sichtlich freute.
Es war ungefähr drei Tage nach seiner Ankunft. Ich befand mich in meinem Schlafzimmer und zog mich zum Abendessen um, als jemand an die Tür klopfte.
»Herein«, rief ich, und zu meiner Überraschung kam meine Mutter ins Zimmer.
In letzter Zeit strahlte sie förmlich. Vermutlich war sie darüber froh, daß wir Besuch hatten, und ich freute mich für sie, denn wir hatten etliche Tragödien hinter uns, und sie war seit dem Tod meines Vaters sehr unglücklich gewesen. Sie hatte nachher noch einen sehr treuen Freund verloren, einen Arzt, der meinen Vater während seiner Krankheit behandelt hatte. Er war bei einem Brand in dem von ihm geleiteten Fürsorgeheim auf entsetzliche Weise ums Leben gekommen. Es war eine schreckliche Zeit gewesen, denn auch meine Gouvernante war bei dieser Katastrophe verbrannt. Und dann war natürlich die Sache mit Dickon, über die sie sich aufregte, was mir viel Kummer bereitete. Obwohl ich sie gern beruhigt hätte, war ich dazu nicht imstande, denn dann hätte ich Dickon aufgeben müssen. Deshalb war es eine Erleichterung für mich, daß der Comte ihre trübe Stimmung aufhellte, auch wenn es nur für einige Zeit war.
»Ich möchte mit dir sprechen, Lottie«, begann sie.
»Ja, Mutter.«
»Was hältst du vom Comte?«
»Sehr vornehm. Sehr elegant. Sehr unterhaltsam. Ein wirklich sehr angenehmer Mann. Warum hat er uns eigentlich besucht? War er vielleicht schon früher einmal hier? Ich habe den Eindruck, daß er die Gegend kennt.«
»Das stimmt.«
»War er ein Freund von Onkel Carl?«
»Ein Freund von mir.«
Sie benahm sich wirklich merkwürdig, suchte nach Worten – sie, die für gewöhnlich so frei und offen sprach.
»Er gefällt dir also«, fuhr sie fort.
»Natürlich, wie könnte es auch anders sein. Er kann so interessant plaudern, erzählt so viel über den französischen Hof und über sein Château. All diese vornehmen Leute. Er muß eine bedeutende Persönlichkeit sein.«
»Er ist Diplomat und arbeitet in Hofkreisen. Lottie ... hm ... magst du ihn?«
»Versuchst du, mir etwas beizubringen, Mutter?«
Sie schwieg einige Sekunden, dann sagte sie schnell: »Es war vor langer Zeit ... bevor du auf der Welt warst ... Ich hatte Jean-Louis sehr gern.«
Ich war erstaunt; warum nannte sie meinen Vater Jean-Louis? Warum sagte sie nicht ›dein Vater‹, und warum erzählte sie mir, daß sie ihn gern gehabt hatte? Ich hatte miterlebt, wie sie ihn während seiner Krankheit gepflegt hatte und wie betrübt sie bei seinem Tod gewesen war. Ich wußte am besten, was für eine liebevolle, ergebene Frau sie ihm gewesen war. Deshalb antwortete ich ein bißchen ungeduldig: »Natürlich.«
»Und er hat dich geliebt, du warst für ihn so wichtig. Er hat oft erwähnt, wieviel Freude du in sein Leben gebracht hast, daß du der Ausgleich für alle seine Leiden warst.«
Sie blickte starr vor sich hin; ihre Augen glänzten, und sie sah aus, als würde sie jeden Augenblick zu weinen beginnen.
Ich ergriff ihre Hand und küßte sie. »Erzähl mir doch, was du auf dem Herzen hast, Mutter.«
»Vor dreizehn Jahren kam ich nach langer Zeit nach Eversleigh zurück. Mein ... ich nenne ihn Onkel, aber die Verwandtschaft war komplizierter. Onkel Carl war sehr alt und wußte, daß er nicht mehr lang zu leben hatte. Er wollte, daß Eversleigh in der Familie blieb, und anscheinend war ich seine nächste Verwandte.«
»Ja, das weiß ich.«
»Dein Vater konnte mich nicht begleiten. Er hatte gerade einen schweren Unfall erlitten ... also reiste ich allein. Der Comte wohnte damals in Enderby, und wir lernten einander kennen. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, Lottie. Wir lernten einander kennen ... und ... ich wurde seine Geliebte.«
Ich sah sie verblüfft an. Meine Mutter ... mit einem Liebhaber in Eversleigh, während mein Vater krank in Clavering Hall lag. Ich war wie vor den Kopf gestoßen, weil wir so wenig über unsere engsten Mitmenschen wissen. Sie war mir immer als sittenstrenge Frau erschienen, die unbeirrbar an den überlieferten Konventionen festhielt... und sie hatte einen Geliebten gehabt!
Sie hatte meine Hände ergriffen. »Bitte, versuche mich zu verstehen.«
Trotz meiner Jugend konnte ich mich viel besser in sie einfühlen, als sie glaubte. Ich liebte Dickon, und ich wußte, wie leicht man sich von seinen Gefühlen hinreißen läßt.
»Aus unserer Verbindung entsprang ein Kind ... du.«
Jetzt hatte das Geständnis eine Wendung ins Fantastische genommen. Ich war nicht die Tochter des Mannes, den ich immer für meinen Vater gehalten hatte, sondern die des einmaligen Comte. Es war kaum zu glauben.
»Ich weiß, was du von mir denkst, Lottie«, redete meine Mutter hastig weiter. »Du verachtest mich. Du bist zu jung, um das alles zu verstehen. Die ... Versuchung war stärker als ich. Und nachher war dein Vater ... ich meine Jean-Louis ... so glücklich. Ich konnte es ihm nicht sagen, ihm meine Schuld gestehen. Es wäre ein tödlicher Schlag für ihn gewesen. Er hatte soviel gelitten, war so froh, als du zur Welt kamst, und du weißt, wie er zu dir gestanden hat. Außerdem warst du so gut zu ihm... so liebevoll, so sanft, so rücksichtsvoll. Er hatte sich immer Kinder gewünscht, anscheinend konnte er aber keine bekommen. Ich war sehr wohl dazu imstande, wie ich ja bewiesen habe, und jetzt weißt du alles, Lottie. Der Comte ist dein Vater.«
»Weiß er es?«
»Ja, das ist auch der Grund für seinen Besuch ... um dich kennenzulernen. Warum sprichst du nicht?«
»Ich weiß im Augenblick nicht, was ich sagen soll.«
»Bist du entsetzt?«
»Das weiß ich nicht.«
»Ich habe es dir zu plötzlich beigebracht. Er wollte, daß du es erfährst. Er hat dich in so kurzer Zeit so lieb gewonnen. Warum schweigst du, Lottie?«
Ich sah sie nur stumm an; sie schloß mich in die Arme und drückte mich an sich.
»Du verachtest mich doch nicht ...«
Ich küßte sie. »O nein, Mutter, ich weiß nur nicht, was ich dazu sagen, was ich davon halten soll. Ich möchte allein sein und über alles in Ruhe nachdenken.«
»Vorerst möchte ich nur eines wissen. Hat sich an deiner Liebe zu mir etwas geändert?«
Ich schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht. Warum denn auch?«
Ich küßte sie zärtlich; im Augenblick war sie eine Fremde, nicht meine Mutter, die ich mein Leben lang gekannt hatte.
Meine Gefühle waren so durcheinander geraten, daß ich nicht klar denken konnte. Es war eine bestürzende Enthüllung gewesen. Wahrscheinlich erlebt jeder Mensch einmal einen Schock, aber wenn man entdeckt, daß der Mann, den man bisher für seinen Vater gehalten hat, es gar nicht ist, und wenn jemand anderer an seine Stelle tritt, dann ist das zumindest äußerst verwirrend.
Der Comte war eine so blendende Erscheinung, daß ich stolz darauf war, seine Tochter zu sein. Dieses Gefühl wich aber sofort der Beschämung, wenn ich an den armen Jean-Louis dachte, der so freundlich, sanft und selbstlos gewesen war. Er hing so innig an mir; seine Augen leuchteten immer auf, wenn ich sein Zimmer betrat, und wenn ich mich zu ihm setzte, lag in ihnen herzerwärmende Zärtlichkeit. Als er starb, war ich verzweifelt gewesen – genau wie meine Mutter. Sie hatte auch ihn geliebt. Ich war damals zu jung, um die komplizierten Gefühle der Menschen zu verstehen, aber dennoch hatte mich die Enthüllung meiner Mutter tief erschüttert.
Merkwürdigerweise brachte ich das zufällige Auftauchen des Comte nicht mit meiner Beziehung zu Dickon in Verbindung. Aber selbst wenn ich es getan hätte, hätte ich mich auch damit abgefunden, daß er nach all den Jahren nicht zufällig nach England gekommen war.
Als ich zum Abendessen hinunterging, war ich gefaßt. Meine Mutter beobachtete mich ängstlich, und bei Tisch herrschte eine gespannte Atmosphäre. Der Comte tat sein Bestes, um sie zu zerstreuen, indem er von amüsanten Ereignissen am Hof von Frankreich erzählte.
Als wir uns vom Tisch erhoben, drückte mir meine Mutter die Hand und sah mich flehend an. Ich lächelte ihr zu, küßte ihr die Hand und nickte. Sie verstand mich: Ich hatte meinen neuen Vater akzeptiert.
Wir tranken im Nebenzimmer noch einen Schluck Wein, und meine Mutter sagte: »Ich habe es ihr erzählt, Gerard.«
Er kam auf mich zu und schloß mich in die Arme; dann hielt er mich von sich weg.
»Ich bin stolz auf dich, meine Tochter«, meinte er. »Das ist einer der glücklichsten Augenblicke meines Lebens.«
Und damit beseitigte er jede Befangenheit zwischen uns.
***
Ich verbrachte viel Zeit in seiner Gesellschaft. Heute weiß ich, daß meine Mutter es so einrichtete. Sie ließ uns viel allein und legte sichtlich Wert darauf, daß wir einander gut kennenlernten. Er sprach immerzu davon, daß ich ihn in Frankreich besuchen müsse, daß er erst zufrieden sein würde, wenn ich sein Château gesehen hätte, und ich erwiderte, daß ich mich erst zufriedengeben würde, wenn ich sein Château zu Gesicht bekommen hätte.
Er faszinierte mich – mir gefiel alles an ihm: sein lässiges Benehmen, seine Galanterie, sogar sein dandyhaftes Außeres, wie wir es in England genannt hätten. Er bezauberte mich. Am glücklichsten war ich aber darüber, daß er mich als Erwachsene behandelte, und deshalb dauerte es nicht lange, bis ich ihm von Dickon erzählte.
Ich liebte Dickon. Ich wollte Dickon heiraten. Dickon war der am besten aussehende Mann, den ich kannte.
»Du mußt ihm früher einmal ähnlich gewesen sein«, meinte ich.
»Ach«, lachte er, »da siehst du, was die Jahre aus einem Menschen machen. Ich sehe nicht mehr so gut aus wie Dickon. Der einzige Trost ist, daß Dickon eines Tages dieser Tatsache ebenfalls ins Auge sehen wird.«
»Was für ein Unsinn. Du bist auf deine Art faszinierend. Dickon ist nur jünger... obwohl er viel älter ist als ich. Um etwa elf Jahre älter.«
Mein Vater legte den Kopf schief. »Der arme alte Mann.«
Mit ihm konnte ich über Dickon sprechen, ganz anders als mit meiner Mutter.
»Sie haßt ihn nämlich«, erklärte ich dem Comte. »Es hat etwas mit Torheiten zu tun, die er als Junge begangen hat. Er war sehr mutwillig, wie Jungen eben sind. Ich nehme an, daß du auch nicht anders warst.«
»Und ob«, stimmte er zu.
»Es ist wirklich unvernünftig, wenn man Menschen gegenüber Vorurteile hat.«
»Erzähl mir von Dickon.«
Ich versuchte, Dickon zu beschreiben, was nicht leicht war. »Er hat sehr schönes blondes Haar, das in Locken um seinen Kopf liegt. Seine Augen sind blau ... nicht dunkelblau wie meine, sondern heller. Sein Gesicht wirkt, als hätte es ein großer Bildhauer geschaffen.«
»Apollo hat sich unter uns Irdische gemischt.«
»Er ist sehr charmant.«
»Den Eindruck habe ich allerdings.«
»Aber auf sehr ungewöhnliche Art. Er nimmt nie etwas ernst... außer unserer Beziehung. Er ist sehr schlagfertig und kann manchmal grausam sein ... allerdings niemals mir gegenüber. Dadurch liebe ich ihn noch mehr. Ohne diesen Fehler wäre er zu vollkommen.«
»Ein bißchen Unvollkommenheit macht den Charme erst unwiderstehlich. Das verstehe ich.«
»Was ich dir jetzt sage, darfst du meiner Mutter auf keinen Fall verraten, versprichst du es mir?«
»Ich verspreche es.«
»Ich glaube, daß sie ein bißchen eifersüchtig auf ihn ist.«
»Wirklich?«
»Ja, daran ist ihre Mutter, meine liebe Großmutter Clarissa, schuld. Lange bevor sie den Vater meiner Mutter heiratete, hatte sie eine Romanze – sehr kurz, aber sehr tiefreichend – mit einem Jungen. Es war sehr –«
»Unschuldig?«
»Ja. Er wurde wegen der Rebellion im Jahr 1715 verbannt. Dann heiratete sie meinen Großvater, und meine Mutter kam zur Welt. Der junge Mann kehrte Jahre später zurück, als mein Großvater bereits gestorben war, doch statt meine Großmutter zu heiraten, heiratete er ihre Cousine Sabrina und fiel dann in der Schlacht von Culloden. Sabrina brachte sein Kind zur Welt und das war Dickon. Meine Großmutter und Sabrina erzogen ihn gemeinsam, und beide hingen sehr an ihm. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Meine Mutter hat immer das Gefühl gehabt, daß ihre Mutter Dickon mehr liebte als sie selbst. Es ist ein bißchen kompliziert, aber kannst du mich trotzdem verstehen?«
»O ja.«
»Deshalb haßt sie Dickon.«
»Hat sie keinen triftigeren Grund?«
»Ach, Gründe finden sich immer. Man muß nur jemanden nicht mögen, dann fallen einem alle möglichen Gründe ein, um die eigene Haltung zu rechtfertigen.«
»Du bist ja beinahe eine Philosophin.«
»Du lachst mich aus.«
»Ganz im Gegenteil, ich bewundere dich uneingeschränkt. Ich lächle nur deshalb, weil ich so glücklich über dein Vertrauen zu mir bin.«
»Vielleicht könntest du Mutter beeinflussen.«
»Erzähl mir mehr.«
»Dickon und ich lieben einander.«
»Er ist um viele Jahre älter als du.«
»Nur um elf. Und wir werden alle einmal erwachsen.«
»Das läßt sich nicht leugnen.«
»Wenn ich vierzig bin, wird er einundfünfzig sein. Dann sind wir beide alt... es spielt also keine Rolle.«
»Es stimmt, die Kluft wird im Lauf der Jahre kleiner, aber wir müssen leider auch an die Gegenwart denken. Sein Heiratsantrag war vielleicht ein wenig voreilig.«
»Das finde ich nicht. Königinnen werden schon verlobt, wenn sie noch in der Wiege liegen.«
»Auch das stimmt, aber diese Verlobungen führen oft zu nichts. Im Leben muß man abwarten können. Was willst du tun? Dickon jetzt heiraten ... in deinem Alter?«
»Natürlich werden alle finden, daß ich nicht alt genug bin. Aber ich könnte warten, bis ich vierzehn bin.«
»Auch dann bist du noch sehr jung, und was machen zwei Jahre schon aus?«
Ich seufzte. »Wir müssen so lange warten, aber wenn ich vierzehn bin, wird mich nichts mehr aufhalten.«
»Vielleicht wird dich dann niemand mehr aufhalten wollen.«
»O doch, meine Mutter. Ich sage dir ja, sie haßt Dickon. Sie behauptet, daß er es auf Eversleigh abgesehen hat, nicht auf mich. Eversleigh gehört meiner Mutter, sie hat es geerbt, und ich bin ihr einziges Kind, deshalb wird es nach ihrem Tod vermutlich einmal an mich fallen. Ihrer Meinung nach will Dickon mich nur deshalb heiraten.«
»Und was glaubst du?«
»Ich weiß, daß er Eversleigh besitzen will. Im Augenblick verwaltet er Clavering, aber es ist nicht annähernd so groß wie unser Besitz. Wenn wir erst einmal verheiratet sind, will er nach Eversleigh übersiedeln. Das ist doch vollkommen natürlich, nicht wahr? Er ist ehrgeizig, und das gefällt mir an ihm.«
»Und deine Mutter glaubt, daß er dich nur wegen Eversleigh heiraten will?«
»Sie behauptet es jedenfalls.«
»Und es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit herauszubekommen?«
»Ich will sie nicht herausbekommen. Warum sollte er Eversleigh nicht haben wollen? Ich weiß, daß es mit ein Grund ist, warum er mich heiraten will. Es kann gar nicht anders sein. Wenn man jemanden mag, weil er ein Haus besitzt, ist das auch nicht anders, als wenn man jemanden mag, weil er schöne Haare oder ausdrucksvolle Augen hat.«
»Ich finde, daß es da noch einen Unterschied gibt. Augen und Haare gehören zu einem Menschen, ein Haus nicht.«
»Trotzdem, denk nicht darüber nach. Ich werde Dickon heiraten.«
»Ich stelle fest, daß du eine sehr willensstarke junge Dame bist.«
»Wenn du nur meine Mutter überreden könntest. Du bist doch jetzt ein Familienmitglied, nicht wahr? Als mein Vater hast du bei der Angelegenheit auch ein Wort mitzureden, obwohl ich dich gleich warnen muß: Nichts, was jemand gegen Dickon sagt, kann mich beeinflussen.«
»Das kann ich mir gut vorstellen, und als erst kürzlich anerkanntes Familienmitglied, dessen Anspruch auf die Achtung seiner Tochter noch auf sehr wackligen Beinen steht, würde ich nie den Versuch unternehmen, dich zu überreden. Ich kann dir nur meinen Rat anbieten, und bekanntlich nehmen wir gute Ratschläge nur dann an, wenn sie mit unseren eigenen Ansichten übereinstimmen. Deshalb werde ich dir nur das gleiche sagen, was ich jedem rate, der ein Problem hat: warte ab.«
»Wie lang?«
»Bis du alt genug bist, um zu heiraten.«
»Und wenn er wirklich Eversleigh will?«
»Du weißt ja, daß er es will.«
»Aber wenn ihm mehr daran liegt als an mir?«
»Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, wäre, daß deine Mutter Eversleigh jemand anderem vermacht und ihr abwartet, ob er dich trotzdem heiratet.«
»Sie müßte es jemandem aus der Familie hinterlassen.«
»Es wird sich bestimmt irgendein entfernter Verwandter finden.«
»Dickon gehört zur Familie. Mein Onkel Carl wollte ihm den Besitz nicht hinterlassen, weil sein Vater ein ›verdammter Jakobit‹ war, wie er ihn nannte. Onkel war ein bißchen inkonsequent, denn der Großvater meiner Mutter war auch einer. Aber vielleicht machte es ihm weniger aus, weil das eine Generation vorher war.«
»Damit sind wir wieder bei dem goldenen Grundsatz: abwarten. Schließlich kannst du derzeit kaum etwas anderes tun, Lottie, wenn du alles recht bedenkst.«
»Du findest nicht, daß ich zu jung bin, um zu wissen, was ich will... Das behauptet jedenfalls meine Mutter.«
»Du bist reif genug, um genau zu wissen, was du vom Leben erwartest. Ich will dir noch eine goldene Lebensregel mitgeben: Nimm dir alles, was du unbedingt haben willst, aber wenn dir dann die Rechnung präsentiert wird, bezahle fröhlich. Das ist die einzige Art, wie man leben kann.«
Ich sah ihn ernsthaft an. »Ich bin froh, daß du wiedergekommen bist. Ich bin froh, daß ich jetzt die Wahrheit weiß. Ich bin froh, daß du mein Vater bist.«
Ein befriedigtes Lächeln huschte über sein Gesicht. Mein neuer Vater war überhaupt nicht sentimental. Jean-Louis’ Augen hätten sich mit Tränen gefüllt, wenn ich ihm etwas Ähnliches gesagt hätte.
»Jetzt ist es an der Zeit, meine Einladung auszusprechen«, meinte mein Vater. »Ich werde bald abreisen. Willst du mich begleiten, zu einem kurzen Besuch? Ich möchte dir so gern etwas von meinem Land zeigen.«
***
Ich war stolz, weil ich mit ihm reisen durfte, und überall genauso ehrerbietig behandelt wurde wie er. Er war reich und in seinem Land angesehen, aber er hatte eine natürliche Vornehmheit an sich, die jeden beeindruckte, mit dem er es zu tun hatte. Er verlangte die beste Bedienung so natürlich, als hätte er ein Recht darauf, und die Menschen fügten sich ihm widerspruchslos.
Eine neue Welt eröffnete sich mir, und ich begriff, wie ruhig wir auf dem Land gelebt hatten. Wir hatten zwar gelegentlich Reisen nach London unternommen, aber nur selten, und ich war nie bei Hof gewesen, obwohl sich unser Hof, den der gute, aber einfache König Georg und seine hausbackene Gemahlin Charlotte führten, sicherlich wesentlich von dem des verschwenderischen König Ludwig XV. von Frankreich unterschied. Es war ein zynischer Streich der Geschichte, daß der tugendhafte Hof – und niemand konnte unseren König und unserer Königin diese Eigenschaft absprechen – verspottet wurde, während der unmoralische – und das traf zweifellos auf den Hof Ludwig XV. zu – vielleicht nicht gerade bewundert wurde, aber als amüsant und als angenehmer Aufenthaltsort galt.
Mein neuer Vater war entschlossen, mich zu bezaubern, mich dazu zu bringen, daß ich sein Land und seinen Lebensstil bewunderte. Und ich war nur zu bereit, mich bezaubern zu lassen.
Wir reisten gemächlich nach Aubigné und unterbrachen die Fahrt, um in entzückenden Gasthäusern zu nächtigen. Der Comte bezeichnete mich stolz als seine Tochter, und ich sonnte mich in seinem Glanz.
»Wir werden Paris und vielleicht auch Versailles später besuchen«, meinte er. »Ich lasse dich erst zurückfahren, wenn du einen großen Teil meines Landes gesehen hast.«
Ich lächelte glücklich, denn ich wünschte mir nichts sehnlicher.
Er war entzückt darüber, daß ich eine gute Reiterin war, denn es war seiner Ansicht nach eine viel bessere Art zu reisen als mit einer Kutsche. Es waren goldene Tage; ich ritt an seiner Seite, staunte immer noch darüber, daß er mein Vater war, war immer noch schuldbewußt, weil ich mich darüber freute, plauderte fröhlich und unbefangener mit ihm als mit meiner Mutter oder auch mit Jean-Louis. Das kam daher, daß der Comte ein Mann von Welt und davon überzeugt war, daß ich mit den Tatsachen des Lebens vertraut war. Er unternahm keinen Versuch, mich vor Dingen zu behüten, die ein Mensch mit meiner Intelligenz bereits wissen mußte. Dadurch fiel es mir leicht, mit ihm über Dickon zu sprechen. Er zeigte Verständnis für meine Gefühle und beleidigte mich nie durch die Feststellung, daß ich noch zu jung wäre, um wirklich tiefreichender Gefühle fähig zu sein. In seiner Gesellschaft fühlte ich mich nie als Kind.
Erst in Frankreich erwähnte er seine Familie und die Menschen, die ich kennenlernen würde. Merkwürdigerweise war mir bis dahin nie der Gedanke gekommen, daß er eine Familie besaß. Er hatte so viel von seinem Leben bei Hof erzählt, daß ich ihn mir nicht als häuslichen Menschen vorstellen konnte.
»Meine Tochter Sophie ist ungefähr um ein Jahr älter als du«, begann er. »Ich hoffe, daß ihr Freundinnen werdet.«
»Deine Tochter!« rief ich erstaunt. »Ich habe eine Schwester!«
»Halbschwester«, stellte er richtig. »Ihre Mutter ist vor fünf Jahren gestorben. Sie ist ein braves Mädchen, und ich bin davon überzeugt, daß ihr euch anfreunden werdet. Ich werde sogar darauf bestehen.«
»Eine Schwester...«, murmelte ich. »Hoffentlich mag sie mich. Du kannst sie nämlich nicht dazu zwingen, mich zu mögen.«
»Sie ist dazu erzogen worden, zu gehorchen ... Ihre Erziehung war etwas strenger als die deine.«
»Sophie«, wiederholte ich. »Wie interessant. Ich freue mich auf sie.«
»Ich möchte dich auf unseren Haushalt vorbereiten, ich habe nämlich auch noch einen Sohn: Armand, Vicomte de Graffont. Graffont ist ein kleiner Besitz meiner Familie in der Dordogne. Wenn ich sterbe, wird natürlich Armand den Titel erben. Er ist um fünf Jahre älter als Sophie.«
»Ich habe also auch einen Bruder. Wie aufregend! Ob es viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, daß sie Verwandte haben?«
»Tausende. Das Leben sorgt für die ungewöhnlichsten Überraschungen. Vermutlich trägt jeder Mensch sein kleines Geheimnis mit sich herum.«
»Halten sich deine Kinder im Château oder in Paris auf?«
»Sophie befindet sich mit ihrer Gouvernante im Château. Bei Armand weiß ich es nicht genau; er führt ein sehr eigenständiges Leben.«
»Ich bin so aufgeregt, mein Leben wird von Minute zu Minute interessanter. Zuerst ein neuer Vater... und jetzt eine Schwester und ein Bruder. Gibt es noch weitere Verwandte?«
»Nur entfernte, die dich nicht betreffen.«
Ich war so verwirrt, daß ich die Landschaft kaum wahrnahm.
Wir waren in Le Havre an Land gegangen, von dort nach Elbôeuf geritten und hatten dann eine Nacht in Evreux, der Hauptstadt von Eure, verbracht, denn in dieser Provinz lag auch das Château d’Aubigné.
Als wir Evreux erreichten, sandte der Comte zwei Reitknechte zum Château voraus, damit sie unsere Ankunft ankündigten, und drängte dann darauf, daß wir bald aufbrachen, denn er konnte es kaum noch erwarten, nach Hause zu kommen.
Und dann erblickte ich das Schloß, das auf einem sanften Hang lag, zum erstenmal; es war aus grauen Steinen errichtet und wirkte mit seinen Strebepfeilern und den mit Kragsteinen versehenen Wachttürmen geradezu einschüchternd. Ich betrachtete staunend das mächtige Gebäude mit den Schildmauern zu beiden Seiten des Pförtnerhauses.
Der Comte sah, wie beeindruckt ich war. »Ich freue mich, daß dir mein Château gefällt. Natürlich sieht es nicht mehr so aus wie früher. Einmal war es ausschließlich eine Festung. Seine jetzige Gestalt hat es im sechzehnten Jahrhundert erhalten, als sich die französische Architektur auf ihrem Höhepunkt befand.«
Die Dämmerung brach herein, und im Zwielicht sah das Château geheimnisvoll, beinahe bedrohlich aus. Als ich in den Hof ritt, überlief mich ein Schauder, wie eine Warnung vor einer lauernden Gefahr.
»Morgen früh werde ich dich selbst durch das Schloß führen«, meinte der Comte. »Du wirst feststellen, daß ich dabei ziemlich prahlerisch und überheblich sein werde.«
»Das wäre jeder in deiner Lage.«
»Nun, es ist jetzt auch deine Familie, Lottie.«
Ich stand in der Halle. Der Comte hatte mir die Hand auf die Schulter gelegt und beobachtete mich aufmerksam, um zu sehen, welchen Eindruck sein Haus auf mich machte. Natürlich war ich überwältigt. Es war so großartig, mahnte so sehr an die Vergangenheit. Ich hatte das Gefühl, daß ich in ein anderes Zeitalter geraten war; es erfüllte mich mit Stolz, daß ich zu den Menschen gehörte, die jahrhundertelang hier gelebt hatten. Dennoch hielt die leichte Beunruhigung an, die ich mir nicht erklären konnte.
An den alten Wänden hingen Wandteppiche, auf denen Schlachtenszenen dargestellt waren, und wo es keine Teppiche gab, hingen glänzende Waffen; einige Rüstungen standen in den dunklen Ecken wie Wächter, und es wäre mir nicht schwergefallen, mir einzureden, daß sie sich bewegten, und daß in der Halle jemand anwesend war, der mich genauso abschätzte wie ich das Haus. Auf dem langen Eichentisch standen zwei Kandelaber, und die Kerzen warfen ihren flackernden Lichtschein auf die gewölbte Decke.
Ein Mann kam in die Halle geeilt; in seiner blaugrünen Livree mit den Messingknöpfen sah er bedeutend aus. Er begrüßte den Comte unterwürfig.
»Alles steht bereit, Monsieur le Comte.«
»Gut. Weiß der Vicomte, daß ich hier bin?«
»Monsieur le Vicomte befand sich auf der Jagd, als Ihre Boten eintrafen. Er ist noch nicht zurückgekehrt.«
Der Comte nickte. »Mademoiselle Sophie ...«
»Ich werde jemanden zu ihrem Apartment schicken, Monsieur le Comte.«
»Tun Sie das unverzüglich.«
Der Mann verschwand, und der Comte wandte sich mir zu.
»Es ist am besten, wenn du Sophie sofort kennenlernst. Sie kann dafür sorgen, daß alles seine Ordnung hat.«
»Was werden sie sagen, wenn sie es erfahren?«
Er sah mich fragend an, und ich fuhr fort: »Wenn sie erfahren, wer ich bin ... wie ich mit dir verwandt bin.«
Er lächelte mild. »Mein liebes Kind, niemand hat das Recht, meine Handlungen zu kritisieren.«
In diesem Augenblick sah ich Sophie.
Sie kam die schöne Treppe am Ende der Halle herunter, und ich musterte sie sehr genau. Wir waren einander überhaupt nicht ähnlich. Sie war klein, hatte dunkelbraunes Haar und olivfarbene Haut. Sie war bestimmt nicht sehr hübsch – freundliche Menschen bezeichnen Leute wie sie als einfach, und die weniger freundlichen als reizlos. Sie war zu dick und zu plump, um anziehend zu wirken, und ihr blaues Kleid mit dem eng geschnürten Mieder und dem weiten Reifrock, der wie eine Glocke um sie stand, trug nicht zur Verbesserung ihres Aussehens bei.
»Sophie, mein Liebling«, begrüßte sie der Comte, »ich möchte dir Lottie vorstellen ...«
Sie trat zögernd näher. Wahrscheinlich hatte sie großen Respekt vor ihrem Vater.
»Ich möchte dir etwas erklären, was Lottie betrifft... Sie wird einige Zeit bei uns bleiben, und du sollst dafür sorgen, daß sie sich hier wohlfühlt. Und das Wichtigste: Sie ist deine Schwester.«
Sophies Mund klappte auf. Sie war erstaunt, was mich nicht überraschte.
»Wir haben einander erst kürzlich entdeckt. Was sagst du dazu, Sophie?«
Die arme Sophie! Sie stotterte und sah aus, als würde sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen.
Ich kam ihr zu Hilfe. »Ich freue mich sehr, eine Schwester zu haben. Ich wollte immer schon Geschwister haben – für mich ist es wie ein Wunder.«
»Ich bin davon überzeugt, daß du genauso empfindest, Sophie«, sagte der Comte. »Ihr werdet einander in den nächsten Tagen sicherlich näherkommen. Aber jetzt ist Lottie müde. Sie möchte sich umkleiden und waschen, nehme ich an. Sophie, du weißt ja, wo sich ihr Zimmer befindet. Bring sie hin und sorge dafür, daß sie alles bekommt, was sie benötigt.«
»Ja, Papa.«
»Ist ein Zimmer für sie hergerichtet worden?«
»Ja, Papa, die Reitknechte haben berichtet, daß du eine junge Dame mitbringst.«
»Dann ist ja alles in Ordnung, Lottie, geh mit Sophie mit. Sie wird dir den Weg zeigen.«
Ich bedauerte sie. »Ich werde lernen müssen, mich allein im Château zurechtzufinden. Es ist sehr groß, nicht wahr?«
»Allerdings«, stimmte sie zu.
»Führ sie jetzt hinauf«, wiederholte der Comte, »und wenn sie fertig ist, bring sie wieder herunter, denn dann werden wir essen. Reisen macht hungrig.«
»Ja, Papa.«
Er legte mir die Hand auf den Arm. »Du und Sophie, ihr müßt Freundinnen werden.« Ich sah zu Sophie hinüber und nahm an, daß sie das als Befehl empfand. Solche Befehle akzeptierte ich nicht. Ich wollte meine Schwester näher kennenlernen. Ich wollte ihre Freundin werden, aber nur, wenn es sich von selbst ergab.
»Bitte komm mit mir«, forderte mich Sophie auf.
»Danke«, antwortete ich und war froh, daß Jean-Louis mich Französisch gelehrt hatte. Seine Mutter war Französin gewesen, und obwohl er sehr jung gewesen war, als sie ihn verließ, hatte er seine Französischkenntnisse gepflegt, indem er weiterhin französische Bücher las; dann hatte er mich die Sprache in Wort und Schrift gelehrt. Meine Mutter hatte darauf bestanden. Ich begriff jetzt erst, daß sie es getan hatte, weil mein leiblicher Vater Franzose war. Und deshalb konnte ich mich jetzt mit Sophie unterhalten.
Ich folgte ihr die Treppe hinauf in mein Zimmer. Es war sehr groß und enthielt ein Himmelbett mit moosgrünen, golddurchwirkten Vorhängen; sie paßten zu den Fenstervorhängen und zu den Aubusson-Wandteppichen, durch die der Raum wirklich luxuriös wirkte.
»Ich hoffe, daß du dich wohlfühlen wirst«, meinte Sophie höflich. »Hier ist die Ruelle, in der du Toilette machen kannst.«
Es handelte sich um einen mit einem Vorhang abgeschlossenen Alkoven, in dem sich alles befand, was ich brauchte.
»Die Sattelpferde mit deinem Gepäck sind schon abgeladen. Dort drüben steht es.«
Vermutlich versuchte sie, sich so natürlich wie möglich zu benehmen, um ihre Verblüffung über unsere Verwandtschaft zu verbergen.
Ich konnte nicht anders, ich mußte sie fragen. »Was hast du gedacht, als dein Vater dir mitteilte, wer ich bin?«
Sie blickte zu Boden und suchte nach Worten, und sie tat mir plötzlich leid, denn sie schien Angst vor dem Leben zu haben und auch vor ihrem Vater, mit dem ich mich so rasch so gut verstanden hatte. Ich wollte ihr helfen. »Es muß ein Schock für dich gewesen sein.«
»Daß es dich gibt? Eigentlich nicht. Solche Dinge passieren. Daß er dich ins Schloß gebracht und einfach vorgestellt hat«, sie zuckte die Schultern, »ja, das hat mich ein wenig überrascht, weil ...«
»Weil ich nur zu einem kurzen Besuch hier bin?«
»Das meinte ich. Wenn du für immer bei uns geblieben wärst...«
Sie hatte die störende Gewohnheit, ihre Sätze nicht zu beenden, aber vielleicht war das auf den Schock zurückzuführen. Sie hatte recht. Da ich nur zu einem kurzen Besuch da war, hätte mich der Comte zuerst als Gast vorstellen und erst später und nicht so unvermittelt erklären können, wie wir miteinander verwandt waren.
»Das alles ist so herrlich aufregend«, schwärmte ich. »Plötzlich zu entdecken, daß ich eine Schwester habe!«
Sie sah mich beinahe verschämt an. »Ja, damit hast du recht.«
In diesem Augenblick ging die Tür auf, und ein Gesicht schaute herein.
»Ach, du bist es, Lisette«, sagte Sophie. »Das hätte ich mir denken können.«
Ein Mädchen trat ins Zimmer. Sie konnte nicht viel älter sein als ich – höchstens ein bis zwei Jahre. Sie war sehr hübsch, hatte blondes, gelocktes Haar und funkelnde blaue Augen.
»Sie ist also gekommen.« Lisette musterte mich.
»Du bist ja schön«, stellte sie dann fest.
»Danke. Es freut mich, daß ich das Kompliment erwidern kann.«
»Du sprichst hübsch. Nicht wahr, Sophie? Kein ganz einwandfreies Französisch, aber nicht schlecht. Bist du zum erstenmal in Frankreich?«
»Ja. Wer bist du?«
»Lisette. Ich lebe hier. Ich bin die Nichte von Madame la Gouvernante, der Haushälterin. Tante Berthe ist eine sehr wichtige Dame, nicht wahr, Sophie?«
Sophie nickte.
»Ich lebe seit meinem sechsten Lebensjahr hier«, fuhr Lisette fort. »Jetzt bin ich vierzehn. Der Comte hat mich sehr gern. Ich werde gemeinsam mit Sophie unterrichtet, und obwohl ich nur die Nichte der Gouvernante bin, bin ich ein angesehenes Mitglied des Haushalts.«
»Ich freue mich, dich kennenzulernen.«
»Du bist zu jung, um eine Freundin des Comte zu sein. Aber angeblich gibt der König den Ton an, und wir alle wissen, wie es in Versailles zugeht.«
»Sei still, Lisette.« Sophie war rot geworden. »Papa hat mir gerade etwas erklärt. Lottie ist seine Tochter und somit meine Schwester.«
Lisette starrte mich an; in ihre Wangen stieg Farbe, und ihre Augen leuchteten wie Saphire.
»O nein, das glaube ich nicht.«
»Das ist deine Sache. Er hat es mir jedenfalls erzählt, und deshalb ist sie da.«
»Und deine Mutter?« Lisette sah mich fragend an.
»Meine Mutter lebt in England. Ich bin nur zu Besuch hier.«
Lisette betrachtete mich, als sähe sie mich in neuem Licht.
»Besucht der Comte sie oft?«
»Sie haben einander jahrelang nicht gesehen. Ich habe erst vor kurzer Zeit, als er bei uns zu Gast war, erfahren, daß er mein Vater ist.«
»Das ist alles so komisch«, bemerkte Lisette. »Ich meine nicht die Tatsache, daß du ein Bastard bist. Von denen gibt es weiß Gott genug auf der Welt. Aber da hat er dich all die Jahre nicht gesehen, und dann bringt er dich plötzlich her und macht kein Geheimnis daraus.«
»Mein Vater hält es eben nicht für nötig, Geheimnisse zu haben«, meinte Sophie.
»Das stimmt«, bestätigte Lisette. »Er tut, was er will, und die anderen müssen sich damit abfinden.«
»Lottie möchte sich waschen und umziehen. Wir sollten sie jetzt allein lassen.«
Damit ergriff sie Lisettes Arm und führte sie aus dem Zimmer. Lisette war durch die Neuigkeit so verblüfft, daß sie ihr widerspruchslos folgte.
»Danke, Sophie«, sagte ich.
In meinem Gepäck fand ich ein Kleid – es entsprach kaum dem großartigen Rahmen des Châteaus, aber es war tiefblau, paßte zu meiner Augenfarbe, und ich wußte, daß es mir stand. Nach einiger Zeit erschien Sophie, um mich hinunterzuführen. Sie hatte sich ebenfalls umgezogen, aber dieses Kleid stand ihr auch nicht besser als dasjenige, in dem ich sie kennengelernt hatte.
»Ich weiß nicht, was du von Lisette hältst«, sagte sie. »Sie hatte nicht das Recht, so hereinzuplatzen.«
»Ich finde sie recht interessant und sehr hübsch.«
»Ja.« Sophie schien zu bedauern, daß sie in dieser Beziehung nicht mithalten konnte. »Aber sie gibt an. Sie ist schließlich nur die Nichte der Haushälterin.«
»Offensichtlich ist die Haushälterin eine sehr wichtige Person im Château.«
»O ja. Sie kümmert sich um den ganzen Haushalt... die Küche, die Dienstmädchen, einfach um alles. Sie und Jacques, unser Majordomus, wahren ihre Rechte eifersüchtig. Mein Vater war sehr gut zu Lisette und erlaubte ihr, hier unterrichtet zu werden. Das gehört wahrscheinlich zu dem Abkommen, das er mit Tante Berthe geschlossen hat. Ich nenne sie immer Tante Berthe, weil Lisette es auch tut. In Wirklichkeit heißt sie Madame Clavel. Ich glaube nicht, daß sie wirklich eine ›Madame‹ ist, aber sie bezeichnet sich so, weil sie dann mehr Ansehen genießt, als wenn sie nur eine Demoiselle wäre. Sie ist sehr streng und genau, und niemand könnte sich vorstellen, daß sie verheiratet ist. Sogar Lisette hat Respekt vor ihr.«
»Lisette legt sich überhaupt keine Zurückhaltung auf.«
»Das stimmt. Sie drängt sich immerzu in den Vordergrund. Sie würde gern mit uns bei Tisch essen, aber Armand würde das nie gestatten. Er hat sehr genaue Vorstellungen von der Stellung der Dienerschaft, und Lisette gehört ja eigentlich dazu. Sie muß viel für Tante Berthe erledigen. Aber es hat ihr ähnlich gesehen, so hereinzuplatzen. Sie war verblüfft, als sie erfuhr ...«
»Ja, das habe ich bemerkt. Doch die meisten Menschen würden so darauf reagieren.«
Sie war nachdenklich. »Mein Vater tut nur, was ihm gefällt; er ist offensichtlich stolz auf dich und will, daß alle erfahren, daß er dein Vater ist. Du siehst sehr gut aus.«
»Danke.«
»Dafür mußt du dich nicht bedanken. Ich achte immer auf das Äußere der anderen. Wahrscheinlich, weil ich selbst so häßlich bin.«
»Das bist du doch gar nicht«, log ich.
Sie lächelte nur.
Die erste Mahlzeit im Château verlief sehr zeremoniell. Ich weiß nicht mehr, was wir gegessen haben, ich war zu aufgeregt, um es zu bemerken. Die Kerzen auf dem Tisch verliehen dem Raum ein geheimnisvolles Aussehen – auch hier hingen überall Wandteppiche –, und ich hatte das unheimliche Gefühl, daß mich Gespenster beobachteten. Alles war so elegant: das Besteck, die Silberbecher, die Diener in ihrer blaugrünen Livree, die geräuschlos hin und her huschten, Teller wegnahmen und mit einer Schnelligkeit, die an Zauberei grenzte, neue vor uns hinstellten. Welcher Gegensatz zu Eversleigh, wo die Diener mit den Suppenschüsseln und den Platten mit Rindfleisch, Hammelbraten und Pasteten herein- und hinausstampften.
Aber ich mußte meine Aufmerksamkeit der Gesellschaft widmen. Ich wurde meinem Halbbruder Armand, einem sehr weltklugen, etwa achtzehn Jahre alten jungen Mann vorgestellt, dem es offensichtlich Spaß machte zu entdecken, wer ich war.
Er sah sehr gut aus und hatte viel Ähnlichkeit mit dem Comte, obwohl sein Kinn noch nicht so kräftig entwickelt war. Doch das würde später kommen, denn ich war davon überzeugt, daß Armand genauso auf seiner Freiheit bestehen würde wie sein Vater. Jedenfalls gewann ich diesen Eindruck von ihm. Er war verwöhnt, das stand ebenfalls fest; seine stutzerhafte Art war ausgeprägter als bei seinem Vater. Sein Gesichtsausdruck war hochmütig und sein Benehmen darauf angelegt, jedermann deutlich zu machen, daß er ein Aristokrat war. Seine Augen musterten mich beifällig, was mich freute; das gute Aussehen, das ich von meiner Vorfahrin Carlotta geerbt hatte, öffnete mir alle Türen.
Der Comte saß an einem Ende des Tisches, und Sophie an dem anderen. Die Entfernung zwischen ihnen schien ihr recht zu sein. Ich saß rechts vom Comte und gegenüber von Armand, aber der Tisch war so groß, daß wir weit voneinander getrennt waren.
Armand stellte mir viele Fragen über Eversleigh, und ich erklärte, daß meine Mutter es erst kürzlich geerbt hatte und daß ich den größten Teil meines Lebens in Clavering, in einem anderen Teil des Landes, verbracht hatte.
Sophie sprach kein Wort, so daß die übrigen beinahe vergaßen, daß sie auch am Tisch saß, aber ich wurde ständig ins Gespräch einbezogen, bis sie sich über Angelegenheiten des Hofes verbreiteten, und ich nur noch interessiert zuhörte.
Armand war vor wenigen Tagen aus Paris zurückgekehrt und behauptete, daß sich die Haltung der Pariser dem König gegenüber geändert hatte.
»Solche Veränderungen werden immer zuerst in der Hauptstadt deutlich«, bestätigte der Comte, »obwohl Paris den König bereits seit langem haßt. Die Zeit, als man ihn ›Den Vielgeliebten‹ nannte, ist längst vorbei.«
»Er ist jetzt ›Der Vielgehaßte‹«, fügte Armand hinzu. »Er sucht die Hauptstadt nur dann auf, wenn es unbedingt erforderlich ist.«
»Er hätte nie die Straße von Versailles nach Compiègne bauen dürfen. Er hätte nie die Achtung der Pariser verlieren dürfen. Die Situation ist zweifellos gefährlich. Er müßte seinen Lebensstil sofort ändern, dann wäre es vielleicht...«
»Das wird er niemals tun«, widersprach Armand. »Außerdem haben wir nicht das Recht, ihm deshalb Vorwürfe zu machen.« Er sah boshaft zu mir herüber, und ich begriff, was er meinte. Er warf meinem Vater vor, daß er ein genauso unmoralisches Leben führte wie der König, und ich hatte das Bedürfnis, den Comte gegen seinen zynischen Sohn zu verteidigen. »Aber ich glaube, daß der Hirschpark jetzt kaum mehr benützt wird«, fuhr Armand fort.
»Er wird eben alt. Dennoch wird die politische Lage immer gefährlicher.«
»Ludwig ist König, und daran kann niemand rütteln.«
»Hoffentlich versucht es niemand.«
»Das Volk wird immer unzufrieden sein, das ist nichts Ungewöhnliches.«
»In England hat es Unruhen gegeben«, warf ich ein. »Angeblich wegen der hohen Lebensmittelpreise. Die Regierung hat Soldaten eingesetzt, und mehrere Menschen wurden getötet.«
»Das ist das einzig Richtige«, bestätigte Armand. »Gleich das Militär einschalten.«
»Wir sollten die Wirtschaft fördern«, meinte der Comte. »Dann hätten wir nicht so viele Arme. Wenn das Volk sich einmal erhebt, stellt es eine ansehnliche Macht dar.«
»Nicht solange wir über die Armee verfügen, um es in Schach zu halten«, widersprach Armand.
»Dennoch ist es möglich, daß das Volk sich eines Tages gewaltsam sein Recht verschafft«, warnte der Comte.
»Das werden sie nie wagen«, behauptete Armand leichthin. »Und wir langweilen unsere neue Schwester Lottie mit diesem öden Gerede.« Er betonte meinen Namen auf der letzten Silbe, was bezaubernd klang.
Ich lächelte ihm zu. »Nein, ich langweile mich nicht im geringsten. Mich interessiert alles, was ihr erzählt, und ich möchte immer wissen, was vor sich geht.«
»Wir werden morgen gemeinsam ausreiten«, versprach Armand. »Ich werde dir die Umgebung zeigen, kleine Schwester. Und ich nehme an, daß du Lottie Paris zeigen wirst, Papa?«
»Sehr bald. Ich muß ohnehin in die Stadt.«
Die Mahlzeit nahm kein Ende, doch endlich erhoben wir uns und tranken in einem kleinen Salon noch ein Glas Wein. Ich war so müde, daß mir die Augen zufielen. Der Comte merkte es und befahl Sophie, mich in mein Zimmer zu bringen.
Die Tage waren voll neuer Eindrücke und vergingen wie im Flug. Das Château begeisterte mich, es war architektonisch ungemein reizvoll, um so mehr, als es Bauteile aus mehreren Jahrhunderten aufwies. Am besten erkannte man das aus einiger Entfernung, und während der ersten Tage genoß ich diesen Anblick bei jedem Ausritt: Die steilen Dächer, die alten Zinnen, die Schildmauern, die Brüstung mit den Kragsteinen, in die über zweihundert Pechnasen eingelassen waren, der zylindrische Bergfried oberhalb der Zugbrücke – ein Bild der Macht und der Unbezwingbarkeit.
Es berührte mich tief, daß dies das Heim meiner Vorfahren war, und dann bereute ich diese Gedanken wieder, weil ich mit meiner Mutter und Jean-Louis im geliebten, gemütlichen Clavering so glücklich gewesen war.
Doch ich konnte nicht anders, ich war stolz darauf, zur Familie d’Aubigné zu gehören.
Zuerst befürchtete ich, daß ich mich nie im Château zurechtfinden würde. Ich verirrte mich ständig und entdeckte dabei immer neue Räumlichkeiten. Es gab den ältesten Teil mit kurzen Wendeltreppen und den Verliesen, in dem die Luft kalt war und modrig roch. Es war mir unheimlich, denn hier waren die Feinde der Familie gefangengehalten worden. Der Comte selbst zeigte mir die Verliese ... kleine dunkle Zellen mit großen Eisenringen an den Wänden, an die die Gefangenen gekettet worden waren. Als ich erschauerte legte er mir den Arm um die Schultern. »Vielleicht hätte ich dich nicht hierher bringen sollen. Aber man kann das Leben nur begreifen, wenn man alle seine Facetten kennenlernt.«
Dann führte er mich in die Gemächer, die seine Vorfahren dem König zur Verfügung gestellt hatten, wenn er auf Reisen war, und die mir mit ihrer eleganten Einrichtung eine ganz andere Seite des Châteaus zeigten.
Von den Zinnen aus überblickte man die liebliche Gegend bis zu der Stadt mit den Fachwerkhäusern und den engen Straßen. So viele Eindrücke stürmten in so kurzer Zeit auf mich ein, und ich dachte oft: Wenn ich Dickon wiedersehe, muß ich ihm von all dem berichten. Es wird ihn bestimmt interessieren, und er wäre sicherlich begeistert, wenn er einen solchen Besitz bewirtschaften könnte.
Doch am interessantesten waren die Menschen um mich. Ich war viel mit dem Comte beisammen, der von meiner Gesellschaft nicht genug bekommen konnte, was bemerkenswert war, weil er Sophie so gleichgültig behandelte. Offensichtlich hatte ich großen Eindruck auf ihn gemacht, oder aber er liebte meine Mutter wirklich, und ich erinnerte ihn an die Zeit, die er mit ihr verbracht hatte. Sie war wahrscheinlich ganz anders als die Menschen, mit denen er sonst verkehrte. Ich hatte ein Porträt seiner Frau gesehen, die genauso schüchtern aussah wie Sophie. Sie war sehr jung gewesen, als das Bild gemalt worden war.
Manchmal besuchte mich Sophie in meinem Zimmer, und Lisette leistete uns auch Gesellschaft. Ich hatte allerdings den Eindruck, daß Sophie dem Mädchen seine Aufdringlichkeit verbieten wollte, aber Angst vor ihm hatte, wie vor so vielem anderem.
Ich freute mich über Lisettes Anwesenheit, denn sie plauderte über alles mögliche, und obwohl ich Sophie allmählich lieb gewann, war sie keine sehr unterhaltsame Gesprächspartnerin.
Ich hatte auch schon die berüchtigte Tante Berthe erblickt, eine hochgewachsene Frau mit strengem Gesicht und schmalen Lippen, die aussahen, als würde es ihnen sehr schwer fallen zu lächeln. Ich hatte erfahren, daß sie sehr fromm war und die Dienstmädchen in strenger Zucht hielt, was Lisette zufolge gar nicht so leicht war, weil die Männer immer hinter den Mädchen her waren.
»Du weißt ja, wie die Männer sind«, lachte Lisette. »Sie schwanken zwischen dem Verlangen nach den Mädchen und der Angst vor Tante Berthe. Wenn sie einen von ihnen dabei erwischt, würde sie darauf bestehen, daß beide das Château verlassen müssen.«
»Der Comte würde sie sicherlich nicht so streng bestrafen.«
»Du meinst, weil er selbst kein reines Gewissen hat?« Lisette sprudelte ohne zu überlegen alles heraus, was ihr durch den Kopf ging. Sie führte bestimmt einen nicht ganz einwandfreien Lebenswandel. Wahrscheinlich verließ sie sich darauf, daß ihre Tante hinter ihr stand und nie zulassen würde, daß ihre Nichte aus dem Haus gewiesen wurde.
Lisette sprach gern über Liebhaber; meiner Meinung nach, um Sophie zu necken. Es machte ihr Spaß zu zeigen, wie weit sie der armen Sophie an Witz und gutem Aussehen überlegen war.
»Eines Tages wird sich ein Ehemann für mich finden«, erklärte sie einmal, »genau wie für dich, Sophie. Der einzige Unterschied wird darin bestehen, daß du einen Edelmann bekommen wirst und ich einen ehrenwerten Angehörigen der Bourgeoisie, der vor Tante Berthes strengen Augen Gnade findet.«
Sophie sah verschüchtert aus, wie immer, wenn die Rede auf ihre Heirat kam.
»Eine Ehe kann etwas sehr Angenehmes sein«, meinte ich, um sie zu trösten.
»Ich weiß, daß sie schrecklich sein wird«, antwortete sie.
Ich erzählte ihnen von Dickon, und sie lauschten begierig, besonders Lisette.
»Es wird nicht mehr lange dauern«, meinte Sophie bekümmert, »bis ich bei Hof zugelassen werde. Papa ist davon überzeugt, daß mir dort nichts geschehen wird. Der König liebt junge Mädchen, wird mir aber sicherlich keine besondere Aufmerksamkeit schenken.«