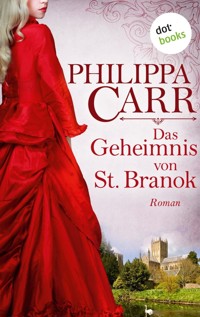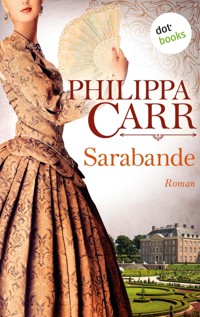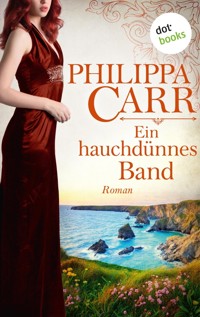Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jedes Glück hat ihren Preis: Die große Saga »Die Töchter Englands: Schicksalsjahre« von Philippa Carr jetzt als eBook bei dotbooks. Während die Stürme der Zeit über England aufziehen, riskieren diese vier Frauen alles, um sich und ihre Liebsten zu schützen … England, 1755: Nach den Schrecken der Jakobiteraufstände glaubt die schöne Zippora Ransome, ihr Glück in einer zwar leidenschaftslosen, aber sicheren Ehe gefunden zu haben. Doch dann begegnet sie bei einem Besuch auf Eversley, dem Stammsitz ihrer Familie, dem mysteriösen Adeligen Gerard d'Aubigné. Vom ersten Moment an lösen seine Blicke etwas in Zippora aus, was sie zuvor nie gespürt hat – doch sie ahnt nicht, in was für ein riskantes Spiel sie dadurch hineingezogen wird … Auch für die Ladys Charlotte, Claudine und Jessica hält das Schicksal größte Herausforderungen bereit – und es ist an den mutigen Frauen, für das zu kämpfen, was ihnen am meisten bedeutet … Bewegend, dramatisch, romantisch – vier Romane der international erfolgreichen Saga »Die Töchter Englands« erstmals in einem neu zusammengestellten Sammelband: Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Sammelband »Die Töchter Englands: Sehnsuchtsjahre« von Philippa Carr, auch bekannt als Jean Plaidy und Victoria Holt, ist der dritte Sammelband der Serie und umfasst die Bände 9 bis 12: »Die Erbin und der Lord«, »Im Sturmwind«, »Im Schatten des Zweifels« und »Der Zigeuner und das Mädchen«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2072
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Während die Stürme der Zeit über England aufziehen, riskieren diese vier Frauen alles, um sich und ihre Liebsten zu schützen … England, 1755: Nach den Schrecken der Jakobiteraufstände glaubt die schöne Zippora Ransome, ihr Glück in einer zwar leidenschaftslosen, aber sicheren Ehe gefunden zu haben. Doch dann begegnet sie bei einem Besuch auf Eversley, dem Stammsitz ihrer Familie, dem mysteriösen Adeligen Gerard d’Aubigné. Vom ersten Moment an lösen seine Blicke etwas in Zippora aus, was sie zuvor nie gespürt hat – doch sie ahnt nicht, in was für ein riskantes Spiel sie dadurch hineingezogen wird … Auch für die Ladys Charlotte, Claudine und Jessica hält das Schicksal größte Herausforderungen bereit – und es ist an den mutigen Frauen, für das zu kämpfen, was ihnen am meisten bedeutet …
Über die Autorin:
Philippa Carr ist – wie auch Jean Plaidy und Victoria Holt – ein Pseudonym der britischen Autorin Eleanor Alice Burford (1906–1993). Schon in ihrer Jugend begann sie, sich für Geschichte zu begeistern: »Ich besuchte Hampton Court Palace mit seiner beeindruckenden Atmosphäre, ging durch dasselbe Tor wie Anne Boleyn und sah die Räume, durch die Katherine Howard gelaufen war. Das hat mich inspiriert, damit begann für mich alles.« 1941 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem in den nächsten 50 Jahren zahlreiche folgten, die sich schon zu ihren Lebzeiten über 90 Millionen Mal verkauften. 1989 wurde Eleanor Alice Burford mit dem »Golden Treasure Award« der Romance Writers of America ausgezeichnet.
Eine Übersicht über den Romanzyklus »Die Töchter Englands« finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
Sammelband-Originalausgabe April 2023
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Die Originalausgabe von »Die Erbin und der Lord« erschien erstmals 1982 unter dem Originaltitel »The Adulteress«
Copyright © der englischen Originalausgabe 1982 by Philippa Carr
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 1986 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Die Originalausgabe von »Im Sturmwind« erschien erstmals 1983 unter dem Originaltitel »Zipporah’s Daughter«
Copyright © der englischen Originalausgabe 1983 by Philippa Carr
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1984 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KH, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Die Originalausgabe von »Im Schatten des Zweifels« erschien erstmals 1984 unter dem Originaltitel »Voices in a haunted room«.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1984 by Philippa Carr
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1986 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Die Originalausgabe von »Der Zigeuner und das Mädchen« erschien 1985 unter dem Titel »The Return of the Gypsy«.
Copyright © der Originalausgabe 1985 by Philippa Carr
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1988 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Stefan Hilden, hildendesign.de; Covermotive: © Shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-305-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie werden in diesem Roman möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen begegnen, die wir heute als unzeitgemäß und diskriminierend empfinden, unter anderem dem Begriff »Zigeuner«.
»Zigeuner« ist die direkte Übersetzung des im englischen Originaltext verwendeten Begriffs »Gypsy«, und es ist nicht möglich, dieses Wort in Titel und Text durch die heute gebräuchlichen Eigenbezeichnungen »Sinti und/oder Roma« zu ersetzen, weil sie inhaltlich nicht passen würden. Zur Handlungszeit im frühen 19. Jahrhundert war »Zigeuner« die gängige Fremdbezeichnung für die Sinti und Roma, wobei dieser Begriff seit dem 18. Jahrhundert vielerorts mit einem zunehmenden stigmatisierenden Rassismus verbunden war. Die Sinti und Roma lehnen die Bezeichnung »Zigeuner« daher heute zu Recht ab.
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt und von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Philippa Carr hat keinen Roman im Sinne der völkisch rassifizierten Nazi-Nomenklatur geschrieben, sondern verwendet Begrifflichkeiten so, wie sie aus ihrer Sicht zu der Zeit, in der ihr Roman spielt, verwendet wurden; Klischees werden hier bewusst als Stilmittel verwendet. Keinesfalls geht es in diesem fiktionalen Text aber um rassistische Zuschreibungen oder die Verdichtung eines aggressiven Feindbildes.
Es ist dotbooks wichtig, zu betonen, dass wir uns gegen die Verwendung des Begriffes »Zigeuner« im aktuellen Sprachgebrauch und gegen Diskriminierung jedweder Art aussprechen.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Hoffnungstage« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Philippa Carr
DIE TÖCHTER ENGLANDSHoffnungstage
Vier Romane in einem eBook
dotbooks.
Die Erbin und der Lord
Aus dem Englischen von Hilde Linnert
Die unruhigen Zeiten der Jakobitenaufstände sind vorbei – doch über einem englischen Landsitz braut sich im Jahre 1755 neues Unheil zusammen … Die schöne Zippora Ransome stammt von einer langen Linie Frauen ab, die für ihr Glück alles riskieren mussten. Wie gut, dass sie es an der Seite ihres treusorgenden Mannes bereits gefunden zu haben scheint, auch wenn die Ehe zu ihrem großen Kummer kinderlos geblieben ist. Doch dann ändert ein einziger Brief alles: Zippora wird von einem entfernten Verwandten auf dessen Stammsitz Eversleigh eingeladen – und lernt so Gerard d’Aubigné kennen. Sein Charme, sein gutes Aussehen und der Hauch von Gefahr, der ihn umweht, machen den französischen Edelmann unwiderstehlich … aber darf sich Zippora wie ihre Vorfahrinnen auf ein gewagtes Spiel einlassen, obwohl sie dadurch alles verlieren könnte, was ihr bisher wichtig war?
Kapitel 1Ein Hilferuf
Ich habe mich jedesmal gewundert, wenn sich Menschen, die ihr Leben lang die gesellschaftlichen Spielregeln eingehalten haben, plötzlich von Grund auf änderten und sich auf einmal anders gaben als bisher. Es war für mich daher beinahe ein Schock, als ich erkennen mußte, daß ich in das gleiche Fahrwasser geriet, und da das sicherlich auch für alle, die mich kannten, ein Schock gewesen wäre, mußte ich mein Abenteuer geheimhalten. Dafür gab es natürlich auch praktische Gründe.
Oft habe ich darüber nachgedacht, wie so etwas ausgerechnet mir widerfahren konnte, und ich habe nach Entschuldigungen gesucht. Ist es möglich, daß der Teufel von einem Menschen Besitz ergreift? Mittelalterliche Mystiker waren dieser Ansicht. War es innerer Zwang? War es der Geist eines längst Verstorbenen, der in meinen Körper schlüpfte und mich veranlaßte, gegen alle meine Grundsätze zu handeln? Warum versuche ich überhaupt, mein Gewissen zu beruhigen? Es gibt im Grunde nur eine vernünftige Erklärung: Daß ich mich selbst nicht gekannt hatte, bis die Versuchung an mich herangetreten war.
Alles begann an einem Tag im Frühjahr, der sich in nichts von allen anderen Tagen meiner schon zehnjährigen Ehe mit Jean-Louis Ransome unterschied. Unser Leben war friedlich und angenehm verlaufen. Jean-Louis und ich waren meist einer Meinung; wir kannten einander seit unserer Kindheit und waren zusammen aufgewachsen, denn meine Mutter hatte ihn kurz vor meiner Geburt in ihre Obhut genommen; er war damals vier Jahre alt. Seine Mutter war Französin und hatte ihn meiner Mutter überlassen, als er sich entschieden geweigert hatte, mit ihr und ihrem zweiten Mann in eine andere Gegend zu übersiedeln.
Alle Welt war überzeugt gewesen, daß wir einmal ein Paar werden würden, und unsere Heirat hatte daher allgemeine Befriedigung ausgelöst. Vielleicht war alles zu leicht und zu glatt gegangen, und wir waren deshalb ein so normales, konventionelles Ehepaar geworden.
Ich weiß noch, wie ich im Blumenzimmer stand und die gelben Narzissen, die ich kurz zuvor im Garten gepflückt hatte, in Vasen arrangierte. Der Garten ging unmerklich in den Wald über und war ein bißchen verwildert, aber gerade das gefiel Jean-Louis und mir. Um diese Jahreszeit stand die ganze Wiese voller Narzissen; ich liebte ihr leuchtendes Gelb, in dem ich einen Vorboten des Sommers sah. Ich verteilte sie überall im Haus; im Grunde bin ich ein Gewohnheitsmensch und tue vieles nur deshalb, weil ich es immer schon getan habe.
Ich bewunderte gerade, wie gut sich die Narzissen in einem Tafelaufsatz aus grünem Glas ausnahmen, als ich das Geräusch von Pferdehufen und dann Stimmen hörte.
Irritiert blickte ich auf. Ich hatte nichts gegen Besucher, aber es wäre mir lieber gewesen, wenn ich schon mit dem Arrangieren der Blumen fertig gewesen wäre.
Sabrina und Dickon kamen auf das Haus zu, also nahm ich ein Tuch, trocknete mir die Hände ab und ging ihnen entgegen.
Sabrina ist die Cousine meiner Mutter – eine auffallend schöne Frau, die vor langer Zeit in dramatische Ereignisse verstrickt war. Sie ist um zehn Jahre älter als ich, muß also damals etwa vierzig gewesen sein. Man sah ihr ihr Alter nicht an, obwohl gelegentlich ein gequälter Ausdruck in ihre Augen trat und sie ins Leere starrte, als blicke sie in die Vergangenheit. Sie hatte immer bei uns gewohnt, und meine Mutter hatte Mutterstelle an ihr vertreten. Dickon war Sabrinas Sohn, und sie hing meiner Meinung nach viel zu sehr an ihm. Er war erst nach dem Tod seines Vaters zur Welt gekommen.
»Zippora«, rief Sabrina. Ich habe mich oft gefragt, warum ich ausgerechnet diesen Namen bekommen habe, denn ich bin die einzige Zippora in der ganzen Familie. Als ich meine Mutter fragte, warum sie ihn gewählt habe, erklärte sie: »Ich wollte etwas Besonderes. Der Name gefiel mir, und dein Vater hatte natürlich nichts dagegen.« Ich fand heraus, daß es sich um einen Namen aus dem Alten Testament handelt, und war enttäuscht, weil das Leben der biblischen Zippora genauso ereignislos verlaufen war wie mein eigenes. Anscheinend bestand ihr ganzes Verdienst darin, daß sie Moses geheiratet und ihm zahlreiche Kinder geboren hatte. Ich unterschied mich nur dadurch von ihr, daß meine Ehe – zu Jean-Louis’ und meinem Kummer – kinderlos geblieben war.
»Zippora«, fuhr Sabrina fort, »deine Mutter möchte, daß ihr zum Abendessen hinüber kommt. Ginge es noch heute? Sie möchte etwas mit euch besprechen.«
»Ich glaube schon«, antwortete ich, während ich sie umarmte. »Hallo, Dickon.«
Er erwiderte meinen Gruß eher kühl. Für meine Mutter und für Sabrina war er der Mittelpunkt ihres Lebens. Ich fragte mich manchmal, was aus ihm werden würde. Er war erst zehn Jahre alt; vielleicht würde er sich ändern, wenn er in die Schule eintrat.
»Kommt weiter«, sagte ich, als wir am Blumenzimmer vorbei kamen.
»Ach, du hast die Narzissen arrangiert«, meinte Sabrina lächelnd. »Ich hätte es mir denken können.«
Anscheinend bin ich wirklich ein Gewohnheitstier.
»Hoffentlich habe ich dich nicht bei dem Ritual gestört«, fuhr sie fort.
»Nein, natürlich nicht. Ich freue mich, euch zu sehen. Macht ihr einen Spazierritt?«
»Ja, und wir wollten nur auf einen Augenblick bei dir vorbeischauen.«
»Möchtet ihr ein Glas Wein und die Spezialkekse unserer Köchin?«
»Wir wollen nicht so lange bleiben.«
Aber Dickon unterbrach sie. »Ja, bitte, ich hätte gern ein paar Kekse.«
Sabrina lächelte zärtlich. »Dickon hat eine Vorliebe für diese Kekse. Wir müssen uns einmal das Rezept geben lassen.«
»Die Köchin hütet ihre Rezepte eifersüchtig.«
»Du kannst ihr ja befehlen, es uns zu geben«, meinte Dickon herausfordernd.
»Oh, das würde ich nie wagen.«
»Du mußt Zippora also öfter besuchen, wenn du Kekse essen willst, Dickon«, schloß seine Mutter.
Die Erfrischung wurde gebracht. Dickon verschlang alle Kekse – sicherlich zur Freude der Köchin. Sie war auf Komplimente geradezu versessen. Wenn man sie lobte, war sie den ganzen Tag über guter Laune; hingegen genügte die Andeutung einer Kritik, um das Leben in der Küche zur Hölle werden zu lassen, wie eines der Dienstmädchen behauptete.
»Es klingt, als hätte meine Mutter etwas Wichtiges zu besprechen«, bemerkte ich.
»Schon möglich. Es geht um einen Brief von Onkel Carl – du weißt ja, Lord Eversleigh.«
»Ach so. Was will er denn?«
»Er macht sich Sorgen um Eversleigh, weil er keinen Sohn hat, der den Landsitz erben könnte. Es ist wirklich merkwürdig, daß es keinen direkten Nachkommen gibt. Das heißt, keinen männlichen Nachkommen, Mädchen gibt es ja genügend in der Familie. Ein Jammer, daß Onkel Carl keinen Sohn hat.«
»Doch, ich glaube, er hatte einen, aber der starb bei der Geburt.«
»O ja, das ist so lange her – die Mutter des Kindes starb ebenfalls. Es war ein schrecklicher Schlag für Onkel Carl, den er angeblich nie ganz überwunden hat. Er heiratete nie wieder, obwohl er Mätressen hatte, soviel ich weiß. Aber das alles ist vorbei, der alte Mann macht sich jetzt Sorgen wegen eines Erben und ist dabei auf dich verfallen.«
»Ausgerechnet auf mich! Was ist denn mit dir? Du bist doch älter als ich.«
»Deine Großmutter Carlotta war älter als meine Mutter Damaris, also stehst du wahrscheinlich vor mir in der Erbfolge. Außerdem würde er mich nicht in Betracht ziehen. Angeblich war er verärgert, als ich diesen verdammten Jakobiten heiratete.«
»Die Jakobiten waren tapfer«, mischte sich Dickon ein. »Wenn ich erwachsen bin, werde ich auch ein Jakobit.«
»Zum Glück dürfte dieser Unsinn jetzt vorbei sein«, antwortete ich. »1745 ist ein Schlußstrich darunter gezogen worden.«
Ich bereute diese Worte sofort, da ja Sabrina ihren Mann bei Culloden verloren hatte.
»Ich hoffe es auch«, sagte sie jedoch ganz ruhig. »Nun, Tatsache ist, daß Onkel Carl dich sprechen will, zweifellos, um dich als Erbin einzusetzen. Er schrieb an deine Mutter, die natürlich vor dir an der Reihe wäre, aber sie ist ja die Tochter des Erzjakobiten Hessenfield.«
»Es wimmelt geradezu von Jakobiten in unserer Familie«, murmelte Dickon.
»Folglich bleibst nur du übrig«, fuhr Sabrina fort. »Onkel Carl schätzte deinen Vater sehr, vor allem, weil er einmal für König Georg kämpfte. Damit müßte seiner Meinung nach die Begeisterung für König Jakob II. bei dir ausgelöscht sein. Und jetzt möchte deine Mutter, daß ihr sie besucht, damit wir die ganze Angelegenheit gemeinsam besprechen und zu einem Entschluß gelangen.«
»Jean-Louis könnte den Besitz im Augenblick nicht verlassen.«
»Es würde sich nur um einen kurzen Besuch handeln. Denk jedenfalls darüber nach und komm heute abend herüber.«
»Ich würde gern nach Eversleigh fahren«, warf Dickon ein.
Seine Mutter lächelte ihn verliebt an. »Dickon möchte alles, was er sieht, nicht wahr, Dickon? Eversleigh ist nicht für dich bestimmt, mein Sohn.«
»Das kann man nie wissen«, murmelte Dickon verschmitzt.
»Sprich mit Jean-Louis darüber«, sagte Sabrina zu mir, »und wir werden uns dann eingehend damit befassen. Deine Mutter wird dir den Brief zeigen, damit du dir ein Bild machen kannst.«
Ich begleitete sie hinaus und kehrte zu den Narzissen zurück.
***
Jean-Louis und ich gingen zu Fuß vom Verwalterhaus, in dem wir wohnten, nach Clavering Hall hinüber. Ich hatte Jean-Louis von Carls Brief erzählt, und er wirkte leicht beunruhigt. Er war als Verwalter des Clavering-Besitzes glücklich, weil das Gut nicht zu groß war und alles reibungslos lief. Jean-Louis liebte Veränderungen gar nicht.
Wir gingen Arm in Arm. Jean-Louis meinte, daß es für uns schwierig wäre, Clavering ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt zu verlassen. Wir sollten lieber später reisen, wenn es weniger Arbeit gab.
Ich war ganz seiner Meinung – wie immer. Wir führten eine sehr glückliche Ehe, und deshalb ist meine Handlungsweise umso unbegreiflicher.
Der einzige Wermutstropfen in unserem Glück war die Tatsache, daß wir keine Kinder hatten. Meine Mutter hatte mit mir darüber gesprochen, weil sie wußte, daß ich deswegen unglücklich war. »Es ist traurig«, gab sie zu. »Ihr wäret so gute Eltern. Aber vielleicht ergibt es sich noch, vielleicht müßt ihr nur ein bißchen Geduld haben.«
Jedoch die Zeit verging, und wir hatten immer noch kein Kind. Ich hatte beobachtet, wie sehnsüchtig Jean-Louis manchmal Dickon ansah. Auch er neigte dazu, den Jungen zu verwöhnen. Vielleicht kam es daher, daß er das einzige Kind in der Familie war.
Mir war Dickon gleichgültig, und ich versuchte nie, meine Gefühle ihm gegenüber zu analysieren. Erst später begann ich über meine Haltung ihm gegenüber nachzudenken, suchte Gründe und fand nur Entschuldigungen. War es möglich, daß ich auf ihn eifersüchtig war? Meine Mutter, die ich beinahe genauso innig liebte wie seinerzeit meinen strahlenden Vater, hatte sehr viel für Dickon übrig – vielleicht sogar mehr als für mich, ihr eigenes Kind. Das hing mit der uralten Romanze zusammen, die sie mit Dickons Vater erlebt hatte – aber dennoch hatte nicht sie, sondern Sabrina ein Kind von ihm bekommen.
Als wir das Haus meiner Mutter betraten, erwartete sie uns schon. Sie umarmte mich zärtlich; sie zeigte sich mir gegenüber immer sehr liebevoll. Aber weil sie so sicher war, daß ich immer das tun würde, was man von mir erwartete, machte sie sich nie Sorgen um mich und beschäftigte sich nie sehr lange mit mir.
»Es ist sehr lieb von euch, daß ihr gekommen seid, Zippora und Jean-Louis«, begrüßte sie uns.
Jean-Louis küßte ihr die Hand. Er war meiner Mutter immer sehr dankbar gewesen und benützte jede Gelegenheit, es ihr zu zeigen.
Immerhin war sie es gewesen, die ihn davor bewahrt hatte, gemeinsam mit seiner Mutter Clavering Hall verlassen zu müssen. Seine Mutter konnte kein sehr angenehmer Mensch gewesen sein, denn sie war in eine geheimnisvolle Mordaffäre verwickelt gewesen. Aber auch das lag schon viele Jahre zurück.
»Ich möchte dir Lord Eversleighs Brief zeigen«, begann meine Mutter. »Es ist sehr merkwürdig, daß er dir Eversleigh hinterlassen will.«
»Ich kann es nicht recht glauben. Es gibt sicherlich einen anderen Erben.«
»Wir haben einander nach dem Tod deiner Urgroßeltern etwas aus den Augen verloren. Und dabei war Eversleigh einmal der Mittelpunkt der Familie. Seltsam, wie sich die Verhältnisse ändern.«
Es war wirklich seltsam. Überhaupt hatte sich vieles geändert, als mein Vater plötzlich aus meinem Leben verschwunden war. Damals gab es eine Zeit, in der sich in meiner Umgebung aufregende Ereignisse abspielten. Als mein Vater starb, war ich zehn Jahre alt; das war jetzt zwanzig Jahre her, aber einen Mann wie ihn kann man nicht vergessen. Ich hatte ihn über alles geliebt. Er verzärtelte mich nie so wie meine Mutter. Er hatte gern gelacht, hatte nach Sandelholz gerochen und war immer elegant gekleidet gewesen – ein richtiger Dandy. Ich hatte ihn für den am besten aussehenden Mann der Welt gehalten. Fünf Minuten mit ihm waren mir wichtiger als all die liebevolle Fürsorge und Zuneigung meiner Mutter. Er hatte mich nie gefragt, ob ich brav lerne, er war nie auf die Idee gekommen, daß ich mich erkälten könnte. Er hatte mir oft von seinen Erlebnissen am Spieltisch erzählt. Er war nämlich ein Spieler und ich hatte seine Spielleidenschaft verstanden. Er hatte mich behandelt, als wäre ich einer seiner Freunde und nicht seine kleine Tochter. Oft ritt er mit mir aus. Wir schlossen Wetten um kleine Beträge ab. Er wettete zum Beispiel mit mir, daß ich einen Kiesel nicht über eine bestimmte Entfernung werfen könne, und setzte sorglos alles Mögliche ein – seine Krawattennadel, einen Ring, eine Münze –, was er gerade zur Hand hatte. Meine Mutter hat diese Wetten gehaßt. Mehr als einmal hat sie gesagt: »Du wirst das Kind zu einer ebensolchen Spielernatur erziehen, wie du es bist.«
Ich hatte gehofft, daß es ihm glücken würde. Ich wollte unbedingt in allem genauso sein wie er. Er war fröhlich und besaß einen unwiderstehlichen Charme, der seiner leichten Lebensart entsprang. Ihn konnte nie etwas erschüttern; er hatte bei den Wechselfällen des Lebens immer nur die Schultern gezuckt und hatte später dem Tod gegenüber die gleiche Einstellung gezeigt. Ich wußte nicht, warum er an jenem Morgen in den Tod gegangen war – aber ich konnte es mir denken.
Dieses Ereignis traf uns wie ein Keulenschlag, obwohl sich schon vorher eine Katastrophe angekündigt hatte. Das hatte ich, ohne es zu wollen, aufgeschnappt. Ich wußte, daß Vater ums Leben gekommen war, weil er »die Ehre meiner Mutter verteidigt hatte«, wie die Diener sich zuflüsterten. Das kam daher, daß ein Mann gestorben war und man in seinem Schlafzimmer einen Gegenstand gefunden hatte, der meiner Mutter gehörte – ein Hinweis darauf, daß sie zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm gewesen sein mußte.
Damit war ein Abschnitt meines Lebens zu Ende. Für ein zehnjähriges Mädchen ist ein solches Ereignis sehr schwerwiegend. Wir zogen aufs Land – obwohl das nichts Neues für mich war, weil wir immer einen Teil des Sommers in Clavering Hall verbracht hatten; es gehörte zum Besitz meines Vaters.
Es war eine schreckliche Zeit gewesen, und umso schrecklicher für mich, weil ich nicht alles wußte. Sabrina war auch in die Geschichte verwickelt, denn sie sagte einmal zu meiner Mutter: »O Clarissa, ich bin an all dem schuld.« Und ich wußte, daß sie diejenige war, die sich im Schlafzimmer des Toten befunden hatte.
Das alles war äußerst verwirrend, und wenn ich Fragen stellte, sagte mir Nanny Curlew – die ich von Sabrina übernommen hatte –, daß man kleine Kinder sehen, aber nicht hören soll. Ich wurde daraufhin vorsichtig, denn Nanny Curlew kannte schauerliche Geschichten über unfolgsame Kinder. Wenn sie lauschen und Dinge hören, die nicht für sie bestimmt sind, bekommen sie lange Ohren, so daß alle wissen, was sie getan haben; und wenn Kinder Grimassen schneiden oder schmollen oder gar die Zunge herausstrecken, sind sie plötzlich »wie vom Schlag getroffen« und bleiben ihr Leben lang so. Da ich ein logisch denkendes Mädchen war, widersprach ich: Ich hatte nie jemanden mit riesigen Ohren oder heraushängender Zunge gesehen. »Warte nur«, hatte sie drohend gemeint und mich so streng angeschaut, daß ich eilig zu einem Spiegel lief, um mich davon zu überzeugen, daß meine Ohren nicht gewachsen waren und daß meine Zunge sich noch immer an ihrem Platz befand.
Irgendwer hat behauptet, daß die Zeit alle Wunden heilt, und das stimmt, denn wenn sie sie auch nicht immer heilt, so schwächt sie doch die Erinnerung ab und lindert den Schmerz. Nach einiger Zeit gewöhnte ich mich daran, daß mein Vater nicht mehr da war, und begann, Freude am Landleben zu finden. Schließlich hatte ich meine Mutter, hatte Sabrina, Jean-Louis und die furchteinflößende und allmächtige Nanny Curlew. Ich tat, was man von mir erwartete, und stellte selten Fragen. Einmal sagte Sabrina zu meiner Mutter: »Zippora hat dir wenigstens noch nie Kummer bereitet, und ich könnte schwören, daß sie es auch nie tun wird.« Zuerst freute ich mich über diese Bemerkung, aber später stimmte sie mich nachdenklich.
Dann wurde ich erwachsen und besuchte Tanzveranstaltungen, und bei einer davon bewies Jean-Louis, daß er eifersüchtig sein konnte, weil ich mich seiner Meinung nach zu sehr für den Sohn eines Landedelmannes interessierte. Kurz darauf beschlossen wir zu heiraten, aber Jean-Louis wollte damit warten, bis er nicht mehr unter dem Dach meiner Mutter lebte. Er arbeitete auf dem Gut und war sehr tüchtig. Tom Staples sagte, er wisse gar nicht, wie er ohne Jean-Louis zurechtkommen würde. Dann erlitt Tom Staples gänzlich unerwartet einen Herzanfall und starb. Also wurde der Verwalterposten frei, und Jean-Louis trat Toms Nachfolge an. Er bewirtschaftete das Gut, zog in das Verwaltergebäude ein, und damit gab es keinen Grund mehr für uns, die Heirat hinauszuschieben.
All das hatte sich vor über zehn Jahren, also 1745, abgespielt. Die Dinge nahmen erst wieder eine dramatische Wendung, als die Jugendliebe meiner Mutter zurückkehrte. Er war dreißig Jahre zuvor nach Virginia deportiert worden, weil er an dem Aufstand des Jahres 1715 beteiligt gewesen war. Ich war damals gerade jung verheiratet und in mein Glück so eingesponnen, daß ich die Zusammenhänge nur undeutlich erfaßte – daß der heimgekehrte Dickon der seinerzeitige Verehrer meiner Mutter war, von dem sie ihr Leben lang geträumt hatte, sogar während ihrer Ehe mit meinem Vater, diesem wunderbaren Mann. Zu ihrem Leidwesen verliebte sich Dickon in Sabrina, heiratete sie, und die Frucht ihrer Liebe war der kleine Dickon.
Meine arme Mutter! Jetzt weiß ich erst, wie sehr sie damals gelitten haben muß. Nach der Schlacht von Culloden und dem Tod von Dickons Vater kehrte Sabrina zu meiner Mutter zurück. Dann kam Dickon zur Welt – das war vor zehn Jahren, und seither leben Sabrina und meine Mutter miteinander in Clavering Hall. Jetzt erst, seit meinem eigenen Erlebnis, begreife ich, daß sie in dem Kind den Mann wiedergefunden haben, den sie beide verloren hatten.
Wahrscheinlich war es ein Trost für sie. Aber ich nehme an, daß es sich auf Dickons Charakter nachteilig auswirkte.
Nun, Jean-Louis und ich führten in all den Jahren eine gute Ehe. Unser Leben wurde kaum von äußeren Ereignissen beeinflußt; die Kriege in Europa, an denen unser Land beteiligt war, berührten uns nicht. Die Jahreszeiten folgten unveränderlich aufeinander, nach dem düsteren Karfreitag kam der fröhliche Ostersonntag, wir feierten Sommerfeste – wenn das Wetter schön war, im Freien, wenn es schlecht war, in der Halle unseres Hauses –, beim Erntedankfest bemühte sich jedes Gut, die schönsten Früchte und Gemüse vorzuweisen, und zu Weihnachten fanden die üblichen Vergnügungen statt. So verlief unser Leben.
Bis zu dem Tag, an dem die Botschaft aus Eversleigh Court eintraf.
Meine Mutter hängte sich bei mir und Jean-Louis ein.
»Ich habe nur die Familienmitglieder eingeladen, damit wir in Ruhe darüber sprechen können. Nur Sabrina, ihr beide und ich. Ich hoffe sehr, Jean-Louis, daß du dich freimachen und mit Zippora nach Eversleigh reisen kannst.«
Daraufhin zählte Jean-Louis eine Unzahl von Problemen auf, die die Verwaltung des Guts mit sich brachte. Es war sein Lieblingsthema, weil es für ihn das Wichtigste auf der Welt war. Er redete sich in Begeisterung und erklärte, es würde ihm sicherlich sehr schwer fallen, sich auf einige Zeit von seiner Arbeit zu trennen.
Wir gingen in die Halle – ein sehr schöner Raum, der der Mittelpunkt des Hauses war. Es war übrigens ein großes Haus, das für eine große Familie gedacht war. Meine Mutter hätte es sicherlich gern gesehen, wenn Sabrina wieder geheiratet und mit ihren Kindern in Clavering Hall gelebt hätte.
Doch es sah so aus, als würde Sabrina nie wieder heiraten. Auch auf meine Mutter traf das zu, obwohl sie noch sehr jung gewesen war, als mein Vater starb. Aber beide hatten Dickon den Älteren zu ihrem Gott erhoben und beteten ihn an – er war der Held aus der Jugendzeit meiner Mutter. Paradoxerweise liebte sie ihn immer noch, obwohl er ihr untreu geworden war und Sabrina zur Frau genommen hatte. Wenn er nicht bei Culloden den Heldentod erlitten hätte – wäre er dann auf dem Piedestal stehengeblieben? Aber das fragte ich mich erst später; damals sah ich das Leben mit den Augen der anderen. Ich versuchte nie herauszubekommen, was sich hinter dem Vorhang der Konvention verbarg.
Der junge Dickon kam den beiden verlassenen Frauen wie ein Geschenk des Himmels, er hatte ihrem Leben neuen Inhalt gegeben. Er half ihnen über ihren Kummer hinweg; indem sie ihn umhegten, hatten sie wieder jemanden, den sie anhimmeln konnten.
Ich fühlte mich in Clavering Hall genauso zu Hause wie im Verwalterhaus. Ich war hier inmitten der kostbaren Möbel und der geschmackvollen Tapeten und Vorhänge aufgewachsen, die davon Zeugnis ablegten, wie sehr mein Vater alles Schöne geliebt hatte.
Ich blickte zu den beiden eleganten Treppen hinüber, die in den Ost- und Westflügel führten. Ein so großes Haus für so wenige Menschen! Einmal hatte ich Jean-Louis gegenüber erwähnt, daß meine Mutter hier nie allein leben könnte, falls Sabrina noch einmal heiraten sollte; dann würde uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als zu ihr zu ziehen. Jean-Louis hatte mir, wenn auch nur zögernd, zugestimmt, denn ihm gingen sein eigenes Haus und seine Unabhängigkeit über alles. Jean-Louis ist ein sehr zurückhaltender, sehr gütiger Mann, und deshalb ist das, was ich getan habe, umso tadelnswerter.
Wir saßen im Eßzimmer beim Abendessen. Meine Mutter hatte nach dem Tod meines Vaters nichts im Haus verändert, nicht einmal das Spielzimmer, obwohl es seither keine Kartenpartien mehr gab. Nur gelegentlich spielten meine Mutter und Sabrina mit den Nachbarn Whist, wenn sie zu Besuch kamen, aber niemals um Geld. Manche Leute bezeichneten meine Mutter deshalb als puritanisch, aber wir kannten sie besser.
Jetzt saßen wir auf den geschnitzten und vergoldeten japanischen Stühlen um den Eichentisch mit der geschnitzten Leiste, der in Frankreich für einen Höfling von Ludwig XV. angefertigt worden war, wie mir mein Vater erzählt hatte.
Der Butler stand beim Büffet und schöpfte die Suppe in die Teller, die ein Mädchen auf den Tisch stellte; da ging die Tür auf, und Dickon kam herein.
»Dickon«, sagten meine Mutter und Sabrina gleichzeitig in dem Ton, den ich so gut kannte – ein bißchen ärgerlich, vorwurfsvoll und doch voll nachsichtiger Bewunderung für seine Kühnheit. Genauso hätten sie sagen können: Natürlich darf er das nicht, aber was dem Kind nicht alles einfällt, unserem kleinen Liebling!
»Ich möchte mein Abendessen«, erklärte er.
»Dickon«, bemerkte meine Mutter, »du hast erst vor einer Stunde gegessen. Solltest du nicht schon im Bett sein?«
»Nein.«
»Warum nicht?« fragte Sabrina. »Es ist Schlafenszeit.«
»Weil ich hier sein will«, erklärte Dickon hartnäckig.
Der Butler sah in die Suppenterrine, als gäbe es dort etwas Interessantes zu entdecken, das Dienstmädchen war mit einem Teller in der Hand unentschlossen stehengeblieben und wußte nicht, wo sie ihn abstellen sollte.
Ich hatte erwartet, daß Sabrina ihren Sohn ins Bett stecken würde. Stattdessen sah sie meine Mutter hilflos an, und diese zuckte die Schultern. Dickon glitt auf einen Stuhl – er hatte gesiegt. Zweifellos hatte er gewußt, wie die Machtprobe ausgehen würde. Mir war klar, daß sich diese Szene nicht zum ersten Mal abspielte.
»Nun ja, vielleicht dieses eine Mal, was meinst du, Sabrina?« fragte meine Mutter beinahe schmeichelnd.
»Eigentlich solltest du nicht hier sitzen, Liebling«, erklärte Sabrina.
Dickon lächelte sie verführerisch an. »Nur dieses eine Mal.«
»Servieren Sie weiter, Thomas«, ordnete meine Mutter an.
»Ja, Mylady.«
Dickon warf mir einen triumphierenden Blick zu. Er wußte, daß ich mit diesen Erziehungsmethoden nicht einverstanden war, und freute sich, weil er mir zeigen konnte, wer hier der Herr im Haus war.
»Ja, und jetzt muß ich euch Carls Brief zeigen«, sagte meine Mutter. »Ich hoffe, Jean-Louis, daß du es schaffen wirst, bald abzureisen.«
»Zu dumm, daß es ausgerechnet um diese Zeit sein muß.« Jean-Louis runzelte die Stirn. Er wollte meine Mutter nicht enttäuschen, denn es war nicht zu übersehen, wie großen Wert sie darauf legte, daß wir bald nach Eversleigh fuhren.
»Der junge Weston hat sich doch ganz gut eingearbeitet, oder?« fragte Sabrina.
Der junge Weston war einer unserer Angestellten. Er war ein vielversprechender junger Mann, aber Jean-Louis hing so sehr an dem Besitz, daß er unglücklich war, wenn er nicht selbst alles beaufsichtigen konnte. Weder ér noch ich hatten das Bedürfnis, längere Zeit in London zu verbringen, und das wirkte sich auf das Gut natürlich sehr günstig aus.
»Er ist noch nicht so weit«, widersprach Jean-Louis daher.
Meine Mutter griff nach der Hand meines Mannes.
»Ich weiß, daß du es irgendwie möglich machen wirst.« Das gab den Ausschlag – Jean-Louis würde es möglich machen.
Weil meine Mutter jetzt sicher war, daß Jean-Louis mit mir fahren würde, begann sie alte Erinnerungen aufzufrischen.
»Ich bin schon so lange nicht mehr in Eversleigh gewesen. Ob es sich sehr verändert hat?«
Sabrina fügte hinzu: »Ich nehme an, daß auch Enderby noch genauso aussieht wie früher. Was für ein merkwürdiges Haus. Angeblich spukt es dort.«
Ich wußte nur andeutungsweise über Enderby Bescheid. Es lag in der Nähe von Eversleigh Court, und die beiden Häuser gehörten zusammen, weil meine Großmutter Carlotta Enderby geerbt hatte. Aber vorher hatte sich dort eine Tragödie abgespielt – jemand, der nicht zu unserer Familie gehörte, hatte dort Selbstmord begangen.
Sabrina erschauerte und fuhr fort: »Ich glaube nicht, daß ich Enderby wiedersehen möchte.«
»Gibt es dort wirklich Gespenster?« fragte Dickon.
»Es gibt überhaupt keine Gepenster«, griff ich ein. »Das reden sich die Menschen nur ein.«
»Woher willst du das wissen?«
»Gesunder Menschenverstand.«
»Ich mag Gespenster«, erklärte er und erteilte damit mir und meinem gesunden Menschenverstand eine Abfuhr. »Ich möchte, daß es dort Gespenster gibt.«
»Dann werden wir uns welche besorgen«, lachte Jean-Louis.
»Ich bin in Enderby glücklich gewesen«, sagte meine Mutter. »Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich aus Frankreich dorthin kam und wie wunderbar es war, daß ich im Kreis einer Familie leben durfte, die mich liebte ... und es war jahrelang mein Zuhause ... mit Tante Damaris und Onkel Jeremy.«
Sie dachte offensichtlich an die schreckliche Zeit in Frankreich, als ihre Eltern plötzlich gestorben waren – angeblich waren sie vergiftet worden –, und sie in der Obhut eines französischen Dienstmädchens zurückgeblieben war, das nach der Auflösung des Haushalts auf der Straße Blumen verkaufte.
Meine Mutter hatte mir oft davon erzählt. Sie erinnerte sich an ihre Mutter Carlotta, die Schönheit in der Familie, die wilde Carlotta.
»Es wird dich bestimmt interessieren, das alles zu sehen, Zippora«, sagte sie.
»Wir werden doch nicht länger als ein paar Wochen dort bleiben müssen, oder?« fragte Jean-Louis.
»Ich glaube nicht. Der alte Mann muß sehr einsam sein, er wird sich sicherlich über euren Besuch freuen.«
Dickon hörte gespannt zu. »Ich fahre statt euch hin.«
»Nein, mein Liebling«, wies ihn Sabrina zurecht. »Du bist nicht eingeladen.«
»Aber er ist mit dir verwandt, und deshalb auch mit mir.«
»Ja, aber er hat Zippora eingeladen.«
»Ich könnte sie anstelle von Jean-Louis begleiten.«
»Nein«, widersprach Jean-Louis, »ich muß mich um Zippora kümmern.«
»Sie braucht niemanden, der sich um sie kümmert. Sie ist alt genug.«
»Jede Dame braucht einen Kavalier, der sich um sie kümmert, wenn sie eine Reise unternimmt«, griff meine Mutter ein.
Dickon beschäftigte sich gerade so intensiv mit dem Wildbraten, daß er nicht antwortete.
Jean-Louis fand, es wäre am besten, wenn wir in drei Wochen abreisten. Bis dahin konnte er alle notwendigen Anordnungen treffen, und wenn wir nicht länger als zwei Wochen in Eversleigh blieben, sollten sich eigentlich keine Schwierigkeiten ergeben.
Meine Mutter lächelte ihm zu. »Ich habe gewußt, daß du es möglich machen wirst. Danke. Ich schreibe Carl sofort. Vielleicht könntest du ein paar Zeilen hinzufügen, Zippora.«
Ich erklärte mich dazu bereit.
Dickon gähnte. Er hätte schon längst schlafen müssen, und als Sabrina ihm vorschlug, zu Bett zu gehen, protestierte er nicht.
Meine Mutter und ich verließen das Eßzimmer, um den Brief zu verfassen. Im ehemaligen Spielzimmer stand ein Schreibtisch, und ich wandte mich dorthin.
»Möchtest du nicht lieber in die Bibliothek kommen? Sie ist gemütlicher«, schlug meine Mutter vor.
»Nein, ich habe das Spielzimmer immer schon gemocht.«
Als ich mich an den Schreibtisch setzte, trat meine Mutter neben mich und strich mir über das Haar. »Du siehst deinem Vater so ähnlich. Helles, beinahe goldenes Haar, leuchtend blaue Augen – und du bist auch beinahe so groß wie er. Der atme Lance. Ein vergeudetes Leben.«
»Er starb als wahrer Edelmann.«
»Allerdings. Er hat sein Leben genauso vergeudet wie sein Vermögen.«
»Ich erinnere mich daran, wie mein Vater in diesem Zimmer saß. Er war hier am glücklichsten.«
Meine Mutter runzelte die Stirn, und ich begann mit meinem Brief. Er war nur kurz: Ich dankte Onkel Carl für die Einladung und teilte ihm mit, daß mein Mann und ich ihn in drei Wochen besuchen würden. Das genaue Ankunftsdatum würden wir noch bekanntgeben.
Kurz darauf gingen Jean-Louis und ich nach Hause.
***
Wir hatten den ersten Juni als Reisetermin festgesetzt. Wir wollten reiten und drei Reitknechte mitnehmen.
»Kutschen sind viel gefährlicher«, meinte meine Mutter, »weil es so vide Wegelagerer gibt. Es ist wesentlich leichter, eine schwerfällige Kutsche zu überfallen; aber so sind die drei Reitknechte und Jean-Louis ein guter Schutz für dich.«
Lord Eversleigh schrieb uns noch einen Brief. Seine Freude hatte etwas Rührendes. Als Sabrina den Brief las, sagte sie: »Er liest sich beinahe wie ein Hilferuf ... oder so ähnlich.«
Ein Hilferuf! Eine seltsame Vorstellung. Ich las den Brief noch einmal, entdeckte aber nichts Derartiges in ihm; ein alter Mann, der zu lang von seinen Verwandten getrennt gewesen war, freute sich darauf, sie wiederzusehen.
Sabrina zuckte die Schultern. »Jedenfalls ist er froh, weil du kommst. Der arme alte Mann fühlt sich offensichtlich einsam.«
Eine Woche vor unserer Abreise saß ich im Garten und arbeitete an einer Stickerei, als ich Stimmen hörte. Ich erkannte Dickons herrischen Tonfall, legte den Stickrahmen beiseite, trat zu den Büschen und sah hinüber. Dickon befand sich in Begleitung von Jake Carter, dem Sohn eines Gärtners, der gelegentlich seinem Vater bei der Arbeit half. Er war genauso alt wie Dickon, und die beiden steckten oft beisammen. Es war anzunehmen, daß Dickon den Jungen schamlos tyrannisierte, und ich war gar nicht sicher, daß Jake ihn mochte. Wahrscheinlich hatte ihm Dickon alles Mögliche angedroht, wenn Jake nicht bei seinen Streichen mitmachte, und meine Mutter und Sabrina waren ja wirklich in Dickon so vernarrt, daß sie dem Jungen alles glaubten, was er über die Dienstleute erzählte.
Die beiden Jungen befanden sich bereits in einiger Entfernung vom Garten, aber ich sah, daß sie einen Eimer trugen; außerdem hatte Jake ein in Papier gewickeltes Paket in der Hand.
Die beiden schlugen die Richtung zu Hassocks Farm ein, die an unseren Besitz grenzt. Die Hassocks waren gute Farmer, und Jean-Louis schätzte sie sehr. Sie hielten ihre Scheunen und Hecken in Ordnung, und der alte Hassock sprach oft mit Jean-Louis darüber, wie man den Ertrag der Felder steigern könnte.
Ich setzte mich wieder zu meiner Stickerei, ging aber bald in die Vorratskammer hinauf, um die Behälter für die Erdbeeren bereitzustellen. Ich wollte noch vor meiner Abreise dafür sorgen, daß die Früchte gepflückt und eingelegt wurden.
Etwa eine Stunde später stürzte eines der Mädchen in mein Zimmer.
»O Mistress«, rief sie, »bei Hassocks brennt es. Der Herr ist gerade hinübergeritten.«
Ich lief ins Freie; eine der Scheunen brannte lichterloh. Einige Dienstleute gesellten sich zu mir, und wir gingen gemeinsam durch den Garten und über Hassocks Felder zur Scheune.
Dort war alles in hellem Aufruhr; die Menschen liefen durcheinander und schrien einander zu, aber sie schienen das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.
Eines der Mädchen schrie auf, und da sah ich, daß Jean-Louis auf dem Boden lag und einige Männer versuchten, ihn auf einen Fensterladen zu legen.
Ich lief hinüber und kniete neben ihm nieder. Er war blaß, aber bei Bewußtsein und lächelte mich an.
Einer der Männer sagte: »Der Herr hat sich wahrscheinlich das Bein gebrochen. Wir bringen ihn nach Hause ... vielleicht könnten Sie inzwischen den Arzt holen lassen.«
Ich war bestürzt. Die Scheune war nur noch ein Haufen verkohlter Balken, aus denen gelegentlich eine zuckende Flamme hervorschoß. Der bittere Brandgeruch reizte zum Husten.
»Ja, rasch«, sagte ich. »Bringt ihn nach Hause. Und einer von euch holt den Arzt.«
Einer der Diener machte sich auf den Weg, und ich wandte mich Jean-Louis zu.
»Ein schweres Unglück«, meinte einer von Hassocks Arbeitern. »Sieht aus, als hätte jemand in der Scheune Feuer gelegt. Der Herr war als erster drin; dann stürzte das Dach ein und erwischte ihn am Bein. Ein Glück, daß wir in der Nähe waren und ihn herausziehen konnten.«
»Seht zu, daß ihr rasch ins Haus kommt«, sagte ich. »Könnt ihr ihn auf dem Fensterladen überhaupt transportieren?«
»Etwas Besseres haben wir nicht, Mistress. Der Doktor wird es schon wieder in Ordnung bringen.«
Jean-Louis’ Bein war merkwürdig abgewinkelt – es schien wirklich gebrochen zu sein. Zum Glück konnte ich in einer Krise die Ruhe bewahren, meine Gefühle und Ängste beherrschen und das Notwendige tun.
Ich wußte, daß wir den Bruch vor dem Transport fixieren mußten und beschloß, es zu versuchen, obwohl ich von solchen Dingen keine Ahnung hatte. Ich schickte ein Mädchen um einen Spazierstock und um Leinenstreifen, die wir zum Bandagieren verwenden konnten.
Die Männer hatten Jean-Louis sehr vorsichtig auf die improvisierte Tragbahre gelegt, und ich ergriff seine Hand. Er litt sichtlich große Schmerzen, aber es war typisch für ihn, daß er vor allem mich beruhigen wollte.
»Mir geht es gut«, flüsterte er. »Es ist nichts Besonderes ...«
Dann wurden der Spazierstock, den ich zum Schienen benützen wollte, und ein in Streifen gerissenes Laken gebracht. Meine Helfer hielten Jean-Louis’ Bein vorsichtig fest, während ich die Bandagen um Bein und Stock wickelte. Dann trugen die Männer Jean-Louis in sein Bett, und der Arzt traf beinahe gleichzeitig mit ihm ein.
Es sei ein einfacher Bruch, sonst nichts, meinte der Arzt. Er beglückwünschte mich zu meiner raschen und zweckmäßigen Hilfeleistung; dadurch hatte ich verhindert, daß aus dem einfachen Bruch ein komplizierter wurde.
Ich blieb bei Jean-Louis, bis er einschlief. Dann erinnerte ich mich an die entsetzlichen Augenblicke, als ich ihn für tot gehalten hatte, und an die Verzweiflung, die mich daraufhin ergriffen hatte. Was hätte ich ohne Jean-Louis angefangen?
Kurz nachdem er eingeschlafen war, trafen meine Mutter, Sabrina und Dickon ein.
Die beiden Frauen waten sehr aufgeregt und wollten genau wissen, wie sich alles abgespielt hatte.
»Wenn man bedenkt, daß er schwer verletzt sein könnte ... und alles nur wegen Hassocks Scheune.«
»Er hat selbstverständlich alles unternommen, um das Feuer zu löschen«, verteidigte ich ihn.
»Er hätte Hilfe holen sollen«, meinte Sabrina.
»Jean-Louis hat bestimmt das Richtige getan«, wiederholte ich.
»Aber er hätte dabei ums Leben kommen können!«
»Daran hat er nicht gedacht«, meinte meine Mutter. »Er versuchte einfach, das Feuer zu löschen. Wenn er es nicht getan hätte, hätten die Flammen auf das Feld übergegriffen, und Hassock hätte sein Korn verloren.«
»Besser das Getreide als Jean-Louis«, widersprach Sabrina.
»Hat man eine Ahnung, wie das Feuer entstanden ist?« fragte meine Mutter.
»Man wird es schon noch herausbekommen«, antwortete ich.
Sie sah mich ernst an. »Damit sind deine Reisepläne für Eversleigh ins Wasser gefallen.«
»Ach, richtig, das habe ich vollkommen vergessen.«
»Der arme alte Carl wird sehr enttäuscht sein.«
»Vielleicht könntest du an meiner Stelle fahren, Sabrina«, schlug ich vor. »Nimm Dickon mit!«
»O ja«, rief Dickon, »ich möchte nach Eversleigh.«
»Kommt nicht in Frage«, widersprach Sabrina. »Wir wären dort nicht willkommen. Ihr dürft nicht vergessen, daß ich die Frau des verdammten Jakobiten bin und daß Dickon sein Sohn ist.«
»Warten wir ab«, meinte meine Mutter. »Zunächst muß Jean-Louis’ Bein in Ordnung kommen. Und wenn das Feuer aus grober Fahrlässigkeit entstanden ist ...«
»Wer käme denn auf so eine Idee?« fragte ich.
»Vielleicht war es ein dummer Streich«, meinte Sabrina.
In diesem Augenblick kamen zwei von Hassocks Arbeitern herein. Sie trugen einen Gegenstand, der wie die Überreste eines Eimers aussah; drinnen lagen ein paar Stücke verkohltes Rindfleisch.
»Wir wissen, wie der Brand ausbrach«, sagte einer von ihnen. »Jemand, der nicht viel davon verstand, wollte Fleisch braten, indem er in diesem Eimer ein Feuer anzündete; das hier sieht aus wie eine Art Rost.«
»O Gott!« rief ich. »War es vielleicht ein Landstreicher?«
»O nein, Mistress, ein Landstreicher hätte sich geschickter angestellt. Jemand muß in dem Eimer ein Feuer angezündet haben, das dann irgendwie außer Kontrolle geriet. Der Kerl bekam Angst und lief davon.«
»Was ist mit diesem Eimer? Wo stammt er her?«
»Nein, Mistress, aber wir werden versuchen, es herauszubekommen.«
Ich verbrachte eine unruhige Nacht. Ich schlief auf dem schmalen Sofa im Ankleideraum neben unserem Schlafzimmer. Die Tür stand offen, so daß ich es hören mußte, wenn Jean-Louis aufwachte. Er lag in unserem großen Bett, sein Bein war eingerichtet, und ich hätte erleichtert sein müssen, weil ihm nichts Schlimmeres zugestoßen war.
Zu meiner Überraschung war ich tief enttäuscht, weil ich meinen Besuch in Eversleigh aufschieben mußte, wahrscheinlich sogar für lange Zeit, denn Jean-Louis würde die weite, anstrengende Reise sicherlich nicht sofort unternehmen können, sobald der Bruch geheilt war.
Ich hatte oft an Eversleigh Court gedacht und hätte gern Enderby gesehen, das Haus, das eine so wichtige Rolle in unserer Familiengeschichte spielte. Mir war gar nicht klar gewesen, wie sehr ich mich auf das Abenteuer gefreut hatte.
Ich schlief schlecht, wachte mitten in der Nacht auf und versuchte zu ergründen, was mich geweckt hatte. Schließlich fand ich es heraus: Ich hatte geträumt, daß ich die Reise allein unternommen hatte. Und warum eigentlich nicht?
Je länger ich darüber nachdachte, desto durchführbarer schien mir diese Idee. Natürlich würde sie allgemein mißbilligt werden – denn junge Frauen reisen nicht allein. Aber erstens war ich keine junge Frau mehr, und zweitens würde ich natürlich nicht allein reiten. Ich würde, wie vorgesehen, die drei Reitknechte mitnehmen; der einzige Unterschied wäre dann, daß Jean-Louis nicht bei mir sein würde.
Diese Gedanken regten mich so auf, daß ich nicht mehr einschlafen konnte, sondern Pläne schmiedete, wie ich meine Reise nach Eversleigh ohne die Begleitung von Jean-Louis bewerkstelligen konnte.
Am nächsten Morgen herrschte allgemeine Aufregung, weil die Spur des Brandstifters zu uns führte. In einem der Schuppen im Garten fehlte ein Eimer, und obwohl das in der Scheune gefundene Exemplar verkohlt und verbeult war, konnte es unschwer als unser Eigentum identifiziert werden.
Hassock hatte erklärt, daß er den Übeltäter halbtot prügeln würde, wenn er ihn erwischte, denn dieser unbesonnene Streich hatte ungeheuren Schaden angerichtet.
Nachdem man herausgefunden hatte, woher der Eimer stammte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis man den Bösewicht fassen würde. Am frühen Nachmittag tauchte Ned Carter bei mir auf, mit seinem Sohn Jake im Schlepptau.
Jakes Gesicht war bleich und angstverzerrt, und auf seinen Wangen sah man Tränenspuren.
»Das ist der Schlingel, der an allem schuld ist, Mistress«, sagte Carter. »Er hat es zugegeben. Er nahm den Eimer, um sich Fleisch zu braten. Aber wo hatte er das Fleisch her? Das möchte ich wissen. Ich kann ihn prügeln, so viel ich will, er sagt es nicht. Aber ich werde es schon noch herausbekommen. Ich habe ihm ohnehin gesagt, wenn er so weitermacht, landet er demnächst auf den Galeeren oder am Galgen.«
Jake Carter tat mir leid. Er war noch ein Kind und er hatte fürchterliche Angst.
Dann erinnerte ich mich daran, wann ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte – da war er nicht allein gewesen. Natürlich! Ungefähr eine Stunde, bevor das Feuer ausgebrochen war.
Damit war mir klar, daß nicht Jake die Idee gehabt hatte, das Fleisch und den Eimer zu stehlen. Sein Komplize hatte ihn dazu gezwungen.
Ich fragte: »War jemand bei dir, Jake, als du in die Scheune gingst?«
»Nein, Mistress, ich war allein. Ich wollte nichts Böses tun, nur das Fleisch braten.«
»Wo hast du das Fleisch hergehabt?«
Er schwieg. Aber er mußte nicht sprechen, ich konnte mir auch so vorstellen, wie sich das Ganze abgespielt hatte.
»Antworte der Dame«, sagte Ned und versetzte dem Jungen eine Ohrfeige, so daß er an die gegenüberliegende Wand flog.
»Warte mal, Ned«, fuhr ich dazwischen. »Laß dir Zeit. Schlag den Jungen erst, wenn ich meine Fragen gestellt habe.«
»Aber er hat es getan, Mistress. Er hat es ja praktisch schon zugegeben.«
»Einen Augenblick. Ich möchte mit ihm nach Clavering Hall gehen.«
Jake sah aus, als wolle er jeden Augenblick davonrennen, und ich war jetzt meiner Sache sicher.
»Komm«, sagte ich, »wir gehen sofort.«
Meine Mutter war sehr überrascht, als ich mit Ned Carter und seinem verschreckten Sohn bei ihr einmarschierte.
»Was ist denn los?« rief sie.
»Ist Dickon hier?« fragte ich.
»Er ist mit Sabrina ausgeritten. Warum?«
»Ich muß mit ihm sprechen.« Zum Glück kamen er und Sabrina im selben Augenblick herein.
Dickon verriet sich sofort, weil er so verdutzt darüber war, daß die Carters vor ihm standen.
Er wandte sich zur Tür. »Ich habe mein ...« Er unterbrach sich, weil ich ihm den Weg verstellte.
»Einen Augenblick noch«, nagelte ich ihn fest. »Angeblich hat Jake den Brand in Hassocks Farm verursacht. Aber ich glaube nicht, daß er dabei allein war.«
»Ich glaube es schon«, widersprach Dickon.
»Nein, ich glaube, er hatte einen Mitschuldigen, und das warst du.«
»Nein«, rief Dickon. Er ging zu Jake hinüber, der sich verängstigt duckte. »Hast du vielleicht Märchen erzählt?«
»Er hat dich gar nicht erwähnt«, mengte ich mich ein.
»Aber Zippora, mein Liebling«, intervenierte meine Mutter, »warum zerbrichst du dir wegen solcher Dinge den Kopf? Wie geht es dem armen Jean-Louis?«
Ich ließ mich jedoch nicht beschwichtigen, denn jede Ungerechtigkeit empörte mich so sehr, daß meine heftigen Reaktionen schon einige Male die Menschen um mich überrascht hatten. »Ich zerbreche mir den Kopf darüber, warum Jake Carter wegen etwas bestraft wird, das er nur getan hat, weil er dazu gezwungen wurde.«
»Nein, nein«, widersprach Jake. »Ich habe es getan. Ich habe das Feuer im Eimer angezündet.«
»Ich sehe mal nach Vesta«, verkündete Dickon. »Ihre Jungen müssen jeden Augenblick zur Welt kommen.«
»Du wirst noch einen Augenblick warten, bevor du sie besichtigst«, entschied ich. »Zuerst wirst du uns erzählen, wer das Fleisch aus der Speisekammer gestohlen und Jake um den Eimer geschickt hat, wer mit ihm in die Scheune gegangen und mit ihm davongelaufen ist, als das Feuer außer Kontrolle geriet.«
»Warum fragst du ausgerechnet mich?« Dickons Ton war aufsässig.
»Weil ich zufällig die Antwort auf alle diese Fragen kenne: du bist der wahre Schuldige.«
»Das ist eine Lüge.«
Ich ergriff ihn am Arm, und er funkelte mich haßerfüllt an. Ich erschrak darüber, daß ein so junger Mensch solch heftiger Gefühle fähig war.
»Ich habe dich gesehen«, sagte ich. »Es hat keinen Sinn zu leugnen. Ich sah dich mit dem Eimer – du hast ihn nämlich getragen. Jake hielt ein Paket in den Händen, und ihr gingt zu Hassocks Anwesen hinüber.«
Es folgte tiefe Stille.
Dann bequemte sich Dickon zu einem Geständnis. »Es war ja nur ein Spiel. Wir wollten die Scheune nicht in Brand setzen.«
»Aber ihr habt es getan. Außerdem hast du Jake dazu gezwungen, dich zu begleiten, und hast dann ihm die ganze Schuld in die Schuhe geschoben.«
»Wir kommen selbstverständlich für den Schaden auf«, mischte sich Sabrina ein.
»Natürlich«, antwortete ich, »aber damit ist die Angelegenheit noch nicht erledigt.«
»O doch«, widersprach Dickon.
»O nein. Du mußt Ned Carter noch erklären, daß seinen Sohn keine Schuld trifft.«
»Ach, so viel Lärm um nichts«, war Dickons Antwort.
Ich sah ihn unverwandt an. »Ich würde es nicht als ›nichts‹ bezeichnen. – Du kannst jetzt gehen, Ned. Und denk daran, daß Jake nichts dafür kann, sondern gegen seinen Willen mitmachen mußte. Mein Mann wird sicherlich verärgert sein, wenn er erfährt, daß du den Jungen bestraft hast.«
Als sie gegangen waren, herrschte Schweigen in der Halle.
Dickon pflanzte sich vor mir auf, sah mich starr an und sagte: »Das werde ich dir nie vergessen.«
»Ich auch nicht, Dickon.«
»So, und jetzt sehe ich nach Vesta.« Damit lief er hinaus.
»Alle Jungen machen in seinem Alter irgendwelche Dummheiten«, bemerkte Sabrina.
»Das stimmt. Aber wenn man sie dabei erwischt, dann schiebt kein anständiger Junge die Schuld auf einen anderen, noch dazu, wenn der keine Möglichkeit hat, sich zu verteidigen.«
Meine Mutter und Sabrina ertrugen es nicht, wenn man ihr geliebtes Kind kritisierte, aber sie wußten nicht, was sie darauf erwidern sollten.
Und dann hörte ich mich zu meiner Überraschung sagen: »Ich habe beschlossen, nächste Woche wie vorgesehen nach Eversleigh zu reiten.«
»Aber Jean-Louis ...« begann meine Mutter.
»Kann mich natürlich nicht begleiten. Er hat hier die beste Pflege, also spielt es keine Rolle, wenn ich ihn allein lasse, noch dazu nur für kurze Zeit. Es würde Lord Eversleigh sicherlich schwer treffen, wenn ich nicht käme.«
Ich glaube, damals hat mein zweites Ich von mir Besitz ergriffen.
Die Familie widersetzte sich meinem Entschluß heftig. Meine Mutter erklärte, daß sie keine ruhige Minute haben würde, bis ich wieder sicher zu Hause sei, und Sabrina schloß sich ihr an. Es hätte noch nie so viele Wegelagerer gegeben wie gerade jetzt, behaupteten sie einhellig.
Dickon fügte hinzu: »Wenn du dich weigerst, dein Geld herzugeben, schießen sie dich tot.«
Wahrscheinlich wäre er über eine solche Entwicklung sehr erfreut gewesen, denn seit der Affäre mit dem Brand herrschte eine gewisse Spannung zwischen uns.
Jean-Louis reagierte genauso, wie ich erwartet hatte. Er fügte sich ins Unvermeidliche und war bestrebt, mir alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Er humpelte durch das Haus und ließ sich in einem Leiterwägelchen auf dem Gut herumfahren; es wäre zu schlimm für ihn gewesen, an dem Geschehen auf Clavering nicht teilnehmen zu können.
»Ich habe das Gefühl, daß ich fahren muß«, hatte ich ihm erklärt. »Der Brief des alten Mannes wirkte irgendwie merkwürdig. Sabrina fand, er klänge wie ein Hilferuf. Wahrscheinlich ist diese Auslegung zu phantasievoll, aber andererseits liegt wirklich etwas Eigenartiges in ihm.«
»Ich mache mir vor allem wegen der Reise Sorgen. Wenn ich nur sicher sein könnte, daß dir nichts zustößt ...«
»Ach, Jean-Louis, so viele Leute unternehmen Reisen. Wir erfahren eben nur von den Unglücksfällen, aber nie von den Tausenden, die heil davongekommen sind.«
»Bestimmte Straßenabschnitte sind sehr gefährlich ... dort halten sich oft Wegelagerer versteckt.«
»Wir werden sie meiden; außerdem bin ich ja nicht allein.«
»Deine Mutter ist absolut dagegen.«
»Ich weiß. Sie erlebte als Kind einen Überfall und hat ihn nie vergessen. Mir wird schon nichts zustoßen, Jean-Louis.«
»Du möchtest unbedingt fahren, nicht wahr?«
»Ja.«
»Ich verstehe dich.« Das tat er wirklich – er erriet oft meine Gedanken, bevor ich sie ausgesprochen hatte. Vielleicht hatte er damals das Gefühl, daß mein Leben zu eintönig verlief, daß ich das Bedürfnis nach Abwechslung hatte. Doch weil er ein aktiver Mensch war, grübelte er nicht darüber nach, welche Gefahren mir drohten, sondern sorgte dafür, daß die Reise so sicher wie möglich verlief.
»Du wirst sieben Reitknechte mitnehmen«, erklärte er. »Sie werden zurückreiten, sobald sie dich heil abgeliefert haben, und dich wieder abholen, wenn du Eversleigh verläßt. Das sollte als Schutz ausreichen.«
Ich küßte ihn voll überströmender Liebe.
»Also?« fragte er.
»Ich habe den besten Mann der Welt.«
Er machte sich mit Feuereifer an die Vorbereitungen und besprach die Reiseroute genau mit mir.
***
Es war ein herrlicher Junimorgen, als wir aufbrachen; die Sonne war eben erst aufgegangen, aber es würde sicherlich ein klarer Tag werden. Wir kamen gut voran, und meine Vorfreude wuchs. Um uns blühte alles; weiße Schmetterlinge saßen auf blauen Kornblumen; die Bienen summten um die roten Blüten des Klees; Gänseblümchen, Dotterblumen, Himmelschlüssel und Pimpernellen leuchteten im Gras.
Wir sollten unterwegs zweimal übernachten, und Jean-Louis hatte dafür gesorgt, daß die Wirtshäuser Zimmer für uns reservierten.
Ich schlief in der ersten Nacht nicht sehr gut. Ich war zu aufgeregt, und deshalb war ich schon auf den Beinen, als die ersten Streifen der Morgenröte am Himmel auftauchten.
Auch der zweite Tag verging rasch und reibungslos, und nach einer kurzen Nachtruhe näherten wir uns am dritten Tag endlich unserem Ziel.
Wir sollten gegen vier Uhr nachmittags in Eversleigh eintreffen, aber als wir bei einem Gasthaus Mittagsrast hielten, stellten wir fest, daß eines der Pferde ein Hufeisen verloren hatte. Ich überlegte, ob ich die Verzögerung in Kauf nehmen und warten sollte, bis das Pferd wieder beschlagen war, oder ob ich mit nur sechs Begleitern weiterreiten sollte.
Da ich meiner Mutter versprochen hatte, mich nur in Begleitung aller Reitknechte auf den Weg zu machen, beschloß ich zu warten.
Es dauerte jedoch länger als angenommen, denn der Hufschmied war zu einem der Landedelleute in der Umgebung geholt worden. Er hatte zwar versprochen, bald wieder zurück zu sein, aber es wurde doch vier Uhr, bis er eintraf.
Er tat zwar sein Möglichstes, aber es dauerte noch eine Weile, bis wir wieder unterwegs waren. Deshalb dämmerte es schon, als wir Eversleigh erreichten.
Kapitel 2Jessie
Ich war vor langer Zeit in Eversleigh Court gewesen und erinnerte mich undeutlich daran. Als ich ein Kind war, hatten wir Weihnachten dort gefeiert, denn es war immer das Stammhaus der Familie gewesen. Als meine Mutter nach dem Tod meines Vaters nach Clavering Hall übersiedelte, stellte sie diese Besuche ein, und ich hatte das alte Haus seither nicht wiedergesehen. General Eversleigh, der meine Mutter sehr gern gehabt hatte, hatte eine Zeitlang den Besitz verwaltet, aber nach seinem Tod war Carl, Lord Eversleigh, zurückgekehrt – ich wußte nicht, wo er sich inzwischen aufgehalten hatte – und hatte sich in Eversleigh niedergelassen.
Ich war sehr aufgeregt. Während der Reise hatte ich versucht, mich an alles zu erinnern, was ich von der Familie wußte, die in dem großen Haus gelebt hatte. Noch interessanter war natürlich das geheimnisumwitterte Enderby, und ich wollte es so bald wie möglich aufsuchen. Aber zunächst mußte ich mich einmal mit Eversleigh befassen.
Das Tor in der hohen Mauer stand offen, und wir ritten in den Hof ein. Im Haus blieb es still, doch hinter einem Fenster sah ich einen Lichtschimmer.
Ich war überrascht, weil die große Haustür nicht geöffnet wurde; schließlich wurden wir erwartet, und man mußte das Geräusch der Hufe auf dem Kies gehört haben.
Wir warteten einige Augenblicke, doch kein Stallknecht tauchte auf und das Haus blieb dunkel.
»Weil wir so spät kommen, haben sie uns wahrscheinlich nicht mehr heute erwartet«, meinte ich. »Läutet die Glocke, dann wissen sie, daß wir hier sind.«
Einer der Knechte saß ab und zog am Klingelstrang. Ich erinnerte mich daran, wie ich als Kind das gleiche getan und dann fasziniert dem Ton der Glocke gelauscht hatte.
Die Glocke verklang, und es wurde still. Ich begann mich unbehaglich zu fühlen. Das war nicht der Empfang, den ich aufgrund von Lord Eversleighs Briefen erwartet hatte.
Endlich ging die Tür auf, und in ihrem Rahmen erschien eine junge Frau. Ich konnte sie nicht deutlich ausmachen, aber sie wirkte wie eine Schlampe.
»Was wollen Sie?« fragte sie.
»Ich bin Mistress Zippora Ransome«, antwortete ich. »Lord Eversleigh erwartet mich.«
Die Frau sah mich verständnislos an. Ich hatte den Eindruck, daß sie geistig zurückgeblieben war und versuchte, an ihr vorbei in die Halle zu sehen. Aber in der Halle brannte kein Licht; die einzige Beleuchtung war die Kerze, die sie abgestellt hatte, als sie die Tür öffnete.
Einer der Reitknechte hielt mein Pferd, während ich abstieg und zur Tür ging.
»Lord Eversleigh erwartet mich. Bring mich zu ihm. Wer führt den Haushalt?«
»Mistress Jessie.«
»Dann hole bitte Mistress Jessie. Ich werde in der Halle auf sie warten. Wo sind die Ställe? Meine Reitknechte sind müde und hungrig. Gibt es jemanden, der ihnen helfen kann, die Pferde zu versorgen?«
»Ja, Jethro. Ich werde jetzt Mistress Jessie holen.«
»Schön, aber beeil dich. Wir haben eine lange Reise hinter uns.«
Sie wollte mir die Tür vor der Nase zuschlagen, aber ich drückte sie auf und trat in die Halle.
Das Mädchen schlurfte davon, nachdem es die Kerze auf dem langen Eichentisch abgestellt hatte.
Anscheinend gingen hier wirklich merkwürdige Dinge vor. Ich mußte an Sabrinas Feststellung denken: »Ein Hilferuf.« Das schien zu stimmen.
Ich schrak zusammen, weil am oberen Ende der Treppe eine Gestalt aufgetaucht war. Es war eine Frau, die in der hocherhobenen Hand einen Leuchter hielt – wie eine Figur aus einem Bühnenstück. Im flackernden Kerzenlicht sah sie überraschend gut aus. Sie war groß, rundlich, aber wohlgeformt, und an ihrem Hals glitzerten Diamanten. Diamanten glitzerten auch an ihren Handgelenken und an ihren Fingern – eine ganze Menge Diamanten.
Würdevoll kam sie die Treppe herab.
Sie trug eine reichgelockte, sehr helle, beinahe blonde Perücke, und eine Locke fiel ihr auf die linke Schulter. Ihr Reifrock umgab sie wie eine Glocke; er war aus pflaumenblauem Samt und vorne ausgeschnitten, so daß man das elegante, mit Blumen bestickte, malvenfarbene Unterkleid sah. Sie war offensichtlich eine Dame, und ich konnte mir nicht vorstellen, was für eine Rolle sie in dem Haushalt spielte. Als sie näherkam, erkannte ich, daß das Rot ihrer Wangen zu leuchtend war, um natürlich zu sein; unter den leicht hervorquellenden blauen Augen trug sie ein Schönheitspflästerchen und ein weiteres neben dem grellrot geschminkten Mund.
Ich stellte mich vor. »Ich bin Zippora Ransome. Lord Eversleigh hat mich aufgefordert, ihn zu besuchen. Er wußte, daß wir heute eintreffen würden. Wir sind allerdings etwas spät dran, weil eines unserer Pferde ein Hufeisen verloren hat.«
Die Augen der Frau verengten sich; sie sah mich verständnislos an, und ich fuhr hastig fort: »Ich nehme an, daß ich erwartet werde.«
»Ich weiß nichts von alledem«, antwortete die Frau. Sie sprach sehr geziert, und wenn nicht ihre Kleidung gewesen wäre, hätte ich sie für die Haushälterin gehalten.
»Ich erinnere mich nicht, von Ihnen gehört zu haben«, sagte ich. »Vielleicht könnten Sie ...«
»Ich bin Mistress Stirling, aber die Leute nennen mich Mistress Jessie. Ich sorge seit zwei Jahren für Lord Eversleigh.«
»Sie sorgen ...«
Sie lächelte beinahe verächtlich. »Ich bin eine Art Hausdame.«
»Ach so. Und er hat Ihnen nicht gesagt, daß er mich eingeladen hat?«