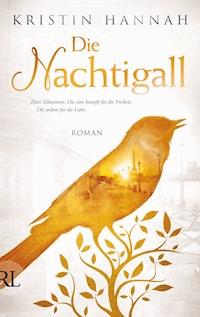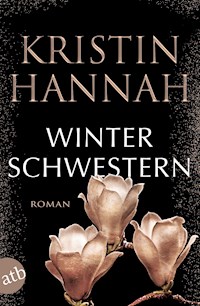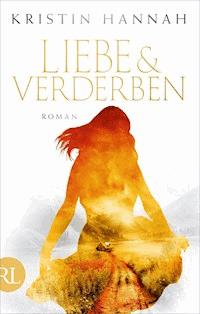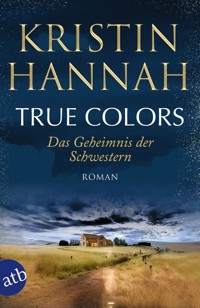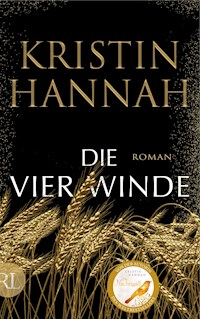8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn die Liebe uns fordert.
Der vergebliche Wunsch nach einem Kind hat die Ehe von Angie und Conlan zerbrechen lassen. Nun kehrt sie zu ihrer Familie zurück, die in einem kleinen Ort am Pazifik ein Restaurant betreibt. Sie begegnet der jungen Lauren, die ohne jede Unterstützung darum kämpft, studieren zu können, und versucht, für das Mädchen da zu sein. Doch das birgt Konflikte in sich, mit denen keine der beiden gerechnet hätte. Und Angie kann ihre Gefühle für Conlan nicht vergessen …
Ein bittersüßer Roman über das, was man manchmal loslassen muss, um lieben zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Kristin Hannah
Kristin Hannah, geboren 1960 in Südkalifornien, arbeitete als Anwältin, bevor sie zu schreiben begann. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Autorinnen der USA und lebt mit ihrem Mann im Pazifischen Nordwesten der USA. Nach zahlreichen Bestsellern war es ihr Roman »Die Nachtigall«, der Millionen von Lesern in über vierzig Ländern begeisterte und zum Welterfolg wurde.
Gabriele Weber-Jarić lebt als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Sie übertrug u. a. John Boyne, Mary Morris, Mary Basson und Kristin Hannah ins Deutsche.
Informationen zum Buch
Wenn die Liebe uns fordert.
Der vergebliche Wunsch nach einem Kind hat die Ehe von Angie und Conlan zerbrechen lassen. Nun kehrt sie zu ihrer Familie zurück, die in einem kleinen Ort am Pazifik ein Restaurant betreibt. Sie begegnet der jungen Lauren, die ohne jede Unterstützung darum kämpft, studieren zu können, und versucht, für das Mädchen da zu sein. Doch das birgt Konflikte in sich, mit denen keine der beiden gerechnet hätte. Und Angie kann ihre Gefühle für Conlan nicht vergessen …
Ein bittersüßer Roman über das, was man manchmal loslassen muss, um lieben zu können.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kristin Hannah
Die Dinge, die wir aus Liebe tun
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Gabriele Weber-Jarić
Inhaltsübersicht
Über Kristin Hannah
Informationen zum Buch
Newsletter
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Impressum
Wieder für Benjamin und Tucker.
Und für meine Freunde und Freundinnen Holly und Gerald, Mark und Monica, Tom und Lori, Megan und Kany, Steve und Jill.
Ein besonderes Dankeschön geht an Linda Marrow, deren Leistung all meine Erwartungen übertroffen hat.
»Nicht die Dinge ändern sich; wir ändern uns.«
Henry David Thoreau
Erstes Kapitel
Es war einer jener seltenen Frühlingstage, an denen von morgens bis abends die Sonne schien. In West End standen Mütter vor den Häusern, beschirmten die Augen mit der Hand und sahen ihren Kindern beim Spielen zu. Sie wussten, dass der Himmel sich spätestens am nächsten Tag wieder zuziehen würde. Die Frühlingssonne würde verschwinden, die Luft diesig werden, und dann würde es regnen.
So war es, wenn man in Oregon lebte. Dort gehörte der Regen zum Monat Mai wie die Kürbisse zu Halloween und das Feuerwerk zum vierten Juli.
»Ist das warm«, sagte Conlan, nachdem er bestimmt eine Stunde lang geschwiegen hatte und außer dem Motorengeräusch des schwarzen BMW Cabrio nichts zu hören gewesen war.
Es war ein Versuch, Konversation zu treiben, und Angie dachte sich, dass sie nun wohl ihrerseits etwas sagen sollte. Vielleicht etwas über den blühenden Weißdorn am Straßenrand. Doch dann musste sie daran denken, dass die Blüten bald zu welken begännen. In kalten Nächten verloren sie ihre Farbe und fielen zu Boden. Nichts davon würde Conlan interessieren, und warum sollte man etwas so Flüchtiges auch erwähnen?
Sie näherten sich West End, der kleinen Stadt, in der Angie groß geworden war und wo ihre Familie noch immer lebte. Angie schaute aus dem Fenster. Sie hing an ihrer Familie, trotzdem war sie seit Monaten nicht mehr hier gewesen. Es lag nicht an der Entfernung, die Fahrt von Seattle dauerte kaum mehr als zwei Stunden, doch es gab Tage, da fehlte ihr einfach die Kraft, den Anblick der vielen Kinder in ihrer Familie zu ertragen.
Sie bogen in ihr Viertel ein. Es war der schönste und älteste Teil von West End. Hier standen auf schmalen Grundstücken Häuser im viktorianischen Stil, und wenn die Sonne schien, warf das Laub der großen Ahornbäume filigrane Muster aus Licht und Schatten auf die Straße. Früher war diese Ecke das pulsierende Herz der kleinen Stadt gewesen, überall hatte man Kinder gesehen. Die einen rannten umher, andere strampelten auf Dreirädern über den Gehsteig, wieder andere rasten mit ihren Fahrrädern durch die Gegend. An Sommersonntagen trafen sich Familien nach der Kirche und dem Mittagessen zum Plaudern in einem der Häuser oder Gärten, während die Kinder bei schönem Wetter draußen Fangen oder Verstecken spielten.
Inzwischen war es in dem alten Wohnviertel still geworden. Es lag daran, dass sich in diesem Teil des Landes viel verändert hatte. In den Flüssen Oregons gab es nicht mehr so viele Lachse wie früher, die Holzindustrie war am Boden, die Bewirtschaftung der Felder lohnte sich kaum noch. Alteingesessene Familien, die ihren Lebensunterhalt mit Fischfang, Forstwirtschaft und dem Anbau von Getreide und Gemüse verdient hatten, gerieten ins Abseits, und ihre Kinder zogen fort. Die neuen Bewohner errichteten ihre Häuser am Rand von West End, in Siedlungen, die nach den Bäumen benannt wurden, die für die Neubauten gefällt worden waren.
Angies Elternhaus stand am Ende einer Straße und wirkte so unverändert, als wäre die neue Zeit spurlos daran vorübergegangen. Die weiße Außenfarbe sah aus wie frisch gestrichen, die smaragdgrünen Einfassungen der Fenster und der Haustür glänzten, auf dem Rasen des Vorgartens wuchs nicht das kleinste Unkraut. Vierzig Jahre lang hatte sich Angies Vater um das Haus gekümmert, es war sein ganzer Stolz gewesen. Sechs Tage in der Woche führte er das Restaurant der Familie, und montags, wenn es geschlossen war, widmete er sich seinem Haus und dem Garten. Angies Mutter versuchte es nach seinem Tod ebenso zu halten. Es war ihre Art, dem Mann nahe zu bleiben, den sie ihr Leben lang geliebt hatte, aber vielleicht lenkte die Arbeit sie auch von ihrer Trauer ab. Wenn ihr die Arbeit zu schwer wurde, hatte sie stets jemanden in ihrer Nähe, der ihr half. Sie sagte, das sei das Schöne, wenn man drei Töchter hatte und den Lohn dafür kassieren konnte, sie in ihrer Pubertät ertragen zu haben.
Conlan fuhr an den Straßenrand und hielt an. Über ihnen schloss sich das Verdeck des Wagens. Er drehte sich zu Angie um. »Bist du sicher, dass es dir nicht zu viel wird?«
»Sonst säße ich nicht hier.« Sie sah in seine blauen Augen und erkannte, wie erschöpft er war, entmutigt. Er würde nichts sagen, jedenfalls nichts über das Baby, das sie vor einigen Monaten verloren hatten.
Sie schwiegen beide. Außer dem Zwitschern der Vögel in den Bäumen war nichts zu hören.
Es hatte Zeiten gegeben, da hätte er sie jetzt in die Arme genommen und erklärt, dass er sie liebte. Es hätte ihr Kraft gegeben. Doch diese Zeiten waren vorüber. Vielleicht war auch ihre Liebe vorüber, verloren wie ihre Jugend.
»Noch können wir verschwinden. Könnten sagen, der Wagen wäre auf halber Strecke liegen geblieben.« Früher hätte so ein Vorschlag zu ihm gepasst, dachte Angie. Als er noch der Mann war, der sie zum Lachen bringen konnte. Aber dieser Mann war er nicht mehr.
»Soll das ein Witz sein?« Angie öffnete ihren Sicherheitsgurt. »Der Wagen ist neu, und jedem in meiner Familie ist klar, wie viel er gekostet hat. So ein Wagen bleibt nicht liegen. Im Übrigen wird meine Mutter längst wissen, dass wir da sind, sie hat Ohren wie ein Luchs.«
»Vielleicht ist sie hinten in der Küche und macht für eine ganze Armee Cannelloni. Deine Schwestern werden bei ihr sein und ohne Punkt und Komma reden. Niemand merkt es, wenn wir uns aus dem Staub machen.« Angie warf ihm einen genervten Blick zu. Conlan grinste schief, als wäre alles in Ordnung und es stünde nichts Unausgesprochenes zwischen ihnen. Angie dachte, wie schön es wäre, wenn seine gute Laune halten würde.
»Sie warten auf uns. Livvy wird Gulasch für zehn gekocht haben. Und Mira hat wahrscheinlich eine neue Tischdecke gehäkelt und für alle die gleichen Schürzen genäht.«
»Du hattest in der letzten Woche zwei Konferenzen und hast einen Werbespot gedreht. Wann hättest du noch kochen sollen?«
Armer Conlan. Selbst nach vierzehn Jahren Ehe kannte er die Regeln der Familie DeSaria noch nicht. Bei den DeSarias stand Essen hoch im Kurs, und wenn die Familie zusammenkam, brachte man etwas mit, das man gekocht oder gebacken hatte. Nur Angie fiel aus der Reihe. Ihre Gedanken wanderten zu ihrem Vater. Ihn hatte es nicht gestört, dass sie nicht kochen konnte. Vor vielen Jahren war er mit nicht mehr als ein paar Scheinen in der Tasche in die Vereinigten Staaten gekommen, hatte angefangen für andere zu kochen und schließlich ein Restaurant eröffnet. Es hatte ihn stolz gemacht, dass seine jüngste Tochter ihr Geld mit dem Kopf statt mit den Händen verdiente.
Angie verscheuchte die schmerzlichen Erinnerungen an ihren Vater und sagte: »Lass uns reingehen.«
Sie stieg aus und holte einen Karton aus dem Kofferraum. Er enthielt eine dick mit Sahne bestrichene Schokoladentorte und eine einfache Limonentarte, beide Fertigprodukte der Pacific Dessert Company. Im Geist hörte Angie bereits die Kommentare ihrer Schwestern. Sie würden sich laut wundern, warum sie nicht selbst gebacken hatte, sie daran erinnern, dass ihr Vater sie als Kind zu sehr verwöhnt hatte, sie seine Prinzessin gewesen war, die stets spielen, fernsehen und mit ihren Freundinnen telefonieren durfte, wohingegen Livvy und Mira in der Küche des Familienrestaurants helfen mussten. Inzwischen arbeiteten Angies Schwestern fest im »DeSaria«, was aufrichtige Arbeit war, wie sie betonten, statt irgendetwas »mit Werbung« zu machen.
»Also gut.« Conlan legte eine Hand auf Angies Rücken.
Sie gingen zum Haus, vorbei am Springbrunnen mit der Gipsfigur der Jungfrau Maria. Sie stiegen die Eingangsstufen hinauf. Auf der obersten Stufe stand an der Seite eine kleine Jesusfigur mit ausgebreiteten Armen. Irgendein Witzbold hatte einen Schirm an Jesu Handgelenk gehängt.
Conlan klopfte.
Ein Kind riss die Tür auf, kicherte und rannte wieder fort.
Was Conlan und Angie beim Eintreten als Erstes auffiel, war der Lärm – laute Stimmen, Lachen, Kinder, die die Treppe hinauf- und heruntergaloppierten. Das Mobiliar des Flurs war unter Mänteln, Jacken und Taschen begraben.
Auch im Wohnzimmer tummelten sich Kinder. Die Kleinen waren mit einem bunten Brettspiel zugange, einige der Größeren spielten Karten. Jason und Sarah, die Kinder von Angies Schwester Mira, saßen vor einem Computerspiel. Sie sprangen auf, als sie Angie sahen, und stürzten in ihre Arme. Angie war die Tante, die in Ordnung war. Sie spielte mit ihnen, ohne dass man stundenlang betteln musste, sagte nie, sie sollten die Musik leiser stellen, redete mit ihnen wie mit Erwachsenen und hörte ihnen zu.
Angie drückte die beiden an sich. Hinter ihr begrüßte Miras Ehemann Conlan und bot ihm etwas zu trinken an. Angie küsste Jason und Sarah, löste sich sanft von ihnen und machte sich auf den Weg zur Küche.
Die Küchentür stand weit offen. Angies Mutter bestäubte einen Apfelkuchen mit Puderzucker, eine feine weiße Schicht hatte sich auch auf ihren Wangen niedergelassen. Sie hatte ihre Brille aufgesetzt, ein Relikt aus den siebziger Jahren, mit Gläsern so dick, dass die Augen dahinter riesig wirkten. Auf ihrer Stirn zog ein Schweißfaden seine Bahn. Angies Vater war vor fünf Monaten gestorben, seitdem hatte ihre Mutter Gewicht verloren. Und sie hatte aufgehört, ihr Haar zu färben. Nun war es schneeweiß.
Mira war am Herd, trug eine schwarze Jeans und einen roten Pullover. Das dunkle Haar war zu einem Zopf geflochten, der ihr fast bis zur Taille ging. Von hinten sah sie aus wie ein junges Mädchen. Vier Kinder hatte sie geboren und war trotzdem gertenschlank. Wenn sie die Sachen ihrer halbwüchsigen Tochter trug, schätzten die Leute sie auf höchstens dreißig Jahre, dabei war sie einundvierzig. Mira ließ Gnocchi in einen Topf kochendes Wasser gleiten und sagte irgendetwas, das Angie nicht verstand. Mira redete pausenlos. Wie ein Mixer auf Hochtouren, hatte Angies Vater immer gesagt.
Livvy stand bei ihrer Mutter und schnitt Mozzarella auf. Sie trug ein schmalgeschnittenes schwarzes Kleid und erinnerte Angie an irgendetwas. An einen überdimensionierten Kugelschreiber vielleicht. Ihr Blick fiel auf die haushohen Stöckelschuhe ihrer Schwester, wanderte hinauf zu dem hochaufgetürmten dunklen Haar. Livvy war vor Jahren nach Los Angeles gezogen, um Model zu werden. Sie brachte es sogar zu einigen Fototerminen, doch sie war nicht bereit, sich ganz ausziehen, und damit war ihre Karriere bald beendet. Nach zwei gescheiterten Ehen kehrte sie kurz nach ihrem vierunddreißigsten Geburtstag mit zwei kleinen Söhnen nach West End zurück und machte einen verbitterten Eindruck. Nun arbeitete sie wieder im Familienrestaurant. Wahrscheinlich tat sie es nicht gern, aber was blieb ihr anderes übrig. Sie fühle sich in West End gefangen, hatte sie immer gesagt, sei für die Großstadt geschaffen, nicht für ein Nest in der Provinz. Allerdings hatte sie in der vergangenen Woche Salvatore Traina geheiratet, Ehemann Nummer drei, der sie hoffentlich glücklich machen würde.
Angie dachte an die vielen Stunden, die sie zusammen mit ihrer Mutter und ihren Schwestern in dieser Küche verbracht hatte. Mamas Küche. Das war ihr Zuhause, hier fühlte sie sich geliebt und geborgen. Hier wurde ihr wieder bewusst, wie eng sie und ihre Schwestern miteinander verbunden waren. Wie Stränge eines Seils waren sie, da konnten sie noch so unterschiedlich sein, sich noch so oft auf die Nerven gehen, aber zusammen waren sie stark. Dieses Gefühl brauchte sie. Sie hatte sich lang genug allein gefühlt.
»Hallo ihr drei«, sagte Angie und stellte den Kuchenkarton auf dem Küchentisch ab.
»Hallo du eine.« Ihre Schwestern kamen und schlossen sie eine nach der anderen in die Arme. Sie rochen nach Parfum und italienischem Essen. Livvy wischte sich die Augen und sagte: »Gut, dass du gekommen bist.«
Angie gab ihr einen Kuss. Ihre Mutter breitete die Arme aus. Angie sank an ihre Brust und umschlang sie. Der Geruch nach Haarspray, Thymian und Acqua di Parma stieg ihr in die Nase. Der Geruch von Angies Kindheit.
Ihre Mutter drückte sie so fest an sich, dass Angie kaum noch Luft bekam. Sie wollte sich befreien, doch ihre Mutter ließ sie nicht los.
Angie versteifte sich. Ihre Mutter hatte sie schon einmal auf diese Weise gedrückt. Damals hatte sie geflüstert: »Du darfst nicht aufgeben. Gott wird deinen Kinderwunsch erfüllen.«
»Bitte, sag nichts.« Angie entwand sich den Armen ihrer Mutter und bemühte sich zu lächeln.
Ihre Mutter hatte verstanden. Sie kehrte an den Tisch zurück, griff nach der Parmesanreibe. »Sag den anderen Bescheid, Mira. Das Essen ist gleich fertig.«
Das Esszimmer war in Weinrot und Rosa tapeziert. In der Mitte stand ein schwerer Esstisch aus Mahagoni, der aus der alten Heimat stammte. Angies Vater hatte ihn bei seinem ersten Besuch in Italien erstanden und nach Amerika verschiffen lassen. Über der Tür hing ein Kruzifix und an einer Wand ein Gemälde, das einen mild lächelnden Jesus auf einer weißen Wolke zeigte. Vierzehn Personen hatten an dem großen Tisch Platz, an diesem Tag waren sie fünfzehn und mussten zusammenrücken.
»Lasst uns beten«, sagte Angies Mutter, als alle saßen. Ihr Bruder Francis und Miras Ehemann unterhielten sich weiter. Angies Mutter stieß ihren Bruder an.
Er sagte nichts, senkte nur den Kopf und schloss die Augen. Die anderen taten es ihm nach und beteten. »Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Herr, von Dir. Dank sei Dir dafür. Amen.«
Angies Mutter stand auf und hob ihr Weinglas. »Lasst uns auf das Wohl von Salvatore und Olivia trinken und sie …« Ihre Stimme versickerte. »Ich kann das nicht«, sagte sie verlegen und setzte sich wieder. »Männer können das besser.«
»Das stimmt nicht.« Mira stand auf. »Wir heißen Sal in unserer Familie herzlich willkommen. Auf dass ihr euch ebenso liebt, wie Mama und Papa es getan haben. Wir wünschen euch, dass ihr nie Not leiden müsst, euch ein schönes Zuhause schafft und …« Sie legte eine kleine Pause ein. »… und gesunde Kinder bekommt.« Das Letzte sagte sie leise.
Stille breitete sich aus. Einige hoben ihr Glas, um mit dem frischgebackenen Ehepaar anzustoßen.
Angie zwang sich, ruhig und gleichmäßig zu atmen.
»Ich bin nicht schwanger«, sagte Livvy. Sie warf ihrem Mann einen liebevollen Blick zu. »Aber wir tun unser Bestes.«
Angie lächelte verkrampft. Ihre Mutter und ihre Schwestern fragten sich wahrscheinlich, ob sie ein weiteres Baby in der Familie ertragen konnte.
Sie hob ihr Glas. »Auf Sal und Livvy.« Sie sprach schnell und hoffte, man würde ihre Tränen für Freudentränen halten. »Und auf die Kinder, die noch kommen.«
Die Familie begann zu essen, und sofort setzten lautstarke Gespräche ein, klapperndes Besteck, Kindergekicher und Gelächter erklangen am Tisch. Der Großteil der Familie traf sich zwei Mal im Monat und an den Feiertagen, trotzdem hatten sie sich immer etwas zu erzählen.
Angie ließ alles an sich vorüberziehen. Mit halbem Ohr bekam sie mit, dass Mira ihrer Mutter etwas von einer Schulveranstaltung erzählte, von einem Buffet, das sie ausrichten sollte, und von Spenden, die noch gesammelt werden mussten. Vince und Onkel Francis redeten über Football. Sal flüsterte Livvy etwas ins Ohr. Zwei Kinder stritten sich darüber, was besser war, Xbox oder PlayStation. Tante Giulia erzählte Conlan von der Hüftoperation, die ihr bevorstand. Eines der Kinder bespuckte ein anderes mit einer Erbse.
Angie interessierte sich für keines der Gespräche. Sie konnte nur daran denken, dass ihre Schwester Livvy »ihr Bestes« tat, um wieder schwanger zu werden. Spätestens in einem Jahr hatte sie es vermutlich geschafft. Vielleicht würden sie und Sal das Kind einfach beim Fernsehen in einer Werbepause machen. Bei ihren Schwestern ging so etwas ruckzuck.
Nach dem Essen meldete Angie sich freiwillig zum Abwaschen. Wenn jemand in die Küche kam, um etwas zu holen, sagte er nichts. Nur Mira und Livvy drückten sie kurz an sich und gaben ihr einen Kuss. Was sollten sie auch sagen? Im Lauf der Jahre hatten sie zahllose gute Wünsche geäußert, und aus keinem war etwas geworden. Angies Mutter hatte in der Kirche der Heiligen Cäcilia täglich eine Kerze angezündet, auch das hatte nichts genützt. Angie und Conlan würden ein Ehepaar bleiben und nie zu einer Familie werden.
Mit einem Mal wurde ihr alles zu viel. Sie warf den Spülschwamm ins Wasser, verließ die Küche und lief die Treppe zu ihrem alten Zimmer hinauf. In dem kleinen Raum standen zwei Betten, jedes mit einer pinkfarbenen Steppdecke darüber. Sie setzte sich auf das Bett, das einmal das ihre gewesen war.
Ihr fiel ein, dass sie vor Jahren vor diesem Bett gekniet und gebetet hatte: Lieber Gott, mach, dass ich nicht schwanger bin. Damals war sie siebzehn und zum ersten Mal verliebt. In Tommy Matucci.
Die Tür öffnete sich, Conlan kam herein. Groß und breitschultrig wie er war, wirkte er in dem kleinen Mädchenzimmer übermächtig.
»Mach dir keine Gedanken«, sagte Angie. »Es ist alles in Ordnung.«
»Ach ja?«
In seiner Stimme schwang Bitterkeit, was ihr einen Stich versetzte. Aber sie konnte ihm nicht helfen. Weder ihm noch sich selbst.
»Du brauchst Hilfe«, sagte er. Nun klang er müde. Er hatte es schon so oft gesagt.
»Mir fehlt nichts.«
Er sah sie lange an. In den Augen, die einmal voller Liebe und Bewunderung gewesen waren, erkannte sie nur noch Hilflosigkeit und Verzweiflung. Er seufzte, verließ das Zimmer und zog die Tür hinter sich ins Schloss.
Wenig später ging sie wieder auf. Diesmal war es Angies Mutter. Sie stemmte die Fäuste in die Hüften. Die Schulterpolster ihres Sonntagskleids waren so groß und ihre Hüften so schmal, dass ihr Anblick Angie an einen Footballspieler denken ließ. »Du hast dich früher schon in dein Zimmer verzogen, wenn du traurig warst. Oder wütend.«
Angie klopfte einladend auf den Platz an ihrer Seite. »Und immer bist du mir nachgekommen.«
»Deinem Vater zuliebe.« Ihre Mutter setzte sich. »Er konnte deine Tränen nicht sehen. Wenn Livvy und Mira geweint haben, hat er es kaum wahrgenommen. Aber du warst seine Prinzessin. Deine Tränen haben ihm in der Seele wehgetan.« Sie seufzte resigniert. »Aber jetzt bist du achtunddreißig und solltest allmählich erwachsen werden. Das würde sogar dein Vater – er ruhe in Frieden – sagen.«
»Und was soll das heißen?«
Ihre Mutter legte einen Arm um sie und zog sie an sich. »Gott hat deine Gebete gehört und dir eine Antwort gegeben. Es ist zwar nicht die Antwort, die du dir gewünscht hast, aber es ist eine, mit der du dich abfinden musst.«
***
In der Nacht schreckte Angie aus dem Schlaf hoch, die Wangen feucht von Tränen.
Sie hatte wieder von dem Baby geträumt. Es war immer der gleiche Traum. Sie und Conlan standen sich an den Ufern eines in der Sonne glänzenden Flusses gegenüber. Auf dem Wasser schwamm ein Bündel. Es war in eine rosa Decke eingeschlagen und trieb von ihnen fort, immer weiter, bis es nicht mehr zu sehen war. Conlan und sie schauten ihm nach, jeder auf seiner Seite.
Dieser Traum verfolgte sie seit Jahren. Seit der Zeit, als sie begonnen hatten, von einem Arzt zum anderen zu laufen und sich einem Therapieverfahren nach dem anderen zu unterziehen. In den vierzehn Jahren ihrer Ehe war Angie drei Mal schwanger geworden. Die ersten beiden Male waren es Fehlgeburten. Das dritte Baby – sie hatten es Sophia getauft – war vor einigen Monaten nach wenigen Tagen gestorben. Es war viel zu früh zur Welt gekommen und zu schwach gewesen, um zu überleben. Seitdem hatten sie ihre Bemühungen, ein Kind zu bekommen, aufgegeben. Ihnen fehlte die Kraft, es weiter zu versuchen.
Angie stand auf, streifte ihren Morgenrock über und verließ das Schlafzimmer.
Im Flur knipste sie eine kleine Lampe an. Ihr Licht fiel auf die gerahmten Familienfotos an den Wänden. Sie zeigten vier Generationen DeSarias und Malones.
Am Ende des Flurs, an der letzten Tür, schimmerte der Messingknauf.
Wann hatte sie zum letzten Mal den Mut gehabt, das dahinterliegende Zimmer zu betreten?
Gott hat deine Gebete gehört und dir eine Antwort gegeben … eine, mit der du dich abfinden musst.
Zögernd näherte Angie sich der Tür.
Als sie davorstand, atmete sie tief durch, drehte den Knauf und trat in das Zimmer. Die Luft war abgestanden, es roch muffig.
Angie machte Licht und zog die Tür hinter sich zu.
Es war das schönste Kinderzimmer, das man sich denken konnte.
Der Anblick war so schmerzhaft, dass sie die Augen schloss. Wie aus weiter Ferne hörte sie die Melodie eines Kinderlieds, welches es war, vermochte sie nicht zu sagen. Sie dachte an den Tag, als sie das Zimmer gestaltet hatten. Das war vor zwei Jahren gewesen. Damals glaubten sie, sie hätten ein Kind gefunden, das sie adoptieren konnten.
Wir haben ein Kind für Sie, Mrs Malone. Die Mutter hat sich für Sie und Ihren Mann entschieden. Sie können die junge Frau in meinem Büro kennenlernen …
Angie öffnete die Augen. Das war der Anruf ihrer Anwältin gewesen. Sie wusste noch, wie lang sie überlegt hatte, was sie zu dem Treffen anziehen sollte. Sie wählte eine graue Hose und einen weißen Pulli. Es sollte seriös und freundlich zugleich wirken. Sie trafen die junge Frau in der Kanzlei ihrer Anwältin. Sie hieß Sarah Dekker und war minderjährig. Ihr Freund und sie hatten sich getrennt. Sie, Angie und Conlan mochten einander. »Wir werden ihr Kind lieben«, sagte Angie. »Sie können uns vertrauen.«
Es folgten sechs unbeschwerte Monate. Tage zählen, Temperatur messen, Sex auf Kommando, damit brauchten Angie und Conlan sich nicht mehr zu belasten. Es machte wieder Spaß, miteinander zu schlafen. Sie feierten den bevorstehenden Familienzuwachs mit ihren Familien. Sie luden Sarah zu sich ein, sprachen mit ihr über die Zukunft des Kindes, begleiteten sie zu den Vorsorgeuntersuchungen. Zwei Wochen vor dem Geburtstermin kam Sarah mit Farben und Schablonen, um mit Angie das Kinderzimmer zu streichen und zu schmücken. Die Decke wurde himmelblau, durchsetzt von weißen Wattewolken. Die Wände bekamen einen weißen Lattenzaun, durch den bunte Blumen hindurchwuchsen. Darüber malten sie Bienen und Schmetterlinge.
Ihre Anwältin rief sie an, als bei Sarah die Wehen einsetzten. Angie und Conlan fuhren von der Arbeit nach Hause. Sie setzten sich ans Telefon, hielten einander die Hand und warteten auf die Nachricht, dass sie ihr Baby abholen konnten. Als das Telefon ging, war wieder ihre Anwältin am anderen Ende und sagte, Sarah habe ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Sie waren überwältigt und mussten gegen die Tränen kämpfen. Deshalb brauchten sie einen Moment, bis auch der Rest der Nachricht zu ihnen durchdrang. Angie erinnerte sich nur noch an Bruchstücke.
Es tut mir leid … Sarah hat ihre Meinung geändert … mit ihrem Freund ausgesöhnt … Sie behalten das Baby.
Sie schlossen das Kinderzimmer ab und betraten es nicht mehr. Nur die Putzfrau ging ein Mal in der Woche hinein. Ein Jahr lang blieb das Zimmer leer, ein Schrein ihrer ungestillten Sehnsucht. Sie suchten keine Ärzte mehr auf. Sie hatten resigniert. Bis Angie wie durch ein Wunder erneut schwanger wurde. Sie war im fünften Monat, als sie die Tür zum Kinderzimmer wieder öffneten und noch einmal zu träumen wagten. Sie hätte es besser wissen müssen.
Angie holte den großen Karton aus dem Schrank. Sorgsam und systematisch begann sie die Gegenstände im Zimmer einzusammeln und in den Karton zu packen. Wenn eine Erinnerung kam und sie zu überwältigen drohte, verjagte Angie sie mit einem Kopfschütteln.
»Was machst du da?«
Sie hatte nicht gehört, dass Conlan hereingekommen war.
Wahrscheinlich fand er es abartig, dass sie dieses Zimmer mitten in der Nacht leerräumte. Sie schaute in den Karton. Dort waren all die Dinge, die sie für ihr Kind gekauft hatten: die Nachttischlampe mit dem Bild von Pu dem Bären auf dem Schirm, das Mobile aus bunten Papiervögeln, die Stofftiere und Bilderbücher. Neben dem Karton lag die zusammengefaltete Bettwäsche, ein kleiner ordentlicher Stapel aus rosafarbenem Flanell. Nur das Gitterbettchen mit der nackten Matratze stand noch an seinem Platz.
Angie schaute hoch. Conlans Gesicht verschwamm vor ihren Augen, und sie merkte, dass sie weinte. Sie strich über den weichen Flanellstapel und wollte Conlan erklären, wie leid es ihr tat, dass nichts so geworden war, wie sie es sich vorgestellt hatten. Doch dann sagte sie nur: »Ich konnte den Gedanken an die Sachen in diesem Zimmer nicht mehr ertragen.«
Er setzte sich zu ihr auf den Boden.
Angie wartete darauf, dass er eine Bemerkung machte, aber er saß nur da und sah sie abwägend an. Diesen Blick kannte sie. Er hielt sie für instabil und versuchte, ihre Stimmung auszuloten. Er war vorsichtig geworden, wie ein Tier, das bei jedem Geräusch in Deckung geht. »Ich habe einen Fehler gemacht«, sagte Angie. »Ich habe uns vergessen.«
»Uns gibt es nicht mehr, Angie.« Er sagte es so ruhig und endgültig, dass Angies Herz sich zusammenzog.
Nun hatte es also einer von ihnen ausgesprochen. »Ich weiß.«
»Ich habe mir das Baby ebenso wie du gewünscht.«
Angie wischte über ihre Augen und befahl sich, nicht mehr zu weinen. Das hatte sie ihm sagen wollen, dass sie vergessen hatte, wie sehr auch er sich nach einem Kind gesehnt hatte. Sie hatte zu lange an sich selbst gedacht, an ihre Enttäuschung, ihren Seelenkummer, und dabei übersehen, dass er ebenfalls litt. Bereits jetzt wusste sie, dass sie sich das niemals verzeihen würde. Sie hatte unbedingt ein Kind haben wollen, als wäre es ein Ziel, das sie wie jedes andere auch erreichen musste. Und als es ihr nicht gelang, hatte sie übersehen, dass nicht nur sie unglücklich war.
»Es tut mir unendlich leid«, sagte sie.
Conlan schloss sie in die Arme. Sie küssten sich, wie sie es seit langem nicht mehr getan hatten.
Dann saßen sie einfach da.
Angie wünschte, seine Liebe hätte ihr genügt. Doch ihr Wunsch nach einem Kind war wie eine Sturmflut gewesen, die sie beide mitgerissen hatte. Wahrscheinlich hatte es eine Zeit gegeben, in der sie sich noch hätten retten können, doch die war verstrichen.
»Ich habe dich geliebt«, sagte er.
»Ich weiß.«
»Wir hätten behutsamer mit unserer Liebe umgehen müssen.«
Später, als sie allein in dem Bett lag, das sie sich so lange geteilt hatten, wollte Angie sich an das, was sie zuletzt gesagt hatten, erinnern. Es fiel ihr nicht mehr ein. Das Einzige, woran sie sich erinnerte, waren der Duft von Babypuder und der Klang seiner Stimme, als er sich von ihr verabschiedete.
Zweites Kapitel
Angie und Conlan begannen das Leben, das bis vor kurzem noch ein gemeinsames gewesen war, auseinanderzutrennen. Es war ein zeitraubendes Unterfangen, denn wie teilte man Unteilbares? Ein Haus, ein Auto, ein gebrochenes Herz. Aber es ging auch um den Besitz kleinerer Dinge, bis zuletzt jedes Detail von Bedeutung war und über seinen künftigen Besitzer entschieden werden musste. Als sie alles verteilt hatten, war die Scheidung rasch erledigt. Ende September war ihre Ehe offiziell beendet.
Ihr Haus – nein, jetzt war es das Haus anderer Menschen – war leergeräumt. An seiner Stelle hatten Angie und Conlan nun jeder einen hohen Betrag auf dem Konto, eingelagertes Mobiliar und vollgepackte Koffer.
Zum letzten Mal betrat Angie das Wohnzimmer und ließ sich am Kamin auf dem glänzenden Holzfußboden nieder.
Als sie einzogen, hatte dort noch ein hellblauer Teppichboden gelegen.
»Hierher kommen Eichendielen«, sagten sie und Conlan damals wie aus einem Mund, sahen sich an und fingen an zu lachen. »Wenn wir Kinder haben, ist ein hellblauer Teppich zu empfindlich«, fügte Conlan hinzu.
Vor zehn Jahren waren sie hier eingezogen. Es kam ihr wie ein ganzes Leben vor.
Die Klingel an der Eingangstür schrillte.
Angie erstarrte.
Conlan kann es nicht sein, schoss es ihr durch den Kopf. Er hatte noch einen Schlüssel. Doch er würde nicht vorbeikommen. Es war ihr Tag, um die letzten Sachen zusammenzupacken. Vierzehn Jahre waren sie verheiratet gewesen, und zum Schluss hatten sie Termine ausgemacht, wer wann das Haus betreten konnte, ohne dem anderen begegnen zu müssen.
Angie rührte sich nicht und hörte, wie der Regen an die Fensterscheiben klopfte. Schließlich rappelte sie sich auf, trat in den Flur hinaus und öffnete die Eingangstür. Ihre Mutter, Mira und Livvy drängten sich unter dem Vordach. Jede setzte ein Lächeln auf, das keiner richtig gelingen wollte.
»Es gibt Tage, da braucht man seine Familie«, sagte Angies Mutter und trat an Angie vorbei ins Haus. Mira hatte einen Picknickkorb dabei, dem leichter Knoblauchduft entströmte.
»Wir haben Focaccia mitgebracht«, erklärte sie. »Essen hält Leib und Seele zusammen.«
Die alte Devise ihrer Familie, dachte Angie und war gerührt. Wie oft war sie früher wütend oder niedergeschlagen aus der Schule gekommen. »Iss erst einmal«, hatte ihre Mutter dann nach einem Blick auf sie gesagt. »Danach sieht die Welt wieder anders aus.«
Mira schob Angie zur Seite und betrat das Haus. Livvy folgte ihr. Sie trug eine hautenge Jeans und einen schwarzen Pullover und erinnerte Angie an Jackie Onassis. »Nach zwei Scheidungen weiß ich, dass Essen nichts bringt«, sagte sie. »Ich hatte für eine Flasche Grappa plädiert. Aber du kennst unsere Mutter.« Sie führte ihren Mund an Angies Ohr und flüsterte: »Ich habe Valium dabei.«
»Wo bleibt ihr?«, rief Angies Mutter aus dem Wohnzimmer. »Und wo sollen wir sitzen?«
Angie und ihre Schwestern gingen zu ihr. Angie fühlte sich peinlich berührt. Nicht einmal einen Stuhl konnte sie ihrer Mutter anbieten. So war das, wenn ein Haus kein Heim mehr war.
Sie setzte sich wieder auf den Holzboden. Die anderen standen unschlüssig da und sahen zu Angie hinab, als warteten sie darauf, dass sie endlich etwas äußerte. Vielleicht ein Thema vorgab, das mehr oder weniger unverfänglich war. Aber Angie, die sonst selten um Worte verlegen war, hatte nichts zu sagen. Noch vor einem Jahr hätte eine ihrer Schwestern sie gefragt: »Seit wann bist du so still? Hast du deine Zunge verschluckt?« Und alle hätten gelacht. Jetzt war es nicht mehr komisch.
Mira ließ sich an Angies Seite nieder und rückte dicht an sie heran. Angies Mutter setzte sich vor den Kamin, Livvy nahm an ihrer Seite Platz.
Angies Blick wanderte über die bedrückten Mienen. »Wenn nur Sophia nicht gestorben wäre …«
»Was soll das?«, fragte Livvy scharf. »Das führt doch zu nichts.«
»Ich weiß.« Angies Augen begannen zu brennen. Für einen Moment war sie versucht, sich ihrem Elend zu überlassen, aber sie nahm sich zusammen. Tränen führten zu nichts. In den vergangenen Jahren hatte sie oft genug geweint.
Mira legte einen Arm um sie und zog sie an sich.
Angie lehnte sich an ihre Schwester. Wieder schwiegen alle. Angie sah den prüfenden Blick ihrer Mutter und richtete sich auf.
Livvy zog den Picknickkorb zu sich heran, holte eine Flasche Rotwein, einen Korkenzieher und vier Gläser heraus. »Soll ich ehrlich sein?«
»Nein«, sagte Angie.
»Doch.« Livvy setzte den Korkenzieher an. »Zwischen dir und Conlan hat es schon seit einer Weile nicht mehr gestimmt. So etwas kenne ich aus eigener Erfahrung. Gut, dass ihr einen Schlussstrich gezogen habt.« Sie holte den Korken aus der Flasche, füllte die Gläser und schob jeder eines zu. »Warum verreist du nicht? Mach irgendwo Urlaub, wo die Sonne scheint.«
»Weglaufen hat noch nie geholfen«, sagte Mira.
»Hat es doch.« Livvy nahm einen Schluck. »Angie hat Geld, sie kann fliegen, wohin sie will.« Sie sah Angie an. »Wie wär's mit Rio? Da kannst du halbnackt über den Strand scharwenzeln, wirst braun, trinkst Cocktails.«
»Und das mit meinem schwabbeligen Hintern.« Angie musste lachen. Der Druck auf ihrer Brust ließ ein wenig nach.
»Der schwabbelt nicht.« Livvy grinste. »Oder nur ein bisschen.«
Nach einem tiefen Seufzer holte Angies Mutter ein Messer und Pappteller aus dem Picknickkorb und schnitt die Focaccia in kleine Quadrate. Tante Giulias Hüftoperation sei gut verlaufen, erzählte sie. Und in West End habe es weniger als sonst geregnet.
Angie versuchte zuzuhören, aber ihre Gedanken schweiften immer wieder ab, und ihr Blick strich ruhelos über die leeren Wände. Zig Fragen schossen ihr durch den Kopf, doch alle mündeten sie in eine – wie es hatte kommen können, dass sie nun geschieden war. So viele Jahre ihrer Ehe waren gut gewesen, aber ab irgendeinem Punkt waren sie und Conlan einander entglitten.
Mit halbem Ohr hörte sie, wie Livvy sagte: »Das Geschäft läuft nicht mehr. Wir haben keine andere Wahl.«
Angie kehrte in die Gegenwart zurück. »Was?«, fragte sie. »Wovon redet ihr?«
»Mama will das Restaurant verkaufen«, antwortete Mira und nahm einen großen Schluck Wein.
»Wie bitte?« Angie sah ihre Mutter ungläubig an. Das Restaurant hatten ihre Eltern in mühsamer Arbeit aufgebaut, es gehörte zu ihnen, war das Rückgrat der Familie. Wie konnte man so etwas verkaufen?
»Darüber reden wir ein andermal«, sagte ihre Mutter und warf Mira einen verärgerten Blick zu.
»Herrgott noch mal.« Angie schaute von einer zur anderen. »Warum können wir nicht jetzt darüber reden?«
»Ich mag es nicht, wenn du fluchst, Angela«, erwiderte ihre Mutter. Sie klang müde. »Dem Restaurant geht es schlecht. Und ich weiß nicht, wie wir es halten können.«
»Es ist Papas Lebenswerk«, sagte Angie fassungslos. »Er hat das Restaurant geliebt.«
Ihre Mutter wandte den Blick ab. »Das brauchst du mir nicht zu sagen.«
Angie sah Livvy an. »Kommt niemand mehr, oder was ist das Problem?«
Livvy zuckte mit den Schultern. »Die wirtschaftliche Lage ist das Problem.«
»Dem DeSaria ging es dreißig Jahre lang gut, egal, wie die wirtschaftliche Lage war. Wie kann es sein, dass –«
Livvy ließ sie nicht ausreden. »Komm bloß nicht auf die Idee, uns Vorwürfe zu machen. Oder glaubst du, du weißt es besser?« Sie zündete sich eine Zigarette an. »Ausgerechnet du als Werbetexterin.«
»Ich bin Kreativdirektorin, Libby. Und wir sprechen über die Führung eines Restaurants, nicht über Hirnchirurgie. In einem Restaurant geht es darum, Leuten zu einem vernünftigen Preis gutes Essen anzubieten. Was ist daran schwierig?«
»Jetzt hört doch auf«, sagte Mira. »Die Streiterei hat uns gerade noch gefehlt.«
Angie dachte, dass sie ein Recht darauf hatte zu streiten. Das Restaurant war das letzte Fundament in ihrem Leben, das noch hielt. Es durfte keine Risse bekommen und einbrechen.
Sie sah ihren Vater wieder vor sich und dachte an das, was er in dieses Restaurant investiert hatte, seine Kraft, seine Zeit, seine Kreativität. Er und ihre Mutter hatten die sichere Welt geschaffen, in der sie und ihre Schwestern aufgewachsen waren.
Das DeSaria war der Anker ihrer Familie. Ohne ihn würden sie davontreiben, jede mit einer anderen Strömung, an deren Ende Einsamkeit stand.
»Angie könnte uns helfen«, sagte ihre Mutter leise.
Livvy schnaubte verächtlich. »Angie hat von der Gastronomie null Ahnung. Papas Prinzessin hat doch nie einen Finger krumm –«
»Sei still, Livvy«, fiel ihre Mutter ein und sah Angie an.
Zwischen den beiden Frauen fand ein wortloser Austausch statt. Ich weiß, was du vorhast, sagte Angie. Ich soll Seattle verlassen, soll mich von den schmerzlichen Erinnerungen trennen, die in dieser Stadt an jeder Ecke auf mich lauern. Und gleichzeitig soll ich dir helfen, das Restaurant zu retten. Zwei Fliegen auf einen Streich. »Livvy hat recht«, sagte sie. »Vom Restaurantbetrieb habe ich keine Ahnung.«
»Du hast in Seattle eine Werbekampagne für ein Restaurant entworfen. Die war ein Erfolg.« Mira sah Angie eindringlich an. »Papa hat die Zeitungsartikel darüber ausgeschnitten und uns zum Lesen gegeben.«
»Angie hat ihm die Artikel geschickt«, korrigierte Livvy und stieß eine lange Rauchwolke aus. »Er hat sie nicht ausgeschnitten.«
Angie dachte an das Projekt zurück. Sie hatte eine Marketingstrategie entwickelt. Sie hatte nicht in einem Restaurant gestanden und selbst Hand angelegt.
»Ich würde mich freuen, wenn du uns hilfst«, sagte Mira.
Angie erinnerte sich an den Tag, als sie West End als junge Frau verlassen hatte. Sie hatte geglaubt, ihr stünde die Welt offen. Und nun sollte sie zurückgekrochen kommen?
»Du kannst im Strandhaus wohnen«, sagte ihre Mutter.
Im Strandhaus.
Das war ein kleines Cottage direkt an der rauen Küste Oregons. Ein Ort voller Erinnerungen an glückliche Zeiten.
Ein Ort der Geborgenheit.
Dort hatten sie als Kinder die schönsten Sommerferien verbracht, hatten zusammen gespielt und gelacht. Vielleicht fände sie dort ihr Lachen wieder.
Angies Blick streifte von neuem die leeren Wände, und sie dachte an die Stadt vor ihrer Tür. Ihre Mutter hatte recht. Es war besser, Seattle den Rücken zu kehren. Und warum sollte sie nicht für eine Weile zu Hause wohnen? So lange, bis sie wusste, wohin sie gehörte.
»Warum nicht«, sagte sie. »Allerdings wäre es nur vorübergehend.« In ihren Kummer mischte sich ein Gefühl der Erleichterung. In West End wäre sie nicht allein.
Ihre Mutter lächelte zufrieden. »Dein Vater wusste, dass du eines Tages zurückkommen würdest.«
»Danke«, sagte Livvy und drückte ihre Zigarette auf einem Pappteller aus. »Danke, dass du so gnädig bist, deiner unfähigen Familie aus der Patsche zu helfen.«
***
Eine Woche später, an einem frühen Morgen, machte Angie sich auf den Weg nach West End. Den Beginn ihrer neuen Lebensphase hatte sie mit voller Energie vorbereitet, wie alles, was sie in Angriff nahm. Zuerst hatte sie ihren Chef um unbefristeten Urlaub gebeten.
Der Mann fiel aus allen Wolken und fragte, ob das ihr Ernst sei oder sie einfach mehr Geld wolle. Ob sie mit ihrem Job unzufrieden sei und warum sie das nicht gesagt habe.
»Ich fühle mich einfach erschöpft«, sagte Angie und zuckte mit den Schultern. »Leer. Weiter nichts.«
»Erschöpft und leer«, wiederholte er. »Das verstehe ich nicht.«
Sie brauche eine Auszeit, sagte Angie. Und wisse nicht, für wie lang. Er sagte, das sei leider ausgeschlossen. Daraufhin kündigte Angie fristlos. Was oder wer hätte sie daran hindern sollen? Auf das Geld war sie nicht angewiesen; seitdem das Haus verkauft war, hatte sie mehr als genug. Immerhin war sie dabei, sich ein neues Leben aufzubauen, und da war es nur konsequent, das alte loszulassen. Und falls sie irgendwann doch wieder in der Werbung arbeiten wollte, würde sie jederzeit etwas finden.
Sie dachte daran, wie oft Conlan sie gebeten hatte, ihren Job zu kündigen oder kürzerzutreten, hatte seine Stimme im Ohr, wie er sagte: »So viel Stress ist nicht gesund. Wann sollen wir Zeit für uns finden, wenn du immerfort auf Hochtouren läufst? Die Ärzte meinen das doch auch …«
Angie drehte das Autoradio lauter, ließ die Musik wummern und trat aufs Gaspedal.
Es begann zu nieseln. Ein feiner Dunst legte sich über die vorbeifliegende Landschaft. Jede Meile führte Angie weiter von Seattle fort, brachte sie dem Ort ihrer Kindheit und Jugend näher.
Sie überquerte die Grenze von Washington nach Oregon. Die ersten Hinweisschilder auf die großen Strände Oregons tauchten auf. An der Ausfahrt West End verließ Angie die Fernstraße.
Als sie West End erreichte, hörte der Regen auf, und die Sonne kam hervor. Die nassen Straßen und das Laub der Bäume glänzten in ihrem Licht. Angie bog in die Hauptgeschäftsstraße ein. Die Farben der Fassaden, die vor einigen Jahren noch verblasst gewesen waren, leuchteten in strahlendem Blau, Grün, Rosa und Gelb. Sie dachte an die Paraden zum vierten Juli, die hier durchgezogen waren. Sämtliche DeSarias hatten daran teilgenommen, stets herausgeputzt und mit einem großen Werbetransparent für das Restaurant ausgestattet. Sie hatten Süßigkeiten in die Menge geworfen. Gott, wie sie das gehasst und versucht hatte, sich davor zu drücken. Fast spürte sie die Hand ihres Vaters wieder, der ihr die Haare zerzauste und sagte: »Hilft alles nichts. Du bist eine DeSaria, du marschierst mit.«
Angie ließ das Seitenfenster ein wenig herunter und atmete den vertrauten Geruch ein, die Mischung aus salziger Seeluft und Nadelwald. An diesem Tag zog noch ein leichtes Zimtaroma hindurch, es musste aus der Bäckerei kommen, deren Tür offen stand.
Die Straße war belebt, doch die Hast und das Gedränge Seattles fehlten. An den Ecken standen Leute zusammen und plauderten. Mr Peterson, der Besitzer der Drogerie, entdeckte Angie und hob grüßend die Hand. Angie winkte ihm. Im Geist sah sie ihn in seinen Laden zurückkehren und jedem Kunden erzählen, er habe Angie DeSaria gesehen. Mit bekümmerter Miene würde er ergänzen: »Die Ärmste ist geschieden, wussten Sie das?«
Angie näherte sich einer Verkehrsampel – einer der wenigen, die es in West End gab – und fuhr langsamer. Die Ampel schaltete auf Rot. Zum Haus ihrer Mutter musste sie links abbiegen, doch als die Ampel grün wurde, fuhr sie geradeaus. Sie wollte zum Meer, war noch nicht bereit, ihrer Familie zu begegnen.
Wenig später lag West End hinter ihr, und sie folgte einer schier endlosen, kurvigen Straße. Zu ihrer Linken zog sich eine Dünenkette, durchsetzt von hohen Kiefern. Der Strandhafer auf den hellen Sandbergen wiegte sich im Wind. Dahinter erstreckte sich der Pazifik bis zum Horizont.
Es war, als wäre sie in eine andere Welt geraten. Die Häuser wurden seltener und blieben dann ganz aus. Hin und wieder wiesen Schilder auf ein Hotel oder eine kleine Ferienanlage hin, die von der Straße aus nicht zu sehen waren. Es war ein einsamer Küstenstrich zwischen Seattle und Portland. Die reichen Bewohner dieser Städte hatten ihn noch nicht entdeckt, um hier Strandhäuser zu bauen, und den Einheimischen der Gegend fehlte dazu das Geld. Alles war noch wie früher. Ursprünglich. Sie ließ das Seitenfenster ganz herunter und hörte die Wogen des Pazifiks donnernd heranrollen und auf den Strand klatschen. Doch es gab auch Tage, an denen das Meer einen sanftmütigen Eindruck machte und die Besucher mit kleinen harmlosen Wellen zu sich lockte – Besucher, die sich Kajaks mieteten und weit hinauspaddelten, bis vor ihnen mit einem Mal Wellen wie Mauern in die Höhe wuchsen. Nicht alle kehrten zurück, manchmal wurden die leeren Kajaks an Land gespült.
An der Zufahrt zum Strandhaus hing an einem Zaunpfahl noch der alte, verrostete Blechbriefkasten mit dem Namen DeSaria darauf.
Angie bog in die Zufahrt ein. Über ihr schlossen sich die breiten Wipfel der Kiefern und sperrten den Himmel und die Sonne aus. Unter ihr breitete sich ein Teppich aus Kiefernnadeln aus. Am Wegrand wucherte Farn. Aus der noch regenfeuchten Erde stiegen Dunstschleier auf und hüllten die Farnsträucher in ein milchiges Licht. Dieses Schauspiel würde sich ihr nun jeden Morgen bieten. Wenn man in der Frühe spazieren ging, konnte es vorkommen, dass man seine Füße nicht sah. Als Kinder hatten sie die Nebelschwaden gejagt.
Dann war sie am Strandhaus, hielt an und stellte den Motor aus.
Bei dem Anblick des alten Cottage schnürte sich Angies Brust zu. Ihr Vater hatte dieses Haus gebaut, auf einer kleinen Lichtung und umgeben von Bäumen, die wahrscheinlich schon da waren, als Lewis und Clark Anfang des neunzehnten Jahrhunderts auf der ersten Überlandexpedition den Pazifik erreichten.
Das frühere Rotbraun der Holzschindeln auf dem Dach und an den Seiten des Hauses war verwittert und silbergrau wie Treibholz geworden. Die hellen Einfassungen an der Tür und den Fenstern hoben sich kaum noch davon ab.
Angie stieg aus dem Auto und vernahm die Symphonie, die sie noch aus ihrer Kindheit kannte: das dumpfe Donnern der Brandung, das Rauschen des Winds in den Bäumen, Vogelgezwitscher, Möwenschreie. Nicht weit entfernt musste jemand am Strand einen Drachen steigen lassen, sie hörte das Knattern der Papierbespannung. Stimmen aus ihrer Kindheit wurden laut.
Komm her, Schätzchen, hilf deinem Vater, die Sträucher zu trimmen.
Livvy, warte auf mich, ich kann nicht so schnell laufen.
Mama, Mira hat sich die ganze Schokolade genommen. Sag ihr, sie soll mit mir teilen.
Plötzlich waren sie wieder da, all die gemeinsamen Spiele, die Kränkungen, die Streitereien, die Freude, der elende Zwang, bei irgendetwas helfen zu müssen. Angie spürte die blassen Sonnenstrahlen auf dem Gesicht und wurde von Erinnerungen davongetragen, die aus irgendeiner längst vergessenen Tiefe heraufstiegen.
Da drüben war der große Stumpf des Mammutbaums, nun umgeben von wie vielen Schösslingen, hinter dem Tommy Matucci sie zum ersten Mal geküsst hatte und mit der Hand über ihre Brüste gefahren war. Und da war der Brunnen, hinter dessen Umrandung sie sich als Kind versteckt und geglaubt hatte, niemand könnte sie sehen.
Und die Farngrotte war auch noch da, ganz hinten und geschützt von zwei gigantischen Zedern. In ihrem Schutz hatten sie und Conlan eines Sommers mit ihren kleinen Nichten und Neffen eine Nacht geschlafen. Tagsüber waren die hohen Farnstauden ihre Burg gewesen, die sie gegen eindringende Piraten verteidigten. Vor dem Schlafengehen machten sie ein kleines Feuer, rösteten Marshmallows. Die Jungen erzählten Gruselgeschichten und lachten sich schief, wenn die Mädchen vor Entsetzen kreischten.
Damals hatte sie sich ausgemalt, wie sie all das auch mit ihren Kindern tun würden.
Angie rüttelte sich wach, war wieder in der Gegenwart und trug ihr Gepäck ins Haus. Auch dort hatte sich nichts geändert. Zur Linken war die Küche mit den buttergelben Schränken, die längst nicht mehr modern waren, und dem Tresen, dessen Platte ihr Vater gekachelt hatte. In der Ecke stand der kleine Esstisch, um den sie sich zu fünft gequetscht hatten. Der Wohnraum nahm den Rest des Erdgeschosses ein, mit einem großen Kamin aus Naturstein, zwei blauen Sofas, einem Couchtisch und dem ledernen Ohrensessel ihres Vaters. Einen Fernseher gab es nicht, weder damals noch heute.
Wenn sie und ihre Schwestern sich deswegen früher beklagten, sagte ihr Vater: »Haben wir uns nichts mehr zu sagen? Ist es nicht schöner, sich abends zu unterhalten oder zusammen zu spielen?«
»Hallo Papa«, sagte Angie. »Hier bin ich wieder.«
Die einzige Antwort war der Wind, der an den Fenstern rüttelte.
Es klang, als klapperte in der Küche jemand mit Töpfen am Herd.
Angie versuchte, die Erinnerungen zu verjagen. Sie musste sich zusammennehmen, nicht daran denken, dass die Zeit mit jedem Atemzug voranschritt, oder daran, dass ihre Jugend vorüber war. Nichts davon konnte man festhalten, ebenso wenig wie Träume oder wie eine Ehe, die gescheitert war.
Wie dumm sie gewesen war zu denken, hier in dem alten Strandhaus und direkt am Meer würde es ihr bessergehen. Wie war sie bloß darauf gekommen? Erinnerungen blieben nicht zurück, nur weil man ins Auto stieg und ein Haus, eine Gegend, eine Stadt verließ, sie reisten einfach mit, setzten sich im Kopf ab, im Herzen. Alles hatte sie mitgeschleppt, sämtliche Gedanken, Gefühle, Schmerzen. Sie konnte sie verdrängen, doch dann würden sie irgendwo lauern und sie von hinten überfallen.
Sie nahm ihre Koffer, stieg die Treppe hinauf und betrat das Zimmer, in dem früher ihre Eltern geschlafen hatten. Das Bett war abgezogen, die Bettwäsche lag wahrscheinlich ordentlich zusammengefaltet im Schrank. Auf der Matratze hatte sich Staub gesammelt. Angie öffnete das Fenster. Dann ließ sie sich auf die verstaubte Matratze sinken und rollte sich zusammen.
Ein ums andere Mal ging ihr durch den Kopf, wie falsch es gewesen war hierherzukommen. Vor dem Fliegengitter des Fensters hörte sie Insekten summen, Vogelgezwitscher und im Wind raschelnde Zweige. Sie schloss die Augen. Ihre Gedanken lösten sich auf. Sie dämmerte ein.
***
Am Morgen wurde Angie von den Sonnenstrahlen geweckt, die durch das Fenster fielen. Noch benommen starrte sie an die Zimmerdecke.
Angies Augen brannten und fühlten sich geschwollen an.
Also hatte sie im Schlaf wieder geweint.
Damit würde nun Schluss sein.
Das hatte sie sich zwar schon zigmal vorgenommen, doch langsam war sie die Tränen leid.
Sie stand auf, ging ins Bad und duschte. Danach fühlte sie sich besser. Sie kämmte sich, band sich die Haare zu einem Pferdeschwanz. Dann nahm sie die ausgeblichene Jeans und den roten Pullover aus einem Koffer heraus und zog sich an. Sie ging nach unten. Als sie einen Blick aus dem Fenster warf, entdeckte sie ihre Mutter.
Hinter der kleinen Veranda, die zum Meer hinausging, saß sie auf einem umgestürzten Baumstamm, sprach mit jemandem und gestikulierte dabei heftig.
Angie nahm an, dass ihre Mutter mit Mira oder Livvy redete, oder mit beiden. Wahrscheinlich drehte es sich um sie, Angie, und ob sie als Hilfe im Restaurant tauge. Was Angie sich selbst auch fragte.
Sie könnte sich zu ihnen setzen, sich anhören, wie sie über das Für und Wider debattierten und dabei stetig lauter wurden.
Sie könnte selbst etwas sagen, nur dass niemand auf sie hören würde.
Angie atmete tief durch, zwang sich zu einem Lächeln und öffnete die Tür zur Veranda. Sie trat hinaus und schaute sich um.
Außer ihrer Mutter war niemand zu sehen.
Sie setzte sich zu ihr.
»Wir wussten, dass du zurückkehrst«, sagte ihre Mutter.
»Wer sind ›wir‹?«
»Dein Vater und ich.«
Angie seufzte. Also tat sie es noch immer. Ihr Vater war tot, doch ihre Mutter sprach mit ihm, als lebte er noch. Zwar wusste Angie aus eigener Erfahrung, wie viel Macht die Trauer besaß und wie schwierig es sein konnte, sich mit der Realität abzufinden, aber langsam begann sie sich Sorgen zu machen. Sie nahm die Hand ihrer Mutter, die sich weich und schlaff anfühlte. »Und was sagt er dazu?«
»Wie lieb du bist«, antwortete ihre Mutter. »Deine Schwestern mögen es nicht, wenn ich mit deinem Vater rede. Sie möchten, dass ich meinen Kopf untersuchen lasse.« Sie drückte Angies Hand. »Wenn du wüsstest, wie froh ich bin, dass du nach Hause gekommen bist.«
Angie legte einen Arm um ihre Mutter. Sie trug nur Jeans und einen Pulli, und Angie spürte, wie dünn und zart sie geworden war. »Du hast wieder abgenommen«, sagte sie mit leisem Vorwurf.
»Wundert dich das? Dein Vater und ich haben immer gemeinsam zu Abend gegessen, Tag für Tag, beinah fünfzig Jahre lang. Allein zu essen ist keine Freude für mich.«
»Okay«, sagte Angie, »dann essen wir beide künftig zusammen. Ich bin jetzt auch allein.«
»Bleibst du?«
»Hier bei euch?«
Angies Mutter nickte »Mira ist der Meinung, dass du nur jemanden suchst, der sich um dich kümmert. Dass du dich bloß eine Zeitlang verkriechen willst und dann wieder verschwindest. Doch es kostet Kraft und Ausdauer, ein schlechtgehendes Restaurant in Schwung zu bringen.«
Angie nahm an, dass auch andere in ihrer Familie so dachten. Bei Mira überraschte es sie am wenigsten. Ihre Schwester hatte ihr Leben lang in West End gelebt und immer im Restaurant der Familie gearbeitet. Wie sollte Mira begreifen, dass Angie einmal von einem anderen Leben geträumt hatte? Sie würde kaum Mitleid empfinden, bloß weil ihre Schwester nach einer gescheiterten Ehe zurückgekehrt war. Auch Angies Ehrgeiz hatte sie nie verstanden, den Drang, beruflich erfolgreich zu sein, genauso wenig wie die Verbissenheit, mit der sie versucht hatte, ein Kind zu bekommen. Mira war von Anfang an davon ausgegangen, dass Angie an ihrer Besessenheit zerbrechen würde. Und beinah hätte sie recht behalten. Angie ließ ihre Mutter los. »Und du? Was glaubst du?«
Ihre Mutter begann an ihrer Unterlippe zu nagen, eine nervöse Angewohnheit, die sie schon hatte, als Angie noch ein Kind war. »Vorhin, als ich mit deinem Vater gesprochen habe, hat er gesagt, dass er immer gehofft hat, du würdest das Restaurant eines Tages übernehmen. Und er möchte nicht, dass dir dabei jemand komisch kommt.«
Angie lachte. Das klang tatsächlich nach ihrem Vater. Wie gern sie seine Stimme noch einmal gehört hätte, doch außer dem Rauschen der Brandung, den Wellen, die über den Strand strichen, den Vogelstimmen und dem raschelnden Laub war nichts zu vernehmen. »Ich weiß nicht, ob ich euch wirklich helfen kann, Mama. Im Moment bin ich nicht sehr stabil.«
Ihre Mutter ging darüber hinweg, sie war in Gedanken noch bei Angies Vater. »Wenn wir im Sommer hierherkamen, hat er als Erstes gesagt: ›Wir müssen die Treppe ausbessern.‹ Weißt du das noch?«
»Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich bin zurzeit nicht in Bestform.«
»Und dann wurde gehämmert. Ständig musste er etwas reparieren oder verändern. Nie sah es hier aus wie im Vorjahr.« Angies Mutter lachte.
»Ja, ich weiß. Aber, was ich meinte –«
»Aber als Erstes kam immer die Treppe dran.«
Angie warf ihrer Mutter einen Seitenblick zu. »Willst du mir etwas sagen? Etwa, dass jede Reise mit dem ersten Schritt beginnt?«
»Warum nicht?«, entgegnete ihre Mutter. »Stimmt doch, oder?«
»Und was ist, wenn man nicht weiß, in welche Richtung man den ersten Schritt machen soll?«
Ihre Mutter legte einen Arm um sie. »So etwas ergibt sich von selbst.«
Eine Zeitlang saßen sie da und schauten schweigend aufs Meer hinaus. Dann fragte Angie: »Wer hat dir eigentlich gesagt, dass ich hier bin?«
»Mr Peterson. Er hat dich gestern durch West End fahren sehen.«
»Und die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet.« In West End blieb nichts geheim. Angie erinnerte sich an den Schulball, bei dem Tommy Matucci beim Tanzen seine Hände auf ihren Hintern gelegt hatte. Der Ball war noch nicht zu Ende, da war es schon zu ihrer Mutter durchgedrungen. Wie hatte sie West End als junges Mädchen gehasst, diese enge kleine Welt, in der jeder alles über jeden wusste. Inzwischen sah sie das anders. Die Leute nahmen am Leben der anderen teil, sorgten sich um den anderen. Und das bedeutete Schutz und Geborgenheit.
Sie hörte den Motor eines Wagens und drehte sich um. Es war ein grüner Minivan, der über den Waldweg geholpert kam und an der Seite des Hauses anhielt.
Die Fahrertür öffnete sich. Mira stieg aus, in einem verwaschenen Overall und mit Kassenbüchern unter dem Arm. »Hallo«, rief sie, trat zu ihnen und überreichte Angie die Bücher. »Das sind die Zahlen der letzten Quartale. Das Kassenbuch von diesem Quartal brauchen wir so schnell wie möglich zurück.«
»Und schon weißt du, wo du anfangen sollst«, sagte Angies Mutter.
Drittes Kapitel
Im feinen Nieselregen glänzte der gepflasterte Vorplatz der Fircrest Academy wie blankgeputzt. Zwei von Laurens Klassenkameradinnen kamen aus dem Schulgebäude, nickten Lauren zu und überquerten den Platz in Richtung Sporthalle.
Lauren spürte, wie die Feuchtigkeit in ihre Kleidung drang. Sie lehnte sich an den Fahnenmast und warf den wievielten Blick auf ihre Uhr.
Viertel nach sechs.
Ihre Mutter hatte versprochen, Punkt halb sechs an diesem Fahnenmast zu stehen.
Lauren fragte sich, warum sie daran geglaubt hatte. Wusste sie nicht, dass die Happy Hour in der Stammkneipe ihrer Mutter erst um halb sieben zu Ende war?
Und warum war sie wegen eines Versprechens, das ihre Mutter nicht einhielt, noch immer enttäuscht? Andere hätten sich längst ein dickes Fell zugelegt und würden nur mit den Schultern zucken.
Der Strom der Eltern und Schüler, die zur Sporthalle liefen, hatte abgenommen. Auch der Regen hörte auf. Nach einem allerletzten Blick in die Runde machte Lauren sich ebenfalls auf den Weg zur Sporthalle. Am Parkplatz hörte sie ihren Namen und drehte sich um.
David.
In Jeans, gelbem Pulli und blauen Dockers stieg er aus dem schwarzen Cadillac Escalade seiner Familie. Lauren erkannte Davids Mutter am Steuer. David musste in den Regen gekommen sein, das blonde Haar klebte feucht an seinem Kopf. Was nichts daran änderte, dass er der bestaussehende Junge der ganzen Highschool war. »Warum bist du noch nicht in der Halle?«, rief er und war mit drei großen Sätzen bei ihr.
»Ich habe auf meine Mutter gewartet. Die nicht erschienen ist.«
»So eine Überraschung.«
»Genau«, sagte Lauren und schluckte ihre Tränen hinunter. »Und es ist mir so was von egal.«
David nahm sie in die Arme. Lauren lehnte den Kopf an seine Brust.
»Was ist mit deinem Vater, kommt er?«, fragte sie. Davids Vater war nicht viel besser als ihre Mutter, doch sie hoffte, dass er es wenigstens zur Informationsveranstaltung der Colleges schaffen würde.
»Natürlich nicht«, antwortete David mit einem bitteren Unterton. »Mein Vater muss dafür sorgen, dass der Regenwald weiter abgeholzt wird.«
Lauren drückte ihn an sich und wollte ihm sagen, dass sie ihn liebte, doch dann vernahm sie das Klappern hektischer Schritte und wandte sich um.
Es war Davids Mutter. »Hallo Lauren«, sagte sie kühl.
Lauren löste sich aus Davids Armen. »Guten Tag, Mrs Haynes.«
»Ist deine Mutter nicht da?« Mrs Haynes klemmte sich ihre elegante Handtasche unter den Arm und schaute suchend über die letzten Schüler und Eltern, die an ihnen vorbeiliefen.
Im Geist sah Lauren ihre Mutter in der Tides Tavern auf einem Barhocker sitzen, im Mundwinkel eine geschnorrte Zigarette. »Sie … sie macht Überstunden.«
Mrs Haynes zog die Brauen hoch. »Obwohl es heute um die Wahl deines Colleges geht?«
Dann änderte sich ihr Blick, in dem nun das arme, vernachlässigte Kind zu lesen war. Lauren hasste diesen Blick. Sie kannte ihn seit ihrer Kindheit. Meistens kam er von Frauen, die sie bemuttern wollten, es auch eine Zeitlang taten, bevor sie die Lust verloren und sich wieder auf ihr eigenes Leben konzentrierten. Danach hatte Lauren sich jedes Mal noch einsamer als zuvor gefühlt. »Meine Mutter wollte kommen«, sagte sie. »Sie konnte nicht.«
»Im Gegensatz zu meinem Vater, der gekonnt hätte«, sagte David.
»Warum sagst du das?«, fragte Mrs Haynes seufzend. »Dein Vater wäre sehr gern hier.«
»Logisch.« David legte einen Arm um Lauren. Sie überquerten den Platz zur Sporthalle. Lauren zwang sich, nicht mehr an ihre Mutter zu denken. Dann war sie eben nicht erschienen. An diesem Tag ging es nicht um ihre Mutter, sondern darum, dass sie und David im Herbst nächsten Jahres dasselbe College besuchen konnten und sie selbst ein Stipendium erhielt.
Das musste sie schaffen, koste es, was es wolle. Um sich Mut zu machen, hielt sie sich vor Augen, was sie in ihrem Leben bereits erreicht hatte. Sie war auf der Fircrest Academy, einer der besten und renommiertesten Privatschulen Oregons. Und den Entschluss, auf eine gute Schule zu gehen, hatte sie ganz allein getroffen, schon damals, als sie und ihre Mutter von Los Angeles nach West End zogen. Sie war zehn Jahre alt gewesen, noch ein richtiges Kind. Wie schüchtern sie da noch gewesen war. Und voller Minderwertigkeitskomplexe. Sie schämte sich wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer ärmlichen Kleidung, sogar wegen ihrer billigen, hässlichen Brille. Machte den Mund nicht auf, vor lauter Angst, etwas Falsches zu sagen.
Lauren erinnerte sich an den Tag, als sie ihre Mutter um neue Schuhe gebeten hatte. Ich kann meine Schuhe nicht mehr tragen, Mom, in den Sohlen sind Löcher. Wenn es regnet, werden meine Füße nass.
Und ihre Mutter antwortete: »An nasse Füße müssen sich Leute wie wir gewöhnen.« Leute wie wir. Diese Worte gingen Lauren noch lange durch den Kopf. Bis sie sich vornahm, anders zu werden. Und erkannte, dass sie dazu vor allem Geld brauchte.
Großartige Möglichkeiten zum Geldverdienen gab es für sie nicht, in ihrer heruntergekommenen Wohngegend hatte kaum jemand etwas übrig. Doch Lauren ließ sich nicht beirren. Sie verlangte nicht viel, und es gab alte Leute, die ihre Dienste brauchten. Sie putzte, ging einkaufen, führte Hunde aus, holte Pakete von der Post ab – und legte jeden Dollar zur Seite.
Als Erstes kaufte sie sich neue Schuhe. Dann musste die Brille fort, Lauren ersetzte sie durch Kontaktlinsen. Jetzt sieht jeder, was für schöne braune Augen du hast, sagte der Optiker. Lauren errötete. Sie sah sich genau an, was die anderen in ihrer Klasse trugen, besorgte sich die gleichen T-Shirts und Jeans.
Sie verlor einen Teil ihrer Schüchternheit, begann sich im Unterricht zu melden. Übte sich im Lächeln, achtete darauf, wie man sich richtig ausdrückte. Sie machte ihre Hausarbeiten, lernte für Tests und bekam gute Noten. Auch an freiwilligen Projekten nahm sie teil.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: