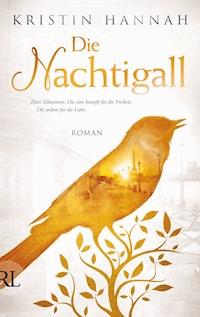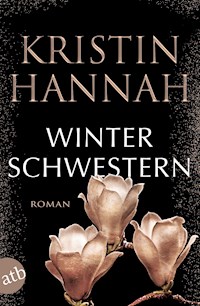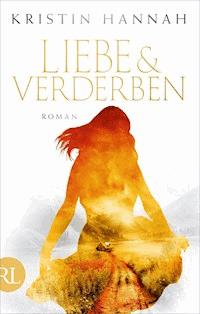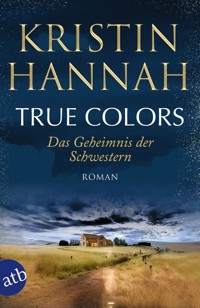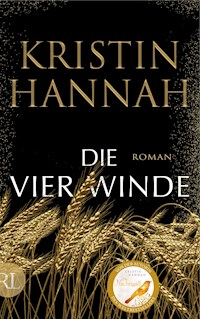
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Von einer meisterhaften Erzählerin der Roman zur Zeit.“ Delia Owens.
Texas, 1934: Seit der Weltwirtschaftskrise sind Hunderttausende arbeitslos, und in den Ebenen der Prärie herrscht Dürre – zu viel wurde gerodet, nach Missernten droht das Land von Sandstürmen davongetragen zu werden. In dieser unsicheren, gefahrvollen Zeit muss Elsa Martinelli eine schwere Entscheidung treffen: Soll sie um das Land kämpfen, das sie liebt und das die Heimat ihrer Familie ist? Oder soll sie mit ihren Kindern wie so viele andere nach Westen ziehen? Irgendwann bleibt Elsa keine Wahl mehr, doch die Flucht nach Kalifornien birgt neue Gefahren in sich. Aber auch die Hoffnung auf ein neues Leben – und eine neue Liebe ...
Ein fulminanter Roman, mit dem Weltbestsellerautorin Kristin Hannah an die Dramatik und die erzählerische Kraft von „Die Nachtigall“ anschließt.
„So elektrisierend wie hoffnungsvoll.“ NEW YORK TIMES.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
»Von einer meisterhaften Erzählerin der Roman zur Zeit.« Delia Owens.
Texas, 1934: Seit der Weltwirtschaftskrise sind Hunderttausende arbeitslos, und in den Ebenen der Prärie herrscht Dürre – zu viel wurde gerodet, nach Missernten droht das Land von Sandstürmen davongetragen zu werden. In dieser unsicheren, gefahrvollen Zeit muss Elsa Martinelli eine schwere Entscheidung treffen: Soll sie um das Land kämpfen, das sie liebt und das die Heimat ihrer Familie ist? Oder soll sie mit ihren Kindern wie so viele andere nach Westen ziehen? Irgendwann bleibt Elsa keine Wahl mehr, doch die Flucht nach Kalifornien birgt neue Gefahren in sich. Aber auch die Hoffnung auf ein neues Leben – und eine neue Liebe.
Ein fulminanter Roman, mit dem Weltbestsellerautorin Kristin Hannah an Dramatik und erzählerische Kraft von »Die Nachtigall« anschließt.
»So elektrisierend wie hoffnungsvoll.« New York Times
Über Kristin Hannah
Kristin Hannah, geboren 1960 in Südkalifornien, arbeitete als Anwältin, bevor sie zu schreiben begann. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Autorinnen der USA und lebt mit ihrem Mann im Pazifischen Nordwesten der USA. Nach zahlreichen Bestsellern waren es ihre Romane »Die Nachtigall« und »Liebe und Verderben«, die Millionen von Lesern in über vierzig Ländern begeisterten und Welterfolge wurden. Im Aufbau Taschenbuch liegen ebenfalls ihre Romane »Die andere Schwester«, »Das Mädchen mit dem Schmetterling«, »Die Dinge, die wir aus Liebe tun« und »Die Mädchen aus der Firefly Lane« vor.
Gabriele Weber-Jarić lebt als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Sie übertrug u. a. Mary Morris, Mary Basson, Kristin Hannah und Imogen Kealey ins Deutsche.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kristin Hannah
Die vier Winde
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Weber-Jarić
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
1921
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
1934
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
1935
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
1936
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog 1940
Anmerkung der Autorin
Dank
Impressum
Dad, dieser Roman ist für Dich.
Prolog
Hoffnung ist eine Währung, die ich stets bei mir trage. In Form eines amerikanischen Pennys, geschenkt von jemandem, den ich zu lieben gelernt habe. Auf meinem Lebensweg hat es Momente gegeben, in denen dieser Penny und die Hoffnung, für die er stand, sich wie das Einzige anfühlten, was mir die Kraft gab weiterzumachen.
Auf der Suche nach einem besseren Leben kam ich in den Westen, doch Armut, Leid und Gier haben meinen amerikanischen Traum zu einem Alptraum werden lassen. Die vergangenen Jahre waren eine Zeit, in der alles verloren ging: Arbeit. Das Zuhause. Genug zu essen zu haben.
Das Land, das wir liebten, wandte sich gegen uns, und es hat uns alle gebrochen. Sogar die starrköpfigen alten Männer, die sonst immer vom Wetter redeten und sich zu der besten Weizenernte der Saison beglückwünschten. Hier draußen muss ein Mann für seinen Lebensunterhalt kämpfen, sagten sie zueinander.
Es waren immer die Männer, um die es ging. Anscheinend dachten sie, zu kochen, zu putzen, Kinder zu gebären und sich um den Gemüsegarten zu kümmern, hätte keinen Wert. Doch auch wir Frauen in den Great Plains arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, schufteten auf Weizenfarmen, bis wir ebenso ausgedörrt und hart waren wie das Land, das wir liebten.
Und an manchen Tagen, wenn ich die Augen schließe, schmecke ich ihn noch immer, den Staub …
1921
Der Erde zu schaden bedeutet, Euren Kindern zu schaden.
Wendell Berry Farmer und Dichter
Kapitel 1
In den Jahren der Einsamkeit, die man ihr auferlegt hatte, las Elsa Wolcott Romane, die von Liebe und Abenteuern handelten. Manchmal hielt sie dabei inne und malte sich ein anderes Leben für sich aus. Allein in ihrem Zimmer, umgeben von den Büchern, die zu ihren Freunden geworden waren, wagte sie bisweilen sogar von einer eigenen Liebe, einem eigenen Abenteuer zu träumen, aber oft kam das nicht vor. Immer wieder hieß es in ihrer Familie, die Krankheit, an der sie als Kind gelitten hatte, habe sie anfällig gemacht und erfordere, dass sie ein zurückgezogenes Leben führe. An guten Tagen glaubte sie daran.
An schlechten Tagen, so wie diesem, wusste sie, dass sie in ihrer Familie von jeher als Außenseiterin gegolten hatte. Schon früh hatten sie gespürt, dass es Elsa an etwas mangelte, dass sie nicht zu ihnen passte.
Elsa kannte den Schmerz, der mit dieser fortwährenden Missbilligung einherging, das Gefühl, etwas Namenloses, Unbekanntes zu entbehren. Sie bewältigte das eine wie das andere, indem sie stillhielt, Aufmerksamkeit weder suchte noch verlangte, sondern akzeptierte, dass sie vielleicht geliebt, wohl aber nicht gemocht wurde. Irgendwann war die Kränkung so alltäglich geworden, dass sie ihr kaum noch auffiel. Sie wusste nur, dass sie nichts mit der Krankheit zu tun hatte, die normalerweise als Grund für die Zurückweisung diente.
An diesem Abend war sie allein im Haus und hatte sich im Salon in ihrem Lieblingssessel niedergelassen. Sie schloss das Buch auf ihrem Schoß und dachte über den Inhalt nach. Zeit der Unschuld, so lautete der Titel des Romans. Die Geschichte hatte etwas in ihr geweckt, hatte ihr schonungslos vor Augen geführt, wie die Zeit verging.
Am nächsten Tag hatte sie Geburtstag.
Dann wurde sie fünfundzwanzig.
Noch jung, würden die meisten sagen. Ein Alter, in dem Männer selbst gebrannten Gin tranken, rücksichtslos Auto fuhren, Ragtime hörten und mit Frauen tanzten, die Stirnbänder und Fransenkleider trugen.
Doch für Frauen bedeutete das etwas anderes.
Wenn eine Frau zwanzig wurde, ließ sie ihre Hoffnung allmählich fahren. Wurde sie zweiundzwanzig, hätte das Getuschel in der Stadt und der Kirche längst angefangen, und lange, mitleidige Blicke würden ihr zuteil. Mit fünfundzwanzig hätte sich ihr Schicksal entschieden. Sie wäre eine unverheiratete Frau, eine alte Jungfer. Man würde sagen, sie sei »sitzengeblieben«, den Kopf schütteln, bedauernd von dem Zug sprechen, der abgefahren war. Dann und wann würden die Leute nach dem Grund suchen, sich fragen, warum aus einer ganz normalen Frau aus einer guten Familie eine alte Jungfer geworden war. In Elsas Fall jedoch war der Grund hinlänglich bekannt. Die Leute mussten sie für taub halten, so wie sie sich in ihrer Gegenwart darüber unterhielten. Die Arme. Dünn wie eine Bohnenstange. Nicht annähernd so hübsch wie ihre Schwestern.
Hübsch sein. Das war das Problem, wie Elsa wusste. Sie war keine attraktive Frau. Sähe ein Fremder sie an einem guten Tag in ihrem schönsten Kleid, würde er sie vielleicht ansehnlich nennen, mehr nicht. Sie war von allem zu viel – zu groß, zu dünn, zu blass, zu unsicher.
Elsa war auf den Hochzeiten ihrer beiden Schwestern gewesen. Keine von ihnen hatte sie gebeten, ihre Brautjungfer zu sein. Elsa hatte es eingesehen. Jemand wie sie, die fast eins achtzig groß war, hätte den jeweiligen Bräutigam überragt und die Hochzeitsfotos ruiniert. Und die Wolcotts legten Wert auf das Bild, das sie nach außen abgaben. Elsas Eltern war es wichtiger als alles andere.
Man musste kein Genie sein, um Elsas weiteren Lebensweg vorherzusehen. Sie würde hierbleiben, im Haus ihrer Eltern in der Rock Road. Maria, die Frau, die ihnen seit ewigen Zeiten den Haushalt führte, würde für sie sorgen. Wenn Maria sich eines Tages zur Ruhe setzte, wäre Elsa da, um sich um ihre Eltern zu kümmern. Wenn ihre Eltern eines Tages tot waren, wäre sie allein.
Und was hätte sie dann vorzuweisen? Welche Spuren hätte sie in der Zeit, die sie auf dieser Erde verbracht hatte, hinterlassen? Wer würde sich an sie erinnern, und aus welchem Grund?
Sie schloss die Augen und gewährte einem lang gehegten Wunschtraum leisen Zutritt zu ihren Gedanken. Stellte sich vor, woanders zu leben. In ihrem eigenen Haus. Sie hörte Kinderlachen. Es waren ihre Kinder.
Sie würde leben, statt nur zu existieren. Davon träumte sie. Von einer Welt, in der ihr Leben und ihre Entscheidungen nicht von dem rheumatischen Fieber bestimmt wurden, das sie als Vierzehnjährige gehabt hatte. Ein Leben, in dem sie Stärken an sich entdeckte, die ihr bislang verborgen geblieben waren, in dem sie nicht aufgrund ihres Äußeren beurteilt wurde.
Die Haustür flog auf, ihre Familie polterte ins Haus. Wie immer bildeten sie eine schwatzende, lachende Gruppe, angeführt von ihrem beleibten Vater, das Gesicht vom Alkohol gerötet. Charlotte und Suzanna, Elsas schöne, jüngere Schwestern, flankierten ihn wie Schwanenflügel. Ihnen folgte ihre elegante Mutter, die sich mit ihren gut aussehenden Schwiegersöhnen unterhielt.
Elsas Vater blieb stehen. »Elsa«, sagte er, »warum bist du noch auf?«
»Ich wollte mit dir reden.«
»Um diese Uhrzeit?«, fragte ihre Mutter. »Und wie erhitzt du aussiehst. Hast du Fieber?«
»Ich habe seit Jahren kein Fieber mehr, Mama. Das weißt du doch.« Elsa stand auf, knetete ihre Finger.
Jetzt, dachte sie. Sie musste es schaffen, durfte nicht wieder den Mut verlieren.
»Papa.« Sie sagte es so leise, dass man es nicht hören konnte, dann versuchte sie es erneut, diesmal lauter. »Papa.«
Er sah sie an.
»Morgen werde ich fünfundzwanzig.«
»Das ist uns bekannt«, antwortete ihre Mutter gereizt.
»Natürlich. Ich wollte nur sagen, dass ich eine Entscheidung getroffen habe.«
Es wurde still.
»Ich … in Chicago gibt es ein College, an dem man Literatur studieren kann. Auch Frauen werden angenommen. Ich möchte mich dort einschreiben und –«
»Elsinore«, fiel ihr Vater ein. »Was willst du mit einem Studium? Du warst zu krank, um die Schule zu beenden. Die Idee ist lächerlich.«
Dazustehen und die eigenen Schwächen in so vielen Augen gespiegelt zu sehen, war nicht einfach. Kämpfe für dich. Sei mutig.
»Ich bin eine erwachsene Frau. Bei meiner letzten Krankheit war ich vierzehn Jahre alt. Außerdem glaube ich, dass die Diagnose des Arztes … voreilig war. Wie auch immer, jetzt geht es mir gut. Wirklich. Ich könnte Lehrerin werden. Oder Schriftstellerin …«
»Schriftstellerin?«, fragte ihr Vater. »Solltest du etwa ein verstecktes Talent haben, von dem wir alle nichts wissen?«
Elsa spürte, wie sie unter seinem Blick immer kleiner wurde.
»Möglicherweise«, antwortete sie kraftlos.
Ihr Vater wandte sich ihrer Mutter zu. »Bitte gib ihr ein Beruhigungsmittel.«
»Ich bin nicht hysterisch.«
Doch Elsa wusste, dass es vorbei war, dass sie diese Schlacht nicht gewinnen konnte. Sie hatte still und unsichtbar zu sein, mehr nicht. »Mir fehlt nichts.«
Sie steuerte die Treppe nach oben an, und niemand in ihrer Familie schenkte ihr noch Beachtung. Es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst.
Hätte sie doch nie Zeit der Unschuld gelesen, dachte Elsa. Was hatte man denn von all der unerfüllten Sehnsucht? Sie würde sich nie verlieben, nie ein eigenes Kind haben.
Auf dem Weg die Treppe hinauf hörte sie Musik aus dem Salon. Jemand ließ auf dem neuen Grammophon eine Schallplatte laufen.
Elsa hielt inne.
Geh wieder hinunter, setz dich zu ihnen.
Sie nahm die letzten Stufen, warf die Tür ihres Zimmers hinter sich ins Schloss und sperrte die Geräusche von unten aus. Sie wäre dort nicht willkommen.
Sie betrachtete sich im Spiegel über dem Waschtisch. Ihr schmales, blasses Gesicht mit dem spitzen Kinn wirkte, als wäre es von lieblosen Händen geformt worden. Ihr langes hellblondes Haar war so dünn, dass es sich stets elektrisch auflud und jegliches Frisieren in Wellen verweigerte. Ihre Mutter hatte ihr verboten, es modisch kurz schneiden zu lassen, und gesagt, kurz sähe es nur noch schlimmer aus. Alles an Elsa wirkte farblos und verwaschen, mit Ausnahme ihrer blauen Augen.
Elsa zündete die Gaslampe auf ihrem Nachttisch an und holte den Roman, der zu ihren größten Schätzen zählte, aus der Nachttischschublade. Fanny Hill.
Sie stieg ins Bett und verlor sich in der anrüchigen Geschichte, wobei sie den erschreckenden, sündhaften Drang, sich zu berühren, verspürte. Beinahe hätte sie ihm nachgegeben. Die Worte lösten eine nahezu unerträgliche Qual in ihr aus, ein schmerzhaftes körperliches Sehnen.
Sie klappte das Buch zu und fühlte sich noch schlechter als zuvor. Rastlos. Unbefriedigt.
Wenn sie nicht bald etwas unternähme, irgendetwas Einschneidendes, würde ihre Zukunft nicht anders als die Gegenwart aussehen. Sie würde ihr Leben lang in diesem Haus festsitzen, Tag und Nacht von einer Krankheit bestimmt, an der sie elf Jahre zuvor gelitten hatte, ebenso wie von einem Aussehen, das sie niemals würde ändern können. Nie würde sie die aufregende Berührung eines Mannes erfahren, nie das Tröstliche eines geteilten Bettes. Sie würde nie ihr eigenes Kind in den Armen halten, nie ein eigenes Heim besitzen.
***
In dieser Nacht wurde Elsa von ihren Sehnsüchten im Traum verfolgt, und am Morgen wusste sie, dass keine Zeit mehr zu verlieren war. Sie musste ihr Leben dringend ändern.
Aber wie?
Es waren doch beileibe nicht alle Frauen schön. Nicht einmal hübsch. Auch andere Menschen hatten als Kind rheumatisches Fieber gehabt und später ein erfülltes Leben geführt. Soweit sie wusste, hatte ihr Arzt damals nur vermutet, dass ihr Herz Schaden genommen habe. Nicht ein einziges Mal hatte es ihr Grund zur Sorge gegeben, nie sein Schlag ausgesetzt. Sie wollte daran glauben, mutig und kräftig genug zu sein, auch wenn sich das bisher noch nicht erwiesen hatte, weil sie nie auf die Probe gestellt worden war. Wie hätte sie es auch wissen sollen? Hatte sie doch nie rennen, spielen und tanzen dürfen. Mit vierzehn hatte man sie von der Schule genommen, so dass sie nie die Gelegenheit gehabt hatte, einen Jungen kennenzulernen. Ihr Leben hatte sich hauptsächlich in ihrem Zimmer abgespielt, wo sie Romane gelesen, geträumt, sich Geschichten ausgedacht und ihre Schulbildung allein vollendet hatte.
Da draußen musste es Dinge für sie zu entdecken geben, die Frage war nur, wo sie zu finden waren.
In der Bücherei. In Büchern fand man auf jede Frage eine Antwort.
Sie machte ihr Bett, wusch sich und zog einen Seitenscheitel in das Haar, das ihr bis zur Taille fiel. Dann flocht sie es und steckte es auf. Sie zog ein schlichtes marineblaues Kleid aus Crêpe an, streifte Seidenstrümpfe über, schlüpfte in schwarze Pumps. Glockenhut, Glacéhandschuhe und Handtasche vervollständigten ihre Ausstattung.
Sie nahm die Treppe nach unten. Glücklicherweise schlief ihre Mutter zu dieser frühen Morgenstunde noch. Sie mochte es nicht, wenn Elsa aus dem Haus ging und »sich anstrengte«, das war ihr nur für den Sonntagsgottesdienst gestattet, bei dem ihre Mutter die Kirchengemeinde bat, für Elsas Gesundheit zu beten.
Nach einer Tasse Kaffee trat Elsa hinaus in den sonnigen Maimorgen.
Vor ihr erstreckte sich Dalhart, eine Stadt im nördlichen Teil von Texas, dem Panhandle, die langsam erwachte. An den erhöhten Holzbürgersteigen wurden die Türen der Läden geöffnet, Schilder, auf denen Geschlossen stand, umgedreht. Jenseits der Stadt, unter dem weiten blauen Himmel, dehnte sich die Ebene der Great Plains ins Endlose, ein Meer fruchtbaren Farmlands.
Dalhart war die Kreisstadt des Dallam County, von dessen florierender Wirtschaft der Ort sehr profitierte. Auch dank der Eisenbahnlinie, die vor nicht allzu langer Zeit von Kansas nach New Mexico verlegt worden war, wurde Dalhart immer größer. Seit Kurzem ragte ein neuer Wasserturm auf den umliegenden Feldern hervor, die der Große Krieg mit seinem nicht abreißenden Verlangen nach Weizen und Mais in eine Goldgrube verwandelt hatte. Weizen gewinnt den Krieg! Die Parole von Präsident Wilson erfüllte die Farmer noch immer mit Stolz. Sie hatten ihren Teil beigetragen.
Inzwischen gab es Traktoren und andere Landmaschinen, die das Leben leichter machten. Die vergangenen Jahre waren gut gewesen, die Preise für Getreide gestiegen, so dass die Farmer noch mehr Land umpflügen, noch mehr Weizen anbauen konnten. Die Dürre von 1908, von der die Alten lange gesprochen hatten, war so gut wie vergessen, schließlich hatte es in den vergangenen Jahren ausreichend geregnet. Und so waren die Leute in Dalhart wohlhabend geworden, was für niemanden mehr galt als für Elsas Vater, der, gegen Bares oder auf Kredit, Landmaschinen und Farmgeräte verkaufte.
An diesem Morgen standen einige Farmer vor dem Diner und diskutierten über die Getreidepreise. Mütter brachten ihre Kinder zur Schule. Noch vor wenigen Jahren hätte man auf der Straße nur Pferdewagen gesehen, nun tuckerten dort auch Automobile, die von einer goldenen Zukunft kündeten, hupten und grauen Qualm hinterließen. Dalhart war eine Stadt der Wohltätigkeitsveranstaltungen, des Square Dance, der Sonntagsgottesdienste und der harten Farmarbeit, die den Menschen ein gutes Leben bescherte.
Elsa betrat den Fußweg, der an der Main Street entlangführte. Die Holzbohlen gaben unter jedem Schritt nach, so dass sie wippenden Schrittes ging. An den Dachtraufen der Läden hingen üppig blühende Blumenampeln und verliehen der eintönigen Straße bunte Farbtupfer, um die sich der Verein zur Verschönerung der Stadt kümmerte. Elsa passierte die Spar- und Kreditvereinigung und den neuen Ford-Händler. Noch immer fiel es ihr schwer zu glauben, dass man einfach so in ein Geschäft gehen, sich ein Automobil kaufen und mit ihm nach Hause fahren konnte.
Die Tür des Gemischtwarenladens öffnete sich, und Mr. Hurst, der Besitzer, erschien mit einem Besen in der Hand. Die Ärmel seines Hemds waren hochgerollt, man sah die fleischigen Unterarme. Sein Gesicht mit der dicken Nase war gerötet. Hurst zählte zu den reichsten Männern der Stadt, ihm gehörten dieser Laden, der Diner, die Eisdiele und die Apotheke. Er war einer der alteingesessenen Bewohner Dalharts, nur Elsas Familie war vor ihm hier ansässig gewesen. Sowohl die Wolcotts als auch die Hursts lebten seit drei Generationen in Texas und waren stolz darauf. Elsas geliebter Großvater war bis zu seinem Tod Texas Ranger gewesen.
»Guten Morgen, Miss Wolcott.« Hurst strich sich sein schütteres Haar aus dem Gesicht. »Scheint wieder ein schöner Tag zu werden. Sind Sie auf dem Weg in die Bücherei?«
»Wohin sonst?«, antwortete Elsa.
»Ich habe einen roten Seidenstoff reinbekommen, aus dem man ein hübsches Kleid nähen könnte. Sagen Sie es Ihren Schwestern.«
Elsa verharrte.
Rote Seide.
Sie hatte noch nie rote Seide getragen. »Zeigen Sie ihn mir. Bitte.«
»Was? Oh natürlich, vielleicht sollten Sie Ihre Schwestern damit überraschen.«
Hurst winkte sie in den Laden. Wie immer war Elsa von der Vielfalt der Waren fasziniert – Kisten voller Erbsen, andere voller Erdbeeren, aufgetürmte Lavendelseife, jedes Stück von Seidenpapier umhüllt, Mehl- und Zuckertüten, Gläser mit eingelegtem Gemüse.
Vorbei an aufgestapeltem Porzellan, glänzendem Besteck, bunten, zusammengefalteten Tischtüchern und Schürzen führte Hurst sie bis zu den Stoffen, aus denen er eine rubinrote Stoffbahn hervorzog.
Elsa legte ihre Handschuhe ab und strich über den Stoff. Noch nie hatte sie etwas so Leichtes, Edles berührt. Sie dachte daran, dass sie an diesem Tag Geburtstag hatte …
»Er würde zu Charlottes Teint –«
Elsa ließ Hurst nicht ausreden. »Ich nehme ihn.«
Hurst wirkte verwundert. Vielleicht hatte sie das Wort »Ich« zu stark betont. Doch er schlug die Seide in braunes Papier ein, wickelte einen Bindfaden darum und reichte ihr das Päckchen.
Auf dem Weg hinaus fiel Elsas Blick auf ein glitzerndes, mit Perlen bestücktes Stirnband, an dem sie nicht vorbeigehen konnte, denn sie war sicher, so eines hätte auch die Gräfin Olenska aus Zeit der Unschuld getragen.
***
Auf dem Rückweg aus der Bücherei presste Elsa das Päckchen mit dem Seidenstoff fest an ihre Brust.
Zu Hause angekommen, öffnete sie das verschnörkelte Gartentor aus Schmiedeeisen und betrat die Welt ihrer Mutter – den tadellos gepflegten Garten, wo es nach Jasmin und Rosen duftete. Am Ende des von Hecken gesäumten Weges lag das große Haus der Wolcotts, das ihr Großvater nach dem Bürgerkrieg für die Frau hatte errichten lassen, die er liebte.
Er war ein temperamentvoller Mann gewesen, trinkfest und streitlustig, doch wenn er jemanden liebte, war diese Liebe bedingungslos. Als Witwer hatte er jahrelang um seine Frau getrauert. Ansonsten war er der einzige Wolcott gewesen, der Elsas Liebe zu Büchern teilte. Und wenn Elsa mit jemandem aus ihrer Familie gestritten hatte, hielt er zu ihr. Du darfst keine Angst haben, Elsa, nicht einmal vor dem Tod. Viel schlimmer ist es, das Leben nicht zu leben. Sei mutig.
So etwas hatte seit seinem Tod niemand mehr zu Elsa gesagt, und es verging kein Tag, an dem sie sich nicht nach ihm sehnte. Seine Geschichten über die frühen Jahre der Gesetzlosigkeit in Texas und den Great Plains waren großartig gewesen.
Er hätte ihr zweifellos geraten, die rote Seide zu kaufen.
Elsas Mutter war mit den Rosen beschäftigt. Sie blickte auf, als sie Schritte hörte, und schob ihre breitkrempige Haube zurück. »Elsa, wo warst du?«
»In der Bücherei.«
»Du hättest deinen Vater bitten sollen, dich zu fahren. Der Weg ist zu beschwerlich für dich.«
»Mir geht es gut, Mama.«
Manchmal kam es Elsa vor, als wolle ihre Familie, dass sie krank war.
Sie umklammerte ihr Päckchen.
»Bitte ruh dich aus, die Hitze ist nichts für dich. Sag Maria, sie soll dir ein Glas kalte Limonade machen.« Elsas Mutter widmete sich wieder den Rosen, schnitt einige ab und legte sie in einen Spankorb.
Elsa betrat das abgedunkelte Haus. Sobald es draußen heiß wurde, wurden alle Vorhänge zugezogen, was in diesem Teil des Landes bedeutete, dass die Räume monatelang im Dämmer versanken. Sie hörte Maria in der Küche auf Spanisch singen.
In ihrem Zimmer streifte Elsa das braune Einschlagpapier ab und genoss den Anblick der leuchtend roten Seide. Sie strich darüber und spürte wieder, wie fein der Stoff war. Als Kind hatte sie einmal ein Seidenband gehabt. Sie hatte es in der Hand gehalten, wenn sie am Daumen genuckelt hatte.
Ihr kam ein Gedanke. Aber würde sie es wirklich wagen, etwas ganz Verrücktes zu tun und an ihrem Aussehen etwas zu verändern?
Sei mutig.
Sie holte eine Schere aus ihrer Kommode, stellte sich vor den Spiegel – und dann begann sie, ihr Haar auf Kinnlänge abzuschneiden. Es war Wahnsinn, doch sie hielt durch, bis sich rings um ihre Füße lange blonde Strähnen häuften.
Als es an der Tür klopfte, fuhr sie zusammen und ließ die Schere fallen.
Die Tür öffnete sich, ihre Mutter kam herein, sah Elsas verunstaltete Haare und erstarrte. »Warum hast du das getan?«
»Ich wollte –«
»Du verlässt das Haus erst wieder, wenn sie nachgewachsen sind. Was sollen die Leute denken, wenn sie dich sehen?«
»Das ist ein Bob. So etwas tragen Frauen in meinem Alter.«
»Anständige Frauen nicht. Binde dir irgendetwas um. Ein Kopftuch.«
»Ich wollte nur hübsch aussehen, Mama.«
Ihre Mutter sah sie so mitleidig an, dass Elsa es kaum ertrug.
Kapitel 2
In den Tagen darauf blieb Elsa in ihrem Zimmer und erklärte, sie fühle sich nicht wohl. Die Wahrheit war, dass sie ihrem Vater nicht gegenübertreten wollte. Wie hätte sie ihm das Verlangen offenbaren können, das sich hinter ihrem abgeschnittenen Haar verbarg? Erst suchte sie Zuflucht bei ihren Romanfiguren, die ihr stets den Raum gegeben hatten, sich, zumindest in ihrer Phantasie, gleichermaßen stark, mutig und schön zu fühlen.
Doch diesmal war es, als flüsterte die rote Seide ihr unablässig ins Ohr, bis sie ihr Buch schließlich zur Seite legte und aus Zeitungspapier ein Schnittmuster für ein Kleid erstellte. Danach kam es ihr dumm vor, nicht auch den nächsten Schritt zu wagen, deshalb schnitt sie auch den Stoff zu und fing an zu nähen, nur um eine Beschäftigung zu haben.
Und während sie das tat, breitete sich in ihr ein Gefühl aus, das einfach nur beglückend war – Hoffnung.
Dann, am frühen Samstagabend, war das Kleid fertig. Es entsprach der neuesten Mode, wie man sie in den großen Städten trug, mit V-Ausschnitt, tief sitzender Taille und Taschentuchsaum. Ein gewagtes Kleid. So etwas trugen Frauen, die die Nächte durchtanzten und keine Sorgen kannten. »Flapper« wurden sie genannt. Junge Frauen, die ihre Freiheit zur Schau stellten, die Schnaps tranken, rauchten und in Kleidern tanzten, deren Säume die Beine bis zu den Knien freigaben.
Elsa beschloss, das Kleid wenigstens anzuprobieren, selbst wenn sie es niemals außerhalb ihres Zimmers tragen würde.
Sie nahm ein Bad, rasierte ihre Beine und zog Seidenstrümpfe an. Die feuchten Haarsträhnen wickelte sie jeweils um einen Finger, befestigte sie mit einer Haarklammer und betete, dass daraus so etwas wie Wellen wurden. Während das Haar trocknete, schlüpfte sie in das Zimmer ihrer Mutter und holte sich einige ihrer Schminkutensilien. Von unten drang Musik herauf, offenbar hatte jemand eine Schallplatte aufgelegt.
Wieder in ihrem Zimmer, bürstete sie ihr Haar aus, das sich tatsächlich leicht gewellt hatte, und setzte das glänzende Stirnband auf. Dann streifte sie das rote Kleid über, das sich wie eine zarte Liebkosung um ihren Körper legte. Sie begutachtete sich im Spiegel und staunte, wie schön der asymmetrisch fallende Saum ihre langen Beine zur Geltung brachte.
Sie führte ihr Gesicht dicht an den Spiegel heran, umrandete ihre Augen mit einem Kajalstift und puderte ihre vorspringenden Wangenknochen blassrosa. Dann trug sie roten Lippenstift auf, der ihre Lippen voller wirken ließ, genau wie es die Modemagazine versprachen.
Als sie sich danach im Spiegel betrachtete, dachte sie: Sieh einer an, beinahe könnte man mich hübsch nennen.
»Du kannst das«, sagte sie laut. Sei mutig.
Auf dem Weg nach unten fühlte sie ein neues Selbstvertrauen. Seit sie denken konnte, hatte es geheißen, sie sei unansehnlich. Doch das war sie gar nicht.
Ihre Eltern saßen im Salon. Bei ihrem Anblick stieß ihre Mutter Elsas Vater an.
Er ließ das Farm Journal sinken, drehte sich zu Elsa um und runzelte die Stirn. »Was hast du da an?«
»Das – das habe ich mir genäht.« Nervös krallte Elsa die Hände ineinander.
»Das ist ein Kleid für eine Hure. Und was ist mit deinen Haaren? Geh sofort in dein Zimmer und mach dir nicht noch mehr Schande.«
Hilfe suchend wandte Elsa sich ihrer Mutter zu. »Das ist die neueste Mode und –«
»Nicht für gottesfürchtige Frauen«, fiel ihre Mutter ein. »Man sieht deine Knie, Elsinore. Wir sind hier nicht in New York.«
»Verschwinde«, sagte Elsas Vater. »Sofort.«
Um ein Haar hätte Elsa gehorcht. Dann dachte sie an ihren Großvater. Er hätte nicht gewollt, dass sie nachgab.
Sie straffte ihre Schultern. »Ich werde heute Abend ausgehen. In die Speakeasy-Bar, wo Musik gespielt wird.«
»Das wirst du nicht.« Ihr Vater stand auf. »Ich verbiete es dir.«
Bevor der Mut sie verlassen konnte, stürzte Elsa aus dem Salon, lief über den Flur und riss die Haustür auf. Sie rannte über den Gartenweg und ignorierte die Stimme ihres Vaters, der ihr nachrief, sie solle sofort zurückkommen. Sie rannte, bis sie stehen bleiben musste, um Luft zu holen.
Das Speakeasy lag versteckt zwischen einer Bäckerei und der alten Pferdestation, die nun, im Zeitalter des Automobils, geschlossen war, Türen und Fenster mit Brettern vernagelt. Seit Beginn der Prohibition hatte Elsa sowohl Männer als auch Frauen durch die Tür der geheimen Bar verschwinden sehen. Und anders, als ihre Mutter meinte, waren viele der jungen Frauen wie sie gekleidet gewesen.
Elsa nahm die Stufen hinunter zu der Eingangstür und klopfte. Die Tür öffnete sich einen Spalt, in ihm erschien ein Augenpaar. Es gehörte einem Mann. Die Augen wurden schmal, als würden sie Elsa taxieren. Klaviermusik und Zigarrenrauch drangen aus dem Spalt. »Kennwort?«
»Was für ein Kennwort?«
Der Mann lachte. »Haben Sie sich verlaufen, Miss Wolcott?«
Elsa erkannte die Stimme. »Nein, Frank, ich würde einfach gern Musik hören«, antwortete sie und war stolz, weil sie so ruhig blieb.
»Ihr alter Herr würde mir das Fell über die Ohren ziehen, wenn ich Sie einlasse«, sagte Frank. »Gehen Sie nach Hause. Eine junge Frau wie Sie hat es nicht nötig, in so einem Kleid durch die Straßen zu laufen. Bringt nur Scherereien.«
Der Spalt schloss sich. Die Musik war nur noch gedämpft zu hören, und in der Luft blieb ein Hauch Zigarrenrauch zurück. »Ain’t We Got Fun« war der Song, der drinnen gespielt wurde.
Verwirrt wandte Elsa sich ab. Warum ließ man sie nicht ein? Zwar war es verboten, Alkohol zu trinken, doch in der Stadt gab es etliche Bars wie diese. Sie wurden gut besucht, und die Polizei drückte ein Auge zu.
Sie lief die Straße hinunter, ohne zu wissen, wohin.
Kurz vor dem Gerichtsgebäude kam ihr ein Mann entgegen.
Hochgewachsen und schlank war er, das dichte schwarze Haar hatte er versucht mit Pomade zu bändigen. Seine dunkle Hose saß eng auf den schmalen Hüften. Darüber trug er einen beigefarbenen Pullover. Im Ausschnitt des Pullovers waren ein weißer Hemdkragen und der Knoten einer Krawatte zu sehen. Die Ballonmütze aus Leder saß schief auf seinem Kopf.
Als er näher kam, erkannte Elsa, wie jung er noch war, höchstens achtzehn. Er war von der Sonne gebräunt und hatte braune Augen – Schlafzimmeraugen hätte man sie in einem ihrer Liebesromane genannt.
Er blieb stehen. »Guten Abend«, sagte er und nahm seine Mütze ab.
Elsa schluckte. »Meinen Sie mich?«
Er blickte sich um. »Sonst sehe ich hier niemanden. Raffaello Martinelli ist mein Name. Wohnen Sie hier in Dalhart?«
Ein Italiener, dachte Elsa. Ihr Vater würde ihr niemals erlauben, diesen jungen Mann auch nur anzusehen, geschweige denn mit ihm zu sprechen.
»Ja.«
»Ich nicht. Ich komme aus Lonesome Tree. Das ist die aufregende Metropole oben an der Grenze zu Oklahoma. Wenn Sie beim Vorbeifahren blinzeln, haben Sie sie verpasst. Wie heißen Sie?«
»Elsa Wolcott.«
»Wie die Firma für Landmaschinen? In dem Fall kenne ich Ihren Vater.« Martinelli lächelte. »Und was machen Sie hier so allein, Elsa Wolcott? In Ihrem schönen Kleid?«
Sei kühn, sei wie Fanny Hill. Vielleicht wäre dies ihre einzige Chance, einen unterhaltsamen Abend zu verbringen. Wenn sie wieder zu Hause war, würde ihr Vater sie wahrscheinlich einsperren. »Ich bin … einfach allein, fürchte ich.«
Martinellis Blick weitete sich. Dann schluckte er, Elsa sah seinen Adamsapfel auf und ab hüpfen. Es schien ihr eine Ewigkeit zu vergehen, bis er antwortete.
»Ich bin auch allein.«
Er griff nach ihrer Hand.
Damit hatte Elsa nicht gerechnet. Um ein Haar hätte sie ihre Hand zurückgezogen.
Wann war sie zum letzten Mal berührt worden?
Es ist nur eine Hand auf deiner, Elsa, stell dich nicht an.
Martinelli sah besser aus als jeder andere Mann, dem Elsa bisher in ihrem Leben begegnet war. Sie fragte sich, ob er auch nett war – oder wie die Jungen früher in der Schule, die sie gehänselt, schikaniert und sich über sie lustig gemacht hatten. Blasses Mondlicht fiel auf sein Gesicht. Sie nahm seine hohen Wangenknochen wahr, die breite Stirn, die gerade Nase und die vollen Lippen.
»Komm mit, Els.«
Els. Der Name, den er ihr gab, veränderte etwas in ihr. Er drängte die Elsa, die sie kannte, in den Hintergrund. Und er schuf eine Intimität, die sie aufregend fand.
Der junge Mann führte sie durch eine dunkle Gasse, dann über die Straße. Aus den geöffneten Fenstern einer weiteren Speakeasy-Bar kam die Stimme von Al Jolson, der »Toot, Toot, Tootsie« sang.
Sie passierten den neuen Bahnhof. An einem kleinen Truck am Straßenrand blieb Martinelli stehen. Es war ein Ford TT, die Ladefläche mit einem Holzaufbau versehen.
»Ein schöner Wagen«, sagte Elsa.
»Den verdanken wir der guten Weizenernte, die wir hatten. Fährst du gern durch die Nacht?«
»Sehr gern.« Elsa kletterte auf den Beifahrersitz.
Er startete den Motor und fuhr in Richtung Norden, wobei sie von den Bewegungen des Wagens geschüttelt wurden. Dalhart war nur noch im Rückspiegel zu sehen.
Schon bald war vor ihnen nichts mehr zu erkennen, weder Hügel noch Bäume, Täler oder Flüsse. Nur der von Sternen übersäte Himmel, so weit, als hätte er die Welt verschluckt.
Dann lenkte er den Wagen in einen Weg mit einer Grasnarbe zwischen den ausgefahrenen Spuren, der zu einer aufgegebenen Heimstatt führte. Hier hatten einmal die Stewards gewohnt, erinnerte sich Elsa, deren Scheune weit und breit für ihre Größe bekannt war. Während der letzten Dürre hatten sie ihr Land verlassen, das kleine Wohnhaus war seit Jahren mit Brettern verbarrikadiert.
Vor der nun leeren Scheune hielt Raffaello den Wagen an. In der Stille hörte man nur das Ticken des erkaltenden Motors und ihren Atem.
Schließlich schaltete er die Scheinwerfer aus und verließ den Wagen. Dann öffnete er Elsas Tür.
Sie sah zu, wie er ihre Hand nahm, um ihr vom Sitz herunterzuhelfen.
Er hätte einen Schritt zurücktreten können, um ihr Platz zu machen, doch das tat er nicht. Sie konnte den Whiskey in seinem Atem riechen und das Lavendelwasser, das seine Mutter beim Waschen oder Bügeln seines Hemdes verwendet haben musste.
Er lächelte sie an. Sie erwiderte sein Lächeln, und wieder spürte sie so etwas wie Hoffnung.
Er breitete eine Decke auf der Ladefläche aus, auf der sie sich niederließen.
Seite an Seite lagen sie nun und blickten in den sternenklaren Nachthimmel.
»Wie alt bist du?«, fragte Elsa.
»Achtzehn.« Er schnaubte ein Lachen hervor. »Trotzdem behandelt meine Mutter mich wie ein Kind. Ich musste mich aus dem Haus stehlen. Sie hat Angst, dass die Leute über mich reden. Du hast Glück.«
»Ich und Glück?« Elsa schüttelte den Kopf.
»Na, immerhin darfst du in diesem Kleid abends allein spazieren gehen, ohne Anstandsdame.«
»Davon war mein Vater alles andere als begeistert.«
»Trotzdem hast du es getan. Glaubst du nicht auch, dass es im Leben mehr geben muss als das, was wir hier haben?«
»Doch«, antwortete Elsa.
»Einen Ort, wo Leute in unserem Alter abends ausgehen, trinken und tanzen. Wo Frauen in der Öffentlichkeit rauchen.« Er seufzte. »Doch wir sind hier.«
»Ich habe mir die Haare abgeschnitten. Daraufhin haben meine Eltern sich aufgeführt, als hätte ich jemanden ermordet.«
»Unsere Eltern sind alte Leute, sie verstehen uns nicht. Meine sind aus Sizilien gekommen mit wenig mehr, als sie am Leib hatten. Davon reden sie die ganze Zeit und zeigen mir den Glücks-Penny, dem sie alles verdanken. Wie kann jemand von Glück sprechen, wenn er hier gelandet ist.«
»Du bist ein Mann, Raffaello. Du kannst tun, was du willst, kannst gehen, wohin du willst.«
»Ich werde Raf genannt. Meine Mutter meint, das klingt amerikanischer. Ich sage immer, wenn ihr das Amerikanische so wichtig ist, hätte sie mich George oder Lincoln nennen sollen.« Wieder seufzte er. »Schön, das mal jemandem sagen zu können. Du bist eine gute Zuhörerin.«
»Danke … Raf.«
Er drehte sich zu ihr um. Sie spürte seinen Blick und musste sich zwingen, ruhig weiterzuatmen.
»Elsa. Darf ich dich küssen?«
Sie schaffte es kaum, zu nicken.
Er küsste ihre Wange, die Lippen so weich, dass Elsa unter ihrer Berührung zu vergehen glaubte.
Dann küsste er sich ihren Hals hinunter. Sie wollte ihn berühren, wagte es jedoch nicht.
»Darf ich … noch mehr, Elsa?«
»Du meinst …«
»Darf ich dich lieben?«
Von einem Augenblick wie diesem hatte Elsa geträumt, sie hatte dafür gebetet, ihn sich beim Lesen ihrer Romane immer wieder ausgemalt. Und nun war er Wirklichkeit. Ein Mann fragte, ob er sie lieben dürfe.
»Ja«, flüsterte sie.
»Bist du sicher?«
Sie nickte.
Hastig öffnete er den Gürtel seiner Hose und streifte sie ab.
Er schob ihr das rote Seidenkleid hoch, es glitt ihren Körper hinauf, sanft kitzelnd, erregend, dann zog er ihr Unterhose und Strümpfe aus. Elsa sah ihre bloßen Beine im Licht des Mondes schimmern und spürte die kühle Nachtluft auf ihrer Haut. Ein Zittern überlief ihren Körper. Sie hielt die Beine geschlossen, bis er sie teilte. Dann lag er auf ihr.
O Gott.
Sie schloss die Augen, und er drang in sie ein. Es tat so weh, dass sie aufschrie.
Um nicht noch einmal zu schreien, presste sie eine Hand auf ihren Mund.
Er bewegte sich in ihr, stöhnte und erschauerte. Dann wurde sein Körper schlaff, und sie spürte seinen heißen Atem an ihrem Hals.
Er wälzte sich von ihr herunter. »Mein lieber Mann«, sagte er.
Er klang, als würde er lächeln, was Elsa nicht verstand. Lächelte er über sie? Vielleicht hätte sie etwas anders machen müssen. Dann fragte sie sich, ob das alles gewesen war.
»Du bist etwas ganz Besonderes«, sagte er.
»War es … gut?«, wagte sie sich vor.
»Es war großartig.«
Sie wollte sich zu ihm umdrehen und ihn küssen, statt in die Sterne zu schauen, die sie schon zahllose Male gesehen hatte. Ihn wollte sie sehen, den Mann, der sie begehrt, sie zur Frau gemacht und etwas Wirklichkeit hatte werden lassen, von dem sie bisher nur hatte träumen können. Sie wünschte, er würde sie in die Arme nehmen und so mit ihr einschlafen.
»Ich fahre dich besser nach Hause«, sagte er. »Wenn ich im Morgengrauen nicht auf unserem Traktor sitze, ist was los. Wir wollen ein großes Stück Land umpflügen, noch mehr Weizen anbauen.«
»Ja«, sagte sie. »Natürlich.«
***
Elsa schloss die Wagentür und sah Raf durch das offene Fenster an. Er lächelte sie an, hob grüßend die Hand und fuhr davon.
Warum verabschiedete er sich so, fragte sie sich. Warum hatte er nicht gesagt, er wolle sie wiedersehen?
Natürlich hatte er das nicht gesagt. So schön, wie er war.
Zudem wohnte er in Lonesome Tree, dreißig Meilen entfernt. Und falls sie sich in Dalhart noch einmal über den Weg liefen, würde sie vielleicht besser tun, als wäre nichts gewesen.
Er kam aus einer Familie sizilianischer Einwanderer. War katholisch und viel jünger als sie. Nichts davon wäre akzeptabel für ihre Familie.
Sie öffnete das Gartentor. Der Duft des blühenden Nachtjasmins stieg ihr in die Nase, und sie wusste, dass sie bei diesem Geruch künftig immer an ihn denken würde.
Im Haus war alles dunkel. Doch die Tür zum Salon stand offen, und durch die Fenster fiel Mondlicht herein. Eine Holzbohle knarrte, dann entdeckte sie ihren Vater.
Er kam auf sie zu und zischte: »Was glaubst du, wer du bist?«
Elsas Stirnband verrutschte, sie rückte es wieder zurecht. »Deine Tochter.«
»Ein Mitglied unserer Familie? Mein Vater hat alles darangesetzt, dass Texas Teil der Vereinigten Staaten wurde. Er war Ranger, hat im Bürgerkrieg gekämpft, bei der Schlacht von Laredo hätte er beinahe sein Leben gelassen. Wir zählen zu den alteingesessenen Familien, die auf dem Boden dieses Staates ihr Blut vergossen haben.«
»Das weiß ich, aber –«
Seine Hand flog auf sie zu, so schnell, dass Elsa ihr nicht mehr ausweichen konnte. Der Schlag traf ihren Kiefer mit solcher Wucht, dass sie ins Taumeln geriet und zu Boden stürzte.
Sie richtete sich auf und presste sich in die Ecke des Flurs, um ihm auszuweichen. »Papa –«
»Geh mir aus den Augen, du bist eine Schande für uns.«
Elsa ging die Treppe hinauf in ihr Zimmer.
Mit zitternden Händen zündete sie die Nachttischlampe an, kleidete sich aus und betrachtete sich im Spiegel.
Über ihrer Brust war ein roter Fleck, vielleicht hatte Raf ihn dort hinterlassen. An ihrem Kiefer deutete sich ein Bluterguss an. Ihr Haar war noch von dem Liebesakt zerwühlt, falls man das, was geschehen war, so nennen konnte.
Trotzdem würde sie es wieder tun, wenn sie könnte. Sollte ihr Vater sie doch schlagen, beschimpfen oder sogar enterben, wenn er wollte.
Sie hatte etwas Neues über sich gelernt, nämlich dass sie alles tun und ertragen würde, um geliebt zu werden, und sei es nur für eine Nacht.
***
Am Morgen wurde Elsa von dem Sonnenlicht geweckt, das durch das geöffnete Fenster in ihr Zimmer strömte. Ihr Blick fiel auf das rote Kleid, das sie in der Nacht über die Tür ihres Kleiderschranks gehängt hatte. Sie spürte ihren schmerzenden Kiefer und das Brennen in ihrem Unterleib, das von Rafs Umarmung geblieben war. Während sie den einen Schmerz nichts als vergessen wollte, würde sie sich die Erinnerung an den anderen noch für lange Zeit bewahren.
Gedankenverloren strich sie über ihre Bettdecke – einen Quilt, den sie an vielen einsamen Winterabenden gefertigt hatte. Ihr Blick wanderte zum Fuß des Betts. Dort stand ihre Aussteuertruhe, liebevoll gefüllt mit bestickter Bettwäsche, einem dünnen weißen Baumwollnachthemd und dem Hochzeitsquilt, mit dem sie als Zwölfjährige begonnen hatte, bevor man ihr klargemacht hatte, dass ihre Reizlosigkeit nicht nur eine Phase, sondern von Dauer sein würde. Irgendwann hatte ihre Mutter aufgehört, von dem Tag zu sprechen, an dem Elsa heiraten würde, auch den Besatz aus Alençon-Spitze hatte sie nicht länger für ein Brautkleid mit Perlen verziert. Der halb fertige Spitzenbesatz lag nun ebenfalls in der Truhe.
Als es an der Tür klopfte, setzte Elsa sich auf.
Ihre Mutter trat ein, bewegte sich in ihren Samtslippern lautlos über den Flickenteppich, der den Holzboden bedeckte. Sie war eine hochgewachsene, breitschultrige Frau, eine vernunftbetonte Person, die ein tadelloses Leben führte, Kirchenkomitees vorstand, den Verein zur Stadtverschönerung leitete und stets mit leiser Stimme sprach, selbst wenn sie zornig war. Ihr schwarz gefärbtes Haar trug sie in einem Nackenknoten, was die Strenge ihrer scharf gemeißelten Züge unterstrich.
Wie Elsas Mutter behauptete, konnte sie nichts und niemand aus der Fassung bringen. Ein Familienmerkmal, seit die ersten ihrer Vorfahren hierhergekommen seien, zu einer Zeit, als man eine Woche lang durch Texas reiten konnte, ohne ein weißes Gesicht zu sehen.
Sie ließ sich auf der Bettkante nieder und berührte den Bluterguss an Elsas Kiefer. »Mein Vater hätte mir Schlimmeres angetan.«
»Aber –«
»Kein Aber, Elsinore.« Ihre Mutter zog die Brauen zusammen. »Wahrscheinlich wird man mir heute in der Stadt den Tratsch über dich zutragen. Gerede. Über eine meiner Töchter.« Sie stieß einen schweren Seufzer aus. »Hast du etwas Unverzeihliches getan?«
»Nein, Mama.«
»Du bist also noch das anständige Mädchen, das du vorher warst?«
Elsa schaffte es nicht, die Lüge auszusprechen, und nickte nur.
Ihre Mutter legte einen Finger unter Elsas Kinn und studierte kritisch ihr Gesicht. »Ein schönes Kleid macht noch lange kein schönes Mädchen.«
»Ich wollte doch nur –«
»Lass uns nicht mehr davon reden. Dann wird es auch nicht wieder geschehen.«
Elsas Mutter stand auf und strich ihren lavendelblauen Rock glatt, auf dem nicht die kleinste Knitterfalte gewagt hätte zu entstehen.
Elsa spürte die Distanz zwischen ihnen, die da gewesen war, seit sie denken konnte, und die niemals zu überwinden war.
»Trotz unseres Geldes und unserer Reputation wird dich niemand heiraten, Elsinore. Kein Mann, der etwas auf sich hält, wünscht sich eine Frau, die unattraktiv und größer als er ist. Und sollte doch einmal einer bereit sein, über diese Makel hinwegzusehen, wird er gewiss keinen beschädigten Ruf hinnehmen. Gib dich mit deinem Leben zufrieden und wirf deine albernen Liebesromane weg.«
Auf dem Weg aus dem Zimmer nahm Elsas Mutter das rote Seidenkleid mit.
Kapitel 3
Seit dem Sieg der Amerikaner im Großen Krieg waren die Bewohner von Dalhart leidenschaftliche Patrioten geworden. Diese Vaterlandsliebe, gepaart mit vielen Sonnentagen, dem zuverlässig fallenden Regen und den steigenden Weizenpreisen, war ein guter Grund, den Unabhängigkeitstag am 4. Juli ausgiebig zu feiern. In den Schaufenstern der Geschäfte wurde auf die Sonderangebote anlässlich des Feiertags hingewiesen, und die Leute gaben sich die Türklinke in die Hand, um sich mit Essen und Trinken zu versorgen.
Bisher hatte Elsa sich immer auf die Feierlichkeiten gefreut, in diesem Jahr jedoch nicht. Seit der Nacht mit Raf fühlte sie sich wie gefangen und noch ruheloser als zuvor.
Keiner in ihrer Familie nahm wahr, wie unglücklich sie war. Und Elsa schluckte ihren Kummer hinunter, statt etwas zu sagen. Sie machte einfach weiter wie bisher, anders hatte sie es nicht gelernt.
Wie auch zuvor hielt sie sich meistens in ihrem Zimmer auf, sogar dann noch, als der glühend heiße Sommer begann und sie im Schatten des Gartens Abkühlung gefunden hätte. Ihre Lektüre ließ sie sich nun aus der Bücherei kommen, Bücher, die ihre Mutter als »angemessen« bezeichnet hätte. Sie bestickte Kopfkissenbezüge und Geschirrtücher. Beim Abendessen lauschte sie der Unterhaltung ihrer Eltern und nickte an den Stellen, an denen man es von ihr erwartete. In der Kirche trug sie ihren Glockenhut tief über den skandalösen Haarschnitt gezogen. Wenn jemand sie ansprach, erklärte sie, sie fühle sich nicht wohl, woraufhin man sie in Frieden ließ.
Manchmal, wenn sie ein Buch sinken ließ und aus dem Fenster blickte, war ihr, als würde sich die Leere ihrer Zukunft bis über den weiten Horizont hinaus erstrecken.
Gib dich damit zufrieden.
Von dem Bluterguss auf ihrem Kinn war längst nichts mehr zu sehen. Mit Ausnahme der wenig tröstlichen Worte ihrer Mutter hatte niemand bei ihr zu Hause – nicht einmal ihre Schwestern – darüber ein Wort verloren.
Sie kam sich vor wie Tennysons Dame von Shalott, die ein Fluch zwang, inmitten eines Flusses in einem Turm zu leben, ohne Zugang zu anderen Menschen.
Falls es in ihrer Familie jemandem auffiel, dass sie noch stiller war als sonst, sich noch mehr zurückzog, fragte derjenige sie nicht nach dem Grund. Schon seit Langem war Elsa wie eines der Tiere, die zu ihrem Schutz die Farben ihrer Umgebung annahmen und unsichtbar wurden. Die sich nicht anders zu wehren wussten. Wenn sie nicht zu sehen war, dann könnte man sie mit der Zeit vielleicht vergessen und ihr nichts mehr anhaben.
Doch nun war Unabhängigkeitstag, und ihr Vater rief sie von unten. »Elsa, beeil dich. Oder sollen wir deinetwegen zu spät kommen?«
Elsa streifte ihre Glacéhandschuhe über, die selbst an diesem heißen Tag getragen werden mussten, und steckte ihren Strohhut fest.
Auf halber Treppe blieb sie stehen. Was, wenn Raf bei den Feierlichkeiten wäre?
Der 4. Juli war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen die ganze Gegend zusammenkam. Die umliegenden Ortschaften feierten zwar auch ihre eigenen Feste, doch zu diesem Anlass reisten die Leute von weit her an.
»Los, Elsa«, sagte ihr Vater. »Deine Mutter hasst es, zu spät zu kommen.«
Elsa folgte ihren Eltern zu dem brandneuen flaschengrünen Ford T Runabout ihres Vaters. Es war ein zweisitziges Cabriolet, sie mussten sich auf dem Ledersitz eng zusammendrängen. Zwar wohnten sie in der Stadt und das Bürgerhaus, wo das Fest stattfand, lag nicht weit von ihrem Haus entfernt, doch sie hatten viel Essen zu transportieren, zudem wäre Elsas Mutter nie im Leben zu Fuß zu einer Veranstaltung gelaufen.
Das Bürgerhaus war mit rot-weiß-blauen Wimpelketten geschmückt. Vor dem Gebäude stand rund ein Dutzend Autos. Sie gehörten den Farmern, die in den vergangenen Jahren Gewinne gemacht, und den Bankern, die ihnen das Geld für ihre Investitionen geliehen hatten. Auch die Frauen des Vereins zur Stadtverschönerung hatten ihr Bestes gegeben: Der Rasen vor dem Bürgerhaus war gepflegt, die Eingangstreppe wurde von üppig blühenden Blumen gerahmt. Kleine Kinder liefen ausgelassen umher. Teenager waren kaum zu sehen, wahrscheinlich drückten sich die meisten von ihnen in irgendwelchen Ecken herum in der Hoffnung auf gestohlene Küsse.
Elsas Vater stellte den Wagen ab.
Aus der geöffneten Eingangstür des Bürgerhauses drangen Musik, lärmende Stimmen und Gelächter. Mehrere Fiedeln spielten, begleitet von einem Banjo und einer Gitarre, »Second Hand Rose«.
Sie stiegen aus. Ihr Vater öffnete den Kofferraum, der all die Leckereien enthielt, die Maria in tagelanger Arbeit zubereitet hatte. Elsas Mutter würde das Lob dafür einheimsen und von Rezepten sprechen, die von den Pionierfrauen ihrer Familie weitergereicht worden waren und die tiefe Verwurzelung der Wolcotts in Texas unter Beweis stellten – Stapelkuchen mit Melasse, Gewürzkuchen, Pfirsichkuchen, Landschinken mit Rote-Augen-Soße und Maisgrütze.
Elsa trug den noch warmen gusseisernen Bräter, in dem der Schinken war.
Die Wände des Festsaals waren mit Quilts dekoriert, auf den Tischen rund um die Tanzfläche lagen bunte Decken. Am Ende des Saals waren an einer Wand lange Tische aufgebaut worden; auf ihnen reihten sich bereits zahlreiche Köstlichkeiten – Schweinebraten, schwere, dunkle Eintopfgerichte, Töpfe voll grüner Bohnen mit Speck, Hühnersalat, Kartoffelsalat, Würste, Brötchen, alle möglichen Brotsorten und Pasteten. Die Leute im County liebten Feste, und die Frauen überboten sich bei solchen Anlässen, um ihre Kochkünste zu beweisen. Auch geräucherte Schinken, hart gekochte Eier, Obsttorten und Hotdogs würde es noch geben.
Elsas Mutter steuerte den Ecktisch an. Dort waren die Frauen des Vereins zur Stadtverschönerung dabei, die Gerichte zu arrangieren. Elsa stellte ihren Bräter ab.
Ihre Schwestern waren auch da. Suzanna trug eine Bluse aus Elsas roter Seide, Charlotte hatte sich daraus eine Stola nähen lassen.
Elsa schnürte es die Kehle zu.
Ihr Vater gesellte sich zu den Männern, die an der Bühne standen und sich lautstark unterhielten.
Für sie gab es, trotz der Prohibition, alkoholische Getränke in Mengen. Viele von ihnen waren raubeinig und hart wirkende Einwanderer aus Russland, Deutschland, Italien und Irland, die mit nichts hierhergekommen waren und daraus etwas gemacht hatten. Sie ließen sich nichts vorschreiben, weder von anderen noch von einer Regierung in Washington, in der man kaum zu wissen schien, dass die Great Plains existierten. Diese Männer waren von ihrer Arbeit gezeichnet, doch etliche hatten Geld auf der Bank, immerhin brachte der Scheffel Weizen einen Dollar dreißig, was ein Reingewinn von neunzig Cent war. Man brauchte nur genügend Land zu haben, um ein reicher Mann zu werden.
»Dalhart ist auf dem Weg nach ganz oben«, sagte Elsas Vater so laut, dass er die Musik übertönte. »Nächstes Jahr baue ich uns ein verdammtes Opernhaus. Warum sollen wir bis nach Amarillo fahren müssen, um uns ein bisschen Kultur zu gönnen?«
»Wir brauchen Elektrizität«, erklärte Mr. Hurst. »Darauf kommt es an.«
Sie blickten zu den Paaren, die sich auf der Tanzfläche drehten.
Elsas Mutter korrigierte die Anordnung der Speisen auf den Tischen, die anderen Frauen hatten es offenbar nicht richtig gemacht. Charlotte und Suzanna unterhielten sich lachend mit ihren gut aussehenden, gut gekleideten Freundinnen, die meisten von ihnen junge Mütter.
Dann entdeckte Elsa ihn – Raf, der mit mehreren italienischen Familien am anderen Ende der Tische stand. Er trug ein einfaches weißes Hemd, eine braune Hose, lederne Hosenträger und eine karierte Fliege, sein dichtes schwarzes Haar fiel ihm in die Stirn. An seinem Arm hing eine hübsche junge Frau mit dunklem Haar.
In den sechs Wochen, die sie ihn nicht gesehen hatte, war sein Gesicht von der Arbeit auf den Feldern tief gebräunt worden.
Schau zu mir, dachte Elsa. Nein, lieber nicht.
Wahrscheinlich würde er tun, als kenne er sie nicht. Oder als hätte er sie nicht gesehen, was noch schrecklicher wäre.
»Herrgott nochmal, Elsa«, sagte ihre Mutter. »Du hast den Bräter mit dem Schinken auf den Tisch mit den Nachtischen gestellt. Wo bist du nur mit deinen Gedanken?«
Elsa griff nach dem Bräter und trug ihn einen Tisch weiter, näher zu Raf, und stellte ihn leise ab.
Raf blickte in ihre Richtung und sah sie. In seiner Miene regte sich nichts, nur sein Blick wurde unruhig und huschte zu der jungen Frau an seiner Seite.
Elsa wandte sich ab und spürte, wie sich ihr Herz verkrampfte. Sie konnte hier nicht bleiben. Das Letzte, was sie wollte, war, sich den ganzen Abend nach ihm zu sehnen, während er tat, als wäre sie Luft.
Sie trat zu ihrer Mutter. »Mama.«
»Siehst du nicht, dass ich mich mit Mrs. Tolliver unterhalte?«
»Entschuldige. Ich wollte nur sagen …« Dreh dich nicht nach ihm um. »Mir geht es nicht gut.«
Ihre Mutter seufzte. »Zu viel Trubel, nehme ich an.« Sie tauschte einen genervten Blick mit Mrs. Tolliver.
»Vielleicht ist es besser, wenn ich nach Hause gehe.«
»Das glaube ich auch.«
Ohne noch einmal zu Raf hinüberzuschauen, steuerte Elsa den Ausgang an und lief an den tanzenden Paaren vorbei.
Sie trat hinaus in den warmen Sommerabend. Die Musik und der Lärm der Festgäste wurden leiser.
Sie passierte die geparkten Automobile und die Pferdefuhrwerke, mit denen die weniger wohlhabenden Farmer gekommen waren.
Die Main Street lag still im Schein der letzten Sonnenstrahlen, bald würde die Abenddämmerung einsetzen. Sie eilte über den Holzsteg.
Hinter ihr ertönten Schritte. »Els!«
Sie blieb stehen, wandte sich langsam um.
»Es tut mir leid«, sagte Raf und wirkte betreten.
»Was tut dir leid?«
»Ich hätte dich da drinnen grüßen sollen. Hätte wenigstens nicken können.«
Er war nun so nahe, dass sie die Wärme seines Körpers spüren konnte.
»Schon gut, Raf. Ich verstehe. Sie ist sehr hübsch.«
»Gia Composto. Wir konnten noch nicht laufen, als unsere Eltern schon beschlossen hatten, dass wir eines Tages heiraten.«
Elsa spürte, wie sein Atem über ihre Wange strich.
»Ich habe von dir geträumt«, sagte er.
»Wirklich?«
Er nickte und schien verlegen.
Ihr war, als näherte sie sich einem Abgrund. Ein falscher Schritt, und sie würde hinabstürzen. Doch wie sollte sie sich zurückhalten? Wie er aussah. Wie seine Stimme klang. Seine Augen waren dunkel wie die Nacht. Ein Hauch Schwermut lag darin. Sie fragte sich, welchen Grund er haben könnte, schwermütig zu sein.
»Komm um Mitternacht zu der alten Steward-Scheune. Dort treffen wir uns.«
***
Später am Abend legte Elsa sich vollständig bekleidet ins Bett.
Sie sollte sich nicht aus dem Haus stehlen, so viel war klar. Der Bluterguss auf ihrem Kinn war zwar verheilt, doch die Erinnerung an den Schlag war noch da. Eine anständige Frau traf sich nachts nicht heimlich mit einem Mann.
Sie hörte ihre Eltern nach Hause kommen und die Treppe hinaufsteigen. Die Tür ihres Schlafzimmers am anderen Ende des Flurs öffnete und schloss sich.
Sie warf einen Blick auf die Uhr auf ihrem Nachttisch. Zwanzig vor zehn.
Es wurde still im Haus, außer ihrem nervösen Atem war nichts mehr zu hören.
Sie wartete.
Sie sollte nicht gehen.
Und doch wusste sie, dass sie es tun würde, ganz gleich, wie oft sie versuchte, sich das Gegenteil einzureden.
Um halb zwölf stieg sie aus dem Bett, trat an das geöffnete Fenster und blickte in die Dunkelheit. Wie oft hatte sie an diesem Fenster gestanden – ihrem Tor zu einem Leben voller Abenteuer –, um sich in die unbekannte Welt zu träumen?
Sie kletterte nach draußen, tastete mit den Füßen nach dem Rosenspalier und hangelte sich daran hinunter.
Leise sprang sie auf den Rasen und wartete angespannt, ob jemand sie gesehen oder gehört hatte. Doch niemand rief nach ihr, und im Haus blieb alles dunkel. Sie schlich sich zu dem Unterstand, wo die alten Fahrräder ihrer Schwestern aufbewahrt wurden, und nahm sich eins. Dann radelte sie zur Main Street und hinaus aus der Stadt.
Nachts war die Welt in diesem Landstrich groß und endlos; erhellt nur von den Sternen hoch am Himmel, erstreckte sich die Dunkelheit meilenweit, ohne dass es ein beleuchtetes Haus gegeben hätte. Doch Elsa kannte den Weg und radelte entschlossen weiter.
An der alten Scheune stieg sie ab und legte ihr Fahrrad in das kniehohe Büffelgras.
Wahrscheinlich würde er gar nicht kommen.
Ganz bestimmt würde er nicht kommen.
Sie dachte daran, was er gesagt hatte, erinnerte sich an jedes seiner Worte, jeden Gesichtsausdruck. Sie wusste, dass sein Lächeln in einem Mundwinkel begann und sich von dort aus langsam ausbreitete. An seinem Kiefer war eine Narbe in Form eines hellen Kommas, ein Schneidezahn stand ein wenig vor.
Ich habe von dir geträumt.
Komm um Mitternacht.
Hatte sie darauf überhaupt geantwortet, oder hatte sie ihn stumm wie ein Fisch angestarrt? Sie erinnerte sich nicht mehr.
Und nun stand sie mitten in der Nacht an einer verlassenen Scheune.
Was für eine Närrin sie war.
Wenn man sie erwischte, wäre der Teufel los.
Sie begann, auf und ab zu laufen, hörte unter ihren Schuhen kleine Steine knirschen. Dann betrachtete sie die Scheune. Der Mond stand tief und hatte die Form eines Hakens. Es sah aus, als wolle er die Spitze des Scheunendachs aufspießen. Im Dach fehlten Schindeln, einige lagen auf der Erde verteilt.
Elsa schlang die Arme um sich.
Wie lange wartete sie hier schon? Lange genug, um sich äußerst unwohl zu fühlen. Sie war kurz davor, aufzugeben, doch in dem Moment hörte sie das Brummen eines Wagenmotors. Kurz darauf tauchte an der Zufahrt Scheinwerferlicht auf.
Elsas Herz begann zu rasen.
Er fuhr viel zu schnell, die Reifen wirbelten Staub und Kieselsteine auf. Dann kam der Wagen schlitternd zum Stehen.
Raf sprang heraus, trat lächelnd auf sie zu und überreichte ihr einen kleinen Strauß Wildblumen.
»Für mich?«
Er nickte, griff in seine Hosentasche und holte eine Flasche heraus. »Und Gin für uns beide.«
Als sie in seine Augen sah, dachte sie, dass sie bereit wäre, für diesen Moment jeden Preis zu zahlen.
Er küsste sie und nahm ihre Hand.
Die Decke lag bereits ausgebreitet auf der Ladefläche. Ein dünner Streifen Mondlicht fiel darauf. Elsa zog sie glatt und legte sich nieder.
Raf folgte ihr.
Sie spürte seinen Körper an ihrer Seite, hörte seinen Atem.
»Hast du an mich gedacht?«, fragte er.
»Ja.«
»Ich auch. Ich meine, ich habe an dich gedacht. An das hier.« Er begann, ihre Bluse aufzuknöpfen.
Eine heiße Welle der Lust stieg in ihr auf. Sie wollte sie vor Raf verbergen, doch es gelang ihr nicht.
Ebenso wie beim ersten Mal streifte er ihr die Unterhose ab und schob ihren Rock hoch. Wie eine sanfte Verlockung strich die warme Nachtluft über sie.
Wie schon zuvor wollte sie ihn berühren, ihn schmecken, ihm sagen, wo sie berührt werden wollte, doch sie wagte es nicht. Wahrscheinlich wäre alles, was sie zu sagen hätte, falsch, und sie wollte nichts mehr, als ihm zu gefallen.
Im nächsten Moment war er in ihr, stieß hart zu und stöhnte. Und dann war es auch schon vorbei, und er sackte auf ihr zusammen.
Er ließ sich von ihr hinuntergleiten und flüsterte ihr etwas ins Ohr, das sie nicht verstand. Sie hoffte, es war etwas Liebevolles gewesen.
Elsa streichelte seine Wange, so vorsichtig, dass sie nicht wusste, ob er es überhaupt spürte.
»Du wirst mir fehlen«, sagte er.
Sie zog ihre Hand zurück. »Gehst du fort?«
Er öffnete die Flasche Gin und nahm einen großen Schluck, bevor er ihr die Flasche reichte. »Meine Eltern wollen, dass ich aufs College gehe.« Er stützte den Kopf auf die Hand.
Elsa kostete einen Schluck, der in ihrem Rachen wie Feuer brannte.
Raf griff nach der Flasche und nahm den nächsten Schluck. »Vor allem meine Mutter wünscht sich das. Sie glaubt, das College macht mich zu einem richtigen Amerikaner.«
»College«, wiederholte Elsa sehnsüchtig.
»Verrückt, oder? Ich brauche kein Studium. Ich will den Times Square sehen, die Brooklyn Bridge, Hollywood. Die ganze Welt will ich sehen und dabei etwas lernen.« Er sah Elsa an. »Wovon träumst du?«
Elsa war es so wenig gewohnt, nach ihren Wünschen und Träumen gefragt zu werden, dass sie im ersten Moment nicht wusste, was sie antworten sollte. »Ich möchte ein Kind«, sagte sie schließlich. »Vielleicht ein eigenes Haus.«
Raf lachte. »Das zählt nicht. Eine Frau, die sich ein Kind wünscht, ist wie ein Samenkorn, das wachsen will. Da muss es noch etwas geben.«
»Wenn ich es dir sage, lachst du mich aus.«
»Ich schwöre, dass ich nicht lachen werde.«
»Was ich sein möchte, ist … mutig«, sagte sie kaum hörbar.
Raf krauste die Stirn. »Wovor hast du denn Angst?«
»Vor allem.« Elsa zuckte mit den Schultern. »Mein Großvater war mutig, er gehörte zu den Texas Rangers. Er hat immer zu mir gesagt, ich müsse mich behaupten und kämpfen. Aber wofür soll ich kämpfen? Ich weiß, das klingt albern …«
Sie spürte seinen Blick und hoffte, dass ihr das Mondlicht wenigstens ein bisschen schmeichelte.
»Du bist anders als die Mädchen, die ich kenne.« Er strich ihr eine Strähne aus dem Gesicht.
»Wann beginnt das College?«
»Im August muss ich los. Wir haben noch ein wenig Zeit. Falls du mich wiedersehen willst.«
Elsa lächelte. »Das will ich.«
Sie würde sich keine Sekunde mit ihm entgehen lassen, koste es, was es wolle. Sogar die Hölle nähme sie dafür in Kauf. Bei ihm fühlte sie sich begehrt, und wenn er sie ansah, kam sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben schön vor.
Kapitel 4
Mitte August hatte die sengende Sommersonne in den Blumenampeln und Blumenkästen von Dalhart alles verdorren lassen. Sowohl die Ladenbesitzer als auch die Frauen des Vereins zur Stadtverschönerung waren von der Hitze zu ermattet, um etwas dagegen zu unternehmen. Vielleicht sagten sie sich auch, die Blumen wären ohnehin bald verblüht. Mr. Hurst hob kraftlos die Hand, als Elsa auf ihrem Weg aus der Bücherei bei ihm vorbeikam.
Als sie ihr Haus erreichte und das Gartentor öffnete, stieg ihr der schwere, süße Duft der Rosen und des Jasmins in die Nase. Hastig drückte sie eine Hand auf ihren Mund, doch es war zu spät. Sie übergab sich in einen Rosenstrauch.
Selbst als nichts mehr kam, würgte sie noch. Irgendwann wischte sie sich mit der Hand über ihren Mund und richtete sich auf. Doch sie fühlte sich noch immer zittrig.
Sie hörte ein Rascheln, dann tauchte ihre Mutter auf, mit Sonnenhut und einer Gartenschürze über ihrem leichten Sommerkleid. In einer Hand hielt sie ihre Gartenschere, in der anderen die Rosen, die sie geschnitten hatte.
»Elsa«, sagte sie scharf. »Musstest du dich nicht schon vor ein paar Tagen übergeben? Seit wann geht das so?«
Elsa zuckte mit den Schultern.
Ihre Mutter legte Rosen und Gartenschere ab und zog ihre Gartenhandschuhe aus, einen Finger nach dem anderen.
Sie legte ihre Hand auf Elsas Stirn. »Fieber scheinst du nicht zu haben.«
»Vielleicht habe ich mir den Magen verdorben.«