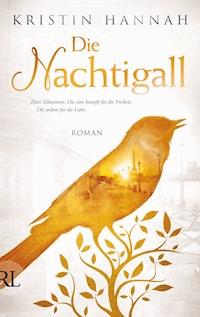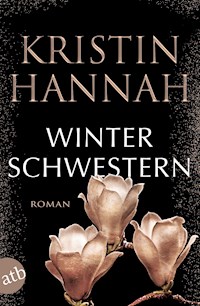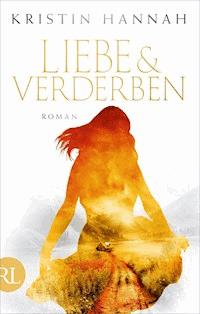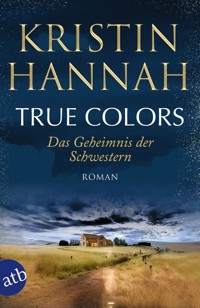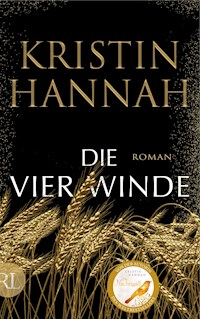10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Niemals werden wir uns trennen.«
Von dem Tag an, als sie sich in der Schule begegnen, sind Lexi und Mia unzertrennlich, so verschieden sie auch sein mögen. Gemeinsam mit Mias Zwillingsbruder Zach verbringen sie einen magischen letzten Sommer, bevor sie auf verschiedene Colleges gehen wollen – bis zu jener Nacht, in der einer von ihnen eine verheerende Entscheidung trifft. Die Familie der Zwillinge wird auseinandergerissen, und Lexi verliert alles. Werden sie einen Weg finden, mit den Folgen dieser Nacht zu leben – oder den Mut, einander zu verzeihen?
»Eine meisterhafte Erzählerin.« Delia Owens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Nichts ist so wichtig für Jude Farraday wie ihre Zwillinge Zach und Mia. Als die junge Lexi in ihre Nachbarschaft zieht und sich mit Mia anfreundet, empfängt Jude das Mädchen, das eine schwere Vergangenheit mit sich trägt, mit offenen Armen. Bald werden Zach und Lexi ein Paar, gemeinsam mit Mia bilden sie ein unzertrennliches Trio. Dann kündigt sich ein schwerer Abschied an, denn Lexi wird auf ein anderes College gehen als Zach und Mia. Ihren letzten gemeinsamen Sommer wollen sie ganz und gar auskosten, und es wird eine Zeit der Liebe und scheinbar ewig währenden Freundschaft – bis zu jenem Augenblick, in dem eines Nachts eine falsche Entscheidung alles zerstört. Plötzlich finden sich die Familie Farraday und Lexi auf verschiedenen Seiten wieder, zwischen ihnen eine unüberwindbare Schuld, und es ist an der Zeit, sich einer neuen Zukunft zu stellen.
Über Kristin Hannah
Kristin Hannah, geboren 1960 in Südkalifornien, arbeitete als Anwältin, bevor sie zu schreiben begann. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Autorinnen der USA und lebt mit ihrem Mann im Pazifischen Nordwesten der USA. Nach zahlreichen Bestsellern waren es ihre Romane »Die Nachtigall« und »Die vier Winde«, die Millionen von Leser:innen in über vierzig Ländern begeisterten und Welterfolge wurden.Alle lieferbaren Titel der Autorin finden Sie unter www.aufbau-verlage.de.
Gabriele Weber-Jarić lebt als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Sie übertrug u. a. Kristin Hannah, Mary Morris, Ranald H. Balson, Imogen Kealey und Allison Pataki ins Deutsche.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kristin Hannah
Night Road – Der Sommer unseres Lebens
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Weber-Jarić
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Prolog — 2010
Teil I
Kapitel 1 — 2000
Kapitel 2
Kapitel 3 — 2003/2004
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Teil II
Kapitel 18 — 2010
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Ich kann nicht leugnen, dass ich eine Helikoptermutter war. Ich ging zu jedem Elternabend, jedem Klassenfest, nahm an jedem Ausflug teil, bis mein Sohn mich anflehte, bitte, bitte zu Hause zu bleiben. Inzwischen ist er erwachsen, hat sein Studium abgeschlossen, und ich kann mit dem Wissen von heute auf unsere gemeinsame Highschoolzeit schauen. Sein letztes Schuljahr zählte zweifellos zu den anstrengendsten wie auch lohnenswertesten Jahren meines Lebens. Wenn ich daran zurückdenke, erinnere ich mich an so viele Höhen und Tiefen – Erinnerungen, die mich zu diesem Roman inspiriert haben. Und dann sage ich mir meist, wie viel Glück ich doch hatte, in einer engen, fürsorglichen Gemeinschaft zu leben, in der einer dem anderen hilft. Daher widme ich diesen Roman meinem Sohn Tucker und den zahllosen Kids, die durch unser Haus gezogen sind und es mit ihrem Lachen erfüllt haben: Ryan, Kris, Erik, Gabe, Andy, Marci, Whitney, Willie, Lauren, Angela und Anna, um nur einige zu nennen. Ebenso widme ich ihn den anderen Müttern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich ohne euch überlebt hätte. Danke, dass ihr immer für mich da wart, gewusst habt, wann ihr mit anfassen, wann eine Margarita anbieten und wann die harte Wahrheit sagen musstet: Julie, Andy, Jill, Megan, Ann und Barbara. Nicht zuletzt danke ich meinem Mann Ben, der mir immer zur Seite gestanden und auf tausendfache Weise zu verstehen gegeben hat, dass wir bei der Erziehung, ebenso wie bei allem anderen, ein Team sind. Ich danke euch allen.
Prolog
2010
Sie steht an der Haarnadelkurve der Night Road.
Hier ist der Wald dunkel, selbst um die Mittagszeit. Uralte Nadelbäume mit moosbewachsenen Stämmen wachsen dicht an dicht, recken sich so hoch in den Sommerhimmel, dass die Sonne nicht hindurchdringt und der abgenutzte Asphaltstreifen im Schatten liegt. Die Luft ist reglos und still, als hielte sie den Atem an. Voller Erwartung.
Einst war diese Straße nicht mehr als der Weg nach Hause, den sie einfach genommen hatte. Die Schlaglöcher waren ihr nicht weiter aufgefallen, und dass die Straße an beiden Seiten abfiel, hatte sie selten – wenn überhaupt jemals – registriert. Sie hatte anderes im Kopf gehabt, alltägliche Dinge. Aufgaben. Besorgungen. Termine.
Natürlich ist sie seit Jahren nicht mehr über diese Straße gefahren. Ein Blick auf das verblichene, grüne Straßenschild hatte stets ausgereicht, um das Lenkrad herumzureißen. Sie wäre lieber von einer Straße abgekommen, als sich hier wiederzufinden. So jedenfalls hatte sie bis zu diesem Tag gedacht.
Noch immer reden die Leute auf der Insel über das, was im Sommer 2004 vorgefallen ist. Sie sitzen in Kneipen und auf Veranden, geben Meinungen und Halbwahrheiten von sich und beurteilen Dinge, deren Beurteilung ihnen nicht zusteht. Sie glauben, ein, zwei Zeitungsartikel hätten ihnen die notwendigen Fakten geliefert. Obwohl die Fakten kaum eine Rolle spielen.
Würde man sie hier sehen, wie sie an dieser einsamen Straße im Schatten steht, käme alles wieder hoch. Man würde sich an jene Nacht vor langer Zeit erinnern, als der Regen zu Asche wurde …
Teil I
Als unseres Lebens Mitte ich erklommen, Befand ich mich in einem dunklen Wald, Da ich vom rechten Wege abgekommen.
Dante AlighieriDie Göttliche KomödieHölle, I. Gesang
Kapitel 1
2000
Lexi Baill studierte die Landkarte des Bundesstaats Washington, bis die winzigen roten Punkte der Grenzlinien vor ihren müden Augen zu tanzen begannen. Von den Ortsnamen ging etwas nahezu Magisches aus, sie deuteten auf eine Landschaft hin, die sie sich kaum vorstellen konnte: schneebedeckte Berge, die bis ans Wasser reichten; Bäume, so hoch und gerade wie Kirchtürme, darüber ein endlos blauer Himmel, der frei von Smog war. Die Sterne würden zum Greifen nah sein und auf Telefonmasten Adler thronen. Nachts wanderten wahrscheinlich Bären durch die stillen Wohngebiete, suchten nach Plätzen, die vor nicht allzu langer Zeit noch ihre gewesen waren.
Ihr neues Zuhause.
Lexi hätte gern geglaubt, dass ihr Leben dort anders verlaufen würde, aber wie realistisch wäre das gewesen? Mit ihren vierzehn Jahren war ihr Wissen vielleicht begrenzt, doch eines hatte sie gelernt: Jugendliche, die sich in der Obhut des Staats befanden, konnte man zurückgeben wie leere Pfandflaschen und Schuhe, die an den Zehen drückten.
Am Vortag hatte ihre Betreuerin sie frühmorgens geweckt und gesagt, sie solle ihre Sachen packen. Wieder einmal.
»Ich habe eine gute Nachricht«, sagte Ms. Watters.
Und obwohl sie noch im Halbschlaf war, wusste Lexi, was das bedeutete. »Eine neue Familie. Wie wunderbar. Danke, Ms. Watters.«
»Nicht einfach eine neue Familie. Deine neue Familie.«
»Richtig. Natürlich. Meine neue Familie. Großartig.«
Ms. Watters gab einen Laut der Enttäuschung von sich, ein leichtes Ausatmen, kein richtiger Seufzer, aber knapp davor. »Du bist so lange stark gewesen.«
Lexi versuchte sich an einem Lächeln. »Es war nicht Ihre Schuld, Ms. W. Ich weiß, wie schwierig es ist, ältere Kinder unterzubringen. Die Rexlers waren in Ordnung. Ich glaube, wenn meine Mom nicht zurückgekehrt wäre, hätte ich bei ihnen bleiben können.«
»An dir hat es jedenfalls nicht gelegen, das weißt du.«
»Ja.« An guten Tagen konnte Lexi sich einreden, dass die Leute sie zurückgaben, weil sie selbst Probleme hatten. An schlechten Tagen – die sich seit Kurzem häuften – fragte sie sich, was an ihr verkehrt war und warum es anderen so leichtfiel, sich von ihr zu trennen.
»Du hast Verwandte, Lexi«, sagte Ms. Watters. »Ich habe deine Großtante ausfindig gemacht. Ihr Name lautet Eva Lange. Sie ist sechsundsechzig Jahre alt und lebt in Port George im Bundesstaat Washington.«
Lexi setzte sich auf. »Was? Meine Mutter hat gesagt, ich hätte keine Verwandten.«
»Deine Mutter hat … sich geirrt. Du hast Familie.«
Seit sie denken konnte, hatte Lexi auf diesen kurzen und doch so wundervollen Satz gewartet. Ihr Leben war von jeher ungewiss und gefährdet gewesen, wie ein Schiff, das auf Untiefen zusteuerte. Und meist war sie allein gewesen, inmitten von Fremden, ein wildes, vernachlässigtes Kind, das um sein Essen und um Aufmerksamkeit gekämpft und weder von dem einen noch dem anderen jemals genug bekommen hatte. Einen Großteil dieser Zeit hatte Lexi verdrängt, doch wenn sie sich anstrengte – wenn einer der behördlichen Psychiater sie dazu zwang –, erinnerte sie sich an Hunger und Kälte und daran, dass sie nach einer Mutter gerufen hatte, die zu high gewesen war, um sie zu hören, zu kaputt, um sich für sie zu interessieren. Lexi wusste noch, dass sie tagelang weinend in einem verdreckten Laufstall gesessen und darauf gewartet hatte, dass jemand sich wieder an ihre Existenz erinnerte.
Nun blickte sie aus dem verschmierten Fenster eines Greyhound-Busses, an ihrer Seite Ms. Watters, die einen Liebesroman las.
Seit sechsundzwanzig Stunden waren sie unterwegs und näherten sich nun endlich ihrem Ziel. Der Himmel hatte die Farbe von Stahlwolle, verschluckte die Spitzen der Bäume, und der Regen malte so unruhige Muster auf die Fensterscheibe, dass man draußen kaum etwas erkennen konnte. Washington kam Lexi wie ein anderer Planet vor. Die sonnenverbrannten Hügel Südkaliforniens waren verschwunden, ebenso die grauen, ewig verstopften Autobahnkreuze. Hier waren die Bäume Giganten, die Berge ebenfalls; überall schienen Pflanzen wild zu wuchern.
Der Bus erreichte die Endstation, ein flaches, betongraues Gebäude, und kam schnaufend und ruckelnd zum Halt. An Lexis Fenster zog eine schwarze Abgaswolke vorüber, hüllte kurz den Parkplatz ein und wurde dann vom Regen zerstört. Die Türen öffneten sich mit einem Zischen.
»Lexi?«
Das war die Stimme von Ms. Watters. Lexi dachte, beweg dich, Lexi, doch sie konnte es nicht. Sie blickte die Frau an, die in den vergangenen sechs Jahren die einzige feste Größe ihres Lebens gewesen war. Jedes Mal, wenn eine Pflegefamilie Lexi wie fauliges Obst zurückgeschickt hatte, war Ms. Watters da gewesen, hatte mit einem traurigen, kleinen Lächeln auf Lexi gewartet. Zu dieser Frau und diesem Lächeln zurückzukehren, war vielleicht nicht viel gewesen, doch mehr kannte Lexi nicht, und nun hatte sie plötzlich Angst, auch dieses bisschen Beständigkeit zu verlieren.
»Was, wenn sie nicht kommt?«, fragte Lexi.
Ms. Watters hielt ihr die Hand hin. Der Handrücken war geädert, die Finger wie dünne Zweige, die Knöchel geschwollen. »Sie wird kommen.«
Lexi holte tief Luft. Sie würde diese Situation meistern. Natürlich würde sie das. In den vergangenen fünf Jahren hatte sie sieben Pflegefamilien und sechs Schulen durchlaufen. Mit Neuem wurde sie fertig.
Sie griff nach Ms. Watters’ Hand. Hintereinander durchquerten sie den schmalen Gang des Busses und stießen an die gepolsterten Sitze auf beiden Seiten.
Als sie ausgestiegen waren, holte Lexi ihren abgewetzten roten Koffer aus dem Stauraum. Der Koffer war voller Bücher und so schwer, dass man ihn kaum heben konnte. Lexi liebte Bücher.
Sie schleppte den Koffer zum Bürgersteig und stellte sich auf die Kante. Es war nur eine Stufe aus Beton, doch ihr kam es wie eine Klippe vor. Ein falscher Schritt, und sie könnte fallen, sich die Knochen brechen oder in den vorbeifließenden Verkehr geraten.
Ms. Watters trat zu ihr und spannte einen Schirm über ihnen auf. Der Regen trommelte auf den Nylonstoff.
Einer nach dem anderen stiegen die Fahrgäste aus dem Bus und zerstreuten sich.
Lexi blickte über den leeren Parkplatz und wollte weinen. Wie oft sie in einer ähnlichen Situation gewesen war. Jedes Mal, wenn ihre Mutter clean gewesen war, war sie gekommen, um Lexi zu holen. Gib mir noch eine Chance, Schatz. Sag dem netten Richter, dass du mich lieb hast. Ich habe mich gebessert und werde dich nie mehr vergessen. Bei ihr hatte Lexi das Warten gelernt. »Wahrscheinlich hat sie es sich anders überlegt.«
»Hat sie nicht.«
»Könnte sie aber.«
»Du hast Familie, Lexi.«
Da war dieser Satz wieder. In Lexis Schutzwall öffnete sich ein Spalt, durch den die Hoffnung schlüpfte.
»Familie.« Wagemutig testete sie das unvertraute Wort, das ihr wie ein Bonbon auf der Zunge zerging und etwas Süßes hinterließ.
Ein ramponierter blauer Ford Fairlane näherte sich und hielt vor ihnen an. Er hatte Rostflecke, ein Kotflügel war eingedellt, und den Sprung im Beifahrerfenster hatte jemand mit Klebeband abgedichtet.
Die Fahrertür öffnete sich langsam, eine Frau stieg aus. Sie war klein und grauhaarig, hatte wässrige braune Augen und Falten im Gesicht, als würde sie viel rauchen. Am bemerkenswertesten war jedoch, dass sie Lexi bekannt vorkam, als wäre sie eine ältere Version ihrer Mutter. Das ungewohnte Wort kehrte zu Lexi zurück, nun jedoch angereichert mit etwas Konkretem. Familie.
»Alexa?«, fragte die Frau mit kratziger Stimme.
Lexi brachte keinen Ton heraus. Sie wollte, dass diese Frau lächelte, sie vielleicht sogar umarmte, doch Eva stand einfach da und runzelte die Stirn.
»Ich bin deine Großtante«, sagte sie schließlich. »Die Schwester deiner Großmutter.«
»Ich habe meine Großmutter nie kennengelernt«, war alles, was Lexi darauf zu sagen wusste.
»Ich habe immer gedacht, du wärst bei der Familie deines Daddys.«
»Ich habe keinen Dad«, erwiderte Lexi. »Ich meine, ich weiß nicht, wer er ist. Mom wusste es nicht.«
Ihre Tante seufzte. »Das ist mir inzwischen auch klar geworden. Dank Ms. Watters. Ist das da dein einziges Gepäck?«
Eine Welle der Scham überflutete Lexi. »Ja.«
Ms. Watters nahm den Koffer und verfrachtete ihn auf den Rücksitz des Wagens. »Komm, Lexi, steig ein. Deine Tante möchte, dass du bei ihr wohnst.«
Ja, jetzt möchte sie das noch.
Ms. Watters drückte Lexi fest an sich und flüsterte: »Hab keine Angst.«
Lexi klammerte sich an sie, ließ sie erst los, als es langsam peinlich wurde, und geriet kurz ins Taumeln. Dann trat sie an den Wagen und öffnete die Beifahrertür, die klappernd und quietschend aufschwang.
Die Sitze waren aus braunem Kunstleder, mit aufgeplatzten Nähten, aus denen graue Füllung quoll. Es roch nach Pfefferminz und kaltem Rauch, als wären in dem Wagen eine Million Mentholzigaretten geraucht worden.
Als ihre Tante losfuhr, rückte Lexi so dicht wie möglich an die Beifahrertür, winkte Ms. Watters durch das gesprungene und geklebte Fenster und sah zu, wie sie hinter ihr in der diesigen Luft verschwand. Lexi legte die Fingerspitzen an die Glasscheibe, als würde die Berührung sie mit der Frau verbinden, die sie nicht länger sehen konnte.
»Der Tod deiner Mutter hat mir leidgetan«, sagte Tante Eva nach langem, bleiernem Schweigen. »Sie ist nun an einem besseren Ort. Das muss dir ein Trost sein.«
Darauf hatte Lexi nie etwas zu antworten gewusst. Auch die fremden Menschen, die sie aufgenommen hatten, hatten sich stets so geäußert. Arme Lexi, deren drogensüchtige Mutter gestorben war. Keinem von ihnen war klar gewesen, wie das Leben ihrer Mutter ausgesehen hatte – mit den Männern, dem Heroin, dem Erbrechen und den Krämpfen. Auch nicht, wie schrecklich das Ende gewesen war. Das wusste nur Lexi.
Sie richtete ihren Blick auf die neue Umgebung, die schroff und grün und dunkel war, selbst mitten am Tag. Nach einer Weile tauchte ein Schild auf, das sie im Reservat Port George willkommen hieß. Im Ort selbst waren überall Symbole der Native Americans zu finden und über den Eingängen von Geschäften holzgeschnitzte Schwertwale. Auf ungepflegten Grundstücken standen Fertighäuser, davor oder daneben häufig rostende Fahrzeuge und Gerätschaften. Verkaufsstände, die Feuerwerkskörper anpriesen, waren selbst zwei Monate nach dem Unabhängigkeitstag noch nicht abgebaut. Auf einem Hang mit Blick auf den Puget Sound wurde ein imposantes Gebäude errichtet, vielleicht ein Casino.
Die nächsten Schilder führten zum Chief Sealth Mobile Home Park, einem Trailerpark. Lexis Tante fuhr hindurch und hielt vor einem gelb und weiß gestrichenen Trailer an. Die Konturen wirkten im Nieselregen verwaschen, was ihm etwas Trostloses verlieh. Hochgeschossene, welkende Petunien in grauen Kunststofftöpfen bewachten die knallblau gestrichene Eingangstür. Die beiden karierten Vorhänge im vorderen Fenster wurden in der Mitte von ausgefransten gelben Kordeln zusammengehalten und sahen aus wie Sanduhren aus Stoff.
»Es ist nichts Besonderes«, sagte Tante Eva und wirkte verlegen. »Ich miete es von einem der hiesigen Stämme.«
Auch dazu wusste Lexi nichts zu sagen. Doch hätte ihre Tante einige der Unterkünfte gesehen, in denen Lexi ihr Leben verbracht hatte, hätte sie sich für diesen hübschen Trailer nicht entschuldigt. »Es ist schön.«
»Also dann.« Tante Eva stellte den Motor aus.
Lexi folgte ihr über einen Kiesweg zur Eingangstür.
Drinnen war alles ordentlich und blitzsauber. Eine kleine L-förmige Küche umgab einen Essbereich, in dem ein Tisch mit Chrombeinen und einer gelb gesprenkelten Resopalplatte stand. Um ihn gruppierten sich vier Stühle. Im Wohnzimmer standen ein mit kariertem Stoff bezogenes Zweiersofa und zwei Fernsehsessel aus blauem Kunstleder vor einem Fernseher. Auf einem Beistelltisch sah Lexi zwei gerahmte Fotos. Eines zeigte eine alte Frau mit Hornbrille, das andere Elvis. Es roch nach Zigarettenrauch und künstlichem Blumenduft. Letzterer stammte vermutlich von den lilafarbenen Duftbäumen, die in der Küche an beinahe jedem Knauf hingen.
»Entschuldige, dass es hier so riecht. Ich habe erst letzte Woche mit dem Rauchen aufgehört – als ich von dir erfahren habe.« Tante Eva wandte sich Lexi zu. »Passivrauchen schadet Kindern, richtig?«
Lexi verspürte etwas Merkwürdiges. Es war vogelgleich und flatternd und so ungewohnt, dass sie es nicht gleich zu benennen wusste.
Hoffnung.
Diese Fremde – diese Tante – hatte ihr zuliebe das Rauchen aufgegeben. Und obwohl sie nicht viel Geld zu haben schien, hatte sie Lexi aufgenommen. Sie sah die Frau an, wollte etwas sagen und brachte kein Wort heraus, aus Furcht, es könnte das falsche sein und sie würde alles verderben.
»Ich bin etwas überfordert, Lexi«, sagte Tante Eva schließlich. »Oscar und ich – Oscar war mein Mann – hatten keine Kinder. Wir haben es versucht, hat nicht geklappt. Deshalb weiß ich nichts über Kindererziehung. Falls du also – «
»Ich werde mich benehmen«, fiel Lexi ihr ins Wort. »Ich schwöre.« Bitte überleg es dir nicht anders. Bitte. »Wenn du mich behältst, wirst du es nicht bereuen.«
»Wenn ich dich behalte?« Lexis Tante schürzte ihre dünnen Lippen, und auf ihrer Stirn deutete sich ein Stirnrunzeln an. »Liebe Güte, deine Mutter scheint dir ja übel mitgespielt zu haben. Was mich nicht wundert. Meiner Schwester hat sie auch das Herz gebrochen.«
»Sie war gut darin, anderen wehzutun«, sagte Lexi leise.
»Wir sind Familie«, entgegnete ihre Tante.
»Ich weiß nicht genau, was das bedeutet.«
Lexis Tante lächelte, doch es war ein bekümmertes Lächeln. Es machte Lexi schmerzhaft bewusst, dass sie nicht mehr unversehrt war. Das Leben mit ihrer Mutter hatte Spuren hinterlassen.
»Es bedeutet, dass du bei mir bleibst«, sagte ihre Tante. »Und ich denke, du nennst mich am besten Eva, denn immer Tante sagen zu müssen, wird einem schnell leid.« Sie wollte sich abwenden, doch Lexi fasste ihr schmales Handgelenk, spürte, wie sich die samtweiche Haut darauf verschob. Das hatte sie nicht tun wollen, hätte sie nicht tun dürfen, aber nun war es zu spät.
»Was ist?«, fragte Eva.
Es fiel Lexi schwer, das Wort zu formen, es saß wie ein Stein in ihrem Rachen, doch sie musste es aussprechen. »Danke«, sagte sie mit brennenden Augen. »Ich mache dir keinen Ärger. Ich schwöre.«
»Wahrscheinlich doch«, entgegnete Eva und schenkte Lexi endlich ein Lächeln. »Wie alle Teenager. Aber das ist in Ordnung. Absolut in Ordnung. Ich war lange allein. Ich bin froh, dass du hier bist.«
Mehr als ein Nicken brachte Lexi nicht zustande. Auch sie war lange allein gewesen.
*
In der Nacht hatte Jude Farraday nicht geschlafen. Kurz vor Anbruch der Morgendämmerung gab sie die Versuche auf. Sie schlug die Sommerdecke zurück, achtete darauf, ihren Mann nicht zu wecken, und tappte zu den Sprossentüren, die sie leise öffnete.
Sie trat hinaus. Im ersten Licht des Tages schimmerte Morgentau in ihrem Garten; der sattgrüne Rasen fiel sanft zu einem Strand aus Sand und Kies ab. Der dahinterliegende Puget Sound war nicht mehr als eine Reihe anthrazitgrauer Wellen, die unentwegt zum Ufer rollten und deren Kronen die Morgenröte orange zu färben begann. Am anderen Ufer erhoben sich in der Ferne die Olympic Mountains, eine gezackte Linie in Rosa und Lavendelblau.
Jude schlüpfte in die Gartenclogs, die an der Tür bereitstanden, überquerte die Terrasse und folgte dem Steinpfad durch ihren Garten.
Dieses Stück Land war nicht nur ihr Stolz und ihre Freude, sondern auch ihre Zuflucht. Auf diesem fruchtbaren, dunklen Boden pflanzte, vermehrte und stutzte sie. Die niedrige Steinmauer, die den Garten umgab, begrenzte ein Reich, in dem sowohl Ordnung als auch Schönheit herrschten. Die Pflanzen blieben dort, wo sie sie eingepflanzt hatte, und bildeten Wurzeln, die tief in die Erde drangen. Und im Frühling oder Sommer erwachten sie zum Leben, ganz gleich, wie kalt und hart der Winter gewesen war, wie heftig der Regen und die Stürme.
»Du bist früh auf.«
Jude wandte sich um. Ihr Mann war herausgekommen und stand auf der Terrasse. Er trug schwarze Boxershorts, und sein zu langes blondes Haar, das langsam grau wurde, war noch vom Schlaf verstrubbelt. Er sah aus wie ein attraktiver Professor für Klassische Philologie oder wie ein alternder Rockstar, dachte Jude. Kein Wunder, dass es für sie Liebe auf den ersten Blick gewesen war, damals vor fast fünfundzwanzig Jahren.
Jude kehrte auf die Terrasse zurück und streifte die Clogs ab. »Ich konnte nicht schlafen«, gestand sie.
Miles nahm sie in die Arme. »Weil heute der erste Schultag ist.«
Das war der Grund. Wie ein Dieb hatte er sich in Judes Gedanken geschlichen und ihr die Ruhe geraubt. »Ich kann nicht fassen, dass sie jetzt schon auf die Highschool gehen. Vor einer Sekunde waren sie doch noch im Kindergarten.«
»Das wird eine interessante Zeit. Bin gespannt, was in den nächsten vier Jahren aus ihnen wird«, sagte Miles.
»Für dich wird es vielleicht interessant«, entgegnete Jude. »Du verfolgst das Spiel vom Rand aus. Ich bin mit auf dem Feld und kriege die Schläge ab. Ich habe Angst, dass etwas schiefgeht.«
»Was soll denn schiefgehen? Unsere Kinder sind klug, wissbegierig und liebevoll. Sie haben alles, was man braucht.«
»Du fragst, was schiefgehen kann? Ist das dein Ernst? Da draußen ist es … gefährlich. Bisher konnten wir sie beschützen, aber wird das auch auf der Highschool möglich sein?«
»Vielleicht solltest du die Sache ein wenig lockerer angehen.«
Das sagte Miles ständig. Nicht nur er, auch andere hatten Jude dazu geraten, schon seit Jahren. Sie waren der Ansicht, sie würde ihre Kinder zu stark überwachen, halte die Zügel zu straff. Doch Jude wusste nicht, wie sie locker lassen sollte. Mutter zu werden war seit dem Moment, als sie sich dafür entschieden hatte, ein Kampf gewesen; vor der Geburt der Zwillinge hatte sie drei Fehlgeburten erlitten. Es hatte Monate gegeben, in denen das Einsetzen ihrer Periode bei ihr Depressionen ausgelöst hatte, ihr Leben grau und glanzlos geworden war. Und dann das Wunder – sie war noch einmal schwanger geworden. Es war eine schwierige, prekäre Schwangerschaft gewesen. Nahezu sechs Monate lang hatte sie liegen müssen. Währenddessen hatte sie sich die Babys vorgestellt und sich gesagt, dass sie dabei war, eine Schlacht zu schlagen, die sie mit reiner Willenskraft gewinnen würde. Und mit der Kraft ihres Herzens.
»Noch nicht«, erwiderte sie schließlich. »Sie sind erst vierzehn.«
»Jude«, sagte Miles und seufzte. »Nur ein kleines bisschen. Mehr will ich doch gar nicht. Jeden Tag kontrollierst du ihre Hausaufgaben, bist bei jeder Schulfeier und jedem anderen Anlass dabei. Du machst ihnen Frühstück, fährst sie überallhin. Du putzt ihre Zimmer und machst ihre Wäsche. Wenn sie ihre Pflichten versäumen, entschuldigst du sie und erledigst es selbst. Unsere Kinder sind keine aussterbende Spezies. Lass sie ab und zu mal von der Leine.«
»Und wie stellst du dir das vor? Wenn ich die Hausaufgaben nicht beaufsichtige, macht Mia sie nicht. Soll ich die Eltern ihrer Freunde nicht mehr anrufen, um mich zu vergewissern, dass die Kinder wirklich bei ihnen sind? Als ich auf der Highschool war, gab es an den Wochenenden immer Bierpartys, und zwei meiner Freundinnen sind schwanger geworden. Künftig muss ich die Kinder sogar noch sorgfältiger im Auge behalten, glaub mir. Denn in den nächsten vier Jahren kann jede Menge schiefgehen, und davor muss ich sie bewahren. Wenn sie auf dem College sind, lasse ich los. Versprochen.«
»Auf dem richtigen College«, korrigierte Miles sie lächelnd, doch beide wussten, dass es nicht scherzhaft gemeint war. Zwar würden die Zwillinge an diesem Tag erst mit der Highschool beginnen, doch Jude hatte sich im Netz bereits Colleges angesehen.
Jude blickte ihren Mann an, wollte, dass er sie verstand. Miles war der Ansicht, dass sie sich zu sehr in das Leben der Kinder einmischte, was sie nachvollziehen konnte, aber sie war Mutter und begriff nicht, wie man das nebenher sein konnte. Zudem konnte sie den Gedanken nicht ertragen, dass ihre Kinder so wie sie aufwachsen und sich ungeliebt fühlen würden.
»Du bist nicht wie deine Mutter«, sagte Miles, und dafür liebte Jude ihn. Sie lehnte sich an ihn, und sie sahen zu, wie der Tag heller wurde, bis Miles sagte: »Ich muss los. Um zehn habe ich eine OP.«
Jude küsste ihn innig und kehrte mit ihm ins Haus zurück. Im Bad duschte sie eilig, föhnte sich das schulterlange blonde Haar und schminkte sich dezent. Anschließend streifte sie eine ausgebleichte Jeans und einen Kaschmirpullover mit U-Boot-Ausschnitt über. Zu guter Letzt entnahm sie einer Kommodenschublade zwei in Geschenkpapier eingeschlagene Päckchen, eins für jedes Kind. Sie verließ das Schlafzimmer und durchquerte den großen Flur mit dem Schieferboden.
Inzwischen schien die Morgensonne durch die bodentiefen Fenster, und das Haus, das zum größten Teil aus Glas, Stein und Tropenholz bestand, schien von innen zu leuchten. Auch die erlesenen Objekte, die in jedem Blickwinkel standen, wurden in helles Licht getaucht. Um aus diesem Haus etwas Besonderes zu machen, hatte Jude vier Jahre lang mit Architekten und Dekorateuren zusammengesessen, und all das, was sie sich erträumt hatte, war umgesetzt worden.
Das obere Stockwerk war eine andere Geschichte. Stieg man die schwebende Treppe aus Kupfer und Stein hinauf, war man im Reich der Kinder. Ein riesiges Wohnzimmer, mit großem Fernseher und Billardtisch, beanspruchte die gesamte Ostseite der Etage. Hinzu kamen zwei großzügig geschnittene Zimmer, jedes mit eigenem Bad.
Jude nahm die Treppe nach oben, klopfte der Form halber an Mias Tür und trat ein. Wie erwartet lag ihre Tochter noch in ihrem Himmelbett und schlief. Im Übrigen sah es in dem Zimmer aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und überall Kleiderhaufen hinterlassen. Mia war auf der Suche nach ihrer Identität, und jede neue Richtung verlangte die entsprechende Kleidung, die offenbar nicht weggeräumt werden konnte.
Jude ließ sich auf der Bettkante nieder und strich Mia eine blonde Strähne aus dem Gesicht. Für einen Moment drehte sich die Zeit zurück, und Jude war wieder die junge Mutter, die ihr pausbäckiges Mädchen mit dem weizenblonden Haar und dem zahnlosen Grinsen betrachtete, das ihrem Bruder wie ein Schatten folgte. Die beiden waren wie Welpen gewesen, die im ausgelassenen Spiel übereinanderkrabbelten, unaufhörlich in der ihnen eigenen Sprache plapperten, lachten, vom Sofa fielen, vom Schoß, die Treppe hinunter. Zach war von Anfang an der Anführer gewesen, hatte als Erster und auch das meiste gesprochen. Mia hatte bis zu ihrem vierten Lebensjahr gebraucht, um das erste richtige Wort von sich zu geben. Bis dahin hatte sie sich auf ihren Bruder verlassen. Er war für sie da, damals wie heute.
Schlaftrunken wälzte Mia sich auf den Rücken, schlug die Augen auf und blinzelte. Ihr blasses, herzförmiges Gesicht mit den hohen Wangenknochen – die hatte sie von ihrem Vater – war voller Akne, und nichts schien dagegen etwas ausrichten zu können. Sie lächelte und entblößte die bunten Gummis ihrer Zahnspange. »Hola, madre.«
»Heute fängt die Highschool an.«
Mia schnitt eine Grimasse. »Erschieß mich. Echt.«
»Es wird besser als in der Mittelschule, du wirst schon sehen.«
»Sagst du. Kannst du mir keinen Hausunterricht geben?«
»Erinnerst du dich an die sechste Klasse? Als ich dir mit den Mathe-Hausaufgaben geholfen habe?«
»Das war schlimm«, sagte Mia niedergeschlagen. »Aber vielleicht wäre es jetzt anders. Ich würde nicht mehr so wütend auf dich werden.«
Jude strich ihr über das weiche Haar. »Du kannst dich vor dem Leben nicht verstecken, mein Schatz.«
»Will ich auch nicht. Nur vor der Highschool. Das ist ein Haifischbecken. Ich könnte einen Fuß verlieren.«
Jude musste lachen. »Richtig so, nimm es mit Humor.«
»Sagt man, wenn ein Mädchen hässlich ist und von niemandem gewollt wird. Vielen Dank.« Mia zuckte mit den Schultern. »Aber wozu braucht der Mensch schon Freunde?«
»Du hast Freunde«, erwiderte Jude.
»Habe ich nicht. Zach hat Freunde, die hin und wieder aus Mitleid nett zu mir sind, weiter nichts.«
Jude tat alles, um ihre Kinder glücklich zu machen, doch diese Schlacht konnte sie nicht ausfechten. Mit Sicherheit war es nicht einfach, die schüchterne Zwillingsschwester des beliebtesten Jungen der Schule zu sein. »Ich habe etwas für dich.«
Mia setzte sich auf. »Was?«
Jude überreichte ihr eins der Päckchen. »Mach es auf.«
Mia riss das Geschenkpapier ab und enthüllte ein Tagebuch mit pinkfarbenem Ledereinband und einem glänzenden Schloss aus Messing.
»Als ich in deinem Alter war, hatte ich ein Tagebuch«, sagte Jude. »Und ich habe alles, was mich beschäftigt hat, aufgeschrieben. So etwas kann hilfreich sein. Ich war ebenfalls schüchtern.«
»Aber du warst schön«, entgegnete Mia.
»Das bist du auch. Ich wünschte, du würdest es einsehen.«
»Klar, Pickel und Zahnspange sind mega.«
»Sei den anderen gegenüber einfach offen«, sagte Jude. »Neue Schule, neue Möglichkeiten.«
Mia verdrehte die Augen. »Es ist nur eine neue Adresse, Mom. Die Leute kenne ich seit dem Kindergarten. Und Haley gegenüber war ich offen, falls du dich erinnerst.«
»Das war vor mehr als einem Jahr«, entgegnete Jude. »Und auf schlechten Erfahrungen herumzureiten, führt zu nichts. Heute fängt die Highschool an. Ein neuer Start.«
»Okay.« Mia lächelte, doch es wirkte bemüht.
»Gut, und nun raus aus dem Bett. Ich möchte, dass wir frühzeitig in der Schule ankommen. Wir müssen dein Schließfach und dein Klassenzimmer finden. In der ersten Stunde hast du Geometrie bei einem Mr. Davies. Ich werde ihm sagen, wie gut du im Leistungstest unseres Bundesstaats abgeschnitten hast.«
»Nein, Mom, du gehst nicht mit mir ins Klassenzimmer! Und mein Schließfach finde ich allein.«
Vom Verstand her wusste Jude, dass Mia recht hatte, doch ihr Herz sprach eine andere Sprache. Ihre Tochter war verletzlich, konnte schnell aus dem Konzept gebracht werden. Was, wenn sich jemand über sie lustig machte?
Eine Mutter musste ihre Kinder beschützen, das gehörte zu ihren Aufgaben. Jude stand auf. »Ich werde so gut wie unsichtbar sein. Man wird gar nicht wissen, dass ich da bin.«
Mia stöhnte.
Kapitel 2
Am ersten Schultag stand Lexi früh auf, durchquerte den schmalen Flur zum Bad und betrachtete sich im Spiegel. Es war genauso schlimm, wie sie vermutet hatte: blasser Teint, nein, eher fahl, die blauen Augen rotgerändert und verquollen. Wieder musste sie im Schlaf geweint haben.
Sie duschte rasch, das Wasser nur lauwarm, um Geld zu sparen. Das lange schwarze Haar brauchte sie nicht zu föhnen, es würde sich so oder so kräuseln und machen, was es wollte. Lexi fasste es zu einem Pferdeschwanz zusammen und kehrte in ihr Zimmer zurück.
Sie öffnete den Kleiderschrank, besaß jedoch so wenig, dass sie nicht lange suchen musste.
Was würden die anderen in der Schule tragen? War es auf Pine Island wie in den Nobelvierteln von Los Angeles, in Brentwood und Hollywood Hills, wo Schülerinnen sich wie Models kleideten? Oder eher wie in East Los Angeles, wo man die Wahl zwischen Grunge- und Rapper-Style hatte?
Das Klopfen an der Tür war so leise, dass Lexi es um ein Haar nicht gehört hätte.
Lexis Tante stand draußen und hielt ein Sweatshirt hoch. Es hatte die Farbe von Zuckerwatte, und auf der Brust war ein Schmetterling aus Strasssteinen. Die nierenförmigen Flügel waren bunt – lila, gelb und grün.
»Das habe ich gestern bei uns gekauft«, sagte Eva. »Weil ich mir gedacht habe, am ersten Tag auf der Highschool wollen Mädchen gern etwas Neues anhaben.« Mit »uns« war Walmart gemeint, wo Lexis Tante arbeitete.
Es war das hässlichste Sweatshirt, das Lexi jemals gesehen hatte, und es hätte besser zu einer Vierjährigen als zu ihr gepasst, dennoch liebte sie es auf Anhieb. Noch nie hatte ihr jemand etwas zu einem ersten Schultag gekauft. »Es ist super«, sagte sie mit einem Kloß im Hals. Seit gerade einmal vier Tagen war sie nun bei ihrer Tante, fühlte sich in ihrem Trailer aber zunehmend zu Hause. Das machte ihr Angst. Einen Ort zu mögen, war riskant. Das Gleiche galt für Personen.
»Du musst es nicht tragen, wenn du nicht willst«, sagte Eva. »Ich dachte nur – «
»Ich möchte es tragen«, fiel Lexi ihr ins Wort. »Danke, Eva.«
Ihre Tante lächelte so glücklich, dass sich ihre Wangen rundeten. »Es wird Lexi bestimmt gefallen, habe ich zu Mildred gesagt.«
»Und du hast recht gehabt.«
Eva nickte vor sich hin und verschwand. Lexi streifte das neue Sweatshirt über, dann zog sie eine verwaschene Jeans aus dem Discounter an. Sie griff nach ihrem Rucksack – er stammte aus einem Secondhand-Laden –, steckte Hefte und Blöcke ein, und die Stifte, die Eva ihr am vergangenen Abend aus dem Walmart mitgebracht hatte.
In der Küche stand ihre Tante am Spülbecken und trank Kaffee. Sie trug bereits ihre Arbeitskleidung – blauer Kittel, zitronengelber Pullover aus Acryl und eine Jeans – und machte einen besorgten Eindruck. »Die Pine Island High ist eine der besten Schulen Washingtons«, sagte sie. »Ms. Watters hat sich für deine Aufnahme eingesetzt. Dummerweise kommt der Schulbus nicht bis hierher, du musst mit dem normalen Bus fahren. Ist das für dich in Ordnung? Hatte ich dir das überhaupt schon gesagt?«
Lexi nickte. »Mach dir keine Gedanken, das ist für mich kein Problem. Ich fahre seit Jahren mit dem Bus.« Dass sie auf schmuddeligen Bussitzen geschlafen hatte, wenn ihre Mutter keine Bleibe gefunden hatte, behielt sie für sich.
»Na dann.« Eva trank ihren Kaffee aus, wusch den Becher ab und ließ ihn im Spülbecken stehen. »Heute fahre ich dich. Ich denke mal, an deinem ersten Schultag willst du nicht zu spät kommen.«
»Ich kann doch den Bus – «
»Nicht am ersten Tag. Ich habe mich extra für die Spätschicht eingetragen.«
Lexi folgte ihrer Tante zum Wagen. Auf der Fahrt nach Pine Island blickte sie aus dem Fenster. Sie hatte sich diese Ecke Washingtons zwar auf der Landkarte angesehen, doch die verschiedenen dünnen Linien und kleinen Zeichen erzählten nur einen Teil der Geschichte. So wusste sie, dass Pine Island zwölf Meilen lang und vier Meilen breit war, man die Insel von Seattle mit der Fähre und vom Festlandteil des Kitsap County über eine Brücke erreichte. Port George, wo Lexi und ihre Tante wohnten, gehörte zu einem Reservat, Pine Island nicht.
Als sie die Brücke überquert hatten, sah Lexi die ersten Häuser von Pine Island, bei denen es sich eher um Villen handelte. Die Bewohner der Insel mussten wohlhabend sein.
Dann ging es einen Hang hinauf. Dort lag die Highschool, eine Ansammlung flacher Ziegelbauten, die sich um einen Fahnenmast scharten. Wie andere Schulen, die Lexi besucht hatte, schien auch diese schneller als erwartet gewachsen zu sein, so dass man auf dem Gelände zusätzlich Schulcontainer aufgestellt hatte.
Eva hielt auf der leeren Busspur an und wandte sich zu Lexi um. »Die anderen sind nicht besser als du. Vergiss das nicht.«
Lexi betrachtete die abgearbeitete Frau, die sie aufgenommen hatte, und wurde von einer Woge der Zuneigung erfasst. »Ich komme klar«, sagte sie. »Mach dir um mich keine Sorgen.«
»Viel Glück«, sagte Eva.
Glück spielte auf einer neuen Schule keine Rolle, dachte Lexi, sagte es aber nicht. Stattdessen rang sie sich ein Lächeln ab und stieg aus dem Wagen. Als sie Eva zum Abschied winkte, hielt ein Schulbus hinter dem Ford, und Schüler strömten heraus.
Mit gesenktem Kopf setzte Lexi sich in Bewegung. Sie war oft genug die Neue gewesen, sie wusste, wie man unter dem Radar flog und dass es das Beste war, in der Menge unterzugehen. Regel Nummer eins lautete, nicht stehen bleiben; Regel Nummer zwei, nicht aufschauen. Wenn sie sich daran hielt, wäre sie Ende der Woche nur eine von vielen im ersten Highschool-Jahr. Dann konnte sie versuchen, ein, zwei Freunde zu finden. Was hier vermutlich nicht einfach sein würde. Was konnte sie mit den anderen Schülern schon gemeinsam haben?
Als sie das Gebäude A erreicht hatte, warf sie noch einmal einen Blick auf ihren Stundenplan. Raum 104, das war ihr Ziel. Sie verschmolz mit der Flut der Schüler, die sich alle zu kennen schienen, ließ sich einfach mittragen. Diejenigen, die mit ihr Raum 104 betraten, suchten sich einen Platz und redeten dabei in einer Tour.
Lexi machte den Fehler, stehen zu bleiben und aufzuschauen, um sich zu orientieren. Im Klassenzimmer wurde es still. Alle starrten sie an, fingen an zu wispern, jemand lachte. Lexi dachte an all das, was an ihr falsch war – die buschigen schwarzen Brauen, die schiefen Zähne, die widerspenstigen Locken, die abgetragene Jeans, das peinliche Sweatshirt. Und das in einer Schule, in der Kinder teure Zahnspangen bekamen und mit sechzehn das erste Auto.
Hinten deutete ein Mädchen auf sie und kicherte. Das Mädchen neben ihr nickte. Toller Schmetterling, glaubte Lexi zu hören. Hat sie den selber gemacht?
Ein Junge stand auf. Das Geflüster verebbte.
Lexi wusste, wer das war. So einen gab es auf jeder Schule – attraktiv, beliebt, sportlich, einer, dem alles zuflog, Kapitän der Footballmannschaft und Klassensprecher. Dieser hier trug ein teures, blaugrünes T-Shirt von Abercrombie und eine Baggy Jeans, ein strahlender, selbstbewusster Wunderknabe, der Leonardo DiCaprio ähnelte.
Er kam auf sie zu. Die Frage war, warum. Stand ein hübsches Mädchen hinter ihr? Wollte er sie demütigen und seine Freunde auf ihre Kosten zum Lachen bringen?
»Hey«, sagte er, und alle sahen zu ihnen, beobachteten sie.
»Hey«, sagte Lexi und biss sich auf die Unterlippe, um ihre schiefen Zähne zu verbergen.
Er lächelte. »Susan und Liz sind Giftspritzen. Kümmere dich nicht um sie. Der Schmetterling ist schön.«
Lexi stand nur da, geblendet von seinem Lächeln, und kam sich idiotisch vor. Reiß dich zusammen. Du hast schon andere gut aussehende Jungen gesehen. Sie sollte sein Lächeln erwidern, etwas sagen – irgendetwas.
»Komm.« Er fasste ihren Arm. Bei seiner Berührung durchzuckte sie etwas, als hätte man ihr einen Stromschlag versetzt.
Sie wartete darauf, dass er sich bewegte, sie irgendwohin führte. Deshalb hatte er doch ihren Arm genommen. Aber er stand einfach da und sah sie an, während sein Lächeln langsam verblasste. Mit einem Mal konnte sie nicht mehr atmen, und die Welt ringsum versank, bis nur noch sein Gesicht da war. Wie außergewöhnlich seine grünen Augen waren.
Er sagte etwas, doch Lexis Herz schlug so laut, dass sie kein Wort verstand. Dann wurde er von einem schönen Mädchen in einem winzigen Minirock fortgezogen.
Lexi starrte auf seinen Rücken, hatte noch immer Atemschwierigkeiten, doch dann fiel ihr ein, wo sie war und wer sie war. Die Neue, die ein himmelschreiend hässliches Sweatshirt trug. Mit gesenktem Kopf wandte sie sich ab und fand einen Platz in der hintersten Reihe. Als sie sich niederließ, schrillte die Schulklingel.
In der ersten Stunde hatte sie Landeskunde, es ging um die Anfänge von Seattle, doch Lexi war nicht bei der Sache. Ein ums andere Mal ließ sie die Szene mit dem Jungen an ihrem geistigen Auge vorbeiziehen. Sie sagte sich, dass die Art, wie er sie berührt hatte, nichts zu bedeuten hatte, doch die Erinnerung daran wollte nicht vergehen. Wenn sie nur wüsste, was er gesagt hatte.
Nach der Stunde schaute Lexi verstohlen zu ihm hinüber. Zusammen mit den anderen steuerte er die Tür an, lachte über etwas, das das Mädchen im Minirock gesagt hatte. Als er an Lexis Tisch vorbeikam, hielt er kurz inne und warf ihr einen Blick zu, ohne zu lächeln. Dann lief er weiter.
Warum hätte er auch bei ihr stehen bleiben sollen? Lexi erhob sich schwerfällig und verließ das Klassenzimmer mit dem Rest. Während des ganzen Morgens versuchte sie, sich mit erhobenem Kopf durch überfüllte Flure und von einem Klassenzimmer zum nächsten zu bewegen. Gegen Mittag ließ ihre Kraft nach, dabei stand ihr das Schlimmste noch bevor.
In einer neuen Schule war es die Hölle, in der Kantine zu essen. Man wusste nicht, welches Benehmen richtig und welches falsch war, und wenn man sich auf den verkehrten Platz setzte, brachte man die ganze Rangordnung durcheinander.
An der Tür zur Kantine blieb Lexi stehen. Bereits die Vorstellung, hineinzugehen, begutachtet und bewertet zu werden, war mehr, als sie ertragen konnte. Normalerweise war sie stärker, doch der Junge hatte sie aus dem Lot gebracht und Sehnsüchte in ihr geweckt. Obwohl sie wusste, wie unerfüllbar solche Sehnsüchte waren, die reine Zeitverschwendung.
Lexi machte kehrt und verließ das Schulgebäude. Draußen schien die Sonne. Lexi holte das Pausenbrot, das ihre Tante gemacht hatte, aus dem Rucksack und dazu das zerlesene Exemplar von Jane Eyre. Manche brauchten Plüschtiere, um sich zu trösten, andere Schmusedecken. Bei Lexi war es der Roman.
Sie schlenderte über den Campus, suchte nach einem Platz, um ihr Brot zu essen und zu lesen. Schließlich entdeckte sie ein Bäumchen auf einem kleinen, dreieckigen Stück Rasen, wobei der Baum weniger interessant war als das Mädchen, das im Schneidersitz unter seinem Laubdach saß und sich über ein Buch beugte. Sie war blond, trug das Haar in zwei locker geflochtenen Zöpfen und hatte ein kurzes, rosafarbenes Tutu an, ein schwarzes Tanktop und schwarze knöchelhohe Chucks. Die Aussage dieser Zusammenstellung war klar und lautete: Ich bin nicht wie ihr. Ich brauche euch nicht.
Eine Zeit lang hatte Lexi versucht, mit ihrer Kleidung das Gleiche auszudrücken. Das war zu der Zeit, als sie keine Freunde haben und von niemandem gefragt werden wollte, wo sie wohnte und wie ihre Mutter so war.
Sie atmete tief durch und nahm Kurs auf das Mädchen. Kurz vor ihr verharrte sie. Sie wollte das Richtige sagen, aber was wäre das?
Das Mädchen schaute von seiner Lektüre auf. Sie war zart gebaut, ihr Gesicht voller Akne. Die Augen waren grün, den violetten Eyeliner hatte sie zu dick aufgetragen.
»Hey«, sagte Lexi.
»Er ist nicht hier«, erwiderte das Mädchen. »Kommt auch nicht.«
»Wer?«, fragte Lexi.
Ein gleichmütiges Schulterzucken war die Antwort. »Wenn du das nicht weißt, ist es auch egal, oder?« Das Mädchen richtete den Blick wieder aufs Buch.
»Darf ich mich zu dir setzen?«
»Das wäre echt Selbstmord«, erwiderte das Mädchen, ohne aufzublicken.
»Was?«
Das Mädchen sah wieder auf. »Wenn du dich zu mir setzt, wäre das Sebstmord. Nicht mal die aus der Theater-AG wollen mit mir gesehen werden. Tiefer kann man nicht sinken.«
»Heißt das, ich kann dann nicht Cheerleader werden? Wie tragisch.«
Der Blick des Mädchens wurde zum ersten Mal neugierig, und um ihre Lippen deutete sich ein Lächeln an. »Den meisten Mädchen ist so etwas wichtig.«
»Im Ernst?« Lexi ließ ihren Rucksack aufs Gras fallen. »Was liest du?«
»Sturmhöhe.«
Lexi zeigte ihr Buch vor. »Ich lese Jane Eyre. Darf ich mich setzen?«
»Den Roman kenne ich noch nicht.« Das Mädchen rutschte zur Seite, um Lexi Platz zu machen. »Ist er gut?«
Lexi ließ sich nieder. »Es ist mein Lieblingsbuch. Wenn du deins durchgelesen hast, können wir tauschen.«
»Das wäre schön. Ich heiße Mia.«
»Lexi. Worum geht es in deinem Buch?«
Mia begann, ihr die Romanhandlung von Sturmhöhe zu schildern, zuerst stockend, doch als sie zu Heathcliff kam, geriet sie in Fahrt. Und wenig später unterhielten sie sich, als wären sie seit Langem befreundet. Als die Klingel das Ende der Pause ankündigte, kehrten sie gemeinsam ins Schulgebäude zurück.
Lexi fühlte sich nicht mehr allein, presste ihre Schulbücher nicht mehr an die Brust, mied nicht mehr den Blick der anderen. Stattdessen lachte sie.
In der nächsten Stunde hatte Mia Spanisch. An der Tür zu ihrem Klassenzimmer blieb sie stehen. »Wenn du magst, kannst du nach der Schule mit zu uns kommen«, sagte sie hastig und wirkte nervös. »Aber wahrscheinlich möchtest du das nicht. Könnte ich verstehen.«
Lexi wollte lächeln, doch die Scham über ihre Zähne hielt sie davon ab. Deshalb sagte sie nur: »Das würde ich total gern.«
»Dann treffen wir uns nach der Schule am Fahnenmast.«
Lexi suchte ihr Klassenzimmer und setzte sich dort wieder in die hinterste Reihe. Bis Schulschluss warf sie immer wieder einen Blick auf die Wanduhr und wünschte, die Zeit würde schneller vergehen. Um zehn vor drei war sie am Fahnenmast und wartete auf Mia. Um sie herum strömten Schüler zum Ausgang und schubsten sich auf dem Weg zu den Schulbussen, die vor der Schule standen.
Vielleicht würde Mia nicht kommen. Nein, nicht vielleicht, wahrscheinlich würde sie nicht kommen.
Lexi war kurz davor aufzugeben, doch dann war Mia plötzlich da. »Du hast gewartet«, sagte sie und klang ebenso erleichtert, wie Lexi sich fühlte. »Komm mit.«
Mia bahnte ihnen einen Weg durch eine Schülerschar zu einem glänzenden schwarzen Cadillac Escalade, der an der Hauptstraße parkte. Sie öffnete die hintere Tür und stieg ein.
Lexi folgte ihrer neuen Freundin und glitt auf einen cremefarbenen Sitz, der nach Leder roch.
»Hola, madre«, sagte Mia. »Das ist Lexi. Ich habe sie zu uns eingeladen. Ist das okay?«
Die Frau am Steuer hatte sich umgedreht, und Lexi konnte nicht fassen, wie schön sie war. Michelle Pfeiffer kam ihr in den Sinn, denn Mias Mutter hatte einen feinen, blassen Teint und glattes, blondes Haar wie die Schauspielerin. Auch auf das Titelbild eines Modekatalogs hätte sie in ihrem teuren, lachsfarbenen Pullover gepasst. »Hallo, Lexi«, sagte sie. »Ich heiße Jude. Freut mich, dich kennenzulernen. Wie kommt es, dass ich dich bisher noch nicht gesehen habe?«
»Ich bin erst vor Kurzem hierhergezogen«, erwiderte Lexi.
»Deshalb also. Und von wo?«
»Kalifornien.«
»O Gott«, sagte Jude belustigt. »Und deine Mutter hat nichts dagegen, wenn du nach der Schule nicht sofort nach Hause kommst?«
»Nein«, sagte Lexi und wappnete sich für die unausweichliche nächste Frage.
»Wenn du möchtest, rufe ich sie an und mache uns miteinander be– «
»Mo-om«, sagte Mia. »Du tust es schon wieder.«
Jude zwinkerte Lexi zu. »Ich bin meiner Tochter peinlich. Neuerdings sogar schon, wenn ich atme. Trotzdem kann ich wohl kaum aufhören, Mutter zu sein. Wahrscheinlich ist dir deine Mutter ebenfalls peinlich, oder?«
Lexi wusste nicht, was sie darauf antworten sollte, aber das machte nichts. Jude lachte und sprach schon weiter, als hätte sie nichts gefragt. »Man darf mich sehen, aber nicht hören. Alles klar. Schnallt euch an.«
Jude startete den Motor, und Mia erzählte sofort von einem Buch, das sie interessierte.
Es dauerte nicht lange, bis sie eine kleine, malerische Hauptstraße erreichten, die jedoch so voller Autos war, dass sie immer wieder ins Stocken gerieten. Erst als sie den Ort hinter sich gelassen hatten und auf den Highway fuhren, hatten sie freie Fahrt.
Nach einer Weile bog Jude ab und folgte einer kurvenreichen, von Bäumen gesäumten Straße nach der anderen, bis sie eine kiesbestreute Auffahrt erreichten und Jude sagte: »Trautes Heim, Glück allein.«
Zuerst sah man nur hohe Bäume, doch nach einer Biegung lag eine sonnenbeschienene Lichtung vor ihnen.
Das Haus darauf sah aus wie einem Roman entsprungen. Es thronte in der Landschaft, ein unglaublich elegantes Bauwerk aus Holz und Stein mit vielen Fenstern. Der Garten, der es umgab, wurde von niedrigen Steinmauern begrenzt. Dahinter lag der Puget Sound, Lexi konnte das Wellenrauschen schon erahnen.
»Wow«, sagte sie, als sie den Wagen verlassen hatte. Sie war noch nie in so einem Haus gewesen. Wie musste sie sich benehmen? Was sollte sie sagen? Mit Sicherheit würde sie etwas falsch machen und Mia sie auslachen.
Auf dem Weg zum Haus strich Jude ihrer Tochter über den Kopf. »Ich wette, ihr seid hungrig«, sagte sie. »Wie wäre es mit Quesadillas? Und beim Essen erzählt ihr mir, wie der erste Schultag war.«
Befangen, wie sie war, ließ Lexi sich ein wenig zurückfallen.
An der Eingangstür drehte Mia sich um. »Was ist, Lexi? Möchtest du doch nicht zu uns kommen? Hast du es dir anders überlegt?«
Lexi spürte, wie sich ihre Nervosität legte. Auch Mia war unsicher. Und mit einem Mal schienen diese Gefühle sich miteinander zu verweben und sich in etwas Gemeinsames zu verwandeln. Sie waren einander ähnlich, so absurd das auch klingen mochte. Das Mädchen, das nichts besaß, war wie das Mädchen, das alles besaß.
»Nein, habe ich nicht.« Lexi lachte und lief auf die Haustür zu.
Im Flur streifte sie die Schuhe ab und sah zu spät, dass sie Löcher in den Socken hatte. Verlegen folgte sie Mia weiter ins Haus. Dort gab es Glaswände, die einen steinernen Kamin, glänzenden Holzfußboden und den Ausblick auf das Meer umrahmten. Lexi traute sich nicht, etwas zu berühren.
Mia griff nach ihrer Hand und zog sie mit sich in eine riesengroße Küche. Lexi nahm einen Herd mit sechs Kochfeldern wahr, darüber ein skelettartiges schwarzes Teil, an dem blank polierte Kupfertöpfe hingen. Sogar Vasen voller Blumen gab es. Mia und sie ließen sich an der Kücheninsel mit einer Arbeitsplatte aus Granit nieder. Mias Mutter begann mit der Zubereitung der Quesadillas.
»Sie hat sich einfach zu mir gesetzt, madre. Ich habe ihr gesagt, dass man sie dafür verachten würde, aber das war ihr egal. Es war so mega.«
Jude lächelte und schien etwas erwidern zu wollen, doch Mia sprach weiter, ein unablässiger Redestrom, als hätte sie seit Jahren Beobachtungen und Gedanken gespeichert, die nun endlich heraussollten. Lexi kannte das. Auch sie hatte vieles für sich behalten, war zu ängstlich gewesen, um es zu äußern.
Während des Essens kam auch Lexi wieder zu Wort und stellte fest, dass sie und Mia in allem einer Meinung waren, ganz gleich, ob es um die Highschool, Jungs, Lehrer, Unterrichtsfächer, Filme, Tattoos oder Bauchnabelpiercings ging. Gleichzeitig wuchs ihre Sorge, wie Mia auf ihre Vergangenheit reagieren würde. Würde sie auch mit der Tochter einer Drogenabhängigen befreundet sein wollen?
Gegen fünf Uhr flog die Haustür auf, und eine Gruppe Jugendlicher stürmte ins Haus.
»Schuhe aus!«, rief Jude von der Küche aus, ohne aufzublicken.
Es waren neun oder zehn, Mädchen wie Jungen, und ganz eindeutig die angesagte Clique der Schule. Jeder hätte das erkannt. Die Mädchen waren hübsch, trugen Hüftjeans und bauchfreie T-Shirts, die Jungen Sweatpants und die blau-gelben Shirts der Highschool von Pine Island.
»Mein Bruder ist der in der grauen Jogginghose«, sagte Mia und beugte sich zu Lexi vor. »Du darfst von den anderen nicht auf ihn schließen. Die haben den IQ eines Pfefferminzbonbons.«
Mias Bruder war der Junge aus der ersten Schulstunde.
Mit der Leichtigkeit von jemandem, der wusste, wie beliebt er war, löste er sich von den anderen und trat zu Mia. Die beiden glichen sich wie ein Ei dem anderen, Mia war lediglich die weibliche, zartere Version. Ihr Bruder wollte etwas zu ihr sagen und registrierte Lexi. Er lächelte kurz, dann wurde sein Blick schärfer, so intensiv, dass Lexis Herz schneller zu schlagen begann. Auf diese Weise hatte sie noch niemand angeschaut. Es war, als fände er alles an ihr interessant.
»Du bist die Neue«, sagte er und strich sich eine lange blonde Strähne aus den Augen.
»Sie ist meine Freundin«, erklärte Mia und lächelte so breit, dass man die bunten Gummis ihrer Zahnspange sah.
Das Interesse in seinen Augen erlosch.
»Ich bin Lexi«, sagte sie, obwohl er sie nicht nach ihrem Namen gefragt hatte.
Mit gleichgültiger Miene wandte er sich ab. »Zach.«
Ein Mädchen in knappen Shorts und bauchfreiem Top schmiegte sich an ihn und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Zach reagierte kaum. »Bis später, Mi-Mi«, sagte er zu seiner Schwester, schlang einen Arm um das Mädchen in den Shorts und verschwand mit ihr und den anderen eine Treppe hinauf.
Mia sah Lexi stirnrunzelnd an. »Stimmt etwas nicht? Ich durfte doch sagen, dass du meine Freundin bist, oder?«
Lexi starrte auf den Fleck, auf dem Zach gestanden hatte, und ihre Unsicherheit kehrte zurück. Er hatte sie doch angelächelt, oder? Am Anfang, einen Moment lang. Was hatte sie falsch gemacht?
»Lexi, ist es okay, wenn ich den anderen sage, dass du meine Freundin bist?«
Lexi atmete hörbar aus, wandte den Blick von dem leeren Fleck ab und sah Mia an, die einen beunruhigten Eindruck machte. Und Lexi erinnerte sich an das, was wichtig war. Jemand wie Zach war es nicht. Zach verwirrte sie höchstens, was kein Wunder war. Für ein Mädchen wie sie würde ein Junge wie er immer verwirrend sein. Was zählte, waren Mia und die ersten zarten Bande ihrer Freundschaft. »Natürlich«, sagte sie lächelnd. Zum ersten Mal schämte sie sich nicht für ihre Zähne. Wahrscheinlich waren sie Mia ohnehin einerlei. »Das kannst du allen erzählen.«
*
Wie immer war das Wohnzimmer im Obergeschoss voller Teenager. Wahrscheinlich gab es Frauen, denen der Lärm und das Chaos zu viel gewesen wären, Jude jedoch nicht. Schon vor Jahren – damals waren die Zwillinge ins sechste Schuljahr gekommen – hatte sie sich entschieden, ihr Haus einladend zu machen. Die Freunde und Freundinnen ihrer Kinder sollten sich bei ihnen wohlfühlen, denn Jude wollte ihre Zwillinge nicht der Obhut einer anderen Frau überlassen. Sie wollte die Kontrolle haben. Dementsprechend hatte sie das obere Stockwerk gestaltet, und es hatte funktioniert. An manchen Tagen waren da oben fünfzehn Jugendliche, die sich wie Heuschrecken durch die Snacks futterten, die Jude für sie bereitstellte. Doch sie wusste, dass ihre Kinder in Sicherheit waren, das war die Hauptsache.
Jude durchquerte den großen Wohnbereich unten und öffnete die holzgerahmten Faltschiebetüren nach draußen. Über ihr dröhnte die Decke von dem Hin und Her der Kids.
Ausnahmsweise hatte Mia sich nicht in ihrem Zimmer verkrochen, um sich in die Welt tröstlicher Disney-Filme zu flüchten, in Die kleine Meerjungfrau oder Die Schöne und das Biest. Stattdessen saß sie mit Lexi unten am Strand. Die beiden hatten sich in die dicke, rot-weiß gestreifte Wolldecke gehüllt, schwarzes und blondes Haar wurde in der salzigen Brise, die vom Wasser kam, durcheinandergeweht. Sie saßen dort schon seit einer Weile, redeten und redeten.
Der Anblick ihrer Tochter, die sich mit einer Freundin unterhielt, stimmte Jude froh. Darauf hatte sie lange gewartet, es sehnsüchtig erhofft. Gleichzeitig meldeten sich wieder die altbekannten Sorgen. Mia war so verletzlich und ihr Wunsch, eine Freundin zu haben, groß. Das machte sie verwundbar. Und nach der Sache mit Haley würde Mia eine weitere falsche Freundin womöglich nicht verkraften.
Jude beschloss, mehr über Lexi in Erfahrung zu bringen. So war sie stets vorgegangen, und jedes Mal war es hilfreich gewesen. Je mehr sie über die Freunde ihrer Kinder wusste, desto mehr wusste sie über die Einflüsse, die sie auf Mia und Zach ausüben konnten, und wäre, wenn nötig, in der Lage gegenzusteuern.
Sie trat hinaus auf die Terrasse. Der Wind wehte ihr Haar hoch und blies ihr Strähnen ins Gesicht. Auf bloßen Füßen überquerte sie die Terrasse, vorbei an den dunkelbraunen Rattanmöbeln und über den Steinpfad hinunter zu der hohen Zeder, die sich am Strand in den klaren blauen Himmel reckte. Sie hörte, wie Mia sagte: »Ich würde gern für das Theaterstück vorsprechen, aber ich weiß jetzt schon, dass ich die Rolle nicht kriege. Die Hauptrollen gehen immer an Sarah und Joeley.«
»Ich hatte heute Angst, dich anzusprechen«, erwiderte Lexi. »Was, wenn ich es nicht getan hätte? Man darf keine Angst haben. Du musst es einfach wagen.«
Mia wandte sich ihr zu. »Würdest du mitkommen, wenn ich vorspreche? Die anderen in der Theater-AG sind so … ernst. Sie mögen mich nicht.«
»Klar komme ich mit«, sagte Lexi und klang feierlich. »Auf jeden Fall.«
Jude trat näher und legte Mia eine Hand auf die schmale Schulter. »Hallo, ihr beiden.«
Mia schaute zu ihr auf und wirkte glücklich. »Ich werde mich um eine Rolle im Theaterstück für dieses Schuljahr bewerben. Und Lexi begleitet mich. Wahrscheinlich kriege ich die Rolle nicht, aber …«
»Großartig«, sagte Jude lächelnd. »Aber jetzt muss ich Lexi nach Hause fahren. In einer Stunde kommt dein Dad.«
»Kann ich mitfahren?«, fragte Mia.
Jude schüttelte den Kopf. »Du beginnst mit dem Referat, das Freitag fällig ist.«
»Siehst du jetzt schon auf die Homepage der Schule?«, fragte Mia und ließ die Schultern hängen. »Am ersten Schultag?«
»Du brauchst einen guten Start«, erwiderte Jude. »Die Noten, die du auf der Highschool bekommst, sind wichtig.« Sie sah Lexi an. »Bist du so weit?«
»Ich kann den Bus nehmen«, sagte Lexi. »Sie müssen mich nicht fahren.«
»Den Bus?«, fragte Jude verwundert. Seit Jahren fuhr sie die Freunde ihrer Kinder nach Hause, noch nie hatte einer angeboten, den Bus zu nehmen, höchstens erklärt, er könne auch seine Mutter anrufen und sie bitten, ihn abzuholen. Wo fuhr hier überhaupt ein Bus?
Lexi schälte sich aus der Wolldecke und stand auf. Ihre Deckenhälfte fiel auf den Sand. »Wirklich, Mrs. Farraday, Sie müssen mich nicht fahren.«
»Bitte, nenn mich Jude. Wenn du ›Mrs.‹ sagst, muss ich an meine Mutter denken, und das möchte ich nicht. Mia, sag Zach, dass ich losfahre. Wer nach Hause gebracht werden will, soll sich zu mir bequemen.«
Zehn Minuten später startete Jude ihren Wagen, auf dem Rücksitz fünf Teenager, die sich anschnallten und durcheinanderredeten. Lexi saß still auf dem Beifahrersitz und blickte geradeaus.
Mia und Zach waren mit nach draußen gekommen. Jude trug ihnen auf, mit den Hausaufgaben zu beginnen, dann fuhr sie los. Die Strecke war ihr vertraut, sie hätte sie im Schlaf fahren können. Links in den Beach Drive, rechts auf die Night Road, links auf den Highway. Auf der Viewcrest bog sie in eine Einfahrt. Dort wohnte Molly, Judes beste Freundin. Sie hielt an und drehte sich zu Mollys Sohn um. »Tschüs, Bryson. Erinnere deine Mutter daran, dass wir diese Woche zum Lunch verabredet sind.«
Bryson murmelte irgendetwas und stieg aus. Jude fuhr die übliche Runde über die Insel, setzte einen Fahrgast nach dem anderen ab. Zum Schluss war nur Lexi übrig. Sie wandte sich ihr zu. »Okay, Schätzchen, wohin muss ich jetzt fahren?«
»Ist da drüben nicht eine Bushaltestelle?«, fragte Lexi.
Jude schüttelte den Kopf. »Ich setze dich nicht in einen Bus. Wohin also?«
»Nach Port George.«
»Ach«, sagte Jude überrascht. Die meisten Schüler der Pine High lebten auf der Insel, und hinter der Brücke begann eine andere Welt. Geographisch gesehen waren es nicht mehr als hundert Meter, die Pine Island von Port George trennten, doch es gab viele Möglichkeiten, Entfernungen zu messen. In Port George lag der Minimarkt, in dem nette, wohlerzogene Jungs aus Pine Island Bier und Zigaretten kauften, mit gefälschten Ausweisen, die sie aus alten Sammelkarten gemacht hatten. Und die Schulen in Port George waren berüchtigt. Sie fuhr zurück zum Highway und von der Insel.
Sie waren ein Stück hinter der Brücke, als Lexi sagte: »Hier können Sie mich rauslassen. Den Rest laufe ich zu Fuß.«
»Das wirst du nicht.«
Lexi erklärte Jude den Weg, der zu einem Trailerpark führte, und dirigierte sie dort über ein gewundenes Sträßchen zu einem winzigen, von Unkraut übersähten Grundstück, auf dem ein Trailer stand. Sein gelb-weißer Anstrich war dabei zu verblassen, und die Eingangstür, die in der Mitte einen Riss hatte, war von einem scheußlichen Blau. Judes Blick wanderte zu den Vorhängen in den Fenstern, die ausgeblichen waren und unregelmäßig gesäumt. Roststreifen krochen wie Raupen an den Fugen des Häuschens entlang; an einer Stelle zeigten tiefe Schlammspuren im Gras, dass dort normalerweise ein Auto stand.
Das entsprach nicht ganz Judes Erwartungen. Sie hielt den Wagen an und stellte den Motor aus. »Ist deine Mutter zu Hause?«, fragte sie. »Dann könnte ich sie kennenlernen. Ich möchte dich nicht einfach absetzen.«
Lexi drehte sich Jude zu. »Meine Mutter ist vor drei Jahren gestorben. Ich wohne jetzt bei meiner Tante Eva.«
»Oh, Schätzchen«, sagte Jude. Sie wusste, wie es war, wenn man einen Elternteil verlor. Ihr Vater war gestorben, als sie sieben Jahre alt war. Damals hatte sich ihre Welt verändert, war trüb und beängstigend geworden, und sie hatte nicht mehr gewusst, wohin sie gehörte. »Das tut mir leid. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das für dich ist.«
Lexi zuckte mit den Schultern.
»Seit wann lebst du bei deiner Tante?«
»Seit vier Tagen.«
»Seit – was? Und wo warst du – «
»Bei Pflegefamilien.« Lexi seufzte. »Meine Mutter war heroinabhängig. Manchmal haben wir im Auto übernachtet. Wahrscheinlich möchten Sie jetzt nicht mehr, dass ich mit Mia befreundet bin. Ich verstehe das, echt. Ich wünschte, auch meine Mutter hätte es interessiert, mit wem ich zusammen war.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: