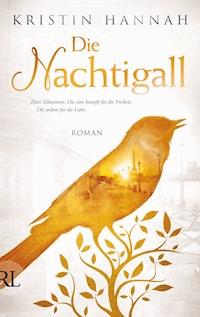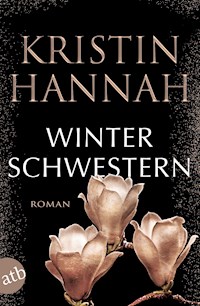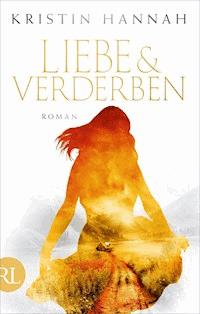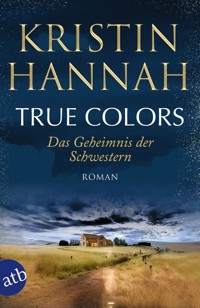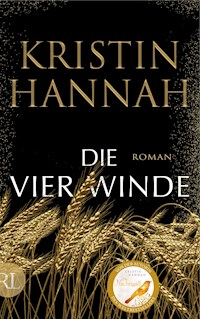4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Träume einer Generation, die Kraft der Freundschaft und eine Frau, die über sich hinauswächst.
Auch Frauen können Helden sein – für die junge Krankenschwesterschülerin Frances McGrath gleichen diese Worte einer Offenbarung. In der sich wandelnden Welt des Jahres 1965 wagt sie es, von dem ihr vorherbestimmten Pfad abzuweichen, und folgt ihrem Bruder nach Vietnam. Und während sie inmitten der Grausamkeit des Krieges über sich hinauswächst, erwartet sie die wahre Herausforderung bei ihrer Rückkehr ...
Wie schon in »Die Nachtigall« lässt Weltbestsellerautorin Kristin Hannah einen besonderen Moment der Geschichte aus der Sicht von Frauen lebendig werden, deren Mut und Tatkraft allzu oft vergessen werden.
»Eine wichtige Hommage an die mutigen Frauen, die in Vietnam gedient haben.« BONNIE GARMUS.
»Ein emotionsgeladener Pageturner.« PUBLISHERS WEEKLY.
»Und wieder richtet Hannah den Blick auf die übersehenen Frauen der Geschichte.« PEOPLE MAGAZINE.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Es ist das Jahr 1965, und die Welt ist im Wandel. Die behütete junge Frances »Frankie« McGrath sucht einen anderen Weg für sich, als zu heiraten und Kinder zu bekommen – können nicht auch Frauen für ihr Land Großes leisten? Gleich ihrem Bruder will sie in einer verkehrten Welt das Richtige tun und meldet sich als Krankenschwester für Vietnam. Aber Leid und Zerstörung des Krieges sind überwältigend und lassen sie die Ideale ihrer Generation infrage stellen. Inmitten des täglichen Spiels um Leben und Tod wächst Frankie über sich hinaus, und als sie dem Arzt Jamie begegnet, erfährt sie eine Zeit des Glücks. Bei ihrer Heimkehr ist sie eine andere geworden, doch vom Leid des Krieges will niemand mehr hören – und schon gar nicht, dass auch Frauen ihren Beitrag geleistet haben.
»Und wieder richtet Hannah den Blick auf die übersehenen Frauen der Geschichte.« PEOPLE MAGAZINE
»Kraftvoll.« MATT HAIG
Über Kristin Hannah
Kristin Hannah, geboren 1960 in Südkalifornien, arbeitete als Anwältin, bevor sie zu schreiben begann. Heute ist sie eine international gefeierte Bestsellerautorin und lebt mit ihrem Mann im Pazifischen Nordwesten der USA. Mit ihrem Roman »Die Nachtigall«, der in über vierzig Ländern erschien, erreichte sie Millionen von Leser:innen weltweit; noch nie jedoch wurde eines ihrer Bücher mit so viel Begeisterung aufgenommen wie »Die Frauen jenseits des Flusses«, was mit Erscheinen die New York Times-Bestsellerliste anführte.
Im Aufbau Taschenbuch liegen ihre Romane »Die andere Schwester«, »Das Mädchen mit dem Schmetterling«, »Die Dinge, die wir aus Liebe tun«, »Die Mädchen aus der Firefly Lane«, »Liebe und Verderben«, »Winterschwestern«, »Der Junge von Angel Falls« und »Die vier Winde« vor.
Christine Strüh übertrug u. a. Cecelia Ahern, Gillian Flynn und Buzzy Jackson ins Deutsche. Sie lebt in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kristin Hannah
Die Frauen jenseits des Flusses
Roman
Aus dem Amerikanischen von Christine Strüh
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Teil 1
Kapitel 1 — Coronado Island, Kalifornien Mai 1966
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Teil 2
Kapitel 23 — Virginia April 1971
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35 — Westliches Montana September 1982
Anmerkungen der Autorin
Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Dieser Roman ist den mutigen Frauen gewidmet, die in Vietnam gedient haben. Diese Frauen – größtenteils Krankenschwestern, die mit heroischen Familiengeschichten aus dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen waren – folgten dem Ruf ihres Landes und zogen in den Krieg. Viel zu oft kehrten sie in eine Heimat zurück, die sich nicht dafür interessierte, was sie geleistet hatten, und in eine Welt, die nichts von ihren Erfahrungen hören wollte; viel zu oft wurden die Schwierigkeiten, mit denen sie nach ihrer Rückkehr aus dem Krieg zu kämpfen hatten, ignoriert, ihre Geschichten vergessen oder bestenfalls als Randbemerkungen abgetan. Ich bin dankbar, die Stärke, die Widerstandskraft und das Durchhaltevermögen all dieser Frauen endlich ins rechte Licht rücken zu können.
Gewidmet ist der Roman ebenfalls den Veteranen sowie den Kriegsgefangenen und Vermissten und ihren Familien, die große Opfer gebracht haben.
Und schließlich widme ich ihn auch dem medizinischen Personal von heute, das die Pandemie bekämpft und alles gegeben hat, um anderen zu helfen.
Danke.
Teil 1
Dieser Krieg hat die Kluft zwischen den Generationen dermaßen vergrößert, dass sie droht, das Land zu zerreißen.
FRANK CHURCH
Kapitel 1
Coronado Island, Kalifornien Mai 1966
Das von Mauern umgebene Privatanwesen der McGraths war eine Welt für sich, geschützt und abgeschieden. An diesem dämmrigen Abend schimmerten die Sprossenfenster des Tudor-Hauses auf dem üppigen, gepflegten Grundstück juwelengleich, die Palmwedel wiegten sich leise, auf dem Pool schaukelten Kerzen, und an den Ästen der großen kalifornischen Steineiche hingen goldene Lampions. Zwischen den zahlreichen, gut gekleideten Gästen schwirrten schwarz livrierte Kellner mit Silbertabletts voller Champagnergläser umher, in einer Ecke spielte dezent ein Jazztrio.
Die zwanzigjährige Frances Grace McGrath wusste genau, was an einem solchen Abend von ihr erwartet wurde. Sie sollte das Inbild einer wohlerzogenen jungen Lady verkörpern, die – stets lächelnd, still und heiter – sämtliche unpassenden Gefühle voll unter Kontrolle hatte. Die Regeln, die Frankie nicht nur zu Hause, sondern auch in der Kirche und in der St. Bernadette’s Academy for Girls beigebracht worden waren, hatten ihr aufs Deutlichste vermittelt, was sich gehörte und was nicht. Die Unruhe, die derzeit überall im Land herrschte, die auf den Straßen und auf dem Universitätscampus der Stadt explodierende Wut waren für sie eine fremde Welt, ebenso unverständlich wie der Konflikt im fernen Vietnam.
So schlenderte sie zwischen den Gästen umher, nippte an ihrer eisgekühlten Cola, versuchte zu lächeln und blieb gelegentlich stehen, um mit Freunden ihrer Eltern Konversation zu betreiben. Sie hoffte, niemand würde ihr anmerken, dass sie sich Sorgen machte und die ganze Zeit über Ausschau nach ihrem Bruder hielt, der zu spät zu seiner eigenen, ihm zu Ehren ausgerichteten Party eintraf.
Frankie vergötterte Finley, ihren großen Bruder. Die beiden waren immer unzertrennlich gewesen: zwei schwarzhaarige, blauäugige Kinder, die, keine zwei Jahre auseinander, den lieben langen kalifornischen Sommer praktisch ohne Aufsicht verbracht hatten, auf ihren Fahrrädern vom einen Ende der verschlafenen Insel zum anderen geradelt und selten vor Einbruch der Nacht zurück nach Hause gekommen waren.
Doch an den Ort, zu dem Finley jetzt aufbrechen wollte, konnte sie ihm nicht folgen.
Das Röhren eines Motors, begleitet von lautem Hupen, unterbrach die Ruhe der Party.
Frankie sah, wie ihre Mutter zusammenzuckte. Bette McGrath hasste alles Laute und Vulgäre, und ganz sicher hielt sie nichts davon, wenn jemand seine Ankunft mit einem Hupkonzert ankündigte.
Wenige Augenblicke später fiel das Gartentor geräuschvoll ins Schloss, und Finley tauchte auf, das hübsche Gesicht erhitzt, die schwarzen Locken umrahmten wild seine Stirn. Rye Walsh, sein bester Freund, hatte den Arm um ihn gelegt, aber keiner der beiden wirkte allzu sicher auf den Beinen. Lachend hielten sie einander aufrecht, hinter ihnen stolperten weitere Freunde herein.
In ihrem makellosen schwarzen Etuikleid, die Haare elegant hochgesteckt, ging Mom auf die Gruppe kichernder junger Männer und Frauen zu. Um den Hals trug sie die Perlen, die ihre Großmutter ihr vererbt hatte, ein subtiler Hinweis darauf, dass Bette McGrath früher Bette Alexander von den Alexanders aus New Port Beach gewesen war. »Jungs«, sagte sie mit melodiöser Stimme. »Wie schön, dass ihr doch noch gekommen seid.«
Schwankend löste Finley sich aus Ryes Umarmung und versuchte, trotzdem einigermaßen aufrecht stehen zu bleiben.
Dad gab der Band ein Zeichen, und die Musik verstummte. Plötzlich war nur noch die Geräuschkulisse von Coronado Island an einem Abend im Spätfrühling zu hören – das leise Rauschen des Ozeans, das Wispern der Palmen, Hundegebell irgendwo in der Nachbarschaft oder vielleicht auch am Strand. In seinem maßgeschneiderten schwarzen Anzug, einem frischen weißen Hemd mit schwarzer Krawatte, in der einen Hand eine Zigarette, in der anderen einen Manhattan, trat Dad nach vorn. Mit seinen kurz geschnittenen schwarzen Haaren und dem eckigen Kinn sah er ein bisschen aus wie ein ehemaliger Boxer, dem der große Wurf gelungen war und der gelernt hatte, sich gut anzuziehen. Denn selbst hier, inmitten all der attraktiven, gut gekleideten Partygäste, stachen er und Mom durch ihre besondere Aura des Erfolgs hervor. Mom gehörte zum alten Geldadel und war auf der gesellschaftlichen Leiter schon immer ganz oben gewesen, Dad hatte sich seinen Weg an die Spitze aus eigener Kraft gebahnt, um nun selbstbewusst neben ihr zu stehen.
»Freunde, Familie, Akademie-Absolventen«, begann Dad mit dröhnender Stimme. Als Frankie ein kleines Mädchen war, hatte man ihm noch den Hauch eines irischen Akzents angehört, aber er hatte hart daran gearbeitet, ihn abzulegen. Dad hatte oft mit seiner eigenen Einwanderersaga geprahlt – eine Geschichte von Disziplin und harter Arbeit –, selten erwähnte er jedoch, welche Chancen es ihm eingebracht hatte, die Tochter seines Chefs zu heiraten. Natürlich wussten das trotzdem alle. Ebenso bekannt war, dass Dad nach dem Tod von Moms Eltern deren Vermögen mit seinem Engagement in der kalifornischen Immobilienbranche mehr als verdreifacht hatte.
Jetzt legte er den Arm um die Schulter seiner zierlichen Frau und zog sie so eng an sich, wie sie es in der Öffentlichkeit zuließ. »Wir sind dankbar, dass ihr alle gekommen seid, um gemeinsam mit uns unserem Sohn Finley eine gute Reise zu wünschen.« Dad lächelte. »Von jetzt an müssen wir ihn nicht mehr morgens um zwei nach irgendeinem lächerlichen Dragster-Rennen aus dem Polizeirevier von Coronado retten.«
Vereinzelt wurde gelacht. Die Partygäste kannten die Umwege, die Finley auf seinem Weg ins Erwachsenwerden gemacht hatte. Von Anfang an war er ein Sonnyboy gewesen, ein Wildfang, der auch das härteste Herz zum Schmelzen brachte. Die Leute lachten über seine Späße, die Mädchen liefen ihm nach. Alle liebten Finley, aber die meisten stimmten überein, dass er kein Kind von Traurigkeit war. In der vierten Klasse blieb er sitzen, hauptsächlich aufgrund seiner ständigen Streiche. In der Kirche mangelte es ihm gelegentlich am nötigen Respekt, und er mochte Mädchen, die kurze Röcke trugen und Zigaretten in der Handtasche versteckten.
Als das Lachen verstummte, fuhr Dad fort: »Wir trinken auf Finleys Wohl, auf sein großes Abenteuer. Wir sind stolz auf dich, mein Sohn!«
Nun erschienen die Kellner mit den Dom-Pérignon-Flaschen, schenkten Champagner nach, Gläserklimpern erfüllte die Luft. Die Gäste umringten Finley; Männer klopften ihm auf die Schulter und gratulierten ihm zu seinem Entschluss, junge Frauen drängelten sich zu ihm durch und buhlten um seine Aufmerksamkeit.
Erneut gab Dad der Band ein Zeichen, und sofort setzte die Musik wieder ein.
Frankie nutzte die Gelegenheit und machte sich auf den Weg ins Haus, vorbei an der großen Küche, in der die Caterer fleißig Tabletts mit Canapés arrangierten.
Sie verkroch sich im Büro ihres Vaters, das als kleines Mädchen ihr Lieblingsort gewesen war. Große, kuschelige Ledersessel, Fußschemel, zwei Wände voller Bücher, ein riesiger, massiver Schreibtisch. Sie knipste das Licht an. Der Raum roch wie immer nach altem Leder und Zigarren, gemischt mit einem Hauch teuren Aftershaves. Auf dem Schreibtisch lagen, in ordentlichen Stapeln, Baugenehmigungen und Architekturpläne.
Eine ganze Wand des Büros war der Familienhistorie gewidmet. Gerahmte Fotos, zum Teil Erbstücke von Moms Eltern und sogar ein paar Bilder, die Dad aus Irland mitgebracht hatte, etwa das Foto von Urgroßvater McGrath in Soldatenuniform, wie er vor der Kamera salutierte. Neben diesem Bild hing, ebenfalls in einem Rahmen, ein Kriegsorden, der Frankies Großvater Francis im Ersten Weltkrieg verliehen worden war. Das Hochzeitsfoto ihrer Eltern war zwischen Großvater Alexanders »Purple Heart«-Verwundetenauszeichnung und einem Zeitungsausschnitt platziert, auf dem das Schiff seiner Truppe bei Kriegsende in den Hafen einfuhr.
Von ihrem Vater gab es keine Bilder in Uniform. Er war mit 4-F als für den Militärdienst untauglich eingestuft worden, was ihn zutiefst beschämte. Darüber klagte er allerdings nur im Privaten, nur im Rahmen der engsten Familie und auch nur, wenn er getrunken hatte. Nach dem Krieg hatte er Grandpa Alexander überredet, in San Diego erschwinglichen Wohnraum für zurückkehrende Veteranen zu bauen. Dad bezeichnete es als seinen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen, und das Projekt war spektakulär erfolgreich gewesen. Im Gespräch mit anderen war er immer so »militärstolz«, dass mit der Zeit anscheinend alle in Coronado seinen Makel, nie gedient zu haben, vergessen hatten. Von seinen Kindern gab es keine Bilder an der Wand – noch nicht. Frankies Vater war der Meinung, dass man sich den Platz in dieser Galerie verdienen musste.
Auf einmal hörte Frankie, wie sich hinter ihr leise die Tür öffnete, und jemand sagte: »Oh. Tut mir leid, Entschuldigung. Ich wollte nicht stören.«
Sie drehte sich um und sah Rye Walsh in der Tür stehen, in der einen Hand einen Cocktail, in der anderen ein Päckchen »Old Gold«-Zigaretten. Anscheinend war er auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen zum Rauchen.
»Ich verstecke mich hier nur vor der Party«, erklärte sie. »Irgendwie habe ich keine große Lust zu feiern.«
Rye ließ die Tür hinter sich offen. »Da hatten wir anscheinend den gleichen Plan. Aber du erinnerst dich wahrscheinlich gar nicht an mich …«
»Joseph Ryerson Walsh, genannt Rye. Wie der Whiskey«, sagte Frankie und versuchte zu lächeln. So hatte er sich letzten Sommer vorgestellt. »Aber warum versteckst du dich? Du und Fin seid doch gute Freunde und liebt Partys.«
Als er näher kam, fing Frankies Herz auf einmal an zu stolpern. Schon bei ihrer ersten Begegnung war es Frankie so gegangen, aber sie hatten sich nie wirklich unterhalten. Auch jetzt wusste sie nicht, worüber sie mit ihm reden sollte, da sie mit einem Gefühl des Verlassenwerdens kämpfte, einem Gefühl von Einsamkeit.
»Ich werde ihn vermissen«, sagte Rye leise.
Frankie spürte, wie ihr Tränen in die Augen stiegen, und wandte sich hastig von Rye ab. Er stellte sich neben sie, und sie starrten gemeinsam auf die Familienbilder und -andenken. Männer in Uniform, Frauen im Hochzeitskleid, Orden für Tapferkeit und Verwundungen, eine dreieckig gefaltete, ebenfalls gerahmte amerikanische Flagge, die Frankies Großmutter väterlicherseits bekommen hatte.
»Warum hängen denn außer den Hochzeitsbildern hier keine Fotos von Frauen?«, fragte Rye plötzlich.
»Es ist eine Heldenwand. Zu Ehren der Opfer, die unsere Familie im Dienst unseres Landes gebracht hat.«
Er zündete sich eine Zigarette an. »Frauen können doch auch Helden sein.«
Frankie lachte.
»Was findest du daran komisch?«
Frankie wischte sich die Tränen aus den Augen und sah ihn an. »Ich … na ja … du meinst nicht etwa …«
»Doch«, sagte er und erwiderte ihren Blick. Frankie konnte sich nicht erinnern, dass ein Mann sie jemals so angeschaut hatte, so intensiv. Sie musste tief Luft holen. »Ich meine es genau so, Frankie. Wir schreiben das Jahr 1966. Die ganze Welt ist dabei, sich zu verändern.«
Stunden später, als die Gäste schon dabei waren, sich höflich zu verabschieden, dachte Frankie noch immer an Rye und seine Worte.
Frauen können doch auch Helden sein.
So etwas hatte sie noch nie gehört. Weder von ihren Lehrerinnen bei St. Bernadette’s noch von ihren Eltern. Nicht einmal von Finley. Sie fragte sich, warum es ihr selbst noch nie in den Sinn gekommen war, dass ein Mädchen, eine Frau, ebenfalls einen Platz an der Bürowand ihres Vaters einnehmen könnte, wenn sie etwas Heroisches oder Wichtiges getan hatte. Dass eine Frau etwas erfinden oder entdecken oder als Krankenschwester auf dem Schlachtfeld womöglich Leben retten konnte.
Die Vorstellung erschütterte nicht nur ihre wohlbehütete Sicht auf die Welt, sondern stellte ihr ganzes Selbstbild auf den Kopf. Aber die Nonnen, die Lehrerinnen und ihre eigene Mutter hatten ihr jahrelang beigebracht, dass Krankenpflege ein exzellenter Beruf für eine Frau sei.
Lehrerin. Krankenschwester. Sekretärin. Das waren akzeptable Aufgabenbereiche für ein Mädchen wie sie. Erst eine Woche zuvor hatte ihre Mutter sich Frankies Klagen über ihre Probleme mit dem Biologieunterricht in der Oberstufe angehört und freundlich erwidert: Wer interessiert sich denn auch für Frösche, Frances? Du wirst sowieso nur so lange als Krankenschwester arbeiten, bis du heiratest. Übrigens ist es Zeit, dass du endlich anfängst, darüber nachzudenken. Du brauchst dich nicht so zu quälen mit deinen anspruchsvollen Kursen, mach ruhig ein bisschen langsamer. Stattdessen solltest du dich öfter verabreden. Frankie hatte gelernt zu glauben, es sei ihre Aufgabe, eine tüchtige Hausfrau zu werden, artige Kinder zu erziehen und für ein schönes Zuhause zu sorgen. Auf ihrer katholischen Highschool hatten die Schülerinnen ganze Tage damit verbracht, Knopflöcher perfekt zu bügeln, eine Serviette präzise zu falten und den Tisch elegant zu decken. Am San Diego College for Women wurde unter ihren Klassenkameradinnen und Freundinnen nicht rebelliert, bestenfalls lachten die Mädchen gelegentlich darüber, dass sie nur für ihren MRS-Abschluss arbeiteten – also nur studierten, um einen Ehemann zu finden und endlich »Mrs.« genannt zu werden. Auch Frankie hatte nicht groß über ihre Ausbildung zur Krankenschwester nachgedacht. Es ging auch ihr eigentlich nur darum, gute Noten zu bekommen, damit ihre Eltern stolz auf sie sein konnten.
Als die Musiker am Partyabend ihre Instrumente einpackten und die Kellner die leeren Gläser wegzuräumen begannen, schlüpfte sie aus ihren Sandalen, verließ den Garten und überquerte den stillen Ocean Boulevard, die breite, gepflasterte Straße, die das Haus ihrer Eltern vom Strand trennte.
Vor ihr erstreckte sich der goldene Sand von Coronado Beach. Ein Stück links von ihr lag das berühmte Hotel del Coronado, rechts befand sich die große Naval Air Station North Island, die Militärbasis der US-Navy, die vor Kurzem als Geburtsort der Marineluftfahrt anerkannt worden war.
Die kühle Nachtbrise fuhr durch ihre toupierte, kinnlange Pagenfrisur, hatte jedoch gegen das »Aqua Net«-Haarspray, das jede Strähne zuverlässig an Ort und Stelle hielt, keine Chance.
Frankie setzte sich in den kühlen Sand, schlang die Arme um ihre angewinkelten Knie und starrte hinaus in die Wellen. Über ihr stand der Vollmond am Himmel, ganz in der Nähe sah sie das orange Schimmern eines Lagerfeuers, der Geruch des Rauchs wehte durch die Nachtluft zu ihr herüber.
Wie konnte eine Frau sich die Welt erschließen? Wie begann man eine Reise, wenn man kaum wusste, wo es hingehen sollte? Für Finley war es einfach, für ihn war der Weg geplant und vorbereitet worden. Er würde das tun, was alle Männer der McGrath- und Alexander-Sippe taten: ehrenvoll seinem Land dienen und anschließend das Immobiliengeschäft der Familie übernehmen. Frankie dagegen hatte – abgesehen von Heiraten und Kinderkriegen – nie jemand einen Vorschlag gemacht, wie sie ihre Zukunft gestalten könnte.
Lachen und das Geräusch rascher Schritte rissen sie aus ihrer Träumerei. Eine junge blonde Frau tauchte auf, zog sich im Sand die Schuhe aus und rannte ungehemmt in die Brandung. Ihr folgte Rye, ebenfalls lachend. Er hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, die Schuhe auszuziehen. Jemand sang etwas unharmonisch »Walk Like a Man«.
Hinter den beiden erschien Finley und ließ sich, noch betrunkener als zuvor, neben sie fallen. »Wo warst du denn den ganzen Abend, Schätzchen? Ich hab dich vermisst.«
»Hey, Fin«, antwortete sie leise, lehnte sich an ihn und erinnerte sich an ihr Leben am Strand, wie sie als Kinder kunstvolle Sandburgen gebaut und beim stets dudelnden Eiswagen, der im Sommer den Ocean Boulevard rauf und runtertingelte, Eis am Stiel gekauft hatten. Lange Stunden hatten sie auf ihren Surfbrettern verbracht, sich, die Füße über die Seiten baumelnd, in der heißen Sonne unterhalten und ihre tiefsten Geheimnisse ausgetauscht, während sie auf die nächste Welle warteten.
Immer zusammen. Beste Freunde.
Frankie wusste, was ihr Bruder jetzt von ihr brauchte; sie sollte ihm sagen, dass sie stolz auf ihn war, und ihn dann mit einem Lächeln verabschieden. Aber sie brachte es nicht fertig. Sie hatten einander nie belogen, und jetzt schien nicht der richtige Zeitpunkt, um damit anzufangen. »Fin, bist du sicher, dass du nach Vietnam gehen solltest?«
»Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst.«
Frankie seufzte. Sie und Finley hatten Präsident Kennedy vergöttert. Was er gesagt hatte, bedeutete ihnen etwas – was konnte sie dagegen einwenden? »Ich weiß, aber …«
»Es ist nicht gefährlich, Frankie. Vertrau mir. Ich bin Absolvent der Marineakademie, Offizier mit einem bequemen Job auf einem Schiff, ich kann eine ruhige Kugel schieben. Und werde im Handumdrehen wieder da sein. Du wirst kaum genügend Zeit haben, mich ordentlich zu vermissen.«
Alle behaupteten das Gleiche: Der Kommunismus verkörpere das Böse und müsse aufgehalten werden, schließlich befänden sie sich mitten im Kalten Krieg. Gefährliche Zeiten. Wenn ein großer Mann wie Präsident Kennedy am helllichten Tag in Dallas von einem Roten erschossen werden konnte, wie sollte sich dann ein Amerikaner noch sicher fühlen? Alle waren sich einig darin, dass man es dem Kommunismus nicht erlauben durfte, sich erfolgreich in Asien auszubreiten, und Vietnam war genau der Ort, an dem man ihn ausbremsen musste.
In den Abendnachrichten sah man lächelnde Soldaten in großen Gruppen durch den Dschungel marschieren und den Journalisten mit nach oben gereckten Daumen zeigen, dass alles in Ordnung war. Kein Tropfen Blut wurde vergossen.
Finley legte den Arm um seine Schwester.
»Ich werde dich vermissen, Schnuckelchen.« Doch sie hörte das kurze Stocken in seiner Stimme und wusste, dass er selbst Angst davor hatte zu gehen.
Hatte er diese Angst schon die ganze Zeit vor ihr versteckt? Womöglich auch vor sich selbst?
Und da war sie wieder, die Sorge, die sie schon den ganzen Abend zu unterdrücken, zu ignorieren versucht hatte. Auf einmal aber wuchs das Gefühl ihr über den Kopf, sie konnte es nicht mehr ertragen. Wegschauen war unmöglich geworden.
Ihr Bruder zog in den Krieg.
Kapitel 2
Die nächsten sechs Monate schrieb Frankie ihrem Bruder jeden Sonntag, wenn sie aus der Kirche zurückkam. Im Gegenzug erhielt sie lustige Briefe über Finleys Leben an Bord des Schiffs und über die Eskapaden seiner Seefahrer-Kollegen. Er schickte Postkarten von üppigen grünen Dschungeln und Stränden mit Sand, der weiß war wie Salz. Er erzählte ihr von Partys im O-Club und in den Dachterrassenbars in Saigon, von den Berühmtheiten, die dort für die Unterhaltung der Truppen sorgten.
Seit Finley weg war, hatte Frankie die Anzahl ihrer Kurse erhöht, so dass sie ihre Ausbildung früher als geplant und mit Auszeichnung abschloss. Als frischgebackene examinierte Krankenschwester bekam sie ihren ersten Job in einem kleinen Krankenhaus im nahe gelegenen San Diego und leistete dort die Nachtschicht. Seit einer Weile schon spielte sie mit dem Gedanken, ihr Elternhaus zu verlassen und sich eine eigene Wohnung zu suchen – ein Traum, den sie Finley bereits kurz davor in einem Brief gestanden hatte. Stell dir das doch mal vor, Fin. Wenn wir zusammen in einer kleinen Wohnung gleich beim Strand wohnen würden. Vielleicht in Santa Monica. Was für ein Spaß das wäre …
Jetzt, an diesem kühlen Abend in der letzten Novemberwoche, war es auf den Krankenhausfluren ganz still. In ihrer gestärkten weißen Uniform, das Schwesternhäubchen auf ihrem toupierten Pagenkopf festgepinnt, folgte Frankie der leitenden Nachtschwester in ein Privatzimmer ohne Blumen und Besucher, in dem eine junge Frau lag und schlief. Wie immer erhielt Frankie Anweisungen, wie sie ihren Job zu erledigen hatte.
»Das Mädchen hier war auf der St. Anne’s Highschool«, sagte die Nachtschwester und fügte lautlos das Wort Baby hinzu, als wäre es eine Sünde, so etwas auch nur auszusprechen. Frankie wusste, dass St. Anne’s das Wohnheim für unverheiratete Mütter war, aber man sprach nicht über die Mädchen, die plötzlich die Schule verließen und Monate später zurückkehrten, allerdings viel stiller als vorher.
»Ihr Infusionstropf ist beinahe leer, ich könnte …«
»Um Himmels willen, Miss McGrath, Sie wissen doch, dass Sie dafür noch nicht bereit sind. Wie lange sind Sie jetzt hier? Eine Woche?«
»Zwei, Ma’am. Und ich bin ausgebildete Krankenschwester, meine Noten …«
»… sind vollkommen unwichtig. Mir kommt es auf klinische Kompetenz an, und davon haben Sie noch zu wenig. Sie sollen nach den Bettpfannen schauen, die Wasserkrüge auffüllen, Patienten beim Toilettengang helfen. Wenn Sie soweit sind, andere Aufgaben zu übernehmen, sage ich Ihnen Bescheid.«
Frankie seufzte leise. Eigentlich hatte sie sich in der Ausbildung nicht so abgerackert, um danach Bettpfannen zu wechseln und Kissen aufzuschütteln. Wie sollte sie die klinischen Kompetenzen erwerben, die sie brauchte, um eine Stelle in einer erstklassigen Klinik zu bekommen?
»Bitte protokollieren und kontrollieren Sie sämtliche intravenös verabreichten Medikamente. Die Information brauche ich gleich. Na los!«
Frankie nickte und begann ihre üblichen Runde von Zimmer zu Zimmer.
Gegen drei Uhr früh kam sie zu Zimmer 107 und öffnete leise die Tür, um niemanden zu wecken.
»Sind Sie hier, um sich die Freak-Show anzuschauen?«
Frankie hielt inne, unsicher, was sie tun sollte. »Ich kann auch später noch mal wiederkommen …«
»Nein, bleiben Sie. Bitte.«
Frankie schloss die Tür hinter sich und ging zu dem Bett, in dem ein junger Mann mit langen, wirren, blonden Haaren und einem blassen, schmalen Gesicht lag. Auf seiner Oberlippe wuchs ein Flaum dunkelblonder Haare. Er sah aus wie ein junger Mann, den man beim Surfen in Trestles beobachten könnte – wäre da nicht der Rollstuhl gewesen, der in der Ecke stand.
Unter der weißen Decke konnte sie die Umrisse seiner Beine erkennen. Oder eher die Umrisse seines Beins.
»Sie können gern nachschauen«, sagte er. »Wer verzichtet schon freiwillig darauf, sich ein Wrack anzusehen?«
»Ich störe Sie«, sagte Frankie, trat einen Schritt zurück und wollte sich schon umdrehen und gehen.
»Bleiben Sie doch. Die schicken mich auf die Psycho-Station, weil ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Zwangseinweisung, was für ein Quatsch. Als würden die wissen, was ich denke. Jedenfalls sind Sie womöglich der letzte vernünftige Mensch, den ich für eine Weile zu Gesicht kriegen werde.«
Vorsichtig ging Frankie wieder zu ihm, kontrollierte seinen Tropf und machte einen Eintrag auf seinem Krankenblatt.
»Ich hätte meinen Revolver benutzen sollen«, fuhr der junge Mann fort.
Frankie wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Ihr war noch nie ein Mensch begegnet, der versucht hatte, Selbstmord zu begehen. Ihr kam es unhöflich vor zu fragen, warum er es getan hatte, aber ebenso unhöflich, einfach zu schweigen.
»Ich habe dreihundertvierzig Tage dort verbracht. Dachte, ich wäre praktisch schon wieder auf dem Nachhauseweg. Großer Fehler. Als Shorttimer, meine ich.«
Als er merkte, dass Frankie ihn etwas verwirrt ansah, fügte er erklärend hinzu: »Vietnam.« Und seufzte. »Mein Mädchen – Jilly –, sie hat Kontakt gehalten, mir Liebesbriefe geschrieben, die ganze Zeit, bis ich dann auf die scheiß Mine getreten bin und mein Bein verloren habe.« Er senkte den Blick. »Sie hat mir gesagt, ich würde lernen, damit umzugehen, mit der Zeit. Ich versuch’s ja …«
»Das hat Ihre Freundin Ihnen gesagt?«
»Nein, nein. Eine Schwester im Twelfth Evac Hospital. Sie hat mich durchgekriegt, sich zu mir gesetzt, wenn ich ausgerastet bin.« Er sah Frankie an und griff nach ihrer Hand. »Können Sie bei mir bleiben, bis ich einschlafe, Ma’am? Ich hab solche Alpträume …«
»Natürlich. Ich gehe nirgendwohin.«
Frankie hielt noch seine Hand, als er endlich einschlief, und sie dachte an Finley, an die Briefe, die er ihr jede Woche schrieb, mit lustigen Anekdoten und Beschreibungen der wunderschönen Landschaft. Du solltest mal den Seidenstoff und die Juwelen hier sehen, Schätzchen. Mom würde hier alles leer kaufen. Und die bei der Marine wissen, wie man eine Party feiert, Junge, Junge. Immer wieder schrieb er, dass der Krieg bald zu Ende sein würde. In den Abendnachrichten sagte Walter Cronkite dasselbe.
Aber der Krieg ging immer noch weiter.
Männer starben. Und verloren offensichtlich ihre Beine.
Eine Schwester im 12th Evac Hospital. Sie hat mich durchgekriegt.
An Krankenschwestern in Vietnam hatte Frankie bisher noch nie gedacht, Frauen wurden in den Zeitungen nie erwähnt. Und gesprochen wurde über Frauen im Krieg erst recht nicht.
Frauen können doch auch Helden sein.
In diesem Moment erlebte Frankie eine Offenbarung, sie spürte einen kühnen, ungewohnten Ehrgeiz in sich aufsteigen.
»Ich könnte meinem Land dienen«, sagte sie zu dem Mann, dessen Hand sie hielt. Eine revolutionäre, unheimliche, beglückende Vorstellung.
Aber war das tatsächlich möglich?
Woher wusste man, ob man die Kraft und den Mut besaß? Vor allem als wohlerzogene junge Frau, deren Courage noch nie auf die Probe gestellt worden war.
Sie ließ die Idee auf sich wirken, schloss die Augen und stellte sich vor, ihren Eltern zu erzählen, dass sie der Marine beigetreten wäre und nach Vietnam gehen würde. Finley einen Brief zu schreiben: Trommelwirbel, bitte! Ich gehöre nun auch zur Marine und werde nach Vietnam geschickt! Auf baldiges Wiedersehen!
Wenn sie sich jetzt dazu entschloss, konnten sie zusammen dort drüben sein. Vor Ort.
So konnte sie sich wirklich ihren Platz an der Heldenwand verdienen, und das nicht nur für eine gute Ehe, nein, dafür, in Kriegszeiten Leben zu retten.
Ihre Eltern würden so stolz auf sie sein, genauso stolz wie auf Finley. Ihr ganzes Leben lang hatte man ihr beigebracht, dass der Militärdienst Familienpflicht war.
Moment.
Denk noch mal richtig darüber nach, Frankie. Es könnte gefährlich werden.
Aber die Gefahr fand keinen Nachhall in ihr. Sie würde auf einem Klinikschiff arbeiten, weit weg von den Kampfhandlungen.
Als sie die Hand des Soldaten losließ, hatte sie sich entschieden.
In der vergangenen Woche hatte Frankie ihren freien Tag wie besessen geplant, hatte niemandem von ihren Absichten erzählt und niemanden um Rat gefragt. Immer wieder hatte sie sich selbst ermahnt, das Tempo zu drosseln, ihren Plan sorgfältig zu durchdenken. Fakt war jedoch, dass sie ja genau wusste, was sie tun wollte. Und sie würde sich ihr Vorhaben von niemandem ausreden lassen.
Nach einer kurzen Dusche ging sie zurück in ihr Zimmer, das vor Jahren mit einem rüschenbesetzten Himmelbett, Flokati und gestreifter Provence-Rosen-Tapete für ein junges Mädchen eingerichtet worden war. Sie wählte eines der konservativen Kleider, die ihre Mutter gern und oft für sie kaufte. Hohe Qualität, Frances, daran erkennt man eine Lady auf den ersten Blick.
Erwartungsgemäß war das Haus um diese Zeit leer. Mom spielte Bridge im Country Club, Dad war bei der Arbeit.
Um 13 Uhr 25 hielt Frankie vor dem nächstgelegenen Rekrutierungsbüro der Navy, wo eine kleine Gruppe von Kriegsgegnern demonstrierte und Slogans skandierte. Auf den Schildern, die die Teilnehmer in die Höhe reckten, war zu lesen: »KRIEG GEFÄHRDET DIE GESUNDHEIT« oder »BOMBARDIEREN FÜR FRIEDEN IST WIE VÖGELN FÜR JUNGFRÄULICHKEIT«.
Zwei langhaarige Männer verbrannten ihren Einberufungsbescheid – was illegal war –, und die Versammlung feuerte sie an. Frankie hatte derartige Proteste nie verstanden. Glaubten diese Leute denn wirklich, ein paar Plakate würden Präsident Johnson dazu bringen, den Krieg zu beenden? Verstanden sie denn nicht, dass ganz Südostasien dem Kommunismus anheimfallen würde, wenn Vietnam kommunistisch würde? Hatten sie nicht gelesen, wie bösartig solche Regimes oft waren?
Als Frankie aus dem Auto stieg, spürte sie plötzlich, wie sehr sie aus dem Rahmen fiel. Ihre teure dunkelblaue Kalbslederhandtasche eng an sich gedrückt, näherte sie sich der demonstrierenden Gruppe, die jetzt skandierte: »Scheiß auf Wehrpflicht, mit uns nicht!«
Als die Demonstranten Frankie bemerkten, herrschte für einen Moment absolute Stille.
»Verdammt, die gehört bestimmt zu den Jungen Republikanern!«, rief jemand.
Frankie zwang sich, ruhig weiterzugehen.
»O Mann«, sagte jemand anderes. »Die Kleine ist irre.«
»Geh nicht dort rein!«
Frankie öffnete die Tür des Rekrutierungsbüros. Drinnen sah sie einen Tisch unter einem Schild, auf dem stand: SEI EIN PATRIOT, GEH ZUR NAVY. Am Ende des Tischs stand ein Matrose in Uniform.
Frankie schloss die Tür hinter sich und ging zu dem Rekrutierungspult.
Einige der Demonstranten hämmerten an die Fensterscheibe. Frankie gab sich alle Mühe, nicht zusammenzuzucken, nicht nervös oder gar ängstlich zu wirken.
»Ich bin Krankenschwester«, sagte sie, die Geräusche von draußen ignorierend. »Ich möchte der Navy beitreten und mich freiwillig für den Einsatz in Vietnam zur Verfügung stellen.«
Der Matrose warf unruhige Blicke auf die Menge draußen. »Wie alt sind Sie?«
»Zwanzig, Sir. Nächste Woche werde ich einundzwanzig.«
»Damit die Navy Sie nach Vietnam schickt, Ma’am, müssen Sie mindestens zwei Jahre gedient haben, das heißt, Sie müssen erst mal zwei Jahre hier in den Staaten in einem Krankenhaus arbeiten.«
Zwei Jahre. In zwei Jahren würde der Krieg doch längst vorbei sein. »In Vietnam werden also keine Krankenschwestern gebraucht?«
»O doch, ganz dringend sogar.«
»Mein Bruder ist in Vietnam. Ich … ich möchte helfen.«
»Tut mir leid, Ma’am. So sind nun mal die Vorschriften. Zu Ihrer eigenen Sicherheit, das können Sie mir glauben.«
Als Frankie das Büro verließ, war ihr zwar der Wind aus den Segeln genommen, aber sie war nicht entmutigt. Sie eilte an den Demonstranten vorbei, die ihr Beleidigungen zuriefen, fand eine Telefonzelle in der Nähe, wo sie das Telefonbuch von Los Angeles aufschlug und sich die Adresse der nächstgelegenen Rekrutierungsstation der Air Force heraussuchte.
Dort erklärte man ihr das Gleiche – dass sie Erfahrung in den Staaten sammeln müsste, bevor man sie nach Vietnam ziehen lassen könnte.
Bei der Rekrutierungsstelle der Army hörte sie endlich, was sie hören wollte: Selbstverständlich, Ma’am. Das Army Nurse Corps braucht Krankenschwestern. Wir könnten Sie nach dem Basistraining direkt rausschicken.
Frankie unterschrieb auf der gepunkteten Linie und war von da an ganz einfach Second Lieutenant Frances McGrath.
Kapitel 3
Als Frankie auf die Insel zurückkam, gingen gerade die Straßenlaternen an. Downtown Coronado war mit Girlanden und Lichtern festlich geschmückt, vor einigen Geschäften standen weißbärtige, rotgewandete Weihnachtsmänner. An den über die Straße gespannten Seilen baumelten beleuchtete Schneeflocken.
Zu Hause fand Frankie ihre Eltern schon zum Dinner gekleidet vor. Dad stand an der Bar und blätterte in der Zeitung, während Mom in ihrem Lieblingssessel am Feuer saß, eine Zigarette rauchte und einen Graham-Greene-Roman las. Das Haus war weihnachtlich geschmückt mit einer verschwenderischen Vielzahl an Lichtern und einem drei Meter hohen Baum.
Als Frankie hereinkam, faltete Dad seine Zeitung zusammen und lächelte ihr zu. »Hallo, Schätzchen.«
»Ich möchte euch etwas erzählen«, platzte Frankie aufgeregt heraus.
»Du hast einen Jungen kennengelernt, der dir gefällt«, sagte Mom und legte ihr Buch weg. »Endlich.«
Frankie stutzte. »Einen Jungen? Nein.«
»Frances, die meisten Mädchen in deinem Alter …«, begann Mom stirnrunzelnd.
Doch Frankie fiel ihr ungeduldig ins Wort: »Ich möchte euch etwas ganz Wichtiges erzählen.« Dann holte sie tief Luft und sagte: »Ich bin dem Army Nurse Corps beigetreten. Jetzt bin ich Second Lieutenant McGrath und werde nach Vietnam gehen. Und ich kann zumindest für einen Teil seiner Stationierungszeit mit Finley zusammen sein!«
»Darüber macht man keine Scherze, Frances«, sagte Mom.
Auch Dad starrte Frankie mit ernstem Gesicht an. »Ich habe nicht den Eindruck, dass das ein Scherz sein soll, Bette.«
»Du hast dich der Armee angeschlossen?«, fragte Mom sehr langsam, als versuche sie, Worte in einer Fremdsprache richtig auszusprechen.
»Ja, und ich würde salutieren, wenn ich schon wüsste, wie das geht. In drei Wochen beginnt das Basistraining. In Fort Sam Houston.«
Frankie verzog das Gesicht. Warum gratulierten ihre Eltern ihr nicht zu ihrem Entschluss? »Die McGraths und die Alexanders gehen doch alle zum Militär«, sagte sie. »Als Finley sich gemeldet hat, wart ihr begeistert.«
»Die Männer gehen zum Militär«, erwiderte Dad scharf. »Die Männer.« Dann hielt er inne. »Warte. Hast du Army gesagt? Wir sind seit jeher eine Marine-Familie. Coronado ist eine Marine-Insel.«
»Ich weiß, aber die Navy lässt mich nicht nach Vietnam, ohne dass ich vorher zwei Jahre hier in den Staaten in einem Krankenhaus gedient habe«, erklärte sie. »Das Gleiche bei der Air Force. Sie haben gesagt, ich hätte nicht genügend Erfahrung. Nur die Army lässt mich sofort nach der Grundausbildung gehen.«
»Herr des Himmels, Frankie«, sagte Dad und fuhr sich durch die Haare. »Für solche Regelungen gibt es doch Gründe.«
»Nimm deine Anmeldung zurück, sofort.« Mom sah Dad an und stand langsam auf. »Guter Gott, wie sollen wir das den Leuten erklären?«
»Was werdet ihr …« Frankie verstand das alles nicht. Ihre Eltern benahmen sich, als wäre sie ein Grund zur Scham. Aber … das ergab doch keinen Sinn. »Wie oft hast du uns in deinem Büro versammelt, um über die militärische Vergangenheit dieser Familie zu sprechen, Dad? Du hast uns erzählt, wie sehr du dir gewünscht hast, für dein Land kämpfen zu können. Ich dachte …«
»Er ist ein Mann«, fiel Mom ihr ins Wort. »Und es ging um Hitler. Nicht um irgendein Land, das niemand auf einer Landkarte findet. Dummheiten sind keineswegs patriotisch, Frances.« Sie hatte Tränen in den Augen, wischte sie jedoch hastig weg. »Nun, Connor, du hast es ihr beigebracht. Jetzt glaubt sie daran. Eine echte Patriotin.«
Auf Moms Vorwurf hin verließ Dad den Raum schäumend vor Wut.
Frankie ging zu ihrer Mutter und wollte ihre Hand nehmen, aber Mom trat flink beiseite.
»Mom?«
»Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass dein Vater dir den Kopf mit solchen Geschichten vollstopft. Bei ihm klang das alles so … so heroisch, diese ganzen Kriegsanekdoten. Obwohl ja keine davon aus seiner eigenen Familie stammte, nicht wahr? Er konnte nicht zum Militär, deshalb ist es … ach, Herrgott noch mal, das ist doch jetzt sowieso alles egal.« Sie wandte den Blick ab. »Ich weiß noch, wie mein Vater aus dem Krieg nach Hause kam, ein gebrochener Mann. Mühsam wieder zusammengeflickt. Er hatte schlimme Alpträume. Nur deshalb ist er so früh gestorben.« Ihre Stimme brach. »Und du glaubst, du gehst einfach da rüber, um ein paar Abenteuer mit deinem Bruder zu erleben? Wie kannst du nur so dumm sein?«
»Ich bin Krankenschwester, Mom, kein Soldat. Der Rekrutierer hat gemeint, ich werde in einem großen Krankenhaus stationiert, weit weg von der Front. Und er hat versprochen, dass ich Finley zu sehen kriege.«
»Und du hast ihm geglaubt?« Mom zog lange an ihrer Zigarette. Frankie sah, wie ihre Hand zitterte. »Es ist also endgültig?«
»Ja. Im Januar melde ich mich beim Basistraining, und im März nehme ich das Schiff. Zu meinem Geburtstag nächste Woche und zu Weihnachten bin ich zu Hause, dafür habe ich gesorgt. Ich weiß ja, wie wichtig das für dich ist.«
Mom biss sich auf die Lippe, und Frankie sah, dass ihre Mutter sich bemühte, gelassen zu wirken. Plötzlich jedoch nahm sie Frankie in den Arm, zog sie so fest an sich, dass Frankie kaum noch Luft bekam.
Frankie schmiegte sich an sie und vergrub ihr Gesicht in Moms auftoupiertem, mit reichlich Haarspray behandeltem Haar. »Ich liebe dich, Mom«, flüsterte sie.
Irgendwann ließ Mom sie wieder los, wischte sich die Tränen weg und sah Frankie fest in die Augen. »Versuch bloß keine Heldin zu werden, Frances Grace. Es ist mir vollkommen gleichgültig, was man dir beigebracht hat oder welche Geschichten dein Vater dir erzählt hat. Verhalte dich unauffällig und sorge dafür, dass du in Sicherheit bleibst. Hörst du?«
»Versprochen. Ich komme klar.«
Es klingelte an der Tür.
Ein ferner Laut, kaum hörbar zwischen all den unausgesprochenen Worten, die in der Stille zwischen ihnen umherschwirrten.
Mom blickte zur Seite, in Richtung Diele. »Wer in aller Welt kann das denn sein?«
»Ich gehe schon«, sagte Frankie.
Sie ließ ihre Mutter allein im Wohnzimmer stehen. In der Eingangshalle ging sie um den glänzenden Palisanderholztisch herum, den eine große weiße Orchidee schmückte, und öffnete die Tür.
Auf der Schwelle standen zwei Marineoffiziere in Paradeuniform.
Ihr ganzes bisheriges Leben hatte Frankie auf Coronado Island gelebt, hatte beobachtet, wie Jets und Helikopter über sie hinwegdonnerten und Matrosen in Reih und Glied am Strand entlangmarschierten. Bei jeder Party oder sonstigen Zusammenkunft erzählte jemand eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg oder dem Koreakrieg. Auf dem Stadtfriedhof gab es reichlich Gräber von Männern, die Coronado im Krieg verloren hatte.
Deshalb wusste Frankie genau, was es bedeutete, wenn Offiziere vor der Haustür standen. »Bitte«, flüsterte sie, obwohl sie die Tür am liebsten schnell wieder geschlossen hätte.
Hinter sich hörte sie Schritte, Absätze auf Hartholz. »Frances?«, sagte Mom und stellte sich neben sie. »Was …?«
Dann sah auch sie die beiden Offiziere und holte tief Luft.
»Tut mir leid, Ma’am«, sagte der eine Offizier, nahm seine Mütze ab und klemmte sie unter seinen Arm.
Frankie fasste nach der Hand ihrer Mutter, aber Mom zog sie weg. »Kommen Sie herein«, sagte sie mit heiserer Stimme. »Sie wollen doch sicher mit meinem Mann sprechen …«
Wir bedauern, Ma’am, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ensign Finley McGrath im Einsatz gefallen ist.
Abgeschossen … in einem Helikopter …
Keine sterblichen Überreste … die gesamte Besatzung unrettbar verloren.
Auf ihre Fragen reagierten die Männer lediglich mit einem ruhigen Es ist Krieg, Sir, als sage das alles.
Frankie wusste, dass sie diesen Abend für immer in schrecklicher Erinnerung behalten würde: Dad, hoch aufgerichtet, mit zitternden Händen, ohne Emotion, bis einer der Offiziere seinen Sohn einen Helden nannte und er mit leiser Stimme nach Einzelheiten fragte – als spiele das eine Rolle -, wo ist es geschehen, wann, wie? Ihre sonst so vornehme, abgeklärte Mom, die, in ihrem Sessel kauernd, die elegante Frisur in Auflösung begriffen, bloß die Frage wiederholte: Wie kann das sein, Connor, du hast doch gesagt, das ist eigentlich gar kein richtiger Krieg.
Ihre Eltern bemerkten wohl nicht, wie Frankie das Haus verließ, den Ocean Boulevard überquerte und sich in den kühlen Sand setzte.
Wie war er abgeschossen worden? Was hatte er als Adjutant überhaupt in einem Helikopter zu suchen? Und was bedeutete die Behauptung, es gebe keine sterblichen Überreste? Was sollten sie begraben?
Wieder kamen ihr die Tränen. Erinnerungsbilder tauchten auf. Sie und Finley hier am Strand, Hand in Hand in der Brandung. Er brachte ihr das Schwimmen bei, zeigte ihr, wie man sich auf dem Rücken treiben ließ. Im Kino schauten sie sich Psycho an, was ihre Mutter Frankie ausdrücklich verboten hatte. Finley spielte ihr bei einer Party zum 4. Juli heimlich eine Flasche Bier zu. Mit geschlossenen Augen dachte sie an ihren Bruder, an ihr gemeinsames Leben, an ihre Auseinandersetzungen und Kabbeleien. Ihr erstes Mal in Disneyland, das Fahrradfahren im Sommer, der Wettlauf zum Christbaum am Weihnachtsmorgen, bei dem er sie gewinnen ließ. Ihr großer Bruder.
Er war weg. Einfach weg.
Wie oft waren sie und Fin abends hier draußen gewesen, im Dunkeln am Strand, waren mit dem Fahrrad im Licht der Straßenlaternen nach Hause zurückgefahren, mit weit ausgestreckten Armen. Freihändig Fahrrad fahren kam ihnen damals wie ein Risiko vor.
Wie frei sie sich gefühlt hatten. Unbesiegbar.
Auf einmal hörte Frankie hinter sich leise Schritte und spürte dann, wie ihre Mom sich neben ihr niederließ. »Sie meinen, wir sollen in seinem Sarg die Stiefel und den Helm eines anderen begraben«, stieß sie nach einer Weile hervor. Ihre Unterlippe blutete leicht, sie hatte wohl zu heftig darauf herumgekaut, und sie kratzte sich an einer roten Stelle an ihrem Hals.
»Eine Beerdigung«, sagte Frankie. Daran hatte sie noch gar nicht gedacht. Schwarz gekleidete, auf Kirchenbänken kauernde Trauergäste, Father Michael, der endlos schwadronierte und womöglich lustige Anekdoten über Finleys Zeit als rebellischer Messdiener erzählte. Wie er seine Spielzeugsoldaten im Taufbecken gewaschen hatte. Wie sollten sie alle das ertragen?
Ein leerer Sarg. Keine sterblichen Überreste.
»Geh nicht«, sagte Mom leise.
»Ich bin doch hier, Mom.«
Ihre Mutter sah sie an. »Ich meine … nach Vietnam.«
Vietnam. Ein Unglückswort.
»Ich muss«, erwiderte Frankie. Seit der Nachricht über den Tod ihres Bruders hatte sie sich schon mehrmals gefragt, ob sie die Verpflichtung, die sie eingegangen war, vielleicht doch auflösen könnte, so dass sie bei ihren Eltern in Sicherheit bleiben und in Ruhe trauern konnte.
Aber es war zu spät. Sie hatte sich verpflichtet, sie konnte ihr Wort nicht brechen.
»Ich habe keine andere Wahl, Mom. Ich kann es nicht rückgängig machen. Gib mir deinen Segen. Bitte. Ich möchte, dass du stolz auf mich bist.«
Für den Bruchteil einer Sekunde sah Frankie den Schmerz ihrer Mutter. Sie war bleich und vollkommen erschöpft. Mit matten, leblosen blauen Augen starrte sie Frankie an. »Stolz auf dich?«
»Du musst dir keine Sorgen um mich machen, Mom. Ich werde wieder nach Hause kommen, versprochen.«
»Das waren auch die letzten Worte, die ich von deinem Bruder gehört habe.« Moms Stimme brach. Einen Moment hielt sie inne und sah aus, als wolle sie etwas sagen. Doch stattdessen stand sie auf, wandte sich von Frankie ab und ging durch den Sand zurück zum Haus.
»Tut mir leid«, flüsterte Frankie, zu leise, als dass ihre Mutter es hätte hören können, aber was spielte das für eine Rolle?
Es war zu spät für Worte.
Zu spät, irgendetwas zurückzunehmen.
Kapitel 4
Beim Basistraining brillierte Frankie. Nicht nur hatte sie gelernt, in Formation zu marschieren, im Eiltempo Kampfstiefel und Gasmaske anzuziehen, sie hatte gelernt, eine Schiene anzubringen, eine Wundtoilette durchzuführen, eine Trage zu schleppen und eine Infusion zu legen. Außerdem konnte sie schneller Verbände aufrollen als jeder andere Rekrut.
Als der März kam, war sie mehr als einsatzbereit. Ihr riesiger Seesack, in den sie ihre Schutzweste, ihren Stahlhelm, Kampfstiefel, GI-Pack, die weiße Schwesternuniform und ihre Feldjacke gestopft hatte, war gepackt und kontrolliert.
Jetzt war sie endlich unterwegs. Stunden vergingen nach der Landung auf Honolulu, dann bestieg sie als einzige Frau unter 257 uniformierten Soldaten den Jet nach Vietnam.
Im Gegensatz zu den Männern, die allesamt ihre bequeme olivfarbene Arbeitsuniform trugen, musste Frankie in ihrer formellen Uniform reisen: grüne Jacke, schmaler Rock, Nylonstrümpfe, blank polierte schwarze Pumps, flache Feldmütze. Und unter all dem ein vorschriftsmäßiges Miederhöschen, das die Strümpfe an Ort und Stelle hielt. Es war schon unbequem gewesen, als sie Texas verlassen und das Flugzeug nach Vietnam bestiegen hatte, aber jetzt, zweiundzwanzig Stunden später, war es einfach nur noch schmerzhaft. Lächerlich, dass sie keine Strumpfhose tragen durfte.
Sie stopfte ihre neue weiche Reisetasche ins Gepäckfach und suchte sich einen Fensterplatz. Doch als sie sich setzte, rutschte ein Straps aus seiner Halterung an ihrem Miederhöschen und schnippte wie ein Gummiband gegen ihren Oberschenkel. Mit einiger Mühe konnte sie ihn im Sitzen wieder befestigen.
Soldaten defilierten an ihr vorbei, lachten und plauderten, verteilten freundschaftliche Knüffe. Viele von ihnen waren ungefähr im gleichen Alter wie Frankie oder sogar jünger, die meisten von ihnen schätzte sie auf achtzehn oder neunzehn.
Ein Captain in einer fleckigen, zerknautschten Arbeitsuniform blieb an ihrer Sitzreihe stehen. »Darf ich mich zu Ihnen setzen, Lieutenant?«
»Selbstverständlich, Captain.«
Er machte es sich auf dem Sitz am Gang bequem. Trotz der Uniform sah man deutlich, wie dünn er war. Tiefe Falten durchzogen seine Wangen, sein Anzug verströmte einen vagen, unangenehm muffigen Geruch.
»Norm Bronson«, stellte er sich mit einem müden Lächeln vor.
»Frankie. McGrath. Krankenschwester.«
»Gratuliere, Frankie, wir brauchen Krankenschwestern.«
Das Flugzeug setzte sich in Bewegung, rollte ein Stück, hob sich schließlich von der Startbahn und begann den Aufstieg in die Wolken.
»Wie ist es denn so?«, fragte Frankie. »Vietnam, meine ich.«
»Mit Worten lässt sich das nicht beschreiben, Ma’am. Ich könnte Ihnen den ganzen Tag erzählen, wie es ist, und Sie wären trotzdem nicht darauf vorbereitet. Aber Sie werden es schnell lernen. Passen Sie gut auf sich auf.« Er lehnte sich zurück und schloss die Augen.
Noch nie hatte Frankie jemanden so schnell einschlafen sehen.
Sie fasste in ihre schwarze Army-Handtasche, zog ihre Informationsmappe heraus und studierte sie zum tausendsten Mal. Wiederholung und Wissen hatten sie schon immer beruhigt, und sie war entschlossen, als Soldatin ebenso vorbildlich zu sein wie als Studentin. Nur so würde sie ihre Eltern davon überzeugen können, dass es klug von ihr gewesen war, sich zum Militärdienst zu verpflichten, vielleicht sogar mutig.
Sie hatte sich die Lage sämtlicher Militärstützpunkte und Krankenhäuser eingeprägt und auf ihrer Vietnam-Karte gelb unterstrichen. Auch den Verhaltenskodex hatte sie sich zu Gemüte geführt. Die Regeln fürs Benehmen und die Sicherheit vor Ort, wie man sich zu kleiden und mit Feuerwaffen umzugehen hatte, dass man stets ein stolzer und ehrenhafter Soldat zu sein hatte.
Für sie ergab alles in der Army einen Sinn. Regeln existierten aus guten Gründen, und man befolgte sie, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und um einander zu helfen. Das System war dazu bestimmt, die Soldaten – Männer und Frauen – zur Konformität zu zwingen und zuverlässige Teams aufzubauen. Angeblich konnte das für jeden Einzelnen lebensrettend sein. Sich anzupassen, ein Teil von etwas Größerem zu werden, den eigenen Job gut zu machen, ohne ihn zu hinterfragen – mit all dem fühlte Frankie sich wohl.
Wie sie ihrer Mutter immer wieder erklärt hatte, zog sie zwar in den Krieg, aber nicht wirklich, nicht wie die Männer in diesem Flugzeug. Sie würde nicht an der Front stehen, niemand würde auf sie schießen. Sie ging nach Vietnam, um Leben zu retten, nicht, um ihr eigenes aufs Spiel zu setzen. Militärkrankenschwestern arbeiteten in großen hellen Gebäuden, beispielsweise in dem riesigen 3rd Field Hospital in Saigon, das von hohen Zäunen geschützt war und weit von den Kampfhandlungen entfernt lag.
Frankie lehnte sich zurück und schloss die Augen, ließ sich vom Brummen der Motoren einlullen und beruhigen. Sie hörte das Stimmengewirr der Männer, die redeten, lachten, das Zischen, wenn eine Colaflasche geöffnet wurde, den Geruch der Sandwiches, die verteilt wurden. Sie stellte sich vor, Finley wäre bei ihr im Flugzeug und würde ihre Hand halten; für den Bruchteil einer Sekunde vergaß sie, dass er nicht mehr da war, und lächelte. Bald sehen wir uns, dachte sie, doch dann verblasste ihr Lächeln.
Als sie langsam in den Schlaf hinüberglitt, glaubte sie, Captain Bronson murmeln zu hören: »… schicken lauter Kinder in den Krieg …«
Als Frankie wieder aufwachte, war es in der Flugzeugkabine abgesehen vom Summen der Motoren ganz still. Die meisten Fensterjalousien waren heruntergezogen, ein paar Deckenlampen tauchten die dicht zusammensitzenden Männer in ein düsteres Halblicht.
Das Herumalbern, das Lachen, der Klamauk, alles, was die meiste Zeit dieses Flugs von Honolulu bis Saigon geprägt hatte, war verstummt. Die Luft schien dicker, das Atmen schwerer. Die neuen Rekruten – zu erkennen an den Bügelfalten in ihren grünen Arbeitsuniformen – waren unruhig. Verunsichert. Frankie bemerkte, wie sie einander ansahen, ihr Lächeln seltsam verkrampft. Die anderen Soldaten, jene müde wirkenden Männer in ihren abgetragenen Uniformen, Männer wie Captain Bronson, wirkten fast allzu still.
Neben Frankie öffnete der Captain die Augen, ohne einen Mucks zu machen.
Plötzlich geriet das Flugzeug ins Schlingern und schien sich auf die Seite zu legen. Dann ging es in den Sturzflug, und Frankie knallte mit dem Kopf gegen die Rückseite des Sitzes vor ihr. Die Gepäckfächer öffneten sich, Dutzende Taschen purzelten in den Gang herunter, auch Frankies.
Beruhigend legte Captain Bronson seine raue, knotige Hand auf die von Frankie, die krampfhaft die Armlehne umklammerte. »Wird schon schiefgehen, Lieutenant.«
Der Flugzeug wurde langsamer, stabilisierte sich, ruckelte steil nach oben. Frankie hörte ein Knallen, und neben ihr zerbrach etwas.
»Schießt jemand auf uns?«, fragte sie entsetzt. »O mein Gott!«
Captain Bronson lachte leise. »Ja. Das machen sie gern. Keine Sorge. Wir werden einfach eine Weile kreisen und es dann noch mal probieren.«
»Hier? Sollten wir nicht lieber anderswo landen?«
»Mit diesem großen Vogel? Nein, nein. Wir landen auf dem Tan-Son-Nhat, dort warten sie schon auf die FNGs, die wir an Bord haben.«
»FNGs?«
»Na, auf die Fucking New Guys, das Frischfleisch.« Er grinste. »Und natürlich auch auf eine hübsche junge Krankenschwester. Unsere Männer werden den Flughafen im Handumdrehen freiräumen. Kein Grund zur Beunruhigung.«
Das Flugzeug kreiste so lange, dass Frankies Finger vom Umklammern der Armlehne schmerzten. Draußen sah sie leuchtende Explosionen, überall am dunklen Himmel rote Streifen.
Schließlich pendelte sich das Flugzeug wieder ein, und die Stimme des Piloten kam über den Lautsprecher: »Okay, Sportsfreunde, versuchen wir es noch mal. Schnallt euch an.«
Als hätte Frankie auch nur darüber nachgedacht, ihren Sicherheitsgurt abzulegen.
Der Jet senkte sich. In Frankies belegten Ohren knackte es, und ehe sie recht wusste, was geschah, donnerte das Flugzeug auch schon über die Landebahn, verlangsamte, rollte aus und blieb schließlich stehen.
»Ranghohe Offiziere und Frauen steigen zuerst aus«, erklang eine Stimme aus dem Lautsprecher.
Die Offiziere warteten, dass Frankie sich als Erste auf den Weg machen würde. Es war ihr extrem unangenehm, doch sie griff sich trotzdem ihre Reisetasche aus dem Gang und warf sie zusammen mit ihrer Handtasche über die linke Schulter, damit sie die rechte Hand zum Salutieren frei hatte.
Als sie aus dem Flugzeug trat, hüllte die Hitze sie sofort ein. Und der Geruch. Himmel, was war das denn bloß? Benzin … Rauch … Fisch … und ohne Zweifel auch etwas wie Kot. Hinter ihren Augen machte sich Kopfschmerz breit. Sie ging die Treppe hinunter, an deren Fuß in der Dunkelheit ein einzelner Soldat stand, den das Licht irgendeines fernen Gebäudes von hinten beleuchtete. Sein Gesicht konnte sie kaum sehen.
Links explodierte in der Ferne etwas und ging in orange Flammen auf.
»Lieutenant McGrath?«
Frankie konnte nur nicken. Schweißtropfen liefen ihr über den Rücken. Wurde dort etwa bombardiert?
»Folgen Sie mir«, sagte der Soldat und führte sie über die holprige, pockennarbige Landebahn, vorbei am Terminal und zu einem schwarz lackierten Schulbus. Selbst die Fensterscheiben waren geschwärzt und außerdem noch mit einem hasendrahtartigen Geflecht bedeckt. »Sie sind die einzige Krankenschwester, die heute angekommen ist. Setzen Sie sich und warten Sie. Aber bitte verlassen Sie den Bus nicht, Ma’am.«
Im Bus war es so heiß wie in einer Sauna, und der Geruch – Exkremente plus Fisch – brachte sie zum Würgen. Sie setzte sich auf einen Platz in der mittleren Reihe, an einem der schwarz lackierten Fenster. Sie kam sich vor wie in einem Grab.
Kurz darauf kletterte ein schwarzer Soldat in Arbeitsuniform und mit einer M16 über der Schulter auf den Fahrersitz. Mit einem Zischen schlossen sich die Türen, die Scheinwerfer gingen an und schnitten in die vor ihnen liegende Dunkelheit einen goldenen Spalt.
»Nicht zu nahe ans Fenster, Ma’am«, sagte der Mann und gab Gas. »Wegen der Granaten.«
Granaten?
Frankie rutschte ein Stück zur Seite, weg vom Fenster, richtete sich in der übelriechenden Hitze kerzengerade auf und ließ sich auf ihrem Sitz durchrütteln. Nach kurzer Zeit war ihr so übel, dass sie fürchtete, sich übergeben zu müssen.
Endlich wurde der Bus langsamer, und im grellen Licht der Scheinwerfer sah Frankie ein von amerikanischem Militär bewachtes Tor. Einer der Wachposten redete mit dem Fahrer und zog sich dann zurück. Das Tor ging auf, sie fuhren hindurch.
Wenig später stoppte der Bus erneut. »Bitte sehr, Ma’am.«
Inzwischen schwitzte Frankie so heftig, dass sie sich den Schweiß aus den Augen wischen musste. »Wie bitte?«
»Hier steigen Sie aus, Ma’am.«
»Was? Oh.«
Auf einmal fiel ihr ein, dass sie gar nicht zur Gepäckausgabe gegangen war und demzufolge auch ihren Seesack nicht geholt hatte. »Mein Gepäck …«
»Das wird Ihnen gebracht, Ma’am.«
Also sammelte Frankie ihre Handtasche und ihre Reisetasche ein, ging zur Tür des Busses und spähte hinaus.
Draußen, im Schlamm vor dem Eingang eines großen Klinikgebäudes, stand eine von der Haube bis zu den Schuhen weiß gekleidete Krankenschwester und erwartete sie. Wie um alles in der Welt konnte man eine solche Uniform sauber halten?
»Sie müssen hier aussteigen, Ma’am«, sagte der Fahrer.
»Oh. Ja.« Langsam kletterte Frankie in den dicken Schlamm hinunter und machte Anstalten zu salutieren.
Doch die weiß gekleidete Schwester packte unsanft ihr Handgelenk und hielt es fest. »Nicht hier. Die Charlies lieben es, Offiziere zu töten«, erklärte sie und deutete dann auf einen wartenden Jeep. »Er bringt Sie zu Ihrer vorläufigen Unterkunft. Melden Sie sich morgen für die weitere Abwicklung um null-siebenhundert bei der Verwaltung.«
In Frankies Kopf kreisten zu viele Fragen, als dass sie sich für eine davon hätte entscheiden können, außerdem tat ihr der Hals weh. Sie umklammerte ihr Gepäck, ging hinüber zu dem Jeep und kletterte auf den Rücksitz.
Der Fahrer trat augenblicklich aufs Gaspedal, so hart, dass Frankie auf ihrem Sitz zurückgeschleudert wurde. Der Abendverkehr im Stützpunkt war extrem zäh. An einigermaßen gut beleuchteten Stellen erhaschte Frankie kurze Ausblicke auf Stacheldraht, vor Holzgebäuden gestapelte Sandsäcke, bewaffnete Posten auf Türmen. Auf Soldaten, die in Arbeitsuniform, das Gewehr im Arm, durch die Straßen liefen. Ein großer Wassertanklaster bremste rumpelnd neben ihnen und rollte dann an ihnen vorbei. Ständig wurde gehupt, Männer schrien sich an.
Kurz darauf ein weiterer Kontrollpunkt – scheinbar planlos aus Metallfässern, Stacheldrahtrollen und einem großen Maschendrahtzaun zusammengeschustert. Der Wachposten winkte den Jeep durch.
Schließlich gelangten sie an einen weiteren Zaun, diesmal mit Stacheldraht versehen.
Der Jeep bremste und hielt, der Fahrer beugte sich hinüber und öffnete ihre Tür. »Hier steigen Sie aus, Ma’am.«
Frankie runzelte die Stirn. Es dauerte, bis sie sich in ihrem engen Rock aus dem Jeep ins Freie manövriert hatte. »In diesem Gebäude, Ma’am. Zweiter Stock, 8 A.«
Hinter dem großen Metallzaun entdeckte Frankie ein Bauwerk, das aussah wie ein verlassenes Gefängnis. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt, große Stücke der Mauer fehlten. Ehe sie sich genauer erkundigen konnte, wohin sie gehen sollte, rangierte der Jeep bereits zurück, hupte kurz und bretterte davon.
Da ihr nichts anderes übrig blieb, ging sie zum Tor, das beim Öffnen laut quietschte, und trat auf einen völlig überwachsenen Hof, in dem abgemagerte Kinder mit einem ziemlich schlappen Ball spielten. Am Zaun hockte eine alte vietnamesische Frau und brutzelte etwas über einem offenen Feuer.
Ein defekter Plattenweg führte zur Haustür, Frankie folgte ihm und betrat das Gebäude. Drinnen warfen ein paar Gaslaternen flackerndes Licht an die Wand. Im Halbdunkel des Eingangsbereichs wartete eine Frau in Arbeitsuniform auf sie. »Lieutenant McGrath?«
Gott sei Dank. »Ja.«
»Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Folgen Sie mir.« Die Frau ging voraus durch einen Korridor voller Pritschen, eine durchhängende Treppe hinauf zu einem Zimmer im ersten Stock – genauer gesagt zu einer Kammer, die kaum groß genug war, um die Pritschen und die einsame Kommode zu beherbergen. Vielleicht war das Haus früher einmal ein Kloster oder eine Schule gewesen. »Weitere Abwicklung morgen um null-siebenhundert. Melden Sie sich bei der Verwaltung.«
»Aber …«
Die Soldatin drehte sich um, verließ die Kammer und schloss die Tür hinter sich.
Dunkelheit.
Frankie tastete nach einem Lichtschalter, fand ihn und drückte darauf.
Nichts passierte.
Sie öffnete die Tür wieder, dankbar für das bisschen Licht, mit dem die Gaslaternen den Korridor beleuchteten. Sie fand ein Badezimmer mit einem rostfleckigen Waschbecken und einer Toilette. Als sie den Hahn anstellte, kam zögernd ein schwacher Strahl lauwarmes Wasser, mit dem sie sich das Gesicht wusch und dann ein paar Schlucke davon trank.
Eine Frau in einem armeegrünen T-Shirt und Shorts kam herein, entdeckte Frankie und runzelte die Stirn. »Das werden Sie bereuen, Lieutenant. Trinken Sie niemals das Wasser.«
»Oh. Ich bin neu … in Vietnam.«
»Ja«, sagte die Frau und beäugte Frankie in ihrer Uniform. »Das sieht man.«
Mitten in der Nacht erwachte Frankie mit Magenkrämpfen. Sie rannte den Korridor hinunter zur Toilette und warf die Tür hinter sich zu. Noch nie im Leben hatte sie solchen Durchfall gehabt, ein Gefühl, als ströme alles, was sie im letzten Monat gegessen hatte, einfach aus ihr heraus. Leider hörten die Krämpfe nicht auf, als nichts mehr da war.
Auch die Morgendämmerung brachte keine Besserung. Frankie sah auf die Uhr, rollte sich zusammen und schlief wieder ein. Um null sechshundertdreißig stand sie mit wackligen Beinen auf, kaum imstande, ihre Uniform zuzuknöpfen. Das Miederhöschen war die reinste Folter.
Draußen auf dem Hof wimmelte es von vietnamesischen Kindern, die sie anstarrten. Auf einer Wäscheleine hingen Dutzende grüner Arbeitsuniformen.
Frankie schob das Tor auf und bewegte sich schwerfällig durch den weitläufigen Stützpunkt, eine wilde Sammlung von Gebäuden, Zelten, Schuppen und Straßen; nirgends war ein Baum zu sehen. Offensichtlich hatten Bulldozer das Areal gerodet. Mit kompletten Familien besetzte Fahrradtaxis, von Wasserbüffeln gezogene alte Autos und Dutzende Army-Fahrzeuge wetteiferten darum, möglichst rasch an ihr jeweiliges Ziel zu kommen. Ein Jeep rumpelte an ihr vorbei durch den Schlamm, und der Fahrer versuchte, mit lautem Hupen die Kinder am Straßenrand ebenso zu vertreiben wie die dort entlangtrottenden Wasserbüffel.
Niemand würdigte die Frau eines Blickes, die sich langsam und in der Hoffnung, sich nicht übergeben zu müssen, in ihrer Paradeuniform die Straße entlangschleppte.
Nach knapp einer Stunde hatte sie endlich die Verwaltung gefunden, die im weitläufigen 3rd Field Hospital gleich neben der Station A untergebracht war, wo kleine Gruppen von Krankenschwestern in gestärkten weißen Uniformen umherwuselten. Aus schwarzen Lautsprechern dröhnten pausenlos Durchsagen.
Frankie klopfte, hörte ein »Herein« und betrat den Raum.
Im Büro salutierte sie vor dem Colonel, einer dünnen Frau, die hinter ihrem Schreibtisch saß.
Die Frau blickte auf und hob das Kinn mit einer scharfen, vogelgleichen Bewegung, die ihre Schmetterlingsbrille aus dem Gleichgewicht brachte. Der tiefe Seufzer, mit dem sie Frankies Eintreten kommentierte, war alles andere als ermutigend. »Und Sie sind?«
»Second Lieutenant Frances McGrath, Colonel.«
Die Frau blätterte einen Papierstapel durch. »Sie sind dem Thirty-Sixth Evacuation Hospital zugewiesen worden. Folgen Sie mir.« Damit erhob sie sich energisch und marschierte an Frankie vorbei zur Tür.
Frankie gab sich größte Mühe, Schritt zu halten, und hoffte inständig, keine weiteren Bauchkrämpfe zu bekommen.
Die Offizierin führte sie durch das Gedränge des Klinikpersonals zu einem runden weißen Helikopterlandeplatz mit einem roten Kreuz, wo bereits ein Hubschrauber auf sie wartete. Dort gab sie dem Piloten mit hochgerecktem Daumen das Zeichen, den Motor anzulassen. Die riesigen Rotorblätter kreisten langsam, wurden schneller und schmetterten Frankie heiße Luft ins Gesicht.
»Ich habe … mehrere Fragen, Colonel«, stotterte sie.
»Aber nicht für mich, Lieutenant. Los, der Flieger hat nicht den ganzen Tag Zeit für Sie.«
Mit einer entschlossenen Handbewegung drückte sie Frankies Kopf nach unten und schob sie geduckt in Richtung des surrenden Helikopters.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: