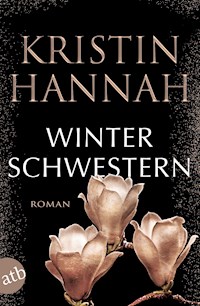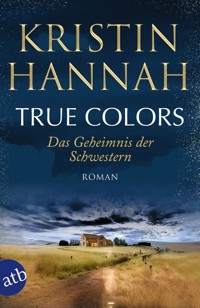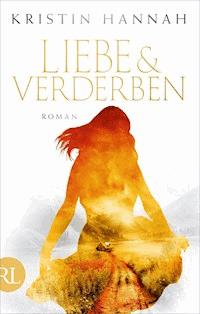
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich bin hier und werde niemals aufhören, auf Dich zu warten.
Als Lenora Allbright mit ihren Eltern nach Alaska zieht, ist die Familie voller Hoffnung, das Trauma des Krieges, das der Vater in Vietnam davongetragen hat, hinter sich zu lassen. In Matthew, dem Sohn der Nachbarn, findet Leni einen engen Freund, und aus ihrer Vertrautheit entwickelt sich bald eine junge Liebe. Doch auf die Schönheit des Sommers in Alaska folgt unweigerlich die Finsternis des Winters, und je länger diese andauert, desto weniger vermag Lenis Vater die in ihm wohnenden Dämonen zu bändigen. Schon bald müssen die beiden jungen Liebenden um ihr Miteinander kämpfen – bis sie eines Tages auszubrechen versuchen …
Mit emotionaler Wucht erzählt Kristin Hannah eine große Geschichte über unsere Verletzlichkeit, wenn wir zum ersten Mal lieben, über die dunklen Seiten der Liebe und über die niemals endende Verbundenheit zwischen einer Mutter und ihrem Kind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Kristin Hannah
Kristin Hannah, geboren 1960 in Südkalifornien, arbeitete als Anwältin, bevor sie zu schreiben begann. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Autorinnen der USA und lebt mit ihrem Mann im Pazifischen Nordwesten der USA. Nach zahlreichen Bestsellern war es ihr Roman »Die Nachtigall«, der Millionen von Lesern in über vierzig Ländern begeisterte und zum Welterfolg wurde.
Gabriele Weber-Jarić lebt als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Sie übertrug u.a. Kristin Hannah, John Boyne, Mary Morris und Mary Basson ins Deutsche.
Informationen zum Buch
Ich bin hier und werde niemals aufhören, auf Dich zu warten.
1974: Als Lenora Allbright mit ihren Eltern nach Alaska zieht, ist die Familie voller Hoffnung, das Trauma des Krieges, das der Vater in Vietnam davongetragen hat, hinter sich zu lassen. In Matthew, dem Sohn der Nachbarn, findet Leni einen engen Freund, und aus ihrer Vertrautheit entwickelt sich bald eine junge Liebe. Doch auf die Schönheit des Sommers in Alaska folgt unweigerlich die Finsternis des Winters, und je länger diese andauert, desto weniger vermag Lenis Vater die in ihm wohnenden Dämonen zu bändigen. Schon bald müssen die beiden jungen Liebenden um ihr Miteinander kämpfen – bis sie eines Tages auszubrechen versuchen …
Mit emotionaler Wucht erzählt Kristin Hannah eine große Geschichte über unsere Verletzlichkeit, wenn wir zum ersten Mal lieben, über die dunklen Seiten der Liebe und über die niemals endende Verbundenheit zwischen einer Mutter und ihrem Kind.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kristin Hannah
Liebe & Verderben
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Weber-Jarić
Inhaltsübersicht
Über Kristin Hannah
Informationen zum Buch
Newsletter
1974
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
1978
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
1986
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Dank
Impressum
Leseprobe aus: Michelle Marly – Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe
Für die Frauen in meiner Familie, die alle Kämpferinnen sind: Sharon, Debbie, Laura, Julie, Mackenzie, Sara, Kaylee, Toni, Jacqui, Dana, Leslie, Katie, Joan, Jerrie, Lin, Courtney und Stephanie.
Und für Braden, unseren jüngsten Abenteurer.
Die Natur betrügt uns nie. Wir sind es immer, die wir uns selbst betrügen.
Jean-Jacques Rousseau
1974
Kapitel eins
In jenem Frühjahr kam der Regen in so schweren Sturmböen, dass er an den Dächern der Häuser riss und lärmte. Das Wasser drang bis in die kleinsten Ritzen und untergrub noch die stärksten Fundamente. Land, das die sichere Heimat mehrerer Generationen gewesen war, brach auf und häufte sich zu Schlackebrocken auf den tieferliegenden Straßen, riss Häuser und Autos und Swimmingpools mit sich. Bäume stürzten um, krachten auf Stromleitungen. Flüsse traten über ihre Ufer, überfluteten Gärten und zerstörten Häuser. Menschen, die einander liebten, gerieten in Streit miteinander. Unterdessen fiel der Regen unablässig, und das Wasser stieg weiter.
Leni war nervös. Sie war neu in der Schule, nur ein unbekanntes Gesicht in der Menge – ein rothaariges Mädchen mit Mittelscheitel, das keine Freunde hatte und jeden Tag allein zur Schule ging.
Sie saß auf ihrem Bett, die Knie umschlungen, die mageren Schenkel an die flache Brust gedrückt. »Unten am Fluss« lag aufgeschlagen neben ihr, eine Taschenbuchausgabe voller Eselsohren. Durch die dünnen Wände des Hauses hörte sie ihre Mutter sagen: Ernt, Baby, bitte nicht. Hördoch …
Dann die verärgerte Stimme ihres Vaters: Lass mich zufrieden, verdammt noch mal.
Es ging wieder los. Das Streiten. Das Gebrüll.
Bald würde es Tränen geben.
Wetter wie dieses brachte die dunkle Seite ihres Vaters zum Vorschein.
Leni schaute auf die Uhr an ihrem Bett. Wenn sie sich jetzt nicht auf den Weg machte, käme sie zu spät zur Schule. Sie würde auffallen, und das war das Einzige, was noch schlimmer war, als auf der Mittelschule die Neue zu sein. Zu dieser Erkenntnis war sie auf die harte Tour gelangt. In den letzten vier Jahren war sie auf fünf Schulen gewesen, und auf keiner war es ihr geglückt dazuzugehören. Doch sie gab nicht auf und hoffte noch immer, dass sie es eines Tages schaffen würde. Sie atmete tief durch und stand auf. Leise verließ sie ihr karg möbliertes Zimmer und überquerte den Flur. An der geöffneten Küchentür blieb sie stehen.
»Herrgott, Cora«, sagte Dad. »Du weißt doch, wie schwer es für mich ist.«
Ihre Mutter machte einen Schritt auf ihn zu und streckte die Hand nach ihm aus. »Du brauchst Hilfe, Baby. Es ist nicht deine Schuld. Die Alpträume –«
Leni räusperte sich, um auf sich aufmerksam zu machen. »Hey«, sagte sie.
Ihr Vater entdeckte sie und trat einen Schritt von Mom zurück. Leni erkannte, wie müde er aussah, wie abgekämpft.
»Ich … ich muss zur Schule«, sagte Leni.
Mom griff in die Brusttasche ihrer rosafarbenen Kellnerinnenuniform und holte ein Päckchen Zigaretten heraus. Sie wirkte erschöpft. Hinter ihr lag die Spätschicht und vor ihr die Mittagsschicht. »Lauf los, Leni. Sonst kommst du zu spät.« Ihre Stimme war ruhig, sanft und ebenso zart, wie sie selbst es war.
Leni wollte weder bleiben noch gehen, das eine wäre so unerfreulich wie das andere. Es war sonderbar, vielleicht sogar ein bisschen albern, aber manchmal kam es ihr vor, als wäre sie der ausgleichende Ballast, der das schlingernde Allbright-Schiff auf Kurs hielt, fast so etwas wie die einzige Erwachsene in ihrer Familie. Ihre Mutter war seit geraumer Zeit auf der Suche nach sich selbst. In den vergangenen Jahren war sie allen möglichen Theorien gefolgt, um ihr Entwicklungspotenzial auszuschöpfen, wie sie es nannte. Sie hatte es mit Überlebenstraining versucht und mit dem Human Potential Movement, mit spiritueller Unterweisung, auch mit Unitarismus. Sogar mit dem Buddhismus. Überall hatte sie mitgemacht und sich das Beste für ihre Selbstfindung herausgepickt. Nach Lenis Eindruck waren es vor allem T-Shirts und markige Phrasen, die sie mitgenommen hatte. Sätze wie Was ist, ist, und was nicht ist, ist nicht. Letztlich schien nichts davon einen Unterschied zu machen.
»Geh«, sagte Dad.
Leni nahm ihren Rucksack vom Küchenstuhl und lief zur Haustür hinaus. Als sie hinter ihr ins Schloss fiel, begann es drinnen von neuem.
Herrgott, Cora–
Bitte, Ernt, hör mir zu–
So war es nicht immer gewesen. Zumindest behauptete das ihre Mutter. Vor dem Krieg seien sie glücklich gewesen, sagte sie, damals, als sie in Kent im Wohnwagenpark wohnten und Dad eine gute Stelle als Mechaniker und Mom stets ein Lachen auf den Lippen getragen und beim Kochen zu »Piece of My Heart« getanzt hatte. In Lenis Erinnerung an diese Zeit war nur noch das Bild ihrer tanzenden Mutter lebendig.
Dann wurde ihr Vater eingezogen. Er ging nach Vietnam, wo er kurz darauf abgeschossen und gefangen genommen wurde. Ohne ihn an ihrer Seite zu wissen, verlor Mom ihren Halt. Damals begriff Leni zum ersten Mal, wie zerbrechlich ihre Mutter war. Eine Zeitlang zogen sie umher, Leni und ihre Mutter, von Job zu Job, von Ort zu Ort, bis sie zuletzt in Oregon in einer Kommune unterkamen. Dort kümmerten sie sich um die Bienenstöcke und fertigten Lavendelsäckchen, um sie auf dem Bauernmarkt zu verkaufen. Sie demonstrierten gegen den Krieg in Vietnam, und Mom passte sich ihrem politisch engagierten Milieu an.
Als ihr Vater zurückkehrte, erkannte Leni ihn kaum wieder. Der gutaussehende, lachende Schemen ihrer kindlichen Erinnerung war ein seinen Launen hilflos ausgelieferter Mann geworden, den mal Wutanfälle plagten, dann wieder blieb er kühl und distanziert. Alles an der Kommune schien ihm verhasst zu sein, und schon bald zogen sie fort. Und wieder fort. Und wieder. Und nie war etwas so, wie er es haben wollte.
Nachts konnte er nicht schlafen, am Tage konnte er keinen seiner Jobs behalten, obwohl Mom schwor, dass er der beste Mechaniker sei, den es je gegeben habe.
Darüber hatten sie und er an diesem Morgen gestritten. Ihm war wieder einmal gekündigt worden.
Leni zog sich die Kapuze ihrer Jacke über den Kopf. Auf ihrem Schulweg lief sie durch Straßen mit gepflegten Häusern und machte einen Bogen um ein dunkles Gehölz; von dem musste sie sich fernhalten, man wusste nie, was einem dort zustoßen konnte. Sie kam an dem Fastfood-Restaurant vorbei, wo die Schüler der Highschool sich am Wochenende trafen, und an einer Tankstelle, wo die Autos in einer Schlange darauf warteten, Benzin für vierzig Cent den Liter zu tanken. Das war etwas, was die Gemüter aller erregte – die hohen Benzinpreise.
Eigentlich waren ohnehin alle Erwachsenen unentwegt gereizt, jedenfalls empfand Leni es so. Und es war auch kein Wunder. Der Vietnamkrieg hatte das Land gespalten. Tag für Tag verkündeten die Schlagzeilen der Zeitungen neue Grausamkeiten: Mal waren es Bombenanschläge der linksradikalen Weathermen, dann wieder die der IRA, Flugzeuge wurden genauso entführt wie Menschen, etwa die Erbin Patty Hearst, die von einer terroristischen Guerillatruppe gefangen genommen worden war. Das Massaker bei den Olympischen Spielen in München hatte die ganze Welt erschüttert, eben dies schien sich auch bei der Watergate-Affäre abzuzeichnen. Und seit kurzem verschwanden im Bundesstaat Washington immer wieder junge Frauen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Die Welt war gefährlich geworden.
Was hätte Leni darum gegeben, eine richtige Freundin zu haben. Es war ihr größter Wunsch. Sie wollte mit jemandem reden können.
Doch würde es ihr letztlich irgendetwas bringen, wenn sie mit jemandem über ihre Sorgen sprechen könnte? Wozu jemandem ihr Herz ausschütten? War es nicht einfach so, dass ihr Vater manchmal die Kontrolle verlor und herumbrüllte und sie nie genug Geld hatten und dauernd umzogen, um ihren Gläubigern zu entkommen? So war ihre Familie nun einmal, aber immerhin liebten sie einander.
Aber dann gab es Tage, solche wie diesen, an denen Leni Angst hatte. Es war ihr, als stünde ihre Familie an einem tiefen Abgrund, wo der Boden unter ihren Füßen jeden Augenblick nachzugeben und abzubrechen drohte und sie wie die Häuser an den aufgeweichten Hängen von Seattle in die Tiefe stürzen würden.
***
Nach der Schule lief Leni durch den Regen nach Hause. Allein.
Das flache, schlauchartige Haus, in dem sie wohnten, stand in einer Sackgasse, umgeben von deutlich gepflegteren Anwesen. Es war außen dunkelbraun und mit leeren Blumenkästen versehen, die Regenrinne war verstopft, das Garagentor ließ sich nicht schließen und stand stets halb offen. Zwischen den verrottenden grauen Dachpfannen wucherten Unkrautbüschel.
Leni entdeckte ihren Vater in der Garage. Er saß auf der Werkbank neben dem ramponierten Mustang ihrer Mutter. Das Dach des Mustang war mit Klebeband geflickt. An den Wänden der Garage reihten sich die Umzugskartons, gefüllt mit den Sachen, die sie seit ihrer Ankunft in Seattle noch nicht ausgepackt hatten.
Wie üblich trug ihr Vater seine abgewetzte Armeejacke und zerschlissene Levi’s. Er saß gekrümmt, die Ellbogen auf die Knie gestützt. Sein langes schwarzes Haar war ein strähniges Durcheinander, und der Schnurrbart hätte dringend geschnitten werden müssen. Er hatte keine Schuhe an, und seine Füße waren verschmutzt. Doch selbst in diesem Aufzug und trotz seines erschöpften Gesichtsausdrucks hatte er immer noch das Aussehen eines Filmstars. Das sagten alle.
Er legte den Kopf schief, strich seine Haare zurück und schaute Leni an. Wenngleich sein Lächeln etwas angestrengt war, hellte es dennoch sein Gesicht auf. Und das war das Problem mit ihrem Vater: Er mochte launisch und jähzornig sein, mitunter sogar furchterregend, doch das war er nur, weil er Gefühle wie Liebe und Verlust und Enttäuschung so intensiv erlebte. Vor allem die Liebe. »Lenora«, sagte er mit seiner heiseren Raucherstimme. »Ich habe auf dich gewartet. Es tut mir leid. Heute früh war ich einfach außer mir. Ich habe meinen Job verloren. Du musst schrecklich enttäuscht von deinem Vater sein.«
»Nein, Dad.«
Leni wusste, wie leid es ihm tat. Sie konnte es von seinem Gesicht ablesen. Als sie noch kleiner war, hatte sie sich manchmal gefragt, wozu die vielen Entschuldigungen gut sein sollten, wenn sich doch nie etwas an seinem Verhalten änderte. Mom hatte es ihr erklärt. Der Krieg und die Gefangenschaft hatten in ihrem Vater etwas zerbrochen. Stell dir vor, er wäre verletzt, sagte sie. Und einen Menschen, der leidet, hört man nicht einfach auf zu lieben. Im Gegenteil, man selbst wird stärker, damit er Halt bei einem finden kann. Er braucht mich. Uns.
Leni setzte sich zu ihrem Vater. Er legte einen Arm um sie und zog sie an sich. »Die Welt wird von Verrückten regiert. Das ist nicht mehr mein Land. Ich möchte …« Er ließ den Satz unbeendet. Leni sagte nichts. Sie war diese Traurigkeit ihres Vaters, seine Enttäuschung von der Welt, gewöhnt. Ständig brach er mitten im Satz ab, als fürchtete er, sonst etwas allzu Beängstigendes oder Deprimierendes von sich zu geben. Leni verstand diese Verschlossenheit. Sie hatte längst begriffen, dass es oftmals besser war zu schweigen.
Ihr Vater griff in seine Jackentasche und zog ein zerdrücktes Päckchen Zigaretten hervor. Er steckte sich eine an. Leni stieg der vertraute beißende Geruch in die Nase.
Sie wusste, wie groß das Leid war, das er mit sich herumtrug. Manchmal wurde sie nachts von seinem Weinen geweckt, hörte, wie ihre Mutter ihn zu beruhigen versuchte. Ganz ruhig, Ernt, es ist vorbei, du bist zu Hause, in Sicherheit.
Dad schüttelte den Kopf und stieß eine blaugraue Rauchwolke aus. »Ich möchte einfach … mehr – verstehst du? Nicht nur einfach einen Job. Ein Leben. Ich möchte über die Straße gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass mich irgendjemand ein imperialistisches Schwein oder einen Kindermörder nennt. Ich will …« Er seufzte. Lächelte. »Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Wir schaffen das.«
»Du findest einen neuen Job«, sagte Leni.
»Natürlich, Rotfuchs. Morgen ist ein neuer Tag.«
Das sagten ihre Eltern immer.
***
An einem trüben und kalten Morgen Mitte April wurde Leni früh wach. Sie stand auf, hockte sich auf ihren Platz auf dem durchgesessenen Sofa mit dem Blumenmuster und stellte die Today Show an. Auf der Suche nach einem vernünftigen Bild richtete sie die beiden Antennenstäbe aus. Als das Bild endlich scharf war, hörte sie die Moderatorin Barbara Walters sagen: »Auf diesem Foto sieht man Patricia Hearst, die sich jetzt Tania nennt, bei einem kürzlich erfolgten Banküberfall in San Francisco mit einem Gewehr. Augenzeugen berichten, dass die neunzehn Jahre alte Enkeltochter des Medienmoguls William Randolph Hearst, die im Februar von der Symbionese Liberation Army entführt wurde …«
Leni war wie gebannt und konnte noch immer nicht glauben, dass eine »Armee« einfach in eine Wohnung marschieren und eine Neunzehnjährige mitnehmen konnte. Wie sollte man sich in einer solchen Welt noch sicher fühlen? Und wie wurde aus einer reichen jungen Frau eine Revolutionärin namens Tania?
»Es wird Zeit, Leni«, rief ihr ihre Mutter aus der Küche zu. »Mach dich für die Schule fertig.«
Die Haustür flog auf.
Dad kam herein und strahlte auf eine Weise, die es Leni unmöglich machte, ihn nicht auch anzulächeln. Der niedrige triste Flur mit seinen grauen Wänden voller Stockflecken stand in keinem Verhältnis zu seiner energischen, kraftvollen Erscheinung, er wirkte beinah überlebensgroß. Wasser tropfte aus seinem Haar.
Mom stand am Herd und briet Frühstücksspeck.
Dad stürmte in die Küche und stellte das Kofferradio auf dem Küchentresen lauter. Ein kratziger Rocksong ertönte. Er lachte und nahm ihre Mutter in die Arme.
Leni hörte, wie er: »Es tut mir leid. Verzeih mir«, zu ihr sagte.
»Immer«, antwortete Mom und umschlang ihn, als hätte sie Angst, er würde sie fortstoßen.
Er legte einen Arm um ihre Taille, führte sie zum Küchentisch und zog einen Stuhl hervor. »Leni, komm zu uns«, rief er.
Es bedeutete Leni viel, wenn ihre Eltern sie einbezogen. Sie verließ das Sofa und setzte sich zu ihrer Mutter. Dad zwinkerte ihr zu und überreichte ihr ein Taschenbuch von Jack London, »Ruf der Wildnis«. »Das wird dir gefallen«, sagte er.
Er ließ sich ihrer Mutter gegenüber nieder, rückte dicht an den Tisch heran und lächelte wie immer, wenn er irgendetwas vorhatte. Leni kannte dieses Lächeln. Offenbar hatte er wieder eine Idee, wie sie ihr Leben ändern könnten. Es hatte schon viele solcher Pläne gegeben. Einmal hatten sie alles verkauft und waren den Highway am Big Sur an der Westküste entlanggefahren, um dort zu zelten. Ein ganzes Jahr lang. Ein anderes Mal hatten sie Nerze gezüchtet, was ein echter Horror gewesen war. Als Nächstes hatte ihr Vater beschlossen, nach Kalifornien zu gehen und den Gärtnern dort Samentütchen zum Verkauf anzubieten.
Nun griff er in seine Jackentasche, holte einen zusammengefalteten Brief heraus und knallte ihn triumphierend auf den Küchentisch. »Erinnerst du dich an meinen Freund Bo Harlan?«
Mom dachte einen Moment lang nach, bevor sie antwortete. »Aus Vietnam?«
Dad nickte. Zu Leni sagte er: »Bo Harlan war der Crew Chief und ich der Bordschütze. Wir gaben uns gegenseitig Rückendeckung, immer. Wir waren auch zusammen, als sie unseren Hubschrauber runtergeholt haben und wir gefangen genommen wurden. Wir sind zusammen durch die Hölle gegangen.«
Bei diesen Worten fing er an zu zittern. Er hatte die Ärmel seines Hemds hochgerollt, und Leni konnte die Brandmale sehen, tiefe Furchen, die sich von den Handgelenken bis zu den Ellbogen zogen, mit runzliger, verunstalteter Haut, die nie bräunte. Leni wusste nicht, wie diese Narben entstanden waren. Ihr Vater hatte es ihr nie erklärt und sie nie danach gefragt, doch sie war zu dem Schluss gekommen, dass er sie den Männern, die ihn gefangen genommen hatten, verdankte. Auch sein Rücken war von Narben bedeckt, die Haut voller Schwielen und Knubbel.
»Sie haben mich gezwungen, dabei zuzusehen, wie er starb.«
Leni warf ihrer Mutter einen Blick zu. Darüber hatte ihr Vater bisher nie gesprochen. Es war verstörend, sich so etwas vorzustellen.
Dad begann mit dem Fuß einen Takt zu schlagen und trommelte dazu mit den Fingern auf den Tisch. Dann entfaltete er den Brief, strich ihn glatt und drehte ihn so, dass Leni und ihre Mutter den Text lesen konnten.
Sergeant Allbright,
Sie sind kein Mann, der leicht zu finden ist. Mein Name ist Earl Harlan.
In vielen Briefen, die mein Sohn Bo geschrieben hat, ging es um seine Freundschaft mit Ihnen. Für diese Freundschaft danke ich Ihnen.
In seinem letzten Brief schrieb er, falls ihm in dem Drecksloch da drüben etwas zustoßen sollte, dann sollen Sie sein Grundstück hier oben in Alaska kriegen.
Es ist nichts Großes. Ungefähr sechzehn Hektar mit einem Blockhaus, an dem einiges zu tun ist. Aber wenn man sich ins Zeug legt, kann man von dem Land da oben leben.
Telefon habe ich nicht, aber Sie können mir hier nach Kaneq postlagernd schreiben. Früher oder später kommt der Brief dann bei mir an.
Das Grundstück liegt am Ende der Straße, nach einem Metallgatter mit einem Rinderschädel und kurz vor dem verkohlten Baum an der Meile Nummer 13.
Noch einmal vielen Dank.
Earl
Mom sah auf, drehte den Kopf ruckartig wie ein Vogel und starrte Dad an. »Dieser Mann – dieser Bo hat uns ein Haus vermacht? Ein Haus?«
»Stell dir das vor.« Vor Begeisterung sprang er auf. »Ein Haus, das uns gehört. Das unser Eigentum ist. An einem Ort, wo wir uns selbst versorgen können. Wir bauen unser eigenes Gemüse an, leben von den Tieren, die ich jage, und wir werden frei sein. Davon haben wir seit Jahren geträumt, Cora. Ein einfaches Leben, weit weg von dem ganzen Mist hier. Wir können in Freiheit leben. Stell dir das vor.«
»Moment mal«, sagte Leni. Selbst für ihren Vater war dieser Plan ungewöhnlich. »Willst du wieder umziehen? Nach Alaska? Wir sind doch gerade erst hierhergezogen.«
Mom runzelte die Stirn. »Da oben gibt es doch gar nichts, oder? Nur Bären und Eskimos.«
Dad zog sie so schwungvoll hoch, dass sie ins Taumeln geriet und an seine Brust fiel. In den Augen ihres Vaters erkannte Leni die Verzweiflung, die seinem Überschwang innewohnte. »Ich brauche das, Cora. Ich brauche einen Ort, an dem ich wieder atmen kann. Hier ist mir, als würde man mir die Luft abdrücken. Da oben werden die Flashbacks und der ganze Mist aufhören. Das weiß ich. Wir brauchen das. Dann kann es für uns wieder so werden wie früher, bevor Vietnam mir das Gehirn zersetzt hat.«
Mom sah zu ihm hoch. Ihr blasses Gesicht stand in scharfem Kontrast zu seinem dunklen Haar und gebräunten Teint.
»Komm schon, Baby«, sagte er. »Stell dir doch nur vor, wie es wäre …«
Leni konnte dabei zusehen, wie ihre Mutter nachgab, wie sie ihre Bedürfnisse umformte, um sie den seinen anzupassen, wie sie ein neues Bild von sich ersann – das einer Frau, die in Alaska lebte. Vielleicht dachte sie auch, das wäre eine Art Überlebenstraining, etwas wie Yoga oder Buddhismus, das man auf seiner Suche nach sich selbst ausprobierte. Das einem Antworten geben könnte. Wie diese letztlich aussähen, wo und wann sie sie fände, interessierte ihre Mutter nicht. Für sie ging es nur um ihn. »Unser eigenes Haus«, sagte sie. »Aber für einen Neuanfang brauchen wir Geld. Du könntest die Kriegsversehrtenrente beantragen.«
»Nicht schon wieder dieses Thema«, erwiderte Dad mit einem Seufzer. »Das kommt nicht in Frage. Ich brauche lediglich eine Veränderung. Von jetzt an werde ich sorgfältiger mit dem Geld umgehen, Cora. Ich schwöre es dir. Von dem, was mein Vater mir hinterlassen hat, habe ich noch etwas übrig. Und ich werde weniger trinken. Wenn du willst, gehe ich auch zu der Selbsthilfegruppe des Veteranenvereins.«
Wie oft Leni diese Versprechen schon gehört hatte. Doch unter dem Strich spielte das, was sie und ihre Mutter sich wünschten, sowieso keine Rolle. Ihr Vater wollte einen Neuanfang. Brauchte ihn. Und ihre Mutter brauchte diesen Mann und wollte ihn glücklich sehen.
Also würden sie es mit dem nächsten neuen Ort versuchen, in der Hoffnung, dass die Probleme sich durch eine geografische Veränderung lösen ließen. Um den jüngsten Traum ihres Vaters zu verwirklichen, würden sie nach Alaska ziehen. Leni würde sich fügen und eine gute Miene aufsetzen. Und wieder einmal wäre sie die Neue in einer Schule.
Denn das war es, was Liebe war.
Kapitel zwei
Am nächsten Morgen lauschte Leni im Bett dem Regen, der auf das Dach des Hauses trommelte. Sie stellte sich vor, wie unter ihrem Fenster Pilze sprossen, giftige Knollen, die den schlammigen Erdboden durchbrachen und verführerisch glänzten. Bis lange nach Mitternacht hatte sie wach gelegen, von der Weite Alaskas gelesen und erstaunt festgestellt, wie faszinierend die Geschichten darüber waren. Die letzte Grenze, wie man das nördlichste Grenzgebiet ihres Landes nannte, schien ihrem Vater zu ähneln. Herausragend. Großartig. Unvorhersehbar.
Musik ertönte, eine blechern klingende Melodie aus dem Kofferradio in der Küche. Es war »Hooked on a Feeling«. Leni schlug die Decke zurück und stieg aus dem Bett. In der Küche stand ihre Mutter am Herd und rauchte eine Zigarette. Im Licht der Deckenlampe hatte sie etwas überirdisch Schönes. Das gestufte blonde Haar war noch vom Schlaf verwuschelt, das Gesicht von einem blaugrauen Schleier umhüllt. Sie trug ein weißes Trägerhemd, das nach dem vielen Waschen lose um ihren schmalen Oberkörper hing. Auch der Bund ihrer rosa Unterhose war ausgeleiert. Der kleine blaue Fleck unten an ihrem Hals war auf seltsame Weise schön, beinah strahlenförmig. Er hob das Zarte ihrer Gesichtszüge hervor.
»Warum schläfst du nicht?«, fragte sie. »Es ist noch früh.«
Leni trat zu ihr und legte den Kopf an ihre Schulter. Ihre Mutter roch nach Rosenparfum und Zigaretten. »Wir schlafen nicht«, antwortete sie.
Wir schlafen nicht. Das sagte Mom immer. Du und ich. Die Verbindung zwischen ihnen beiden war eine feste Größe, etwas, das ihnen Trost gab, als würden ihre Gemeinsamkeiten ihre Liebe zueinander noch stärker machen. Seit Dads Rückkehr hatte ihre Mutter Schlafschwierigkeiten. Jedes Mal, wenn Leni nachts wach wurde und aufstand, stieß sie auf Mom, die im offenen, durchscheinenden Morgenrock durchs Haus geisterte.
»Ziehen wir wirklich dorthin?«, fragte Leni.
Ihre Mutter sah zu, wie der Kaffee in dem kleinen Glasaufsatz über der Metallkanne blubberte. »Ich glaube schon.«
»Wann?«
»Du weißt, wie dein Vater ist. Bald.«
»Kann ich das Schuljahr hier zu Ende machen?«
Mom zuckte mit den Schultern.
»Wo ist Dad?«
»Er ist in aller Herrgottsfrühe losgezogen, um die Münzsammlung zu verkaufen, die er von seinem Vater geerbt hat.« Mom schenkte sich Kaffee ein, trank einen Schluck und stellte den Becher auf den Küchentresen. »Alaska. Lieber Himmel. Warum nicht gleich Sibirien?« Sie nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. Stieß den Rauch aus. »Ich brauche eine Freundin, mit der ich reden kann.«
»Ich bin deine Freundin.«
»Du bist dreizehn. Ich bin dreißig. Ich sollte dir eine Mutter sein. Das darf ich nicht vergessen.«
In der Stimme ihrer Mutter hörte Leni ihr Verzagen, und das machte ihr Angst. Ihr war klar, wie zerbrechlich alles war – ihr Familienleben, ihre Eltern. Jedes Kind eines ehemaligen Kriegsgefangenen wusste, wie leicht es geschehen konnte, dass ein Mensch zerbrach.
»Dein Dad braucht eine Chance. Einen Neuanfang. Den brauchen wir alle. Vielleicht ist Alaska die Lösung.«
»So wie Oregon die Lösung war und die Samentütchen, von denen wir reich werden sollten? Nicht zu vergessen das Jahr, als er dachte, er könnte ein Vermögen mit Flipperautomaten machen. Können wir nicht wenigstens bis zum Ende des Schuljahrs warten?«
Ihre Mutter seufzte. »Ich glaube nicht. Mach dich jetzt lieber für die Schule fertig.«
»Wir haben heute keine Schule.«
Mom schwieg für lange Zeit. Dann sagte sie leise: »Du hast doch noch das blaue Kleid, das Dad dir zum Geburtstag geschenkt hat.«
»Ja.«
»Zieh es an.«
»Warum?«
»Tu mir einfach den Gefallen. Wir beide müssen heute ein paar Dinge erledigen.«
Obwohl sie genervt und verwirrt war, tat Leni wie geheißen. Das tat sie immer. Es machte ihr Leben leichter. Sie ging in ihr Zimmer und wühlte in ihrem Kleiderschrank, bis sie das Kleid gefunden hatte.
Bildschön siehst du darin aus, Rotschopf.
Das war leider ein Irrtum. Leni wusste genau, wie sie mit dem Kleid aussah, nämlich wie eine spindeldürre, flachbrüstige Dreizehnjährige in einem altmodischen Kleid, das ihre mageren Schenkel und merkwürdig knochigen Knie entblößte. Eigentlich hätte sie kurz davor stehen sollen, eine Frau zu werden, doch davon war nicht die geringste Spur zu sehen. Leni ging davon aus, dass sie das einzige Mädchen in ihrer Klasse war, das noch nicht ihre Periode hatte und bei dem auch noch keine Anzeichen eines Busens zu entdecken waren.
Sie kehrte in die Küche zurück, wo es nach Kaffee und Zigarettenrauch roch. Sie ließ sich auf einen Stuhl fallen und schlug »Ruf der Wildnis« auf.
Es dauerte eine geschlagene Stunde, bis ihre Mutter aus ihrem Zimmer herauskam, und Leni erkannte sie kaum wieder. Sie hatte ihr blondes Haar mit Spray bearbeitet und zu einem winzigen Knoten zusammengesteckt. Dazu trug sie ein tailliertes avocadogrünes Kleid mit Gürtel und langen Ärmeln. Es war hochgeschlossen und reichte bis zu den Knien. Nylonstrümpfe hatte sie auch an, und ihre Schuhe sahen aus wie die einer alten Frau. »Mannomann«, sagte Leni.
»Ja, ich weiß.« Mom steckte sich eine Zigarette an. »Ich sehe aus, als müsste ich bei einem Schulfest den Kuchenverkauf organisieren.« Der blaue Lidschatten, den sie aufgetragen hatte, glitzerte, und die unechten Wimpern waren offenbar mit unsteter Hand befestigt worden, die Lidstriche dicker als sonst gezogen. »Hast du keine anderen Schuhe?«, fragte sie Leni.
Leni schaute auf ihre Clogs mit der Plateausohle. Joanne Berkowitz trug auch solche, und als sie damit in die Schule kam, hatten alle in der Klasse bewundernde Laute von sich gegeben. Wie sehr Leni anschließend um diese Schuhe gebettelt hatte. »Ich habe noch rote Tennisschuhe, aber an denen ist gestern ein Schnürsenkel gerissen.«
»Also gut. Komm, wir müssen los.«
Leni folgte ihrer Mutter aus dem Haus.
Sie stiegen in den alten, mit matter Farbe gestrichenen Mustang und ließen sich auf den eingerissenen roten Sitzen nieder. Der Kofferraum des Wagens war mit einem leuchtend gelben Seil verschlossen.
Mom klappte die Sonnenblende herunter und prüfte ihr Make-up im Spiegel. Sie zog ihre Lippen nach, presste sie zusammen und benutzte die spitze Ecke eines zusammengefalteten Taschentuchs, um irgendeinen unsichtbaren Makel zu entfernen. Als sie endlich zufrieden war, klappte sie die Sonnenblende hoch und startete den Motor. Das Radio schaltete sich ein. Dröhnend laut ertönte »Midnight at the Oasis«.
»Weißt du, dass man in Alaska auf Hunderte Arten zu Tode kommen kann?«, fragte Leni. »Man kann einen Berg hinunterstürzen oder auf dem Eis einbrechen. Man kann erfrieren oder verhungern. Man kann sogar gefressen werden.«
»Ich wünschte, dein Vater hätte dir dieses Buch nicht gegeben.« Mom schob eine Kassette ein. Nun erklang Carole King. I feel the earth move…
Ihre Mutter sang mit, dann fiel auch Leni ein. Ein paar wundervolle Minuten lang taten sie etwas ganz Normales und fuhren singend über die Interstate 5 auf die Innenstadt von Seattle zu. Sobald ein Auto vor ihnen war, wechselte Mom zum Überholen die Spur – eine Hand am Lenkrad, die Zigarette zwischen zwei Fingern.
In der Innenstadt angekommen, fuhr sie bei einer Bank vor und stellte den Wagen ab. Wieder überprüfte Mom ihr Make-up. »Warte hier«, sagte sie und verließ den Wagen.
Leni neigte sich zur Seite und verriegelte die Fahrertür von innen. Sie sah, wie ihre Mutter zur Eingangstür der Bank ging. Obwohl man das eigentlich nicht gehen nennen konnte. Sie schwebte dahin, schwang die Hüften von einer Seite zur anderen. Ihre Mutter war eine schöne Frau, und sie war sich dessen bewusst. Auch darüber stritten Lenis Eltern sich – über die Art, wie Männer Mom anschauten. Es brachte Dad zur Weißglut, doch sie genoss die Aufmerksamkeit. Obwohl sie das aus gutem Grund für sich behielt.
Eine Viertelstunde später kehrte Mom zurück. Diesmal schwebte sie nicht, sondern marschierte, die Hände zu Fäusten geballt. Sie machte einen wütenden Eindruck, die zarte Kinnpartie wirkte verkrampft. »Dieser Mistkerl«, sagte sie, als sie die Tür aufriss und in den Wagen stieg. Als sie die Tür zuknallte, sagte sie es noch einmal.
»Was ist los?«, fragte Leni.
»Dein Vater hat unser Sparkonto geplündert. Und sie geben mir keine Kreditkarte, wenn nicht dein Vater oder mein Vater mit unterschreibt.« Mom zündete sich eine Zigarette an. »Wir haben das Jahr 1974, verdammt noch mal. Ich habe einen Job. Ich verdiene Geld. Und dann kriege ich als Frau keine Kreditkarte ohne die Unterschrift eines Mannes? Wir leben in einer Welt, die den Männern gehört, merk dir das, Schätzchen.« Sie startete den Wagen, raste die Straße hinunter und bog in die Auffahrt zur Autobahn ein.
Auf der Fahrt wechselte sie die Spur so häufig, dass Leni auf ihrem Sitz hin und her rutschte. Sie konzentrierte sich so sehr darauf, nicht den Halt zu verlieren, dass sie erst nach einer Weile merkte, dass sie die hügelige Innenstadt verlassen hatten und nun durch eine ruhige, baumbestandene Gegend mit herrschaftlichen Häusern fuhren. »Du meine Güte«, sagte sie leise. In dieser Gegend war sie seit Jahren nicht mehr gewesen. Beinah hätte sie vergessen, dass sie überhaupt jemals hier gewesen war.
Die Häuser kündeten von den Privilegien ihrer Bewohner. Auf den gepflasterten Einfahrten standen brandneue Cadillacs, Toronados und Lincoln Continentals.
Mom parkte vor einem großen Haus aus grob behauenem grauem Stein mit rautenförmigen Fensterscheiben. Es stand auf einer kleinen Anhöhe, umgeben von einem gepflegten Rasen, der von makellosen Blumenrabatten eingefasst war. Der Name auf dem Briefkasten lautete Golliher.
»Wow«, sagte Leni. »Hier waren wir schon ewig nicht mehr.«
»Weiß ich. Du wartest im Wagen.«
»Auf keinen Fall. In diesem Monat ist wieder ein Mädchen verschwunden. Ich bleibe nicht allein hier draußen.«
»Also gut.« Mom holte eine Bürste und zwei rosa Bänder aus ihrer Handtasche hervor. Dann zog sie Leni dichter an sich heran und bearbeitete ihr langes kupferrotes Haar, als hätte es ihr etwas getan. »Aua!« Leni schrie auf, als ihre Mutter ihr Haar zu Zöpfen flocht, die wie zwei Henkel von Lenis Kopf abstanden.
»Du wirst heute nur zuhören, Leni«, sagte Mom, verknotete die rosa Bänder um die Zopfenden und band sie zu Schleifen.
»Ich bin zu alt, um Zöpfe zu tragen«, jammerte Leni.
»Nur zuhören, denk daran«, wiederholte ihre Mutter. »Nimm dein Buch mit. Drinnen sitzt du still und lässt die Erwachsenen reden.« Sie öffnete die Tür und kletterte aus dem Wagen. Leni lief ihr nach.
Mom fasste ihre Hand und führte sie über einen Gehweg, vorbei an gestutzten Hecken, zu einer imposanten Haustür.
Sie warf einen Blick auf Leni, murmelte: »Wird schon schiefgehen«, und drückte auf die Klingel. Man hörte ein Läuten wie von Kirchenglocken, dann gedämpfte Schritte.
Gleich darauf öffnete Lenis Großmutter die Tür. Sie war so sorgfältig zurechtgemacht, als wäre sie zum Lunch mit dem Gouverneur von Washington verabredet. Zu einem eierschalenfarbenen Kleid mit einem schmalen Taillengürtel trug sie eine dreireihige Perlenkette, ihr kastanienbraunes Haar war zu einer dicken Tolle hochgesteckt und starrte vor Haarspray. Die stark geschminkten Augen weiteten sich. »Coraline«, flüsterte sie, trat einen Schritt vor und breitete die Arme aus.
»Ist Dad da?«, fragte Mom.
Lenis Großmutter wich zurück, ihre Arme fielen herab. »Er ist heute im Gericht.«
Mom nickte. »Können wir hereinkommen?«
Die Frage schien Lenis Großmutter zu verwirren. Auf ihrer blassen, gepuderten Stirn bildeten sich wellenförmige Falten. »Natürlich. Und Lenora ist auch mit dabei. Wie schön, dich wiederzusehen.«
Lenis Großmutter trat in den dämmrigen Flur zurück und geleitete sie durch die Eingangshalle, vorbei an Türen und einer Treppe, die in den ersten Stock hinaufführte und ebenfalls im Dämmerlicht lag.
Es roch nach Wachs mit Zitronenduft und nach Blumen.
Sie erreichten einen Wintergarten mit großen Glastüren und Glasfenstern. Überall standen oder hingen Pflanzen. Die Einrichtung bestand aus weißen Korbmöbeln und schmiedeeisernen Stühlen. Leni wurde ein Platz an einem kleinen Tisch zugewiesen, mit Blick auf den Garten.
»Wie sehr ich euch beide vermisst habe«, sagte ihre Großmutter. Als wäre ihr dieses Bekenntnis peinlich, wandte sie sich sogleich ab und verschwand. Kurz darauf kehrte sie mit einem Buch zurück. »Ich erinnere mich noch, wie gern du gelesen hast«, sagte sie zu Leni. »Schon mit zwei Jahren hattest du immer ein Buch in der Hand. Das hier habe ich vor Jahren für dich gekauft – ich wusste nicht, wohin ich es schicken sollte. Das Mädchen hat auch rotes Haar.«
Leni nahm das Buch entgegen. Es war »Pippi Langstrumpf«, ein Buch, das sie so oft gelesen hatte, dass sie ganze Teile davon auswendig kannte. Natürlich war es für Kinder in einem Alter, dem Leni seit langem entwachsen war. »Vielen Dank, Ma’am«, sagte sie.
»Bitte, nenn mich ›Grandma‹«, antwortete ihre Großmutter leise und mit einem sehnsüchtigen Unterton. Dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf Mom.
Sie winkte sie zu einem weißen schmiedeeisernen Tisch am Fenster. Dort hing ein vergoldeter Käfig mit zwei gurrenden weißen Vögeln. Leni dachte, dass diese Vögel, die nicht fliegen durften, traurig sein mussten.
»Ich wundere mich, dass du mich hereingelassen hast«, sagte Mom und setzte sich.
»Sei nicht patzig, Coraline. Du bist uns immer willkommen. Dein Vater und ich, wir lieben dich.«
»Aber meinen Ehemann hättest du nicht ins Haus gelassen.«
»Er hat dich gegen uns aufgehetzt. Und gegen deine ganzen Freunde, falls ich das hinzufügen darf. Er wollte dich für sich ganz allein.«
»Darüber möchte ich nicht noch einmal reden, und es ist nicht der Grund, warum ich gekommen bin. Wir ziehen nach Alaska.«
Lenis Großmutter ließ sich nieder. »Allmächtiger.«
»Ernt hat dort ein Haus und ein Stück Land geerbt. Wir werden Gemüse anbauen und jagen, was wir brauchen, und nach unseren Regeln leben. Wir werden nur für uns sein. Wie Pioniere.«
»Danke, aber diesen Unsinn möchte ich nicht hören. Du folgst ihm also bis ans Ende der Welt, wo du niemanden mehr finden wirst, der dir helfen kann? Dein Vater und ich haben alles versucht, um dich vor deinen Entscheidungen zu schützen, aber du lässt dir ja nicht helfen. Oder täusche ich mich? Du glaubst wohl immer noch, dass das Leben eine Art Spiel ist, und treibst –«
»Das reicht«, sagte Mom scharf und beugte sich vor. »Weißt du, wie schwierig es für mich war, heute hierherzukommen?«
Auf diese Worte hin breitete sich Stille aus, die nur vom Gurren der Vögel unterbrochen wurde.
Es war, als wäre ein kalter Wind durch den Raum gestrichen. Leni hätte schwören können, dass sich die kostbaren Spitzenvorhänge an den Fenstern bewegten, doch die Fenster waren alle geschlossen. Sie versuchte, sich ihre Mutter in dieser engen, zugeknöpften Welt vorzustellen, aber es gelang ihr nicht. Die Kluft zwischen dem Mädchen, das ihre Mutter hatte werden sollen, und der Frau, die nun vor ihr saß, schien unüberbrückbar. Sie fragte sich, ob all die Demonstrationen, an denen sie und ihre Mutter teilgenommen hatten, als ihr Vater fort war – gegen Atomkraft, gegen den Krieg –, und all die Selbsterfahrungsgruppen und Religionen, mit denen sie experimentiert hatte, in Wahrheit nur ihre Art gewesen war, sich von der Frau, zu der sie erzogen worden war, zu befreien.
»Tu es nicht, Coraline. Es ist verrückt und gefährlich. Verlass diesen Mann. Komm nach Hause. Hier findest du Sicherheit.«
»Ich liebe ihn, Mutter. Begreifst du das nicht?«
»Cora«, antwortete Lenis Großmutter sanft. »Bitte, hör auf mich. Du weißt, dass er unberechenbar ist.«
»Wir gehen nach Alaska«, sagte Mom fest. »Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden und …« Ihre Stimme wurde leise. »Hilfst du uns oder nicht?«
Eine Zeitlang sagte Lenis Großmutter nichts. Sie verschränkte die Arme vor ihrer Brust und öffnete sie wieder. »Wie viel brauchst du diesmal?«, fragte sie.
***
Auf der Rückfahrt rauchte Mom eine Zigarette nach der anderen und stellte das Autoradio so laut, dass es unmöglich war, sich zu unterhalten. Aber Leni hätte ohnehin nicht gewusst, was sie hätte sagen sollen, zu viele Fragen gingen ihr durch den Kopf. An diesem Tag hatte sie einen Blick auf eine Welt erhascht, die sich tief unter der Oberfläche ihrer eigenen verbarg. Ihre Mutter hatte ihr nie viel über ihr Leben vor ihrer Ehe erzählt. Leni wusste nur, dass ihre Eltern miteinander durchgebrannt waren. Ihre Geschichte war die einer großen, einzigartigen Liebe, die allen Widerständen getrotzt hatte. Ihre Mutter hatte die Schule abgebrochen und »von der Liebe gelebt«. So nannte sie es immer. Ein Märchen. Inzwischen war Leni alt genug zu erkennen, dass die Geschichte ihrer Eltern wie alle anderen Märchen auch gefährliche Dickichte, dunkle Orte und zerbrochene Träume enthielt. Und ein Mädchen, das sich verirrt hatte.
Ganz offensichtlich war Mom nicht gut auf Lenis Großmutter zu sprechen, und doch war sie zu ihr gegangen, weil sie Hilfe brauchte. Sie hatte Geld erhalten, um das sie nicht einmal hatte bitten müssen. Das war merkwürdig und ergab keinen Sinn. Wie konnten Mutter und Tochter sich so weit auseinanderleben?
Ihre Mutter bog in ihre Einfahrt ein und stellte den Motor aus. Die Radiomusik brach ab und überließ sie der Stille.
»Wir werden deinem Vater nicht erzählen, dass ich von meiner Mutter Geld bekommen habe«, erklärte sie. »Er ist ein stolzer Mann.«
»Aber –«
»Kein Aber, Leni. Du hältst den Mund.« Mom stieg aus dem Wagen und knallte die Tür zu.
Leni wunderte sich über den Befehl. Verwirrt folgte sie ihrer Mutter über das verschlammte Gras vor ihrem Haus, vorbei an den ausufernden Wacholderbüschen.
Im Haus saß Dad am Küchentisch, vor ihm Bücher und ausgebreitete Landkarten. Er trank Coca-Cola aus der Flasche.
Als Leni und ihre Mutter in die Küche kamen, sah er auf und strahlte sie an. »Ich habe unsere Strecke rausgesucht. Wir fahren durch British Columbia und das Yukon-Territorium. Das sind ungefähr zweitausendvierhundert Meilen. Notiert es in euren Kalendern, meine Damen. In vier Tagen beginnt für uns ein neues Leben.«
»Aber das Schuljahr ist noch nicht zu Ende«, sagte Leni.
»Was kümmert uns die Schule? Da oben wirst du alles lernen, was du fürs Leben brauchst, Leni«, antwortete Dad. Er schaute ihre Mutter an. »Ich habe meinen Pontiac GTO, meine Münzsammlung und meine Gitarre verkauft, wir haben also ein bisschen Geld. Deinen Mustang können wir gegen einen VW-Bus tauschen – trotzdem könnten wir noch mehr brauchen.«
Leni sah ihre Mutter von der Seite an. Ihre Blicke trafen sich.
Du sagst kein Wort.
Es fühlte sich nicht richtig an. War es etwa nicht immer falsch zu lügen? Etwas zu verheimlichen, so wie sie es jetzt taten, bedeutete doch eigentlich auch, die Unwahrheit zu sagen.
Trotzdem schwieg Leni. Es kam für sie gar nicht in Frage, sich ihrer Mutter zu widersetzen. In dieser großen weiten Welt – deren Unermesslichkeit sich angesichts des drohenden Umzugs nach Alaska für sie soeben vervielfacht hatte – war ihre Mutter alles, was Leni Halt gab.
Kapitel drei
»Leni, Süße, wach auf. Wir sind gleich da.«
Leni blinzelte. Als Erstes sah sie ihren Schoß voller Kartoffelchipskrümel, daneben eine alte Zeitung, übersät von Bonbonpapier, und ihre Taschenbuchausgabe von »Die Gefährten«, dem zweiten Buch von »Der Herr der Ringe«. Es stand aufgeklappt auf dem Sitz und glich einem Zelt, die vergilbten Seiten durchgebogen. Ihre Polaroid-Kamera, ihr größter Schatz, hing an einem Riemen um ihren Hals.
Es war eine außergewöhnliche Reise gewesen, und ihr erster richtiger Familienurlaub. Sie waren dem ALCAN Highway gefolgt, einer größtenteils noch unbefestigten Durchgangsstraße in Richtung Norden. Tagsüber fuhren sie in strahlendem Sonnenschein, abends zelteten sie an reißenden Flüssen oder an still dahinziehenden Gewässern, am Fuß von Bergen mit Gipfeln wie Sägeblätter. Aneinandergelehnt saßen sie am Lagerfeuer und malten sich ihre Zukunft aus, die täglich näher rückte. Zum Abendessen brieten sie Würstchen, machten Hotdogs und aßen zum Nachtisch geröstete Marshmallows und geschmolzene Schokolade auf Kräckern. Dabei träumten sie laut von dem, was sie am Ende der Reise erwartete. Noch nie hatte Leni ihre Eltern so glücklich gesehen, vor allem nicht ihren Vater. Er lachte, strahlte, scherzte und versprach ihnen das Blaue vom Himmel. Das war der Vater, wie Mom ihn von früher beschrieb.
Normalerweise tauchte Leni in die Welt ihrer Bücher ab, wenn sie mit dem Auto unterwegs waren, doch auf dieser Reise zog sie die Szenerie ganz in ihren Bann, erst recht, als sie durch die phantastische Gebirgswelt von British Columbia kamen. Von der Rückbank des VW-Busses aus versank sie im Anblick der Landschaft, die sich ohne Unterlass veränderte, und stellte sich vor, sie wäre der Hobbit Frodo oder Bilbo, einer der Helden ihrer Sehnsuchtswelt.
Der Bus rumpelte über irgendetwas hinweg, eine Bodenschwelle wahrscheinlich. Hinten im Wagen flogen ihre Sachen umher, fielen zu Boden oder auf die Rucksäcke und Umzugskartons. Quietschend kam der Wagen zum Stehen. Es roch nach Abgasen und warmen Gummireifen.
Durch die verschmierten Fensterscheiben voller Fliegenreste drang das gleißende Sonnenlicht. Leni kletterte über den Haufen nachlässig zusammengerollter Schlafsäcke und schob die Seitentür auf. Das Papierschild Alaska sehen oder sterben, das sie mit Regenbogenfarben bemalt und mit Klebestreifen am Wagen befestigt hatten, knatterte im Wind.
Leni stieg aus dem Bus.
Dad trat zu ihr und legte eine Hand auf ihre Schulter. »Wir haben es geschafft, Rotfuchs. Homer, Alaska. Das Ende der Welt. Hierher kommen die Leute aus der ganzen Gegend, um Vorräte zu kaufen. Es ist so etwas wie der letzte Außenposten der Zivilisation. Man nennt es den Ort, wo das Land aufhört und das Meer beginnt.«
»Wow«, sagte Mom.
Trotz der vielen Bilder, die Leni sich angeschaut, und all der Zeitungsartikel und Bücher, die sie gelesen hatte, überwältigte sie die wilde, atemberaubende Schönheit dessen, was sie vor sich sah. Die Weite des Landes hatte etwas Unwirkliches, ja fast Magisches, mit den hochaufragenden Bergen und schneeweißen Gletschern, gekrönt von messerscharfen Gipfeln, die in den wolkenlosen kornblumenblauen Himmel stachen. Zu ihren Füßen lag die Bucht von Kachemak wie eine Scheibe gehämmertes Silber in der Sonne. Die Luft roch nach Salz, nach der Tiefe des Meeres. Watvögel ließen sich mit dem Wind treiben, hoben und senkten sich schwerelos.
Der berühmte Homer Spit, von dem Leni gelesen hatte, war eine schmale Landzunge, ein viereinhalb Meilen langer Bogen, der sich in die Bucht hinausschwang. Bunt zusammengewürfelte Häuser thronten auf Stelzen am Ufer und erinnerten an einen Jahrmarkt. Es war ein Ort, an dem Abenteuerreisende zum letzten Mal Station machten und ihre Rucksäcke mit Vorräten füllten, bevor sie in die Wildnis aufbrachen.
Leni hob ihre Polaroid-Kamera und begann Bilder zu machen. Ein Foto nach dem anderen zog sie hervor und sah zu, wie sich die Motive herausschälten. Schicht um Schicht malten sich die Berge, die Bucht und die über dem Wasser schwebenden Pfahlbauten auf das glänzend weiße Papier.
»Unser Land ist da drüben in Kaneq.« Dad deutete über die Kachemak Bay hinweg auf eine Kette grüner Buckel in der diesigen Ferne. »Unser neues Zuhause. Es liegt im Süden der Halbinsel Kenai, und es führen keine Straßen dorthin. Mehrere Gletscher und ein Bergmassiv trennen Kaneq vom Festland. Deshalb muss man dorthin fliegen oder mit dem Schiff übersetzen.«
Ihre Mutter trat zu Leni. In ihrer tiefsitzenden Jeansschlaghose und dem spitzenbesetzen Trägerhemd, mit ihrem blassen Gesicht und dem blonden Haar, hätte man meinen können, sie wäre aus den kühlen Farben dieses Landstrichs erschaffen worden – ein Engel, der auf dem Meeresufer niedergegangen war, das ihn freudig empfangen hatte. Selbst ihr Lachen schien hierherzugehören, es war wie ein Echo der Glockenspiele, die an den Ladentüren klimperten. Ein kühler Windstoß drückte das Trägerhemd gegen ihre bloßen Brüste. »Schätzchen, wie gefällt es dir hier?«
»Super.« Leni schoss ein weiteres Foto. Doch sie bezweifelte, dass es ein Bild auf Fotopapier gäbe, das der Pracht dieser Welt gerecht werden könnte.
Ihr Vater wandte sich zu ihnen um und lächelte so breit, dass sein Gesicht sich in Falten legte. »Die Fähre nach Kaneq geht morgen. Wir können also eine kleine Besichtigungsrunde drehen. Dann suchen wir uns am Strand einen Platz für unser Zelt und laufen noch ein wenig herum. Was haltet ihr davon?«
»Viel«, sagten Leni und Mom wie aus einem Mund.
Sie stiegen wieder in den Bus, ließen die Landzunge hinter sich und fuhren durch Homer. Leni drückte sich die Nase an der Fensterscheibe platt. Die Gebäude der Stadt ergaben eine bunte Mischung – große, solide Häuser mit blank geputzten Fenstern wechselten sich mit einfachen Unterständen ab, die mit Hilfe von Plastikplanen und Klebeband bewohnbar gemacht worden waren. Es gab Holzhäuser mit tiefen Dächern, die wie ein A gebaut waren, genauso wie Schuppen, abgestellte Trailer oder Wohnmobile. Busse, die am Straßenrand standen, hatten Gardinen an den Fenstern und Stühle vor der Tür. Einige Vorgärten waren gepflegt und umzäunt, in anderen türmten sich verrostetes Gerümpel, ausrangierte Autoteile und allerlei entsorgte Gerätschaften. Fast alles machte einen unfertigen Eindruck. Auch Geschäfte gab es in den verschiedensten Unterkünften, die von alten rostigen Airstream-Wohnwagen über Holzschuppen bis zu brandneuen Blockhütten reichten. Leni fand die Umgebung etwas bizarr, aber nicht so fremd und weltabgeschieden, wie sie gedacht hatte.
Sie erreichten einen langen grauen Sandstrand. Dad stellte das Autoradio aus. Die Reifen ihres Busses versanken im Sand, und sie kamen nur noch schwer voran. Überall auf dem Strand standen Fahrzeuge – Lastwagen, Vans und ganz normale Autos. Offenbar hausten die Leute hier in jeder Art von Unterschlupf – in Zelten, liegengebliebenen Autowracks, Bretterbuden aus Treibholz und Zeltplanen. »Diese Leute nennt man die ›Ratten vom Spit‹«, erklärte ihr Vater. »Sie arbeiten in den Konservenfabriken auf der Landzunge und für die Charterfirmen.«
Er manövrierte den Wagen in eine Lücke zwischen einem schlammbespritzen Ford-Transporter mit einem Nummernschild aus Nebraska und einem kleinen limonengrünen AMC Gremlin mit Fensterscheiben aus Pappe. Sie errichteten ihr Zelt im Sand und vertäuten es an der vorderen Stoßstange ihres Busses. Der Wind, der nach Meer roch, wehte hier ohne Unterlass.
Wellen strichen flüsternd über das Ufer und zogen sich wieder zurück. Überall um sie herum genossen die Menschen den schönen Tag, warfen für ihre Hunde Frisbees, machten Lagerfeuer und schoben ihre Kajaks ins Wasser. Doch angesichts der mächtigen Landschaft wirkte der Widerhall ihrer Stimmen im Wind flüchtig und bedeutungslos.
Sie verbrachten den Tag damit, durch Homer zu spazieren. Die Eltern besorgten sich im Salty Dawg Saloon Bier, Leni kaufte sich an einer Bude auf dem Spit ein Hörnchen Eiscreme. In einem Laden der Heilsarmee wühlten sie in den Schuhtonnen und fanden für jeden von ihnen passende Gummistiefel. Für nur fünfzig Cent erwarb Leni fünfzehn gebrauchte Bücher, auch wenn sie schadhaft waren und Wasserflecke hatten. Dad erstand einen Drachen, um ihn am Strand steigen zu lassen. Mom steckte ihr ein paar Dollar zu und sagte: »Kauf dir einen neuen Film, Schätzchen.«
In einem kleinen Restaurant an der Spitze des Spit setzten sie sich dann draußen an einen Picknicktisch und aßen Taschenkrebse. Leni fand den Geschmack des weißen, süß-salzig schmeckenden Krebsfleisches, das sie in geschmolzene Butter tunkte, großartig. Über ihnen kreisten Möwen, die laut kreischend ihre Fritten und Weißbrotscheiben im Auge behielten.
Leni konnte sich nicht erinnern, jemals einen so schönen Tag erlebt zu haben, und noch nie war ihr die nahe Zukunft so vielversprechend erschienen.
Am nächsten Morgen fuhren sie mit dem Bus in den Bauch der Tustumena-Fähre, von den Einheimischen »Tusty« genannt, die ein Teil des Seewegsystems von Alaska war. Das schwere alte Schiff fuhr abgelegene Orte wie Homer, Kaneq, Seldovia, Dutch Harbor an, sogar die noch weiter entfernten Inseln der Aleuten. Als sie eingeparkt hatten, liefen sie zum Deck hinauf und suchten sich einen Platz an der Reling. Mit ihnen waren jede Menge Menschen an Bord, überwiegend Männer mit langem Haar und buschigen Bärten. Sie trugen Trucker Caps und karierte Flanellhemden, dicke Daunenwesten und schmutzige Jeans, deren Hosenbeine in braunen Gummistiefeln steckten. Einige junge Hippies, vermutlich Studenten, waren auch da. Man erkannte sie an den Rucksäcken, den gebatikten T-Shirts und den Sandalen.
Das riesige Fährschiff verließ die Anlegestelle und stieß Rauchwolken aus. Leni stellte fest, dass das Wasser der Kachemak Bay keineswegs so ruhig war, wie es vom Strand aus den Anschein gehabt hatte. Schon kurz nach dem Ablegen wurde es kabbelig, und die Wellen bekamen Schaumkronen. Mit Wucht rollten sie heran und schlugen gegen die Seite des Schiffs. Es war ein kraftvoller, betörender Anblick. Leni schoss mindestens ein Dutzend Fotos und steckte sie in ihre Jackentasche.
Im klaren Wasser konnte man eine Gruppe Schwertwale erkennen, und auf den zerklüfteten Küstenfelsen richteten sich Seelöwen auf und brüllten das Schiff an. In den Algenfeldern entlang der rauen Ufer tummelten sich die Seeotter.
Dann drehte die Fähre und tuckerte um einen smaragdgrünen Hügel herum. Er bot ihnen Schutz vor dem Wind, der über die Bucht hinwegfegte, und das Wasser wurde ruhiger. Tiefgrüne Inseln mit felsigen Ufern und zerzausten Bäumen auf den Klippen erhoben sich nun vor ihnen.
»Nächster Halt Kaneq«, ertönte es über den Lautsprecher. »Übernächster Halt Seldovia.«
»Alle Allbrights von Bord!«, rief Lenis Vater gutgelaunt. Sie gingen wieder unter Deck, schlängelten sich an den anderen Fahrzeugen vorbei, bis sie ihren VW-Bus fanden, und stiegen ein.
»Ich kann es kaum erwarten, unser neues Haus zu sehen«, sagte Lenis Mutter.
Die Fähre legte an. Sie fuhren vom Schiff hinunter und dann über eine breite unbefestigte Straße einen bewaldeten Hügel hinauf. Auf der Kuppe stand eine Kirche aus weißem Schindelholz. Die Kuppel des Kirchturms war blau gestrichen und trug das russisch-orthodoxe Kreuz mit den drei Querbalken. Den daneben gelegenen Friedhof umgab ein niedriger Lattenzaun. Der Friedhof war voller Holzkreuze.
Von hier oben konnten sie einen ersten Blick auf Kaneq auf der anderen Seite des Hügels werfen.
»Nein.« Leni spähte aus dem verdreckten Seitenfenster. »Das kann es nicht sein.«
Sie sah Wohnwagen und Häuser, die nichts anderes als Bruchbuden waren. An einem waren drei magere Hunde angekettet. Sie standen auf ihren Hundehütten, bellten aufgebracht und winselten. Die Wiese vor den Hütten war von den Löchern durchsetzt, die die Hunde in ihrer Ausweglosigkeit gegraben hatten.
»Kaneq ist eine alte Siedlung mit einer interessanten Geschichte«, erklärte Dad. »Zuerst ließen sich hier die Ureinwohner Alaskas nieder, dann kamen irgendwann russische Pelzhändler und danach die Goldgräber. 1964 wurde der Ort von einem so schweren Erdbeben heimgesucht, dass der Erdboden sich von einer Sekunde zur anderen um anderthalb Meter senkte. Ganze Häuser brachen auseinander oder stürzten ins Meer.«
Leni starrte auf die baufälligen Gebäude mit der abblätternden Farbe, die ein verwitterter Holzsteg verband. Alle Bauten des Ortes standen auf Pfählen im Schlick. Dahinter lag ein Hafenbecken voller Fischerboote. Die Hauptstraße reichte gerade so von einem Ende der Buden zum anderen und war nicht geteert.
Auf der Seite zur Bucht hin befand sich eine Kneipe namens Kicking Moose. Das Gebäude selbst schien kaum mehr zu sein als eine geschwärzte Hülle, die irgendwann einmal gebrannt haben musste. Durch die schmutzigen Fenster erkannte man schemenhaft Gäste – Menschen, die um zehn Uhr morgens und mitten in der Woche in einem verkohlten Schuppen Alkohol tranken.
Auf der anderen Straßenseite lag eine verlassen aussehende Pension. Ihr Vater sagte, dass sie wahrscheinlich vor über hundert Jahren für die russischen Pelzhändler eröffnet worden sei. Daneben gab es einen Imbiss – wenig größer als ein Wandschrank – mit dem Namen Fish On. Die Tür stand offen. Leni erblickte einige Gestalten, die an der Theke hockten. An der Zufahrt zum Hafen parkten zwei alte Lastwagen.
»Wo ist die Schule?«, fragte Leni mit einem Anflug von Panik.
Kaneq war keine Stadt, kaum konnte man es eine Siedlung nennen. Solche Orte hatte es vielleicht vor hundert Jahren gegeben, als die Siedler in Amerika mit Planwagen nach Westen zogen und an Stationen haltmachten, an denen niemand blieb. Leni fragte sich, ob hier überhaupt jemand in ihrem Alter lebte.
Sie parkten vor einem schmalen altmodischen Haus mit spitz zulaufendem Dach. Anscheinend war das Haus einmal blau gestrichen gewesen, so viel verrieten jedenfalls die Farbflecke, die auf den Holzwänden hier und da noch auszumachen waren. Auf einem Fenster klebte ein Schild mit der Aufschrift Handelsstation/Gemischtwarenladen. »Alle Allbrights ausschwärmen und Terrain sondieren«, sagte ihr Dad.
Ihre Mutter verließ den Wagen und lief zu dem kleinen Stück Zivilisation, das dieser Laden darstellte. Leni folgte ihr. Als Mom die Ladentür öffnete, bimmelte über ihnen eine Glocke. Leni griff nach dem Arm ihrer Mutter.
Das Sonnenlicht fiel durch die Fenster in ihrem Rücken und beschien den vorderen Teil des Ladens. Darüber hinaus spendete nur noch eine nackte Glühbirne an der Decke Licht. Der hintere Teil lag im Dunkeln.
Es roch nach altem Leder, Whiskey und Tabak. An den Wänden standen ringsum Verkaufsregale, in deren Fächern Leni Sägen, Äxte, Hacken, Pelzstiefel und Anglerstiefel entdeckte, auch bergeweise Socken und Kisten voller Stirnlampen. An den Regalpfosten hingen an dicken Haken Stahlfallen und aufgewickelte Eisenketten. Auf der Theke und in den Regalen waren ausgestopfte Elchköpfe, Geweihe und alle möglichen Arten ausgebleichter Tierschädel ausgestellt. Ein gewaltiger Königslachs war für immer auf einen glänzenden Holzsockel gebannt worden, und in einer Ecke diente ein ausgestopfter Rotfuchs als Staubfänger. In einem Regal auf der Linken lagerten die Nahrungsmittel: Kartoffelsäcke, Eimer voller Zwiebeln, gestapelte Dosen Lachs, Krebsfleisch und Sardinen, Säcke voller Reis, Mehl und Zucker, Speiseölkanister. Hier entdeckte Leni auch eine Ecke voller bunt verpackter Süßigkeiten, die sie an die Läden in Seattle erinnerte. Zudem gab es Kartoffelchips, fertigen Karamellpudding und verschiedene Sorten von Frühstücksflocken.
Leni dachte, dass dieser Laden ebenso gut in Unsere kleine Farm zu sehen hätte sein können.
»Kundschaft!«
Jemand klatschte in die Hände. Eine dunkelhäutige Frau mit einem riesigen Afro tauchte von hinten auf. Sie war groß gewachsen und breitschultrig und so übergewichtig, dass sie sich seitwärts hinter der glänzend lackierten Holztheke hervorzwängen musste.
Doch die Frau bewegte sich behände und mit klappernden Knochenarmbändern an den wulstigen Handgelenken. In Lenis Augen war sie alt, mindestens fünfzig Jahre. Sie trug einen langen Flickenrock, Wollsocken, die nicht zusammenpassten, und Sandalen. Ihre lange blaue Bluse war aufgeknöpft, darunter sah man ein ausgebleichtes T-Shirt. An ihrem breiten Ledergürtel hatte sie ein Futteral befestigt, darin steckte ein Messer. Winzige schwarze Muttermale sprenkelten ihr Gesicht. »Willkommen!«, sagte sie. »Ich weiß, dass es hier ein bisschen unordentlich und abschreckend aussieht, aber ich versichere Ihnen, dass ich genau weiß, wo alles ist, bis hin zu den Dichtungsringen und den AAA-Batterien. Ach, und die Leute nennen mich ›Large Marge‹.« Sie streckte ihre Hand aus.
»Die dicke Marge?«, sagte Mom und schüttelte die dargebotene Hand. »Und das lassen Sie zu?« Sie zeigte ihr schönstes Lächeln, von dem Leni wusste, dass es die Leute anzog und ansteckend wirkte.
Large Marge lachte laut und japsend, als bekäme sie nicht genug Luft. »Ich mag Frauen mit Sinn für Humor. Mit wem habe ich denn das Vergnügen?«
»Cora Allbright«, antwortete Mom. »Und das ist meine Tochter Leni.«
»Willkommen in Kaneq, meine Damen. Touristen sind bei uns eine Seltenheit.«
In diesem Moment betrat Dad den Laden. Er hatte den letzten Satz gehört und sagte: »Wir sind Einheimische, genauer gesagt, werden wir das bald sein. Wir sind eben erst angekommen.«
Large Marge musterte Leni und ihre Eltern von Kopf bis Fuß. Aus ihrem Doppelkinn wurde ein Dreifachkinn. »Einheimische?«
Dad reichte ihr seine Hand. »Bo Harlan hat mir sein Grundstück vermacht. Wir werden uns hier niederlassen.«
»Donnerlittchen, dann bin ich ja eure Nachbarin. Marge Birdsall, ihr findet den Namen auf einem Schild an der Straße. Ich wohne eine halbe Meile von euch entfernt. Die meisten Leute hier hausen irgendwo in der Wildnis, wir haben das Glück, an einer Straße zu wohnen. Habt ihr alles, was ihr braucht? Wenn ihr wollt, könnt ihr bei mir anschreiben lassen und später entweder bezahlen, oder wir tauschen etwas – es gibt bestimmt das ein oder andere, was du kannst, was jemand anderes nicht kann. So halten wir das hier.«
»Das ist genau das Leben, das wir gesucht haben«, sagte Dad. »Tauschen wäre nicht schlecht, mit dem Geld sind wir nämlich knapp dran. Ich bin ein guter Mechaniker, kann beinah jeden Motor reparieren.«
»Schön zu hören«, entgegnete Large Marge. »Werd ich weitersagen.«
»Danke«, sagte Dad. »Wir könnten ein bisschen Schinkenspeck gebrauchen. Reis vielleicht auch. Und Whiskey.«
»Da drüben.« Large Marge deutete auf ein Regal. »Hinter den Äxten und Beilen.«
Er trat zu einem der hinteren Regale.
Large Marge legte den Kopf schief und begutachtete Mom. »Ich schätze mal, dass hinter eurem Umzug hierher der Traum deines Mannes steht, Cora Allbright. Und dass ihr, ohne groß zu planen, hier oben gelandet seid.«
Mom zuckte mit den Schultern. »Wir sind ziemlich spontan. So bleibt das Leben aufregend.«
»Soso. Hier oben musst du vor allem stark sein. Dir und deiner Tochter zuliebe. Du kannst dich nicht nur auf deinen Mann verlassen. Du wirst in der Lage sein müssen, dich und deine hübsche Tochter zu beschützen.«
»Klingt ziemlich dramatisch«, sagte Mom.
Large Marge bückte sich zu einem großen Pappkarton und zog ihn über den Fußboden heran. Dann wühlte sie darin, mit Fingern so flink wie die eines Klavierspielers. Schließlich zog sie an schwarzen Riemen zwei große orangerote Trillerpfeifen hervor, die sie Leni und ihrer Mutter um den Hals legte. »Die Trillerpfeifen werdet ihr brauchen, um Bären zu verjagen. Lektion Nummer eins: In Alaska darf man niemals leise – oder unbewaffnet – umherlaufen. Nicht in unserer abgelegenen Ecke und nicht zu dieser Jahreszeit.«
»Willst du uns Angst machen?«, fragte Mom.
»Darauf kannst du Gift nehmen. Angst zeugt von gesundem Menschenverstand. Zu uns kommen so viele, mitsamt Fotoapparat und all ihren Träumen vom einfachen Leben. Aber fünf von tausend Bewohnern Alaskas verschwinden jedes Jahr – spurlos. Sind einfach weg. Und was machen die anderen Träumer? Die meisten von ihnen geben nach dem ersten Winter auf. Können gar nicht schnell genug dahin zurückkehren, wo es Autokinos gibt und die Heizung per Knopfdruck angeht. Und wo die Sonne scheint.«
»Wenn man dich hört, klingt das Leben hier reichlich ungemütlich«, sagte Mom und wirkte beunruhigt.
»Zu uns kommen zwei Arten von Menschen, Cora. Diejenigen, die sich nach etwas sehnen, und diejenigen, die vor etwas davonlaufen. Vor Letzteren solltest du dich in Acht nehmen. Aber nicht nur die Menschen musst du im Auge behalten. Dieses Land selbst kann in einer Minute liebreizend wie Dornröschen sein, in der nächsten gleicht es einer Furie mit abgesägter Schrotflinte. Wir haben hier ein Sprichwort: In Alaska darfst du nur einen Fehler machen. Der zweite ist dein Tod.«
Mom steckte sich eine Zigarette an. Ihre Hand zitterte. »Marge, ich finde, dass du als Begrüßungskomitee etwas zu wünschen übrig lässt.«
Large Marge lachte. »Das kannst du laut sagen. Meine Umgangsformen sind in der Wildnis den Bach runtergegangen.« Dann lächelte sie beruhigend und legte eine Hand auf Moms zarte Schulter. »Jetzt verrate ich etwas, das dir besser gefallen wird. Wir in Kaneq bilden eine enge Gemeinschaft. Es sind zwar nur knapp dreißig Personen, die das ganze Jahr in unserer Ecke leben, aber wir kümmern uns umeinander. Mein Grundstück liegt nicht weit von eurem entfernt. Wenn du etwas brauchst – ganz egal, was –, greifst du nach dem Funkgerät. Und ich komme gerannt.«
***